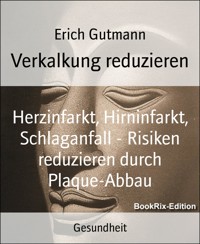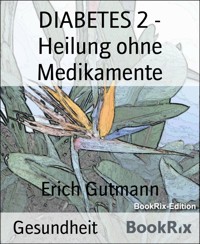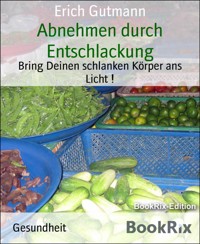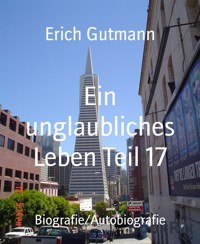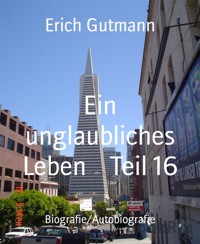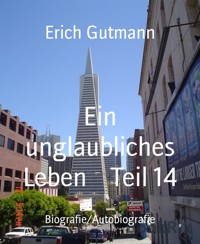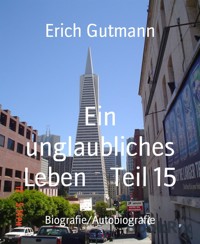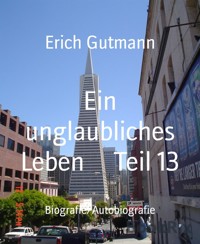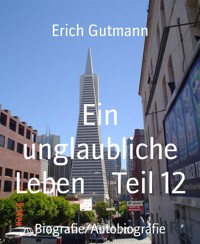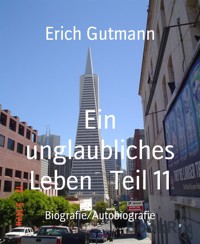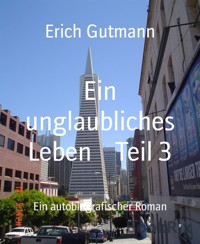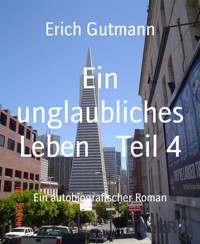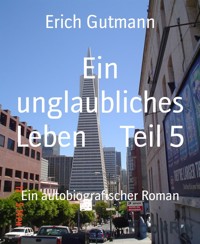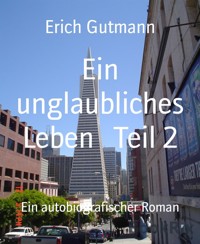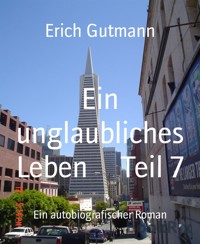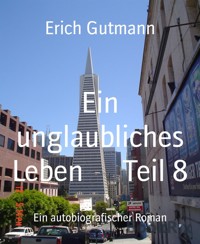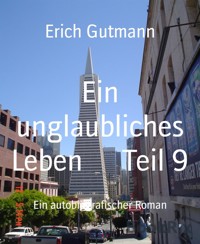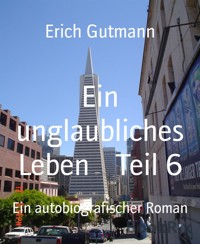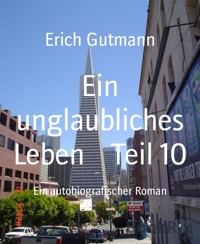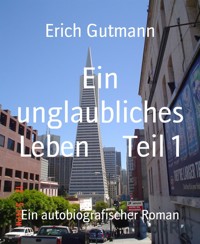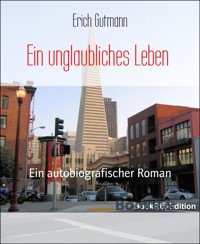
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein schwäbischer Junge mit schlechten Voraussetzungen wie 7,5 Jahre Volksschule, Fettsack genannt und schlechter Aussprache schafft den Aufstieg zum Techniker, Diplomingenieur, Landesbeamten, Projektleiter für das Statistische Bundesamt, - für das Bundeskriminalamt. Ist am Neuaufbau von Vertrieben für Kleincomputern, Hochgeschwindigkeitsnetzwerken, Officecomputern, Workstations leitend beteiligt. Kommt früh schon in die Siemens-Zentrale am Wittelsbacher Platz, hat bei amerikanischen Firmen Leitungsfunktionen bis zum General-Manager Deutschland-Ö-CH. Und setzt sich Ende 56 Jahren zur Ruhe. Um dann in der Gesundheitsberatung federführend Impulse zu setzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ein unglaubliches Leben
Ein autobiografischer Roman
Ohne das uneingeschränkte Vertrauen seiner Mutter und den selbstbewussten Formulierungen seines toten Vaters hätte er sich dies alles nie getraut.BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Ein unglaubliches Leben
Ein autobiografischer Roman
Fassung vom 03.01.2021
Vorwort
„Was andere können, kann ich auch – vielleicht sogar noch viel besser!“
Das, und noch viele andere Weisheiten, lernte Hannes Griesinger von seinem gefallenen Vater, zitiert von seiner Mutter.
Immer, wenn es im Laufe des Lebens schwierig und angespannt wurde, dann war das Bewusstmachen dieser Weisheiten enorm wichtig, hilfreich – und entspannend.
Die Griesingers
Hannes kam 1942 als drittes Kind von der 32jährigen Katharina (genannt Käthe) und der 28jährige Friedrich (genannt Frieder) zur Welt, 3 Wochen zu früh. Der Weihnachtsstress mit dem Höhepunkt Heilig Abend löste die Geburt aus. Der Vater schickte nach der Hebamme. Der kleine Hannes wartete jedoch nicht auf deren Ankunft. Der Vater Frieder sagte seiner Ehefrau Käthe: „Bleib ruhig!“ „Wir kriegen das schon hin!“ „Ich habe schon oft bei Entbindungen geholfen!“
„Wo denn?“ „Im Stall natürlich!“ „Bei Kühen, Ziegen, Schafen, Katzen!“ war seine Antwort. „Das Grundprinzip ist doch immer dasselbe.“ Und tatsächlich kam der kleine Hannes mit seiner Hilfe – ohne Hebamme – zur Welt.
Als die Hebamme dann eintraf, konnte sie sich um die Nachversorgung kümmern.
Morgens 10 Minuten vor 10 Uhr erblickte der Hannes das Licht der Welt, am Abend wurde der kleine Hannes, schön verpackt in seiner Babykleidung, in einem Korb unter den Weihnachtsbaum gestellt. Frisch gestillt, wohlig gesättigt und deshalb ohne Geschrei; friedlich schlafend verabschiedete er sich von dem Heilig Abend Rummel.
Als 3. Kind (alle im Abstand von ca. 1 ½ Jahren) war Hannes willkommen und so gut versorgt, wie es in den Kriegsjahren eben möglich war. Bis Kriegsende waren Haushaltsmädchen dienstverpflichtet, so dass immer eine Hilfe im Haushalt da war. Wenn man überlegt, dass kein fließend warmes Wasser vorhanden war, nur kaltes. Auch, dass es keine Waschmaschine und keine Geschirrspülmaschine gab, so dass jedes warme oder heiße Wasser, auch zum Baden der Kinder, erst auf dem Herd mit Holz und Kohlen erhitzt werden musste.
1933 besuchte die Mutter von Hannes Griesinger, die Käthe geborene Moser mit einer Freundin das Missionsfest in Bad Liebenzell. Bei einer Besteigung des Burgturms Liebenzell begegnete ihnen ein junger Mann, auch aus dem Schwäbischen, der ihr gleich ins Auge stach
Danach gingen dann doch noch einige Jahre ins Land. Am 7. Oktober 1934 kam es zu dem ersten Wiedersehen. Hierzu der Kommentar aus dem Jahr 2002: . „Er kam, sah und siegte!“ – im Alter von 92 Jahren. Auch danach war es noch eine längere Zeit, bis man sich näherkam.
Der Frieder war das fünfte von acht Kinder einer Rohrauer Bauernfamilie. Er wurde bis zum Ender der sieben Jahre Volksschulzeit in äußerst strenger Zucht erzogen. Neben der Schule musste er schon sehr früh tüchtig in der Landwirtschaft mithelfen.
Nach der Schule durfte er bei Herrn Obermeister Könner in Sindelfingen das Wagnerhandwerk erlernen und schloss mit der Gesellenprüfung im Oktober 1930 ab. Wegen Auftragsmangel wurde er entlassen und arbeitete in verschiedenen Betrieben aushilfsweise mit. Ab März 1933 wurde er bei Daimler-Benz in Sindelfingen als Wagner eingestellt.
Durch seinen guten Verdienst konnte er den elterlichen Betrieb, der nach den Notjahren in Schulden geraten war, wieder auf die Füße stellen.
Die eintönige Akkordarbeit widersprach seinem nach vorne strebendem geistigen Denken. Deshalb, aber auch, um seinen Arbeitsplatz für einen der vielen Arbeitslosen vor den Fabriktoren freizumachen, entschloss er sich gegen den Willen seines Vaters, als Freiwilliger in die damalige Reichswehr einzutreten. Dies war die 5. Pionier-Batterie in Ulm an der Donau.
Die Straffheit des Dienstes, die Vielseitigkeit des Pionierdienstes und die sportliche Tätigkeit entsprachen voll seinen Vorstellungen, so dass er körperlich und geistig aufblühte.
Neben der normalen Ausbildung erhielt er eine Spezialausbildung für Gasschutz und anschließend eine für LKW-Fahrer und erwarb so auch den Führerschein der Klasse II.
Nach der einjährigen Dienstzeit verpflichtete er sich auf ein weiteres Jahr und wurde zur Horch- und Lehr-Kompanie der Heeresnachrichtenschule nach Halle an der Saale als Kraftfahrer versetzt.
Als Horchfunkfahrer erlebte er im März 1935 die Wiederbesetzung der 50-km-Zone, welche im Versailler „Schandvertrag!“ festgesetzt worden war.
Seine Freizeit nutzte er zur Erlernung von „Hören und Geben“ sowie den Erwerb des Reichssportabzeichens.
Die unsittliche Lebensweise seiner Vorgesetzten (das hatte er in seinen offiziellen Lebenslauf 1944 geschrieben) veranlasste ihn, nach Ablauf der Dienstzeit am 3. November 1936 aus dem Heer auszuscheiden.
Er bewarb sich bei der Deutschen Reichsbahn. Da die Stellen auf lange Zeit wegen der Arbeitslosenbeseitigung schon besetzt waren, begann er als Streckenarbeiter am 15. Mai 1937.
Bei der Reichsbahn hatte er dann in unermüdlichem Fleiß in der Praxis sowie durch fortdauernden Besuch von Fachschulsemestern und Ablegung von Schul- und Fachprüfungen die Beamtenstellung eines Assistenten erreicht und bereits die Vorprüfung zum Reichsbahninspektor erfolgreich bestanden.
Zuletzt wurde er auf verschiedenen Bahnhöfen als Dienststellenvorsteher aushilfsweise verwendet.
So waren die Jahre seit meinem Beginn bei der Deutschen Reichsbahn sehr mit Arbeit ausgefüllt, zumal seine Dienststelle 15 km, die Fachschule der DR 30 km von seiner Familienwohnung entfernt war. So hatte er während des ganzen Krieges dauernden Verkehrsschwierigkeiten zu überwinden, die oftmals seine ganze Freizeit raubte.
Außerdem musste er seinen betagten Eltern kräftig in der Landwirtschaft helfen, weil die Hilfskraft des Betriebes „im Felde stand“.
Er selbst war bis zum 14.9.1944 UK (=unabkömmlich) gestellt, obwohl er sich mehrmals freiwillig zur Einberufung meldete.
Am 15.9.1944 wurde er zur 5. Werfer AA4 nach Münsterlager einberufen. Hier wurde er zu einem Lehrgang nach Beraun/Protektorat Tschechien kommandiert und dort als Funktrupp Fahrer ausgebildet. Anschließend kam die Feldabstellung zur Einheit 1114/h4 als Funkfahrer. Sein Lebenslauf endet: „Mein Wunsch ist, bald meine ganze Kraft dem Gegner entgegenzuwerfen zur Sicherung der geliebten Heimat und des Sieges.“
Die Zeit bis zum 15. März 1945, seinem Todestag, ist eindrucksvoll in dem E-Book beschrieben:
!“Fünf Monate bis zur Ewigkeit“ von Benny Goodman
Die Hochzeit war ursprünglich nicht nach Plan des Bräutigams Frieder verlaufen. Er hatte immerhin eine Wohnung im 2. Stock eines Kolonialwarengeschäftes ausfindig gemacht und seiner Braut Katharina, genannt Käthe (oder auch Kati) gezeigt. Deren Arbeitgeber in Stuttgart, eine Fotografengeschäft, konnte und wollte die Kati aber nicht gehen lassen. Sie müssen mindestens bis zur Konfirmation von ihrem Mädchen noch dableiben.
Der Bräutigam: „Das Fräulein Käthe kann es nicht richten. Ob bis dahin die Wohnung (waren ja auch damals schon knapp) noch frei ist, glaube ich nicht!“
Die Braut Käthe war ja auch zuvor schon unterdrückt worden. So hatte die Schwester des Hausherrn in Stuttgart ihren Mann verloren, war also Witwe und konnte sich nicht mehr selbst ernähren.
Der Hausherr kürzte der Käthe den Monatslohn mit der Begründung, ich muss jetzt noch meine Schwester unterhalten – und die Käthe, als christlich erzogene und gläubige und nächstenliebend junge Frau – sah das ein und akzeptierte, natürlich enttäuscht, aber einsehend, dieses Schicksal. Einfach eine andere Stelle suchen und annehmen kam ihr nicht in den Sinn
Als die Konfirmation nahekam, stellte sich heraus, dass die avisierte Wohnung noch frei war. Die Käthe war begeistert, dass von morgens bis abends die Sonne in die Wohnung scheinen konnte (Fenster auf der Ost-, Süd- und Westseite). Allerdings war es keine abgeschlossene Wohnung – und die Gemeinschaftstoilette auf dem Treppenhaus-Zwischengeschoß.
So verhandelte sie mit dem Vermieter den Einbau einer Wohnungstür, dann den Einzug einer Trennwand im Wohnzimmer, so dass sich ein schmales Kinderzimmer ergab. Über die Kosten dafür (200 Reichsmark) wurde man sich einig und die Käthe bezahlte dies im Voraus.
April 1939 war dann die Hochzeit in Rohrau, der Heimat von Frieder, der gerade 26 Jahre alt geworden war. Käthe: „In 5 Jahren bekam ich 4 Kinder und wenn mein Frieder den Krieg überlebt hätte, wäre es bestimmt 8 bis 10 Kinder geworden“, sagte sie später zu ihrem Hannes. „Wir waren beide kinderlieb“.
Als der Hannes 1 ¾ Jahr alt war, musste der Papa in den Krieg – und nach 5 Monate war er tot. Die Stimmung im Haushalt war natürlich sehr gedrückt. 3 Wochen vor der Todesmeldung fühlt die Mutter Käthe, dass es ihn getroffen hat. Als dann am 30. April 1945 der Nazi-Ortsgruppenleiter um die Kurve der Kirchstraße kam, wusste sie, dass dieser Besuch ihr galt. So war es dann auch. Er brachte die Nachricht von dem Tod ihres geliebten Mannes, wenige Tage vor dem Kriegsende am 8. Mai 1945!
Keine 6 Jahre verheiratet, 4 Kinder – und jetzt Witwe. Das war der Beginn einer schweren Zeit. Was sie nicht wusste: Nach Kriegsende 1945 wurde es noch schlimmer. Keine geregelte Versorgung mehr, kein dienstverpflichtetes Hausmädchen mehr. Eine Rente, die vorne und hinten nicht reichte, um alle Mäuler zu stopfen, wie es so schön heißt.
„Viele liebe junge Menschen halfen mir, die Freundschaft besteht noch heute“ schreibt sie im September 2002.
Hannes Mutter nähte Tag und Nacht Knopflöcher auf ihrer Singer-Nähmaschine, es gab auch viel zu flicken – und alles für ganz wenig Geld, da ihre Kunden selbst unter Geldnot litten. Oft wurde auch in Naturalien bezahlt, etwas Brot, einige Eier.
Alle 3 Sonntage ging es in der Regel nach Rohrau mit dem Leiterwägele. Die Mutter vorne an der Deichsel, die kleinen Kinder auf dem Wägele, die größeren, wenn es bergauf ging, liefen nebenher.
In Rohrau gab es Gutes zum Essen – und einen großen Bauernlaib zum Mitnehmen nach Hause.
Auf dem Heimweg war es schon dunkel. Da begegnete ihnen niemand. Autos fuhren damals noch nicht auf dieser Nebenstrecke.
Die Mama erzählte auf dem ganzen Weg Geschichten, so dass den Kindern die Zeit nicht lang wurde und sie kamen immer wieder gut zu Hause an.
Fünf Jahre verheiratet, der Mann immer unterwegs – im Dienst, bei der Ausbildung, bei den Eltern zur Hilfe – und dazu nach die verbotenen Treffen mit seiner Jungschar, die in wechselnden privaten Wohnung in den Ortschaften der Umgebung stattfanden, um den Jungen „Das Evangelium lieb zu machen!“
Und dann war er ganz weg, begraben im Elsass. Das Heimweh nach dem lieben Mann war oft stark, aber sie konnte ja vor ihren Kindern keine Schwäche zeigen und jammern und klagen. So kamen immer positive und konstruktive Gedanken und Worte von ihr, welche Hannes und seine Geschwister aufbauten.
Im Geschäftshaus der Firma Friedrich Bröder hatten die Griesingers eine kleine Wohnung. Diese war 2. Stock, sehr hell und freundlich, aber noch kein warmes Wasser, keine Toilette, keine Zentralheizung. Aber das war damals ja normal und deshalb kein Grund, unzufrieden zu sein.
Natürlich gab es eine Toilette, diese war aber vom Treppenhaus zu erreichen und lag zwischen dem 1. und dem 2. Stockwerk. Es war ein Plumpsklo, also nur ein Loch in einem Brett, mit einem Deckel, den man an einem Deckelknopf anfassen konnte. Diese Toilette war für alle, das heißt, für das ganz Haus, da. Alle, das waren die Mitglieder der Bröder Familie, Eltern, 4 Kinder, 1 Haushaltshilfe, sowie die Familie Chimmerle mit Eltern, 3 Kinder und dann noch die Griesinger Familie mit Eltern, später nur noch die Mutter und die 4 Kinder.
Das Toilettenpapier bestand aus Zeitungspapier, welches der Hausherr und Vermieter persönlich, also der Herr Bröder, faltete, mit dem Messer aufschlitzte, dann wieder faltete, mit dem Messer aufschlitzte, bis es die Größe etwas A6-Format hatte. Dann wurde alles auf einen Nagel, der in die Wand eingeschlagen war und oben mit einer Feile angespitzt worden war, aufgespießt. So sauber, wie man heute den Hintern abputzen kann, war dies damals nicht möglich.
Da passt noch folgender Witz: Sagt der A-Mann zum B-Mann: „Sagt mal, hast Du in die Hose gemacht?“ „Nein, wie kommst Du darauf!“ „Du stinkst aber nach Kacke!“ „Das kann doch gar nicht sein!“ Am Ende machen sie eine Wette: „Ich zahle eine Mark, wenn Deine Hose sauber ist! Und wenn da noch Kacke drin ist, dann zahlst Du die Mark!“ Überlegt der B-Mann ein Weilchen und sagt dann: „Einverstanden! Aber eines sag ich Dir, das ALTBACKENE gilt fei net!“ (Das Eingetrocknete gilt aber nicht bei dieser Wette, nur das Frische)
Das Lebensmittelgeschäft, später noch zusätzlich mit Kohlen- und Baustahlverkauf ergänzt, war im Erdgeschoss. Der 1. Stock war dem Wohnbedarf der Familie Bröder vorbehalten, der 2. Stock war dreigeteilt. Südseite die Griesinger, Nordseite die Familie Chimmerle und in der Mitte noch ein Zimmer für das jeweilige Hausmädchen der Bröders.
Im September 1944 wurde der Vater Friedrich zur Wehrmacht eingezogen und war fünf Monate später tot, gefallen im Elsass. Die Mutter Käthe war also kurz vor Kriegsende zur Witwe geworden, mit vier Kindern im Alter von 1 bis 5 Jahren.
Bis Kriegsende war die Versorgung mit Lebensmittelmarken, dienstverpflichtetem Hausmädchen, Gehalt bzw. Witwenrente klar geregelt. Erst mit Kriegsende kam das Chaos, wo nichts mehr funktionierte und für den Schwarzmarkt kein Geld vorhanden war.
Hinzu kamen noch die vielen Rat-Schläge (werden auch als Schläge von den Besserwissern empfunden) für die alleinerziehende Mutter. Alle wussten es besser, ohne wirklich zu helfen. Der Schock über den Verlust ihres Gatten war sicher auch ein weiterer Grund für die Sprachlosigkeit in der Familie.
Als der Hannes mit drei Jahren immer noch kein Wort sprach, wurde er z.B. vom Nachbar Chimmerle für dumm und blöd, d.h. für behindert, gehalten.
Seine Mutter erzählte Hannes Jahre später: „Wenn ihr Kinder im Hof gespielt habt und ich habe zu Euch hinuntergerufen, da hat keine und keiner reagiert, nur mein Hannes!“ „Und der hat dann gemacht, was ich gerufen hatte!“ „Da wusste ich, der ist nicht dumm.“ Und so war es dann auch.
„Als die Füße lang genug waren, um die Tretpedale des Harmoniums zu bedienen, da hat mein Hannes schon probiert, Harmonium zu spielen.“ „Hat sich von mir zeigen lassen, welche Note zu welcher Taste auf dem Harmonium gehört – und hat dann halb nach Noten und halb nach Gehör gespielt.“
Die Aidlinger Schwester Gertrud, Tochter vom Veitlinger Sattler Wörn, musste immer auf dem Harmonium spielen, wenn sie zu Besuch kam. Der Freund Schwarz aus Magstadt hatte immer seine Geige dabei, um zu spielen, wie auch der Schwager Friedrich Renner aus Rohrau.
Spielen und singen von christlichen Liedern aus dem Choralbuch war normal und schön und auch beruhigend und entspannend. Lenkten so von dem Schmerz des Verlust ab, auch von den täglichen Probleme „Wie bekomme ich Essen für meine Familie zusammen?“.
Ein Besuch bei den Schwiegereltern Griesinger in Rohrau war nicht einfach für die fünf Personen. Ein kleiner Leiterwagen, gezogen von der Mama, war das Hilfsmittel für den Transport von Veitlingen nach Rohrau. Dort gab es keine Reichtümer, aber etwas zu essen gab es immer aus der kleinen Landwirtschaft.
Zur Schwester Gertrud noch eine Anmerkung: Am 31. August 2016 war Hannes Griesinger mit seiner Frau Doris im Brandner Tal (Vorarlberg) und standen Schlange an der Seilbahn zum Lüner See. Vor ihnen stand eine Frau in Schwesterntracht, welche Hannes bekannt vorkam. Auf die Frage der Herkunft kam die Antwort „Aus dem Diakonissenmutterhaus in Aidlingen, bei Sindelfingen!“ Die Gegenfrage: „Kennen Sie die Schwester Gertrud Wörn!“ kam die Antwort „Ja, natürlich!“ „Leider ist sie schon dement, ich werde sie aber trotzdem von Ihnen grüßen!“
Sie tauschten die Mailadressen aus. Später kam per Mail die Mitteilung: „Als ich Ihren Namen und den Ort Veitlingen sagte, strahlte sie über das ganze Gesicht. Da war also schon noch Erinnerung vorhanden! Und sie sagte immer wieder – Veitlingen, Veitlingen!“
Nach dem Krieg auch beim Schwager Erich Griesinger, seiner Frau Hilde – und ihren immer mehr werdenden Kindern die finanzielle Not groß. Er war zwar zum Bürgermeister gewählt worden, da jedoch der kleine Ort nahezu keine Gewerbesteuereinnahmen hatte, hatte der Gemeinderat seinen Gehalt um 40% gekürzt wegen fehlender Einnahmen.
Erst 1972, als der kleine Ort von Veitlingen eingemeindet worden war, und er offiziell vom Bürgermeister zum Ortsvorsteher degradiert worden war, bekam er 100% des ihm zustehenden Gehaltes, so dass es ihm und seiner Familie ab diesem Zeitpunkt finanziell deutlich besser ging.
Am Freitag war der Hauseingang bis zur Treppe nach oben vollgestellt mit nach Fisch stinkenden Fässer. Da wurde direkt aus dem Fass der Hering und andere Fische verkauft.
Hannes Griesinger kam im September 1949 in die Volksschule von Veitlingen. Nach der 4. Klasse kam ein Kurzschuljahr, so dass das Schuljahr nunmehr zu Ostern begann. Ein Wechsel auf die Oberschule in Herrenberg kam nicht in Frage. Hannes Mutter: „Einen zweiten Oberschüler kann ich mir nicht mehr leisten.“
Herbst 1956 kam dann die Frage auf, was soll nach der Schule passieren. Eigentlich war das ja klar. Alle gingen zum Daimler, einige wenige hatten das Glück, von IBM genommen zu werden.
Da kam bei Hannes der Berufsberater in die Klasse, schaute sich die Zeugnisse an und sagte zu Hannes: „Du bist in allen Fächer, auf die es ankommt, bei sehr gut bis gut. Wir melden Dich zur Aufnahmeprüfung bei der Flurbereinigung in Herrenberg an!“ So geschah es. Hannes nahm teil, obwohl er noch keinerlei Vorstellung von diesem Beruf hatte. Übrigens mussten alle Kandidaten, ob von Volksschule, Realschule oder mit Abitur diese einheitliche Aufnahmeprüfung machen.
Hannes bestand diese Prüfung und erhielt einen Ausbildungsvertrag zum „Vermessungstechniker“. Der erste Schritt der Ausbildung war das Internat in Ellwangen, auf dem Schloss Ob Ellwangen (später in Hohenellwangen umbenannt). Mit dem Ausbildungsvertrag kam auch eine detaillierte Aufstellung, welche Art von Kleidung und Unterwäsche in welcher Stückzahl in das Internat mitzubringen war.
Die Kosten für dies alles waren für die Witwe Griesinger mit vier Kindern recht hoch, so dass sie das Geld bei Freunden leihen musste. Da sie an jedem Monatsanfang ihre Schulden abbezahlte, war oft schon nach 1-3 Wochen kein Geld mehr für das Nötigste da.
Das Internat in Ellwangen begann am 2. Mai 1957 los. Davor waren noch 1 Monat Zeit. Hannes war angeboten worden, in dieser Zeit als Meßgehilfe bei einem Flurbereinigungsverfahren mitzuwirken, natürlich gegen Bezahlung nach dem üblichen Stundensatz. Das brachte zum Glück wieder Geld in die Familienkasse.
In Breitenstein bei Neuweiler war die Arbeitsstelle, eigentlich das Arbeitsfeld, dann man bewegte sich ja in Ausübung seiner Tätigkeit auf der gesamten Gemarkung. Früh morgens um 5 Uhr war Aufstehen, kurz vor 6 Uhr ging der Zug mit Dampf-Lokomotive nach Böblingen, von dort der Zug mit Dampflok nach Weil im Schönbuch, von dort zu Fuß 2 km nach Breitenstein. Das war die tägliche Anreise. Abends natürlich wieder zurück.
Hannes war dem sehr sportlichen Vermessungstechniker Fritz Baitinger zugeordnet. Da dieser wusste, dass Hannes der neue Vermessungstechnikerlehrling war, nahm er diesen in jeder Beziehung sportlich und mathematisch streng ran. Der unsportliche Hannes war nach den ersten Tagen völlig kaputt, geschafft, fix und fertig. Dann ging es allmählich besser. Fritz Baitinger hatte als Hobby Fahrradrennen und war dort sehr gut, war also bestens durchtrainiert. Während des Tages nutzte er auch jede Gelegenheit, dem Hannes Griesinger in Geometrie und Mathematik zu fordern und somit zu trainieren.
Es war eine sehr gute Vorbereitung auf das berufliche Internat, dass Hannes schon die Grundfertigkeiten der Vermessung kennenlernen und praktizieren konnte. Dadurch war es dann auf dem Internat in Ellwangen etwas einfacher.
Internat
Hannes Griesinger kam am 1. Mai 1957 nachmittags im Schloss an. Dort meldete er sich bei dem Lehrer, der ihn im Internat sehr freundlich begrüßte. Danach führte er ihn in den Schlafsaal, zeigte ihm sein Bett (das untere von einem Stockbett) und seinen Spind, gab ihm die Bettwäsche und beauftragte ihn mit dem Überziehen des Bettes und der Bettdecke. „Wenn Du fertig bist, dann meldest Du dich bei mir!“
Hannes tat, wie er geheißen war. Danach ging er voller Stolz über sein Werk vor in das Lehrerzimmer. „Na, da wollen wir mal sehen, was Du gemacht hast!“ Sie gingen in den Schlafsaal und zum Bett von Hannes. Mit lauter und tiefer männlicher Stimme brüllte der Lehrer: „Was ist das denn?“
Er riss alles heraus und warf es auf den Boden. „Nochmal, aber diesmal richtig!“ Dem Hannes rutschte das Herz in die Hose. Zum ersten Mal weg von der Mama, weg von zu Hause. Zum ersten Mal angeschrien zu werden von einer hässlichen Männerstimme. Zu Hause gab es keine Männerstimme.
Nach diesem „freundlichen“ Empfang war der Schock doppelt so schlimm. Ja, das war erst der Anfang von dieser Schleiferei im Kommiss-Stil der Wehrmacht. Nach und nach tröpfelten die Teilnehmer aus ganz Württemberg herein. Es gab insgesamt vier Schlafsäle. Hannes hatte seinen Schlafsaal gleich neben dem ersten Lehrsaal, was auch seine Vorteile hatte. Andere mussten ein Stockwerk höher in ihren Schlafsaal.
Am anderen Tag gab es dann die Einführung in die Abläufe. Es wurden die Vorschriften über den Umgang untereinander und mit Lehrpersonal erklärt. Die Teilnehmer waren typischer Weise Realschüler, also ca. 16 Jahre alt. Dann gab es ältere Teilnehmer bis hin zum Abitur. Und dann die ganz schlauen Volkschüler, die alle dieselbe Aufnahmeprüfung bestanden hatten, so wie Hannes.
Schüler im Alter von 18 Jahren hatten abends Ausgangserlaubnis (falls nicht ein Strafe dies wieder verhinderte), die jüngeren mussten schön zu Hause, das heißt, im Internat Schloss-ob-Ellwangen bleiben.
Beim Essen mussten alle sitzen bleiben, bis auch der letzte Schüler seinen Teller leer gegessen hatte. Das war für viele ein großes Problem, gab es doch auch von zu Hause verwöhnte Esser und Schleckmäuler. Für Hannes gab es zum ersten Mal in seinem Leben ein geregeltes und gutes Essen, morgens, mittags, abends. In der Mittagspause konnte man noch in einem Kiosk etwas kaufen, dafür hatte allerdings Hannes kein Geld.
Auch dies (der Kiosk-Besuch) konnte im Rahmen einer Strafe verboten werden.
Licht aus und Nachtruhe war ab 21:45 Uhr. Dies wurde immer wieder kontrolliert, in dem einer der Lehrer sich vorsichtig an die Tür des Schlafsaals heranschlich und dann ruckartig die Tür öffnete und mit einer starken Taschenlampe herein leuchtete.
Ab und zu erwischte er einen – oder gar mehrere – die noch sich im Schlafsaal bewegten, also zu den anderen gegangen waren und noch leise redeten.
Alle, die erwischt wurden, mussten Liegestützen machen, oder sich den Trainingsanzug anziehen, dann die Wendeltreppe hinunter auf den Schlosshof – und dann bis zum Schlosseingangstor hin und zurück laufen – und je nach Lust und Laune ließ der Lehrer dies dann wiederholen. Er – und die anderen Schüler – schauten dabei von oben aus den Fenstern und freuten sich darüber, dass es einen nicht ihn selbst erwischt hatte.
Als Griesinger sich einmal zu laut darüber freute, nahm dies der Lehrer aus dem Augenwinkel war. Als dann die anderen fertig waren, wieder oben angekommen waren und dabei waren, ihren Schlafanzug anzuziehen, sagte der Lehrer zu Griesinger: „So, jetzt bist Du dran!“ „Du warst zu schadenfreudig!“ „Also los!“ „Umziehen!“ „Runter in den Schlosshof!“ Nun hatten die anderen Schüler ihren Spaß beim Zuschauen.
Ja, das ist dem Griesinger nie wieder passiert. Da hat er sich künftig zurückgehalten.
Sechsmal KURZ war der Klingelton morgens zum Wecken. Kam anschließend ein Dauerton (das hing vom Wetter ab), dann bedeutete dies: „Zum Training in Sportkleidung im Schlosshof versammeln!“
Und jeder wusste: „Die letzten 10 Schüler bekommen eine Sonderbehandlung!“
Um nicht zu den letzten zu gehören, begannen manche, sich schon vor dem Wecken umzuziehen. Auch dies wurde kontrolliert. Gelegentlich kam schon vor dem Weck-Zeitpunkt eine Kontrolle per Anschleichen und dann Voll-Licht und alle, die dann schon dabei waren, sich den Trainingsanzug anzuziehen, hatten sich für die „Sonderbehandlung“ beziehungsweise „Sondertraining“ qualifiziert.
Im Schlosshof versammelten sich die Schüler in Reih und Glied. Die letzten 10 der 60 Schüler waren schon getrennt aufgestellt worden – und zwar vor allen anderen. Diese bekamen dann die Kommandos für die Sonderübungen zu hören, während sich die restlichen 50 daran ergötzen konnten. War dann dies zu Ende, dann ging es rein ins Glied und alles nochmal gemeinsam mit allen anderen von vorne.
Nach 3 Wochen hatte es Griesinger zum ersten und einzigen Mal erwischt. Sein Gegenüber im oberen Stockbett war beim Alarmstart auf ihm gelandet. Peter Sayer war damals schon 18 Jahre alt, groß und schwer, und hatte den Hannes mit seinem Körpergewicht fast KO geschlagen.
Bis er dann wieder zu sich kam, raus in den Gang rannte (sein Spind war draußen, direkt an der Wendeltreppe in den Schlosshof) kam er kaum zum Anziehen, da alle anderen an ihm vorbeimussten, ihn notgedrungen anrempelten und somit ihn massiv beim Umziehen (Schlafanzug aus, Trainingsanzug an) behinderten.
Dadurch war er unter den letzten 10 und somit bei der Truppe mit den Sonderübungen.
Danach noch die gemeinsamen Übungen. Dann im Dauerlauf nach hinten durch eine kleine Pforte nach außen auf den steil abfallenden Burgabhang und dann einmal um die ganze Burg herum.
Je später einer zu der kleinen hinteren Pforte kam, desto länger musste er staubedingt warten, bis er durchkam, so dass danach die Letzten den größten Rückstand zum Lehrer hatten, der als Erster vorne draus immer gleichmäßig weiter trabte.
Nicht schön, wenn man dann auch noch den staubedingten Rückstand aufholen musste.
In den Tagen nach dem Strafexerzieren hatte der unsportliche Griesinger einen fürchterlichen Muskelkater – und deshalb ist ihm dies nie wieder passiert. Ab da war er immer unter den ersten 50 Schülern auf dem Schlosshof.
Als sehr schlauer Volksschüler hatte Griesinger in den für Geometer wichtigen Fächern wie Mathematik, Geometrie aber auch in Deutsch immer gute Noten. Deshalb bekam er nie wegen fehlenden oder falschen Hausaufgaben Strafen verhängt, welche anderen Schülern oft die knappe Freizeit stahl.
Die Köchin Frau Burkhard wohnte direkt vor dem Schlosstor mit ihrer Familie in dem Wächterhäuschen. Sie war lieb und herzlich und kochte sehr schmackhaft und reichlich, so dass nur die verwöhnten Söhnchen daran etwas auszusetzen hatten.
Jeder Teilnehmer bekam seine Portion auf den Teller und aufgestanden wurde erst, wenn alle Teller leer waren. Wenn wegen einem der verwöhnten Mitschüler, der nicht bereit war, seinen Teller leer zu essen, alle 59 anderen sitzen bleiben mussten (zu Lasten ihrer knappe bemessenen Freizeit), gab es danach schon Druck auf den Betreffenden. Manchmal schnappte sich einer der Nachbar dessen Teller, wenn gerade kein Lehrer herschaute, um diesen schnell zu leeren, damit man endlich aufstehen durfte.
Die älteren Mitschüler machten die jungen unbedarften wie den 14-jährigen Griesinger darauf aufmerksam, dass die Hilfsköchin beim Herausschöpfen sich immer an die Tischecke mit ihrer Muschi an- und auflehnte – und sich so „einen abrieb“ – wie die älteren dies nannten. Die jüngeren Teilnehmer hatten noch nicht die sexuelle Fantasie der älteren, die auch in ihren Sprüchen und Kommentaren über weibliche Wesen zum Ausdruck kam und verstanden deshalb die Kommentare nicht richtig oder falsch.
Schachspiel
In der knappen Freizeit konnte man im Turmzimmer auch Spiele machen. Dazu gehörte auch Schach.
Eines Tages spielte Hannes Griesinger gegen den Lehrer Häberle Schach. Und gewann am Ende auch noch. Während des Schachspiels war der Umgangston freundlich und sachlich. Als Häberle dann hinaus ging, machte Griesinger einen großen Fehler. Er feixte, machte eine Grimasse zu seinen Mitschülern, die auch in diesem Aufenthaltsraum waren.
Häberle zog die Tür nicht hinter sich zu, sondern drehte sich um, um sie sorgfältig zu schließen. Dabei sah er Griesingers Grimassen. Er kam herein und verpasste Griesinger eine schallende Ohrfeige, ohne irgendetwas zu sagen. Dann ging er und zog die Tür zu. Danach spielte er nie wieder gegen Griesinger.
Kachelofen-Explosion
Zu Beginn und gegen Ende der Internatszeit konnte es ganz schön kalt werden. Im Schloss gab es große Kachelöfen, die dann beheizt wurden. Hannes Griesinger war für den Lehrsaal 1 als zweiter Heizer eingeteilt, der erste Heizer war sein Kollege aus Herrenberg, der Rainer Tizmann.
Bei Kälte hatten die Beiden den riesigen Kachelofen in Gang zu bringen. Als erstes wurde natürlich immer ein Holzfeuer gemacht. Wenn dieses gut im Brand war, dann wurde vorsichtig Kohle nachgeschüttet. Wenn die Kohle sichtbar brannte und glühte, dann wurde noch mehr Kohle nachgeschüttet, denn es sollte im Prinzip für den ganzen Tag, zumindest für den Vormittag reichen.
Eines Tages, sie hatten zu spät mit der Befeuerung begonnen und deshalb viel zu früh die Kohle nachgeschüttet, da kam der Schock: „So ein Mist, unser Feuer ist aus! Was machen wir bloß?“ Es war keine Zeit, alles wieder heraus zu holen und von vorne zu beginnen. Beide hatten Schiss vor der Bestrafung und der Kritik.
Wie wild stocherten sie mit den langen Schürhaken im Kachelofen herum. Nach einiger Zeit gab es eine richtige Explosion, eine Kohlestaubexplosion, eine kräftige Verpuffung, welche die beiden Heizer richtig umhaute. Beide waren pechschwarz im Gesicht, die Kleidung voll mit schwarzem Kohlestaub. Aber sie waren glücklich, richtig happy. Nach der Verpuffung brannte auf einmal die gesamte Füllung im Kachelofen. Der Tag war gerettet, die Heizung funktionierte. Aus schwarzen Gesichtern strahlten sich Rainer und Hannes glücklich an.
Jetzt ging es nur noch darum, die Ofentür zu schließen, die richtigen Zuluft- und Abgasklappen richtig einzustellen. Und dann ab ins die Dusche. Kleider runter, duschen, andere Kleider anziehen und fertig machen zum Frühstück und Unterricht. Genau genommen fiel an diesem Morgen das Frühstück aus, weil dafür keine Zeit mehr war.
Später ging es nur noch darum, den Kachelofen zu kontrollieren, damit er nicht zu stark – oder zu schwach brannte. Und am Nachmittag bei Bedarf noch nachzufüllen.
Dies Malheur passiert nur ein einziges Mal. Für die Zukunft war die beiden Heizer gewarnt – und gingen sehr viel vorsichtiger mit der Feuerung um. Vor allem begannen sie früher mit dem Heizen, damit sie Zeit hatten, alles sorgfältiger zu erledigen.
Während der eine Lehrer morgens pünktlich mit dem Unterricht begann, kontrollierte der andere Lehrer Dusch- und Toilettenräume, Schlafsäle etc.
Dann, mitten im Unterricht, zum Beispiel 30 Minuten nach Beginn, kam der andere Lehrer herein und begann, Schüler aufzurufen. Da hatte man zackig aufzustehen. Bei dem unsportlichen Griesinger funktionierte das noch lange nicht. „Auf!“ „Sitzen!“ „Auf!“ „Sitzen!“ Immer wieder musste er rauf/runter. Und der arme Griesinger wusste immer noch nicht, was er angestellt hatte, was der Grund für alles war.
Der Lehrer rief: „Deuschle, zeigen Sie mal dem Griesinger, wie mal aufsteht.“ „Auf“ „Nieder“ „Auf“
Der exzellent trainierte sportliche Fußballer Deuschle spritzte nur so auf, in Sekundenbruchteilen.
„Sehen Sie, Griesinger, soooo steht man auf!“ „Und jetzt nochmal: „Auf“ „Ab“ „Auf““
Und dann erst begann die Kritik, zum Beispiel: „Bett nicht ordentlich gemacht!“ Oder irgendetwas anderes.
Auf die Frage: „Wer hat die letzten 3 Blatt auf der Toilette Nr. 7 verbraucht!“ meldete sich niemand. Auch nach wiederholter Nachfrage meldete sich keiner.
Die Vorschrift war: „Wer die letzten 3 Blatt auf der Toilette benutzt, hat Nachschub zu besorgen!“ Gleichzeitig wusste jeder, wenn ich jetzt noch, nachdem es schon zum Unterricht geklingelt hat, noch Toilettenpapier hole, dann komme ich zu spät zum Unterricht und werde deshalb bestraft.
Da sich keiner meldete, kam der Strafbefehl: „Alle schreiben bis morgen früh hundertmal: Wer die letzten 3 Blatt benutzt, hat sofort neues Toilettenpapier zu beschaffen und einzulegen!“
Da waren natürlich alle stinksauer. Wer macht schon gern eine Strafarbeit, wenn ein anderer die Strafe verursacht hat.
Da sich hinterher der Übeltäter verplappert hatte, kam die Kollektivstrafe auf ihn zurück. Griesinger war nicht Zeuge, da dieser zu einem anderen Schlafsaal im oberen Stockwerk gehörte. Der Feigling wurde so bestraft, dass die Mitschüler seine linke Po-Backe mit brauner Schuhwichse, seine rechte Po-Backe mit schwarzer Schuhwichse eingeschmiert und poliert hatten.
Er soll mehr als sechs Wochen gebraucht haben, um diese Schuhwichse von seinen Pobacken restlos wieder zu entfernen.
Bei künftigen Strafaktionen kam es dann vor, dass sich einer freiwillig meldete, um alle anderen vor der Kollektivstrafe zu verschonen (Worauf er hinterher natürlich hinwies, um sein Lob einzusammeln).
Die älteren Mitschüler, ab 18 Jahren, durften am Abend noch in die Stadt, also nach Ellwangen, sofern sie nicht im Rahmen von Strafmaßnahmen Ausgangssperre hatten.
In der Stadt gab es aber Spione, nämlich Geschäftsinhaber von dem Papiergeschäft oder anderen Geschäften, aber auch die Inhaber von Restaurants, die unziemliches Verhalten der Schloss-Schüler sofort nach oben meldeten, meist mit einer ziemlich genauen Personenbeschreibung, was dann natürlich für den Betreffenden eine Strafmaßnahme zur Folge hatte.
Griesinger hätte, selbst wenn er gedurft hätte, gar kein Geld gehabt, um in eine Gaststätte zu gehen.
Im Schloss waren die große Räume alle sehr hoch, im Gegensatz zu den Gängen, die deutlich niedriger waren. Irgendwann entdeckte einer der Mitschüler, dass man im Dachgeschoß an einer bestimmten Stelle die Bretterbohlen anheben konnte und so in die Dienstboten-Gänge hineinkam.
So konnten die Dienstboten über den Gängen der Herrschaften in niedrigen Gängen zum Beispiel zu allen Kachelöfen in den großen Räumen kommen und ohne die Herrschaften zu belästigen, sich um die Heizung zu kümmern.
Nachdem dies entdeckt worden war, gab es auch Situationen, wo man, wenn man sich leise bewegte, auch mal die Lehrer und die Lehrbeauftragten belauschen konnte, die sich in einem der Räume versammelt hatten.
Der Eggerik Enkena vom Flurbereinigungsamt Ravensburg soll auch mal über einen dieser Gänge die große Schlossuhr gefunden und daran gedreht haben. So hatte er die Zeiger der großen Schlossuhr kräftig verstellt und alle haben sich gefragt, was da wohl passiert ist.
Da Griesinger dies nur vom Hörensagen weiß, kann er auch nicht garantieren, dass der Eggerik der Übeltäter war.
Im Hochsommer, als tagsüber die Hitze unerträglich war, gab es genaue Anweisungen bezüglich Lüftung. So durften nur nachts, bis morgens um 6 Uhr, die hohen Fenster geöffnet sein. Wer diese zu einem späteren Zeitpunkt aufmachte, wurde bestraft. Wer seine Missetat nicht bekannte, war schuld an einer Kollektivstrafe, die dann alle betraf.
Zu Beginn bestand der Lehrgang aus 60 Teilnehmern. Im Laufe der sechs Monate wurden einzelne jedoch bei schlechtem Verhalten und/oder schlechter Leistungen ausgesiebt, das heißt, nach Hause geschickt. Deren Ausbildung war somit beendet, was zu Hause bei den Familien keine Freude auslöste, sondern peinliche Nachfragen bei den Söhnen zur Folge hatte.
Bei der Abschlussprüfung zum Schluss gab es nochmals Verlierer. Die restlichen ca. 50 Teilnehmer wurden dann auf die jeweiligen Flurbereinigungsämter geschickt, um dort die praktische Ausbildung aufzunehmen.
Der Vorteil dieser Internatsausbildung war, dass danach alle Vermessungstechnikerlehrlinge sofort produktiv in der Praxis eingesetzt werden konnten. Bei den Lehrlingen der Staatlichen Vermessungsämtern war dies ein weitaus längerer Prozess, bis deren Vermessungstechniker-Lehrlinge denselben Ausbildungsstand erreicht hatten.
Spinnrad
Ab 1984 war Hannes Griesinger Verkaufsleiter für Bayern bei der Firma Network-Systems. Die Zentrale war in Frankfurt-Niederrad. Per Auto war somit die Strecke über Nürnberg die Standardstrecke, alternativ zum Flug nach Frankfurt.
Als dann 3 Jahre später die Autobahn A7 von Ulm nach Würzburg fertig war, war das gerade im Sommerhalbjahr ein Vergnügen, am frühen Morgen diese Strecke nach Frankfurt zu fahren. Geschwindigkeitsbeschränkungen war am Anfang noch selten, der Verkehr war noch spärlich, so konnte man noch richtig Gas geben.
Nachdem die A7 bei Ellwangen vorbeiführte, machte Griesinger auch mal einen Besuch beim Schloss Hohenellwangen, zu Internatszeiten noch Schloss ob Ellwangen genannt.
Wie er da vom äußeren Schloßhof den Durchgang zum inneren Schlosshof passierte, traf er die ehemalige Betreuerin des Schloss-Museums und man tauschte Erinnerungen auf.
Als er vom Lehrgang 1957 sprach, sagte sie: „Ja, damals haben mir die Jungs mein schönes wertvolles Spinnrad kaputt gemacht.
Hannes blieb das Herz stehen. Er gestand, dass er persönlich der Schuldige war. Er hatte einfach Spass daran gehabt, das Spinnrad mit dem Tretpedal immer schneller laufen zu lassen, bis es plötzlich einen Knacks gab und das Spinnrad sich in seine Einzelteile zerlegte.
In panischer Angst über die finanziellen Folgen verlies er blitzartig das Museum und zog sich in die Internatsräume zurück.
Seine Mutter mit der viel zu geringen Witwen-Rente und ihren 4 Kindern hätte selbst bei einem kleinen Haftungsbetrag schon gravierende Probleme bekommen.
Auch als Tage später nach dem Täter gesucht wurde, hatte sich Hannes nicht gemeldet. Alle Internatszöglinge waren sich einig, dass die „ein Besucher von außen gewesen sein müsste“, so dass die Sache im Sande verlief – zur großen Erleichterung von Hannes Griesinger.
Als einmal für einen Aktion jeder Lehrling 10 Mark beisteuern sollte, kam der Brief von der Mutter mit dem Kommentar zurück: „Mehr als 5 Mark konnte ich nicht auftreiben, so leid es mir tut!“ Mit diesem Schreiben ging Hannes zu dem Lehrgangsleiter und der Rest wurde Hannes dann erlassen.
Berufsschule
Am Ende der Internatsausbildung begannen die Verbleibenden in ihren Heimat-Flurbereinigungs-Ämter die praktische Tätigkeit und weitere Ausbildung. Für die restliche Lehrzeit von zweieinhalb Jahren musste dann die Steinbeis-Berufsschule in Stuttgart besucht werden. Diese lag in der Nähe des Stuttgarter Nordbahnhofes. Der Unterricht erfolgte jeweils über acht Wochen am Stück, so dass die Lehrlinge mit größerem Anfahrtsweg sich ein Zimmer nehmen mussten.
Dort gab es nicht nur die theoretische, sondern auch eine praktische Weiterbildung. Mittwochs war immer Feldmessen in Sillenbuch-Riedenberg. Die Anfahrt nach Sillenbuch erfolgte mit der Straßenbahn, der Rest ging man zu Fuß bis zum Eichenhain.