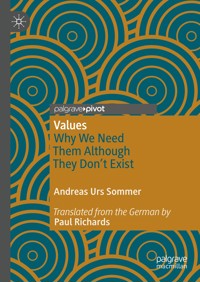Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Viele Bürger, besonders die jüngeren, aber auch einige Wähler der extremen Parteien, fühlen sich in unserem Parteiensystem nicht mehr repräsentiert. Auf die Frage, bei wem die Nachbarin bei der letzten Bundestagswahl ihr Kreuzchen gemacht hat, nur Schulterzucken und Resignation. Dabei ist die Vertretung von vielen durch einen Einzelnen bei unseren Möglichkeiten gar nicht mehr notwendig. Per Mausklick oder Wischen können Meinungen in Sekundenschnelle statistisch erhoben werden. Wir müssen endlich lernen, politisch mitzuentscheiden. Die Idee ist keine politische Verschwörung, sondern direkte Demokratie »made in Switzerland«. Andreas Urs Sommer zeigt in diesem Buch, dass es niemand nötig hat, nur repräsentiert zu werden. Er appelliert an alle: Wir müssen für uns selbst stehen und politisch mitentscheidend mündig werden!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Steh auf und geh!
(Apostelgeschichte 3,6)
Wenn die Leute fragen,
Lebt der Hecker noch?
Könnt ihr ihnen sagen:
Ja, er lebet noch.
Er hängt an keinem Baume,
Er hängt an keinem Strick.
Er hängt nur an dem Traume
Der freien Republik.
(Heckerlied, 1848/49)
Andreas Urs Sommer
Eine Demokratie für das 21. Jahrhundert
Warum die Volksvertretung überholt ist und die Zukunft der direkten Demokratie gehört
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2022
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Verlag Herder, Freiburg
Umschlagmotiv: © MJgraphics / shutterstock
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timisoara
ISBN Print 978-3-451-39167-5
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-82718-1
ISBN E-Book (E-Pdf) 978-3-451-82706-8
Inhalt
Aufriss
Wer spricht? Wer darf sprechen? Und wie?
Was heißt Repräsentation?
Wer soll repräsentieren?
Gruppenrepräsentation
Die Heilslehre des Gremialismus
Ideenrepräsentation
Die Fiktion der Repräsentation und die Fiktion des Gemeinwillens
Warum soll repräsentiert werden?
Das Trugbild der Identität und der Zwang zur Vielfalt
Was heißt Partizipation?
Partizipation gestern: Das Gespenst des teilhabe-gewährenden Oberlichts
Partizipation heute: Das Gespenst der Beeinflussung
Partizipation in sechs Aspekten
Sein ist Partizipation
Partizipationsüberlasten
Partizipationszwänge
Partizipationsselbstbeschränkungen
Ökonomische Partizipation: Das Gespenst der Entmündigung
Warum soll man politisch teilhaben?
Entkolonialisierung der Zukunft
Politik und Komplexität
Mangel an Wissen statt Expertokratie
Das Digitale und das Direkte
Vielmütigkeit und Möglichkeitssinn
Die Krise der Parteien und Medien
Gesetzgebungszwänge im Repräsentativismus
Ohnmacht oder zu viele Möglichkeiten?
Mit sich selbst ins Reine kommen
Partizipation ist ein menschliches Bedürfnis
Solidarität, Konflikt und die partizipative Einhegung politischer Mythen
Die Verfassung als Rahmenweltanschauung
Vertrauenspolitiken
Das listigste aller Tiere
Einübung von Entscheidungsfähigkeit
Verantwortung
Angstarbeit und Angstbewältigungsarbeit
Wer soll politisch teilhaben?
Ausschluss der Eingeschlossenen I: Wer partizipiert nicht, weil er nicht die vollen Mitbestimmungsrechte hat?
Ausschluss der Eingeschlossenen II: Wer partizipiert nicht, obwohl er volle Mitbestimmungsrechte hat?
Wohl und Weh des Paternalismus
Bedingungsloses Grundeinkommen?
Wahlpflicht und Wahlverzichtsfreiheit
Wir sollen, weil wir können
Betroffenheit
Einschluss der Nichteingeschlossenen
Wie soll man politisch teilhaben?
Opposition und Parteipolitik
Vielfältige Partizipationsmöglichkeiten, das Kleinräumigkeitsdogma und ziviler Ungehorsam
Dissens und Wettkampf
Deliberationszwang
Losverfahren und Bürgerräte
Abstimmungen
Elektronische Demokratie
Amateurisierung der Politik und Revidierbarkeit der Entscheidungen
Politik als Spannungsgefüge
Geteilte Herausforderungen, geteilte Macht
Geteilte Fiktionen
Demokratiewende durch Selbstzweifel und Teilnahmetraining
Die Rechten und die direkte Demokratie. Ein Rückblick
Die Demokratie im Jahr 2072. Ein Ausblick
Nachwort
Anhang
Anmerkungen
Über den Autor
Aufriss
Der Erzählerschlendrian hat im Roman keinen Platz; man erzählt nicht, sondern baut.
Alfred Döblin: An Romanautoren und ihre Kritiker. Berliner Programm (1913)
Krise überall, schon längst vor Corona. Jedenfalls, wenn man dem Glauben schenken will, was traditionelle Medien von rechts bis links ihren verschreckten Nutzerinnen und Nutzern ebenso unentwegt einhämmern wie die neuen sozialmedialen Akteure, die „Influencer“ und „Blogger“. Seltene Einigkeit herrscht darüber, dass die Krise da sei, dass sie dränge, ja, dass es eigentlich bereits viel zu spät sei, um noch etwas dagegen auszurichten. Weitgehende Uneinigkeit zeigt sich hingegen bei der Bestimmung dessen, was die Krise ausmacht. Da gibt es beispielsweise sehr prominent jene, die sagen, die Krise sei ökologischer Art, es drohten Erderhitzung und Klimakollaps. Fast ebenso lautstark sind die, die die Krise als soziale identifizieren: Grund allen Übels sei die ungleiche Verteilung von Kapital, Ressourcen und Arbeit. Kaum verhaltener klingen die Stimmen jener, die die Krise in einem noch immer patriarchalisch dominierten Geschlechterverhältnis und dem Mangel an Frauengleichberechtigung begründet sehen, oder derjenigen, die die Krise in rassistischer Diskriminierung verwurzelt wähnen. Sehr schrill lassen sich schließlich diejenigen vernehmen, die zu wissen vorgeben, die Krise gründe einzig darin, dass unabsehbar viele Fremde zu uns kämen, auf nichts weiter sinnend, als das „Wesen unseres Volkes“ zu untergraben. Mitunter schwingt sich das allgemeine Krisenbewusstsein zu höheren synthetischen Einsichten auf und versucht, mehrere als höchst kritisch empfundene Zeitphänomene zu bündeln und sie als Symptome eines um sich greifenden, allgemeinen Kulturverfalls auszugeben, der falsche Eindeutigkeit her-, alles weg-, ver- und zustelle.[1]
Die Krise ist im gehobenen, von allerlei Nichtigkeitsängsten heimgesuchten Bildungsbürgertum angekommen. Dieser Kulturnegativismus segelt unter der Flagge „Alles ist Krise“ und fühlt sich im eisigen Gegenwind des angeblich anstehenden Untergangs offensichtlich pudelwohl.[2] Bekommt der Kulturnegativismus mit der Coronapandemie nicht schmerzlich recht: Geht nicht alles vor die Hunde, wenn nicht ein starker Arm einer starken Frau oder eines starken Mannes das Ruder noch im letzten Augenblick herumreißt und uns eine letzte Frist vor dem endgültigen Schiffbruch vergönnt?[3]
Ich muss die Untergangseuphoriker enttäuschen. Sowenig die Probleme des sozialen Unrechts oder des ökologischen Ungleichgewichts zu leugnen sind, dringt, wer sie zur Hauptsache erklärt, noch nicht zum Kern des gegenwärtigen Krisenempfindens vor. Will man es in der Sprache des Kulturnegativismus beschreiben, würde man sagen, es handle sich im Kern um eine Krise der Ohnmacht. Weil ich keinerlei kulturnegativistische Neigung verspüre, ziehe ich es vor, von einer Krise der Nichtbeteiligung zu sprechen. Diese Wortwahl scheint mir analytisch fruchtbarer als das lähmende Vokabular der Ohnmacht.
Was wir beobachten, ist eine seit mehreren Jahrhunderten anhaltende Herausbildung des selbstmächtigen Individuums, dessen Weltmacht, sprich: politisches Einflussvermögen, damit nicht Schritt gehalten hat.
Dieses Buch will etwas zeigen. Es wird nicht leugnen, dass all die genannten Probleme von Ökologie bis Migration, von Ausbeutung bis Unterdrückung gravierend sind und der Abhilfe bedürfen. Aber sie sind, zur Abwechslung einmal mit nüchternem Blick betrachtet, nicht Haupt-, sondern Nebensachen, wenn es darum geht, den Kern des politischen Krisenbewusstseins in der Jetztzeitkultur zu bestimmen. Dieses Buch will zeigen, dass im Kern dieses politischen Krisenbewusstseins eben eine Krise der Nichtbeteiligung liegt. Es handelt sich um eine hochgradig paradoxe Krise, denn Modernisierung bedeutet wesentlich Möglichkeitszugewinn. Die Jetztzeitkultur unterscheidet sich von anderen Kulturen dadurch, dass möglichst vielen Menschen möglichst viele Möglichkeiten eingeräumt werden. Zugleich aber bleibt den meisten eine wesentliche Möglichkeit verwehrt – nämlich die, ihre politische Welt selbst zu gestalten, alle politischen Entscheidungen selbst zu treffen, die für ihr Leben relevant sind.
Daran hindern sie kein böser Wille, keine Verschwörung, keine mediale Verblendungsmatrix, keine heimtückischen Kapitalisten oder bevormundenden Öko-Linken, geschweige denn ein finsteres diktatorisches Regime. Was uns alle hindert, die politischen Entscheidungen selbst zu treffen, die für unser Leben relevant sind, ist eine urtümliche Strukturierung des politischen Feldes, die der Emanzipation des Menschen, seiner Selbstermündigung nicht länger angemessen ist.
Das Zauberwort dieser urtümlichen Strukturierung des politischen Feldes heißt Repräsentation. Repräsentation bedeutet, dass andere für mich stehen. Andere, wird man einwenden, die ich immerhin in regelmäßigen, freien und geheimen Wahlen gewählt habe – sofern ich mich nicht sogar selbst zur Wahl habe aufstellen lassen. Andere, so erwidere ich, die ein freies Mandat haben, nicht an meine Wünsche, Präferenzen und Interessen gebunden sind und ein paar Jahre lang für mich, für all ihre Wähler und im Namen des gesamten Volkes Sachentscheidungen treffen werden, in die dieses gesamte Volk ansonsten nicht eingebunden ist. Die uns und mich unmittelbar betreffen, ohne dass ich an ihnen teilgehabt hätte.
Das allgegenwärtige politische Unbehagen gründet nicht darin, dass der Parlamentarismus schlechter funktionieren würde als früher (er tut es nicht), auch nicht darin, dass die Welt schlechter geworden wäre (sie ist es nicht), oder darin, dass Ungleichheit und Ungerechtigkeit zugenommen hätten (sie haben es nicht). Vielmehr ist es die zwangsläufige Folge einer Entwicklung, die Neuzeitlichkeit und Moderne überhaupt ausmacht, nämlich es dem Individuum zu erlauben, sich immer stärker aus einer Vielfalt von Möglichkeiten zu dem zu formen, was es sein will. Man kann dies Individualisierung nennen oder Eröffnung eines riesigen Möglichkeitsraumes. Menschen werden immer unterschiedlicher. Diese Entwicklung ist aber nicht begleitet gewesen von der Erweiterung der individuell-politischen Weltmächtigkeit, der individuell-politischen Lebensweltmächtigkeit – also der Fähigkeit, die äußere Wirklichkeit zu gestalten. Daraus entsteht ein widersprüchlicher Gefühlszustand in der Selbst- und Weltwahrnehmung. Sie lässt uns das Nichtbeteiligtwerden als Krise empfinden. Wir dürfen zwar wählen, welchen Beruf wir ergreifen oder mit wem wir unser Leben verbringen wollen, aber wir dürfen nicht mitbestimmen, wie die Welt politisch gestaltet ist, in der wir dieses Leben führen. Wir dürfen allenfalls jemanden benennen, der für uns diese Welt politisch gestaltet. Das ist dem Stand der Selbstaufklärung des Menschen nicht angemessen.
Und dennoch hängt die politische Philosophie mit erstaunlicher Beharrlichkeit am vormodernen Konzept der Repräsentation. Offenbar fühlt sie sich im 18. Jahrhundert, als jene politischen Theorien erdacht wurden, auf die sie sich noch immer leidenschaftlich beruft – von John Locke bis Immanuel Kant, von Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède de Montesquieu bis Jean-Jacques Rousseau –, wohl, sicher und heimisch. Der Republikanismus und der Repräsentativismus gelten als heiliges Mantra der politisch-philosophischen Selbstbeweihräucherung. Vor diesem Hintergrund wurde demokratische Politik entweder so gedacht, dass es den Willen eines Volksganzen, eine volonté générale gebe, die sich in Mehrheitsbeschlüssen auf mehr oder weniger mystische Weise kundtun soll. Oder aber, dass die Menschen eines Gemeinwesens in diverse Gruppen zerfallen, die der Repräsentanten bedürfen, um ihre Anliegen durchzusetzen. Beiden Ansätzen gemeinsam ist, dass sie die aufklärerische Freistellung des Individuums prinzipiell zurückdrängen.
Wer hingegen das aufgeklärte oder sich zumindest aufklärende Individuum ernst und beim Wort nimmt, wer dem Menschen etwas zutraut, dem listigen, interessanten und wendigen Tier, muss diesen Menschen auch in seinem Entscheidungsvermögen und in seiner Weltwirksamkeit freisetzen – muss ihm die Möglichkeit einräumen, sich unentwegt in politischer Entscheidung zu üben.
Dieses Buch wird etwas zeigen. Es wird zeigen, dass im politischen Feld niemand uns nötigt, andere für uns stehen zu lassen. Dass wir auch und gerade im Politischen sehr wohl für uns selbst stehen können – ja stehen müssen, um im Übrigen auch jener Würde des Menschen, die Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes festschreibt, gerecht zu werden. Aufklärung bedeutet wesentlich, dass es keine Stellvertretung mehr gibt – oder sie immer nur situativ und vorläufig sein soll. Politische Repräsentation, wie sie in der westlichen Welt praktiziert wird, verletzt dieses Gebot der Vorläufigkeit und Situativität. Bei Lebensentscheidungen – und politische Entscheidungen sind Lebensentscheidungen – ist bei Mündigen Stellvertretung fehl am Platz.
Das griechische Wort krisis, auf das die Rede von der Krise zurückgeht, bedeutet Scheidung, Unterscheidung, Streit, dann aber auch Urteil und Entscheidung, die einen Konflikt beenden. Die Krise besteht nicht darin, dass wir unserer Mitbestimmung müde geworden wären, sondern darin, dass wir zur Mitbestimmung noch nicht wirklich die Möglichkeit haben – noch nicht die Möglichkeit haben, gemeinsam mit unseresgleichen zu entscheiden. Krise als Entscheidung, die das Projekt der Aufklärung einen guten Schritt voranbringen kann – Entscheidung dafür, teilzuhaben an den Entscheidungen, die uns angehen.[4]
1913 meinte Alfred Döblin, der Erzählerschlendrian habe im Roman keinen Platz mehr. Sich mit den Antworten der Vormoderne begnügend, hat es sich der Philosophenschlendrian im politischen Feld zu lange bequem gemacht. Machen wir uns stattdessen ans Bauen.
Wer spricht? Wer darf sprechen? Und wie?[1]
Die allseits beklagte sprachliche Entfesselung ist ein Symptom. Aber kein Symptom einer überaus bedenklichen politischen Entwicklung oder gar eines allgemeinen kulturellen Verfalls. Vielmehr ist sie ein Symptom politischer Reifung: Jede und jeder darf heute sprechen, und zwar in eigenem Namen. Schrill und sprachlich brutal wird, wer sich nicht gehört fühlt, wer sich ohnmächtig wähnt. Will man dem abhelfen, muss jeder und jedem nicht nur Sprachmacht, sondern Weltwirkungsmacht zugebilligt werden.
Geht einmal euren Phrasen nach bis zu dem Punkt, wo sie verkörpert werden. – Blickt um euch, das alles habt ihr gesprochen; es ist eine mimische Übersetzung eurer Worte. Diese Elenden, ihre Henker und die Guillotine sind eure lebendig gewordnen Reden.
Georg Büchner: Dantons Tod, 3. Akt (1835)
Der Stoff, aus dem das Politische geformt wird, sei in falsche Hände geraten. Wenigstens zu einem beträchtlichen Teil und wenigstens nach Meinung derjenigen, die die auserwählten Hüter dieses Stoffes zu sein behaupten. Der Stoff, aus dem das Politische geformt wird, ist die Sprache. Und ihre Hüter, die Politiker mit staatstragendem Jobprofil (deutsche Bundespräsidenten beispielsweise) und die Dichter mit staatstragenden Preisen, können sich gar nicht beruhigen, wie angeblich alles vor die Hunde geht. Da liest man beispielsweise bei Durs Grünbein, Träger sowohl des Georg-Büchner- wie auch des Friedrich-Nietzsche-Preises, „die Brutalisierung der öffentlichen Rede“ habe „dramatische[.] Konsequenzen für die Demokratie“.[2]
Und doch reibt man sich die Augen: Der Dichter beginnt nicht etwa damit, dass er anprangert, wie rüpelhaft Menschen in der U-Bahn oder auf dem Pausenhof verbal miteinander umspringen, auch nicht damit, wie Hollywood-Blockbuster mit heroischem Gesülze die moralische Aufgeregtheit anheizen und uns damit politischen Manichäismus, das Denken in Schwarz-Weiß-Schablonen, aufnötigen wollen – ein Denken, ohne das man heutzutage weder an Montags- noch an Freitagsdemonstrationen bella figura machen kann. Nein, der Dichter beginnt mit George Orwells 1984, mit „New-Speak“, jenem sprachchemischgereinigten Idiom, mit dem das autoritäre Zukunftsregime durch radikale Vereinfachung auch die Gedanken zu kontrollieren hofft. Hat sich der Dichter da womöglich im Zettelkasten vertan? Denn so abscheulich man die sprachpolizeilichen Maßnahmen in Orwells Dystopie auch finden kann – einen Vorwurf kann man ihnen nicht machen, nämlich den einer Brutalisierung der Sprache. Vielmehr verschleiert „Newspeak“ gerade systematisch alle faktische Brutalität der Herrschenden: Statt Menschen zu töten, werden sie „vaporisiert“, statt „böse“ muss man „ungut“ sagen.
Soll man im Ernst glauben, dass gegenwärtig eine derartige realitätsvernichtende Einheitssprache um sich greife? Die von Grünbein gegebenen Beispiele legen Gegenteiliges nahe: Da ist vom mittlerweile abgewählten amerikanischen Präsidenten die Rede und vom russischen Amtsinhaber mit seinen persönlichen Trollen. Über das präsidiale Sprachverhalten lässt sich gewiss allerlei sagen, aber schwerlich, dass die Herren sich einer Ausdrucksweise bedienten, die Gegensätze abschleife. Mit Orwells „Newspeak“ hat die präsidiale Sprachpraxis, die der Dichter brandmarken will, fast gar nichts zu tun – genauer gesagt nur so viel, als es in beiden Fällen darum geht, Herrschaft zu stabilisieren. Die eine, bei George Orwell geschilderte Praxis ist die, alle Gegensätze aufzuheben[3] und Einheit zu suggerieren, wo Vielheit ist; die andere, insbesondere von Donald Trump geübte Praxis ist die, überall Gegensätze aufzureißen – vor allem dort, wo es gar keine gibt.
Kann es sein, dass man bei der Betrachtung der Gegenwartssprache leicht jenen Manichäismen aufsitzt, die man bei der politischen Konkurrenz aufs Schärfste verurteilt? Oder ist es ausgemacht, dass das moralisch-politisch Wahre, Schöne und Gute bei uns und unseresgleichen liegt, so dass für „die anderen“ nur noch das Unwahre, Unschöne, Ungute übrigbleibt? Es herrscht ohnehin eine bemerkenswerte Diskrepanz in der kritischen Wahrnehmung der gegenwärtigen Sprachgebräuche: Ist es jetzt ein gewaltiger Vereinheitlichungsdruck, der auf diesen Sprachgebräuchen lastet, oder vielmehr ein gewaltiger Verluderungsdruck? Ist es das Problem, dass wir einer womöglich machtpolitisch, womöglich massenmedial eingeträufelten Sprachdiktatur unterworfen werden, oder vielmehr, dass eine Sprachanarchie um sich greift, wo dann jeder nur noch in seiner Partikularsprache spricht, die in seiner Gruppe, seinem Kiez gerade en vogue ist?
Für manche scheint klar, dass „eine Radikalisierung des öffentlichen Sprechens“ zu beobachten sei, die mit „Diskriminierung“ und einem „allgemeine[n] Verfall der ethischen Standards, eine[r] Versumpfung der Sprache in den Boulevardblättern wie in den sozialen Netzwerken“ einhergehe.[4] Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt zu Protokoll: „Wo die Sprache verroht, ist die Straftat nicht weit.“[5]
Aha. Da würde man doch gern einmal wissen, wo genau diese Entfesselung der Sprache stattfindet, die der Dichter und der Bundespräsident im Chor mit den Kultnegativisten jedweder Färbung meinen diagnostizieren zu können. Wo genau wird die Sprache brutalisiert? Zugegeben, die Leute flüstern hierzulande nicht wie in Tokyo, wenn sie sich in der U-Bahn partout unterhalten müssen, und sind auch der fernöstlichen Gepflogenheit abgeneigt, sich bei jeder Gelegenheit zu verbeugen, um sich für das eigene Vorhandensein zu entschuldigen. Aber aggressives Gebrüll ist selbst in Neukölln so wenig die Regel wie unentwegte Messerstechereien. Pöbeleien und Beleidigungen haben im physischen öffentlichen Raum quantitativ schwerlich signifikant zugenommen, Gewaltverbrechen gemäß Kriminalstatistik ohnehin nicht.[6] Und sollte jemand doch vor sich hinfluchen und selbst vor groben Unflätigkeiten nicht zurückschrecken, wird der aufgeklärte Zeitgenosse verständig nicken und dem Mitmenschen mitleidig ein Tourettesyndrom bescheinigen. Schaut man sich da um, wo Menschen physisch und potenziell höchst konfliktuös miteinander interagieren, ist die Feststellung unausweichlich: Wir gehen jeder Konfrontation vorsichtig aus dem Weg. Wir Zivilisationsmenschen sind vorzüglich domestizierte Tiere. Der Mensch ist das sich im Zaum haltende Tier.
Indes findet die Brutalisierung, die unsere lyrischen und politischen Zivilisationsverfallsliteraten die Stirn in Falten legen lässt, durchaus statt – nämlich überall dort, wo kein Anwesender direkt und unmittelbar adressiert ist, auf Demos, bei denen man den Kanzler oder wahlweise die Dieselautolobby an den Galgen wünscht; auf Parteiversammlungen, wo man sich gegen „die da draußen“ in Rage redet, oder selbst im Bundestag, wo es fast wieder so ruppig zugeht wie zu Zeiten von Herbert Wehner und Franz Joseph Strauß.[7] Abgesehen davon, dass dies natürlich ein untrügliches Zeichen für den Untergang des Abendlandes ist (ist es zu Strauß’ und Wehners Zeiten auch schon einmal untergangen?),[8] fällt auf, dass die Adressaten der Attacken – beispielsweise die Ausländer, die Automobilkonzernbosse, die Altparteien – zwar unverblümt angegangen, oft auch namentlich genannt werden,[9] die direkte Konfrontation von Mensch zu Mensch aber doch oft sorgfältig vermieden wird. Selten tickt einer wirklich einmal aus, greift zum Messer und lässt den aufpeitschenden Worten Bluttaten folgen. Eine solche Korrelation von Worten und Taten ist zum Glück in Sachen Gewalt keineswegs der Normalfall; mancher Beobachter des politischen Feldes wird sogar anmerken, eine solche Korrelation zwischen Worten und Taten sei extrem unwahrscheinlich. Ausnahmen bestätigen leider die Regel.
Der Hauptaustragungsort verbaler Brutalität sind dennoch nicht Protestcamps und Parlamente, sondern das World Wide Web. Es bietet einige Vorteile für Rabauken und Hassprediger. Erstens werden sie gesehen, gehört und gelesen, ohne dass sie sich für dieses Privileg hätten qualifizieren müssen. Schlechterdings jede und jeder kann und darf sich zu Wort melden. Zweitens muss niemand für das, was sie oder er sagt, Gründe oder Argumente beibringen. Man kann seiner Meinung freien Lauf lassen, ohne diese Meinung auf irgendeine Evidenz zu stützen. Drittens haben nicht nur die kundgetanen Meinungen einen stark persönlichen Index und zeugen für das Subjekt, das sie ausspricht, sondern diese Meinungen verbleiben oft nicht im Allgemeinen, sind gegen andere Subjekte, sehr konkrete, namentlich genannte Personen gerichtet. Der oder die Sprechende profiliert sich, indem er oder sie andere verunglimpft. Entscheidend ist, diesen anderen Personen nicht von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten zu müssen. In diesem Fall würde man kaum wagen, ihnen die Unflätigkeiten auf den Kopf zuzusagen. Viertens bleibt also das sich durch Polemik so scharf profilierende Subjekt meist hinter dem Schleier der Anonymität; es verbirgt sich hinter Avataren und keiner weiß, ob es mit einem echten, raumzeitlichen Subjekt identisch ist. Fünftens ist der verbal-digitale Brutalisierer juristisch für das, was er online tut, mitunter nicht belangbar; manche Gerichte halten selbst übelste Beschimpfungen wie „Stück Scheiße“, „Schlampe“, „Drecksau“ für gedeckt durch das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit.[10]
Nun sind manche Zivilisationsverfallsliteraten versucht, den Untergang des Abendlandes wenigstens im Netz auszurufen. Aber ihnen entgeht eine Kleinigkeit: Das Netz ist nicht mit der Wirklichkeit deckungsgleich. Was sich dort abspielt, ist weder Spiegel noch Abziehbild dessen, was in der analogen Welt geschieht. Verbale Brutalisierung im Netz – einmal vorausgesetzt, sie sei ein flächendeckend gesicherter Befund – ist kein Beleg dafür, dass sie auch anderswo stattfindet, im täglichen Leben, jenseits von Protestcamps und Parlamenten.
Im Gegenteil könnte sich eine andere Mutmaßung einschleichen: Gerade weil es uns, den so vorzüglich domestizierten Tieren im täglichen Leben mit all seinen neuen Empfindlichkeitsbarrieren mehr und mehr verwehrt werde, Affekte sprachlich unmittelbar abzureagieren, die anderen als Sauhunde, Schlampen oder Schlimmeres zu beschimpfen, wenn uns jemand die Vorfahrt nimmt oder anrempelt, würden wir gezwungen, wenigstens in Avatarsgestalt ins digitale Schimpfasyl auszuweichen. Das Internet macht vermutlich kaum jemanden zum realweltlichen Ausfälligkeitsmonster, auch nur selten zum Massenmörder.
Wesentlich hat das Netz hingegen eine Ventilfunktion. Es hilft, emotionalen Überdruck abzubauen, wenn man im Namen seines anonymen Alter Ego Gemeinheiten auf Tastatur oder Touchscreen tippt und der digitalen Echogemeinde kundtut. Man kann sich im Anschein der Kommunikationsmacht sonnen: Es gibt da draußen im Digitalen Leute, die auf all das, was dieses anonyme Alter Ego absondert, auch reagieren, sei es pikiert mit Gegenkommentaren, sei es applaudierend mit Likes und Herzchen. Aber über den bloßen Anschein von Kommunikationsmacht gelangen nur wenige „Blogger“ und „Influencer“ ernstlich hinaus.
Dass es bei diesem bloßen Anschein bleibt, hängt wesentlich daran, dass die Kommunikationsadressaten vage, fluid, blass bleiben, selbst dann, wenn sie direkt beim Namen genannt werden. Während eine direkte Beschimpfung im wirklichen Leben eine direkte Erwiderung verlangt, wird, wer sich einer gewissen Aufmerksamkeit erfreut, achselzuckend über all das hinweggehen, was ihr oder ihm in den Kommentarspalten an gegen sie oder ihn gerichteten Zumutungen entgegenschlägt. Und wer nicht direkt attackiert wird, kann ohnehin gelassen entscheiden, ob sie oder er sich gemeint und betroffen fühlen will.
Das unterscheidet die digitale Kommunikationsexplosion grundlegend von Orwells „Newspeak“-Indoktrinationsvision: Sie ist weder unilateral noch unidirektional; es gibt keine autoritative Verlaufsrichtung der Kommunikation mehr. Mag sich der ehemalige POTUS auf Twitter noch so in Rage geredet haben:[11] Niemand wurde von seinen Tweets niedergeknüppelt. Jede und jeder konnte so damit umgehen, wie sie oder er wollte. Das Internet ist kein Nötigungsmedium. Es ist ein Wegklick-, ein Wegwischmedium.[12]
Die Brutalisierung ist augenscheinlich nur die eine Seite des gegenwärtigen öffentlichen Sprachgebrauchs. Die andere ist die sprachliche Betulichkeit, die allgegenwärtige Angst, irgendjemanden zu verletzen. Daher wird die Bibel in (gender-)gerechter Sprache verabreicht, die Zeitung, die Bügeleisenbedienungsanleitung. Man darf mich in Deutschland öffentlich nicht mehr „Schweizer“ nennen oder „Türke“, sondern nur noch „Mensch (m/w/d) mit schweizerischem/türkischem Migrationshintergrund“. Dabei ist die Empörung die Währung, mit der die Brutalisierer ebenso bezahlen wie ihre staatstragenden Kritiker. Empörung ist zu einem höchsten moralischen Gut avanciert[13] – sehr anschaulich zu bestaunen bei der Greta-Thunbergisierung der Klimadebatte. Wer mit Empörung bezahlt, läuft freilich Gefahr, einen hohen Preis zu entrichten. Namentlich den der Lächerlichkeit – wenn die zunächst von der Empörungslust Mitgerissenen ausgeschlafen sind, sich die Augen reiben und sich die Dinge wieder zurechtrücken.
Womit wir erneut bei den bedenkenschweren Dichtern wären, die die allseitige Ausweitung der sprachlichen Kampfzone betrauern. Ausgerechnet Dichter! Habe ich da in der elften Klasse etwas nicht richtig verstanden, als mir der Deutschlehrer zu vermitteln versuchte, dass poetische Modernität gerade in einer gewaltigen Sphärenausweitung bestehe? Hat er uns damals nicht beibringen wollen, moderne Poesie habe den geschützten Raum und den regelpoetischen Rahmen verlassen, habe fortan darauf gepfiffen, sich einhegen zu lassen, und die Grenzen zur außerpoetischen Normalwelt problematisiert, überschritten, eingerissen? Hat diesen Deutschlehrer, sonst die leibhaftige intellektuelle Trägheit, an jenem denkwürdigen Vormittag ein heiliger Schauer ergriffen, als er darlegte, dass das einzig sichere Kriterium für poetische Modernität die Entfesselung der Sprache sei? Sagte er nicht, wahre Herkulesse der Dichtkunst hätten statt Prometheus den Sprachgebrauch von seinen Ketten befreit? Und nannte der enthusiasmierte Pauker uns nicht Namen, die wir bis dahin noch nie gehört hatten, auch nicht in seinem Unterricht: von Klopstock bis Baudelaire, von Byron bis Dada, von Marinetti über Benn bis Enzensberger? (Dass Marinetti ein böser Faschist, Benn womöglich noch böser gewesen sei, weswegen man sie alle beide nicht lesen dürfe, erfuhr ich erst im Studium von einem politisch bewegten Assistenten.)
Will also der Büchner- und Nietzsche-Preisträger jene Enthemmung und Entfesselung zurücknehmen und die Sprache wieder in den Kaninchenstall zurückbeordern, in dem sie jahrhundertelang hatte ausharren müssen? Haben sich denn in der sprachlichen „Radikalisierung“ und „Brutalisierung der öffentlichen Rede“ nicht genau jene Träume von der Macht der Sprache verwirklicht, die den Glutkern moderner Poesie ausmachen (gesetzt den Fall, ich hätte den Deutschlehrer damals richtig verstanden)? Diese Träume von der Macht der Sprache feiern auch in Trumps Brutalismen fröhliche Urständ. Da derlei Brutalismen den Zivilisationsverfallsliteraten missfallen, muss dagegen wahlweise der große moralische Holzhammer oder die politisch korrekte Kettensäge hervorgekramt werden.
Aus kühler Distanz betrachtet ist das Problem, das die intellektuellen und poetisch-politischen Unkenrufer umtreibt, nicht der Umstand, dass die Sprache selbstmächtig geworden ist. Sondern, dass sich Menschen Sprachmacht, Sprachgewalt anmaßen, die aus der Sicht der berufenen Unkenrufer dazu nicht autorisiert sind. Das Problem ist der Kontrollverlust der Poeten, Pädagogen und Präsidenten – der Verlust der Kontrolle über das, was gesagt werden darf und was nicht.[14] In Zeiten der Vollbeschäftigung dämmern die poetisch-pädagogischen Sprachkontrolleure der Arbeitslosigkeit entgegen. Psychologisch ist nur allzu verständlich, dass sie darüber lamentieren und ihre eigene Bedeutungseinbuße, nicht mehr die Herren über Sagbares und Unsagbares zu sein, mit dem Untergang des Abendlandes gleichsetzen. Das tun regelmäßig auch die Lokführer, wenn wieder einmal ein Bahnvorstand es wagt, über automatisierte, führerlose Triebwagen zu sprechen. (Bloß zeitigt der Streik der Lokführer regelmäßig gravierendere Folgen als der Streik von Poeten, Pädagogen und Präsidenten.)
Aber noch ein pastorales Wort zur Beruhigung: Vielleicht fallen ja nur jene in die Depression der Bedeutungslosigkeit, die ihre Rolle als Sitten- und Sprachwächter missverstanden haben. Während andere Dichter und Denker nicht nur erkennen, dass sie es waren, die der Entfesselung der Sprache den Weg geebnet haben. Sondern vor allem, dass ihnen die sprachlich und gedanklich so polymorphe Gegenwart unendlich viel Stoff zum Dichten und Denken bietet.
Das Offensichtliche wird leicht übersehen: dass die digitale Entfesselung mit dem Abschied vom Trägermedium Papier und der verlegerisch-redaktionellen Kontrolle über das Gedruckte nicht nur die Fiktion einer universellen Wissensordnung vernichtet,[15] sondern eine Ermächtigung, eine Ermündigung des sich selbst aufklärenden Individuums ist. Sprachlich-politische Entfesselung ist übrigens keineswegs neu und keineswegs prinzipiell „rechts“. Wie hieß es doch gleich im Hecker-Lied, dem Bekenntnissong der 1848er-Revolutionäre: „Blut muß fließen / Knüppeldick, / Nieder mit den Feinden / Von der Republik. […] Reißt die Konkubine / Aus des Fürsten Bett! / Schmiert die Guillotine / Mit der Pfaffen Fett!“[16] Sprachliche Brutalisierung ist ein Akt der Selbstermächtigung, gerade auch der Ohnmächtigen – und, siehe den abgehalfterten POTUS, derjenigen, die an der Macht bleiben wollen.
Per se ist diese Entfesselung weder gut noch böse. Sie ist – vorausgesetzt, sie sei wenigstens in gewissen Feldern gegeben – ein Symptom. Ein Symptom dafür, dass die Menschen nicht die Weltwirksamkeit haben, die ihnen als freien und mündigen Individuen eigentlich zukommen müsste.
Dass das Internet dabei als Druck- und Lautverstärker dient, ist ebenfalls deutlich. Es begünstigt einerseits „die ideologische Selbstversiegelung“, andererseits vermag es „eine neue Beweglichkeit“ zu stiften.[17] Es kann gleichermaßen dogmatisieren und dynamisieren, macht aber à la longue Selbstabkapselung in geschlossenen Echoräumen schwierig.[18] Denn das Internet ist nicht nur ein Wegwisch-, es ist auch ein Wegführmedium. Überall lauert, hätten Beichtväter früherer Jahrhunderte gesagt, die Versuchung. Auf Schritt und Tritt winkt mir eine Information entgegen, die mein dogmatisches Weltbild erschüttern könnte – es sei denn, ich bewege mich tatsächlich nur auf den vier oder fünf Seiten, die dieses Weltbild bestätigen und bestärken wollen.
Gegen die Unkenrufer ist der eigentliche Befund für das Netz und für die Wirklichkeit außerhalb des Netzes der einer ungeheuren Zunahme der Stimmenvielfalt: Jede und jeder lernt, mit der eigenen Stimme zu sprechen. Zwangsläufig gibt es unendlich viel zu vernehmen, was nicht nur dem Unkenrufer wider den Geschmack und wider den Strich geht. Die Vielfalt der Stimmen ist keineswegs harmonisch, sondern dissonant, schrill, oft töricht.
Nicht alle versuchen diesem Gewirr mit Abwehrzauber abzuhelfen. So berichtet Warren Breckman von den Occupy-Generalversammlungen, dass dort jede und jeder jederzeit reden durfte, eine auf Permanenz gestellte Diskussion: „Da in ihr jede Form von elektrischer Verstärkung verboten war, griff die Versammlung zum Mittel des menschlichen Mikrophons. Dabei werden die Worte des oder der Sprechenden durch die Gruppe getreu wiederholt. […] Das menschliche Mikrophon zwang die Sprecher, ihre Sprache anzupassen, in kurzen Sätzen sowie klar und direkt zu sprechen.“[19] Hier büßt nicht nur das Sprechercharisma seine Wirkmächtigkeit ein, da die Rede ja erst durch die laute Wiedergabe mit tausend Stimmen überhaupt vernehmbar wird, vielmehr ist in Syntax, Grammatik und Semantik eine radikale Reduktion erforderlich, um das Gesagte massenhaft reproduzierbar zu halten. Idealerweise stößt der Sprecher zu einer Reihung atomarer Aussagen, politischer Elementarsätze vor, die das Herz jedes Anhängers des Wiener Kreises hätte höher schlagen lassen. Ist das jetzt eine Verarmung des Politischen? Oder seine Läuterung und Klärung?
Jede und jeder muss jedenfalls die eigene Stimme neu erfinden, im Resonanzraum des menschlichen Mikrofons ebenso wie im Resonanzraum des Internets. Voraussetzung dieser permanenten Neuerfindung ist die große politische Errungenschaft wiederholter Aufklärungen: dass nämlich jede und jeder sprechen darf. Im Internet lässt sich die Utopie, dass jede und jeder nicht nur sprechen darf, sondern potenziell jeden und jede erreichen kann, auch tatsächlich realisieren. Wenn viele ihre Stimme erheben, bleibt freilich ein Drunter und Drüber nicht aus. Diese Kakofonie beleidigt das unter Unkenrufern offenbar vorherrschende Bedürfnis nach Vornehmheit. Und vor allem den unter Studienräten und Feuilletonredakteurinnen, poetae laureati[20] und politischen Sprachverwalterinnen verbreiteten Wunsch, sich die Kontrolle über das Sagbare und das Nichtsagbare vorzubehalten.
Schauen wir unbefangen hin: Die „Radikalisierung“ und „Brutalisierung“, die angebliche Sprachohnmacht ist wenig mehr als ein Anzeichen für den Machtverlust etablierter Spracheliten. Deshalb nimmt das weinerliche Wundenlecken unter Wort-Arbeitern kein Ende. Das zu Zeiten von Pierre Bayle unter Aufklärern noch verbreitete „Bewusstsein für die vielen Urteilskräfte“[21] ist längst selbst in Rechthaberei umgeschlagen: Dort die bösen „Populisten“, hier die guten „Linksliberalen“.
Folgerichtig will man manches partout nicht wahrhaben. Beispielsweise handelt es sich keineswegs um ein moralisch empörendes Gegenwartsphänomen, dass Sprache Gewalt wird, wie Durs Grünbein titelt. Vielmehr ist diese Gewaltwerdung der Sprache vermutlich nicht erst seit den Propheten des Alten Testaments ein Herzenswunsch der Sprachmächtigen. Sprachmacht soll Weltwirkungsmacht werden. Der Unterschied besteht nur darin, dass die Sprachmacht sich heute demokratisiert hat.
Man könnte nun ein bisschen weniger Zimperlichkeit fordern. Hätten gegenwärtige Formzwänge, etwa die 140 oder 280 Zeichen für einen Tweet, nicht einen Lichtenberg oder einen La Rochefoucauld zu Höchstleistungen herausgefordert? Und sollte man sich nicht an den einen oder anderen unbequemen Gedanken gewöhnen? Falls die bejammerte Radikalisierung nicht nur eine Reaktion auf allgegenwärtige Sprachverbote ist, quasi ein instinktiver Versuch, die eingeschränkten Freiheitsräume durch Überkompensation zu durchbrechen,[22] drückt sie womöglich Ohnmacht aus, handelnd nichts ändern zu können, so dass wir redend immer schriller werden müssen. Und reden können wir im Netz jetzt alle – bloß nichts tun. Die Kommunikationsmacht des digitalen Kommentators und Schimpfboldes ist keine reale Handlungsmacht. Sich mit dem bloßen Anschein von Kommunikationsmacht zu begnügen, wird auf Dauer niemandem reichen. Das Netz ist nicht die Wirklichkeit. Auch die Sprache ist nicht die Wirklichkeit.
Dass alle reden, wild durcheinander, beweist einen allgemeinen Partizipationswillen. Gerade verbale Brutalität ist der Versuch einer Selbstermächtigung. Wen das stört, der oder die kann, statt zu lamentieren, eigentlich nur eines tun: nämlich denen Macht, Lebensmitbestimmungsmacht einräumen, die nicht bloß reden wollen. Wer tatsächlich Gehör findet, muss weniger schrill sprechen. Kein Liberaler und Anhänger der freien Republik singt heute mehr als die ersten, noch gar nicht blutrünstigen Zeilen des Hecker-Liedes.[23]
Wer darf sprechen? Es sollen alle sprechen dürfen, und alle schicken sich an, es zu tun. Das gefällt manchen nicht. Es ist dies aber eine Modernisierungsfolge, ein Möglichkeitszugewinn. Nicht andere sollen für mich sprechen, sondern ich für mich selbst. Jede und jeder kann jetzt sprechen. Aber noch nicht jede und jeder kann für sich handeln, für sich entscheiden. Was sich in der angeblichen Radikalisierung der Sprache kundtut, ist ein Partizipationswille, ein Wille, mitzubestimmen, obwohl man bisher nicht mitbestimmen durfte. Es ist ein Indiz dafür, dass die Menschen gern weltmächtig wären, dass sie gern im Streit mit anderen ihr Eigenes durchsetzen möchten. Demokratie ist, zumindest auch, ein agonales Geschehen: In ihr regieren Wettstreit und Widerstreit. Das flößt denjenigen Angst ein, die bisher über das Rederecht verfügt und damit den Stoff, aus dem das Politische gefertigt ist, nämlich die Sprache für sich gepachtet haben. Jedoch stehen dieser Stoff und die Möglichkeiten, die er bietet, allen zu.
Was heißt Repräsentation?
Entspricht das althergebrachte System der Repräsentation jener politischen Reifung des Individuums, die seit der Aufklärung sich ankündigt? Reicht es, wenn jede und jeder für sich sprechen darf? Sollte nicht jede und jeder auch für sich und für alle handeln können, ohne an die Streckbank der Repräsentation gefesselt zu sein?
… was hat das Volk, in dessen Namen regiert wird, für Möglichkeiten der Mitsprache, der Einmischung in seine eignen Angelegenheiten?
Max Frisch: Aus dem Berliner Journal (1973/74)
Wir müssen reden. Wir dürfen reden. Und wir können reden. Viele Jahrhunderte hat es gebraucht, bis alle reden durften und konnten. Wären wir nicht kleinmütig und verdruckst, würden wir darin eine große Errungenschaft sehen.
Aber mit dem Reden-Können und dem Reden-Dürfen ist es so eine Sache. Vor einigen Jahren nahm ich – nicht mehr ganz neu in Deutschland, doch bis dahin mangels Staatszugehörigkeit nie am politischen Geschehen beteiligt, nun aber frisch ausgestattet mit einem deutschen Pass – in unserem idyllischen Wohnort am Fuße des Schwarzwaldes an einer Gemeindeversammlung teil. Oder an dem, wovon ich in meiner Neubürgernaivität glaubte, es müsse eine Gemeindeversammlung sein. Kurzum: Ich bin in der Erwartung hingegangen, ich dürfe da gemeinsam mit sämtlichen Mitbürgerinnen und Mitbürgern über all das diskutieren, befinden und abstimmen, was die Gemeinde bewegt: die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos, die Ausweisung einer neuen Bauzone, die Erweiterung des Spielplatzes und das Gemeindebudget für das kommende Jahr.
Und da saß ich nun und durfte – zuhören. Wie die Damen und Herren des Gemeinderates, unsere für fünf Jahre gewählten „Repräsentanten“ über das Feuerwehrauto und die Bauzone, den Spielplatz und das Budget diskutierten, befanden und abstimmten. Das Amtsblatt hatte gar nicht, wie ich fälschlich gelesen hatte, zur öffentlichen Gemeindeversammlung, sondern zur öffentlichen Gemeinderatsversammlung eingeladen. Immerhin, nach zweieinhalb Stunden und nachdem alles entschieden war, war es auch den anwesenden, vielleicht 30 Nichtgewählten gestattet, ihre Stimme zu erheben: Der letzte Tagesordnungspunkt nach den Varia sah eine „Bürgerfragestunde“ vor. Sie war innerhalb von viereinhalb Minuten erledigt – nur ein Anwohner wollte besorgt in Erfahrung bringen, wann es denn endlich mit der Wanderwegbeschilderung weitergehe. Der Duft des für alle Ausharrenden vorgesehenen Imbisses hat die Redseligkeit selbst dorfbekannter Querulanten im Keime erstickt.
Schnell lerne ich, dass hierzulande zwar alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht, dies jedoch nicht bedeutet, dass sie so bald wieder zu ihm zurückkehrt.[1] Für die Verwaltung dieser Staatsgewalt seien die „Repräsentanten“ da.[2] Diese „Repräsentanten“ handeln politisch an meiner Statt: „In den Ländern, Kreisen und Gemeinden muß das Volk eine Vertretung haben, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist.“[3] An sich sähe derselbe Grundgesetzartikel auch eine andere Möglichkeit vor: „In Gemeinden kann an die Stelle einer gewählten Körperschaft die Gemeindeversammlung treten.“[4] Aber zumindest in unserem idyllischen Ort am Fuße des Schwarzwaldes macht man von dieser Möglichkeit lieber keinen Gebrauch.
Soll ich mich darüber grämen? Ich habe ja meine Repräsentanten. Oder sie haben mich, als ihren Wähler, ihren politischen Auftraggeber. Will ich freilich wissen, was der Begriff Repräsentation bedeutet, gibt sich das Grundgesetz zugeknöpft. Das einzige Mal, wo dort überhaupt ein Wort aus dem Feld von Repräsentation auftaucht, geht es um die Hauptstadt – darum, dass „die Repräsentation des Gesamtstaates in der Hauptstadt“ „Aufgabe des Bundes“ sei.[5] Nicht gerade erhellend für die Frage, inwiefern die Gemeinderätinnen mich und meine Mitbürger repräsentieren – oder die Parlamentarierinnen, gar die Regierungen auf Länder- und Bundesebene.
Also frage ich meine Gemeinderäte. Sie sagen mir, sie repräsentierten mich und all die andern Dörfler, indem sie uns eine Stimme gäben, indem sie für uns sprächen. Ich erwidere, das könne ich ja ganz gut selbst und bräuchte niemanden, der für mich spreche. Nach einem Augenblick des Innehaltens meint mein Repräsentant, es sei ja zwar so, dass jeder sprechen, sich so jedoch noch keineswegs Gehör verschaffen könne. Die Repräsentanten seien dazu da, den Stimmen, die in der Vielzahl der Stimmen leicht untergingen, also allen Stimmen der Bürger Gehör zu verschaffen. Und sie sprächen nicht nur für mich und all die anderen Dörfler. Sondern sie handelten auch. Sie entschieden in Abwägung aller Stimmen und Interessen, was nottue. Beschlössen die Anschaffung des Feuerwehrautos und die Ausweisung der Bauzone, die Errichtung des Spielplatzes und das Budget.
Wir alle könnten zwar sprechen, aber meist nicht vernehmlich genug, weshalb wir der Repräsentanten als Sprechverstärker bedürften. Und da nicht jeder für sich oder gar für andere zu entscheiden und zu handeln vermöge, seien die Repräsentanten nicht nur unsere Entscheidungshandlanger, sondern unsere Entscheidungsträger. Anstelle all der Bürgerinnen und Bürger entscheiden sie, was Sache sein soll – wie das Gemeinwesen zu gestalten ist. Weil wir sie gewählt haben.
Repräsentation heißt, für etwas zu stehen. Das tun wir alltäglich unentwegt, ohne zwingend dafür gewählt oder dazu mandatiert zu sein. Als Leserin oder Leser dieses Buches repräsentieren Sie jetzt gerade die Gruppe der Bildungsbürger; wenn Sie nachher Tennis spielen, dann werden Sie die Gruppe der Sportler repräsentieren; heute Abend an der Schule Ihrer Tochter die Gruppe der Eltern. In den ersten beiden Fällen bedeutet Repräsentation nicht mehr als Zugehörigkeit: Sie werden wegen des bloßen Bücherlesens kaum von Artenschützern als Repräsentant des aussterbenden Bildungsbürgertums in Gewahrsam genommen, und auch Reporterinnen werden sich kaum einstellen und sich um ein Interview mit Ihnen reißen, weil Sie im Tenniscourt eine ordentliche Leistung abliefern – es sei denn, Sie belegen einen der vorderen Plätze auf der Weltrangliste. Um die Gruppe der Sportler oder der Bildungsbürger über die einfache Gruppenzugehörigkeit hinaus zu repräsentieren, müssen besondere Leistungen oder eine besondere Mandatierung hinzukommen. Sie müssen, um öffentlich als „Repräsentant des Sportes“ zu gelten, nicht zwingend selbst sportlich aktiv sein. Es reicht, wenn Sie sich zum DFB-Präsidenten wählen lassen. Oder als „Repräsentant der Elternschaft“ zum Elternsprecher.
Gleitend sind die Übergänge zwischen bloßer Gruppenzugehörigkeit und einer allseits zugeschriebenen Repräsentativität für etwas. So sind Eltern zwar immer Eltern, Repräsentanten kinderhabender Lebewesen, aber sehr viel weniger intensiv und sichtbar, während sie Bücher lesen und die Kinder in der Schule weilen, als beim Elternabend, wo die Lehrer sie nicht als Geschäftsfrauen oder Hausmänner, sondern eben als Eltern ansprechen.
Weil wir vielem zugehören, repräsentieren wir vieles – in unterschiedlichem Grad. Und wir sind darauf angewiesen, dass andere etwas repräsentieren und von uns nicht oder nicht nur als unverwechselbare, einmalige Individuen wahrgenommen werden wollen. Die Ärztin, von der ich Genesung erhoffe, soll die Heilkunde repräsentieren, der Verkäufer, von dem ich meine Teigwaren kaufe, den Einzelhandel. Das soziale Gefüge ist ein Repräsentationsgeflecht. In ihm spielen wir selbst zahlreiche Rollen, repräsentieren auf unterschiedlichste Weise.
Dabei haben sich die Rollen im Prozess der Modernisierung offensichtlich vermehrt: Während vor 300 Jahren ein Fischer an der Nordsee gerade einmal Fischer, Ehegatte, Vater, Bruder, Kirchgänger und Untertan gewesen sein mag, übernimmt er heute unzählige weitere Rollen, zum Beispiel als Gewerkschafter, als Krankenkassenmitglied, als Fernsehzuschauer, als Rettungsschwimmer, als Lottospieler, als Staatsbürger. Moderne bedeutet Rollenvervielfältigung, weil Moderne Möglichkeitsvervielfältigung ist.
Das Wort Rolle legt womöglich nahe, dass es dahinter ein wahres Selbst gebe – das, was den Menschen eigentlich ausmache, der sich als Fischer, Ehegatte, Vater, Kirchgänger, Krankenkassenmitglied, Lottospieler oder Staatsbürger bloß eine Maske vor das Gesicht halte, um sein authentisches Sein vor neugierigen Blicken zu verbergen. Dem ist nicht so. Die Idee des wahren Selbst ist nichts weiter als eine Illusion, die zwar im Prozess der Modernisierung gern gegen Modernisierung in Anschlag gebracht wurde (etwa im 18. Jahrhundert bei Jean-Jacques Rousseau), aber der Realität des Beziehungswesens Mensch nicht gerecht wird. Was ich bin, bin ich im Austausch mit all dem, was mir entgegentritt – in Reaktion darauf, in Auseinandersetzung damit, in Aneignung dessen. Was selbst ist, bildet sich heraus in der Ausübung all der Rollen, die mir zuwachsen oder die ich mir zulege. Der Illusion des wahren Selbst kann ich getrost den Abschied geben.
Freilich zeigt nicht jede Rolle, die ich im Leben spiele, ein Repräsentationsverhältnis an. Ich kann in die Rolle des verschmähten Liebhabers oder des Wetterfühligen schlüpfen, ohne dadurch für andere oder anderes in die Pflicht genommen zu werden oder werden zu wollen. Von Repräsentation im engeren Sinne sprechen wir, wenn etwas oder jemand für eine Institution, eine Gruppe oder eine bestimmte Auffassung, eine Idee, einen „Wert“ steht. Repräsentation kann dann heißen, dass etwas Besonderes für etwas Allgemeines steht (ein Buch repräsentiert eine Idee), etwas Konkretes für etwas Abstraktes (eine Handlung repräsentiert einen „Wert“), etwas Kleineres für etwas Größeres (eine Kompanie repräsentiert die wehrhafte Nation). Oder ein Einzelner steht für eine Vielzahl von Personen.
Wer repräsentiert, soll das Wahre, Eigentliche des Repräsentierten wenn schon nicht vollständig abbilden, so doch nach Kräften verkörpern und darstellen. Das, worauf es ankommt. Doch worauf kommt es an? Im Falle des Verkäufers oder der Ärztin ist mir das klar: Er repräsentiert das Unternehmen, von dem ich etwas kaufen will, sie die Wissenschaft, von der ich meine Heilung erwarte. Wenn er mir das Produkt seines Unternehmens verkauft und sie mich nach den Regeln der Medizin behandelt, tun sie das, worauf es mir ankommt, auch wenn sie, als Einzelne, die für das Allgemeine stehen, nie alles verkörpern können, was das Unternehmen oder die Medizin ausmacht. Repräsentation als das Stehen für etwas ist stets defizitär, wenn das Kleinere für das Größere eintritt, die Einzelne für eine Vielzahl.
Worauf aber kommt es im Politischen an? Die politische Repräsentantin ist weder Verkäuferin noch Ärztin. Wofür steht sie, wenn ich ihr meine Stimme gebe, wenn sie an meiner Stelle im Parlament eine Rede hält? Die Politikwissenschaftlerin Hanna Fenichel Pitkin hat Repräsentation in einem allgemeinen Sinn verstanden wissen wollen als Präsent-Machen von etwas, was nicht buchstäblich oder tatsächlich präsent ist.[6] Sie unterscheidet politisch dann zwischen der „Standing-For“-Repräsentation und der „Acting-For“-Repräsentation. Im ersten Fall soll der, die oder das Repräsentierende „deskriptiv“ oder „symbolisch“ das Repräsentierte vergegenwärtigen – dann wäre beispielsweise das Parlament ein Miniaturabbild sämtlicher Bürgerinnen und Bürger oder des „Volkes“. Im zweiten Fall würde hingegen von solchen mimetischen Beziehungen abgesehen. Der, die oder das Repräsentierende ist dann nicht eine verkleinerte Kopie des oder der Repräsentierten, sondern steht vielmehr handelnd für sie ein, ficht also etwa im Parlament die Anliegen durch, von denen der Repräsentierende glaubt, sie müssten diejenigen der Repräsentierten sein. Politische Repräsentation sollte in diesem Fall die Stimmen und Interessen derjenigen in die politischen Prozesse einbringen, deren Stimmen und Interessen nicht ohnehin schon präsent sind.
Bringt man die zwei unterschiedlichen Formen der Repräsentation auf die Formel „Mikrokosmos-Modell“, nämlich „maßstabgetreues Abbild der Gesellschaft im Kleinen“, und „Anwalts-Modell“, nämlich Beauftragung der Parlamentarier durch die Stimmbürger, ihre Interessen wahrzunehmen,[7] werden die Schwierigkeiten unmittelbar augenfällig: Das Parlament als Abbild des Volkes ist eine Fiktion, und der Parlamentarier als Beauftragter der Wähler erfüllt keineswegs deren Mandat so wie eine Anwältin das tut, die keinen anderen Auftrag hat, als im gesetzlichen Rahmen das Interesse ihres Mandanten durchzusetzen. Man darf bezweifeln, dass die Anwaltsanalogie so funktionieren kann, wie die Politikwissenschaftlerin Nadia Urbinati es andeutet, indem sie politische Repräsentation zwar als „advocacy“ definiert – als Anwaltschaft, Fürsprache, Eintreten –, aber neben einer starken Bindung an die Wähleranliegen dem Repräsentanten ein autonomes Urteil zubilligt.[8] Anwaltschaft müsste doch wohl heißen, alles Erdenkliche zu tun, um diejenigen zu befriedigen, denen man sein Mandat verdankt. Das liefe auf das imperative Mandat eines Delegierten hinaus, der die Vorgaben der ihn Entsendenden erfüllen muss. Sein Urteilsvermögen kann er dazu einsetzen – wie jede gute Anwältin auch –, die besten Wege und heimlichsten Schliche zu finden, diese Vorgaben einzulösen.
Fundamentaleinwände gegen das „Anwalts-Modell“ hat eigentlich schon Edmund Burke am 3. November 1774 mit einer Rede an seine Wähler in Bristol zu Protokoll gegeben: „Parliament is not a congress of ambassadors from different and hostile interests; which interests each must maintain, as an agent and advocate, against other agents and advocates; but parliament is a deliberative assembly of one nation, with one interest, that of the whole; where, not local purposes, not local prejudices, ought to guide, but the general good.“[9] Entsprechend verwahrt sich der Abgeordnete Burke dagegen, nun im Parlament für die Partikularinteressen Bristols einzutreten; er sieht sich nur dem allgemeinen Guten verpflichtet – wobei er es sich selbst vorbehält, darüber zu entscheiden, worin dieses allgemeine Gute denn besteht. Das scheint auf einer Linie zu liegen mit der einschlägigen Bestimmung im Grundgesetz zu den „in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl“ zu wählenden Abgeordneten des Bundestages: „Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen.“[10]
Der hier aufgerufene Begriff der Vertretung hat für den Nichtjuristen allerdings eine beinahe mystische Dimension: Nicht das gesamte Parlament in seiner Vielköpfigkeit vertritt das ganze Volk, sondern „die Abgeordneten“ tun es – jede und jeder Einzelne ganz oder doch nur ein bisschen und erst alle gemeinsam ganz? Inwiefern vertritt die einzelne Parlamentarierin das ganze Volk?[11] Wer den sensus mysticus