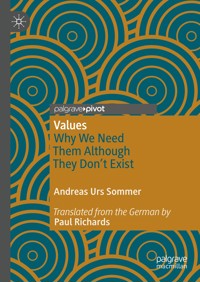Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nominiert für den »Tractatus«-Preis 2023 Ist der Krieg eine an sich verdammenswerte und von allen demokratisch geprägten Gesellschaften per se abzulehnende Angelegenheit? In seinem knappen, thesenstarken Buch zeigt Andreas Urs Sommer, dass Krieg und Demokratie sich nicht nur nicht ausschließen, sondern dass der Krieg als Chance der Selbstermündigung demokratischer Gesellschaften begriffen werden kann. Ein Buch, das nicht nur vor dem Hintergrund des aktuellen Ukrainekriegs von Bedeutung ist, sondern als ein wichtiger Debattenbeitrag zur geopolitischen »Zeitenwende« verstanden werden muss. Andreas Urs Sommers Streitschrift ist für den Tractatus 2023 nominiert worden. Prämiert werden damit herausragende Publikationen, die philosophische Fragen im weiteren Sinn ambitioniert und verständlich diskutieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Urs Sommer
Entscheide dich!
Der Krieg und die Demokratie
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2023
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: total italic Grafik Design Studio, Berlin
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft, Timisoara
ISBN Print 978-3-451-39437-9
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83005-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83013-6
Inhalt
Aufriss
Krieg ist Möglichkeitsvernichtung
Die Kultur moderner liberaler Demokratien ist eine Möglichkeitskultur
Möglichkeitsvernichtung im Krieg und Möglichkeitsvermehrung in der Demokratie
Der Krieg als Mittel autoritärer Staaten, den eigenen Möglichkeitsspielraum zu erweitern
Kann Krieg auch für Demokratien ein Mittel sein? (I)
Kann Krieg auch für Demokratien ein Mittel sein? (II)
Ist eine Armee mit ihrem Gehorsamszwang nicht unvereinbar mit Demokratie?
Sind Töten und Sich-töten-Lassen nicht unvereinbar mit Demokratie?
Ohnmachtserfahrung und direkt-demokratische Selbstermächtigung
Krieg als Partizipation – Mitbestimmung als Partizipation
Der Krieg kann neue Möglichkeiten erschließen
Demokratie, Neutralisierung und Entneutralisierung
Krieg ohne Zukunft. Ein Ausblick ins Jahr 2073
Nachwort
Anmerkungen
Über den Autor
Aufriss
„Wie stehen wir jetzt zueinander?“, will H. wissen, als er nach zwei Jahren Funkstille wieder einmal vor der Tür steht. Corona habe ihn, wie er sagt, ganz in Beschlag genommen, aber nicht die Krankheit selbst, sondern die nach seinem Dafürhalten völlig verfehlte Coronapolitik. Die Grundrechte würden systematisch abgebaut, Freiheit sei nur noch die Freiheit des Mainstreams, auf Verhaltens- und Meinungsabweichler einzudreschen. Wir hätten uns in einen „engen Meinungskorridor“ hineinzwingen lassen. In ihm würden Politik, Medien und Justiz gleichgeschaltet und kritische Geister drangsaliert. „Aufmerksamkeitslenkung“ diene dazu, die Menschen von dem abzulenken, worum es eigentlich in ihrem Leben gehe: Man male die Schrecken der Pandemie in grellsten Farben an die Wand und verhindere so, dass die Menschen sich mit dem beschäftigten, was wirklich nottue. Er, H., habe während der letzten beiden Jahre ununterbrochen mit der Analyse all der falschen Informationen verbracht, die über die an sich ziemlich harmlose Krankheit verbreitet worden seien. Jetzt aber habe er sich in eine „mentale Blockhütte“ zurückgezogen, in der er nichts mehr an sich heranlasse.
Wie stehen wir zueinander? Nun, sicher so, wie Menschen oft zueinander stehen – mit gegensätzlichen Meinungen, mit gegensätzlichen Sichtweisen auf das, was man die Wirklichkeit zu nennen pflegt. Manche Absurditäten abgerechnet, kam mir der Umgang der Berufspolitik mit der Pandemie hierzulande nicht grundsätzlich verkehrt vor; ich konnte keine abgründige Allianz des ökonomischen, des politischen und des medialen Komplexes zur Verdummung und Versklavung der Menschen ausmachen. Allerdings habe ich meine Zeit auch nicht damit zugebracht, den Zahlen, ihrer Interpretation und den daraus zu ziehenden praktischen Folgerungen besondere Beachtung zu schenken. Ich muss zugeben, dass ich in Coronaeinzelheiten viel schlechter informiert bin, als H. es war, bevor er sich in seine „mentale Blockhütte“ zurückgezogen hat.
Nun hätte ich es bei dieser Meinungsdissonanz bewenden lassen können. Aber die von H. angeprangerte „Aufmerksamkeitslenkung“ hing mir doch nach. Ohne ihm abzunehmen, dass die Pandemie eigens erfunden worden sei, um die Menschen dumm und unwissend zu halten, indem man sie nur noch mit (überdies unnützen) Informationen zu Corona vollstopft, konnte ich doch die monomanische mediale Fixierung auf das eine Thema während zweier langer Jahre nicht leugnen. Aber ich zögerte, diese „Aufmerksamkeitslenkung“ einem vereinten, verschwörerischen Willen verbandelter Eliten zuzuschreiben,[1] die die normalen Menschen auf den Holzweg führen wollen. So sehr ich mich anstrengte, konnte ich keine konzertierte Aktion, keine geplante Konvergenz der so unterschiedlichen Akteure in Medien, Politik, Wissenschaft, Kultur, Justiz und Ökonomie erkennen, in der Absicht, uns unserer Freiheit zu berauben.
Vielmehr entspringt die „Aufmerksamkeitslenkung“ doch wohl eher der Sachlogik dessen, was man „Medien“ nennt, ganz egal, ob es sich um „alte“ oder „neue“ handelt. Medien sind Aufmerksamkeitserzeugungs- und Aufmerksamkeitskanalisierungsmaschinen. Sie leben davon – und nur davon –, dass sie die Aufmerksamkeit ihrer Nutzerinnen und Nutzer zu gewinnen und zu bündeln verstehen. Bieten sie nichts, was mich zu fesseln vermag, blättere ich um, schalte ab, wische weiter. Eine Möglichkeit der Aufmerksamkeitsgenerierung und Aufmerksamkeitslenkung besteht darin, möglichst viel Unterschiedliches anzubieten, immer mit einem neuen Thema, einer neuen Sache zu locken. Da folgen dann auf einen Dachstuhlbrand im Fachwerkmusterdorf und auf einen dreisten Überfall am Bahnhof der Alligator im Badesee und die Pressekonferenz der Bundeswissenschaftsministerin. Das Problem dabei ist das Risiko, die Mediennutzer an die Konkurrenz zu verlieren, weil sie nach dem Dachstuhlbrand vielleicht keine Lust mehr auf den Überfall, den Alligator oder die Bundeswissenschaftsministerin haben. Algorithmen helfen bei digitalen Medien zwar, jeden Nutzer möglichst mit dem zu füttern, wofür er dem Netz bereits eine Neigung verraten hat. Aber als noch Erfolg versprechender hat sich in jüngster Zeit eine andere Möglichkeit der Aufmerksamkeitsgenerierung und Aufmerksamkeitslenkung erwiesen, nämlich die, möglichst nur etwas Bestimmtes, aber dies in allen Varianten und Verästelungen anzubieten. Sobald sich zeigt – etwa durch die Menge der digitalen Suchanfragen nach „Corona“ –, dass ein Thema das Potenzial hat, die Aufmerksamkeit der Nutzerschaft zu fesseln, wird alle medienmacherische Kompetenz in dieses Thema investiert. Gewöhnlich ebbt das Nutzerinteresse nach einer Weile wieder ab, aber im Falle von Corona ließ es sich sehr lange aufrechterhalten. Und zwar nicht nur, weil die Fokussierung Panik und damit verdoppelte Aufmerksamkeit versprach, sondern vor allem deshalb, weil eine interessante Wechselwirkung der medialen Sphäre mit der politischen Sphäre auftrat. Berufspolitiker, zunächst zögerlich, gehorchten der medialen Aufmerksamkeitslenkung und befeuerten sie durch all die erlassenen Maßnahmen.
In modernen liberalen Demokratien erwies sich Berufspolitik weitgehend als reagierend statt als agierend. Diese Demokratien verwandelten sich nicht in autoritäre Demokratien, wie manche Kritiker unkten, sondern sie erwiesen sich als das, was sie wohl schon längere Zeit insgeheim waren, nämlich Reaktionsdemokratien: Eine solche Demokratie ist reaktiv im Blick auf das, worauf die Aufmerksamkeit gerade gelenkt wird. Dass die Aufmerksamkeit aber hierauf oder darauf gelenkt wird, hat nichts mit dunklen Machenschaften zu tun, sondern nur damit, dass dasjenige zum beherrschenden Thema wird, was womöglich die noch größere Aufmerksamkeit generiert. Es ist also ein systemischer Defekt des medialen Komplexes, der zur strategischen Kurzatmigkeit und zur rein taktischen Orientierung der Berufspolitik führt. Sie ist von der medialen Aufmerksamkeitsmaschinerie ganz und gar abhängig – nicht nur bei der Themensetzung, sondern auch existenziell in ihrem eigenen Überleben: Nur wer Aufmerksamkeit gewinnt und behält, wird gewählt und wiedergewählt.
Nun haben bekanntlich seit dem 24. Februar 2022 die Aufmerksamkeitserzeugungs- und Aufmerksamkeitskanalisierungsmaschinen einen neuen, in ebenso raumgreifender Breite bearbeiteten Exklusivgegenstand erschlossen: Russlands Krieg gegen die Ukraine.
„Wie stehst du zum Krieg?“ Das ist die Frage, der auch lange nach Kriegsbeginn noch niemand entgehen kann. Zuerst einmal waren die Fachleute gefragt und jene, die gerne als solche gelten. Sie überboten sich gegenseitig mit Vorschlägen, was an geopolitischen, militärischen und ökonomischen Maßnahmen zu ergreifen wäre, um Russland – und mittelbar auch China – einzudämmen, soweit sie nicht, um weiteres Blutvergießen zu verhindern, der Ukraine anrieten, die Waffen zu strecken und den Russen zu geben, was sie anscheinend so inbrünstig haben wollen. Auf der einen Seite raten die Falken, erstens der Ukraine unbeschränkt schwere Waffen zu liefern, zweitens alle Exporte nach Russland zu verhindern, die unmittelbar oder mittelbar dem Militär zugutekommen könnten, drittens eine scharf bewachte neue NATO-Verteidigungslinie in Polen, im Baltikum und in den skandinavischen Ländern zu ziehen, viertens die sozialen Folgen der erwartbaren Energieknappheit hierzulande abzumildern, fünftens sich mittelfristig völlig unabhängig von fossiler Energie zu machen, sechstens China entschieden in die Schranken zu weisen.[2] Die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften fordert die Streichung der Zivilklauseln in vielen Hochschulgrundordnungen, einst erlassen zum Verbot aller nichtzivilen Forschung in rückblickend idyllisch anmutenden Zeiten, als noch niemand daran dachte, dass auf dem gegenwärtigen Stand der Menschheitsentwicklung ein vergleichsweise zivilisierter Staat zum Angriffskrieg übergehen könnte.[3]
Auf der anderen Seite werden die Tauben nicht müde, vor den möglichen Eskalationen zu warnen und zu betonen, dass es doch mit Blick auf den möglichen Dritten Weltkrieg allein vom russischen Präsidenten abhänge, von wann an er die Unterstützung der Ukraine durch die westlichen Staaten als Kriegseintritt bewerte.[4] Manche noch Taubenfüßigere vertraten schon in den ersten Wochen des Kriegs die Auffassung, nicht nur Waffenlieferungen des Westens seien verwerflich, weil sie die Auseinandersetzung unnötig verlängerten, sondern die Ukraine müsse schnellstens kapitulieren, um noch mehr Leid von der Zivilbevölkerung abzuhalten.[5]
In der anhaltenden Aufgeregtheit häufen sich auch die Peinlichkeitsmomente, weil die Routine bei der Bewältigung der gegebenen Situation den friedensverwöhnten Europäern fehlt: War man denn nicht eben noch davon ausgegangen, dass „es sich beim klassischen zwischenstaatlichen Krieg um ein historisches Auslaufmodell“[6] handle? Ein Beispiel für diese Peinlichkeitsmomente war die deutsche Haarspalterei darüber, ob man jetzt die „Ausrüstung“ oder die „Aufrüstung“ der Bundeswehr betreiben solle – anstatt zu erkunden, ob denn nicht vielleicht demokratische Bewaffnung in viel umfassenderem Sinne notwendig wäre. Oder die Gewissheit vieler sich medial aufplusternder Möchtegernakteure, mit ihrer jeweiligen Position unbedingt und allein im moralischen Recht zu sein.[7] Es ermüdet entsetzlich, wenn alle es sein wollen.
Wo immer man steht, bei all dem Geflatter von Tauben und Falken, muss man hierzulande – im Unterschied zur Ukraine – bisher nicht wirklich für seinen Standpunkt einstehen. Sondern man erteilt je nach eigenem Temperament und Geltungsdrang entweder denen, die für ihr Tun einstehen müssen, gute Ratschläge, oder man klärt die Mitmenschen, die ebenfalls davon entlastet sind, darüber auf, was denn moralisch oder politisch oder militärisch oder ökonomisch einzig und zwingend wahr sei. Die Aufmerksamkeitslenkung funktioniert so, dass wir uns alle nicht fragen, wie wir für das einstehen können, was wir sagen. Immerhin erklingt – jenseits der Frage, ob und in welcher Weise sich „der Westen“ am Krieg beteiligen sollte – da und dort durchaus auch Aufbruchsrhetorik: Verstehe man den Krieg als „Erkenntnisveränderer“, hätten „wir“ nun „auf einmal die Chance, eine neue freie Welt zu erschaffen, die sich von Silicon Valley bis Charkiw und von Feuerland bis zum Nordkap erstreckt“.[8] Aber wer ist dieses „Wir“, und was genau sollen wir tun? „Wir im alten Westen müssen zwar immer selbstkritisch sein, aber wir dürfen uns nicht selbst hassen.“[9] Nun ja, da mag sich jeder von uns bemühen – aber ob das hilft, ein weltweites Demokratienetz aufzuspannen? Sicher, es ist schön, wenn der Politikwissenschaftler weiter dazu rät, Freihandelsabkommen abzuschließen und die demokratischen Partner Asiens einzubeziehen. Aber mit dem, was „wir“ – Sie, du und ich – tun können, hat das nichts zu tun, solange „uns“ die Möglichkeit vorenthalten wird, wesentliche politische Sachentscheidungen selbst zu fällen.
Tauben und Falken einmal dahingestellt: Wie verhält sich die Eule der Minerva, wenn sie sich der Versuchung widersetzt, ihre Aufmerksamkeit der nächstmöglichen Beute zu schenken? Vielleicht wird sie finden, dass alles, was die Falken schreien und was die Tauben gurren, so ganz falsch nicht sei. Dass die Falken und die Tauben aber doch nur das Nahe- und Nächstliegende vor ihrem Schnabel hätten, sei freilich auch offensichtlich – gelenkte Aufmerksamkeit eben. So wichtig das Nahe- und Nächstliegende auch anmute: Das eigentliche Problem sei, was das alles mit uns, mit unserer Demokratie mache – und vor allem, was wir daraus machen, jenseits kalter Wohnzimmer im Winter und pazifistischer Scharmützel im Sommer.
Krieg erzeugt Selbstvergewisserungsdruck. Ein solcher Druck kann in Selbstbefragungsgesellschaften, die sich ihrer Überzeugungen und Werte nie definitiv sicher sind, heilsam sein. Er kann Fokussierungskraft geben. Der Selbstvergewisserungsdruck des Kriegs richtet sich im gegenwärtigen Fall zunächst eben auf das Naheliegende, nämlich darauf, dem Humanitätsanspruch zu genügen, den Kriegsflüchtlingen zu helfen. Die Frage „Wie stehst du zum Krieg?“ geht uns alle an. Und sie ist wesentlich auch eine Frage: „Wie stehen wir zueinander?“ Der Selbstvergewisserungsdruck erschüttert allerdings bald die Grundfesten. Mit situativen, taktischen Antworten ist da keine Erleichterung zu schaffen.
Die Aufmerksamkeitsmaschinerie lenkt unsere Blicke auf den Vordergrund und bindet den berufspolitischen Betrieb in bloßer Reaktivität. Er bleibt in kurzfristiger Taktik gefangen, anstatt eine langfristige Strategie auszuhecken. Die Aufgabe aber, eine Strategie für das zu entwickeln, was unsere Gesellschaft sein kann und sein soll, dürfen wir deshalb auch nicht den Berufspolitikerinnen und Berufspolitikern überlassen. Vielleicht ist es am besten, ihnen das Taktische, das Nächstliegende einzuräumen, damit wir alle – alle Bewohnerinnen und Bewohner der demokratischen Welthälfte – alle möglichen Strategien gemeinsam entwickeln – und zwar mit den Mitteln der direkt-partizipatorischen Demokratie.[10]
Die Frage „Wie stehst du zum Krieg?“ provoziert nicht nur Folgefragen wie: „Kannst du für den Krieg sein oder ihn doch zumindest als Mittel billigen, um die Demokratie zu schützen?“ Die Frage bohrt weiter in die Tiefe und zerstört die bequeme Aufmerksamkeitslenkung. Sie führt unerbittlich fort zu Fragen wie: „Wie hältst du es mit der Demokratie? Wie soll eine Demokratie aussehen, die sich um jeden Preis zu verteidigen lohnt? Kann der Krieg einer grundlegenden Erneuerung der Demokratie dienstbar gemacht werden?“
Das vorliegende Buch stellt diese Fragen – und stellt sie zu einem Zeitpunkt, zu dem noch niemand weiß, wie der Krieg Russlands gegen die Ukraine ausgehen wird. Vielleicht wissen Sie es in dem Augenblick, während Sie diese Zeilen lesen. Sehr gerne würde ich einen Satz aus Thomas Manns Radioansprache an die „Deutschen Hörer“ vom Juli 1942 auf Putin ummünzen können: „Hitlers Sieg ist ein leeres Wort: es gibt so etwas gar nicht, es liegt nicht im Bereich des Annehmbaren, Zulässigen, Denkbaren.“[11] Ich kann allerdings nicht ausschließen, dass die Hoffnungen der freien Welt trügen werden. Für die Niederlage der Ukraine, für einen russischen Sieg sind wir wenigstens zum Zeitpunkt der Niederschrift kaum gewappnet.
Dieses Buch ist auch geschrieben für den Fall, dass die Ukraine, dass Europa, dass wir im sogenannten freien Westen diesen Krieg verlieren. Dass es Putins Imperium gelingt, die Ukraine ganz oder zu großen Teilen einzuverleiben. So verlockend es ist: Es wäre nicht redlich, diese Möglichkeit zu verdrängen. Eine politisch-philosophische Antwort auf die Frage nach Krieg und Demokratie muss dieser Möglichkeit Rechnung tragen. Es geht hier also auch nicht nur um „diesen Krieg“ – sondern um jeden möglichen.
Demokratien können nur (kriegsun)wetterfest werden, wenn sie sich verändern. Wenn sie in der Lage sind, sich selbst so zu verändern, dass sie zu den Orten werden, an denen für alle Menschen die bestmöglichen Lebensbedingungen herrschen. Das wird dann erreichbar, wenn alle Menschen möglichst umfassend partizipieren können. Ziel muss es sein, die Demokratie so attraktiv zu machen, dass auf lange Sicht jede Autokratie der eigenen Zentrifugalkraft erliegt. Wie immer der Ukrainekrieg ausgeht: Die Demokratie muss ihre systemische Überlegenheit beweisen – indem sie stets im Prozess der Demokratisierung bleibt.
Auch dieses Buch betreibt Aufmerksamkeitslenkung: Welche Demokratie wollen wir gerade angesichts des Kriegs? Wir können stehen. Für uns selbst stehen. Und für die andern einstehen. Entscheide dich!
Krieg ist Möglichkeitsvernichtung
„Die Kriegsführung ist eine Kunst, eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende freie schöpferische Tätigkeit.“ So stand es in der „Truppenführung“ betitelten Heeresdruckvorschrift 300 der Reichswehr von 1933/34, einer maßgeblich vom damaligen Generalleutnant und nachmaligen Widerstandskämpfer gegen Hitler, Ludwig Beck (1880-1944), verfassten Handreichung. Beck hat in seinen späteren Betrachtungen über den Krieg diesen Satz zitiert und hinzugefügt: „Anderseits wird jedoch niemand ernstlich behaupten wollen, daß man einen Krieg planlos beginnen und führen könne.“[12] Beides empört heutige, lange friedensverwöhnte Leserinnen und Leser in westlich-liberalen Gesellschaften gleichermaßen: dass man Krieg als „Kunst“, als „schöpferische Tätigkeit“ meint verstehen zu dürfen und dass man Krieg nach einem strengen, rationalen Plan führen solle. Beides, Kunst und Vernunft, scheint vielen von uns mit Krieg vollständig unvereinbar.
Die Vorstellung, dass der Krieg eine Kunst sein solle, reicht freilich tief in die Geschichte der Menschheit zurück; sie findet sich ebenso im alten China, wo im 6. vorchristlichen Jahrhundert General Sunzi (ca. 544–496 v. Chr.) ein einschlägiges, bis heute viel gelesenes Buch zum Thema schrieb, wie im alten Europa bereits bei den Griechen.[13] Zwei Jahrtausende später versteht der Politiker und Philosoph Niccolò Machiavelli (1469–1527) in seinem 1513 entstandenen, erst 1532 postum veröffentlichten Principe den Krieg als wesentlichstes Hilfsmittel, um die Macht eines herrschenden oder nach Herrschaft strebenden Individuums zu steigern: „Ein Fürst soll also nichts anderes zum Gegenstand seines Nachdenkens machen und sich mit nichts anderem beschäftigen als mit dem Kriegswesen, den militärischen Einrichtungen und mit der militärischen Zucht; denn dies ist die einzige Kunst, die man von dem erwartet, der befiehlt. […] Die erste Ursache zum Verlust des Staates ist die Vernachlässigung dieser Kunst; und das Mittel, das dich einen Staat gewinnen lässt, ist, Meister dieser Kunst zu sein.“[14]
Folgt man diesem Paradigma des Kriegs, schafft sich jemand im Krieg, wenn er es gut macht und „Meister“ dieses Faches wird, eine machtvolle Fülle von Möglichkeiten. Versteht man die „Kriegsführung“ wie Beck als „freie schöpferische Tätigkeit“, dann nutzt sie nicht nur eine Bandbreite von Möglichkeiten – nämlich militärische Mittel, deren sich der gewiefte Taktiker zu bedienen weiß. Sondern sie schafft auch eine Fülle neuer Möglichkeiten, nämlich durch Siege und Eroberungen. Das lateinische Wort potentia steht für Macht und Möglichkeit gleichermaßen. Die Kriegsherren und Kriegskünstler waren und sind nach beidem lüstern.
Die Möglichkeits- und Machterweiterung, die der siegreiche Feldherr für sich verbuchen kann, geht freilich auf Kosten der Möglichkeiten und der Macht des jeweiligen Feindes. Zunächst beugt sich der besiegte Feldherr dem Joch der neuen Herrschaft, dann werden seine Truppen ihrer Waffen und schließlich sein Land seiner Freiheiten beraubt. Aber hätte sich ein einfacher Soldat der Reichswehr in der Losung wiedergefunden, „Kriegsführung“ sei eine „freie schöpferische Tätigkeit“? War er denn mehr als todgeweihtes Menschenmaterial, damit sich die hochmögenden Herren der Generalität schöpferisch frei entfalten konnten? War er mehr als Kanonenfutter?
Nun ließen sich durchaus auch in der Tradition alteuropäischer Kriegskunst Stimmen vernehmen, die der schöpferischen Entfesselung Einhalt gebieten wollten. In der ihm eigenen Nüchternheit hielt Friedrich II. von Preußen in seinem Militärischen Testament von 1768 fest: „Es geht mit der Kriegskunst wie mit allen Künsten. Sie ist bei rechtem Gebrauch nutzbringend und bei Mißbrauch verderblich. Ein Fürst, der aus Unruhe, Leichtsinn oder zügellosem Ehrgeiz Krieg führt, ist ebenso strafwürdig wie ein Richter, der mit dem Schwert der Gerechtigkeit einen Unschuldigen mordet. Gut ist jeder Krieg, der geführt wird, um das Ansehen des Staates aufrechtzuerhalten, seine Sicherheit zu wahren, den Bundesgenossen beizustehen oder einen ehrgeizigen Fürsten in Schranken zu halten, der auf Eroberungen sinnt, die Eurem Vorteil zuwiderlaufen.“[15] Versteht man Kunst, auch die des Kriegs, so, nämlich als Mittel und nicht als Zweck, muss sie sich stets fragen lassen, welches Gut mit ihr erreicht werden soll. Nach Friedrichs Aufzählung fallen die Selbstverwirklichung eines Herrschers, die Befriedigung seines persönlichen Ehrgeizes nicht unter die achtbaren Zwecke, zu denen vornehmlich defensive zählen. Ob sich Friedrich an die eigenen Maßgaben selbst gehalten hat, kann dahingestellt bleiben. Zumindest programmatisch ist jedenfalls sein Bemühen erkennbar, den rhetorisch als Kunst, Wissenschaft und Schöpfertum verklärten Krieg einzuhegen und seiner schlimmsten Auswüchse Herr zu werden.
Allerdings gibt es spätestens seit dem Humanismus Stimmen, die das Reden von „gerechtem“, „gerechtfertigtem Krieg“ und von Kriegführung als einer irgendwie achtbaren Kunst in Bausch und Bogen verwarfen. Die wohl hörbarste dieser Stimmen ist die des Humanisten Erasmus von Rotterdam (1469–1536), der die Göttin des Friedens, Pax, selbst auftreten und Klage darüber führen lässt, was man ihr und den Menschen in Kriegen alles angetan hat: Die 1517 erschienene Querela Pacis initiiert den europäischen Pazifismus,[16] bleibt indes mit ihrer rigorosen Verdammung des Kriegs in der lichten Sphären moralischer Überlegenheit, was sie politisch nicht recht anschlussfähig machte. Erasmus’ Werk verweigert sich dem bis dahin selbstverständlichen Hinnehmen des entweder als Naturnotwendigkeit oder als Erbsündenfolge gedachten Kriegs. Hatte man im Mittelalter eifrig darüber debattiert, unter welchen Umständen ein Krieg „gerecht“ sein könnte, aber ihn weder als Kunst noch als Mittel prinzipiell verworfen, so kündigt hingegen Erasmus oder seine Friedensfigur jegliches wohlwollende Verständnis dafür auf, dass überhaupt Krieg geführt wird. „Schon höre ich“, sagt die Friedensgöttin Pax, „was diejenigen zur Entschuldigung vorbringen, die darin zu ihrem eigenen Unheil so erfinderisch sind. Sie sagen, sie würden dazu gezwungen und würden ungern genug in den Krieg verwickelt. Aber reiße dir die Maske vom Gesicht, wasche die Schminke ab, gehe in dich, und du wirst sehen, dass dich Zorn, Ehrgeiz und Dummheit dahin getrieben haben und nicht die Notwendigkeit, es sei denn, dass du schließlich das als Notwendigkeit betrachtest, kein Gelüste unbefriedigt zu lassen.“[17] Es gehe beim Krieg doch nur darum, „dass alles um der Fürsten willen unternommen, aber zum Unheil des ganzen Volkes durchgeführt worden“ sei.[18] Und schließlich gibt sich die Göttin überzeugt: „Ein Friede kann nicht so ungerecht sein, dass er nicht auch dem ‚gerechtesten‘ Kriege vorzuziehen wäre.“[19] Von der landläufigen Dreiheit der Gründe zur Legitimation eines gerechten Kriegs, nämlich vom gerechten Grund (iusta causa), von der richtigen Absicht (recta intentio) und von der Autorität des Herrschers (auctoritas principis) ist bei Erasmus nichts zu sehen – wer, fragt er andernorts rhetorisch, halte denn nicht seinen eigenen Grund für gerecht?[20]
Gleich zu Beginn der Querela