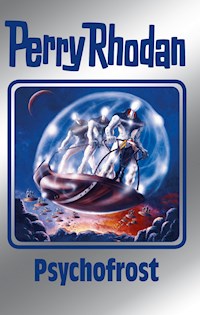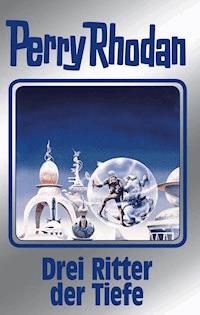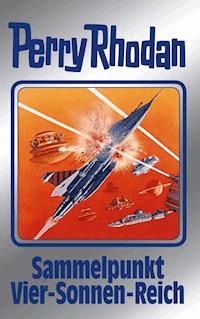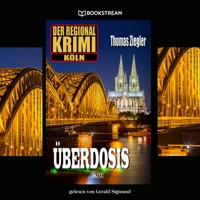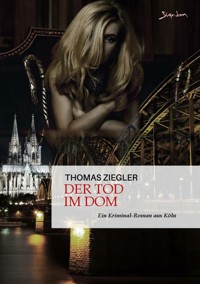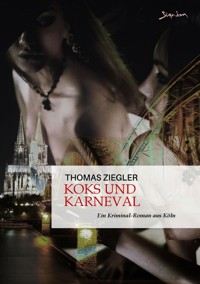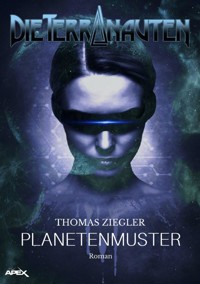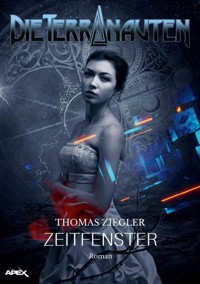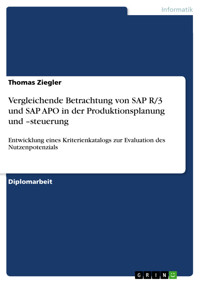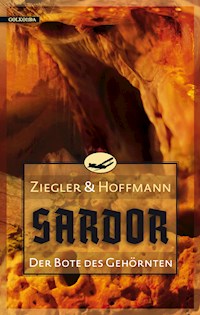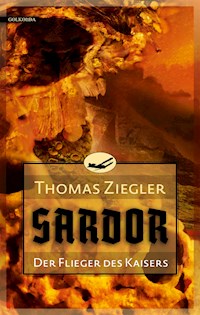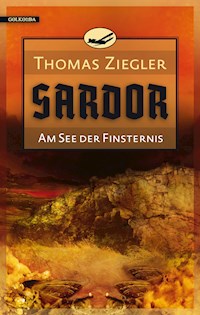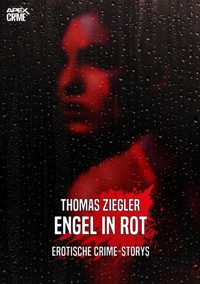6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Wir wollen den Holocaust ungeschehen machen«, sagte der mächtigste Mann des wiedervereinigten Deutschland. »Wir wollen das Leben der von den Nazis ermordeten sechs Millionen Juden durch ein Zeitexperiment retten.
Und Sie werden uns dabei helfen... «
Aber das ist EINE KLEINIGKEIT FÜR UNS REINKARNAUTEN...
Neben der im Jahr 1991 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichneten Titelnovelle enthält diese vollständig durchgesehene und von Christian Dörge farbig illustrierte Neu-Ausgabe drei weitere dystopische Zukunftsvisionen von Thomas Ziegler.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
THOMAS ZIEGLER
Eine Kleinigkeit für uns
Reinkarnauten
Erzählungen
Apex-Verlag
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Der Autor
Methusalem
Tief unten im Tal
Marie
Eine Kleinigkeit für uns Reinkarnauten
Das Buch
<"" id="anchor37" class="calibre1">
»Wir wollen den Holocaust ungeschehen machen«, sagte der mächtigste Mann des wiedervereinigten Deutschland. »Wir wollen das Leben der von den Nazis ermordeten sechs Millionen Juden durch ein Zeitexperiment retten.
Und Sie werden uns dabei helfen... «
Aber das ist EINE KLEINIGKEIT FÜR UNS REINKARNAUTEN...
Neben der im Jahr 1991 mit dem Kurd-Laßwitz-Preis ausgezeichneten Titelnovelle enthält diese vollständig durchgesehene und von Christian Dörge farbig illustrierte Neu-Ausgabe drei weitere dystopische Zukunftsvisionen von Thomas Ziegler.
Die Erstausgabe dieses Buches erschien im Jahr 1997 im Blitz-Verlag:
Der Autor
Thomas Ziegler.
(* 18. Dezember 1956, + 11. September 2004).
Thomas Ziegler war das Pseudonym des deutschen Schriftstellers, Übersetzers und Drehbuch-Autors Rainer Friedhelm Zubeil. Im Jahr 1977 debütierte er mit dem Dämonenkiller-Roman Eisvampire, welchen er unter dem Pseudonym Henry Quinn verfasste; dies Pseudonym nutzte er später auch für gemeinschaftliche Werke mit Uwe Anton und Ronald M. Hahn.
Mit Die Stimmen der Nacht gelang ihm ein einmaliges Kunststück: gleich zweimal erhielt er dafür den Kurd-Laßwitz-Preis - 1984 für die ursprüngliche Erzählung und 1994 für den daraus entstandenen Roman mit demselben Titel. Er schrieb in den 80er-Jahren für die Science-Fiction-Serien Die Terranauten (wiederum unter dem Pseudonym Robert Quint) und Perry Rhodan; bei beiden Serien war er zeitweise auch als Exposé-Autor verantwortlich und prägte diese nachhaltig. Darüber hinaus schuf er die Science-Fiction-Taschenbuchreihe Flaming Bess (neun Bände) sowie die mit zwei Bänden unvollständig gebliebene Fantasy-Serie Sardor. Der als Abschluss vorgesehene dritte Teil wurde als Fragment in Zieglers Nachlass gefunden. Die fehlenden Kapitel wurden von Markolf Hoffmann ergänzt und schließlich 2013 veröffentlicht.
Als herausragend gelten überdies seine SF-Story-Sammlungen Unter Tage (1982), Nur keine Angst vor der Zukunft (1985), Lichtjahrewelt (1986), Eine Kleinigkeit für uns Reinkarnauten (1998).
Neben Science Fiction schrieb er skurrile, vorwiegend im Kölner Raum angesiedelte Kriminalromane wie beispielsweise Überdosis (1988), Koks und Karneval (1990) und Tod im Dom (1991).
Als Übersetzer lag sein Schwerpunkt bei Science Fiction-Romanen sowie bei Kompendien und Sachbüchern zu Star Wars. Von besonderer Bedeutung sind seine zahlreichen Übersetzungen der Werke von Philip K. Dick: u.a. die Valis-Trilogie (bestehend aus Valis, Die Göttliche Invasion und Die Wiedergeburt des Timothy Archer), Eine Handvoll Dunkelheit, Planet für Durchgangsreisende, Die Konservierungsmaschine, Die Kriecher, Androiden und Menschen, Kosmische Puppen und andere Lebensformen, Warte auf das letzte Jahr.
Rainer Zubeil verstarb im September 2004 . Seinen literarischen Nachlass verwaltet der Schriftsteller Ronald M. Hahn.
Methusalem
In der Nacht hatten Unbekannte einen Elektrischen Maulwurf auf die Computerleitspur des Kölner Citytaxi-Netzes angesetzt, und gegen Morgen, als es dem Technischen Dienst endlich gelang, den Maulwurf aufzuspüren und mit einem gezielten elektromagnetischen Schockimpuls auszuschalten, waren vier Verteiler-Relais zerstört und große Teile der Südstadt ohne City-Anschluss.
Das sind die Nachrichten, die einem den Morgenkaffee versüßen, dachte Philip Jaumann verdrossen und schaltete über die Fernbedienung das Radio aus.
»Juniacs«, sagte Katrin. Mit zusammengekniffenen Augen bohrte sie ihr Messer in das ofenfrische Brötchen. »Ich gehe jede Wette ein, dass die Juniacs dahinterstecken. Genau wie in Berlin. Halbwüchsige Terroristen, die jeden umbringen, der älter als fünfzig ist.« Sie nickte bekräftigend und teilte das Brötchen mit chirurgischer Präzision. Es sah wie eine Hinrichtung aus.
Jaumann schauderte. Daran werde ich mich nie gewöhnen, durchfuhr es ihn. Nicht an diese allmorgendliche Hinrichtung des Backwerks. Zum Teufel, das kann kein Zufall sein. Es muss etwas zu bedeuten haben. Vielleicht ist Katrin krank. Unheilbar geisteskrank wie diese Junior-Aktivisten, für die jeder Rentner, jeder, der auch nur irgendwie alt aussieht, Freiwild ist...
»Warte nur ab«, fuhr Katrin düster fort. »Das mit dem Maulwurf ist erst der Anfang. Es ist wie in Berlin. In Berlin hat es auch mit Maulwurf-Anschlägen auf die Leitspuren der Automatentaxis begonnen, und später haben sie dann ein Krebsprogramm in den Zentralcomputer geschleust. Sechzehnjährige Hacker, die eine ganze Stadt lahmlegen! Und all die Toten! Gott, bin ich froh, dass wir keine Kinder haben. Stell dir vor, wir hätten eine derartige Bestie in unserem Haus großgezogen. Man weiß doch, was die Berliner Senioren mit den Eltern der Juniacs gemacht haben.«
Jaumann rührte in seinem Kaffee. »Unsinn«, sagte er. »Köln ist nicht Berlin. Es wird hier keine Wiederholung des Berliner Blutsonntags geben. Und noch liegen keine Beweise dafür vor, dass die Täter zu den Junior-Aktivisten gehören. Vielleicht waren es Technophobe; irgendwelche gemeingefährlichen Naturfreaks, die sich nicht mehr mit der Demontage von Taschenrechnern oder elektrischen Schmusetieren zufriedengeben wollten. Zum Teufel, in dieser Stadt wimmelt es doch von gelangweilten Irren, die nur auf eine Gelegenheit warten, ihre massenmörderische Pläne in die Tat umzusetzen.«
Er nippte am Kaffee und verbrühte sich die Zunge. Mit einer gemurmelten Verwünschung sah er zur Kaffeemaschine hinüber.
»Manchmal verstehe ich diese Technophoben«, knurrte er. »Manchmal verstehe ich sie wirklich. Diese verdammte Maschine. Immer ist der Kaffee zu heiß.«
»Es waren die Juniacs«, beharrte Katrin. Das Messer blitzte im Licht der Küchenlampe, als sie mit einer schwungvollen Bewegung ein Stück Butter aufspießte. »Die Südstadt ist ein Seniorenviertel. Dort wohnen nur Rentner und Pensionäre. Ganze Straßenzüge voller Greise. Und jeder weiß, dass die Citytaxis hauptsächlich von den Senioren benutzt werden.«
Sie bestrich das Brötchen mit Butter. »Warum auch nicht? Wenn ich fünfzig Freikilometer im Monat hätte, würde ich auch nicht mehr mit der Magnetbahn fahren. Ich würde mich auch direkt vor die Haustür kutschieren lassen. Dabei braucht man noch nicht einmal gebrechlich zu sein. Man muss nur seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert zu haben.« Sie verzog den Mund. »Wenn ich ein Junior-Aktivist wäre, ich würde mir für einen Anschlag die Südstadt aussuchen. Oder die Rheinterrassen. Gott, all diese alten Menschen, die an den Rheinterrassen mit dem wundervollen Blick auf den Fluß wohnen. Dabei haben die doch nichts von der Aussicht, oder? Die meisten sind doch blind. Oder so gut wie blind. Kurzsichtig und...«
»Sie tragen Brillen«, unterbrach Jaumann. »Kontaktlinsen. Transplantate. Manche von denen sehen mehr als du und ich zusammen.« Vorsichtig nippte er erneut an seinem Kaffee. Er verzog den Mund. Zu süß.
Ein hungriger Ausdruck trat in Katrins Augen, aber ihr Hunger galt nicht dem Brötchen, dessen knusprige, gebutterte Spitze soeben in ihrem Mund verschwand und von den Schneidezähnen geköpft wurde. »Vielleicht hat es Tote gegeben«, sagte sie kauend. »Wie in Berlin. Wie am Blutsonntag.«
»Nein.« Jaumann schüttelte den Kopf. »Dann hätten sie es in den Nachrichten gebracht. Du hast doch gehört: Nur ein Dutzend Unfälle mit geringen Sachschäden. Die Automatentaxis haben bei den ersten Störungen die Parkstreifen und Haltebuchten aufgesucht. Sie sind programmiert, bei irgendwelchen Zwischenfällen an den Straßenrand zu fahren. Was in Berlin passiert ist, kann sich in Köln nicht wiederholen. Selbst wenn der Zentralcomputer von einem Krebsprogramm lahmgelegt wird - unsere Citytaxis rasen nicht wie Geschosse aufeinander los. Sie fahren an den Straßenrand.«
Katrin kaute. Ihre Backenzähne mahlten knirschend aufeinander und zermalmten das Brötchen Stück für Stück. Jaumann hörte fasziniert zu. Es war ein obszönes Geräusch. Es erinnerte ihn an eine hydraulische Presse, unter der Knochen barsten. »Wie viele Menschen sind beim Berliner Massaker ums Leben gekommen?« fragte Katrin. »Hundert? Zweihundert?«
»Über zweihundert«, antwortete Philip Jaumann. »Keiner davon war jünger als sechzig. Es war schrecklich. Das Krebsprogramm hat den Zentralcomputer völlig durcheinandergebracht. Jedes zweite Automatentaxi scherte auf die Gegenspur aus. Die Perversion des Reißverschlußprinzips. Sie sind zu Dutzenden aufeinander zugerast. Kamikaze. Wie diese verrückten japanischen Flieger im Zweiten Weltkrieg. Und ohne das rasche Eingreifen der Techniker hätte es noch mehr Tote gegeben. Aber das eingeschleuste Programm haben sie bis heute nicht eliminieren können.«
Jaumann schnaubte.
»Jedesmal, wenn sie glauben, das verdammte Ding endlich gelöscht zu haben, baut sich das Krebsprogramm von neuem auf. Eine teuflische Sache. Die gesamte Software ist ruiniert.«
Katrin senkte Brötchen und Messer.
Sie sah ihren Mann an, und plötzlich waren ihre Augen groß und furchtsam.
»Und wenn so etwas doch hier in Köln passiert, Philip?« fragte sie. »Was ist, wenn diese verdammten Juniacs auch unseren Verkehrscomputer mit einem Krebsprogramm verseuchen? Ich meine « - das Messer fuhr hoch, zerschnitt blitzend die Luft - »ich meine, dann sind wir doch alle in Gefahr. Nicht nur die Alten.«
»Seit Berlin hat man dazugelernt«, sagte Jaumann. Er ließ das Messer nicht aus den Augen. »Die Sicherungen sind so gut wie perfekt. Außerdem sind die Jugendlichen hier in Köln weniger radikal. Wir sind keine Greisenstadt wie Berlin. Bei uns besteht die Bevölkerung nicht zu siebzig Prozent aus Rentnern. Wir liegen bei knapp vierzig Prozent. Das ist schon ein Unterschied. Wirklich. Das macht verdammt viel aus.«
*
Der Vormittag war grau und regnerisch, und erst gegen elf Uhr riß die Wolkendecke auf. Jaumann dämpfte die Lichtgardine des Küchenfensters und sah hinunter auf den Innenhof. Da kam es. Er hatte es erwartet. Das Kind.
Das Kind war vier oder fünf Jahre alt und es gehörte den Sobrowskys vom Haus gegenüber. Es hatte blondes, kurzgeschnittenes Haar. Es war ein stilles Kind.
Aber, dachte Jaumann, das beweist nichts. Schließlich ist es das einzige Kind in der ganzen Straße. Ihm bleibt keine andere Wahl als still zu sein.
Das Kind trug Stiefel, Thermaloverall und einen AntiSchmutz-Anorak, leuchtend blau wie der genmanipulierte Rasen, der die eine Hälfte des Hofes einnahm. Auf der anderen Hälfte - weitab von den Bänken und Tischen, an denen sich bei schönem Wetter die Senioren der angrenzenden Häuser versammelten und die welke, runzlige Haut der Sonne aussetzen - stand wie ein Fossil die Kunststoffrutsche neben einem plastikumrandeten Sandkasten von der Größe einer Besenkammer. Der Sandkasten war abgedeckt, die Abdeckung zugeschraubt.
»Es ist schön, in einem Haus zu wohnen, das ein Herz für Kinder hat«, murmelte Jaumann.
Im Wohnzimmer mäßigte sich das Dröhnen der TV-Wand. »Was hast du gesagt?« rief Katrin durch die halb geöffnete Tür.
»Das Kind.« Jaumann hob seine Stimme. »Das Kind ist wieder da.« Er sah aus dem Fenster. Das Kind hatte sich der Rutschbahn auf halbem Weg genähert. Es hätte die Abkürzung über den Rasen nehmen können, aber es war zu klug, dieses Risiko einzugehen. Jaumann lächelte schmal. Ja, es hatte dazugelernt. Es war ein raffiniertes kleines Luder...
Er hörte Schritte. Dann blies ihm Katrin ihren warmen Pfefferminzlikör-Atem in den Nacken. »Das gefällt mir nicht - diese Hartnäckigkeit«, zischte sie. »Das gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Kind ist mir unheimlich.«
Jaumann starrte nach draußen, schüttelte den Kopf. »Ich möchte wissen, warum sie nicht am Stadtrand geblieben sind. Bei den anderen.« Eine steile Falte erschien auf seiner Stirn. »Da gibt es Leute, die haben sogar drei Kinder.«
»Kinder, die so hartnäckig sind«, sagte Katrin, »können gar nicht anders. Solche Kinder werden automatisch zu Juniacs. Es liegt ihnen im Blut. Es gefallt ihnen, alte Leute zu quälen.«
Jaumann dämpfte die Lichtgardine um weitere fünfzig Watt, um besser sehen zu können. »Einfach verantwortungslos. Ich möchte wissen, was sich die Eltern dabei gedacht haben. Zum Teufel, warum sind sie nicht am Stadtrand geblieben? Warum hat man sie überhaupt einziehen lassen? Sie stören hier nur.«
»Kleine Kinder und alte Leute«, sagte Katrin. »Dafür arbeiten wir. Um den einen die Rente und den anderen das Kindergeld zu finanzieren.«
Jaumann schwieg. Das Kind hatte inzwischen die Rutschbahn erreicht. Es blieb stehen, klein und leuchtend blau, und Jaumann fragte sich plötzlich, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Im Sommer, dachte er. Im Sommer werden wir es erfahren. Dann werden wir sehen, ob es Röcke oder Hosen trägt. Aber vielleicht wohnen die Sobrowsky im Sommer gar nicht mehr hier.
Der Kopf des Kindes, halb von der Anorak-Kapuze verhüllt, drehte sich forschend hin und her. Es schien die Fenster zu beobachten, die gleißenden Rechtecke der Lichtgardinen. Als es nichts sah, hob es einen Fuß. Der Fuß näherte sich der untersten Leitersprosse der Rutschbahn.
»Jetzt«, sagte Jaumann. Er hielt den Atem an. Er wusste, was geschehen würde, und dann geschah es. Im gegenüberliegenden Haus, im dritten, im vierten, im fünften Stock, erloschen die Lichtgardinen und die Fenster wurden aufgerissen. Wie zornige,
graue Krähen steckten die Rentner die Köpfe hinaus. Weitere Gardinen erloschen, weitere Fenster öffneten sich, weitere Krähen reckten die Köpfe. Kalt starrten ihre Knopfaugen in die Tiefe, auf das Kind.
Das Kind bewegte sich nicht. Es stand da, den Fuß noch immer erhoben, erstarrt unter den Krähenblicken. Die alten Köpfe wackelten hin und her. Sie verständigte sich stumm. Die Drohung wuchs.
»Sie haben darauf gewartet«, flüsterte Katrin. Jaumann sah, dass ihre Wangen glühten. Ihr Flüstern klang heiser. Erregt. »Sie haben auf diesen Moment gewartet. Sie Hassen das Kind.«
»Sie hätten am Stadtrand bleiben sollen«, wiederholte Jaumann, »die Sobrowskys. Sie müssen verrückt sein, ausgerechnet in unser Viertel zu ziehen.«
In dieser Sekunde hob das Kind den Kopf und schien direkt zu ihm hinauf zu schauen. Das Gesicht war ein kleiner weißer, ovaler Fleck im grauen Vormittagslicht. Fast schuldbewusst wich Jaumann zurück. Dann drehte sich das Kind um und ging langsam über den Kiesweg zurück zum Haus. Eine Tür schlug. Der Hof war wieder leer. Die Krähen nickten in grimmiger Befriedigung. Die Fenster schlossen sich, die Lichtgardinen leuchteten auf.
»Ja«, sagte Katrin, »es wird ein Juniac. In zehn oder fünfzehn Jahren wird aus diesem Kind ein verdammter Junior-Aktivist, und dann sind wir die Alten. Es wird uns Hassen. Es wird sich an uns erinnern. Wahrscheinlich notiert es schon jetzt die Namen der Hausbewohner, um sich später zu rächen, und unsere Namen werden an erster Stelle stehen. Ich fühle es. Ich weiß es. Das Kind macht mir Angst, Philip.«
Jaumann starrte sie an. »Angst?« wiederholte er. »Aber es ist noch ein Kind. Nur ein Kind.«
Katrin wandte sich ab. »Es wird älter werden. Genau wie wir.«
»Das Kind tut mir leid«, sagte Jaumann leise.
Katrin lachte. Ihr Lachen blitzte wie das Frühstücksmesser. »Du bist eben sentimental, Philip. Hoffnungslos sentimental.«
Am Nachmittag liebten sie sich. Der Regen prasselte gegen das Fenster, und Donner stieg polternd vom Himmel herab, und bei jedem Donnerschlag drang Jaumann tief in Katrin ein. Naturgewaltig, dachte er, schwitzend und keuchend, und er rieb sich an ihrer Haut, und ihre Haut war glatt und ihre Brüste waren straff, und er dachte: Sie ist noch so jung. Sie ist erst fünfundvierzig. Er sah sie an, während er sich über ihr hob und senkte, und wie immer, wenn sie miteinander schliefen, hatte sie die Augen geschlossen und ihr Gesicht war verzerrt, wie im Schmerz. Er hielt inne.
»Was ist?« fragte Katrin. »Warum machst du nicht weiter? Was ist los?« Aber sie hielt die Augen geschlossen.
»Ich dachte gerade«, sagte er, »ich habe mich gerade gefragt, wie es sein wird, wenn wir sechzig sind. Oder siebzig... Ich meine, werden wir es dann immer noch tun? Die Senioren«, sagte er, »tun sie es? Wie wir? Schlafen sie miteinander wie wir?«
Katrin blinzelte. »Was soll das? Was ist los mit dir? Was redest du da?« Es war lächerlich. Er wusste, dass es lächerlich war, jetzt, in diesem Augenblick, eine derartige Frage zu stellen, doch gleichzeitig spürte er, dass diese Frage wichtig war. »Wie ist der Sex im Alter? Greisensex. Wie wird das sein? Was fühlen wir, wenn wir uns lieben und wenn unsere Haut faltig ist? Wenn deine Brüste« - er stützte sich auf einen Ellbogen, umfasste mit der Hand die Wölbung ihrer linken Brust - »wenn deine Brüste schlaff sind. Wenn sie alt sind. Runzlig.«
»Großer Gott!« Sie starrte ihn an, ungläubig, schockiert, und dann stieß sie ihn fort, rollte sich auf die Seite und zog die Decke über ihre Brüste, zog sie hoch bis zum Hals. »Großer Gott! Du musst den Verstand verloren haben!«
»Wir könnten neunzig werden«, sagte er. Die Worte kamen von ganz allein. Er sprach wie unter einem inneren Zwang. Es war absurd. »Oder hundert. Viele Leute werden heute schon hundert Jahre alt, Verdammt, über ein Drittel der Bevölkerung besteht aus Rentnern. Die Menschen werden immer älter und älter, es gibt immer und immer mehr alte Menschen. Mit ein wenig Glück haben wir noch sechzig oder achtzig Jahre vor uns. Achtzig Jahre! Zum Teufel, das sind fast... das sind fast dreißigtausend Nächte! Was werden wir in diesen Nächten tun? Und was tun die anderen in all den Nächten? Was treiben diese alten Hexen und diese Greise vom Haus gegenüber in den Nächten?«
»Du musst den Verstand verloren haben!« Katrin sah ihn noch immer mit diesem ungläubigen, schockierten Gesichtsausdruck an.
»Ich habe gehört, dass die Lust nicht nachlässt«, sagte Jaumann. »Bei den Frauen. Sie lässt bei den Frauen nicht nach. Selbst im hohen Alter nicht. Bei uns Männern ist es anders. Organisch, verstehst du? Organisch. Altersimpotenz! Prostata! Kreislauf! Blutgefäße!« Er sprach jetzt zu laut.
Warum ereifere ich mich so? fragte er sich. Was rede ich da? Was ist los mit mir? Was? »Aber die Frauen. Was ist mit den Frauen, mit all den Millionen und Abermillionen alten Frauen? Sie müssen doch irgend etwas tun. Sie hören doch nicht auf, wenn sie sechzig sind. Oder? Hören sie auf? Hören sie einfach auf? Oder nehmen sie sich junge Männer? Gibt es Bordelle für all diese Millionen alten Frauen mit ihrer alten Haut und ihren alten Brüsten; Bordelle, wo Männer auf diese alten Frauen warten? Junge Männer? Juniacs? Ist das der Grund für den Hass der Jungen auf die Alten? Fühlen sie sich missbraucht? Ist es das? Ist es das?«
Katrin sprang auf. Sie war blass. Sie griff nach ihrem Morgenrock und zog ihn hastig an. »Das genügt, Philip«, sagte sie. »Es genügt. Gott! Du bist krank. Das ist es. Du bist krank. Wir schlafen miteinander, und du denkst an diese schmutzigen Dinge.« Das Fieber wich. Er war verwirrt. »Schmutzig? Wieso schmutzig? Was ist daran schmutzig? Ich verstehe das nicht. Was hast du?«
»Du bist pervers«, sagte Katrin. Sie nickte. Sie wurde rot. »Pervers. Großer Gott! Mein Mann ist ein gottverdammter Perverser!«
Es donnerte, und mit dem Donnerschlag fiel die Schlafzimmertür ins schloss. Jaumann lag da, auf dem Bett, das noch warm war von Katrins Körper, und er fragte sich, was er falsch gemacht hatte.
Angst, sagte er sich. Sie hat Angst. Vor dem Alter. Vor dem Altwerden, den Falten und Runzeln. Deshalb will sie nichts davon hören. Sie hat schreckliche Angst, aber sie kann der Wahrheit nicht entfliehen. Wenn sie aus dem Fenster sieht, wenn sie auf die Straße geht - Spiegelbilder. Wir alle sehen unsere Spiegelbilder auf den Straßen. Mit unseren Augen reisen wir in unsere persönliche Zukunft. Mit den Augen sehen wir all diese alten Menschen, diese furchtbaren Spiegelbilder unserer Zukunft: Greise, die uns so grausam an das erinnern, was aus uns werden wird. Er dachte an das Kind. Er fröstelte.
*
In den Abendnachrichten wurden Unruhen in der Südstadt und Rentnerdemonstrationen an den Rheinterrassen gemeldet. Die Panther und die Seniorenpartei riefen für den nächsten Tag zu einem Schweigemarsch zu den Familiensiedlungen am Stadtrand auf, und der Kölner Polizeipräsident warnte im Bürgerkanal des kommunalen Fernsehens vor einer Eskalation des Konflikts. Noch immer gab es keine Beweise dafür, dass Juniacs für den Anschlag auf das Citytaxi-Netz verantwortlich waren, aber angeblich wurden alle Kölner unter Dreißig von den Fahndungscomputern überprüft. Gerüchte. Die ganze Stadt war eine einzige Gerüchteküche.
»Vielleicht waren es in Wirklichkeit die Panther«, sagte Jaumann. »Radikale Rentner, die die Spannungen anheizen wollen. In Berlin hat man nach dem Blutsonntag eine Bannmeile um die Seniorenviertel gelegt. Man hat den Jugendlichen das Betreten ganzer Stadtteile verboten. Vielleicht wollen die Panther das auch in Köln erreichen. Das ist doch denkbar, oder?«
Er sah Katrin an. Seine Frau lag im Körperformsessel des Wohnzimmers, hielt in der einen Hand ein Glas mit grünem Pfefferminzlikör und kraulte mit der anderen das elektrische Schmusetier: Katzenfell und Rehaugen. Das Schmusetier schnurrte. Jaumann schaltete die TV-Wand aus, und der Nachrichtensprecher verschwand in einer schwarzen Implosion. Katrin drehte den Kopf.
»Du redest wie ein verdammter Junior-Aktivist«, beschuldigte sie ihn. »Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Schau dich doch an! Du bist fünfundvierzig! Dir fallen die Haare aus, du bekommst Falten, einen Bauch. Du wirst alt. Wenn dich diese halbwüchsigen Terroristen allein auf der Straße erwischen, bringen sie dich um. Und du verteidigst sie noch!«
Jaumann schwieg. Sein Blick wanderte zum Fenster. Die Lichtgardine war ein diffuser Schleier, und durch den Schleier glitzerten die Lichter der Stadt, und oben am dunklen Himmel glühte rot wie ein Kohlenfeuer ein Hologramm des Kölner Doms.
Katrin horchte. »Was ist das?« Von der Straße drang Lärm. Wildes Geschrei. Heisere Stimmen wie krächzende Krähen. Jaumann fuhr zusammen.
»Großer Gott!« flüsterte Katrin. »Es wird doch nichts passiert sein, oder? Die Juniacs werden doch nicht...«
Jaumann war mit vier großen Schritten beim Wohnzimmerfenster. Er drehte am Regulator der Lichtgardine und spähte hinunter auf die Straße. Im gedämpften Schein der Straßenlaternen warfen die Bäume drohende Schatten. Die Fenster der gegenüberliegenden Häuser waren geöffnet. Graue Köpfe zeichneten sich wie Scherenschnitte gegen die hellen Rechtecke ab. Haustüren standen weit offen, und aus ihnen strömten lärmende, gestikulierende Gestalten. Die Straße war voller alter Menschen. Stöcke wurden geschwenkt, knochige Fäuste geschüttelt. Die Schreie verrieten Hass - und Furcht. Hysterie, dachte Jaumann.
»Was ist?« stieß Katrin hervor. Sie klammerte sich an seinen Arm und starrte auf die wogende, Hasserfüllte Menge. »Was ist los, Philip?«
Jaumann zuckte die Schulter. »Ich weiß es nicht. Es ist nichts zu sehen. Es ist zu dunkel.«
»Das Kind«, sagte Katrin plötzlich. Ein böser Zug entstand um ihren Mund. »Es ist das Kind. Es hat irgend etwas angestellt.« Sie atmete schwer. »Vielleicht hat es Feuer gelegt. Bestimmt hat es irgend etwas in Brand gesteckt. Ich wusste es! In diesem Kind steckt der Teufel!«
»Unsinn«, wies Jaumann sie barsch zurecht. »Das ist eine fixe Idee von dir.«
Er wandte sich ab. Katrin hielt ihn fest. »Wo willst du hin?«
»Nach draußen«, sagte er. »Auf die Straße. Ich werde nachsehen, was passiert ist.«
Katrin lief an ihm vorbei. »Ich komme mit. Ich bleibe nicht allein in dieser Wohnung. Nicht, wenn dieses mörderische Kind in der Nacht herumschleicht und Feuer legt.« Jaumann verzichtete auf eine Erwiderung.
Mit einem leisen Seufzer ging er in den Korridor, streifte hastig Schuhe und Mantel über und folgte ihr dann nach draußen. Im Treppenhaus war es seltsam still. Ihre Schritte hallten, als sie zum Aufzug hasteten, und Jaumann sah sich schuldbewusst um. Aber die Türen blieben verschlossen. Kein Rentner kam heraus geschlurft, um sich über den Lärm zu beschweren. Wahrscheinlich waren sie alle draußen auf der Straße. Vor dem Aufzug blieb Katrin plötzlich stehen. Im Neonlicht der Treppenhausbeleuchtung war ihr Gesicht kalkweiß.
»Wir sollten die Treppe nehmen«, flüsterte sie. »Der Aufzug... Es ist so leicht, den Aufzug lahmzulegen. Wir könnten steckenbleiben, und dieses Kind...«
Jaumann fluchte und hieb mit der Faust auf den Rufknopf. »Nun ist es aber genug«, fauchte er. »Hör endlich mit diesem Unsinn auf!«