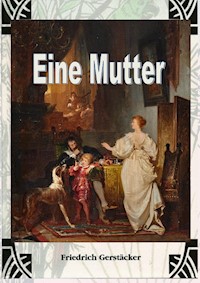
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor führt das Schicksal der Personen aus dem Roman 'Eine Colonie' fort. Das frisch verheiratete Paar Helene und Felix kehrt aus Brasilien nach Deutschland zurück, um das Geheimnis der wahren Herkunft Helenes zu lüften. Ihr Mann, Graf Felix von Rottack, vermutet, dass sie ein außerehelich geborenes Kind der Gräfin Monford ist. Aber bei der Konfrontation mit den Beweisen streitet die Gräfin alles ab und erkennt ihr Kind nicht an. Der ebenfalls aus Brasilien zurückgekehrte Jeremias sucht indessen nach seiner geschiedenen Frau und Tochter, die er im Elend und krank findet. Der junge Schauspieler Rebe kann sich kaum am Theater gegen seinen größten Widersacher behaupten - und liebt die Tochter von Jeremias. Und schließlich ist da noch der alte, geheimnisvolle Maulwurffänger, dessen Geheimnis erst auf dem Sterbelager gelüftet wird... Diesmal also statt exotischer Plätze eine spannende und durchaus abenteuerliche Familiengeschichte, die in Deutschland spielt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 794
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gesammelte Schriften
von
Friedrich Gerstäcker.
Eine Mutter.
Roman
im Anschluss an ‚die Colonie‘
Volks- und Familien-Ausgabe, Zweite Serie
Band 1 der Ausgabe Hermann Costenoble, Jena
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Ungekürzte Ausgabe nach der von Friedrich Gerstäcker für die Gesammelten Schriften,
H. Costenoble Verlag, Jena, eingerichteten Ausgabe „letzter Hand“, herausgegeben von Thomas Ostwald für die Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V., Braunschweig
Hinweis: Die im 19. Jahrhundert verfassten Texte Friedrich Gerstäckers enthalten Bezeichnungen, die heute nicht mehr in dieser Form verwendet werden.
In dieser unbearbeiteten Werkausgabe wurden sie unverändert übernommen.
Ausgabe letzter Hand, ungekürzt, mit den Seitenzahlen der Vorlage
Gefördert durch die Richard-Borek-Stiftung und Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz
Friedrich-Gerstäcker-Gesellschaft e.V. und Edition Corsar, Braunschweig, 2021
Geschäftsstelle: Am Uhlenbusch 17, 38108 Braunschweig
Alle Rechte vorbehalten! © 2016 / © 2022
1. Fürchtegott Pfeffer.
Ein gar reges und geräuschvolles Leben und Treiben erfüllte heute die überhaupt nicht unbedeutende und besonders viel von Fremden besuchte Provinzialstadt Haßburg.
Schon die Lage des alten Ortes war eine reizende, und eine große Zahl von wohlhabenden Leuten hatte sich deshalb sogar in oder nahe bei der Stadt bleibend niedergelassen, so dass sie mit ihren freundlichen Villen und Wohnhäusern die Anlagen wie die Hänge der daran stoßenden Hügelkette bunt und prächtig überstreuten.
Heute füllte aber noch eine ganz besondere Veranlassung sowohl die engen und etwas winkeligen Straßen des Weichbildes, wie auch die Anlagen und freien Plätze mit einer Unzahl geputzter Menschen, denn es war Jahrmarkt wie zugleich Haßburger Vogelschießen, wozu sich dann natürlich du ganze Nachbarschaft herbeidrängte. Besonders die Bauern kamen in hellen Schwärmen zu Markt gezogen, und in der Hauptverbindungsstraßen wimmelte es wie bei einer Völkerwanderung.
Unmittelbar vor der Stadt, auf einem großen freien Platz, der sogenannten „Schützenwiese," stand denn auch eine große Zahl von Buden aufgeschlagen, während dicht daneben in einem niedrigen, langen Gebäude die ‚Altschützen‘ auf ver/
2/schiedenen Ständen unermüdlich nach ihren dahinter aufgestellten Scheiben knallten.
Der Verkehr war hier draußen auch der stärkste, wenngleich selbst die innere Stadt nicht von Buden verschont geblieben war, und während eine Zahl von Drehorgeln mit ihren grausig gemalten Mordgeschichten, böhmischen Musikbanden, Gymnastikern in schmutzig-weißen, phantastischen Anzügen, und anderen Messkünstlern geringeren Grades die Promenaden überschwemmten, sammelte sich hier das Volk besonders, und oft wurde selbst die Passage durch die verschiedenen Aufzüge für kurze Zeit gehemmt und unterbrochen.
An diesen Teil der Promenade stieß übrigens unmittelbar die Stadt, mit ihren hohen, schmalen, gedrängten Häusermassen, und während die Front der hier sichtbaren Reihe in eine enge, dumpfige Straße hinaussah und auch dort ihren Haupteingang hatte, genossen die Wohnungen der Hintergebäude (so eingeschränkt die Mietsleute dort auch vielleicht wohnen mussten) doch wenigstens freie Aussicht auf grüne Bäume und blauen Himmel und jetzt auch, als Zugabe, auf das ganze wilde Gedränge des Markttrubels, der unmittelbar vor ihren Fenstern auf und ab wogte.
In der zweiten Etage eines dieser schmalen Gebäude wohnte der am Haßburger Theater angestellte Komiker Fürchtegott Pfeffer mit seiner Schwester und deren achtzehnjähriger Tochter Henriette in einem kleinen und sehr beschränkten Logis. Aber ebenso klein und beschränkt war auch seine Gage, und Pfeffer, wenn auch sonst ein wunderlicher und exzentrischer Kauz, doch ein ziemlich guter Haushalter und - sonderbarerweise - fast der Einzige oder doch einer der Wenigen vom ganzen Theaterpersonal, der in Haßburg keine Schulden hatte.
Das ganze Logis bestand nur aus zwei nebeneinander liegenden Stuben, jede mit einem kleinen Alkoven versehen, dann einer etwas engen und nur notdürftig erleuchteten Küche und einer kleinen Holzkammer.
Die eine Stube hatte Pfeffer selber zum Studirr- und Wohnzimmer inne, in dem daran stoßenden Alkoven schlief er. In dem anderen Zimmer wohnten Mutter und Tochter, und /3/ es wäre kaum möglich gewesen, sich zwei sonst ganz gleiche Räumlichkeiten verschiedener zu denken, als diese zwei sich zeigten.
Das Zimmer der Frauen glich einer Puppenstube. Die allerdings sehr zerwaschenen Gardinen waren schneeweiß; ebenso der sorgsam gescheuerte Boden. Kein Stäubchen lag auf irgendeinem der sauber polierten Erlenmöbel. Überall herrschte die größte, ja, fast peinliche Ordnung, und nur auf einem schmalen Arbeitstisch am Fenster, an dem Henriette saß und einen geschmackvollen Kranz von künstlichen Veilchen und Schneeglöckchen zusammenstellte, lagen die verschiedenen zu ihrer Arbeit nötigen Ingredienzen ebenso durcheinander, wie es die Arbeit gerade mit sich bringt.
An allem sah man, dass hier sorgliche und ordnungliebende Frauenhände walteten - und wie lag dagegen das Nachbarzimmer!
Dort wirtschaftete Onkel Pfeffer, und zwar als unumschränkter Gebieter der Räumlichkeit, über welche man aber nicht gleich beim ersten Betreten des Zimmers einen vollkommenen Überblick bekam, da eine permanente Wolke von Tabaksqualm den überhaupt nicht sehr hellen Raum in ein ewiges, geheimnisvolles Halbdunkel hüllte. Hatte man sich aber erst daran gewöhnt und war nicht gleich beim ersten Betreten dieses künstlerischen Heiligtums über einen Haufen dicht an der Tür liegender Broschüren, Bücher und Schriftstücke gestolpert, so erschien Fürchtegott Pfeffer, wie der heraufbeschworene Geist eines Zauberers, mit in Papilloten rund herum fest eigewickelten Haaren, in einem sehr schmutzigen, langen, wattierten Schlafrock, die lange Pfeife in der Linken, eine offene „Rolle", aus der er memorierte, in der rechten Hand, und blieb dann jedes Mal - beide Arme vor sich haltend und mit einer Bewegung etwa mitten in der Stube stehen, als ob er hätte sagen wollen: Na, wer stört mich nun wieder?
Die Stube selber befand sich nicht allein in einer künstlerischen, sondern sogar in einer künstlichen Unordnung, gegen die aber weder Schwester noch Nichte einschreiten durften. Pfeffer behauptete nämlich - und vielleicht nicht ganz mit /4/ Unrecht -, sobald einmal bei ihm aufgeräumt würde, fände er nie mehr, was er suche, und es sei nachher eine Heidenarbeit, sein Studierzimmer wieder in den Stand zu setzen, wie er es allein brauchen könne, das heißt: in ein wahres Chaos von lauter benutzten und unbenutzten Dingen.
Die Gardinen waren jedenfalls, als sie am Ersten des Monats aufgemacht worden, ebenso rein und weiß gewesen, wie in der Nachbarstube; wenn aber erst drei Wochen dazwischen lagen, so sahen sie doch jetzt schon entsetzlich aus. Ein schwarzer Reif schien auf sie gefallen zu sein - wie ein Trauercouvert mit schwarzen Rändern hingen sie von der Decke nieder und noch immer zog der dicke Qualm zu ihnen empor und setzte sich den vorangegangenen Rußteilchen an.
An den Wänden hingen eine Menge Bilder von theatralischen Größen, alle jedoch nur in einfach braunen oder schwarzen Rahmen. Was aber die Kunst getrennt, hatte die Kunst hier wieder vereint, denn über dem kleinen, mit buntem Kattun bezogenen Sofa nahmen Bogumil Dawison1 und Emil Devrient den Ehrenplatz ein, ja, ein Lorbeerkranz verband sogar beide miteinander.
Dort hingen auch Ludwig Löwe und Laroche, dort hingen die Charlotte Ackermann, die alte Schröder und eine Menge berühmter Schauspieler und Schauspielerinnen; dort hingen Schiller, Goethe, Lessing, Iffland - aber kein einziges Bild eines Tenoristen oder einer Primadonna, und noch viel weniger eins, das nur im Entferntesten auf die Posse Bezug gehabt hätte.
Pfeffer hasste nicht allein die Oper, sondern auch die Posse, und war vielleicht gerade deshalb ein so ausgezeichneter Komiker, weil er seine Rolle mit einer solchen Erbitterung - ja, mit einem wahrhaft tödlichen Haß abspielte, gewissermaßen, um sie nur los zu werden.
Außerdem stand in der Stube noch ein alter Schreibtisch aus Nussbaumholz, aber von oben bis unten mit Büchern Rollen, Kostümbildnern, Zeitungsblättern wie allen nur erdenklichen Rauchapparaten, als Tabakskasten und Beutel, Pfeifenröhren, Zigarrenspitzen etc., bedeckt. Den Nipptisch in de Stube bildete aber die Kommode mit einem Photographie-/5/Album im Zentrum. Rechts davon stand ein unbenutzter Mahagoni-Tabakskasten mit gestickten Seitenwänden, neben ihm ein gesticktes Uhrgehäuse, links eine eben solche Zigarrentasche, wie ein mit Silber beschlagener, guter Meerschaumkopf in geöffneter Kapsel - alles mit dichtem Staub bedeckt, denn abwischen durfte es niemand.
Zwischen den beiden Fenstern, über einem kleinen Wandschrank, war auch ein Spiegel angebracht, der Vorhang aber von beiden Seiten so gesteckt worden, dass er den oberen, als benutzbaren Teil desselben vollkommen bedeckte und nur den unteren sichtbar ließ, den Pfeffer brauchte, wenn er sich rasierte.
Zwischen den beiden Stuben, die er und seine Schwester bewohnten, bestand eine Verbindungstür, aber sie schien kassiert zu sein. Es hing wenigstens auf seiner Seite ein dicke wollene Decke davor und ein kleines Büchergestell war so angebracht, dass es den unteren Raum vollkommen ausfüllte. Aber nicht deshalb war es etwa geschehen, weil sich Bruder und Schwester nicht vertragen hätten - im Gegenteil, es gab kaum zwei Geschwister, die sich zärtlicher liebten - wenn sich auch Pfeffer selber etwas Derartiges nie merken ließ. Wäre aber die Tür benutzt gewesen, so hätte der fortwährende und furchtbare Tabaksqualm auch unfehlbar in das andere, von den Damen bewohnte Zimmer hineinziehen müssen und Pfeffer selber tat da Einspruch.
So verkehrten sie denn, wenn auch nicht so rasch, doch ebenso häufig durch den kleinen Vorsaal miteinander, der draußen auf die Treppe ausmündete und dadurch dem Tabakrauch einen freien Abzug gab, ohne in das Zimmer der Schwester zu dringen. Nach einem stillschweigenden Übereinkommen betrat er deshalb auch nie das Nachbarzimmer mi seiner Pfeife - wenigstens nie, wenn die Fenster geschlossen waren. An warmen Sommertagen, wenn diese weit geöffnet standen, kam er aber doch auch manchmal einen Moment „als Schornstein" hinüber, blies den Qualm ein paar Minuten dort in's Freie hinaus und kehrte dann in sein „Rauchnest" zurück - oftmals ohne auch nur eine einzige Silbe gesprochen zu haben. Heute Morgen /6/ war er in besonders schlechter Laune, denn die zahlreichen Musikbanden, von denen manchmal zwei zu gleicher Zeit verschiedene Melodien unter seinem Fenster bliesen, hatten jedes Memorieren unmöglich gemacht. Was half es ihm, dass er die Fenster fest verschlossen hielt und die Rouleaux selbst herunterließ, um so wenig als möglich von dem Treiben da unten zu hören und zu sehen! Die schrillen Töne drangen doch hindurch und der Tabaksqualm wurde zuletzt so dicht und arg, dass er es selber nicht mehr darin aushalten konnte.
Mit einem halb verbissenen Fluche zog er die Rouleaux wieder in die Höhe, stieß die Fensterflügel auf und ging dann, sein Zimmer auch durch die geöffnete Tür lüftend, einen Augenblick zu seiner Schwester hinüber, wo er an eins der weitgeöffneten Fenster trat.
„Du kannst wohl heute bei dem Lärm nicht arbeiten, Onkel?", fragte ihn das junge Mädchen, das in einfach bürgerlicher, fast etwas dürftiger Tracht an einem kleinen Tisch am Fenster saß und künstliche Blumen zusammenstellte. Sie sah ihm wohl an, dass er mürrisch und verdrießlich war, konnte aber in solchen Fällen noch immer am besten mit ihm auskommen.
„Arbeiten," knurrte Pfeffer an seiner Pfeifenspitze vorbei und schoss erst eine Anzahl von Rauchringeln in die blaue, sonnige Luft hinaus - „arbeiten, bei dem Skandal? Es ist ordentlich, als ob sie Einem das Gehirn auseinander trieben. Das halte ich auch nicht länger aus. Gott straf' mich, morgen kündige ich das verwünschte Logis und ziehe an's andere Ende der Stadt! Lieber doch oben auf einem Turm und eine Meile vom Theater wohnen, als hier in diesem Sodom und Gomorrha!"
Henriette lächelte leise vor sich hin, denn den nämlichen Entschluss fasste der Onkel an jedem solchen Markt, hütete sich aber wohl, ihn je auszuführen; denn die Wohnung lag ihm selber viel zu bequem und nahe beim Theater, um sie leichtsinnig aufzugeben. Er war eben verdrießlich heute und musste man ihn austoben lassen; er wurde auch schon von selber wieder gut. /7/
Jetzt freilich leuchtete sein Gesicht wie eine Wetterwolke mit seinen finster zusammengezogenen Brauen, die Stirn in tiefen Falten und einen Ausdruck in den Zügen, als ob er die Welt hätte vergiften können. Da plötzlich, als ob eine Garbe von Leuchtkugeln die dunkle Nacht erhellt, nahm die Pfeife aus dem Munde - sein Gesicht strahlte vor Freundlichkeit, und mit einer tiefen Verbeugung und dem verbindlichsten Lächeln vom Fenster aus Jemanden grüßend, der gerade unten vorbeiging, sagte er mit seiner wohlwollendsten Miene: „Dass Du den Hals brächest, Du verdammter schiefbeiniger Halunke Du - Du Leuteschinder - empfehle mich Ihnen gehorsamst!"
„Wer geht denn da vorbei?", sagte seine Schwester, eine Frau vielleicht hoch in den Dreißigern, aber ein liebes, freundliches, matronenhaftes Wesen, die leidend schien und auf dem Sofa lag.
„Der Herr Direktor," lächelte Henriette.
„Wie der Schuft die Beine spreizt," sagte Pfeffer, der wieder seine alte, finstere Miene angenommen hatte, sobald der Direktor von unten nicht mehr heraufsah - „breitspuriger Musenkutscher - grüßt auch noch, der - Heuchler!“
„Ach, Onkel, sieh nur, was da für reizende Kinder in der Equipage sitzen!", rief Henriette, die von ihrer Arbeit aufgeblickt, während Pfeffer noch immer giftig seinem Vorgesetzten oder Chef nachschaute. „Das sind gewiss Fremde, denn ich erinnere mich nicht, sie schon hier gesehen zu haben."
Unten vor dem Fenster fuhr in diesem Augenblick ganz langsam, da die Pferde in dem Menschengewühl nur im Schritt gehen konnten, eine leichte, sehr elegante Equipage vorüber. Ein Kutscher in Livree führte sie, und im Fond derselben saßen ein Herr und eine Dame in Reisekleidern, während auf dem Rücksitz ein junges Mädchen - wahrscheinlich die Bonne - die größte Mühe hatte, zwei allerliebste Kinder, einen Knaben von etwa vier und ein kleines Mädchen von vielleicht drittehalb Jahren, ruhig auf ihren Sitzen zu halten. Und es schien in der Tat kein kleines Stück Arbeit, denn das lebendige Pärchen entdeckte in der neuen, /8/ regen Umgebung eine solche Menge von Merkwürdigkeiten, dass sie mit den kurzen Ärmchen nur immer da- und dorthin deuteten und Vater und Mutter das gerade Bemerkte auf frischer Tat auch zeigen, ja, am liebsten hinaus und näher hinan wollten.
Die Eltern aber, die dem sie umwogenden Treiben kaum einen Blick schenkten, lächelten über die fröhliche Unruhe der Kinder und mussten nur selber mit beschwichtigen und ermahnen helfen, um ihren unruhigen Eifer zu zügeln.
„Ja, das sind Fremde," sagte Pfeffer, der einen mürrischen Blick nach der bezeichneten Richtung hinunterwarf; „es wimmelt ja von denen jetzt in Haßburg - vornehmes Pack - hochnäsige Gesellschaft - was kümmern die uns!"
„Was das für eine reizende Frau ist und was für wundervolle Haare sie hat!", fuhr Jettchen fort.
„Ja, wie Deine Tante, Fräulein Bassini - ein echter Goldfuchs - wie nur ein Mensch an roten Haaren Freude finden kann."
„Aber sie sind doch nicht rot, Onkel - es ist das herrlichste Goldblond, das ich in meinem ganzen Leben gesehen habe."
„Goldblond," brummte Pfeffer verächtlich vor sich hin - „Rotfuchs - was Du für einen Begriff von goldblond hast."
„Du bist einmal verdrießlich heute, Onkel," lächelte Henriette, „und in der Stimmung hättest Du selbst am Himmelsblau 'was auszusetzen."
„Hätt' ich?", brummte Pfeffer und qualmte stärker - „was die Jungfer Naseweis nicht Alles bemerkt. - Das da unten sind auch ein paar goldblonde Pferde, nicht wahr?"
„Das ist die Equipage des reichen Monford," sagte Jettchen, die wieder einen Blick hinausgeworfen hatte, aber zugleich auch, verlegen errötend, ohne dass der Onkel jedoch etwas davon bemerkte, nach unten irgendjemanden dankend grüßte.
„Die wälzen sich ordentlich in Gold," sagte Pfeffer – Herr Gott, ist das nun Gerechtigkeit? Das Volk weiß nicht, wie es dieTausende, nur um sie los zu werden, zum /9/ Fenster hinauswerfen soll und bei uns langt's manchmal knapp zu Kartoffeln und Heringen!",
„Und wer weiß, ob sie so glücklich sind, wie wir!'
„Glücklich - was sollte denen an ihrem Glück fehlen Alles, was sich ein Mensch nur möglicher Weise wünschen kann, wenner recht unverschämt ist, haben sie: eine große, reiche Familie, Sohn und Tochter, gesund und vornehm - bah, geh mir mit den Redensarten, die sich recht hübsch von der Kanzel herunter oder auf dem Theater ausnehmen, ‚Reichtum macht nicht glücklich‘ - aber im wirklichen Leben - alle Teufel," unterbrach er sich plötzlich und nahm rasch die Pfeife aus dem Mund, „schnüffelt da unten nicht schon wieder unser siebenundzwanzigster Liebhaber, unser Herr Rebe mit seinem klassischen Vornamen herum? Horatius Rebe - Horatius Cocles - jedenfalls Geschwisterkind miteinander - dass Dich die Milz sticht!"
„Aber, bester Onkel," lächelte Henriette, dabei doch etwas verlegen und jedenfalls mehr errötend, als eigentlich nötig gewesen wäre - „was kann denn ein Mensch für seinen Vornamen? Er hat ihn sich doch nicht selber gegeben."
„Unsinn, selber gegeben - natürlich hat er ihn sich nie selber gegeben, sondern irgend ein ebenso verrückter Pate, aber kann ihn doch zum Teufel werfen, so wie er nur einmal so viel Verstand hat, um eine Nachtmütze von einer Lichtschere zu unterscheiden!", rief der Onkel, der heute wirklich entschlossen schien, sich über Alles zu ärgern. - „Horatius - Horatius! Jeder anständige Mensch auf der Welt hat doch wenigstens zwei oder drei verschiedene Vornamen, von denen er berechtigt ist, sich den auszuwählen, der ihm am besten gefällt. Warum tut er das nicht auch? - aber denkt gar nicht dran. Wahrscheinlich ist er auch noch stolz auf seinen Horatius; dass Dich der Henker hole - ich wollte Dich behoratiussen, wenn Du mein Sohn wärest!"
„Aber, Onkelchen“, lachte Henriette still vor sich hin, „wenn Dir nun seine anderen Namen auch nicht besser gefielen, wie der da?"
„Ach, Schnack," rief Pfeffer, „und was weißt Du überhaupt von seinen anderen Vornamen, heh? Was sagst Du?" /10/
„Oh, nichts, Onkelchen, ich zählte nur eben die Blätter zu dieser weißen Rose ab."
„Und beim Himmel," fuhr Pfeffer auf, der, während er sprach, den jungen Menschen nicht aus den Augen gelassen hatte, „da kommt er schon wieder auf's Haus zu! Jettchen, Jettchen, ich will Dir 'was sagen - ich fange an Verdacht zu schöpfen, dass sich der junge Springinsfeld die Schuhsohlen hier nicht umsonst alle Tage vor dem Fenster abläuft - ich hätte Dich für vernünftiger gehalten."
„Aber, Onkel!"
„Die Posse lass Dir vergehen“, fuhr Pfeffer fort; „Du hast nichts, als was Du Dir mit Deiner Hände Arbeit sauer genug verdienst, und er hat gar nichts, als seine ‚Liebe zur Kunst‘, wie er es hochpoetisch nennt, und die ihn bis jetzt nicht viel höher gebracht hat, als Stühle herauszutragen und höchstens einmal einen Ritter anzumelden! Darin passt Ihr nun allerdings zueinander, dass Ihr beide nichts habt, aber das Ende vom Liede wäre auch, dass Ihr Euch beide unglücklich machtet und Euer Leben verdürbet!"
„Aber, Onkel, er denkt gar nicht daran!"
„Denkt nicht daran? -- Lehr' Du mich Menschen kennen! - Übrigens weiß ich schon, dass er nur wieder unter dem Vorwände heraufkommt, mich zu besuchen. Na, die Freude will ich ihm dieses Mal machen - arbeiten kann ich außerdem heute nichts - dass Ihr ihn mir aber nicht hier herüber lasst - das sag' ich Euch!" - Und damit nahm er seinen Schlafrock vorn zusammen und ging wieder über den Vorsaal in sein eigenes Zimmer hinüber.
Henriette blieb schweigend an ihrer Arbeit sitzen, und die Mutter war aufgestanden und nahm ihr jetzt gegenüber am Fenster Platz.
„Der junge Rebe ist die letzte Zeit recht oft hier gewesen, Kind," sagte sie endlich, während ihr Auge über die bunten Gruppen vor dem Fenster glitt, ohne sie zu sehen.
„Liebe Mutter..."
„Ich glaube, der Onkel hat Recht, Kind," fuhr die Frau aber wehmütig fort - „nicht, dass ich etwas gegen den jungen Mann selber einzuwenden hätte; er scheint brav und /11/ ordentlich zu sein, und man hört über sein ganzes Betragen nur immer Gutes, aber - das Theater ist ein gefährlicher Boden für junge Leute, und - kein Mensch weiß außerdem, ob er auch wirklich Talent hat und es je zu etwas bringen wird."
„Er studiert so fleißig!", sagte Henriette leise.
„Ja, mein Kind," seufzte die Frau, „das allein macht es nicht, und darin steht der Künstler weit gegen den Gelehrten im Nachteil. In jedem anderen Fache kann es ein wirklich tüchtiger Mann durch Fleiß und Ausdauer erzwingen, vorwärts zu kommen, wenn er auch nicht übermäßig begabt sein sollte; in der Kunst aber nicht, und nicht allein das Talent hilft ihm da, er muss auch Glück haben, wenn er es je zu etwas bringen - wenn er je ein erstes Fach bekleiden will. Kann er aber das nicht, dann wäre es viel vernünftiger, er lernte eher das einfachste Handwerk, als dass er sich seine Lebenszeit bei kleinen Bühnen herumtriebe, um da zweite oder dritte Rollen zu spielen. In dem Fall, mein Herz, ist der Schauspielerstand ein elendes und trauriges Leben, glaube mir!"
„Aber Du warst selber beim Theater, Mama," sagte Henriette, „der Onkel ist dabei, Deine selige Mutter, wie Du mir oft erzählt, soll ebenfalls eine brave Sängerin gewesen sein, ja Deine eigene Schwester spielt jetzt noch Komödie!"
„Das alles ist wahr, Herz," nickte die Mutter, „unsere ganze Familie gehört dem Theater an, und doch danke ich Gott, dass Du Dir Dein Brod, so spärlich es auch sein mag, auf andere Art verdienen kannst. Ja, wer eins der ersten Fächer bekleidet, wer bei einer großen Bühne der Liebling des Publikums geworden, der nimmt wohl eine ehrenvolle Stellung ein und kann auch ganz seiner Kunst leben; die Direktion braucht ihn und seine Zukunft ist gesichert - aber wie Wenigen unter Tausenden ist das beschieden, und sich in untergeordneten Fächern bald hier, bald da herumtreiben, jetzt hier mit einer kleinen Gage angestellt, dann wieder im Lande nach einem Engagement herumsuchend, das, mein liebes Kind, sei versichert, ist ein trauriges Brod, und schlimmer, weit schlimmer als Holzhacken und Tagelohn!" /12/
„Aber verdienen die Leute nicht, was sie zum Leben brauchen?"
„Ja - vielleicht. - Solange sie allein stehen und gesund bleiben, schlagen sie sich durch, und der Leichtsinn, der ein glücklicher Erbe dieses Standes ist, hilft ihnen über manches Schwere hinweg. Verheiraten sie sich aber und kommt Familie dazu, dann tritt nur zu häufig der furchtbare Ernst des Lebens an sie heran und sie leiden oft, ohne eine Stätte, wohin sie ihr Haupt legen können, die bitterste Not. - Aber ich brauche Dir das gar nicht weiter zu bestätigen; Du siehst es selber hier fast jede Woche, denn keine vergeht, wo nicht Einer oder der andere hier durchkommt und sein Leben mit Kollektenmachen fristet - nur um den nagenden Hunger zu stillen, nur um der dringendsten Not abzuhelfen. Jeder Taler aber, der ihnen gereicht wird, ist doch nur ein Tropfen Wasser auf einen heißen Stein und ihres Jammers kein Ende - kannst Du es mir und dem Onkel verdenken, wenn wir Dich vor einem solchen Schicksal bewahrt wissen wollen?"
„Liebe Mutter!"
„Aber wir schwatzen und schwatzen hier," brach die Frau plötzlich ab, „und es wird indessen spät; da schlägt es wahrhaftig schon zehn Uhr - Kind, Du musst nach dem Mittagessen sehen, sonst wird der Onkel nachher böse, wenn es nicht zur rechten Zeit auf dem Tisch steht."
„Ja, ja, Mama," rief Henriette, schob ihre Arbeit rasch beiseite und ging hinaus in die Küche. Die Mutter sah ihr sinnend nach, stützte dann den Kopf in die Hand und seufzte leise, aber recht aus tiefster Seele herauf:
„Oh, dass wir so arm sind!" -
Pfeffer hatte indessen sein unter der Zeit vollständig gelüftetes Zimmer wieder betreten und die Tür geschlossen, als es anklopfte.
„Guten Morgen, Herr Pfeffer!", sagte in diesem Augenblick der junge Rebe, welcher auf der Schwelle erschien, „ich störe doch nicht?"
„Woher vermuten Sie das, mein sehr verehrter Herr Horatius Rebe, wenn man fragen darf?", brummte Pfeffer, dessen Laune sich noch nicht im Geringsten gebessert hatte. /13/
„Weil ich Sie so deutlich erkennen kann," lächelte der junge Mann, „denn wenn Sie tüchtig arbeiten, haben Sie auch gewöhnlich eine dementsprechende Wolke um sich her."
„Das Rauchen ist Ihnen doch nicht unangenehm?", frag Pfeffer verbindlich und mit einer Bewegung, als ob er seine Pfeife gleich in die Ecke stellen wollte.
„Mein guter Herr Pfeffer," sagte Rebe mit einem wehmütigen Zug um die Lippen, „ich weiß sehr wohl, dass mir nichts unangenehm sein darf - übrigens würde ich selber wieder rauchen, wenn meine Gage nur ein klein wenig höher wäre.“
„So - und was verschafft mir da heute die Ehre Ihres Besuches?"
„Ich sehe, Sie sind heute nicht in glücklicher Stimmung, sagte Rebe - „kann ich vielleicht die Damen sprechen?"
„Nein," brummte Pfeffer - „meine Schwester ist krank und Jettchen pflegt sie."
„Doch nicht ernstlich?"
„Allerdings, sie pflegt sie ganz ernstlich."
„Nein, ich meine . . ."
„Wünschen Sie sonst noch etwas?“
„Mein lieber Herr Pfeffer, sagen Sie mir nur, weshalb Sie mich heute so schrecklich ablaufen lassen," bat Rebe herzlich, indem er auf ihn zuging und seine Hand zu ergreifen suchte, die Pfeffer aber in die Tasche steckte - „habe ich Ihnen etwas zu Leide getan?"
„Nein - noch nicht - aber Sie wollen es!", brummte mürrisch der Mann.
„Ich will es?"
„Ja - Sie verdrehen dem Mädel, dem Jettchen, den Kopf!"
„Aber, bester Herr Pfeffer!"
„Können Sie eine Frau ernähren?"
„Noch nicht, aber ich hoffe..."
„Hoffe - alberne Redensart - hoffe, hoffe - dafür gibt Ihnen kein Mensch einen Pfefferling, viel weniger eine ganze Haushaltung! Wie lange sind Sie schon beim Theater?"
„Seit einem Jahre - seit ich hier bin!" /14/
„Hm - und was waren Sie früher?"
„Ich habe studiert."
„Nun ja, das dachte ich mir ungefähr und nachdem Sie Ihren Eltern das schwere Geld gekostet, laufen Sie zum Theater - nein, es ist ganz unglaublich, wie verrückt manche Menschen sind, studiert bis in die blaue Pechhütte hinein, nur um nachher die Geschichte an den Nagel zu hängen und in der Welt herum zu fahren! Wofür haben Sie nun studiert?"
„Und glauben Sie wirklich, dass mir das als Schauspieler verloren wäre?", lächelte Rebe. „Hier gerade kann es mir bedeutend nützen und wenn meine Liebe zur Kunst ...."
„Jetzt hören Sie auf," schrie Pfeffer - „Liebe zur Kunst - wenn ich den Blödsinn nur nicht mehr hören müsste - Liebe zur - ich hätte bald 'was gesagt, Herr Horatius! - Apropos, ist der Horatius etwa Ihr Theatername und glauben Sie, dass er sich besonders hübsch auf dem Zettel ausnehmen soll, wenn es zum Beispiel heißt: Horatio Herr Horatius Rebe?"
„Ich bin so getauft," lächelte der junge Mann, „und - möchte mich doch auch nicht gern wieder umtaufen."
„Aber Sie haben doch, zum Teufel, auch noch andere Namen!", rief Pfeffer. „Weshalb nehmen Sie nicht einen von denen?"
„Allerdings, Herr Pfeffer," sagte Rebe etwas verlegen, „aber die anderen klingen eben auch nicht besser. Ich heiße mit meinem vollen Namen Horatius Scipio Quintus."
„Nanu bitt' ich aber zu grüßen!", rief Pfeffer erstaunt. „Weiter nichts?"
„Mein Vater war ein armer Schullehrer," fuhr Rebe fort, „der für die Alten schwärmte - er ist lange tot," fügte er leise hinzu, „und ich mochte ihn nicht dadurch noch im Grabe kränken, dass ich den ihm einst lieb gewesenen Namen verwarf."
„Sehr ehrenwert, Herr Horatius Cocles - Rebe, wollt' ich sagen," brummte Pfeffer, „aber ich glaube, Sie haben Ihren toten Papa noch viel mehr damit gekränkt, dass Sie unter die Komödianten gegangen oder, wenn Ihnen der Ausdruck besser gefällt, Mime geworden sind. Keinesfalls hätten /15/ Sie zu studieren brauchen, um ein schlechter Schauspieler zu werden."
„Aber ich hoffe ein guter zu werden, Herr Pfeffer."
„Da haben wir wieder die Hoffnung, und indessen beschäftigen Sie sich mit hinaustragen von Stühlen und Ableiern von kleinen Rollen!"
„Weil ich keine größeren bekommen kann!", rief Rebe. „Ist denn der Direktor auch nur dazu zu bewegen, mir einmal einen Versuch zu gestatten? Erlaubt er mir denn nur ein einziges Mal, zu zeigen, was ich wirklich kann?. Ach, mein bester Herr Pfeffer, wenn Sie es nur ein einziges Mal dahin bringen könnten, dass ich ..."
„Bleiben Sie mir vom Leibe," rief Pfeffer; „ich habe mit der ganzen Schmiere nichts zu tun! Ich spiele meine Rollen ab und damit Basta - wenn Ihnen eine von denen zusagen sollte, mit dem größten Vergnügen - in das Andere mische ich mich nicht. So viel sage ich Ihnen aber: - hier - wenn Sie wirklich Talent hätten - kommen Sie zu nichts; Handor spielt alles, also eine Aussicht bleibt Ihnen nicht, und deshalb bitte ich Sie sehr ernstlich, dass Sie dem Mädchen, dem Jettchen, keine weiteren Sparren in den Kopf setzen!'"
„Aber, bester Herr Pfeffer!"
„Ich glaube, Sie haben mich verstanden?"
„Vollkommen!"
„Schön, dann brauchen wir auch weiter nichts darüber zu reden, und ich..."
Er wurde hier unterbrochen, denn in dem Moment flog die Tür auf und herein stürzte in größter Eile und mit einem „Allseitigen Guten Morgen" Fräulein Bassini, Pfeffer's älteste Schwester, ebenfalls Mitglied des hiesigen Stadt-Theaters - mit einem riesigen Toupet von hochroten Locken, dabei dekolletiert und sehr phantastisch angezogen. Sie machte auch nicht viel Umstände.
„Fürchtegott," rief sie, „ich habe meine Dose vergessen und muss in die Probe - borg' mir die Deinige."
Fräulein Bassini - wie sie mit ihrem Theaternamen hieß, da ihr der Name Pfeffer zu prosaisch klang - spielte /16/ Charakter- und Anstandsdamen. Sie war aber „jeder Zoll eine Schauspielerin" und, wenn auch schon im Anfange der Vierzig - was sie übrigens hartnäckig leugnete -, doch noch so liebenswürdig kokett, wie ein junges Mädchen von siebzehn Jahren.
„Schon wieder einmal," sagte Pfeffer, wie es übrigens schien, nicht sehr erbaut von dem Überfall; „merkwürdig, dass Du nie etwas von Deiner Auftakelei vergisst. Frauenzimmer, wie siehst Du heute Morgen wieder aus - gerad' wie ein Pfingstochse!"
„Du bist und bleibst ein Grobian!", rief Fräulein Bassini, indem sie ohne Weiteres die auf dem Tisch stehende Dose an sich nahm und einsteckte - „was müssen denn nur andere Leute von Dir denken. - Guten Morgen, Herr Rebe!"
„Und willst Du nicht einmal zu Deiner Schwester hinübergehen? Sie ist nicht recht wohl."
„Es hat schon zehn Uhr geschlagen, und ich komme im ersten Act," rief Fräulein Bassini, und damit war sie aus der Tür verschwunden.
Als sie dieselbe öffnete, sah Rebe draußen in der Küche Henriette stehen.
„Also, mein lieber Herr Pfeffer?"
„Nun, ich denke, Sie haben auch Probe; Sie machen ja wohl einen von den Ballgästen?"
„Leider," seufzte der junge Mann, „aber ich komme erst am Schluss des zweiten Aktes."
„War mir sehr angenehm," sagte Pfeffer mit einer Miene, als ob er ihn eben so lieb wie nicht zur Tür hinausgeworfen hätte.
Rebe machte eine Verbeugung und verließ das Zimmer. Wie er die Tür hinter sich zudrückte, traf er vorn in der kleinen, halbdunkeln Küche, die ihr Licht nur durch ein Türfenster des Vorsaales erhielt, Jettchen.
„Mein liebes Fräulein, ich danke meinem Schicksal, dass ich Ihnen wenigstens Guten Morgen sagen kann."
„Guten Morgen, Herr Rebe," erwiderte Henriette leise.
„Ihre Frau Mutter ist nicht wohl?"
„Hoffentlich nur eine Erkältung." /17/
„Hoffentlich - und Sie arbeiten so fleißig?"
„Ich muss ja wohl."
„Sie glauben nicht, wie lang mir der gestrige Tag geworden ist - wie lang mir mein übriges Leben werden wird."
„Ich verstehe Sie. nicht," sagte Jettchen leise.
„Ihr Onkel hat mir mit ziemlich deutlichen Worten das Haus verboten - und ich fühle selber, dass er dabei in seinem Recht ist. Zürnen Sie mir nicht, mein liebes Jettchen, wenn ich seinem Befehl gehorche - ich sehe ein, dass es sein muss."
Drinnen im Zimmer klingelte es.
„Die Mutter verlangt nach mir," rief das junge Mädchen.
„Leben Sie wohl, Jettchen," sagte Rebe und reichte ihr die Hand, die sie schüchtern nahm - aber wieder klingelte es - und sich losreißend, flog sie in das Zimmer zurück. Horatius Rebe aber sah ihr wehmütig nach und verließ dann in einer recht gedrückten und traurigen Stimmung das Haus, welches er kurz vorher so freudig betreten hatte.
2.Unter den Buden.
Der Wagen mit dem jungen Paar und den Kindern, der vorhin Henriettens Aufmerksamkeit erregt, fuhr noch eine Strecke durch das Menschengewühl im Schritt, bis er einen freieren Platz erreichte. Dort ließ der Kutscher die Pferde ein wenig austraben und bald hielt das leichte Fuhrwerk vor einem nicht sehr großen, aber außerordentlich freundlich gelegenen herrschaftlichen Haus, an dessen Gartenpforte schon verschiedene dienstbare Geister standen, um die erwartete Herrschaft in Empfang zu nehmen. /18/
Der junge Mann war, wie nur der Wagen hielt, rasch zuerst hinausgesprungen und seine beiden Kleinen aufnehmend und den herbeieilenden Mädchen übergebend, half er der jungen Frau ebenfalls aus dem Wagen - aber sie bedurfte kaum seiner Hilfe.
Es war eine reizende, schlank gewachsene Gestalt, mit wundervollen goldblonden Haaren und lebendigen, aber doch so seelenvollen Augen, die aber kaum ihre Hand auf seinen Arm stützte, so leicht sprang sie ans dem Wagen herab. Aber unten blieb sie stehen und einen halb neugierigen, halb ängstlichen Blick umherwerfend, sagte sie mit leiser, fast zitternder Stimme:
„Und sind wir denn wirklich hier in Haßburg, Felix? Haben wir endlich unser lang ersehntes Ziel erreicht?"
„Haßburg gewiss," lächelte ihr Gatte, indem er ihren Arm in den seinen zog und, von den Kindern und den Dienern gefolgt, dem Hause zuschritt - „und alles andere wird sich auch wohl fügen. Jetzt aber, herziges Frauchen, zeige ich Dir vor allen Dingen unsere neue Heimat und hoffe gewiss, dass Du mit mir zufrieden sein sollst."
„Mein guter Felix - Du sorgst so für Alles!"
„Du wirst mir bezeugen müssen," lächelte ihr Gatte, „dass ich mich diesmal selbst übertroffen habe."
Und in der Tat hatte er nicht zu viel versprochen. Das freundliche Haus, das mitten in einem reizenden, wohlgepflegten Garten stand, glich einem kleinen Paradies. Alles war dabei wohl reich und ihrem Rang entsprechend, aber auch so einfach und geschmackvoll hergerichtet, dass, wie er mit seiner Gattin die Räume durchschritt, Helene, die junge Gräfin Rottack, kaum Worte fand, ihm dafür zu danken.
So durchwanderten sie das ganze Hans, und endlich, als sie so ziemlich alles besichtigt hatten, traten sie hinaus auf einen kleinen eisernen Balkon. Hier aber eröffnete sich ihnen ein wunderliebliches Landschaftsbild nach den Haßburg umschließenden Hügeln und Hängen hinüber, und Helene, von der Aussicht wirklich entzückt und überrascht, flüsterte, indem sie ihr Haupt an des Gatten Schulter schmiegte:
„Wie soll ich es Dir danken, Felix, dass Du so meinen /19/ kleinsten, vielleicht törichten Wunsch erfüllt? Wie soll ich überhaupt je im Leben das wieder gut machen, was Du schon in den wenigen Jahren für mich - für das arme, freundlose Kind - für die Waise getan? - ich weiß es nicht - mein ganzes Herz ist nur erfüllt von dem einen Gefühl des Dankes, der Liebe für Dich, Du guter Mann!"
„Meine Helene - mein liebes Herz!", rief Graf Rottack, sie an sich pressend - „wer von uns ist dem Anderen denn mehr zu Dank verpflichtet, Du mir, oder ich Dir? Was anders habe ich getan, als nur die Liebe erwidert, die Du mir entgegenbrachtest, während Du Dein ganzes Glück, Dein ganzes Leben vertrauensvoll in meine Hände legtest! Was wäre aus mir geworden, wenn Du Dich meiner nicht angenommen? In einer Stimmung, die mich der tollsten Streiche fähig machte, wäre ich vielleicht zugrunde gegangen. Du allein hast mich dem Leben erhalten, und gebe nur Gott, dass ich Dir, armes Herz, auch den Frieden wiedergeben könne, nach dem Du Dich sehnst, dass ich Dir das Einzige verschaffe, was bisher nicht m meinen Kräften stand - die Liebe Deiner Mutter!"
„Und hast Du jetzt nicht den Schritt getan, der uns ihr näher bringen musste?", sagte Helene herzlich.
„Ja, mein Schatz," erwiderte Graf Felix, indem er sie losließ und sich mit der Hand wie verlegen durch die dunkeln Locken fuhr - „aber - ich möchte nicht, dass Du Dich dadurch zu großen Erwartungen hingäbst, und ich - fürchte - wir sind jetzt gerade noch so weit von unserem Ziel entfernt, wie früher."
„Du hast kein Vertrauen zu ihr. . ."
„Aufrichtig gesagt, nein," erwiderte ihr Gatte. „Du weißt, dass die Gräfin Monford, als wir vor fünf Jahren aus Brasilien zurückkehrten, mit ihrem Gatten auf Reisen war und sich drei Jahre lang in Italien, Griechenland und Ägypten amüsierte. Dann kehrten sie auf wenige Monate zurück und gingen wieder nach Paris und London, so dass eben kein Halt an sie zu bekommen war. Jetzt endlich haben sie sich seit /20/ etwa sechs Monaten hier bei Haßburg auf ihrem alten Stammsitz niedergelassen, und ich war imstande, die genauesten Erkundigungen über sie einzuziehen."
„Und was können fremde Menschen über sie sagen?"
„Fremde Menschen wissen genau, wie sie sich fremden Menschen zeigt," sagte Graf Rottack achselzuckend, „und wir selber müssen vollkommen darauf gefasst sein, als Fremde von ihr behandelt zu werden."
„Die eigene Tochter?"
„Liebes Kind, Du vergisst, dass sie Dich nicht öffentlich anerkennen darf, wenn sie sich nicht in den Augen der Welt vollständig kompromittieren will. Graf Monford ist dabei nicht allein ein sehr reicher, sondern auch entsetzlich stolzer Herr, der an seinem Stammbaum mit einer Verehrung hängt, als ob ihn Gott der Herr damals dem Altvater Noah mit den ersten Weinreben in den Garten gepflanzt hätte. Einen Flecken darauf, sobald er nur eine Ahnung davon bekäme, würde er für mehr als ein Unglück, er würde ihn für das Verderben seines ganzen Hauses halten, und erhielte er die Gewissheit des Geschehenen, so zerrisse er - glaube mir, ich kenne dergleichen Herren - nachsichts- und erbarmungslos die Bande, die ihn an seine Gattin fesseln. Und seine Gattin weiß das, darauf kannst Du Dich verlassen."
„Aber das Gefühl muss ja doch in ihr sprechen," sagte Helene weich und herzlich.
Graf Rottack wollte etwas darauf erwidern, aber bezwang sich. Er hatte die Arme gekreuzt und starrte einen Augenblick sinnend auf die sonnenbeschienenen Hänge hinaus. Endlich wandte er das Antlitz wieder der ängstlich zu ihm aufschauenden Gattin zu und sagte, ihr freundlich in die Augen sehend: „Du weißt, Helene, dass ich bis jetzt alles getan habe, Deinen Wunsch zu erfüllen, Deinen Plan zu fördern. Es ist alles geschehen, um uns dem näher zu bringen - die Entfremdung von Deiner Mutter zu heben; so lass uns aber, ehe wir den letzten Schritt dazu tun, auch die Sache vorher ruhig besprechen, damit Dich eine doch mögliche Enttäuschung Deiner Hoffnungen nachher nicht zu unerwartet fasst und erschüttert."
„So glaubst Du wirklich..." /21/
„Von Glauben kann noch keine Rede sein, mein Herz, aber Du weißt, wie Deine Mutter, nach jenem Fehltritt ihres Lebens, sich von Dir lossagte und von da an eigentlich weiter gar nichts für Dich tat, als dass sie jener nach Brasilien gehenden Frau, der sie Dich vollständig überließ - ein Kostgeld für Dich zahlte. Du entdecktest das Geheimnis und verließest jene Frau. Fest aber darfst Du davon überzeugt sein, dass diese Madame Baulen Deiner Mutter die Flucht ihres Kindes nicht angezeigt hat, sondern nach wie vor das Geld für Dich noch regelmäßig fortbezieht. Deine wirkliche Mutter muss Dich also noch immer in Brasilien glauben."
„Ich bat Dich immer, ihr einmal zu schreiben," sagte Helene leise.
„Um Gottes willen keinen Brief, Schatz!", rief ihr Gatte lächelnd. „Eine Sache, die man man wirklich als Geheimnis wahren will, darf man nie einem Papier anvertrauen, denn kein Mensch kann wissen, wem ein solches Blatt einmal durch Zufall in die Hand gerät. Denke nur daran, wie Du selber das Geheimnis Deiner Geburt erfahren: nur dadurch, dass Deine Mutter diese nötigste aller Vorsichtsmaßregeln versäumte, durch einen in Deine - also unrechte Hände geratenen Brief. Nein, alles Derartige muss entweder mündlich oder gar nicht abgemacht werden, mündlich und ohne Zeugen schon Deiner Mutter und deshalb auch Deinetwegen, und einmal habe ich den Versuch schon gemacht."
„Du hast sie gesehen, Felix?", rief Helene rasch und geängstigt, „und mir kein Wort davon gesagt," setzte sie leise und fast vorwurfsvoll hinzu, „war das recht?"
„Weil ich Dir nicht unnötigerweise weh tun wollte, Schatz."
„Und was sagte sie?"
„Ich hatte mich ihrem Gatten und ihr, als ich damals das Haus kaufte, an einem dritten Orte vorstellen lassen und benutzte dann die Gelegenheit, nachdem der Kauf abgeschlossen, mich bei ihnen als Nachbar, in ihrer eigenen Wohnung, einzuführen. Natürlich war es nur eine Formvisite, aber es sollte auch zugleich eine vorläufige Probe sein, ob die Gräfin bei meinem Erscheinen irgendeine Bewegung zeigen /22/ würde. War das der Fall, so hätte Madame Bauten in Santa Clara ihr doch, und wider alles Erwarten, Mitteilung gemacht."
„Und was sagte sie?"
„Ich hatte mich in unserer alten brasilianischen Freundin nicht geirrt," lachte Felix. „Die Gräfin Monford konnte keine Ahnung haben, denn sie zuckte mit keiner Wimper, mein Name rief keine Erinnerung in ihrer Seele wach. Ich war ihr ein vollkommen fremder Mensch."
„Und war sie gut, war sie freundlich?", fragte Helene und ihr Blick hing angstvoll an den Lippen des Gatten.
„Sie war sehr vornehm und sehr stolz," sagte Felix nach einigem Zögern; „ich konnte nicht warm bei ihr werden. Aber lass Dir das keine Sorgen machen, Kind," fuhr er herzlich fort, als er den schmerzlichen Zug in ihrem Antlitz bemerkte, „gegen einen vollkommen fremden Menschen konnte sie ja auch kaum anders sein. Nur dürfen wir nichts übereilen und müssen vor allen Dingen erst einmal bekannt mit der Familie
werden. Sie soll Dich erst sehen und lieb gewinnen, und dann findet sich einmal eine Gelegenheit, wo Du sie, am besten hier bei uns, ohne Zeugen sprechen und Dich ihr entdecken kannst. Willst Du das mir überlassen?"
„Von Herzen gern, Felix," sagte Helene mit tiefem Gefühl. „Wem auf der Welt könnte ich lieber den heißesten Wunsch meiner Seele anvertrauen, als Dir, der Du schon so oft bewiesen hast, wie lieb ich Dir bin, wie gut Du es mit mir meinst."
„Schön, meine Puppe," lachte da Felix wieder in der alten munteren Laune und schloss sie in die Arme. „Dann aber mach' auch jetzt wieder ein freundliches Gesicht und lass Kummer und Sorgen fahren. Was geschehen kann, geschieht, dann haben wir uns wenigstens selber keine Vorwürfe zu machen. Und nun, - mein goldiger Schatz, nimm Dich vor allen Dingen einmal Deiner Kinder an, denn die kleine Gesellschaft macht ja draußen einen Heidenlärm."
„Ich kann sie nicht mehr bändigen, Herr Graf!", rief in diesem Augenblick die Bonne, die mit ihnen aus dem Nebenzimmer kam. „Günter will absolut hinaus auf den Markt /23/ unter die Buden, und Helenchen verlangt ebenfalls zur Musik!"
„Vortrefflich, dann gehen wir unter die Buden," lachte Felix, dem es ganz erwünscht kam, etwas gefunden zu haben, was seine junge Frau für den Augenblick zerstreuen konnte, und ein Jubelgeschrei der Kinder antwortete ihm.
Helene war nicht recht damit einverstanden, aber das kleine Volk hatte einmal die Zusage und nahm den Papa beim Wort, und die nötigen Anordnungen waren bald getroffen.
Es mochte jetzt etwa zwei Uhr sein; das Diner, welches das junge Paar stets mit den Kindern und der Bonne einnahm, war auf fünf Uhr bestellt und mit dem jubelnden Knaben an der Hand, während Helene das Töchterchen führte, von der Bonne und einer Magd begleitet, die mitgenommen wurde, um das Kleinste von Zeit zu Zeit zu tragen, schritten sie in das Treiben hinaus, das selbst bis hierher seine Trabanten gesandt hatte. Die Schützenwiese lag aber auch gar nicht weit von dort entfernt, und man konnte das Hämmern der Pauken, wie einzelne Trompetenstöße und ebenso den scharfen, kurzen Krach der Büchsenschüsse, wenn auch durch die Entfernung gemildert, doch deutlich bis hier herüber hören.
Und die Kinder waren selig, denn überall bot sich ihnen Neues, Ungeahntes.
Hier stand eine Polichinell-Bude2 mit den kleinen, beweglichen Figuren und der geheimnisvollen, aus dem Kattunkasten herausklingenden Stimme. Dort auf einem großen, runden Tische, von zahlreichen Zuschauern umdrängt, gab eine but gekleidete Affenfamilie ihre Vorstellungen. Da drüben wurde nach einer Reihe von aufgestellten Scheiben und Sternen mit Bolzenbüchsen geschossen, und wenn man das Ziel traf, so sprang plötzlich ein bunt gemalter Mann mit einer spitzen Mütze heraus, oder ein lauter Knall kündete den Treffer.
Und dann die Karussells! Wie jubelte das kleine Pärchen, als es die bunt beflaggen schwebenden Pferde und Wagen sah, und natürlich gaben sie keine Ruhe, bis sie mitten darin saßen und, von der Bonne und Magd bewacht, ihren Rundritt machen durften. Der kleine Günter ließ aber richtig nicht nach, bis er auch auf eines der kleinen Pferdchen /24/ gesetzt wurde, wo er versprach, sich tüchtig festzuhalten. Er fasste auch mit beiden Händchen die Eisenstange, als ob sein kleines Leben daran hinge.
Die Mutter war erst ängstlich, dass er herunterfallen könnte, denn wenn sie selber auch das wildeste Pferd nicht scheute, sorgte sie sich doch um den kleinen Liebling. Der Vater ließ ihn aber lächelnd gewähren, und wie stolz saß jetzt der kleine Bursch auf seinem gewählten Pferd, dessen Seiten er mit den Hacken bearbeitete, bis sich die Reihe an zu drehen anfing. Dann aber klammerte er sich fest und ängstlich an, denn so rasch hatte er sich die Bewegung doch nicht gedacht.
Und nun kamen die Buden selber mit ihren zahmen Ponies und kreischenden Papageien, mit ekelhaft fetten Menschen, die sich für Geld sehen ließen, mit angestrichenen Indianern und gezähmten Hyänen, mit Taschenspielern, Feuerfressern, Bauchrednern und wie diese Unnatürlichkeiten alle hießen. Die Kinder sehen allerdings nur das Wunderbare und den Flittertand daran, während die Erwachsenen gewöhnlich ein Gefühl des Ekels oder Mitleids beschleicht, wo derartige Scharlatanerien zu einem Broterwerb benutzt werden, die doch das Elend nicht verbergen können, das hinter all‘ dem Tand und Putz sich birgt.
Das junge Paar ekelte auch dieses wüste Treiben an, das sie nur den Kindern zuliebe wieder einmal durchkosteten. Diese ließen aber keine Ruhe, bis sie auch wenigstens ein paar der Buden betreten hatten, und am meisten jubelten sie bei einem Marionettenspiel, aus dem sie fast nur mit Gewalt wieder entfernt werden könnten.
„Bleib nur ein klein wenig sitzen, Mama“, rief Helenchen, als der Vorhang endlich fiel, „er geht gleich wieder in die Höh‘!“ Lachend nahm Graf Rottack die Kleine auf den Arm, um sie durch das Gedränge hinaus ins Freie zu tragen, und atmete ordentlich hoch auf, als er endlich wieder den blauen Himmel über sich sah. Hier draußen presste aber gerade eine solche Masse von Menschen vorüber, dass er der BonneAcht auf den Knaben befahl und, seine Frau an den Arm nehmend, über die Straße hinüber zu kommen suchte; wo er freien Raum sah. /25/
Die Marionettenbude war die letzte in der Reihe und dicht daran führte die freie Promenade, welche sich um die Stadt selber herumzog und gewöhnlich zu Spazierfahrten der haute volèe benutzt wurde. Eben jetzt kam eine Equipage, langsam im Schritt durch die Menschenmenge sich Bahn suchend, vorüber und die aus dem Wege Drängenden hemmten jede Passage in diesem Augenblick so, dass Graf Rottack mit den Seinen stehen bleiben musste, um sie erst vorüber zu lassen.
Helene fühlte, wie Felix ihren Arm fest an sich drückte, und von einer plötzlichen Ahnung ergriffen, flüsterte sie rasch und erschreckt: „Wer ist das?"
„Sei stark, mein braves Frauchen, und verrate keine Bewegung," ermahnte sie ihr Gatte, „es sind Monfords!"
„Meine..."
„Bst, mein Schatz," warnte Felix rasch, „wir können ihnen nicht mehr ausweichen. Hänge Dich nur fest an meinen Arm."
Der Wagen hatte sie erreicht und fuhr unmittelbar an ihnen vorüber. Nur der Graf und die Gräfin saßen im Fonds desselben. Der Graf mochte ein Herr hoch in den Sechzigern sein, mit weißem, vollem Haar und einem wohlgepflegten Schnurrbart. Seine Frau, eine Dame von vielleicht einigen vierzig Jahren, stattlich und vornehm, in eleganter, aber nicht überladener Toilette, während der Graf selber nur eine Jagdjoppe mit grünem Kragen trug, lehnte nachlässig neben ihm und betrachtete die an ihrem Wagen vorbeidrängenden Menschen durch ihre Lorgnette.
Graf Rottack, der noch immer sein kleines Töchterchen ans dem Arm trug, grüßte, und Helene, die zitternd an seinem Arme hing, verneigte sich ebenfalls. Graf Monford, den jungen Mann erkennend, dankte freundlich, während die Gräfin nur eben die Lorgnette von ihrem Auge entfernte und langsam das Haupt neigte.
Die Gräfin musste einmal bildschön gewesen sein - sie war es selbst jetzt noch und schien das auch zu wissen - aber der Wagen passierte und Graf Rottack, der sich erst umsah, ob er auch die Seinen beieinander habe, schritt jetzt mit He/26/lenen über die Straße, um aus dem Menschenschwarm hinauszukommen. Dort übergab er sein kleines Töchterchen der Wärterin.
„Kanntest Du den Herrn?", sagte im Wagen Graf Monford zu seiner Gattin, als sie vorübergefahren.
„War das nicht der Graf Rottack, der uns einmal vor einiger Zeit besucht?"
„Ganz recht, mit seiner jungen Frau wahrscheinlich. Er hat sich ja hier angekauft. Ein hübsches Paar."
„Aber die Frau scheint sehr kränklich, sie hatte keinen Blutstropfen im Gesicht."
„Möglich, vielleicht angegriffen von der Reise. Es kann auch sein, dass er sie gerade aus Gesundheitsrücksichten hierher gebracht. Soviel ich weiß, ist es eine Amerikanerin."
„Aus Amerika?"
„Er war ja selber lange dort. . ."
Die Unterhaltung wurde abgebrochen. Die Gräfin hing ihren eigenen Gedanken nach und der Graf richtete sich auf, um nach den Pferden zu sehen, da das Handpferd vor einem vorüberziehenden Kamel scheute und nur schwer wieder beruhigt werden konnte.
Sprachlos hing indes Helene an des Gatten Arm und musste ihre ganze Geistesstärke zusammennehmen, um der Bewegung Herr zu werden, die sie beim ersten Anblick der Mutter ergriffen.
„Oh, wie kalt, wie stolz sie aussah!", flüsterte sie endlich leise vor sich hin.
„Beruhige Dich, mein Herz - wie bleich Du nur geworden bist - sei mein starkes Kind. Es wird ja noch Alles gut werden."
„Lass mich nur einen Augenblick, Felix!", bat die junge Frau, „es war nur der erste Moment, die erste Überraschung. Sieh, jetzt geht es wieder besser, ich bin ja nur ein töricht Kind, dass ich mir über das Aussehen der stolzen Frau Sorge machen sollte. Konnte sie denn ahnen, wer an ihrem Wagen stand?" Und ihr Antlitz war so lieb und schön - Du hast Recht, Felix: es wird noch Alles gut werden."
Mitten im Weg kam ein kleiner, dicker Herr auf sie zu, /27/ der, die Hände in den Taschen, einen sehr hohen Zylinderhut aufhatte und, obgleich er sehr anständig und einfach gekleidet ging, doch durch seine Beweglichkeit, mit welcher er den kleinen, runden Körper schwenkte und durch sein entschieden vergnügtes Gesicht Rottack's Auge einen Moment auf sich zog. Aber bei solchen Gelegenheiten, wie Jahrmarkt und Vogelschießen, kommen ja oft gar wunderliche Leute zusammen und er wollte eben mit der Gattin vorübergehen, als des Fremden Blick auf sie fiel.
Merkwürdig war die Veränderung, die da in dessen Zügen vorging. Im Nu war der kleine vergnügte Mann ganz ernsthaft geworden, ja, er sah ordentlich erstaunt aus, riss aber auch im nächsten Augenblick die rechte Hand aus der Hosentasche und den Hut vom Kopf, wobei er eine ordentlich blendende Glatze zeigte, und ging tief grüßend, aber wie verdutzt vorüber.
Graf Rottack konnte kaum ein Lächeln über den wunderlichen Menschen unterdrücken, aber er dankte freundlich und schritt jetzt in dem hier freier werdenden Weg der gar nicht mehr so fern liegenden Wohnung zu.
Auch von Helenens Antlitz war jetzt der Schatten gewichen, der sich über ihre lieben Züge gelegt, und die Farbe in ihre Wangen zurückgekehrt. Sie hatte ihr kleines Mädchen, das nicht länger getragen werden wollte, an die rechte Hand genommen, und die Kleine trippelte munter nebenher und zeigte mit dem freien Händchen, fortwährend jubelnd, bald da-, bald dortin, wo sie etwas Neues und Ausfallendes entdeckte.
„Bitte um Entschuldigung," sagte in diesem Augenblick, dicht an Graf Rottack's Seite eine Stimme, und als er den Kopf danach umdrehte, bemerkte er zu seinem Erstaunen den komischen kleinen Fremden, der wieder mit entblößtem Kopf neben ihm stand, oder vielmehr neben ihm herging und, zu ihm aufsehend, fortfuhr: „Ich habe doch das Vergnügen, den Herrn Grafen Rottack zu begrüßen?"
„Mein Name ist Rottack," sagte Felix erstaunt, „aber ich weiß nicht..."
„Und kennen Sie mich nicht mehr? Und die Frau Gräfin auch nicht? Und das?", rief er, indem er seinen Hut wieder /28/ aufstülpte, die Füße auseinander spreizte und beide Hände auf die eingebogenen Kniee drückte - „Hurrjeh, das ist schon die kleine Familie?"
„Jeremias!", rief in dem Augenblick erstaunt Helene aus.
„Jeremias, bei Allem, was lebt!", lachte jetzt Rottack gerade hinaus, indem er dem kleinen, noch vor den Kindern kauernden Mann die Hand entgegenstreckte. „Mensch, wo kommen Sie auf einmal hergeschneit?"
„Direkt von Brumsilien, Herr Graf," sagte der kleine Mann mit dem ernsthaftesten Gesicht, indem er sich wieder aufrichtete, die dargebotene Hand derb und herzlich schüttelte und dann eben so ungeniert Helenens freundlich gebotene Rechte nahm -- „direkt von Santa Clara, aus dem alten Nest, und wahrhaftig, keinem Menschen auf der Welt hätte ich lieber begegnen mögen, als Ihnen Beiden! Der Anblick tut kranken Augen wohl. Und das ist die kleine Familie? Jemine, meine Gute, was für ein paar Puppen; und so geschwinde!"
Ein Zug von Schmerz war über Helenens Antlitz gezuckt, als der Anblick des Fremden aus der fernen Kolonie ihr rasch wieder schon fast vergessene, trübe Bilder vor die Seele rief; aber wie eine leichte Wolke strich es darüber hin, und bald lag wieder lichter Sonnenschein auf dem holden Angesicht
Sie hatte auch Jeremias immer gern gehabt und wohl gefühlt, dass dem komischen, hastigen Wesen des Mannes ein guter Kern zugrunde lag, der es treu und ehrlich meinte. Rottack selber war aber hoch erfreut, dem kleinen Manne wieder begegnet zu sein, der ihm Nachricht von vielen Menschen bringen konnte. Übrigens sah er recht gut, dass sich Jeremias, wenn er auch sonst vielleicht noch der Alte geblieben, in seinen Verhältnissen und seinem ganzen Leben sehr gebessert haben musste.
Er war nicht allein sehr anständig gekleidet, sondern sah auch adrett und sauber aus. Er trug keinen Goldschmuck irgendwelcher Art an sich, aber seine Kleider waren vom besten Tuch, die Wäsche schneeweiß. Nur in die Glacè-Handschuhe hatten sich die arbeitsharten Hände nicht gewöhnen können, möglich auch, dass vielleicht keine passende Größe aufzufinden /29/ gewesen, denn im Inneren der Hand waren schon beide aufgeplatzt. Aber seine Bewegungen waren frei und unbefangen, wie immer.
„Nun sagen Sie mir aber vor allen Dingen, Jeremias," rief Rottack endlich, nachdem er sich von seinem ersten Erstaunen über dieses plötzliche Begegnen erholt, „wie kommen Sie gerade nach Haßburg? Stammen Sie aus dieser Gegend, oder hat Sie nur der Zufall hierher geführt?"
„Keins von beiden," erwiderte der kleine Mann, der aber sonderbarer Weise wie etwas verlegen bei der Frage wurde; „das ist übrigens eine lange Geschichte, Herr Graf, die sich nicht so auf der Straße erzählen lässt."
„Dann kommen Sie mit uns, Jeremias," rief der Graf rasch, „und essen Sie mit uns wir - gehen gerade zum Diner!"
„Aber, Herr Graf!", rief Jeremias, ordentlich verblüfft.
„Machen Sie keine Umstände," lachte Felix, der seelenfroh war, gerade jetzt etwas zu finden, das Helene zerstreuen und ihr die frohe Laune wiedergeben konnte; „wir sind ganz unter uns und können da nach Herzenslust plaudern. Ich habe eine ordentliche Sehnsucht danach, wieder einmal etwas von Brasilien zu hören."
„Na, wenn Sie es denn nicht anders haben wollen," lachte Jeremias, dem man es aber ansah, wie schmeichelhaft ihm die Auszeichnung war - „mir kann's recht sein. Jemine, es geht aber doch eigentlich nirgends kurioser zu als in der Welt!"
„Also Sie kommen mit?", lächelte Helene, die selber schon zu lange in den transatlantischen Kolonien gelebt hatte, um darin etwas Außerordentliches zu finden, dass ein Mann, der früher sogar in einem dienenden Verhältnis zu ihnen gestanden, jetzt auch einmal ihr Gast sein sollte, ja, es drängte sie selber, Neues aus dem alten Leben zu hören, mit dem sie jetzt freilich vollkommen abgeschlossen.
„Ob ich mitkomme," lachte aber Jeremias, „mit dem größtmöglichen Vergnügen, und die kleine Erbprinzessin werde ich mir indessen ausbitten," und damit wollte er das kleine Helenchen von der Erde und auf den Arm nehmen. /30/ Das aber war für Helenchen zu viel Vertraulichkeit auf einmal - den fremden Mann kannte sie ja noch gar nicht, und mit einem: „Du, das darfst Du nicht!", fuhr sie zurück und wehrte ihn mit ihren kleinen Händchen von sich ab.
„Steckt im Blute," lächelte Jeremias, während er, den Kopf seitwärts gehalten, nach ihr hinabsah - „bin der kleinen Comtesse noch nicht vorgestellt worden; aber ich weiß, wie man's macht - bitte, warten Sie nur einen Augenblick!", und ehe Graf Rottack und Helene nur etwas entgegnen konnten, drehte er sich ab und schoss mit langen Schritten auf eine gerade dort gelegene große Konditorei los, in die er eintauchte und wenige Minuten später wieder mit einer riesigen, goldpapiernen Zuckertüte zum Vorschein kam.
„Na, und jetzt, mein gnädiges Fräulein," rief er, indem er dem lachenden Kinde die Tüte offen hinhielt, „was sagen wir nun? Zugegriffen, versteht sich - Kinder sind sich doch alle gleich, allgemeine Menschennatur. Und jetzt wollen wir zum Essen gehen, wenn die Frau Gräfin nichts dagegen haben."
Damit nahm er die Kleine, die es sich, eifrig mit der Tüte beschäftigt, jetzt auch ruhig gefallen ließ, ohne Weiteres auf den Arm und unterhielt sich, während Felix mit der
Gattin voran und ihrem Hause zuschritt, unterwegs mit der ihm erst erstaunt und dann lachend zuhörenden Bonne.
3. Das Rendezvous.
Mild und erwärmend lag die Nachmittagssonne auf dem schönen Land und warf einen ordentlich magischen Schein über die rotblinkenden Stämme eines Tannenwaldes, der, dunkel und dicht gedrängt, die nächste Hügelkette deckte, und über das /31/ breite, wohlgepflegte Wiesental, das sich am Fuße desselben hinzog. Ein kleiner schmaler Fluss schlängelte sich hindurch, helle Weidenbäume mit ihrem graugrünen Laube fassten ihn ein, während einzelne hochstämmige Erlen mit den knotigen, oft behackten Stämmen dazwischen standen und malerische Gruppen bildeten. Der Fluss aber sprang murmelnd und rasch zwischen ihnen hin und warf die Sonnenstrahlen wie spielend in blitzenden Lichtern zurück.
Seitwärts aber erhob sich ein kleiner, sorgfältig mit Blütenbüschen bepflanzter Hügel, aus dessen Strauch- und Baumwerk, von einzelnen schlanken italienischen Pappeln überragt, die Mauern eines stattlichen Schlosses oder Herrenhauses hervorleuchteten, während rechts durch einen tiefen Einschnitt der Hügelkette die Ziegeldächer von Haßburg und der eine Turm des Domes sichtbar wurden.
In dem Wiesentale selber, bald dicht am Ufer des kleinen Flusses, bald mitten darin, lagenzerstreute Gruppenvon Birken, knorrigen Eichen, Linden und Blutbuchen, als ob sie der Zufall dort hätte keimen lassen. In der Tat aber waren sie künstlich angelegt und gepflegt und dienten auch nur dazu, um der ganzen Gegend etwas Parkähnliches zu geben, ohne ihr jedoch den Charakter ihrer ursprünglichen Natürlichkeit zu nehmen.
Der ganze Distrikt war auch in der Tat nur ein erweiterter Teil des unmittelbar an das Schloss stoßenden Gartens und ein schmaler, aber gut gehaltener und mit Kies überstreuter Fahr- und Reitweg lief, den Windungen des Wassers folgend, auf das Schloss zu. Das Ganze wurde durch einen leichten, grün angestrichenen Drahtzaun eingeschlossen, der aber von Weitem gar nicht sichtbar war und dadurch dem Parke nur noch mehr das Ansehen einer freien Landschaft ließ.
Menschen waren nirgends zu erkennen, nur unten am Fluss, wo das Hochwasser die Uferbank so ausgewaschen hatte, dass die das Erdreich zusammenhaltenden Wurzeln einer uralten Erle fast eine Art von Dach bildeten, kauerte ein Mensch neben einem hier durch die Strömung gewühlten Wasserloch und angelte.
Ob er ein Recht dazu hatte? Es schien kaum so, denn /32/ alles verriet weit eher, dass er sich hier auf verbotenem Grund oder doch jedenfalls bei einer verbotenen Beschäftigung befand. Er benützte eine höchst sinnreich so gefertigte Angelrute, dass sie, wenn er sie zusammenschob, genau in seinen alten Eichstock passte und durch die unten angeschraubte Zwinge dann vollkommen abgeschlossen und versteckt wurde, und hatte dabei eine alte, abgenutzte, lederne Jagdtasche umgehängt, in welcher auch jedenfalls sein übriges Angelgerät stak, denn draußen war nichts weiter davon zu bemerken.
Der ganze Bursche sah überhaupt alt und abgenutzt aus. Er trug einen fadenscheinigen, grauen Rock mit fettigem Kragen, alte lederne Gamaschen und derbe Schuhe, auf dem Kopfe eine abgegriffene, graue Mütze und eine baumwollene Weste, wie sie die ärmsten Bauern zu tragen pflegen. Er schien dabei auch nicht mehr jung; das unter der Mütze hervorquellende Haar war, wenn nicht ganz weiß, doch stark gesprenkelt. Nur der kleine, struppige Schnurrbart, der nicht zu seinem Vorteil Spuren von Schnupftabak zeigte, war völlig weiß, was sich leider nicht von seiner Wäsche sagen ließ, und trotzdem sah der Mensch aus, als ob er schon einmal bessere Tage gesehen hätte, mochte er jetzt auch noch so arg heruntergekommen sein. Seine Stirn war hoch und gewölbt und das kleine, graue, lebendige Auge konnte, wenn es nicht scheu umherblickte, oft recht trotzig unter den buschigen Brauen hervorleuchten.
In seiner, ob nun hier erlaubten oder verbotenen Kunst schien er übrigens gar nicht so ungeschickt, denn in der kurzen dort verbrachten Zeit hatte er schon zwei mehr als halbpfündige Forellen aus dem fischreichen Strom herausgeworfen, ihnen dann augenblicklich mit einem alten, abgenutzten, aber haarscharfen Genickfänger den Kopf durchstochen und sie, also abgeschlachtet, in seinen Ranzen geschoben.
Übrigens zeigte er wenig Furcht bei seiner Beschäftigung, so versteckt er sie auch trieb; er qualmte aus einer kleinen, kurzen Pfeife mit einem Maserkopf und einer Spitze, die jedem andern Menschen das Rauchen hätte für Lebenszeit verleiden können, und hob nur selten einmal und nur dann, /33/ wenn er wieder einen Fisch gefangen, den Kopf, um über den Wiesenrand in den Park hinaus zu sehen. Aber er hatte auch einen Wächter.
Oben unter der Erle saß ein kleiner Spitz, so alt und ruppig und grau gesprenkelt wie sein Herr, ein Auge geschlossen, als ob er auf der Seite schliefe, während das andere aufmerksam bald da, bald dort hinüberflog, und so regungslos, als ob er zu den Wurzeln, zwischen denen er kauerte, gehörte. Der alte Fischer war auch völlig unbesorgt, denn er wusste recht gut, dass ihm das kleine, pfiffige Tier das Nahen irgendeines Menschen augenblicklich anzeigen würde - war es doch darauf dressiert.
Übrigens hatte der Alte ein Recht, sich hier im Park aufzuhalten, denn sein angebliches Geschäft war, die Maulwürfe aus den Wiesen wegzufangen, worin er eine ganz besondere Geschicklichkeit besaß. Auch in der Gegend, in welcher er seit drei Jahren sein Wesen trieb, war er bekannt genug, und das Volk nannte ihn kurzweg den „Maulwurfsfänger".
Sodann führte er auch Gift für Ratten und Mäuse bei sich, wusste Mittel gegen jedes andere Ungeziefer, und die Bauern in der Umgegend ließen es sich außerdem nicht nehmen, dass er „mehr verstehe als Brot essen", das heißt, dass er auch mit übernatürlichen Dingen Gemeinschaft pflege und in einer Anzahl von „schwarzen Künsten" erfahren sei, die er, wenn er wolle, sowohl zum Nutzen wie zum Schaden seiner Mitmenschen benutzen könne.





























