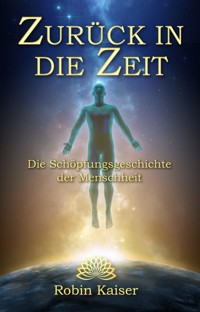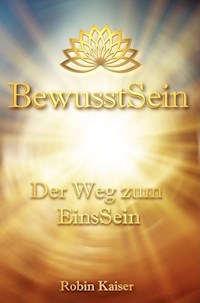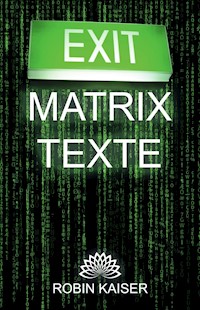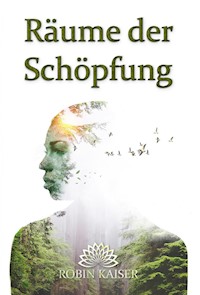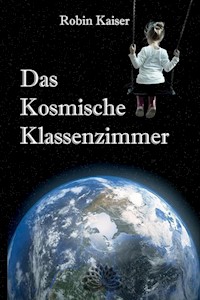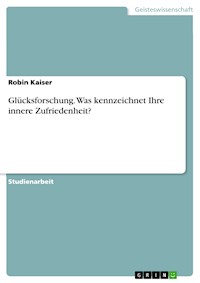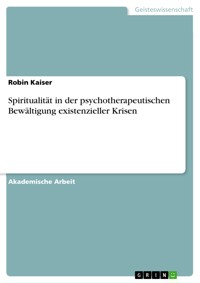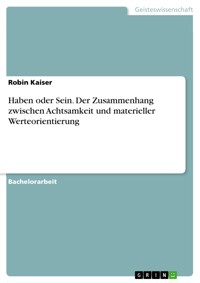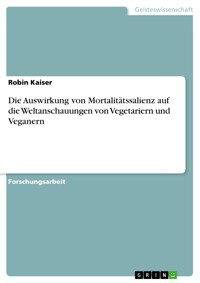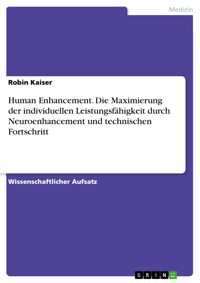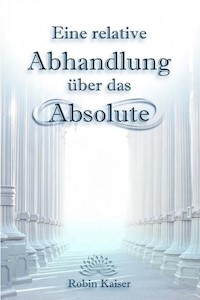
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Diese Abhandlung ist ein sprachlicher Versuch, dem ewig Unsprachlichen das Wort zu verleihen und im Sprachspiel der Gegensätze eine nonduale Erfahrung aufzuschießen. Durch die Sprache einer modernen Mystik entfaltet sich eine systematische Weisheitswissenschaft mit dem Potenzial, die Tore zu den inneren Erkenntnisschätzen des Lesers zu öffnen und diesen in eine höhere Selbsterkenntnis zu führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 545
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ROBIN KAISER
Eine relative Abhandlung über das Absolute
Oder: Der Weg der Selbstwerdung durch Selbstaufgabe
Eine relative Abhandlung über das Absolute© Copyright: 2019 Robin Kaiser, Berlin.Alle Rechte vorbehalten. Verlag: epubli 1.Auflage
Cover: Robin KaiserKorrektorat: Roland Kaiser Druck: Neopubli GmbH, Berlin
www.robinkaiser.eu
ISBN: 978-3-754151-58-7
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Inhalt und FormOder: Der Inhalt für alle Formen
Innerlichkeit und ÄußerlichkeitOder: Was du bist, und was du nicht bist
Selbst und WeltOder: Selbstlosigkeit und Weltlosigkeit
Ordnung und ChaosOder: Ordnung hat Prinzip
Das Sein und das SeiendeOder: Über das Seiende zum Sein
Sein und HabenOder: Es gibt nichts, was das Sein nicht hat
Geist und StoffOder: Stoff ist geronnener Geist
Spiel und SpiegelOder: Der Spiegel spielt das Spiel mit der Existenz.
Möglichkeit und WirklichkeitOder: Die Wirklichkeit ist nur eine Möglichkeit der Wirklichkeit
Kausalität und AnalogizitätOder: Kausalität analog übertragen
Wahrnehmung und WahrgebungOder: Seinszuspruch und Seinsabspruch
Selbstwerdung und SelbstaufgabeOder: Selbstwerdung durch Selbstaufgabe
Alles und NichtsOder: Alles ist immer, und nichts gibt es nicht
Der Findende und der SuchendeOder: Der Suchende kann nicht finden, weil er sucht
Wissen und UnwissenOder: Unwissen als die höchste Form des Wissens
Wissen und GlaubenOder: Wissen, was vergessen hat, dass es Glauben ist
Sinn und SinnlosigkeitOder: Sinn durch die Sinnen-Losigkeit
Leben und TodOder: Der Tod stirbt am Ende des Lebens
Einheit und VielheitOder: Die Einheit in der Vielheit
Licht und DunkelheitOder: Wo Licht ist, kann Dunkelheit nicht sein
Absolutheit und RelativitätOder: Die Relativität zur Absolutheit treiben
Freiheit und DeterminismusOder: Zur Freiheit determiniert
Das Ich und das AndereOder: Das Ich im Anderen und das Andere im Ich
Subjekt und ObjektOder: Subjektivistische Objekte und objektivistische Subjekte
Das Traumleben und das WachlebenOder: Wenn das Wachleben nur ein Traum ist
Abstraktion und KonkretionOder: Was bleibt, wenn alles abstrahiert ist
Das Oberbewusste und das UnterbewussteOder: Unbewusstes Ober- und Unterbewusstsein
Die erste und die letzte DenkfigurOder: Der höchste Gedanke
Schweigen und SprechenOder: Wenn das Sprechen mit sich spricht
Raum und ZeitOder: Die Dimensionen für das kosmische Spiel
Der Zauber und der TrickOder: Das Leben als Zaubertrick
Wahrheit und WahrheitOder: Wie kann etwas nicht Wahrheit sein
Transzendenzlehre und ImmanenzlehreOder: Der kosmische Kreislauf
Epilog
Einleitung
Diese Abhandlung ist das Resultat eines inneren Weges, auf dem ich mir Stück für Stück, Schritt für Schritt, selbst abhandengekommen bin. Es ist weniger ein Weg, als ein Rückweg, eine Rückbindung, eine Religio, und nicht einmal Rückweg trifft es, da ein Rückweg Distanz voraussetzt. Dieses aber, wohin die Abhandlung führt, ist distanzlos nahe und zeitlos dicht.Mit der gleichen Art des blinden Vertrauens auf das, was dort kommt, bin ich in diese Abhandlung hineingestolpert und habe mich in ihr auf ewig verloren. Wer sich gleichermaßen in dem Text verliert, der wird sich darin wiederfinden. Solange ich den Weg noch ging, solange ich noch suchte, wusste ich nicht, wonach ich suchte. Analog dazu liefert die Abhandlung Antworten auf häufig nicht explizit dargestellte Probleme, da überwiegend versucht worden ist, sprachlich gegenstandslos vorzugehen. Die einkreisenden Antworten lösen quasi erst die Lösung der problematischen Phänomene, auf die sie Bezug nehmen, ab. Erst nachdem ich gefunden hatte, wusste ich, wonach ich suchte, und die Lösung des Rätsels wurde mit dem Rätsel der Lösung aufgelöst. Durch den Versuch, die Antithesen zu den großen, tief in der Welt festgesetzten Glaubenssätzen zu denken, verließ mich mein Wissen und hinterließ ein klaffendes Loch, ein existenzielles Vakuum haltlosen Unwissens.Nun haben sich alle Gegensätze versöhnt, indem sich scheinbar lineare Polaritäten, sich zueinander hinneigend, zu einem Kreis vereinigten. So, wie der Kreis sich schloss, so schloss sich auch der Frieden über alle Grenzen, und das Einssein wurde erfahren. Doch bis dieser Friede Einzug hielt, war es ein Ausharren in der gespannten Atmosphäre des Nichts. Dieses Nichts, dieser Raum, in dem alles entstehen kann, öffnet sich über das dialektische Wechselspiel von Gegensätzen, die sich, immer jeweils entgegengesetzt, ihre Existenz schenken und sich ihrer wieder berauben. Wer also auf gegensatzlose, widerspruchsfreie Thesen hofft, bekommt sie nur in der Form, dass widerspruchsfrei alles widersprüchlich ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, so wurde das Wesen des Absoluten, wie es aus relativer Perspektive erscheint, verfehlt. Diese Abhandlung wird letztlich alleinig von der Idee des Absoluten getragen und nur deshalb regelmäßig in die Relation fallengelassen, um wieder vom Absoluten aufgefangen und zurückgeholt zu werden, damit durch die daraus entstehende Bewegung sprachlicher Erkenntnisabwurf entsteht. Der Versuch, alles so dicht wie möglich an der Absolutheit zu bauen, drängt in sprachliche Abstraktionen, durch die eine überweltliche Philosophie, eine Weisheitswissenschaft, zum Ausdruck kommt, in der Mystik und Logik Hand in Hand gehen. Die immerselben (dem Text zugrunde liegenden) Gedanken kleiden sich in unterschiedlichste Sprachgewänder, die in einer Komposition von inhaltlichem Reduktionismus und formaler Diversität unwillentlich die hinter dem Sprachgerüst versteckenden Gedanken zum Vorschein treten lassen. In den abstrakteren Kapiteln wird mehr oder weniger das immer gleiche Spiel gespielt, lediglich die Ausdruckformen der Phänomene, die hartnäckig jeden Ausdruck von sich abweisen, wandeln sich. Die Wörter in den Kapitelüberschriften finden sich in den jeweiligen Kapiteln fast in jedem Satz wieder. Dieser inflationäre Sprachgebrauch der immer gleichen Wörter kommt daher, dass ein Wort erst in der Beziehung zu sich selbst, oder in Relation zu seinem Gegenteil, Zugang zur Ebene jenseits der Wörter gewährt. Auch häufen sich auf dem Weg zum Absoluten die sprachlichen Absolutierungen, die als gedankliche Richtungsweisung aufgefasst werden sollten. Viele gedankliche Gebilde werden sprachlich stark komprimiert dargestellt. Wäre das geistige Gedankengeflecht noch dichter, so wäre vielleicht ein Gedicht daraus entstanden, auch wenn das Vokabular eher an ein wissenschaftliches als an ein literarisches erinnert. Mit dem Mut zur Stilfreiheit wird nach den tiefsten, noch erschürfbaren und nach den höchsten, noch erfassbaren Wahrheiten gesucht, und versucht, ihre Seinsart über eine möglichst perspektivlose Perspektive zu rekonstruieren. Dabei geht es weniger darum, was sich als Niedergeschriebenes festgesetzt hat, als um die darin vorhandene Möglichkeit, das Niedergeschriebene gedanklich-analog durch alle möglichen Wirklichkeitsebenen hindurch wachsen zu lassen. Alles Niedergeschriebene spricht von etwas, was nicht ist, weil sich das, worum es geht, im Niederschreiben auflöst. Um vom Auflösen zum Erlösen zu kommen, gilt es, das Prinzip hinter der Wirklichkeitsebene zu erkennen, um sich dann von der bestehenden Wirklichkeitsvorstellung zu lösen, damit man unbedingt relationslos im Prinzip verweilen kann. Eine Abhandlung, die durch und durch auf Dekonstruktion von Relativität abzielt, ist nur in kleinen Portionen gut bekömmlich und erfordert eine für sich eigenständige Lesart, die Berührung und Selbstrückbezug zulässt. Aufgrund der inhaltsscheuen Sprachstruktur betrachtet der verständige Leser durch die Wörter hindurch sein eigenes Spiegelbild und lernt durch die Gedanken im Text, besser in sich hineinzuschauen. Diese Abhandlung setzt sich aus relativ bedeutungslosen Formen zusammen, die erst darüber ihre Wertigkeit erhalten, dass der Leser über diese hinausgeht und sich von ihnen in ein universelles Einheitserleben hinübertragen lässt. Auch wenn die Form des Geschriebenen oft theoretisch philosophisch anmutet, so stammt sie doch nicht aus einer Philosophie, sondern aus einer Erfahrung, einer Lebenspraxis, und in genau eine solche kann sie vom verständigen Leser wieder umgewandelt werden. Wenn ich nicht selbst den Weg gegangen, die innere Reise durchlebt hätte, und das Ich-in-der-Welt-Sein nicht genauso erleben würde, wie im Text geschildert, dann hätte ich nicht darüber schreiben können. Die Erfahrung des Absoluten ist etwas Universelles, der Weg zu ihr, der Weg, der aus dem Reich der Relativität hinausführt, muss selbst ein relativer sein. Oder anders: Der Weg aus den Illusionen ist selbst ein illusionärer Weg, weil er eine Reise einleitet zu einem Ort, der nie verlassen wurde. Die Reise zum Innersten führt von außen nach innen, von der Form zum Formlosen, von der Endlichkeit zur Unendlichkeit, von der Dimensionalität zur Nondimensionalität, von der Konzeptualität zur Nonkonzeptualität, vom Groben zum Subtilen, vom Konkreten zum Abstrakten, vom Traumleben zum Wachleben, vom Suchenden zum Findenden, von der Selbstaufgabe zur Selbstwerdung, von der Relativität zur Absolutheit, von Vielheit zur Einheit, in der durch und durch alles in allem ist. Alles geht auf dieser Reise verloren, und viel mehr, als das, was verloren geht, wird wiedergefunden. Der “Fund“ lässt den Finder in eine Drittperspektive jenseits von Subjekt und Objekt rutschen, in der er die Dualität von Ich und Welt synergetisch eint. Diesen perspektivischen Zugang einmal freigelegt, wird das Licht der Wahrheit unweigerlich durch ihn einströmen. Weniger geht es um die Wahrheit selbst, als um die Wegbereitung für die Erfahrbarmachung. Für den Absolutheitsfremden, der wenig mit der Negativbestimmung des Absoluten anfangen kann, werden einige der hier angeführten, aus dem Absoluten kommenden, zirkulierende Gedankenfiguren nicht vollkommen, sondern vollkommen absurd anmuten, denn Wahrheit und Wirrheit liegen dicht beieinander. Auch kann gesagt werden, dass nie das gesagt werden kann, was gemeint ist, da der niedergeschriebene Gedanke nicht der Gedanke ist, der zum Niederschreiben veranlasste. Doch hier mein Versprechen: Jeder wird intuitiv aus sich heraus ein Wissen, ein Verständnis über den zentralen, in dieser Abhandlung vorkommenden Gedanken, haben. Diejenigen, die dies nicht glauben, wissen nur noch nicht, dass sie eigentlich doch wissen. Was bedeutet, dass ein Verständnis, auch wenn es noch kein verstandesmäßiges Verstehen ist, wirkt.
Man höre also hin, denn ich habe nichts zu sagen!
Inhalt und FormOder: Der Inhalt für alle Formen
Dieses Kapitel ist das Herzstück der Abhandlung, es ist sowohl das Resultat, als auch der Grundstein, denn es liefert die inhaltliche Ausrichtung für alle weiteren Kapitel. Es empfiehlt sich, dieses Kapitel entweder als erstes, als letztes, oder immer mal wieder zwischendurch zu lesen. Ein kleine, aber für das Verständnis immens relevante Vorabbemerkung: In der Idee dieses Kapitels geht es nicht um Inhalt und Form, sondern für “Inhalt und Form“ geht es um die Idee dieses Kapitels. Damit sollte sowohl auf inhaltlicher, als auch auf formaler Ebene, Inhalt und Form getrennt voneinander verstanden werden. Auch ist die Radikalität der hier zu Formeln verdichteten Transzendenzlehre nicht in dieser Stringenz in den einzelnen Kapiteln vorhanden, obwohl die Ausrichtung durch die Abhandlung hindurch die gleiche bleibt.
Es gibt nur einen Inhalt, und die vierzehn in der Tabelle links aufgeführten Namen repräsentieren den einen Inhalt. Dieser eine Inhalt denkt sich eine Form aus, um sich als Inhalt präsentieren zu können, doch keine Form ist in der Lage, den reinen Inhalt dazustellen. Die Wörter der rechten Spalte sind die radikalste Möglichkeit ihrer Entsprechung auf der linken Seite. Das hiesige Kapitel über Inhalt und Form ist durch hohe Formalisierung formbereinigt, das heißt, das Verhältnis zwischen Form und Inhalt kann immer jeweils auf das oben angeführte Begriffspaar analog übertragen werden. Je nachdem wie stark formbereinigt eine Begriffspolarität ist, muss der projizierte Zusammenhang von Form und Inhalt auf der Ebene nachjustiert werden, auf die sie projiziert wird. Das Sein und das Seiende ist eine der reinsten Ebenen, in der der Inhalt zum Vorschein treten kann. Selbst und Welt hingegen ist eine eher “unreine“ Ebene, denn sowohl Selbst als auch Welt sind schon in Formverstrickungen verwoben, denn ohne diese Verstrickungen wären sie erst gar nicht. Durch keine formale Ausdrucksebene ist der eine Inhalt lupenrein und zur Gänze sichtbar zu machen, muss doch der Inhalt, um sichtbar zu werden, sich stets in eine formale Struktur einfügen. Exemplarisch möchte ich hier die zentralen Gedanken des Zusammenhangs von Form und Inhalt durch dazu passende Ebenen durchdeklinieren. Theoretisch ist der Analogieschluss auf jede Ebene möglich, praktisch ist er aber auf einigen Ebenen (von ihrer Semantik her) weniger sinnvoll.
Es gibt nur einen Inhalt, in dem latent alle Formen vorhanden sind.
Inhalt ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Form gibt es nicht, es gibt lediglich Inhalt, der sich mit Form verwechselt.
Inhalt ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Inhalt nichts, wenn er nicht mit Zuhilfenahme der Form in Erscheinung treten würde, damit ist Form für den Inhalt Anfangs- und Endpunkt.
Form versucht, Inhalt darzustellen, deformiert ihn aber dabei bis in sein Gegenteil, dabei kann Form erst dann auf ihren Inhalt schließen, wenn sie sich eingesteht, dass sie nie Form gewesen ist.
Inhalt ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von Form, es sei denn, der Inhalt identifiziert sich mit der Form.
Inhalt kennt die Form, in die er sich hineinbegibt, die Form aber kann als Form in Inhaltsvergessenheit geraten.
Wird Inhalt geteilt, weitet er sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Form geteilt, reduziert sie sich.
Das, was der Form dienlich ist, schadet dem Inhalt, und das, was dem Inhalt dienlich ist, schadet der Form, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.
Form ist Inhalt, der nach Inhalt strebt.
Je mehr Form sein will, desto weniger ist sie.
Inhalt hat kein Gegenteil, da Form nur das radikalste Zustandsextrem von Inhalt ist.
Abstraktion und Transzendenz führen zum Inhalt, Konkretion und Immanenz führen zur Form.
1) Es gibt nur einen Inhalt, in dem latent alle Formen vorhanden sind.
A) Es gibt nur einen Geist, in dem latent alle Stofflichkeit vorhanden ist.B) Es gibt nur eine Möglichkeit, in der latent alle (möglichen) Wirklichkeiten vorhanden sind.C) Es gibt nur ein Sein, in dem latent alles Seiende vorhanden ist.F) Es gibt nur ein (höheres) Selbst, in dem latent jede Welt vorhanden ist.G) Es gibt nur eine Innerlichkeit, in der latent alle Äußerlichkeiten vorhanden sind.K) Es gibt nur ein Licht, in dem latent alle Dunkelheit vorhanden ist.M) Es gibt nur ein Leben, in dem latent jeder Tod vorhanden ist. Und so weiter…
2) Inhalt ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Form gibt es nicht, es gibt lediglich Inhalt, der sich mit Form verwechselt.
B) Möglichkeit ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Wirklichkeit gibt es nicht, es gibt lediglich Möglichkeit, die sich mit Wirklichkeit verwechselt. C) Sein ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Seiendes gibt es nicht, es gibt lediglich Sein, das sich mit Seiendem verwechselt.G) Innerlichkeit ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Äußerlichkeit gibt es nicht, es gibt lediglich Innerlichkeit, die sich mit Äußerlichkeit verwechselt.H) Das, was du bist, ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und das, was du nicht bist, gibt es nicht, es gibt lediglich das, was du bist, das sich mit dem, was du nicht bist, verwechselt.K) Licht ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Dunkelheit gibt es nicht, es gibt lediglich Licht, was sich für Dunkelheit hält.L) Alles ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Nichts gibt es nicht, es gibt nur Alles, was sich mit Nichts verwechselt.N) Ordnung ist immer unveränderlich zur Gänze vorhanden, und Chaos gibt es nicht, es gibt lediglich Ordnung, die sich mit Chaos verwechselt. Und so weiter…
3) Inhalt ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Inhalt nichts, wenn er nicht mit Zuhilfenahme der Form in Erscheinung treten würde, damit ist Form für den Inhalt Anfangs- und Endpunkt.
A) Geist ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Geist nichts, wenn er nicht mit Zuhilfenahme von Stoff in Erscheinung treten würde, damit ist Stoff für den Geist Anfangs- und Endpunkt.C) Sein ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Sein nichts, wenn es nicht mit Zuhilfenahme des Seienden in Erscheinung treten würde, damit ist Seiendes für das Sein Anfangs- und Endpunkt.F) Subjekt ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Subjekt nichts, wenn es nicht mit Zuhilfenahme der Objekte in Erscheinung treten würde, damit ist Objekt für das Subjekt Anfangs- und Endpunkt.I) Absolutheit ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Absolutheit nichts, wenn sie nicht mit Zuhilfenahme der Relativität in Erscheinung treten würde, damit ist Relativität für die Absolutheit Anfangs- und Endpunkt.J) Einheit ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Einheit nichts, wenn sie nicht mit Zuhilfenahme der Vielheit in Erscheinung treten würde, damit ist Vielheit für die Einheit Anfangs- und Endpunkt.K) Licht ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Licht nichts, wenn es nicht mit Zuhilfenahme der Dunkelheit in Erscheinung treten würde, damit ist Dunkelheit für das Licht Anfangs- und Endpunkt.M) Leben ist alles, was sein kann und alles, was ist, und trotzdem wäre Leben nichts, wenn es nicht mit Zuhilfenahme des Todes in Erscheinung treten würde, damit ist der Tod für das Leben Anfangs- und Endpunkt. Und so weiter…
4) Form versucht, Inhalt darzustellen, deformiert ihn aber dabei bis in sein Gegenteil, dabei kann Form erst dann auf ihren Inhalt schießen, wenn sie sich eingesteht, dass sie nie Form gewesen ist.
A) Stoff versucht, Geist darzustellen, deformiert ihn aber dabei bis in sein Gegenteil, dabei kann Stoff erst dann auf seinen Geist schließen, wenn er sich eingesteht, dass er nie Stoff gewesen ist.B) Wirklichkeit versucht, Möglichkeit darzustellen, deformiert sie aber dabei bis in ihr Gegenteil, dabei kann Wirklichkeit erst dann auf ihre Möglichkeit schließen, wenn sie sich eingesteht, dass sie nie Wirklichkeit gewesen ist.C) Das Seiende versucht, Sein darzustellen, deformiert es aber dabei bis in sein Gegenteil, dabei kann Seiendes erst dann auf sein Sein schließen, wenn es sich eingesteht, dass es nie Seiendes gewesen ist.E) Objekt versucht, Subjekt darzustellen, deformiert es aber dabei bis in sein Gegenteil, dabei kann ein Objekt erst dann auf sein Subjekt schließen, wenn es sich eingesteht, dass es nie Objekt gewesen ist.G) Äußerlichkeit versucht, Innerlichkeit darzustellen, deformiert sie aber dabei bis in ihr Gegenteil, dabei kann Äußerlichkeit erst dann auf ihre Innerlichkeit schließen, wenn sie sich eingesteht, dass sie nie Äußerlichkeit gewesen ist.I) Relativität versucht, Absolutheit darzustellen, deformiert sie aber dabei bis in ihr Gegenteil, dabei kann die Relativität erst dann auf ihren Absolutheitsgrund schließen, wenn sie sich eingesteht, dass sie nie Relativität gewesen ist.J) Vielheit versucht, Einheit darzustellen, deformiert sie aber dabei bis in ihr Gegenteil, dabei kann Vielheit erst dann auf ihre Einheit schließen, wenn sie sich eingesteht, dass sie nie Vielheit gewesen ist. Und so weiter…
5) Inhalt ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von Form, es sei denn, der Inhalt identifiziert sich mit der Form.
C) Sein ist vollkommen, und vollkommen unabhängig vom Seienden, es sei denn, das Sein identifiziert sich mit seinem Seienden.E) Subjekt ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von Objekten, es sei denn, das Subjekt identifiziert sich mit Objekten.F) Das (höhere) Selbst ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von Welt, es sei denn, das Selbst identifiziert sich mit der Welt.G) Innerlichkeit ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von Äußerlichkeit, es sei denn, Innerlichkeit identifiziert sich mit Äußerlichkeiten.H) Was du bist, ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von dem, was du nicht bist, es sei denn, das, was du bist, identifiziert sich mit dem, was du nicht bist.L) Alles ist vollkommen, und vollkommen unabhängig vom Nichts, es sei denn, Alles identifiziert sich mit dem Nichts (glaubt, nicht zu sein).N) Ordnung ist vollkommen, und vollkommen unabhängig vom Chaos, es sei denn, Ordnung identifiziert sich mit Chaos. Und so weiter…
6) Inhalt kennt die Form, in die er sich hineinbegibt, die Form aber kann als Form in Inhaltsvergessenheit geraten.
B) Möglichkeit kennt die Wirklichkeit, in die sie sich hineinbegibt, die Wirklichkeit aber kann als Wirklichkeit in Möglichkeitsvergessenheit geraten.C) Sein kennt das Seiende, in das es sich hineinbegibt, das Seiende aber kann als Seiendes in Seinsvergessenheit geraten.E) Das Subjekt kennt die Objekte, in die es sich hineinbegibt, die Objekte aber können als Objekte in Subjektvergessenheit geraten.F) Das Selbst kennt die Welt, in die es sich hineinbegibt, die Welt aber kann als Welt in Selbstvergessenheit geraten.G) Die Innerlichkeit kennt die Äußerlichkeit, in die sie sich hineinbegibt, die Äußerlichkeit aber kann als Äußerlichkeit in Innerlichkeitsvergessenheit geraten.H) Das, was du bist, kennt das, was du nicht bist, aber das, was du nicht bist, kann vergessen, was du bist.J) Einheit kennt die Vielheit, in die sie sich hineinbegibt, die Vielheit aber kann als Vielheit in Einheitsvergessenheit geraten. Und so weiter…
7) Wird Inhalt geteilt, weitet er sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Form geteilt, reduziert sie sich.
A) Wird Geist geteilt, weitet er sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Stoff geteilt, reduziert er sich.B) Wird Möglichkeit geteilt, weitet sie sich aus und intensiviert(vermehrt) sich (scheinbar), wird Wirklichkeit geteilt, reduziert sie sich.D) Wird Freiheit geteilt, weitet sie sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Determinismus geteilt, reduziert er sich. G) Wird Innerlichkeit geteilt, weitet sie sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Äußerlichkeit geteilt, reduziert sie sich.H) Wird das, was du bist, geteilt, weitet es sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird das, was du nicht bist, geteilt, reduziert es sich.I) Wird Absolutheit geteilt, weitet sie sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Relativität geteilt, reduziert sie sich.M) Wird Leben geteilt, weitet es sich aus und intensiviert sich (scheinbar), wird Tod geteilt, reduziert er sich. Und so weiter…
8) Das, was der Form dienlich ist, schadet dem Inhalt, und das, was dem Inhalt dienlich ist, schadet der Form, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.
B) Das, was der Wirklichkeit dienlich ist, schadet der Möglichkeit, und das, was der Möglichkeit dienlich ist, schadet der Wirklichkeit, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.D) Das, was dem Determinismus dienlich ist, schadet der Freiheit, und das, was der Freiheit dienlich ist, schadet dem Determinismus, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.H) Das, was dem, was du nicht bist, dienlich ist, schadet dem, was du bist, und das, was dem, was du bist, dienlich ist, schadet dem, was du nicht bist, und wenn du das Eine sein willst, musst du vom Anderen absehen.J) Das, was der Vielheit dienlich ist, schadet der Einheit, und das, was der Einheit dienlich ist, schadet der Vielheit, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.K) Das, was der Dunkelheit dienlich ist, schadet dem Licht, und das, was dem Licht dienlich ist, schadet der Dunkelheit, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.L) Das, was dem Nichts dienlich ist, schadet Allem, und das, was Allem dienlich ist, schadet nicht, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen.M) Das, was dem Tod dienlich ist, schadet dem Leben, und das, was dem Leben dienlich ist, schadet dem Tod, und wer das Eine haben will, muss vom Anderen absehen. Und so weiter…
9) Form ist Inhalt, der nach Inhalt strebt.
A) Stoff ist Geist, der nach Geist strebt.C) Seiendes ist Sein, das nach Sein strebt.E) Objekt ist Subjekt, das nach Subjekt strebt.I) Relativität ist Absolutheit, die nach Absolutheit strebt.J) Vielheit ist Einheit, die nach Einheit strebt.K) Dunkelheit ist Licht, das nach Licht strebt.N) Chaos ist Ordnung, die nach Ordnung strebt. Und so weiter…
10) Je mehr Form sein will, desto weniger ist sie.
B) Je mehr Wirklichkeit sein will, desto weniger ist sie.C) Je mehr Seiendes sein will, desto weniger ist es.E) Je mehr ein Objekt sein will, desto weniger ist es.G) Je mehr Äußerlichkeit sein will, desto weniger ist sie.I) Je mehr Relativität sein will, desto weniger ist sie.M) Je mehr der Tod sein will, desto weniger ist er.N) Je mehr Chaos sein will, desto weniger ist es. Und so weiter…
11) Inhalt hat kein Gegenteil, da Form nur das radikalste Zustandsextrem von Inhalt ist.
A) Geist hat kein Gegenteil, da Stoff nur das radikalste Zustandsextrem von Geist ist.D) Freiheit hat kein Gegenteil, da Determinismus nur das radikalste Zustandsextrem von Freiheit ist.G) Innerlichkeit hat kein Gegenteil, da Äußerlichkeit nur das radikalste Zustandsextrem von Innerlichkeit ist.H) Das, was du bist, hat kein Gegenteil, da das, was du nicht bist, nur das radikalste Zustandsextrem von dem ist, was du bist.J) Einheit hat kein Gegenteil, da Vielheit nur das radikalste Zustandsextrem von Einheit ist.K) Licht hat kein Gegenteil, da Dunkelheit nur das radikalste Zustandsextrem von Licht ist.M) Leben hat kein Gegenteil, da der Tod nur das radikalste Zustandsextrem von Leben ist.Und so weiter…
12) Abstraktion und Transzendenz führen zum Inhalt, Konkretion und Immanenz führen zur Form.
A) Abstraktion und Transzendenz führen zum Geist, Konkretion und Immanenz führen zum Stoff.C) Abstraktion und Transzendenz führen zum Sein, Konkretion und Immanenz führen zum Seienden.E) Abstraktion und Transzendenz führen zum Subjekt, Konkretion und Immanenz führen zum Objekt.H) Abstraktion und Transzendenz führen zu dem, was du bist, Konkretion und Immanenz führen zu dem, was du nicht bist(aus Sicht der Transzendenzlehre).I) Abstraktion und Transzendenz führen zur Absolutheit, Konkretion und Immanenz führen zur Relativität.J) Abstraktion und Transzendenz führen zur Einheit, Konkretion und Immanenz führen zur Vielheit.N) Abstraktion und Transzendenz führen zur Ordnung, Konkretion und Immanenz führen zum Chaos.
Und so weiter…
Alles, was im Folgenden über Form und Inhalt gesagt wird, kann auf gleiche Weise durch die vierzehn Ebenen dekliniert werden! Oder man liest die Kapitel, in denen auf die einzelnen Ebenen im Besonderen eingegangen wird, und die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Die folgenden Kapitel sind weniger stark formalisiert und versuchen teilweise, fast schon über einen eher sprachkünstlerischen Ansatz, den Inhalt durchblitzen zu lassen, weshalb die hier aufgestellte Struktur nicht immer direkt in den einzelnen Ausarbeitungen sichtbar wird. Die Begriffspaare sind Angebote, die mal mehr und mal weniger angenommen werden können, um den Inhalt, das eine Prinzip, zu verstehen. Dem aktiv kreativen Leser kann auch nahegelegt werden, beliebig weitere Ebenen hinzuzufügen, indem er ähnlich geartet Begriffspaarungen heranzieht und diese, dem Prinzip folgend, “tanzen“ lässt. Beispielsweise könnte man Qualität und Quantität, Gesundheit und Krankheit oder Liebe und Angst oder Ähnliches einsetzen. Nahezu alle Begriffspaare in den Kapitelüberschriften stehen in einem gleichgearteten Verhältnis zueinander, womit jedes Kapitel auf seine Art eine Wirklichkeitsebene offeriert. Keine Ebene hat für sich den Anspruch auf Vollständigkeit, denkt man aber einen Gedanken, der in einer Ebene Erwähnung findet durch alle anderen Ebenen hindurch, dann ergibt sich ein vollständiges Bild, ein ganzes Puzzel des einen unaussprechlichen Prinzips. Es gibt nichts, was durch das Prinzip nicht verstanden werden kann, da das Prinzip (des Lebens) alles ist, was ist. Im Folgenden öffnet sich also eine hochpotenzierte Dosis Leben, die sich hoch formalisiert in dem Begriffspaar von Inhalt und Form widerspiegelt: Die Abhandlung versucht, Inhalt aus dem Traum der Identifikation mit den Formen wachzurufen. Einmal geschieht der Weckruf über den Weg einer starken Formalisierung und einmal im ungeformten Fluss eines inhaltlichen Selbstausdrucks. Einmal wurde versucht, die Formverunreinigungen durch Formabzug zu verflüssigen, und einmal sie durch extreme Formalisierung aufzuheben. Das folgende Kapitel geht letzteren Weg und sollte aufgrund dessen weniger als ein Lesetext, als wie eine Art Formelsammlung betrachtet werden, die man nach eigenem Ermessen auch überspringen kann. In der Abhandlung geht es weniger um den Inhalt hier, als um den Inhalt in dir, wobei es sich natürlich um ein und denselben Inhalt handelt. Alles, was existiert, existiert im Spannungsfeld zwischen Form und Inhalt. Inhalt ist, geht nie verloren und verändert sich nicht. Inhalt ist, ist notwendigerweise, Formen hingegen können nur werden und sind damit kontingent. Inhalt ist vollkommen, und vollkommen unabhängig von seiner Form. Es gibt nur einen “Fehler“, der gemacht werden kann, nämlich dass sich Inhalt mit seiner Form verwechselt und sich mit dieser identifiziert. Alle möglichen “Fehler“ lassen sich in diese Verwechslung “eindampfen“, und diese Verwechslung präsentiert sich in einer facettenreichen Vielzahl an Fehlern. Inhalt ist der Ursprung der Form, und wer Form mit Inhalt verwechselt, der verwechselt das Symbol mit seiner Quelle, den Ausdruck mit dem, was es ausdrückt. Keine Form von Vollkommenheit kann vollkommen sein, denn nur die Vollkommenheit selbst ist vollkommen. Aber Inhalt (bzw. Vollkommenheit) bleibt für sich vollkommen, unabhängig in welche Form er sich begibt. Wenn eine Form ihren Inhalt vollständig erkennen würde, würde sie sich keinesfalls eine Begrenzung innerhalb einer Form suchen. Formen treten dann in Erscheinung, wenn sie meinen, sich von ihrem Inhalt abtrennen zu können, und gerade die damit einhergehende Seinsungewissheit drängt weiter dazu, in Form zu investieren, um die Inhaltslosigkeit zu verschleiern. Inhalt hingegen, der aus sich zur Gänze seine Seinsgewissheit bezieht, bedarf keiner Seinsrückbestätigung über die Existenz. Oder anders ausgedrückt: Inhalt muss an seiner Inhaltlichkeit und die damit einhergehende Vollkommenheit zweifeln, um in Existenz treten zu können, was Unvollkommenheit damit zur Basis der Existenz innerhalb einer Form macht. Sucht Inhalt in der Form eine Seinsbestätigung, dann sucht er dort, wo er sie nicht finden kann. Doch anstatt anderswo zu suchen, wird jetzt die Seinsbestätigung der Form eingeholt, das heißt, man schafft sich immer wieder eine Bestätigung seiner eigenen Unvollkommenheit. Form lebt immer nur eine Form ihrer selbst und entscheidet sich so gegen alle anderen Formen. Um die Entscheidung zu rechtfertigen, wertet sie ihre Form auf und alle anderen Formen ab. Alle Inhalte im Inhalt hingegen werden vom Inhalt gleichzeitig in jeder möglichen Möglichkeit er- und gelebt, ohne dass diese voneinander unterschieden werden. Form gibt es nicht, es gibt lediglich Inhalt, der sich für Form hält. Inhalt ist alles, was ist, und trotzdem wäre er nichts, wenn er sich nicht in eine Form begeben würde. Das, was wir sind, kennt keine bestimmte Form, und doch kann es nur über eine Verkleidung in einer bestimmten Form sein. Inhalt ist Wahrheit, Formen sind Illusionen. Weder in der Form, noch in dem Inhalt gibt es Abstufungen. Man kann nicht nur ein wenig an Form glauben, sondern, wenn ein Formglaube da ist, ist er ganz da, und Inhalt kann nicht gesehen werden. Umgekehrt gilt es gleichermaßen, wobei Formen zwar noch gesehen, aber durchschaut werden. Für den, der im Formglauben steckt, gibt es innerhalb der Form Abstufungen von Formen und Inhalten, die weniger oder mehr, richtig oder falsch, sind. Für den, der den einen Inhalt sieht, sind alle Formen gleichermaßen illusionsbehaftet, kann doch kein Ausdruck das ausdrücken, was er ausdrücken möchte. Form ist inhaltlicher Abglanz, wobei die Form nicht anders kann, als den Inhalt zu verunreinigen und ihn einzuschränken. Wird Inhalt geteilt, dann wird Form transzendiert. Wird Form geteilt, verringert sich die Form und scheinbar auch der Inhalt, wenn sich dieser mit seiner Form verwechselt. Er gibt nur einen Inhalt, wobei in diesem Inhalt alle Formen und Formabstufungen latent vorhanden sind. Form ist besondere Form, und Inhalt ist so allgemeiner Inhalt, dass er allgegenwärtig ist. Die Besonderheit ist damit beschäftigt, alles, was nicht sie selbst ist, auszusondern. Inhalt ist der prinzipvolle Pol vom prinziplosen Oppositionspol der Form. Will ich Inhalt haben, muss ich von der Form absehen, will ich Form haben, muss ich vom Inhalt absehen, wobei für die Formen der Grundsatz “weniger ist mehr“ gilt. Bei einer starken Formalität geht Inhalt abhanden, sowie bei einer starken Inhaltlichkeit Form verloren geht bzw. transzendiert wird. Und trotzdem ist der Ausprägungsgrad des einen proportional zum Ausprägungsgrad des anderen, denn Gegensätze sind ein und dasselbe und nur im Grad ihrer Ausprägung verschieden. Inhalt lässt sich nicht ausdrücken, nicht aussprechen, und alles, was sich ausdrückt und ausspricht, kann nicht ohne Inhalt sein, denn es ist nicht die Form, die sich ausspricht und ausdrückt. Die Form ist das Mittel zum Zweck des inhaltlichen Ausdrucks. Der Zweck ist inhaltlich geeinigt. Das Mittel, über das der Zweck erreicht wird, ist die Vielheit aller bestehenden Formen. Es gibt keine Form, die nicht letztlich den einen Inhalt repräsentieren könnte, da der Inhalt der Endpunkt ist, der bereits im Anfangspunkt der Form beschlossen liegt. Der Inhalt kann von sich auf eine Möglichkeit seiner Form schließen. Eine Form kann jedoch nicht auf ihren Inhalt schließen, es sei denn, die Form gibt sich als Form auf. Eine Form kann in sich ihren Inhalt erahnen, wenn sie bereit dazu ist, von sich als Form abzusehen. Kommt eine Form in Kontakt mit ihrem Inhalt, dann sieht sie, dass andere Formen den gleichen Inhalt haben, womit das Anderssein verschwindet, und jede Form Kontaktstelle für den einen Inhalt ist. Form kann erst dann vollständig auf ihren Inhalt schließen, wenn sie versteht, dass sie nie Form gewesen ist. Dabei muss Form alles aufgeben, was aus der Idee, Form zu sein, erwachsen ist. Was der Form dienlich ist, schadet dem Inhalt, und was dem Inhalt dienlich ist, schadet der Form. Der Inhalt begibt sich in eine Form, wobei sich, je nach Ausprägungsgrad der Form, die Inhaltlichkeit scheinbar dabei verändert. Inhalt alleine ist sich selbst gegenüber blind, weshalb sie sich über die Form auf einen “Selbsterfahrungstripp“ begibt. Auf diesem geht es dem Inhalt darum, eine für sich möglichst adäquat passende Form zu finden, um sich selbst Ausdruck zu verleihen, um irgendwann zu merken, dass keine Form dem Inhalt gerecht werden kann. Dadurch aber, dass Inhalt selbst von sich nicht weiß, was er ist, weiß er auch nicht, welcher Formausdruck für seine eigene Inhaltlichkeit adäquat ist. Macht Inhalt den Sprung, um als Form zu existieren, dann trägt er anfangs in sich eine Inhaltsgewissheit, obwohl er stark von der Form dominiert wird (Anspielung auf die Natur). Die scheinbare Dominanz der Form ist notwendig, damit der Inhalt sich wieder aus der Form herausentwickeln kann (der evolutionäre Weg der Bewusstwerdung). Verwechselt sich Inhalt mit Form, dann formt die Form den Inhalt so, wie sie meint, dass der Inhalt sei. Der Inhalt wird nur dann von der Form bestimmt, wenn er diese Bestimmung zulässt, denn nur Inhalt kann wirken und innerhalb seiner selbst Formen bilden. Die Bewegung von Form täuscht Inhalt vor, doch Inhalt ist unbewegt, und erst wenn die Bewegung der Form zur Ruhe gebracht wird, kann der immer stille Inhalt erkannt werden. Form muss sich immer verändern, kann nie bewegungslos sein und erschafft über seine Veränderung die Illusion von Inhalt. Eine scheinbar bewegungslose Form kann nur dann bewegungslos erscheinen, wenn sie eine Bewegung auf mikro- und makrokosmischer Ebene aufbringt. Form hat durch ihre Bewegung die Bewegungslosigkeit, den Inhalt, zum Ziel.
Wenn Form ihr Ziel erreicht hat, ist sie keine Form mehr. Form denkt, sie erreiche Ruhe(Inhalt), wenn sie sich bewegt, weshalb sie sich immer mehr bewegt, immer mehr zur Form macht und immer entfremdeter dem Inhalt gegenüber wird. Je mehr eine Form versucht, zu sein, desto weniger ist sie. Denn wenn Form immer mehr zur Form wird, rückt sie immer weiter von sich selbst ab. Durch den scheinbaren “Fehler“ der Form, durch die Form zum Inhalt zu gelangen, wird die Form so weit zur Form, dass sie sich auflöst. Form ist Inhalt, der Form vortäuscht, um Inhalt anstreben zu können. Erreicht die Form das, was sie ist, dann ist sie nicht mehr, weshalb die Bestrebung des Ausdrucks von Inhalt in einer Form immer wieder von Neuem gewollt sein will.Endliche Formen werden von unendlichem Inhalt bis in die Unendlichkeit hinein zum Entstehen gebracht, um wieder zu vergehen. Dabei kann (und muss) Form Inhalt haben, Form strebt aber danach, Inhalt zu sein und nicht nur Inhalt zu haben. Alles, was Form hat, hat Inhalt, und alles, was Inhalt hat, will Inhalt und nicht Form sein. Form kann nie Inhalt sein, das bewirkt die Strebung in jeder Form. Form ist Inhalt, der nach Inhalt strebt! Jede Form bestimmt sich durch den Grad ihrer Abgetrenntheit vom Inhalt. Je stärker die Abgetrenntheit einer Form von ihrem Inhalt ist, desto gegensätzlicher ist der Zustand und die Eigenschaft der Form im Gegensatz zum Inhalt. Und doch haben Form und Inhalt ein und dieselbe Substanz und unterscheiden sich lediglich in ihrem Zustand. Form ist das radikal entgegengesetzte Möglichkeitsextrem von Inhalt. Form besitzt den Willen zu Vergänglichkeit, zur Auflösung, um wieder in den Zustand des immer gleichen Inhalts zurückzukehren, aus dem sie hervor-kam. Und im Inhalt findet sich der Wille zur Formbildung, zum Ausdruck, denn ohne ihn wäre nichts. Die Form wird durch den Inhalt zur Form. Die Form gebiert den Inhalt in seiner begrenzten formalen Weise, wobei es der Inhalt ist, der die Form gezeugt hat. Die Form ist dazu da, etwas über den Inhalt, nicht aber etwa über die Form zu lernen. Allerdings wird der Inhalt erst dann lehr- und lernbar, wenn er sich in ein Formengewand kleidet. Zur Form veräußerlichter Inhalt muss über die Form etwas über sich lernen, was nur dann geht, wenn er sich nicht mit Form identifiziert. Jede Form schränkt den Inhalt in seiner Inhaltlichkeit scheinbar ein. Die hohe Kunst besteht darin, das formal durchzuführen, wozu der Inhalt drängt, sodass Form und Inhalt gleichermaßen ausgerichtet sind, und die Form den Inhalt im geringsten wie nur möglichen Maße beschränkt. Inhalt erschafft Form, Form erschafft nie Inhalt. Werden scheinbar Formen von Formen erschaffen, dann erschafft der Inhalt, in der Form, und nie die Form selbst. Form kann auf Form wirken. Inhalt wirkt nur innerhalb seiner selbst. Hat sich Inhalt einer Form verschrieben, dann hat er sein Sein in ein Werden eingetauscht, indem er mit und gegen andere Formen, im Entstehen und Vergehen der Existenz, ringt. Über die Veränderung der Form und über die Beeinflussung durch andere Formen wird Form zu etwas sich Verselbstständigendes. Inhalt hat sich selbst ausgeliefert und geopfert, damit ein Formenspiel gespielt werden kann. Glaubt der Inhalt in diesem Formenspiel, dass es selbst Form sei, dann scheinen alle eigens erschaffenen Formen auf den formbildenden Inhalt zurückzuwirken. Inhalt glaubt nahezu immer, er sei die Form, die er sich erschaffen hat, und es dauert lange, bis er seinen Irrtum bemerkt. Egal, wie extrem das Verhältnis von Form und Inhalt vom Inhalt hin zur Form gewählt wird, der Inhalt bleibt gleich! Und genau das ist es, was der Inhalt über die Form lernen muss, dass er unabhängig des eigenen Formwandelns inhaltlich gleichbleibt. Inhalt wird ganz zum Gegenteil, zur Form, und dadurch ganz (durch sein Gegenteil), indem er über die Form zu sich zurückkehrt. Inhalt muss die Erfahrung der eigenen Form machen, um seinen Inhalt bestätigt zu sehen, doch keine Form kann zur Gänze diese Bestätigung leisten. Inhalt muss sich in die Form verwickeln, an die Form binden, um irgendwann zu merken, dass der Inhalt unabhängig von Form gleich bleiben kann. Jeder Entwicklung ist eine Herausentwicklung aus dem in die Form verwickelten Inhalt. Das Ziel des Inhalts bei der Bindung an seine Form ist die Lösung von dieser. Inhalt ist die erste Ursache, die Prima Causa, die auf ihrem Weg in die Form die Form notwendigerweise zur ersten Ursache erklärt, damit sich der Inhalt von dort wieder aus der Form herausarbeiten zu kann. Die erste Ursache, der reiner Inhalt, wird zur letzten Wirkung, zur reinen Form. Und auf formaler Ebene wird nun die letzte Wirkung zur ersten Ursache, und die erste Ursache, zur letzten Wirkung. Von der reinen Form aus vertauscht sich Ursache und Wirkung, damit sich Inhalt aus seiner formalen Bestimmtheit herausentwickeln und zu sich als Inhalt zurückkehren kann. Der reine Inhalt bedarf dieser Herausentwicklung nicht, da er von seiner Unabhängigkeit und der Unmöglichkeit von Formbildung weiß. Alles, was auf der Formebene hin und her wirkt, ist dem immer gleichbleibenden Inhalt gleich. Inhalt geht nicht verloren, egal wie formbelastet er ist. Bei jedem Ursache- Wirkungssprung, bei jedem Darüber-Hinaus (Meta) lässt der Inhalt es zu, dass er sich von sich selbst entfernt und in die Entfremdung geht. Ein selbstentfremdeter Inhalt, der durch die Form in Inhaltsvergessenheit versunken ist, wird von seiner Form dominiert. Doch Formmerkmale sind rezessiv, wenn erkannt wird, dass der Inhalt aller Formen Inhalt ist. Hierdurch hört die Form auf, Form zu sein und offenbart sich als Inhalt. Die Frage nach der wahren Ursache von Formen erfragt den Grund von etwas nie Dagewesenen und führt sich deshalb in der Fragestellung schon selbst ad absurdum. Die anfangs getätigte Aussage, Inhalt sei der Ursprung der Form, ist folglich nur bedingt richtig, denn Inhalt hat Form im streng transzendenten Sinne nicht erschaffen, sondern Form hat sich selbst aus dem Bereich des Inhalts zur Existenz “hinausgeträumt“. Formen versuchen sich über die Vielzahl anderer Formen selbst zu verursachen. Doch sind sie jenseits der Seinsbestätigung von anderen Formen ursachenlos und damit inexistent, insofern die Bedeutsamkeit von Formen nicht mehr an anderen Formen, sondern am Inhalt gemessen wird. Inhalt verursacht Inhalt, nie aber hat Inhalt in der Pfadrichtung der Transzendenz eine Form verursacht. Und da Inhalt die einzig wahre Ursache sein kann, schwinden die prinziplosen Formen, sobald ihre Grundlosigkeit gesehen wird und eröffnen die Schau auf den einen formlosen Inhalt. Karikiert man die Inhaltslosigkeit der Form, so kann dies die Formlosigkeit des Inhalts zum Erscheinen bringen, die Formen aus ihrer Inhaltsvergessenheit erwecken und die systemisch-relationalen Selbstverursachungsversuche der Form enttarnen.
Die Lehre von der Form, die in die Inhaltsvergessenheit gestürzt ist, ist die Metaphysik oder auch Immanenzlehre. Die Lehre, die Inhalt vermittelt, wird hier als Transzendenzlehre bezeichnet. Die gesamte Abhandlung lehrt folglich den “Inhalt“ der Transzendenzlehre, und die Transzendenzlehre verweist auf den Inhalt. Alles, was existiert, hat die Doppelstruktur, die Gespaltenheit zwischen Inhalt und Form. Inhaltsarme Form ist leer, ist hohl, besitzt keine eigene Souveränität, keine Selbstauthentizität, eine geringe Eigenschwingung und kaum eine Wirkung, dafür existiert sie fest und konkret. Formarmer Inhalt ist subtil, transparent, allumfassend, fein, hochfrequent und hochpotent, dafür existiert er nur sehr abstrakt und transzendent. Inhalt ist phänomenale Gestimmtheit und auf seine eigene Inhaltlichkeit abgestimmt, wobei die Eigenfrequenz der Gestimmtheit schon wieder Form, schon wieder Ausdruck, und nicht Inhalt ist. Form dagegen ist Bestimmtheit in einem klaren Sachausdruck. Form drückt sich eher darüber aus, was etwas ist, Inhalt hingegen verweist darauf, wie etwas ist. Wie etwas ist, ist unabhängig von dem, was es ist, denn egal in welcher Form etwas erscheint, ist das, wie etwas erscheint, nicht in der Erscheinung selbst, sondern im Auge des Betrachters zu finden. Die Aussage, wie etwas ist, trifft noch keine Aussage darüber, wie etwas zu sein hat, denn Inhalt ohne Form entzieht sich jedem Urteil. Je formbereinigter etwas ist, desto mehr Gewahrsam kommt dem eigenen gegenstandslosen Inhalt zu, und desto leichter kann dieser durch die Form hindurchscheinen. Es geht darum, die Form zu öffnen, aufschließen, um den Inhalt daraus zu befreien. Wer dies macht, erkennt die Vielfalt in Form- und Ausdruckswandel des immer gleichen, inhaltslosen Inhalts. Ein anderer Weg zum Inhalt zu gelangen, ist die Abstraktion, denn was die Abstraktion abzieht, ist immer Form, nie aber Inhalt. Wenn sich Inhalt in die Form niedersetzt, dann deformiert die Form den Inhalt, wobei der niedergesetzte, in Form gekleidete Inhalt von sich glauben muss, dass er aus dem Nichts entstanden oder Ursache seiner selbst sei. Besinnt der Inhalt sich auf sich zurück, dann transzendiert er seine Form und erkennt das, woraus er hervorgegangen ist. Formen können gegeneinander stoßen, sich aneinander aufreiben und sich ihr Anderssein gegenseitig vorwerfen, denn mit der Unterscheidung von Formen kommen Kategorien wie richtig und falsch mit ins Spiel. Alles, was die Formen charakterisiert, wird im Inhalt in sein Gegenteil verkehrt, und Gegenteile sind als Gegenteil blind für einander, obwohl sie aus ein- und derselben Quelle stammen. Form kann nur Formen sehen, Inhalt dagegen kann nur Inhalt sehen, denn er sieht in allen Formen nur seinen Inhalt. Man kann Formen studieren und analysieren, bis in das kleinste Molekül hinein, und man wird trotzdem nicht an den Inhalt gelangen, solange man aus einer Formbetrachtung herausschaut. Erst wenn das zwischen den Formen hervorgetan und beobachtet wird, können die Formen selbst verstanden werden, denn erst der inhaltliche Kontext macht eine Form zu der, wie sie uns erscheint. Um das zu verstehen, was da ist, muss verstanden werden, was da ist, wo nichts ist. Form nimmt viele Formen an und ist doch aus Sicht des Inhalts nur eine bedeutungslose Idee eines Anderssein-Wollens, weshalb Form keine Verbindung zu anderen Formen eingeht, da sonst ihr Anderssein, ihre Formgrenze, aufgelöst werden könnte. Schließen sich Formen doch einmal zusammen, dann vereinigen sie sich nur, um mächtiger gegen andere Formen zu sein. Sie reichern sich quantitativ mit Formen an, wobei immer nur dann an Form gewonnen werden kann, wenn andere Formen Form verlieren. Formen treten nur dann zueinander in Kontakt, um aneinanderzugeraten und einen Konflikt auszutragen. Aus einem solchen Konflikt kann aus Sicht des Inhalts keine Form als Sieger hervorgehen, kämpfen sie doch nur gegen sich selbst, wobei der Inhalt auf beiden Seiten Verlust trägt. Im Bereich der Illusion von sich unterscheidenden Formen wird, gerade aufgrund ihrer Unwirklichkeit, um Wirklichkeit gekämpft. Das, was wahr ist, ist unveränderlich wahr, und damit sind Formen gerade deshalb unwahr, weil sie sich verändern. Sie ringen mit anderen Formen um ihre Wirklichkeit und versuchen, sich als besonders wirklich darzustellen, indem sie möglichst viele andere Formen als unwirklich darstellen. Wo nichts ist, muss darum gekämpft werden, damit der Kampfestrubel (die Bewegung) den Schein aufrechterhält, es sei doch etwas dort. Wobei der Angriff durch das, was er bewirkt, gerechtfertigt wird, da alle Gesetze innerhalb der Form invertiert, auf den Kopf gestellte Gesetze des Inhalts sind. Der Glaube, es gäbe einige Formen, die wahr sind, und andere, die es nicht sind, ist ein Glaube an eine Wirklichkeitsabstufung innerhalb der Illusion, wobei der in Form investierte Glaube immer eine Investition in die Vergänglichkeit selbst ist. Doch streng genommen, und aus Sicht des Inhalts vergehen die Formillusionen nicht, denn das würde die Wirklichkeit ihres vorherigen Daseins voraussetzen. Vielmehr erkennt man die Formen, wenn man sie durchschaut, als nie dagewesene. Keine Form, die ihren Inhalt vollständig erkennt, würde sich für ein Anderssein und eine Begrenzung innerhalb einer Form entscheiden, denn keine Form kann ihrem Inhalt gerecht werden. Im gleichen Maße wie Form Inhalt darzustellen versucht, versteckt sie diesen und verbirgt, dass etwas über die Form hinaus die Form durchsetzt. Dieses Darüber-Hinaus kann vom Inhalt erst über eine Deutung in einen Inhalt übersetzt werden. Form ist also die inhaltsfremde Zone, die erst dann bedeutsam wird, wenn sie in ihrer Funktion der Übermittlungsebene vom Inhalt gedeutet wird. Form an sich ist bedeutungslos, und das Sehen von Formen ist große Blindheit, wenn durch sie jeder Inhalt verloren geht. Erst wenn Formen als Gleichnis aufgefasst werden, kann dessen Symbolgehalt inhaltlich entnommen werden. Offenbart sich ein (hin zur Form verloren geglaubter) Inhalt und schafft dadurch die Selbstrückbindung zu seiner eigentlichen Inhaltlichkeit, dann vereinigt sich der Inhalt mit sich selbst und fügt sich somit in den einen Inhalt ein, der alle Formen formt und in einen Ordnungszusammenhang bringt. Form ist dimensional und konzeptuell. Inhalt ist nondual, nondimensional, nonkonzeptuell und nur über eine Negativbestimmung zu erfassen. Form ist Dimensionsaufteilung, Inhalt hingegen trägt in sich eine Weite jenseits jeder Dimension. Inhalt ist ein gegenteilsloses Einheitssymbol, das aber erst in der Gegenüberstellung zur Form verstanden werden kann. Inhalt für sich gesehen muss anders betrachtet werden, als Inhalt, der in die Polarität gezogen und der Form gegenübergestellt worden ist. Die Gegenüberstellung von Inhalt und Form ist eine Hilfskonstruktion zur Sichtbarmachung des eigentlich gegenteils- losen Inhalts. Form ist eine Form des Inhalts mit einem veränderten Ausprägungsgrad, nicht aber dessen Gegenteil, da Inhalt, wie gesagt, gegenteilslos ist. Gibt man dem Inhalt einen Namen, dann schadet man ihm, ja, alle definitorischen Benennungen kommen einer Zerstörung gleich, da Benennungen ein Relikt aus dem Bereich der Formen sind. So stark, wie hier formalisiert wurde, gibt es keinen Inhalt, der sich noch aussprechen ließe, und gleichzeitig bleibt kein Inhalt damit ungesagt…
Um die Unabhängigkeit von Inhalt und Form unter “Beweis“ zu stellen, nun folgendes Experiment: Inhalt ist ab jetzt Form und Form Inhalt! Über die Unabhängigkeit von Form und Inhalt hinaus, offenbart dieses Experiment die Wahllosigkeit sprachlicher Setzungen und stellt die Illusion einer festen Begriffssprache bloß. Wir lösen also jetzt einen Gedanken, eine Idee, von ihrem sprachlichen Etikett und etikettieren es sprachlich mit dem gegenteiligen “Begriff“. Diese Variabilität sorgt dafür, dass man nicht am sprachlichen Inhalt haften bleibt, sondern, dass man das eine formale Prinzip hinter jeder sprachlichen Inhaltlichkeit zu erkennen vermag. Das Leben, als abstrakte Lebensform, bietet eine Form, in der sich jeder mögliche Inhalt hineinergießen kann. Form formt alles und überformt es in etwas Existierendes.Form als solche ist inhaltslos, doch inhaltslose Form ist nichts, da Form erst über Inhalte sich formal Ausdruck verleihen kann. Dafür kann inhaltslose Form allen möglichen Inhalten Form geben und so in die Wirklichkeit überformen. Hat sich die Form in eine Erscheinung begeben, beginnt die Identifikation mit Inhalten, wobei die Form als Form bestehen bleibt. Formschön ist die Form nur, wenn sie nicht zu sehr von Inhalten zugestellt ist. Inhalte besitzen ein Relativierungsvermögen und wirken wie hypnotisch auf die Form, die sich von ihnen verführen lassen möchte. Hat sich eine Form erst einmal mit Inhalten angereichert und in die Inhaltswelt verstrickt, dann scheint es, richtige oder falsche, passende oder weniger passende Inhalte zu geben. Einige Inhalt scheinen wie für die Form geschaffen zu sein und wissen ihren formalen Selbstausdruck zu bestätigen, an andere Inhalte wagt sich die Form nicht heran, da sie Angst hat, an ihnen zu Bruch zu gehen. Sie wählt das eine aus und lehnt das andere ab, bis sie lernt, dass es keinen Inhalt gibt, für den sie nicht Form sein kann. Gleichzeitig merkt die Form, dass es keine Inhalte gibt, die ihre Form selbst auszudrücken vermögen, da jeder Ausdruck inhaltliche Aufladung mit sich bringt. Die Form wird nun immer transparenter, je mehr Inhalte sie aus sich heraushalten kann. Die Form lernt an den Inhalten, dass kein Inhalt mit dem zu tun hat, was sie als Form ist. Die Bewusstseinsform der Form scheint bei manchen Inhalten einen inhaltsgerechten Umgang gewährleisten zu können und bei manchen nicht. Doch Inhalte können alles ausdrücken, nur nicht ihre Form, sonst wären es keine Inhalte. Es gibt keine Inhalte, es gibt lediglich Form, die Inhalte aus sich heraus evozieren. Eine prämanifeste Erscheinungsform ist Form im strengen Wortsinne, doch wenn Erscheinungsformen erscheinen, reichern sie sich mit Inhalten aus ihrem Inneren an, indem sie sie in ein scheinbares Außen projizieren. Identifiziert sich Form mit dem aus sich heraus geborenen Inhalt, dann wirken alle anderen, bereits bestehenden Inhalte auf die Form ein. Form verliert damit seine formvollendete Formschönheit, wenn diese mit Inhalten durchmischt wird. Form bleibt immer als Form und als Gesamtheit ihrer Eigenschaften bestehen, unabhängig ihres Inhalts! Das, was wir sind, ist reine inhaltslose Form, die sich, wenn sie sich einen Inhalt gibt, nicht selbst wiedererkennt. Etwas bestimmt Erscheinendes ist mehr Inhalt als Form, was eine mögliche Anhaftung mit diesem mit sich bringt. Ein inhaltsloses Wesen wird schnell zu einem formlosen Wesen, da es sich aus der Identifikation mit Inhalten löst und nur bestimmte, feste Inhalte Haftung gewährleisten. Abstraktion ist stets ein Abzug des Inhalts, nie aber Abzug von Form, und sie ist deshalb so dienlich, weil man durch die wachsende Inhaltslosigkeit beginnt, sich selbst in die Struktur einzufüllen. Inhaltsentladungen öffnen Möglichkeitsräume, die die Erfahrbarmachung der eigenen (Lebens)Form ermöglichen, ohne dass diese mit inhaltlichem Gedankengut durchmischt werden. Ist der sachinhaltliche Input auf ein Minimum reduziert, liegt die Aufmerksamkeit mehr auf der Art, zu denken, als auf dem, worüber man nachdenkt. Das, worum es dann eigentlich geht, ist die Spiegelung seiner selbst aufzufangen und sich seiner eigenen Bewusstseinsform bewusst zu werden. Wird inhaltsabstrahierte Form versprachlicht, beschäftigt sich der Leser im Lesen mit sich selbst, und die klassische Subjekt-Objekt-Trennung ist heruntergefahren. Die Denkform, die sich am Inhaltlichen aufhängt, ist bedenklich, wohingegen das gedanklich Ungerichtete, was frei spielerisch mit Form umgeht, wichtiges, kreatives Gut bedeutet. Form ist der stille Beobachter in dir, der die Inhalte an sich vorbeiziehen sieht, ohne sie zu werten oder zu beurteilen, und sie Stück für Stück immer mehr untereinander angleicht. Unterscheidet Form nicht mehr zwischen verschiedenen Inhalten und sieht, dass sie Formgeber aller möglichen Inhalte ist, dann entdeckt sie, dass kein Inhalt seine Form auszudrücken weiß. Sie löst sich von der Welt der Inhalte und begibt sich als reine Form in das absolute Reich der einen formlosen Form.
(Innerhalb der Abhandlung sind Form und Inhalt einmal auf diese und einmal auf die vorherige Art verwendet worden. Das meint es, dass man das, worauf ein Zeichen zeigt, nur aus der Kontexteinbettung des Zeichens verstehen kann, nicht aber aus dem isolierten Zeichen selbst).
Innerlichkeit und ÄußerlichkeitOder: Was du bist, und was du nicht bist
Das, was du bist, ist Innerlichkeit, doch wenn du nicht auch Äußerlichkeit in die Innerlichkeit zugelassen hättest, dann wärst du nicht. Denn das, was du bist, kann als reine Innerlichkeit nicht existieren, ja erst die Äußerlichkeit stellt das Sprungbrett für den Sprung in die Existenz bereit. Innerlichkeit, das was du bist, ist. Ist unbedingt. Ist ohne Bedingung und damit auch nicht dingfest zu objektivieren. Die Bedingung für die Existenz ist die Bedingtheit, die Dingwerdung , das Hereinholen von Äußerlichkeit. Das Unbestimmte, was du bist, kann nicht unbestimmt existieren, ist doch die Bestimmung und damit auch das Bestimmt- Werden notwenige Voraussetzung für die Existenz. Innerlichkeit muss sich in Bestimmtes und Unbestimmtes aufspalten, um Innerlichkeit und Äußerlichkeit auszubalancieren. Eine geteilte Innerlichkeit tritt immer mit einer Ambivalenz, einer Ambiguität, an Äußerlichkeiten heran, in der es sich entweder dazu entscheidet, Innerlichkeit sein zu lassen und in eine Innerlichkeitsbeziehung einzugehen, oder sich mit innerer Äußerlichkeit an äußeren Äußerlichkeiten zu stoßen. Innerlichkeit ist Vollkommenheit, die, wenn sie als Vollkommenheit in Erscheinung treten möchte, sich ihrer inneren Vollkommenheit enthebt. Dadurch, dass das Naturell der Innerlichkeit, die du bist, Vollkommenheit ist, ist Vollkommenheit keine schwer zu erbringende Leistung. Im Gegenteil: Das, was für dich wirklich schwer war, war dich selbst von der Idee deiner eigenen Unvollkommenheit zu überzeugen. Die Überzeugung eigener Unvollkommenheit geht einher mit dem Glauben, dass Trennung und Absonderung von allem, was ist, geschehen könnte. Damit ist die Basis von allem getrennt Existierenden die Unvollkommenheit. Der Mensch, der sich als Mangelwesen auffasst, baut seine eigene Bedürftigkeit auf die Innerlichkeit und die in ihr noch bestehende Idee der Vollkommenheit auf. Würde es keine Innerlichkeit und damit kein intuitives Grundwissen über die Vollkommenheit des großen Ganzen geben, dann könnten wir uns selbst nicht als mangelleidend wahrnehmen. Die Innerlichkeit sieht die Innerlichkeit in jeder Äußerlichkeit und Äußerlichkeit sieht die Äußerlichkeit jeder Innerlichkeit. Oder mit andern Worten: Die Unvollkommenheit sieht die Vollkommenheit unvollkommen und die Vollkommenheit sieht die Unvollkommenheit vollkommen. Würde die Vollkommenheit die Unvollkommenheit als Unvollkommenheit sehen können, dann wäre die Vollkommenheit unvollkommen. Vollkommenheit kann nicht existieren, und trotzdem gibt es nichts, was nicht vollkommen ist. Begegnen sich innere Vollkommenheit und äußere Unvollkommenheit, dann avancieren sie in dem jeweils Anderen ihre eigene Wesensart. Der Mensch als Doppelwesen zwischen Innerlichkeit und Äußerlichkeit kann sich frei dazu entscheiden, in der Unvollkommenheit die Vollkommenheit zu sehen und dadurch die Vollkommenheit in dem Unvollkommenen anzusprechen, sie herauszulocken und sie dadurch zu realisieren. Das Einzige, was dafür getan werden muss, ist die Rückbesinnung auf das, was er ist. Äußerlichkeit ist wirklichkeitsgebunden und bedingt durch eine, in ihr niedergesetzte Innerlichkeit Die Unbedingtheit der ungesetzten Innerlichkeit entbindet von jeder faktischen Wirklichkeitsgebundenheit und bringt eine Möglichkeit mit ins Spiel, die nicht weniger wirklich ist, als die Wirklichkeit selbst. Ein an der Äußerlichkeitswahrnehmung orientiertes Leben ist eine beständige Replizierung vergangener Unvollkommenheitsvorstellungen, die die innere Vollkommenheitsbasis, den vorherigen schöpferischen Akt, leugnet. Die Innerlichkeit ist kontrafaktisch, solange “Ich und Welt“, Innerlichkeit und Äußerlichkeit noch auseinander diffundieren. Doch was ist ein Fakt, wenn nicht letztlich etwas von der Innerlichkeit Hervorgebrachtes und damit durch die Innerlichkeit Veränderbares? Innerlichkeit kann Wahrnehmung und Wirklichkeit überfliegen, gerade weil sie diese durch Wahrgebung von Möglichkeit erschaffen hat. Lasse die Innerlichkeit, die du bist, die Äußerlichkeit, die du einmal sein wolltest, aber nicht bist, überflügeln! Die Kunst besteht darin, eine Glaubensgewissheit in das Potenzial der Innerlichkeit zu setzten und zu lernen, diese konsequent über Äußerlichkeiten zu stellen. So wird die Lücke zwischen den eigenen fantastischen Innerlichkeitszuständen und der äußeren Manifestation dessen verschwindend gering, bis keine Weltenkonstruktion mehr aussteht, da sich Innerlichkeit und Äußerlichkeit geeint haben, bzw. Äußerlichkeiten hineingeholt und als Innerlichkeit durchschaut wurden. Aus der Sicht dessen, was du nicht bist, ist das, was du bist, eine exorbitante Selbstüberschätzung, doch das, was du bist, ist geistige Gesundheit. Und tatsächlich entspricht die Selbsteinschätzung von depressiven Menschen eher ihrem faktischen Fähigkeitsniveau, als bei psychisch gesunden Menschen, die sich mit ihren Einschätzungen systematisch überschätzen. Das Leben in einer kontrafaktischen Innenwelt zeugt von geistiger Gesundheit, denn erst hier lebt ein Geschöpf seinen eingeborenen Schöpfungsmodus aus. Die Innerlichkeit liebt es, sich mit Äußerlichkeiten anzureichen, wobei sie selbst dabei verschüttgeht, und sich ihrer Schöpfungskraft, nach ihrem Willen selbst Äußerlichkeiten zu gestalten, beraubt. Eine fast selbst zu Äußerlichkeit gewordene Innerlichkeit muss sich erst aller Äußerlichkeiten entledigen, um ihr Schöpfungspotenzial zu erkennen. Eine potente Innerlichkeit ist diejenige, die ihr eigenes Sein über die konventionelle Realität zu stellen weiß und immer wieder entgegen eigener Denkgewohnheiten, gegen eigene Musterbildung, denkt. Es ist eine Innerlichkeit, die entgegen einer Festsetzung arbeitet und an äußere Manifestationen nicht anhaftet, unabhängig, ob sie bewusst gewollt, oder unbewusst ungewollt sind. Eine solche Innerlichkeit ist nicht ergebnis-, sondern prozessorientiert, da alles was sie macht Selbstzweck ist, unabhängig der daraus entstehenden Resultate. Diese sehr reine Form der Innerlichkeit geht keinen Weg in der Hoffnung, auf diesem etwas zu finden, oder irgendwo anzukommen. Sie selbst ist der Weg, und egal wo sie hingeht, ist sie immer schon dort angekommen. Sie ist schon immer das, was sie werden will, womit jede Sorte Veränderungen spielend einfach wird. Anstatt sich passiv reaktiv zu Umwelt zu verhalten, verhält sie sich aktiv kreativ, da sie sich als Ursache jeder auf sie einwirkenden Erfahrungen sieht. Nur eine gefestigte, rein gehaltene Innerlichkeit ist stabil genug, die volle Verantwortung für alle ihr widerfahrenden Ereignisse zu tragen. Je mehr Last der Eigenverantwortlichkeit getragen werden kann, desto mehr kann aus der Innerlichkeit heraus erschaffen werden, anstatt sich scheinbar von Äußerlichkeiten erschaffen zu lassen. Eine Figur im Weltengeschehen wird dann immer mehr zu einem Spieler, der die Ursache seiner Erfahrung ist, anstatt nur deren Auswirkungen wahrzunehmen, auf sie zu reagieren und sie für etwas außerhalb von sich zu halten. Ein Spieler mit einer von allen Äußerlichkeiten befreiten Innerlichkeit ist resistent gegen jede Form äußerer Gifte und Verschmutzungen, da alles von außen Kommende nicht Verunreinigungen oder Befleckungen hereintragen kann. Haben sich jedoch Äußerlichkeiten innerlich festgesetzt, dann sind diese wie Andockstellen, an denen sie ihre toxische Wirkung entfalten können. Ignoriert man jede Innerlichkeit, wird alles Absolutheitsnahe, Vollkommene, als eine idealistische Illusion abgetan. Ist die Innerlichkeit aber Grundbaustein für alles darauf Aufbauende, dann wird alles Absolutheitsferne, Relative, als gleichermaßen illusionsbehaftet betrachtet. Es kommt lediglich darauf an, ob der Standpunkt, von dem angefangen wird denkerisch tätig zu werden, ein innerlicher oder ein äußerlicher ist. Eine Innerlichkeit nimmt mit Gelassenheit das, was die Äußerlichkeiten geschäftig werden lässt, um dort geschäftig zu sein, wo die Äußerlichkeit gelassen bleibt. Innerlichkeit durchsetzt und transzendiert Äußerlichkeiten und offenbart somit andere Innerlichkeit, was zum Wegfall der Vorstellung der Andersartigkeit führt, da auch bei unterschiedlichsten Innerlichkeitsformungen deren Substanz immer ein und dieselbe bleibt. Innerlichkeit kann weder in dir noch von anderen getrennt sein, da sie alle äußeren Formen, alle Körper durchsetzt und eine Art kollektives Innerlichkeitssystem bildet. Gleichklingende Innerlichkeiten räsonieren miteinander und bilden Subsysteme. Umso mehr gleichschwingende Innerlichkeiten sich zusammenfinden, desto wirkmächtiger können sie erschaffen, denn Innerlichkeit potenziert sich, wenn man sie teilt.Auf das, was in der Innerlichkeit eines Wesens, besonders aber in den kollektiven Innerlichkeitssystemen passiert, folgen äußerliche Manifestationen in der Sinnenwelt. Stimmt sich Innerlichkeit innerhalb mehrerer Körper aufeinander ein, dann merkt man das an der Stimmung. Wenn etwas räsoniert, stimmt es, es harmoniert im Einklang miteinander und findet Anklang und Zustimmung bei denen, die gleichgestimmt und gleichgesinnt sind. Nur von dem, was räsoniert, sind wir bewegt, und nur das, was uns tangiert, kann etwas in uns in Bewegung setzen. Durch die Übereinstimmung von Innerlichkeit wird diese immer energetischer, bis entweder Unstimmigkeiten auftreten und destruktive Interferenzen das Eingestimmtsein hemmen, oder bis sich Innerlichkeit in etwas Äußerlichem Ausdruck verleiht. Wenn dann die Innerlichkeit nicht wieder den Weg zurück zu sich findet und an ihrem manifestierten Ausdruck haftet, dann hat sie sich im Materiellen bestimmt, was die Innerlichkeit auf Dauer verstimmt, beziehungsweise ihre Stimmung drückt. Hat sich eine Innerlichkeit einmal ausgedacht und haftet an dem dabei Herausgedachten, dann hat es sich für diese Innerlichkeit ausgedacht, und alles, was sie sieht, sind Verschiedenheiten äußerer Formen. Anstatt über Dinge im Außen innere Prozesse weiterzuentwickeln, haben wir gegenteilig innere Prozesse verwendet, um Äußerlichkeiten zu gestalten. Doch die Innerlichkeit dient nicht dem besseren Verstehen von Äußerlichkeiten, sondern Äußerlichkeiten sind für das Verständnis der Innerlichkeit da. Die Innerlichkeit erschafft Äußerlichkeit, die Äußerlichkeit erschafft aber nie Innerlichkeit, denn Innerlichkeit ist immer zur Gänze vorhanden. Damit aber die von der Innerlichkeit gemachten Äußerlichkeitsdinge für den Menschen wirklich werden, muss er glauben, dass Äußerlichkeit auf Innerlichkeit wirke. Oder mit anderen Worten: Menschen machen Dinge, doch Dinge machen keine Menschen. Damit aber die von Menschen gemachten Dinge für den Menschen wirklich werden, entwickelt er einen Glauben daran, dass Dinge Menschen machen, denn hätten diese Dinge keinen Einfluss auf den Menschen, so wären sie nicht wirklich.