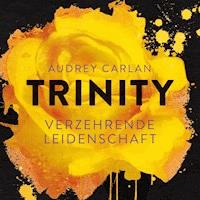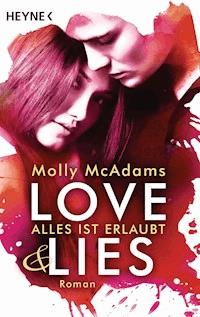9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: venusbooks
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Zwei Stuten und ein Hengst: Der erotische Roman »Eine tabulose Familie« von Mike Schoppke jetzt als eBook bei venusbooks. Einfach unglaublich – und verboten geil … Mike traut seinen Augen kaum, als er Zeuge eines Banküberfalls wird – und die Ganovin nicht nur knallhart, sondern auch noch ein scharfes Luder ist! Als würde sie seine Gedanken lesen könnten, nimmt sie ihn als Geisel. Doch als die beiden der Polizei entkommen sind, denkt Sandra gar nicht daran, Mike gehen zu lassen: Stattdessen soll er es ihr nach allen Regeln der Kunst so richtig besorgen! Schnell merkt Mike, dass seine neue »Herrin« eine unersättliche Stute ist, die es 24 Stunden am Tag braucht. Als plötzlich jedoch ihre Mutter auftaucht, bricht zwischen den schamlosen Schlampen Streit um die Beute aus – und darum, ob die junge Tochter oder die heiße MILF Mikes Schwanz dringender nötig hat … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der herrlich versaute Erotik-Roman »Eine tabulose Familie« von Mike Schoppke. Lesen ist sexy: venusbooks – der erotische eBook-Verlag. Jugendschutzhinweis: Im realen Leben dürfen Erotik und sexuelle Handlungen jeder Art ausschließlich zwischen gleichberechtigten Partnern im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden. In diesem eBook werden fiktive erotische Phantasien geschildert, die in einigen Fällen weder den allgemeinen Moralvorstellungen noch den Gesetzen der Realität folgen. Der Inhalt dieses eBooks ist daher für Minderjährige nicht geeignet und das Lesen nur gestattet, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über dieses Buch:
Einfach unglaublich – und verboten geil … Mike traut seinen Augen kaum, als er Zeuge eines Banküberfalls wird – und die Ganovin nicht nur knallhart, sondern auch noch ein scharfes Luder ist! Als würde sie seine Gedanken lesen könnten, nimmt sie ihn als Geisel. Doch als die beiden der Polizei entkommen sind, denkt Sandra gar nicht daran, Mike gehen zu lassen: Stattdessen soll er es ihr nach allen Regeln der Kunst so richtig besorgen! Schnell merkt Mike, dass seine neue »Herrin« eine unersättliche Stute ist, die es 24 Stunden am Tag braucht. Als plötzlich jedoch ihre Mutter auftaucht, bricht zwischen den schamlosen Schlampen Streit um die Beute aus – und darum, ob die junge Tochter oder die heiße MILF Mikes Schwanz dringender nötig hat…
Mike Schoppke veröffentlichte bei venusbooks außerdem den Roman »Wenn die Stiefmutter kommt«.
***
eBook-Lizenzausgabe Juni 2021
Ein eBook des venusbooks Verlags. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Dieses Buch erschien bereits 2017 unter dem Titel »Eine feine Familie« bei Edition Combes
Copyright © der Originalausgabe 2017 Edition Combes im Verlag Frank de la Porte, 96328 Küps
Copyright © der eBook-Lizenzausgabe 2021 venusbooks Verlag. venusbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, München.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von AdobeStock/deagreez
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-96898-120-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des venusbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieses eBook gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eine tabulose Familie« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.venusbooks.de
www.facebook.com/venusbooks
www.instagram.com/venusbooks
Im realen Leben dürfen Erotik, Sinnlichkeit und sexuelle Handlungen jeder Art ausschließlich zwischen gleichberechtigten Partnern im gegenseitigen Einvernehmen stattfinden. In diesem eBook werden erotische Fantasien geschildert, die vielleicht nicht jeder Leserin und jedem Leser gefallen und in einigen Fällen weder den allgemeinen Moralvorstellungen noch den Gesetzen der Realität folgen. Es handelt sich dabei um rein fiktive Geschichten; sämtliche Figuren und Begebenheiten sind frei erfunden. Der Inhalt dieses eBooks ist für Minderjährige nicht geeignet und das Lesen nur gestattet, wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind.
Mike Schoppke
Eine tabulose Familie
Erotischer Roman
venusbooks
Vorwort
Eigentlich sollte ich nicht mit diesem Wort anfangen, meine Geschichte zu erzählen. Schon mein Großvater hat immer gesagt: »Eine Geschichte, die mit ›Eigentlich‹ beginnt, kann nur mit dem Teufel enden!«
Ja, genau, das war dieser Großvater, der an Feen und Elfen glaubte und der jeden Morgen seinem Frühstücksmüsli aufmerksam zuhörte, wenn es ihm den Sinn des Lebens erklärte.
Also, ich fange nochmal an: Eigentlich unterschied sich dieser Tag in nichts von allen anderen Tagen – zumindest nicht für mich. Ich war so pleite, und mein Leben war so aussichtslos, dass ich bereits fest entschlossen war, es entweder radikal zu ändern oder aber zu beenden. Zur ersten Möglichkeit fehlte mir alles, vor allem das nötige Geld, das man für Veränderungen nun mal braucht. Möglichkeit zwei wurde täglich ein bisschen reizvoller, und als ich an diesem Morgen feststellte, dass ich weder Kaffee noch irgendetwas im Kühlschrank hatte und mich mit einem Frühstück in Form von warmem Wasser aus dem Wasserhahn in der Küche begnügen musste, beschloss ich, dem Leben eine letzte Chance zu geben. Vielleicht hatte Opa ja recht, und es gab wirklich die Wunder, von denen er immer sprach, wenn er zu tief in die Frühstücksflocken geschaut hatte.
Und vielleicht gab es ja auch die guten Feen, die er angeblich immer sah. Drei Wünsche, wie sie den Verzagten und Enttäuschten im Märchen so oft zur Verfügung stehen, wären ziemlich toll gewesen, aber ein einzelner erfüllter hätte mir auch schon ausgereicht.
Kapitel 1
Ich sah dem Bankangestellten hinter seiner nicht von Panzerglas geschützten Schaltertheke an, dass er sein dreckiges, fieses Grinsen nur mit sehr großer Mühe unterdrücken konnte. Das schaffte er, weil er so tat, als würde er sich sehr intensiv mit dem beschäftigen, was sein Computerbildschirm zu meinem Kontostand und meinen finanziellen Möglichkeiten anzeigte. Wieder und wieder tippte er auf seiner Tastatur herum, und ich vermutete, dass er auf Pornoseiten surfte oder seinen Kumpels auf Facebook eine Nachricht postete: »Der Pleitegeier Mike Schoppke ist wieder da und bittet um Geld, hahaha«, oder so ähnlich, während er sein Posting mit einer Nahaufnahme meines Konterfeis aus der Überwachungskamera verzierte. Eine Sekunde später hatte er vermutlich fünfzig Likes und zehn Kommentare.
Okay, wenn ihn das glücklich machte, bitteschön. Er war auch nur einer von den armseligen Hamstern, die ihre Runden im Rad drehten und sich dabei frei und erhaben fühlten. Ich hoffte nur, Gabi würde mein Bild nicht sehen, falls er es denn postete. Sie war mein einziger kleiner Lichtblick, und wir kannten uns noch nicht lange genug, als dass sie wissen konnte, wie es um mich stand.
»Wieviel wollten Sie nochmal abheben, Herr Schoppke?«
Er fragte mich das allen Ernstes, und er hielt es noch nicht einmal für nötig, dabei von seinem Bildschirm aufzublicken und mich anzuschauen. Wahrscheinlich musste er meinen Kontostand erst mit dem DAX, dem Nikkei, dem Dow Jones, der täglichen Inflationsrate und dem aktuellen Bruttoinlandsprodukt abgleichen, um entscheiden zu können, ob er mir etwas auszahlen konnte oder nicht.
»Fünfzig«, wiederholte ich bereits zum zweiten Mal und verkniff mir die unterwürfige Ergänzung »Für Lebensmittel«. Noch hatte ich einen kleinen Rest von Stolz im Leib, und den hatte ich mir auch bewahrt, als der Geldautomat da draußen mir und allen Umstehenden mit einem so lauten Piepen, dass man hätte meinen können, ich wolle ihn aufbrechen, meine Karte wieder ausgespuckt hatte, um mir auf dem Display zu verkünden: »Auszahlung nicht möglich, bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice.«
Fünfzig Euro für Lebensmittel – sowohl für mich als auch für das Abendessen mit Gabi, denn ich hatte versprochen, für sie zu kochen. Das musste doch möglich sein!
Der Bankangestellte wiegte den Kopf hin und her. Er musste eine schwerwiegende Entscheidung treffen, von der die nächste Umdrehung der Erde abhing. Er konnte es wohl nicht riskieren, mir fünfzig Euro zu geben, ohne damit die nächste Weltwirtschaftskrise auszulösen.
»Das wird schwierig«, erklärte er mir, »denn Ihr Konto ist weit überzogen, der Dispo ist …«
Ich hörte nicht mehr richtig zu. Diesen Sermon kannte ich bereits in- und auswendig. Ich steckte in einer Krise, soviel war klar, und ich brauchte Geld, um aus dieser Krise wieder herauszukommen. Dieses Geld bekam ich aber nicht, wodurch sich die Krise vertiefte und der Geldbedarf erhöht wurde.
Ich dachte an Opa und die Feen, von denen er immer sprach. Wahrscheinlich war er im Pflegeheim mit seinem Müsli und seinem schrägen Blick auf die Realität sehr viel glücklicher, als ich es jemals sein würde. Letzte Chance für das Leben: »Lass ein Wunder geschehen und eine Fee erscheinen!«
»Was sagten Sie bitte?«
Der Angestellte schaute mich stirnrunzelnd an. Verdammt, das hatte ich wohl gerade laut gesagt.
»Oh, nichts weiter, ich sagte nur …«
Weiter kam ich nicht.
In diesem Augenblick geschah das Wunder.
Ja, so kann man es wohl nennen. Irgendwie.
Kapitel 2
Im Fernsehen klingt ein Schuss aus einer Pistole immer so ein bisschen wie die Platzpatronen beim Cowboy- und Indianerspielen, damals in der Kinderzeit. In Wirklichkeit aber ist es ein ohrenbetäubender Knall, nach dem man erst einmal so gut wie gar nichts mehr hört – insbesondere, wenn die Waffe innerhalb eines geschlossenen Raumes abgefeuert wurde. Wie zum Beispiel im Schalterraum einer Bank.
Den Ruf »Das ist ein Überfall!« konnte ich gerade noch gut genug verstehen, um zu erkennen, dass er von einer Frau kam. Ehrlich gesagt hielt ich das Ganze erstmal für einen Scherz mit versteckter Kamera, denn die Feststellung, dass dies die Realität war und genau jetzt und hier und mir passierte, wollte sich einfach nicht den Weg in meinen Verstand bahnen. Aber kurz flammte darin der Gedanke auf, dass ich mich für Möglichkeit zwei entscheiden und einen heldenhaften Abgang aus diesem Leben hinlegen konnte, indem ich versuchte, die Bankräuberin zu überwältigen und dabei erschossen zu werden. Da würde der feixende Typ hinter seinem Schalter aber sein ganzes Leben dran zu knabbern haben. Ha!
»Vollpacken, alles was reinpasst, und zwar nur große Scheine«, rief die junge und bemerkenswert attraktive Frau, die – abgesehen von der schwarzen Bob-Frisur und der Tatsache, dass sie High Heels trug – eine gewisse Ähnlichkeit mit Audrey Hepburn in »Breakfast at Tiffany’s« hatte und filmreif mit der Knarre herumfuchtelte. Sie warf dem nun nicht mehr feixenden Banker eine Handtasche auf die Theke. Genau, eine Handtasche! Und zwar keine billige, sondern eine, bei der sogar ein Mann wie ich erkennen konnte, dass es irgendein teures Stück war. Mindestens Gucci oder Louis Vuitton!
»Wir haben nur sehr geringe Bargeldbeträge hier in der Kasse«, stammelte der Banker und sah jetzt nicht mehr ganz so selbstsicher und überlegen aus wie noch vor ein paar Minuten mir gegenüber. »Alles andere ist zeitschlossgesichert.«
Während mir der absurde Zusammenhang zwischen dieser Bemerkung und dem Spruch »Zeit ist Geld« durch den Kopf huschte, erklärte ihm die hübsche Dame hinter der riesigen Sonnenbrille, dann solle er die Zeit mal ein wenig beschleunigen oder die Sicherung umgehen, denn sonst müsste sie den Motivationsfaktor erhöhen.
Bevor mein ehemaliger Verhandlungspartner irgendetwas erwidern konnte, musste ich erkennen, dass mir in diesem Schauspiel gerade eine tragende Rolle zuteil wurde. Die Hauptdarstellerin, die zum Banküberfall im kleinen Schwarzen erschienen war, packte mich beim Kragen, zog mich zu sich heran und hielt mir ihre Pistole an die Schläfe. Von der Idee des heldenhaften Abgangs verabschiedete ich mich sofort. Die Diskrepanz zwischen Theorie und Realität war zu groß. Sie würde mir das Hirn aus dem Schädel pusten, ganz ohne Frage.
»Na los, wird’s bald?«, schnauzte sie den zitternden Jungspund hinter dem Schalter an. »Oder wollen Sie lieber Blut sehen?«
Angesichts des Umstandes, dass es sich dabei um mein Blut gehandelt hätte, lag mir auf der Zunge, ihr zu sagen, sie brauche für mich keinen Finger krumm zu machen. Der nächste blöde Gedanke war die Erkenntnis, dass sie herrliche kleine und feste Titten hatte. Das merkte ich, als sie mich zu sich heranzog und sich von hinten noch enger an mich presste, als wollte sie mich ficken oder mindestens als Schutzschild benutzen. Was man doch für einen Blödsinn denkt, wenn man Angst hat, im nächsten Moment zu sterben. Von wegen »Das ganze Leben zieht noch einmal an einem vorbei!«. Alles Quatsch! Ich dachte vielmehr an die fünfzig Euro, die ich dringend brauchte, an die Titten der Kleinen hinter mir und dass ich sie unter anderen und unbewaffneten Voraussetzungen nicht von der Bettkante stoßen würde.
Glücklicherweise wollte der Banker mich lieber lebendig als tot sehen, und wie auch immer er es schaffte, das Zeitschloss außer Kraft zu setzen: Er packte bündelweise große Scheine in die Handtasche der Frau.
»Schneller, Mann«, knurrte sie. »Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.«
Die Mündung ihrer Pistole, die sie mir an die Schläfe drückte, war noch warm vom abgefeuerten Schuss. Ich hätte Angst haben müssen, und das wäre ja auch eigentlich die normale Reaktion gewesen – aber stattdessen fühlte sich plötzlich alles so herrlich gleichgültig an. Ich dachte daran, wie groß ihre Titten wohl wirklich sein mochten und welche Stellung sie im Bett bevorzugte, und ob sie mir fünfzig Euro leihen könnte, falls der Banker mir keine geben würde.
Erst ihr »Nimm die Tasche!« riss mich aus meinen Träumereien zurück in den Horror der Wirklichkeit.
»Was?«
»Die Tasche«, blaffte sie mich an, und ich sah, dass uns der Banker, der ebenso zitterte wie ich, die Gucci-oder-sonstwas-Tasche entgegenhielt, die nun noch wertvoller war als vorher. »Ich habe gerade keine Hand frei, wie du dir wohl denken kannst.«
Okay, ich nahm die Tasche. In den Augen meines Kundenberaters sah ich sowas wie Mitleid der Sorte »Du arme Sau«, womit er natürlich mich meinte und gleichzeitig froh war, dass es nicht ihn selbst oder womöglich einen der reichen Kunden erwischte, sondern nur einen mit völlig überzogenem Konto. Das war wohl eher verkraftbar.
Die Tasche hatte ein enormes Gewicht, und ich dachte noch, dass ich noch nie im Leben so viel Geld in der Hand hatte und – mit einer Waffe am Kopf – vermutlich auch nie wieder haben würde. Trotzdem kam ich mir mit einer Frauenhandtasche in der Hand ziemlich doof vor. Hoffentlich sah mich niemand, der mich kannte.
»Und jetzt schön langsam rückwärts gehen! Du bist meine Geisel.«
»Aber …« Ich hatte eigentlich keine Ahnung, was ich erwidern wollte, aber sie unterbrach mich sowieso mit einem »Klappe!«, dessen herrischer Tonfall die Vermutung aufkommen ließ, dass sie vielleicht eine Domina war, die sich in diesen schwierigen Zeiten mit Banküberfällen ein bisschen was nebenher verdiente. Zumindest hatte sie Ahnung vom Rumkommandieren.
»Wenn keiner hier Sperenzien macht, ist die Sache gleich vorüber, und niemand wird verletzt.«
Zum Glück rührte sich niemand – abgesehen von einer Frau, die kurzerhand in Ohnmacht fiel. Die junge Lady zerrte mich so geschickt rückwärts mit sich mit, als würde sie das jeden Tag machen oder als habe sie das zumindest schon sehr intensiv geübt. Ich entwickelte innerhalb von Sekunden eine Art Stockholm-Syndrom und fand meine Peinigerin rattenscharf und bewunderte sie sogar. Ich mochte das Klicken ihrer Absätze auf dem Marmorboden, und als ich den Blick senkte, um zu verhindern, dass ich über ihre Füße stolperte, sah ich, dass sie Netzstrümpfe trug. Dass es Strümpfe waren, wusste ich, denn so ein Weib trug sicher keine Strumpfhosen. Mal ernsthaft: Wenn das nicht rattenscharf war, was dann? Eine Frau, die in einem solchen Outfit einen Banküberfall macht, konnte nur ein echter Kracher sein – oder eine Wahnsinnige!
»Wo steht dein Auto?«, fragte sie und rüttelte an meinem Kragen, als sich die automatischen Türen hinter uns öffneten und der Straßenlärm uns entgegenwaberte wie eine zähe Masse. Meine Hoffnung, dass da draußen schon ein SEK, die GSG9 und mindestens hundert weitere Polizisten bereitstünden, um mich zu befreien, fiel wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
»Ey Alder, guck, krass, voll die Geisel«, hörte ich einen eher begeistert klingenden Ausruf und sah die Lady und mich schlagartig umringt von einem Rudel Menschen, die uns mit ihren Handys filmten.
»Wo steht dein Auto?«, fragte die kleintittige Schöne noch einmal, und diesmal klang eine gewisse Unsicherheit am Rande der Panik aus ihrer Stimme heraus. Das konnte gefährlich werden, und zwar für mich.
»Der dunkelblaue Fiat«, erwiderte ich. »Dort!«
»Nicht dein Ernst«, hörte ich sie seufzen. »Die verbeulte Rostlaube?«
Immerhin schien ihr meine verbeulte Rostlaube von einem Kleinwagen besser zu sein als gar nichts.
»Okay, fahr los!«
Sie saß sichtlich unbequem auf dem Beifahrersitz, richtete weiter ihre Waffe auf mich, und ich trat auf das Gaspedal. Wir waren noch keine zwanzig Meter weit gefahren, da riss sie sich die schwarze Bob-Perücke vom Kopf, kurbelte das Seitenfenster herunter und warf die Perücke hinaus. Das wäre normalerweise nichts Besonderes und in einem Krimi eine völlig normale Szene gewesen. Merkwürdig war allerdings, dass sie unter der Perücke einen identischen schwarzen Bob trug.
»Na was? Die finden das Ding und suchen alle nach einer Frau, die so eine Perücke getragen hat«, klärte sie mich immerhin angesichts meiner offensichtlichen Verständnislosigkeit auf. »Aber keiner sucht eine Frau, die wirklich so eine Frisur trägt. Gehört alles zum Plan.«
»Hm, ja, da ist etwas dran!« Vielleicht würde sie mich am Leben lassen, wenn ich versuchte, mich so normal wie möglich mit ihr zu unterhalten und ihr somit zeigte, dass ich ein ganz normaler Mensch war. Ihr Anblick allerdings konnte einen dazu bringen, sich alles andere als normal zu verhalten. Vom sabbernden Idioten war ich nicht mehr weit entfernt, denn wenn ich zu ihr hinüberschaute, sah ich, dass ihr kleines Schwarzes in der Enge dieses Autos verrutscht war und die nackten Schenkel oberhalb der Strümpfe preisgab. Und verdammt, diese Verrückte trug zu einem Banküberfall Strapse! Was für eine irre Nummer lief denn hier?
»Da vorne rechts abbiegen«, sagte sie und fuchtelte mit der Pistole in Richtung der Straße, in die ich fahren sollte. »Und ein bisschen schneller, denn die Polizei dürfte inzwischen die Verfolgung aufgenommen haben.«
»Ich kann mir leider keinen Porsche leisten!« Sofort biss ich mir auf die Unterlippe. Es war sicher keine gute Idee, mit ihr zu streiten und ihr auf die zynische Tour zu kommen. Nicht, solange sie diese Waffe in der Hand hatte.
»Meiner steht noch vor der Bank. Den hole ich später!«
»Sie haben einen Porsche und fliehen in einem Fiat?«
Ich konnte es nicht glauben. Süße Tittchen hin, geile Beine her: Diese Frau war eine komplette Irre, und es hätte mich nicht gewundert, wenn wir auf direktem Weg zur Nervenheilanstalt gewesen wären.
»Ja, ich find’s irgendwie cool, eine Geisel zu haben, die den Fluchtwagen fährt. Im Kreisel da vorne die zweite Ausfahrt!«
Wahrscheinlich fuhr sie jetzt mit mir zu einem abgelegenen Industriegelände, wo ich in einem verlassenen und abbruchreifen Lagerhaus einen ebenso tragischen wie tödlichen Unfall haben würde, den ihre dort auf uns wartende Bande fachgerecht arrangieren würde, und vielleicht würde diese Wahnsinnige vorher noch mit mir ficken wollen.
»Und jetzt erstmal immer geradeaus!«
Okay, die Sache mit dem Industriegelände wurde immer realistischer, denn wir fuhren weit aus der Stadt hinaus, mittenrein ins Nirgendwo. Sehr wahrscheinlich hatte sie nicht vor, irgendwo an einem lauschigen Plätzchen im Wald ein nettes Picknick mit mir zu machen.
»Bitte …«, sagte ich, und es war mir egal, dass ich jammernd und flehend klang. Ich war noch zu jung zum Sterben. »Ich werde niemandem etwas sagen …«
Sie schaute mich an und runzelte hinter ihrer großen Sonnenbrille die Stirn wie zuvor der Bankangestellte.
»Lassen Sie mich leben, ich habe …« Hm, was hatte ich denn? Schulden bis zum Anschlag? Ein aussichts- und chancenloses Leben? Mit »Ich habe Frau und Kinder« konnte ich nicht aufwarten, aber vielleicht würde sich das ja mit Gabi noch ergeben.
»Du glaubst, ich will dich umbringen?«, fragte sie, als hätte ich sie gerade erst auf diese Idee gebracht. Na toll! Von wegen Wunder und gute Fee.
»Nicht?«
Sie lachte und meinte nur, ich solle ein Stück weiter im Wald rechts abbiegen. Ich gehorchte und wunderte mich darüber, dass wir uns einem geradezu schlossartigen Anwesen näherten.
»Quatsch, wieso sollte ich dich umbringen? Und dazu noch mit Platzpatronen?«
Sie lachte erneut und nahm die Sonnenbrille ab. Sie war mir die ganze Zeit schon irgendwie vage bekannt vorgekommen, und jetzt erkannte ich die gute Fee in Schwarz.
Kapitel 3
»Mach’s dir bequem«, sagte sie und fragte, ob ich etwas trinken wolle. Sie machte sich an der Hausbar einen Gin Tonic, und ich bat um einen Weinbrand oder irgendetwas anderes, das richtig stark war und ordentlich reinknallte, und davon gab es in diesem Haus mehr als genug, und das aus gutem Grund.
Mehr oder weniger freiwillig war ich Gast im Hause der Familie Haggenich – ein alter Ruhrpottadel, der seine Kohle allerdings nicht mit Kohle gemacht hatte. Die von und zu und sonstwas Haggenichs waren ihres Zeichens namhafte, steinreiche und berühmt-berüchtigte Fabrikanten von hochprozentigen Spirituosen. »Hackedicht dank Haggenich« war seit jeher ein beliebter Satz unter den Konsumenten dessen, was dieses Unternehmen so auf den Markt brachte.
Ich trank meinen Cognac in großen Schlucken, und die Tochter des Hauses goss sofort nach: Sandra Haggenich! Deshalb war sie mir also bekannt vorgekommen. Es verging keine Woche, in der sie nicht auf irgendeinem Foto in irgendeiner Hochglanz-Zeitschrift oder der Tageszeitung erschien.
»Das war ganz schön spannend, oder?« Sie ließ sich neben mir auf das Sofa fallen und legte die Füße auf den Tisch, ohne ihre High Heels vorher abzustreifen.
»Naja …«
»Spürst du auch das Adrenalin?«
Ich spürte so einiges! Vor allem Erleichterung darüber, dass ich wohl weiterleben durfte, und ich spürte die wohltuende Wirkung des Cognac.
»Wenn der Adrenalinspiegel langsam wieder sinkt, das ist ein geiles Gefühl, was?«
»Hm, ja.«
»Und es macht mich immer rasend scharf, weil ich erst auf Hundertachtzig bin und dann wieder runterkomme.«
Sie trank ihren Gin Tonic aus und küsste mich, und schwupps, schoss ihre Zunge in meinen Mund hinein und rotierte darin wie ein durchgeknallter Küchenquirl. Sandra drückte mich rücklings auf das Sofa und stieg auf mich. Von außen betrachtet musste das aussehen, als wären wir die Hauptdarsteller in einem Porno, der in der High Society spielte. Im Ernst, ich dachte in diesem Augenblick tatsächlich daran, was wir wohl für ein Bild abgaben und was irgendwer wohl denken würde, wenn er oder sie hereinkäme. Ich konnte einfach den Kopf nicht abschalten. Wie auch? Nach allem, was in der letzten Stunde passiert war …
Wenn es jemanden gab, der so viel Geld hatte, dass ein Bankraub völlig überflüssig war, dann war es Sandra Haggenich. Warum setzte sie sich einer solchen Gefahr aus, festgenommen zu werden und in den Knast zu gehen? Warum das Herumgeballer mit Platzpatronen, die Geiselnahme und die Flucht im Fiat, wenn sie doch einen Porsche hatte? All das hätte schiefgehen und verdammt böse enden können! Und warum passierte das ausgerechnet mir?
Über all diese Dinge dachte ich nach, während diese tolle Frau mich küsste. Es gab da draußen etliche Männer, die ihren linken Arm und noch mehr dafür gegeben hätten, jetzt an meiner Stelle zu sein, aber ich musste ja unbedingt das große Grübeln veranstalten.
»Was ist denn los? Normalerweise regt sich etwas in den Hosen der Männer, mit denen ich knutsche. Bist du schwul?«
»Äh, nein, ich habe nur nachgedacht.«
»Nachgedacht?« Sandra schaute mich fassungslos an. Klar, vielleicht machte sie öfter mal einen Banküberfall oder ähnliches und sah das ganz locker. Aber dass ein Mann, dem sie ihre Zunge in den Hals steckte, keinen Steifen bekam, erschütterte dann doch ihr Weltbild.
»Naja, mir geht einiges durch den Kopf.«
»Was denn zum Beispiel?«, gurrte sie verführerisch und leckte mir über die Lippen.
»Zum Beispiel, warum Sie …«
»Sag ›Du‹ zu mir.«
»Warum machst du das? Du hast doch genug Geld. Wieso ein Banküberfall?«
»Weil’s geil ist. Weil’s ein richtiger Kick ist!« Sie machte eine weit ausladende Handbewegung und seufzte. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie langweilig das Leben hier manchmal ist.«
Das arme, reiche Mädchen schmiegte sich wieder an mich und knutschte mich wie eine Verdurstende, die hoffte, in meinem Mund oder meinem Hals eine Quelle zu finden, um ihren Durst zu stillen. Und was tat ich mit dieser rassigen Luxusfrau? Ich schob sie mit sanfter Gewalt von mir weg und wollte über den Sinn des Lebens diskutieren, oder so.
»Aber du erschreckst Menschen! Warum hast du mich als Geisel genommen? Ich hatte Todesangst.«
»Weil du direkt vor mir gestanden hast und ich dich süß fand!«
»Süß?«
»Genau!«
Und zack, war sie wieder über mir und zeigte mir, welche Kunststücke sie mit der Zunge in meinem Mund vollbringen konnte. Also, ich kann’s zwar nicht beweisen, aber ich schwöre, dass Sandra es fertigbrachte, ihre Zunge um meine zu wickeln und sie festzuhalten. Ich malte mir aus, was sie wohl beim Blasen und Lutschen mit einem Schwanz machte, wenn sie beim Knutschen schon sowas anstellte. Aber auch dieser Gedanke heizte mich nicht wirklich an. Ich war verwirrt, aber ich war am Leben, und selten hatte ich das so intensiv gespürt wie jetzt.
»Ich bettelte um fünfzig Euro, die der Kerl am Schalter mir nicht geben wollte, und du bist reich wie Onkel Dagobert und raubst eine Bank aus?«
»Ja. Geil, oder?«
Und schon war ihre Zunge wieder in meinem Mund, während ihre Hand nun dazu überging, meinen Gürtel zu öffnen.
»Was machst du mit dem ganzen Geld?«
»Du kannst es haben, ich brauch’s nicht. Aber die Tasche kriegste nicht, verstanden?«
Meinte sie das etwa ernst? Das ganze Geld? Grob geschätzt mussten das knapp hunderttausend Euro sein. Aber ich konnte es doch nicht behalten! Es war gestohlen, und es war das Geld der Bankkunden.
»Wenn du es nicht willst, kippe ich es in den Teich hinter dem Haus. Und die Bank ist gegen sowas versichert, also spiel hier nicht den Moralapostel.«
Sie riss den Knopf meiner Jeans ab und öffnete den Reißverschluss. Ich spürte, wie ihre Hand in meine Hose glitt und wie sie nach meinem Schwanz tastete. Dem saß allerdings noch immer – kleines Wortspiel – der Schreck im Glied, und er war selbst so sehr mit Denken beschäftigt, dass er klein und weich war.
»Machst du das öfter?«, wollte ich wissen, und sie antwortete grinsend: »Klar, ich mag Schwänze!«
»Nein, ich meine Banküberfälle!«
Ihre zarten, langen Finger betasteten meine momentan unpässliche Männlichkeit und kraulten mir die Eier.
»Och, ich mache auch andere Sachen. Neulich habe ich ein Flugzeug geklaut.«
»Wie bitte?«
»Reg dich nicht auf, es war nur so ein kleines Sportflugzeug.«
Ich trank mein Glas zum dritten oder vierten Mal aus, und diesmal goss ich mir selber nach. Das brauchte ich jetzt. Es machte mich herrlich ruhig, wenngleich das Geschehen in meiner Hose leider ebenfalls von Ruhe geprägt war. Nach und nach verstand ich, was Sandra mit dem nachlassenden Adrenalin meinte. Ich wurde immer gelassener, und sogar meine streikende Männlichkeit war mir plötzlich völlig egal.
Ich kippte noch zwei oder drei Original-Haggenich-Rachenputzer, und dann gingen die Lichter aus.
Kapitel 4
»… hat die Täterin offenbar versucht, mit Hilfe einer entsprechenden Perücke auszusehen wie Sandra Haggenich, die Tochter des Spirituosen-Herstellers Haggenich. Diese Perücke wurde gefunden und wird von der Polizei untersucht …«
Die Worte waberten wie durch Watte an meine Ohren. Sie schienen aus einer anderen Welt und einer anderen Realität zu kommen. Stück für Stück setzte sich alles in meinem Kopf wieder zusammen. Ich hatte das alles wohl nicht geträumt!
»… Flucht in einem Fiat Panda, der der Geisel gehört. Vom Fahrzeug und der Geisel Mike Schoppke fehlt jede Spur.«
Ich öffnete mühsam die Augen. Das Sonnenlicht tat weh.
»Guten Morgen!«, flötete Sandra.
»Morgen?«
»Ja, du hast geschlafen wie ein Stein … wenn auch nicht alles an dir steinhart war.«
Sie lachte, und ich erinnerte mich daran, dass ihre Bemühungen, mir einen Steifen in die Hose zu zaubern, sprichwörtlich in die Hose gegangen waren.
Ich reckte und streckte mich und stellte dabei zwei Dinge fest, die mich erschrecken ließen:
Erstens lag ich splitternackt auf einem Bett, das vermutlich das von Sandra war.
Zweitens war meine linke Hand mit einer Handschelle an den oberen Rahmen des Himmelbetts gefesselt.
Oha!
Sofort fiel mir Gabi ein. Ich musste sie unbedingt anrufen, denn sie war sicherlich verrückt vor Sorge um mich. Neben mir lag Sandra, und zwar splitternackt und mit einem Körper, der jedem Mann die Hormone auf Wildwasserfahrt schicken konnte. Hoffentlich hatte Gabi nichts davon erfahren. Ausnahmsweise stimmte mal die alte Floskel, es sei nicht so, wie es aussah. Es hatte sich wirklich und ehrlich nichts zwischen Sandra Haggenich und mir abgespielt!
Oder etwa doch?
»Ich hole uns mal einen Kaffee und ein bisschen Frühstück«, flötete meine Gastgeberin wohlgelaunt und lachte nur über meine Bemerkung, sie möge mir doch bitte die Handschelle abnehmen. Grazil und geschmeidig bewegte sie ihren Luxuskörper aus dem Bett.
»Und es wäre schön, wenn der noch auf mich wartet, wenn ich zurückkomme«, meinte sie augenzwinkernd und deutete auf meine beeindruckende Morgenlatte, die sich neugierig in die Luft erhob. Sandra verließ das Zimmer, ohne sich etwas anzuziehen. Offenbar legte man im Hause Haggenich wenig wert auf Textilien. Die reichen Leute und ihre Macken … Unsereins dürfte sich das nicht erlauben. Aber verdammt, irgendwie klang das Geräusch ihrer nackten Füße draußen auf dem Flur sehr sexy.