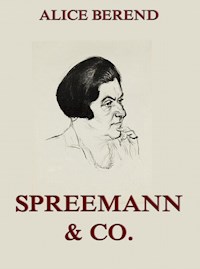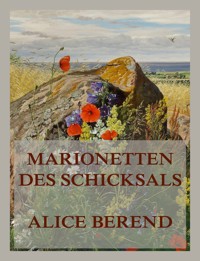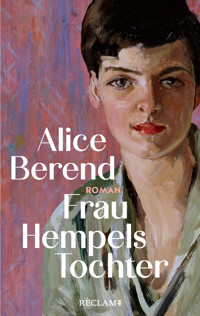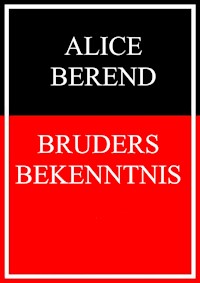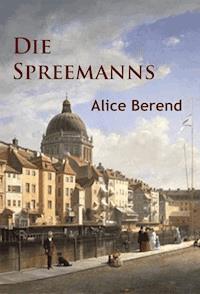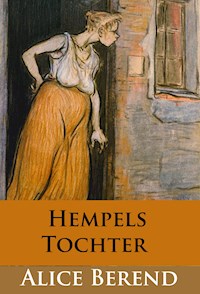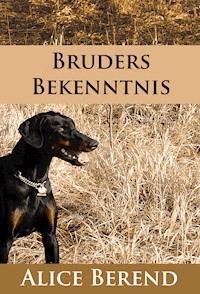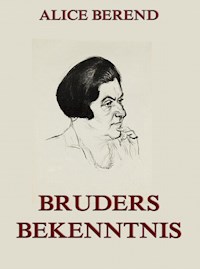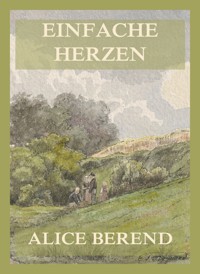
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die 1875 in Berlin geborene Alice Berend gehörte zu den produktivsten humoristischen als auch realistischen Schriftstellerinnen der 1910 er und 1920er Jahre. Da sie nach den NS-Rassegesetzen als Jüdin galt, verbrachte sie die Jahre 1935 bis zu ihrem Tod 1938 im Ausland. Ihre Literatur war bei den Nationalsozialisten genauso unwillkommen wie sie selbst, und so wanderten ihre Werke in den Schrank mit der Aufschrift "Verbrannt und Verbannt." Heute gehören Berends Romane zu den Klassikern der Literatur und sind allesamt und allemal lesenswert. Menschen, die ihr Leben sozusagen im Spinnenwinkel verbringen, schildert sie in ihrem Skizzenband "Einfache Herzen". Es sind Leute, an denen das Dasein vorübergerauscht ist, ohne ihnen Gelegenheit zu geben, seinen Zauber zu erfühlen. Treu und schlicht erfüllen sie ihre Pflichten in dem engen Kreis, in den die Fügung sie gestellt hat, und es kommt ihnen kaum zum Bewusstsein, daß sie um ihr Bestes betrogen worden sind. Der künstlerische Wert des Buches liegt darin, daß die Verfasserin im knappsten Rahmen jedesmal runde, abgeschlossene Menschenschicksale erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 93
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Einfache Herzen
ALICE BEREND
Einfache Herzen, A. Berend
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988681881
Dieses Werk folgt der Originalausgabe des Jahres 1920, erschienen im Dürr & Weber Verlag Leipzig. Quelle: http://digital.bib-bvb.de/view/bvb_mets/viewer.0.6.5.jsp?folder_id=0&dvs=1741871669518~821&pid=18437244&locale=de&usePid1=true&usePid2=true.
www.jazzybee-verlag.de
Inhalt:
Marlenes Narrheit1
Wendeborns Werbung. 16
Opfer25
Herrn Klinkerts Prüfung. 29
Witwe Schmidt34
Gegenüber41
Beppe - Eine italienische Dorfgeschichte. 46
Marlenes Narrheit
Es ist ein Irrtum, dass unser Leben mit unserer Geburt beginnt, wenigstens für uns selbst, die wir doch die Hauptperson dabei sein sollten. Für uns selber fängt es mit weniger Vorbereitung an. Ganz plötzlich zeigt uns ein winziges Geschehnis unserer Kindertage, dass wir leben.
Winzig, aber nicht gering. Dieser erste Augenblick bleibt die Laterne unseres ganzen Lebensweges.
Antonio Schulzes Lebensbegriff schimmerte in einer blanken Welle der Spree. Er hatte das Wassergegaukel für eine rollende Goldkugel gehalten und danach greifen wollen.
Wäre nicht der dicke Bäckermeister und Antonios Hemdzipfel gewesen, wer weiß, was sich ereignet hätte.
Bäcker Pölicke war stolz über sein Rettungswerk. Er zwickte Antonio in die runden Wölbungen der Höschen und erklärte neugierig Herbeigeeilten, dass dieser schlaue Kleine nicht als erster Naturforscher behaupte, dass die grüne Spree Gold im Sand führe. Mancher könne sogar ohne Studium den Wahrheitsbeweis dafür aufbringen. Dabei steckte er die Hände in die Hosentaschen, aus denen stets Goldgeklapper ins Weltall drang.
Antonio gab dieser Münzenmelodie jubelnden Beifall. Pölicke, angenehm berührt, lockerte eins der Geldstücke aus der klimpernden Schar und schenkte es seinem Geretteten.
Man kann sich an einer Sache freuen, auch ohne ihren Wert zu verstehen. Antonio steckte das blinkende Etwas zuerst in den Mund, dann in die Ohren und versuchte es schließlich in eines seiner Nasenlöcher zu pressen. Als ihm dies nicht gelingen wollte, entschloss er sich dazu, es ins Wasser tropfen zu lassen.
Das war der Anfang von der Freundschaft zwischen Antonio Schulze und diesem Strom, der hier, von der Seite des Sonnenaufgangs kommend, die grünen Wiesen blinkend durchlief.
Niemand braucht klüger zu sein als der Mensch. Der auch nichts von heut auf morgen im Voraus weiß. Auch die Spree ahnte nicht, dass sie schon eine kurze Strecke später, in Steinwände eingezwängt, wie eine Städterin ins Korsett, den Unrat einer großen Stadt, unter Brücken und Bogen, davonzutragen hatte.
Hier war sie fröhlich und leichtsinnig. Sie gab zwar Antonio nicht, wie er fußstampfend verlangte, das Geldstück wieder heraus, aber sie schaukelte ihm dafür einige Tage später eine ganze Schar lustiger Dinge zu. Holzformen, in denen sich der Ufersand zu schönen Torten verwandelte. Wie man sie zwar noch nie gekostet, aber in dem Schaufenster des Bäckers Pölicke genug bewundert hatte. War man der Schleckerei überdrüssig, konnte man sie auf dem Wasser schwimmen lassen und ein Schiffer sein, der Apfelkähne hinter sich her zog.
Keine Ermahnung störte Antonio in seinem Tun. Fragte ein Fremder, dem des Kindes geschäftiges Treiben mit den Abfällen der nahen Tischlerei die flüchtige Wanderneugier reizte, nach dem Namen des kleinen Einsamen, sagte er selber jedem, was in Spreedorf jeder wusste, dass er die Narrheit der alten Marlene sei.
Wer Marlene war, musste jeder wissen.
Tag für Tag konnte man sie während aller hellen Tagesstunden hinter einem der vier Fenster ihres niederen Häuschens zwischen Spree und Landstraße sehen, gebückt über Nadel und Faden. Seit wie lange schon hätte niemand zu sagen gewusst. Diese Frage hätte die Spreedörfer in Verlegenheit gebracht. Denn wenn sie auch, selbst ohne die nahe Nachbarschaft der Landeshauptstadt, hell genug waren, um zu wissen, dass Marlene nicht seit Erschaffung der Welt da sitzen konnte, mancher wäre doch geneigt gewesen, dies zu glauben. Jedenfalls konnte man sich nicht vorstellen, dass auch Marlene einmal Rosen am Busen getragen, über einer glatten Stirne weiche Seidensträhne dem Maiwind zum Spiel geboten hätte oder gar imstande gewesen sein konnte, über nichts und wieder nichts zu jubeln, lachen und zu singen. Dagegen wusste man bestimmt, dass, solange einer im Dorf zurückdenken könnte, Marlene in Wäsche und Strumpfzeug die Löcher und Risse stopfte, von denen die Welt so voll war.
Marlene selber entsann sich nur dann und wann noch, dass es allerdings kaum ein halbes Jahrhundert her war, als es einen Dachdecker gegeben, der den Hauptstädtern die Wetterfahnen der höchsten Türme nach eigener Manier zurechtgesetzt. Der selber aber, nicht im Geringsten wetterwendisch, jeden Sonntag ins Spreedorf kam, um in karierter Weste, hellen, weiten Hosen und mit flatternder Halsschleife nur mit einem einzigen Mädchen zu tanzen, Kahn zu fahren oder sonst wie zu scherzen.
Doch eines Tages, von einem Nadelstich zum andern, gab es einen flotten Dachdecker weniger. Aus keinem anderen Grund, als dass, sich ein eigensinniger Wetterhahn nicht mehr hatte drehen und ein lockerer Ziegelstein nicht auf dem ihm bestimmten Platz hatte aushalten wollen.
So musste ein sorgsam aufgezogener Myrtenstrauß auf einem zugigen Grabhügel verkümmern, und statt eines ganzen Geschlechtes flinker Dachdecker und munterer Schneidermamsellen formten einförmige Tage die Flickmarlene zurecht. Jenes segensreiche Werkzeug, das überbürdete, ruhelose Mütter und nadelunkundige, ratlose Witwer für eine unentbehrliche Naturnotwendigkeit hielten.
Aber kein Schatten ohne Licht. Keine Arbeit ohne Freude. Es war einem Vergnügen sehr ähnlich, wenn ein Flicken in die Risslücke genau so hineinpasste wie ein Ei in seine Schale. Es war Anlass genug, alle Zahnlücken lächelnd bloßzulegen, wenn ein Stopf so gut gelungen, dass die Bestellerin selber bei Abholung des neugezauberten Kleidungsstückes dieses wieder und wieder umdrehen musste, ehe sie die schadhaft gewesene Stelle überhaupt herausfinden konnte. Das war noch nicht alles. Ehe man sich's versah, kam der Sonntag, wo man keine Nadel in die Hand zu nehmen geruhte. Wo man in der guten Stube saß und den Fingerhut nur dazu benutzte, um- die Zeilen der Zeitung reihauf, reihab zu tippen, weil man sich an den Unglücksfällen der ganzen Welt zu zerstreuen wünschte.
Man musste es schwarz auf weiß vor sich haben, um glauben zu können, wie unvorsichtig die Menschen da draußen mit ihrem Dasein herumhantierten. Hitzschläge, Beinbrüche, Überfahrenwerden, Ertrinken, Mord, Brand und Diebstahl an allen Ecken und Enden. War das nötig? Konnte man sich nicht bescheiden und ohne dergleichen auskommen?
Man soll nicht hochmütig sein. Ihr eigener Fingerhut sollte Marlene beweisen, wie leicht man vom rechten Weg abirren könne.
Mitten aus einer Spiritusexplosion, entstanden durch eine Brennschere und eine leichtfertige Köchin, rutschte er in den Anzeigenteil hinein, um den sich Marlene niemals kümmerte. Sie wünschte ebenso wenig etwas zu kaufen, wie sie etwas zu veräußern hatte. Noch ganz in der Spannung, ob die Köchin, eitel und leichtsinnig, mit dem Leben davongekommen stieß Marlene auf das Wort: kostenlos.
Das war ein seltenes Wort. Marlene hielt sich nicht für gelehrt, aber sie glaubte mit Bestimmtheit zu wissen, dass nichts in der Welt umsonst sei. Sie wurde neugierig. Die Gedanken noch bei Feuer, Leichtsinn und Leichtentzündlichkeit, buchstabierte sie heraus, dass jemand einen kleinen Knaben, hübsch und von bester Herkunft fortzuschenken wünsche.
Es war lange her, dass Marlene kleinen Kindern zugelächelt, mit Wünschen geheim und ins Erröten bringend.
Kostenlos — Marlene buchstabierte es noch einmal. Sie ließ den Fingerhut Schildwache stehen und grübelte.
Im Ausschnitt des kleinen Fensters war alles grün. Die Juliluft, die hineinkam, roch nach durchsonnten Kiefern und fertigen Erdbeeren. Schritte der Landstraße und Wellen der Spree mischten die Melodie dazu . . .
An diesem Abend erzählte am Stammtisch "Zum braunen Hirschen" der Kaufmann Spielke, dessen Handlung gemischter Schnittwaren neben der Posthalterei lag, dass die Flickmarlene einen Brief zur Beförderung gegeben. Man lachte tüchtig. Kaufmann Spielke war ein Witzbold. Das gehört zu seinem Geschäft mit Tütendrehen.
Marlene aber rückte-in ihrer knarrenden Bettlade, hinter den mit grünen Holztafeln festverschlossenen Fenstern, von einer Seite zur andern. Auf der rechten Seite schien es ihr nicht glaublich, deutlich auf einen Bogen gemalt zu haben, dass sie bereit wäre, den angebotenen Gegenstand zu nehmen, kostenlos. Und, dass sie das Schreiben wirklich in die Welt hinausgeschickt. Sie schalt nicht nur sich, sondern auch die Juliluft und den Sonntagslärm. Sie wusste nicht warum, aber sie schienen ihr in Verbindung mit ihrer Dummheit zu stehen.
Doch auf der linken Seite, wo das Herz um die Wette mit der Kuckucksuhr tickte, durchlächelte Marlene das Dunkel. Sie war neugierig, ob es wirklich in dieser Welt etwas umsonst geben könne. Sogar etwas Hübsches.
So zweifelnd zwischen links und rechts rollend hörte sie die Turmuhr Stunde auf Stunde in Viertel teilen. Ein Glück, dass sie an der Posttür den Anschlag gelesen, dass die Kirchenuhr um sieben Minuten vorgehe, dagegen bei jeder vollen Stunde zwei Schläge zu viel tue. Rechnen war Marlenes schwache Seite. Dieses beständige Abrechnen und Zuziehen brachte sie schließlich in Schlaf. Nicht, ohne dass sie vorerst begriffen hatte, dass kleine Kinder störend auf die Nachtruhe wirken.
Sommernächte sind kurz und Wochentage lassen keine Zeit übrig für die Dummheiten des Sonntags. Als Marlene an einem der nächsten Tage das rötlich werdende Abendlicht schnell dazu nützte, um als Schluss täglicher Mühe ihre Küche besonderer Gründlichkeit zu unterwerfen, lag in ihrem Gedächtnis alles eher als jener Sonntagsbrief. Der Behälter ihrer Gedanken war mit einem dicken Tuch umwickelt, genau wie der Kopf des Besens, der streichelnd die weißen Wände auf und nieder fuhr. Obwohl sich diese nicht über zu viel Bratendunst beschweren konnten. Was sie gewöhnlich umfächelte war der sanfte Hauch des Malzkaffees.
Zwischen Besen, Eimern und Nässe stand plötzlich eine junge Dame. Elegant und städtisch. Der Flickkorb, den sie trug, passte wenig zu dem hellrosa Seidenärmel, an den er sich presste. So etwas geht lieber zerrissen, als mit Stopfen. Wer, wie Marlene, die Wäsche der ganzen Welt unter die Finger bekommt, kennt sich auch unter der Oberfläche aus: Auch die junge Frau, die sich der Apotheker aus der Stadt geholt, trug am Körper solche Spitzenspinnengewebe, durchzogen mit Seidenbändern, wie eine Konfektschachtel. Die waren in Fetzen, wenn sie zu Marlene gelangten.
Zierrat von dieser Sorte vermutete Marlene in jenem Flickkorb unter dem Seidenärmel. Das würde viel Mühe und wenig Vergnügen geben. Marlene sah sich nicht genötigt, ihre Tätigkeit zu unterbrechen.
Nach einer Weile fragte die Angekommene, ob Fräulein Marlene Schröder zu sprechen sei.
Selten Gehörtes macht Eindruck. Diese Anrede, Marlene ebenso recht und billig wie selten zukommend, ließ den Kopf des Fräulein Schröder aus seiner Umwicklung schnellen. Höflichkeit verpflichtet. Die Fremde wurde in die gute Stube gebeten.
Die junge Dame, trippelte in ihren Spangenschuhen mit Rebhuhnschritten über die ausgetretene Schwelle. Sie stellte den Flickkorb auf die weiße Häkeldecke neben der Blumenvase, aus der Schnittlauch und Petersilie, zum Strauß gebunden, ihren lebendigen Duft den sauberen Gardinen luftsuchend zu drängten. Vergeblich. Die Fenster waren festverschlossen. Die gute Stube an Wochentagen zu bewohnen, wäre Marlene ebenso vermessen vorgekommen, wie bei Lebzeiten in ihrem Sarg zu schlafen. Sie bemerkte mit wenig Vergnügen, dass man einen Flickkorb auf Tisch und Decke stellte und warf Verständnis suchende Blicke zu dem großen Kreidebild hinauf, wo der flotte Dachdecker, jung wie vor einem halben Jahrhundert, zufrieden lächelnd auf die Reinlichkeit ringsum starrte. Die Augen der Fremden folgten ihren Blicken und glitten dann zurück zu Marlene.
Dann fragte das Fräulein schnell, ob sie etwa Fräulein Schröder selbst vor sich habe. Und Marlene sah mit Schreck ihre Sonntagsdummheit aus der Tasche des hellen Kleides knistern.
Die jungen stahlblauen Augen nahmen sie stark aufs Korn. Doch auch Marlene strengte ihre alten, aber für die feinsten Stiche noch tauglichen Arbeitslichter an. Das Gesicht der eleganten Zierlichen, glatt und rosig und mit vollen roten Lippen, erinnerten sie an eine Jugendfreundin, die immer ein Samtband um den Hals getragen und nichts lieber getan hatte als Karussell zu fahren. Auch sie war stets freigebig gewesen.
Die junge Dame hatte inzwischen gesagt, dass sie sich Marlene jünger vorgestellt habe, dies aber sofort entschuldigt, indem sie hinzufügte, dass sie gerade in der Zeitung gelesen habe, dass heutzutage erst die Frau im Großmutteralter wahres Verständnis für kleine Kinder habe.
Marlene war mit ihren Beobachtungen beschäftigt. Zwei Dinge auf einmal zu tun war sie nicht gewohnt. Sie horchte erst auf, als ihr Gegenüber gesagt hatte, dass sie selber nie Zeit haben würde, eine Wiege im Gang zu halten. Denn sie brauche ihre Füße zum Tanzen.
Marlene lächelte und antwortete, dass sie auch einmal getanzt habe. Gern und gut.
Erst nach längerem Hin und Her hatte sie begriffen, dass das Fräulein nicht das Tanzen am Sonntag meinte, sondern, dass ihre Beine ihr Beruf wären.