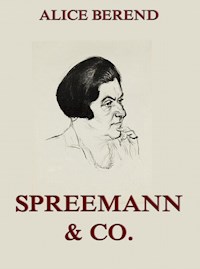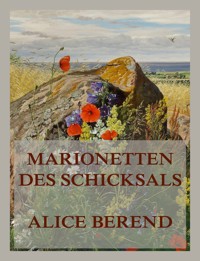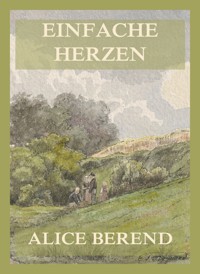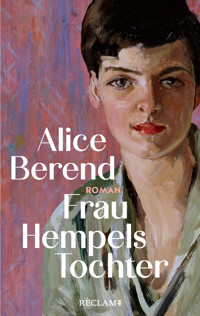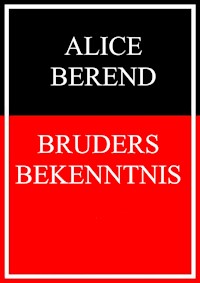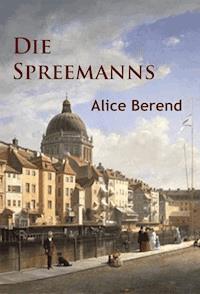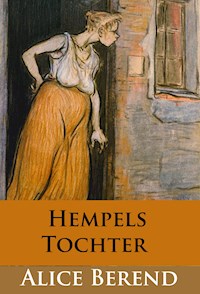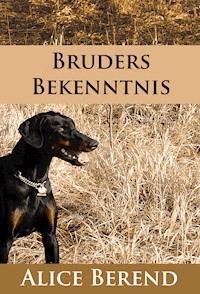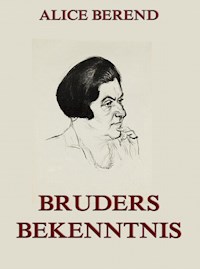Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jaron Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Berlin-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Mit dem Erbe seines Vaters erfüllt sich Klaus Spreemann einen Lebenstraum: Er gründet sein eigenes Stoffgeschäft. Doch seinen Laden und seine Familie durch die Wirrnisse der Zeiten zu lenken, ist nicht so einfach. Denn mal tobt die Revolution vor dem Schaufenster, mal muss ein Sohn in den Krieg gegen Frankreich ziehen. Über sieben Jahrzehnte und drei Generationen hinweg spannt Alice Berend die Geschichte der Familie Spreemann und ihres Geschäfts im Berlin des 19. Jahrhunderts – mit Witz, Wärme und einem genauen Blick für die wichtigen Details.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Spreemann & Co.
Romanvon
Alice Berend
Mit einem Nachwort von Arnt Cobbers
Jaron Verlag
ALICE BEREND, geboren 1875 in Berlin, begann als Theaterkritikerin fürs Berliner Tageblatt, gehörte 1901 zu den Mitbegründern des legendären Kabaretts Schall und Rauch und wurde gleich mit ihren ersten Romanen, die ab 1912 beim renommierten S. Fischer Verlag erschienen, zur Bestseller-Autorin. Sie schrieb zahlreiche Romane, Erzählungen, Märchen und Drehbücher. 1933 wurden ihre Werke auf dem heutigen Bebelplatz in Berlin verbrannt. Zwei Jahre später emigrierte Alice Berend nach Florenz, wo sie im Frühjahr 1938 mittellos verstarb. Spreemann & Co., erschienen 1916, war einer ihrer größten Erfolge.
Zu dieser Ausgabe:
Grundlage des Textes ist die 46. bis 48. Auflage, die 1928 im S. Fischer Verlag, Berlin, erschienen ist. Die Rechtschreibung wurde größtenteils der heute üblichen angepasst, offensichtliche Fehler wurden verbessert, manche Eigenarten und Altertümlichkeiten aber auch beibehalten.
1. Auflage 2022
Jaron Verlag GmbH, Berlin
www.jaron-verlag.de
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Satz und Layout: Prill Partners | producing, Barcelona
Lithografie: Bild1Druck GmbH, Berlin
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH
ISBN 978-3-95552-049-6
ERSTER TEIL
Erstes Kapitel
Niemand weiß, was aus ihm werden kann. So ahnten auch die Bewohner von Berlin einmal nicht, in wie hohem Maße man sie zu Weltstädtern bestimmt hatte.
Selbst als draußen schon die Stränge der Eisenbahn die Welt zu verstricken begannen, barg sich die grüne Stadt an der Spree noch arglos im Netz der Behaglichkeit.
Neben den niederen Giebelhäusern reiften Kohl und Johannisbeeren. Unter schattigen Bäumen trank man seinen Milchkaffee. Und zwar in langsam bekömmlichen Schlucken. Tief waren die Tassen, groß die Semmeln, lang die Pfeifen. Ruhig die Straßen, friedlich die Plätze. Dick und fest die Grenzmauern.
Keinem Berliner wäre es damals eingefallen, durch die Luft fliegen zu wollen. Gemessen und sorgsam bewegte man sich über das holprige Pflaster. Im Sommer hatte man Gras und Wiesenblumen auszubiegen. Im Winter verboten Schlamm oder Glatteis jede übertriebene Eile. Keinem kam es in den Sinn, sich ängstlich zu berechnen, dass eine einzige Minute sechzig kostbare Sekunden umschloss. Aus dem einfachen Grunde, weil man von den Sekunden überhaupt noch keinen Gebrauch machte.
Trotzdem man sonst durchaus nicht verschwenderisch war. Auch wenn man das Geld dazu hatte, kaufte man nicht mehr, als man brauchte. Man verlangte von den Menschen sowie den anderen nützlichen Gegenständen nicht, dass sie schön und glänzend waren, sondern praktisch und dauerhaft.
In jenen Tagen war es, wo beinahe jeder in Berlin wusste, dass es die besten Kleiderstoffe bei Klaus Spreemann am Dönhoffplatz gab.
Das war einem ebenso gut bekannt, wie dass man wusste, dass mittwochs und sonnabends Markt war. Oder dass man seine Fische vor der Spittelkirche kriegte.
Alles Gute aber kündet sich vorher an. Man roch die Fische schon, ehe man die Leipziger Straße zu Ende war. Man bemerkte Spreemanns Laden, bevor man den Dönhoffplatz erreichte. Denn von dem Firmenschild über der Tür lächelte ein eleganter Herr weit über den Platz hinaus. Im besten Mannesalter, in großkarierten Beinkleidern, langem Rock, gelockten Bartkoteletten und breitkrempigem Zylinder zeigte er mit einem zierlichen Spazierstock auf die zwei bedeutungsvollen Worte: reell und billig.
Hinter ihm stand seine Familie. Eine hübsche Dame mit zwei wohlerzogenen Kindern. Wie sich’s gebührte in sehr viel kleinerem Format als der Hausherr. Aber ebenfalls gut und gediegen angezogen. Denn auch aus diesen sechs hellblauen Augen sprach es bescheiden, aber deutlich: reell und billig.
Hatte man Klaus Spreemanns Laden betreten, wusste man noch mehr, dass man hier am rechten Ort war, um sich gut und würdig zu kleiden, über dem Ladentisch, wo neben Elle und Schere Herrn Spreemanns lange Pfeife glimmte, hing ein angenehm belehrender Spruch. Wie auf einem Haussegen stand da in goldenen Buchstaben:
In London nicht, noch in Paris,
In Brüssel nicht, noch Wien,
Kleiden Monsieur sich und Madame
So schick wie in Berlin.
Jetzt wusste man es also. Jeder Käufer richtete sich straffer auf, begann ängstlich an Krawatte oder Seidenband zu nesteln, wenn seine Blicke mit dem Buchstabengold zusammentrafen. Denn die Berliner waren zu allen Zeiten pflichtgetreu …
Zwischen dem Wandspruch und dem Käufer aber bewegte sich Herr Spreemann selbst. Immer lächelnd und in unermüdlichem Eifer. Seine kurzen stämmigen Beine trabten zwischen Regal und Ladentisch rastlos hin und her. Wie die Sonne lief er seine täglichen Kilometer genau auf derselben Bahn ab.
Unverdrossen schleppte er seine Waren herbei. Lobte den hellgelben Nanking. Pries die karierten, echt englischen Stoffe. Die alle in dem nahen Sachsen gewebt waren, das wahrlich immer noch entfernt genug lag. Mit gespreizten Fingern bauschte er Mull und bunten Tarlatan auf. Fiel draußen der Schnee, riet er dringend zu den Schlafrockstoffen, warm und geblümt. Und holte schon den Samt zu ihrer Garnierung. Sogar Troddeln und Quasten gab es in jeder Couleur. Dicht neben dem Kachelofen klaffte der voll gehäufte Kasten. Ganz nach Belieben konnte sich jeder daraus wählen, was ihm gefiel.
Auf dem hohen Regal, unter blumigem Vorhang, verbarg sich die beste, gediegenste Seide. In den Mauern Berlins gewebt. Steif wie ein Brett. Und nach Klaus Spreemanns tröstlicher Versicherung: weit dauerhafter als ein Menschenleben.
Wenn man von dieser Seide etwas abhandeln wollte, stieß Klaus Spreemann einen kleinen Pfiff aus. Wie wenn er Zug auf einen hohlen Zahn bekommen hätte. Seine kurzen Finger fuhren Aufruhr stiftend in die eng gedrängte Schneckenherde der braunblonden Locken, die seinen dicken Schädel überkrausten. Oder er knebelte seine rotbraunen Bartkoteletten, die mit denen auf dem Firmenschild genau übereinstimmten. Aber kein Wort des Verdrusses entfuhr seinen Lippen. Er lächelte weiter. Geduld und Ausdauer sind die Wege zum Reichtum. Und reich wollte Klaus Spreemann werden, so lange er denken konnte.
Auch Hochmut wäre nur ein Hindernis gewesen. Darum führte Klaus Spreemann neben den vornehmen Stoffen auch die einfachsten. Neben der Ladentür, die an Markttagen weit geöffnet war, stapelten sich ganze Ballen von Flanell und Barchent auf. Selbst das lackglänzende Wachstuch für die Schutenhüte der Milchfrauen brauchte sich nicht zu verstecken.
Wie auf dem Rathaus waren alle Stände vertreten. Daher konnte auch hier jeder Stand etwas Passendes finden.
Und das wollte Klaus Spreemann.
Jeder Mensch hat seinen Wert. Jede Ware und jedes Geldstück. Darum machte Klaus Spreemann keinen Unterschied zwischen seinen Käufern. Für alle dasselbe Lächeln. Für alle die gleiche Fixigkeit. Ganz egal, ob es die Madame Bankier mit dem Schildpattlorgnon oder die Hökerfrau mit der Marktkiepe war.
Alles nach einer Elle, sagte er lächelnd, wenn Geld und Schere klapperten und er abwechselnd Seide, Flanell und Wachstuch rasch, reichlich und reell abmaß und durch einen flinken Galoppritt der blanken Schere vom Stück schnitt.
Gleichmäßig tief fielen dabei seine schnellen Verbeugungen aus, wenn die Glocke an der Ladentür meldete, dass ein Käufer kam oder ging.
Denn Klaus Spreemann hatte von früh an gelernt, dass man dem Geld nicht seine Herkunft ansieht.
Und vielleicht nicht nur dem Gelde …
Der Weg zwischen den gefüllten Regalen und der nicht leeren Kasse war jetzt schmal und kurz. Die Straße, die dahin geführt hatte, war lang gewesen …
Obwohl in Klaus Spreemann echtes Berliner Blut floss, konnte er doch nicht behaupten, dass seine Wiege an der Spree gestanden hatte, denn er hatte nie in einer Wiege gelegen. Auf einem alten Sack, der mit Lumpen aller Art gepolstert war, hatte er sich hineingeschlafen ins emsige Leben. Und dieses leicht bewegliche Lager war heute in dieser Herberge aufgeschlagen worden und morgen in jener. Denn Klaus Spreemanns Vater Friedrich wusste, warum es in den Mauern die Tore gab. Sein bunter Laden war die Landstraße gewesen.
Er hatte die neuen, glatten Stoffe, die sein tüchtiger Sohn jetzt führte, bewundernd und kopfnickend befühlt. Denn er selbst hatte sein Leben lang nur mit alten Kleidern gehandelt. In der Stadt erstand er sie. Vor den Mauern, in den Dörfern verkaufte er sie. Und mit Profit. Von ihm hatte es Klaus geerbt, dass man die Käufer nicht wählen, sondern nehmen sollte, wie sie kamen.
Er hatte mit vollem Eifer an den breiten Schanzen mitgeschaufelt, die man dem Erbfeind vor das Brandenburger Tor gebaut hatte. Aber als die Franzosen dann doch kamen, hatte er mit ihnen Geschäfte gemacht. Und keine schlechten. Denn wenn solch lustiger Welsche auch außen ein Franzmann sein musste, so konnte er unter der Uniform oft genug ein altes Berliner Wollhemd gebrauchen, das wenig kostete, so gut wie neu aussah, aber an den deutschen Winter gewohnt war. Und ebenso gereichte es keinem zu Schaden, wenn sich unter feindlichen Stulpstiefeln Strümpfe versteckten, die irgendeine kreuzbrave Berlinerin einmal gestrickt hatte. Wenn sie es auch nicht geahnt hatte, dass sie damit einem fremden Kriegsmann die Füße wärmen würde. Denn niemand weiß, was er tut.
Auch ein Feind ist schließlich ein Mensch. Besonders, wenn er nicht knausert. Ja, wenn’s sein soll, kann uns ein Feind mehr nützen als ein Freund. Die Russen kamen als treue Verbündete. Aber sie wärmten sich mit Branntwein und Schnaps statt mit alten, durchaus noch gediegenen Kleidern.
Ein Patriot jedoch bleibt ein Patriot trotz alledem. Er versteht, dass man das persönliche Glück zur Kriegszeit zurückstellen muss.
Friedrich Spreemann war damals Bräutigam gewesen, aber niemals hätte er früher geheiratet, als bis der Herr Napoleon wieder nach Haus gezogen war.
Denn diese fremden Soldaten hatten im Liebeshandel einen großen Kredit bei den Jungfern. Wär es nach den Mädchen gegangen, hätte Preußisch-Berlin bald kapituliert. Das war ein Gekicher, wenn die Herren Franzosen ihre raschen Kompliments machten. Man verstand nur wenig davon. Aber so viel merkten die schlauen Jüngferchen doch, dass sich’s in dieser beweglichen Sprache dreimal so geschwind schwatzen ließ als im reellen, gediegenen Deutsch. Das gefiel den Plappermäulern natürlich.
Gefallen aber ist gegenseitig.
Die Beauté ist Internationale, sagte der spitzbärtige Hauptmann, wenn er die Mädchen küsste.
Nein, das war keine Konkurrenz für einen soliden Geschäftsmann.
Ehe muss auf sicherem Grund gebaut sein. Erst als Friede im Land war und die Straßen wieder den Preußen allein gehörten, hatte sich Friedrich seine Weggenossin geholt. Sie diente auf einer Ackerwirtschaft und war das Leben im Freien gewohnt. Sie hatte versprochen, sich weder vor Wind noch Wetter zu fürchten. Besonders nicht an der Seite ihres Fritz. Liebe, Lebensmut und Gesundheit waren ihr Brautschatz gewesen.
Aber als ein Ehejahr herum war, hatte sie dazu als erstes greifbares Besitztum den kleinen Klaus erhalten. In der Nikolaikirche war er mit Spreewasser getauft worden. In einer alten zerschossenen Pferdedecke des großen russischen Reichs gewickelt, ward er dem Schutzpatron des Handels, dem heiligen Nikolai, in besondere Obhut gegeben …
Er konnte einen Schutzpatron gebrauchen. Denn die Mutter sollte er nicht behalten. In der Ehe geht mancher Brautschatz verloren. Berthas hatte nur ausgereicht, bis der kleine Klaus laufen und sprechen konnte. Derselbe Winter, der ganz Preußen die große Freiheit brachte, hatte auch sie von allen Lasten befreit.
Auf schief gelaufenen Hacken war Spreemann hinter ihrer Bahre hergerannt. Es ging im Trab. Berlin erwartete die Rückkehr seiner Sieger. Fahnen, Bänder und Banner wimpelten. Festlich gekleidete Menschen füllten die Straßen. Die Träger waren von einer Seitengasse in die andere geeilt, um nicht mit ihrer schweren Bürde zu stören. Aber man war überall im Wege.
Spreemann hatte niemandem übel genommen, dass man für seinen Schmerz keinen Platz hatte. Wer auf der Landstraße lebt, weiß, dass jeder an sich selbst denken muss. Und schon auf dem Rückweg vom Kirchhof hatte er wieder sein Warenlager auf der Schulter.
Auch neue Sieger konnten alte Kleider gebrauchen.
Zweites Kapitel
Manches aus dieser längst vergangenen Zeit spukte noch in Klaus’ Erinnerung. Fetzen ohne Zusammenhang, die aus Erzählungen des Vaters übrig geblieben waren. Er selbst besann sich erst auf die Zeit, die er bei der Latrinen-Jule verbrachte. Diese lange, hagere Frau, die Mutterstelle an ihm vertrat, bis die Landstraße sein Heim wurde. Sie stand im festen Solde der Stadt Berlin. Sie übte das nützliche Amt aus, das man jetzt den finsteren Röhren der Kanalisation überlässt. Sie trug das Irdischste der Menschen aus der Stadt hinaus auf die Felder. Kein Wunder, dass sie nicht nach Flieder roch. Und Unrecht, dass man seinen Spott mit ihr trieb. Aber man tat’s. Obwohl es Beamtenbeleidigung war.
Wenn am Abend alle miteinander durchs Tor der Herberge drängten, kehrte auch Jule heim. Denn sie erfüllte ihren Beruf unter dem Schleier der Dämmerung.
Kaum aber, dass sie zur Tür hineingeschwenkt war, hagelte Gespött auf sie. Man lobte ihr feines Parfüm oder fragte, ob sie auch nichts von der köstlichen Ware, die ihr anvertraut worden, beiseite geschmuggelt hätte.
Aber auch sie war aus Berlin. Sie verstand zu antworten. Sie rief, dass sie alle zusammen das Maul halten sollten. Der Mist sei am ganzen Leben das Wichtigste. Und sie würden sich tüchtig wundern, wenn’s einmal alle damit wär.
Denn Jule war eine gebildete Frau, die von der Landwirtschaft etwas verstand.
Sie also wandte den Rest ihrer verkümmerten Gefühle dem kleinen Klaus Spreemann zu. Besser etwas als gar nichts. Das konnten beide voneinander sagen. Klaus bekam zweimal am Tage eine warme Suppe und spielte dafür geduldig mit alten Knöpfen. Und Jule war froh, nicht allein zu sein. Sie hatte sich seit langem ein Hündchen gewünscht. Das war etwas Ähnliches …
In der Herberge aber wurden die Leute nicht alt. Eines Tages war’s vorbei mit der Jule. Es war der gewohnte Winterschnupfen gewesen. Von dem sie zu sagen pflegte, dass er drei Tage komme, drei Tage stehe und drei Tage gehe. Wohl fünfzigmal hatte sie recht behalten mit dieser Diagnose. Aber diesmal kam’s anders. Nicht der Schnupfen ging, sondern die Jule. Doch ehe sie ihre übernommene Mutterpflicht aufgab, steckte sie dem Vater Spreemann ein kleines, schmieriges Säckchen zu. Einige sorgsam versteckte Groschen klirrten erschreckt darin auf. Für Klaus sollten sie sein. Begraben konnte die Stadt Berlin ihre treue Beamtin. Dienst gegen Dienst. Dreimal benieste Jule noch diese Wahrheit. Dann war sie ihres Berufs und allen Gespöttes enthoben. Sie sah zufriedener aus als je im Leben. Klaus’ Vater aber steckte das Groschensäckchen tief in den Stiefelschaft und wunderte sich, dass selbst am einfachsten Geld kein schlechter Geruch bleibt …
Von dieser Stunde an wanderte Klaus mit dem Vater mit. Sein sehnlichster Wunsch war, ebenso viel aufbuckeln zu können wie dieser. Ein dickes Bündel unter dem linken Arm, ein gleiches auf der linken Schulter, das schwerste aber in der rechten Hand. Bald konnte er’s. Schwer beladen hielt er Schritt, in faltigen Hosen und einem alten Männerrock. Die Stiefel so weit und groß, dass die Füße darin immer noch einen Schritt allein für sich machten. Trotzdem sie doch reichlich genug zu laufen bekamen. Seit dem Tod der Mutter hatte Klaus keine Kleider mehr getragen, die für ihn selbst bestimmt waren.
Begreiflich, dass er manchmal mit sämtlichen Packen haltmachte, wenn er einen Altersgefährten in neuen Kleidern sah; dass er weit hinter dem Vater zurückbleiben konnte, um mit weit aufgerissenen Augen zuzustarren, wie ein Dickbauchiger, der des Vaters Angebot ärgerlich abgewinkt hatte, seinem Hunde ein großes, richtiges Fleischstück zuwarf.
Ja, reich musste man sein. Reich. Die Reichen waren die Starken.
Und des Abends, wenn Vater und Sohn den Stadttoren zueilten und rings in den dunklen Wiesen die Kobolde kauerten, träumte Klaus, dass er schon solch ein reicher Mann sei. Der im Sommer im Schatten sitzen und süße Getränke gegen den quälenden Durst trinken konnte. Der im Winter durch die Scheiben der warmen Stuben die Schneeflocken zählte. Der sogar seinen Hund mit gebratenem Fleisch füttern konnte, das manche Jungen nicht einmal sonntags bekamen.
Und blinkten die ersten Lampen auf, war die Wirklichkeit wieder da, sagte Klaus sich’s immer aufs neue: Reich muss man sein. Reich.
Dieser zähe Wunsch war sein erstes Kapital, das ihm Zinsen brachte wie jedes Vermögen.
Erstaunlich schnell begriff Klaus die alten Hosen und Jacken so vorzulegen, dass Flicke und Risse auf der anderen Seite waren. Verstand er mehr zu verlangen, als selbst der Vater als Bezahlung wünschte. Lernte er, dass Kunden angelächelt sein wollten, gleichviel ob man fror oder schwitzte.
In den ersten Jahren seines Umherwanderns sprach man noch viel vom Krieg. In den Schilderungen von Raub- und Beutezügen hockte der Neid über das rasche Soldatenglück. Klaus wünschte sich neue Kriege. Er wollte Soldat werden. Gewiss, es würde Gefahr geben, aber auch ebenso viel Wege zu Geld und zu Glück.
Wenn er dergleichen dachte, machten seine Beine so große Schritte, dass sie den humpelnden Füßen des Vaters lange vorauskamen.
Aber es wurde nicht wieder Krieg.
Es kamen bessere Zeiten für die Berliner. Gute Tage. Sehr gute Jahre. Aus der Ruhe des Friedens hob sich der Wohlstand. Auf blutgedüngtem Boden wogte Erntesegen.
Neue Zeiten – neue Kleider.
Mancher, der nie eine neue Jacke getragen, konnte sich, wenn’s ihm gefiel, jetzt zwei auf einmal anmessen lassen.
Viele, die jeden Lumpenfetzen verkauften, um einen Sechser in die leere Tasche zu kriegen, erinnerten sich gar nicht mehr, je dergleichen Handel getrieben zu haben, und klapperten mit Geld im gut gefütterten Rock.
Friedrich Spreemanns Geschäft war gehemmt.
»Die Konjunktur der Landstraße steht faul.« Er sagte es immer häufiger unter der rauchenden Funzellampe am Wirtstisch. Und manches vom Hunger modellierte Gesicht nickte ihm schweigend Beifall.
Sonderbar war nur, dass Spreemann bei solchen Reden wohl schmerzlich das Gesicht verzog, doch nicht sonderlich von Sorgen gehetzt schien.
Man kann auch ein Übel bedauern, ohne selbst davon betroffen zu sein. Denn nicht jeder ist ein Egoist.
Viel stärker als die Zeit drückten Friedrich Spreemann seine hohen gefüllten Stiefel. Selbst wenn er die Füße still unter dem Tisch hielt, geschweige denn bei jedem Schritt, fühlte er die harten Taler, die Rubelchen und Napoleons, die sich in den Tagen der guten Konjunktur dort angesammelt hatten. Und unter der linken Zehe, in der tausend Stecknadeln stachen, wenn sich das Wetter ändern wollte, und die er darum sein Barometerchen nannte, lagen die Scheine. Die ersten Zettel, die der preußische Staat seinen Bürgern gegen Bargeld gegeben. Das erste Papiergeld.
Der Mensch ist immer mehr, als sein Nachbar von ihm glaubt.
Der siegreiche, preußische Staat war Friedrich Spreemanns Schuldner.
Und an Klaus sollte er zurückzahlen.
Friedrich Spreemann war zu sparsam und praktisch, um von seinen Schätzen noch etwas für sich auszugeben. Er war ein zu gewiefter Geschäftsmann, um nicht zu wissen, dass ein verbrauchtes Leben nichts wert war. Abgetragene Sachen auszubessern, das lohnte sich nicht.
Aber das Leben von Klaus war noch neu, war ein glattes, gediegenes Stück, aus dem sich noch alles schneidern ließ. Er konnte in Wirklichkeit haben, was sich sein Alter nur gewünscht hatte.
Klaus war pfiffig, gut und geduldig. Er würde erst einen kleinen Laden haben. Dann einen größeren. Und schließlich einen großen. Er würde eines Tages so viel Steuern zahlen, dass ihm der König gnädig zuwinken würde, wenn er ihm Unter den Linden begegnete. Mancher, der das sieht, wird dann vielleicht sagen: Sein Vater war noch Händler. Allerdings ein tüchtiger …
So hatte auch Friedrich Spreemann seine heimlichen Träume. Trotz seines guten Geschäftssinns naschte auch er von dieser goldenen Arznei. Sie kostete gar nichts. Und war doch das beste Mittel gegen knurrenden Magen und wunde Füße.
Klaus war nicht wenig erstaunt gewesen, als der Vater eines Tages mit ihm in eine Schneiderstube bog und dem Schneider befahl, dem Jungen hier Hose und Rock anzumessen.
In der warmen Werkstatt saß neben dem Ofen des Schneiders Vater und hämmerte Schuhe. Da waren zwei schöne Gewerbe friedlich beisammen.
»Ihr habt’s gut«, sagte Friedrich Spreemann, als er sich ächzend auf einen Stuhl plumpsen ließ. Seine tränigen Blicke blinzelten von Schuster und Schneider zu Klaus hinüber und dann an sich selbst nieder.
Ja, ja. Um das Stubenhocken zu lernen, war nicht mehr Zeit genug übrig. Er hatte zu viele Menschen dem Leben Adieu sagen sehen, um nicht zu wissen, was die dicke Schwere in Kopf und Beinen bedeute.
Der Bader hatte schon recht: Fünfzig Jahre lang immer zu wenig Brot und immer zu viel Schnaps, das rächt sich. Es geht alles ganz natürlich im Leben zu …
Der Schneider – ein Stück Kreide hinterm Ohr, zwei Stecknadeln im Mund, die Elle in der Hand – drehte kichernd mehrmals Klaus herum, bevor er mit dem Maßnehmen begann.
Er sagte, dass er das junge Herrchen gar nicht herausfinde aus dem großen Rock, und meckerte wieder.
Aber der Alte am Ofen, der neugierig zusah, stocherte mit dem gebogenen Zeigefinger in die Luft und krächzte, dass man dem Bürschchen da noch manchen neuen Anzug anmessen werde. Hunger und Entbehrung machen die Schlauköpfe.
»Das ist wahr«, sagte der Schneider und sah sich in den Spiegel.
Kleider machen Leute. Spreemann hatte es oft genug versichert, wenn er seine Waren anpries. Überzeugt von der Wahrheit dieser Worte aber wurde er erst, als er seinen Klaus im neuen Anzug sah. So wohlgewachsen und stämmig hatte er sich seinen kleinen Ableger gar nicht gedacht. Er hatte alle Mühe, seinen Stolz zu unterdrücken.
Denn erst hieß es, Schneider und Schuster noch einige Silbergroschen vom Preise zu handeln. Freude braucht nicht gleich übermütig und verschwenderisch zu machen.
Alles zu seiner Zeit. Stolz und Wichtigkeit breiteten sich erst über sein Gesicht, als man den niederen Laden betrat, wo Klaus als Lehrling eintreten sollte.
Hier begann Spreemann, seinen Sohn aus vollem Halse zu rühmen. Es wurde ihm leicht. Es war eins der seltenen Male, dass ihm das Lob über den angepriesenen Gegenstand von Herzen kam. Es war das erste Mal, dass er etwas anzubieten hatte, das nicht nur wie neu aussah, sondern auch wirklich nicht abgenutzt war.
Doch Klaus’ künftiger Prinzipal, der in den Kriegsjahren eine Zeit lang Spreemanns Weggenosse gewesen, unterbrach ihn lächelnd. Er klopfte ihm auf die Schulter und sagte: »Er ist dein Sohn, Spreemann, das genügt mir.«
So trennten sich die Wege von Vater und Sohn. Spreemann wanderte allein hinaus …
Klaus fegte den Laden, verschnürte Pakete, sprang schnell über die Straße, um seinem Herrn das heimliche Schnäpschen zu holen, zog die Wassereimer aus dem Brunnen und kaufte Eier und Brot für die Frau Prinzipalin. In der Mittagsstunde aber, wenn der Herr Chef sein Nickerchen machte, durfte er selbst die Kunden bedienen und den Stoff an der Elle abmessen.
In seiner Schlafkammer war es nicht wärmer als draußen auf der Landstraße. Im Winter war das Wasser in der Kanne gefroren. Wie Feuer brannte das Eis nach dem Waschen auf Gesicht und Händen. So lebte Klaus – trotz aller Bescheidenheit – auf vertrautestem Fuß mit zwei der mächtigsten Elemente.
Am Nachmittag kam sogar etwas Sonne zu ihm. Wenn auch nicht auf dem geradesten Wege. Ehe sie unterging, brach sich ihr blankes Licht in den gegenüberliegenden Fenstern. Die warfen einen warmen Widerschein hinüber zu Klaus. Und oft genug brockte er sich sein Vesperbrot bei schönstem Sonnenschein in die dampfende Tasse.
Zu all diesem bekam er in jedem Monat noch zwei runde Taler ausgezahlt.
Als er sie zum ersten Mal erhalten hatte, wollte er sie dem Vater geben, der ihn des Sonntags fast immer besuchte, denn er wusste, wie viel Geld seine neuen Kleider gekostet hatten. Aber Spreemann wehrte würdig ab. Er sagte:
»Du hast nun Anzug und Schuhe. Du wirst also bald an ein Hemd denken müssen. Und über kurz oder lang sogar an ein zweites. Auch die beiden Paar Strümpfe werden nicht ewig reichen. Verschwende nicht, aber kaufe, was sich als nötig erweist.«
Als er dann in der Dämmerung des Sonntags durch die ruhigen Straßen, vorbei an den erhellten Fenstern der Giebelhäuser, dem Stadttor zuwanderte, wo seine Herberge lag, blieb er häufig stehen, um heftig mit dem Kopf zu nicken. Auf Schritt und Tritt war ihm etwas anderes eingefallen, was sich sein Klaus wird anschaffen müssen, um so nach und nach ein Herr zu werden …
Er hätte gern mit angesehen, wie der König den Klaus Unter den Linden grüßen würde. Immerhin erlebte er noch, dass Klaus mit einem weißen Kragen und großer Seidenkrawatte, die widerspenstige Lockenfülle mit wohlduftender Pomade vornehm geglättet und gescheitelt, als »junger Mann« hinter dem Ladentisch stand. Dass er nicht mehr zu fegen brauchte, sondern nur mit einem Federpuschel die Waren abstäubte und zu jeder Tageszeit die geehrten Kunden artig lächelnd bedienen durfte.
So weit war Klaus gekommen, als eines rauen Novembersonntags nicht mehr die eigenen Füße, sondern mitleidige Menschen den Vater zum Sohn brachten. Er war einige Straßenecken vorher zusammengebrochen.
Klaus bewohnte noch dieselbe kleine Kammer. Nur dass jetzt ein paar Handelsbücher darin standen und Seife, Kamm und Pomade dazugekommen waren. Der kleine, kalte Raum borgte sich gerade wieder den allerletzten Sonnenfunken vom Nachbarhause, als man Friedrich Spreemann auf seines Sohnes Bett legte.
»Die schöne Sonne«, sagte er bewundernd.
Als er sich ein wenig erholt zu haben schien, befahl er dem weinenden Klaus, ihm die hohen Stiefel von den geschwollenen Beinen zu schneiden. Und drückte ihm das Messer dazu in die Hand.
Klaus sammelte fassungslos die herausspringenden Münzen zusammen, auch das Wachstuchpaket unter dem Barometerchen fand er.
»Alles für dich«, sagte Spreemann. »Mit einem kleinen Laden fang an.»
Dann schien seine Kraft zu Ende zu sein. Klaus schluchzte und begann mechanisch das Geld zu zählen.
Da hob Spreemann noch einmal mühselig den Kopf und flüsterte unruhig, dass Klaus nun etwa nicht unnützes Geld für das Begräbnis verschwenden solle.
»Sparsamkeit ist halber Profit.«
Bei diesen Worten war Klaus seines Vaters gesetzlicher Erbe geworden.
Drittes Kapitel
Man kann in niemand hineinsehen. Möglich, dass der freundliche Herr Spreemann noch heute an die vergangenen Zeiten zurückdachte. Anzumerken war es ihm nicht.
Er war nun längst gewohnt, dass sein Lehrling den Laden fegte und dass sein junger Mann die Waren und den Wandspruch mit einem Federpuschel abstäubte. Dass über der Ladendecke eine hübsche Wohnung lag, mit Mullgardinen an den Fenstern und einem breiten Lehnstuhl davor, mit warmem Ofen und hohem Federbett. Und dass Klaus Spreemann darin der Hausherr war.
Was dem Vater der Krieg gewesen, war dem Sohn der Frieden geworden. Von allen Seiten war man durch die friedenbehüteten Tore gezogen, hatte sich sesshaft gemacht und war Berliner geworden. Und da man – so wohl sich’s auch lebte im werdenden Wohlstand – doch nicht im Paradiese war, so hatte man Kleider gebraucht. Kleider und wieder Kleider. Trotz aller Sparsamkeit.
Klaus Spreemann hatte nicht nach Käufern zu suchen gebraucht. Er hatte nur reell und billig zu sein. Zumal auf dem Firmenschild.
In den zwanzig Jahren, die seit seiner Jünglingszeit verflossen waren, hatten sich die Berliner um das Doppelte vermehrt.
Dazu hatte Klaus Spreemann allerdings nichts beigetragen.
Aber auch das war verzeihlich.
Er hatte keine Zeit für Ehe und Liebe gehabt. Alle seine Tage hatten der Arbeit gehört. Einer wie der andere. Denn damals war es noch keine Sünde, auch sonntags ein gutes Geschäft zu machen. Erst zu vielen Jahren gereiht, hatten alle diese zähen Stunden diesen heimlichen Wohlstand geschaffen.
Doch auch ohne um Amors Reich zu streichen, hatte Klaus Spreemann mehr Freuden genossen als die meisten seiner Mitbürger.
Man kann seine Abstammung vor anderen verbergen, aber nicht vor sich selbst.
Keiner, wie Klaus Spreemann selbst, konnte ganz und voll ermessen, was es heißen wollte, des Morgens in sonniger Stube ein kühles Leinenhemd über die gepflegte Haut rieseln zu lassen. Oder sich an einen Tisch zu setzen, der sauber gedeckt war, wo Messer und Gabeln blank, mit reinlichen Horngriffen – und später sogar mit Elfenbeinenden – neben dem guten Berliner Porzellan lagen und Speisen aufgetragen wurden, die auf dem eigenen Herde gekocht waren. Wer begriff, was es sagen wollte, dann mit vollem Magen, die lange Pfeife im Mund, in der Ladentür zu stehen und sich von den besten Bürgern höflich grüßen zu lassen.
Wer von seinen Nachbarn wusste, was es bedeutete, des Abends, wenn draußen der Regen rauschte und die Hunde die müden Schritte eines nächtlichen Wanderers umkläfften, unter das hohe Federbett zu kriechen und an das Dunkel der Landstraße, an die schmutzigen Strohsäcke der Herberge zu denken.
Ruhe und Zufriedenheit gab das.
Selbst die schmerzlich süßen Vorfrühlingstage, wo die weiche Luft mit Veilchenduft gemischt ist, obwohl sie noch nirgends blühen und jeder sich wünschevoll fragt: »Was wollen alle die schönen Tage, wird einer auch mir etwas bringen?«, erregten Klaus Spreemann nicht. Er wusste genau, was sie ihm bringen würden: eine gute Saison.
Und ebenso wenig beunruhigten sein Gemüt die ungewohnten Pfiffe der neuen Eisenbahn, die dann und wann vom Potsdamer oder Anhalter Tore über die Stadtmauer schrillten. Er sagte, dass man auch in Berlin Sonne und Mond sehen könne. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, dass es irgendwo in der Welt schöner sein könne als hier.
Ganz früher, ehe er das war, was er heute geworden, war er wohl manchmal an sommerlichen Sonntagsabenden mit irgendeinem runden Mädchen durch die Kornfelder nach Tempelhof und Schöneberg gewandert. Oder hatte auf dem Stralauer Fischzug eine rotbäckige Schöne einige Runden hindurch auf dem klingelnden Karussell begleitet auf hochgebäumtem und doch sicherem Pferde. Aber nie hatte er solche Ausfälle mit den Gedanken an seine Zukunft verbunden.
Zu dieser gehörte eine Dame.
Zwischen die Mullgardinen und die buntbemusterte Tapete hätte nur eine von den hübschen Demoisellen gepasst, die an der Seite ihrer Mama den duftigen Tarlatan für die Ballkleidchen bei ihm kauften.
Aber im Privatverkehr mit seinen Kunden fühlte sich Klaus Spreemann unsicher. Besonders den jungen Damen gegenüber, die immer über etwas Unbekanntes kicherten und lachten, sodass man ängstlich nach allen seinen Knöpfen zu fassen begann.
Mit den Herren und auch mit den älteren Damen war es leichter gewesen, auf dasselbe Niveau zu kommen. Dazu hatte beinahe der einzige Erziehungslehrspruch zugereicht, den er aus seiner Kindheit behalten hatte. Und den er der Latrinen-Jule verdankte.
»Guter Ton ist nichts weiter als Katzenfreundlichkeit«, hatte sie mehr als einmal gesagt, wenn sie mit den anderen städtischen Beamtinnen ihres Berufs beisammen saß und Strümpfe strickte oder sich mit einer der langen Stricknadeln hinterm Ohr kratzte.
Mit diesem Satz konnte man weiter kommen, als man glaubte.
Nur bei den jungen Damen reichte er nicht aus.
Darum hatte sich Spreemann, als seine Wohnung immer gemütlicher wurde, sogar verleiten lassen, ein Buch anzuschaffen, von dem jetzt viel die Rede war, weil es über den Umgang mit Menschen belehrte.
Aber was da an Nachsicht, Höflichkeit und Geduld seinen Mitmenschen gegenüber gefordert wurde, hatte Klaus Spreemann im Blut sitzen. Dass man sich vor weichen, verworrenen Wünschen hüten sollte, war ihm ebenfalls selbstverständlich.
Über die Liebe jedoch fand er nur etwas Bemerkenswertes: Dass man dem geliebten Gegenstand nicht stundenlang ins Gesicht starren dürfe. Das wäre Klaus Spreemann ohnedies niemals eingefallen. Einzig neu war ihm, dass man auch seine ernsten Absichten nicht dem geliebten Gegenstand anvertrauen dürfe, sondern nur dem infrage kommenden Papa.
Das war ein unsicheres Geschäft. Denn es war natürlich leichter, einem vernünftigen, älteren Herrn zu gefallen als einem wetterwendischen Mädchen voll Spaß und heimlichem Schnickschnack. Nachher hatte man das Auslachen, konnte blamiert für alle Zeit hinter dem Ladentisch stehen. Ein solider Geschäftsmann aber lässt sich auf keinerlei Risiko ein.
Vielleicht ging Klaus Spreemanns löbliche Vorsicht hier zu weit, denn manche der Mütter, besonders solche, die schon drei Winter hindurch Ballkleider einkauften, oft sogar für mehrere Töchter, lächelten den offenbar recht gut situierten Herrn Spreemann, der im besten Mannesalter hinter dem Ladentisch stand, sehr gütig und nachsichtig an. Spreemann aber kam es gar nicht in den Sinn, dieses Lächeln auf seine Privatperson zu beziehen. Er war überzeugt davon, dass die Damen nur lächelten, weil sie möglichst billig einkaufen wollten. Sankt Nikolai schützte sein Patenkind vor Amors Hinterlist.
Trotzdem stand Klaus Spreemann nicht mehr allein auf der Welt.
Seit es ihm gut und reputierlich ging, hatte es sich herausgestellt, dass auch er, wie alle anderen soliden Bürgersleute, Verwandte besaß. Onkel, Tanten, Vettern und Basen. Ganz wie sich’s gehörte.
Man sagte damals häufig: dass Unglück zusammenleime. Sicherlich klebten auch schon zu jener Zeit Glück und Gelingen bedeutend fester.
Denn auf Onkel Emil, den Gerbermeister Ziehlke und dessen Frau, die Tante Minna, die nun beide meist noch mit ihrer Verwandtschaft seine gewohnten Feiertagsgäste waren, konnte er sich aus seiner Kindheit her nur wenig erinnern. Auch dass er mit ihren Kindern, seinen Cousinen, reizend gespielt haben sollte, war ihm ganz etwas Neues.
Er wusste nur noch, dass Ziehlkes zu fein gewesen waren, um mit ihnen zu verkehren. Vater und er wurden stets mit wenig Freude aufgenommen, wenn sie einmal des Sonntagnachmittags in der Splittgerbergasse einkehrten. Ihre Besuche dauerten nicht lange. Wenn die Kaffeetasse ausgetrunken war, wischte man sich den Mund und ging weiter, worüber Klaus allerdings sehr zufrieden gewesen war. Denn hier musste er sich immerfort die Nase zuhalten, trotzdem er durch die Latrinen-Jule gewiss nicht verwöhnt war. Er konnte sich nicht genug wundern, dass es etwas Feines war, zwischen diesen stinkenden Fellen zu wohnen. Er konnte gar nicht begreifen, wie man das aushielt.
Jetzt war er natürlich lebensklüger geworden. Wenn er jetzt Pfeife rauchend mit Onkel Emil über gute und schlechte Konjunkturen sprach, wusste er: Geschäft ist Geschäft.
Aber auch mütterlicherseits hatte Klaus Spreemann Angehörige. Das war die Tante Karoline, die er früher überhaupt nicht gekannt hatte. Erst als sie Witwe geworden und Klaus schon zum zweiten Mal den Laden vergrößerte, war sie eines Sonntagnachmittags zum Kaffee gekommen. Mit ihrem Mariechen, das nicht viel jünger als ihr Vetter Klaus war, aber noch verschämt auf alles Liebesglück der Welt wartete. Zu diesem Zweck vermietete Tante Karoline ihr bestes Zimmer an einzelne Herren, Studenten oder Sekretäre. Einstweilen noch ohne den gewünschten Erfolg.
Klaus hatte sie mit freundlicher Zufriedenheit ausgenommen, als sich die schmale Dame mit Kapotthut, Seidenumhang und goldener Brosche zu seinem Erstaunen als nahe Angehörige bekannte. Und er hatte auch Mariechen, die er ein wenig vertrocknet fand, kräftig die Hand gedrückt. Sodass sie errötet war und »O, Vetter!« gelispelt hatte. Und als dann Ziehlkes hinzukamen, hatte er mit großer Genugtuung die neuen Verwandten miteinander bekannt gemacht und ohne Ärger eine zweite Portion Streuselkuchen holen lassen. Er fand es durchaus richtig und standesgemäß, dass man an festlichen Tagen Verwandtenbesuch zu erwarten hatte. Es war gleich, ob man den Ofen für zwei oder zehn Personen heizte. Nur der Taugenichts gehört zu niemand.
Und der gute Hausgeist, der den Ofen zu heizen und den Kaffee zu brauen hatte, murrte doch nie über ein Zuviel an Arbeit.
Nach manchen Jahren des Ärgers, Aufpassens und doch Übervorteiltwerdens hatte Herr Spreemann auch in der Wahl seiner Wirtschafterin das Rechte getroffen. Mamsell Lieschen schien eigens für diesen Beruf erschaffen zu sein. Sie hatte alle Tugenden des sparsamen Weibes. Auch die, das Herz eines einzelnen Herrn nicht eine Sekunde lang zu beunruhigen. Im Waisenhaus groß geworden, ging stets ein Strom praktischen Gleichmuts und bescheidener Geduld von ihr aus.
Wenn der Frühling kam, band sie sich keine bunten Schleifen ins Haar, sondern sie freute sich, dass nun die Frostbeulen heilten, die Eier billiger wurden, dass es Radieschen gab, die Herr Spreemann schätzte, und jungen Schnittlauch und duftenden Dill. Wenn die Sommersonne ihr Blut zu erhitzen versuchte, hatte sie vor Arbeit überhaupt nicht Zeit, dies zu bemerken. In jeder Woche beinahe hatte eine andere Obstart ihre preiswerteste Zeit und musste als Winterkompott eingekocht und in Gläser gepackt werden. Und mit der größten Akkuratesse. Im Herbst aber drehte sich Lieschens ganzes Denken um die Gans. Geschunden, gepökelt, gefüllt, gebraten wand sich dieser nützliche Vogel in ihren fleißigen Händen. War doch an jedem Sonnabend dicht vor der Haustür großer Gänsemarkt. Stundenlang durchschritt Mamsell Lieschen die Reihen der blauen Leiterwagen, zwischen deren Latten die langen Gänsehälse die schnatternden Köpfe heraussteckten.
»Kommen Sie her, Jungfer Lieschen, ein schönes Gänschen für den reellen Herrn Spreemann.«
»Brät sich im eigenen Fett wie die reiche Madame«, lockten die Marktfrauen.
Aber ehe Mamsell Lieschen nicht mindestens dreißig Gänsebrüste befühlt hatte, kaufte sie nicht. Das war sie dem ehrenvollen Vertrauen Herrn Spreemanns wohl schuldig. Sie trug manch blutigen Riss der unvernünftigen Gänse an Armen und Händen. Aber mit dem gleichen Stolz wie der Student seine Schmisse.
Im Winter waren die kurzen Tage auch reich mit Arbeit beladen. Da heizte Mamsell Lieschen die Öfen, briet sie Schweineschmalz aus, zart und weiß wie Himmelsschnee, hatte sie in der eiskalten Speisekammer immer etwas Gesülztes und Gepökeltes zu drehen und zu wenden.
Strickte sie Strümpfe und Pulswärmer für Herrn Spreemann, faltete sie Fidibusse, briet sie in der einen Ofenröhre kleine, runde Äpfel braun, wärmte sie in der anderen Herrn Spreemanns hellgrüne, von ihren Händen mit Rosen bestickte Hausschuhe und kannte von morgens sechs bis abends neun kein Ausruhen. Dann aber sank sie träumelos in Schlaf.
Für alles dies erhielt sie Ende jedes Monats drei runde Silbertaler. Und wenn jetzt das dritte Jahr herum sein würde, sollte sogar ein vierter, ebenso runder hinzukommen.
Aber schon die drei Taler ärgerten Tante Karoline, die sehr rasch heimisch bei ihrem Neffen geworden und ihn viel häufiger besuchte als die Familie Ziehlke. Sie machte Klaus oft genug darauf aufmerksam, dass dieser Lohn geradezu auf die Straße geworfen sei. Und gab ihm zu verstehen, dass sie selbst von Herzen gern bereit wäre, Mamsell Lieschens Amt zu übernehmen. Aus reiner Verwandtenliebe, ohne die geringste Entschädigung. Und Mariechen bekäme er ebenso gratis dazu. Das liebe Kind spielte so reizend Piano. Und würde die ganze Wohnung mit Wohllaut erfüllen. Sogar das Piano würde sie mitbringen. Es war die stumme und doch geräuschvolle Bezahlung eines Mieters, der ohne Abschied zu nehmen ausgezogen war.
Frauen sind schlau. Und Klaus war kein Praktikus ihnen gegenüber. Aber er gehörte zu den glücklichen Menschen, die stets von selbst das Richtige finden. Wenn Tante Karoline von diesen heiklen Dingen sprach, sah er so eifrig zur Decke auf, wie wenn er dort eine vielziffrige Rechnung zu addieren hatte, und dazu zog er so kräftig aus seiner Pfeife, dass er sehr bald hinter einer Wolke von Tabak allen irdischen Wünschen entschwand. Erst wenn Tante Karoline hustete und spuckte und sich die Wolken wieder zu verteilen begannen, fragte er ruhig:
»Und dein neuer Mieter, gefällt er euch, seid ihr zufrieden miteinander?«
Er konnte fast immer nach einem neuen Mieter fragen. Tante Karolines Hausgenossen wechselten rascher als der unbeständige Mond. Sie hatten es zu gut bei Tante Karoline, und das können die Menschen bekanntlich nicht vertragen. Wohl zehnmal des Tages klopfte Mariechen an die Tür und fragte, ob der junge Herr vielleicht etwas nötig habe. Sobald sich aber der Herr Student oder Sekretär zum Ausgehen rüstete, kam Karoline selbst heraus, fragte, wohin des Weges und wann zurück, und erinnerte daran, dass jung gefreit noch niemanden gereut habe und dass das wahre Glück nur im eigenen Herzen zu finden sei. Man also nicht dazu auszugehen brauche.
Die leichtsinnigen Jünglinge eilten zwar trotzdem davon, aber Tante Karoline sagte sich hier wie bei Klaus, dass noch nicht aller Tage Abend sei. Und das war recht von ihr. Denn Hoffnung muss sein.
Auf diese Weise war man wieder einmal in den März gekommen. Wo der Mensch ganz insbesondere neuen Wünschen geneigt ist. Man heizte zwar noch, aber wenn man die Fenster geöffnet hatte, blieb noch lange ein frischer, belebender Hauch im Zimmer zurück.
Klaus Spreemann hatte schon die ganze neue Sommersaison im Lagerraum. Einen Bleistift hinterm Ohr und einen in der Hand, notierte er die Preise, klebte er die Etiketten, rechnete er die wünschenswerten Überschüsse aus.
Oben in der Küche putzte Mamsell Schmidt die ersten Radieschen und bemerkte dabei mit Staunen die erste Fliege. Die Fliegenklappe, eine Schuhsohle an ein Holzstück gebunden, lag noch wohlverwahrt bei den Sommersachen. Aber Lieschen versuchte trotzdem, sich des geflügelten Insekts zu bemächtigen, denn sie hatte auch für die Mahlzeiten eines Laubfroschs zu sorgen. Sie selbst hatte sich erlaubt, ihn Herrn Spreemann als Weihnachtsgabe zu überreichen.
In Ausdauer geübt, hielt Lieschen auch schließlich diese weltfremde erste Fliege zwischen Daumen und Zeigefinger, um sie so dem Laubfrosch zu überreichen.
Zugleich wollte sie sehen, wie es mit dem Wetter stand.
Es lag eine merkwürdige Unruhe in der Luft. Am Himmel wie zwischen den Häusern. In den Straßen war ein Lärmen, Rennen, ein Gejohle und Gesinge, als wäre die ganze Stadt ein Jahrmarkt. Es war nicht klug zu werden aus alledem.
Aber auch der Laubfrosch schien ratlos zu sein. Er schnappte zwar eilig die Fliege, aber kaum dass er oben auf der Leiter saß, hüpfte er wieder herab. Und war er unten, hopste er wieder hinauf. Heute war irgendetwas nicht richtig in Berlin.
Mamsell Schmidt beschloss, in den Hof hinunter zu gehen und Wasser zu holen. Vielleicht traf man dort am Brunnen diese oder jene, die mehr wusste. Während sie mit den klappernden Eimern die Treppe hinunterstieg, zog draußen wieder ein lärmender Schwarm Studenten vorbei. Sie sangen:
»Gegen Demokraten helfen nur Soldaten.«
Lieschen schüttelte den Kopf. Das ging nun schon seit Tagen so. Herr Spreemann hatte wirklich recht. Hatte man ihnen dazu ein ganzes Schloss eingerichtet? Dieses Prachtgebäude am Kastanienwäldchen? Als Lieschen den Brunnen wieder zuklappte, kam gerade die Sonne noch einmal hervor. Ihr tiefroter Abendschein spiegelte und bewegte sich in den gefüllten Eimern.
Wie Blut, dachte Lieschen und wusste nicht, was sie auf solche dummen Gedanken brachte.
Hastig griff sie nach den Eimern, um ins Haus zu gehen.
Da kam Anna, die Magd von Herrn Kreisrat Giesecke, der mit seiner Familie das obere Stockwerk bewohnte, eilig herausgelaufen.
Herr Kreisrat ließ Herrn Spreemann raten, nicht wie gewöhnlich zu Klausing an den Stammtisch zu gehen, sondern sich sein Weißbier rechtzeitig ins Haus holen zu lassen. Denn heute wäre die Straße kein Aufenthalt für anständige Leute. Er selbst ginge auch nicht aus.
Wieder schrillten draußen Pfiffe, und laufende Schritte jagten über das Pflaster.
»Was wollen denn die verrückten Menschen nur«, fragte Mamsell Schmidt und war ganz blass im Gesicht.
Die runde, saftige Magd zuckte die Achseln.
»Ich glaube Gleichheit, das rufen sie wenigstens immer«, sagte sie dann.
»Wie denn, was denn?« Mamsell Lieschen riss den Mund auf. »Was soll denn gleich sein?«
Anna schnäuzte die Frühlingsfeuchtigkeit in der kurzen Nase hoch und sagte:
»Mir ist alles gleich, wenn sie nur nicht schießen tun. Vor den Soldaten fürchte ich mich nicht, nur vor ihren Gewehren.«
Aber da rief man sie, und die Unterhaltung war zu Ende.
Lieschen schleppte die Eimer so rasch es ging die Treppe hinauf. Dann verriegelte sie die Tür.
Gegen Demokraten helfen nur Soldaten, sang man draußen aufs neue. Dann pfiff und heulte es und war wieder vorüber.
Kaum dass es still geworden, klopfte es an der Tür.
»Hier ist niemand«, schrie Lieschen Schmidt und warf willenlos ein Handtuch über die fertig geputzten Radieschen.
»Nu, da machen Sie nur unbesorgt auf, Mamsell Niemand!«, antwortete draußen eine gutmütige Stimme.
Lieschen hatte sofort erkannt, dass da der kleine Herr Hirschhorn vor der Tür stand. Er kam in jedem Monat einmal, um Herrn Spreemanns Hühneraugen zu schneiden. Eine der wenigen Jugenderinnerungen, die Klaus von der Landstraße und den zu großen Schuhen zurückbehalten hatte.
Mamsell Schmidt mochte den kleinen Juden nicht, der jedem Christenmenschen bis unter die Sohlen sah und mit seinem reichen Wissen von Haus zu Haus ging. Aber heute war er ihr von Herzen willkommen. Rasch riegelte sie die Tür auf und ließ ihn hinein.
»Nur schnell, Jungfer Lieschen, schnell«, sagte er. »Ich hab schon dem Herrn Spreemann zugerufen, dass ich da bin. Heute muss es schnell gehen. Heute soll mit Gottes Hilf noch mancher loswerden, was ihn drückt.«
Damit hatte er schon mit seiner schwarzledernen Handwerkstasche den ihm bekannten Weg zu Herrn Spreemanns sauber gehaltenem Schlafzimmer zurückgelegt.
Mamsell Schmidt folgte ihm in Eile und ergriff noch unterwegs einige frischgewaschene Tücher, die sie vor Herrn Spreemanns Lehnstuhl auf den Boden breitete.
»Versprengen Sie nur nicht wieder die Nägel in alle Zimmerecken, Herr Hirschhorn«, sagte sie ermahnend.
»He, he, Mamsellchen, heute wird vielleicht noch etwas anderes in alle Ecken gesprengt«, antwortete der kleine Mann und packte eifrig seine Scheren und Messer aus.
Lieschen starrte ängstlich auf das geriebene Lächeln und seinen Mund.
»Was ist denn nur los«, sagte sie, »soll denn die Welt untergehen?«
Aber da schloss Herr Spreemann die Tür auf, und Mamsell Schmidt huschte bescheiden aus dem Zimmer.