
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Sechzehn über Nacht Addies zwölfter Geburtstag ist eine einzige Katastrophe – niemand nimmt sie ernst, alle behandeln sie wie ein Kind! Als sie sich von einem Wunschkästchen wünscht, endlich sechzehn Jahre alt zu sein, geschieht das Unglaubliche: Am nächsten Morgen ist sie sechzehn, sie hat den lang ersehnten Hund, jede Menge Make-up und einen mega beliebten YouTube-Channel. Wie cool ist das denn!? Doch Addie merkt schnell, dass ihr vier Jahre älteres Ich ihr fremd ist und so gar nicht dem entspricht, wie sie sich selbst sieht. Eins ist klar: Sie muss so schnell wie möglich in ihr altes Leben zurück! Aber wie? Eine rasante Komödie über das Erwachsenwerden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Jessica Brody
Einmal Teenie und zurück
Biografie
Jessica Brody wollte schon immer schreiben. Sie »veröffentlichte« ihr erstes Buch mit sieben Jahren, mit eigenen Illustrationen, selbstgebunden und selbstgebastelt aus Pappe, Tapetenresten und Isolierband. Seit 2005 ist sie freiberufliche Autorin, sie hat bereits über zwölf Jugendbücher und Romane veröffentlicht, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. Sie lebt mit ihrem Mann und vier Hunden abwechselnd in Kalifornien und Colorado. »Einmal Teenie und zurück« ist ihr erstes Buch für ein jüngeres Publikum.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
Widmung
Power-Smoothie-Mixerhirn
Magie im Herzen
Seesterne und Zwiebelatem
Addie und der fürchterliche, schreckliche, grauenvolle, miese Geburtstag
Alles über alles
Der Yeti Forgetti
Zu alt für Teepartys
Besiegelt und beschlossen
Spieglein, Spieglein an der Wand
Weckruf mit Kickboxen
Cupcake-Nägel und Emojis
Tschüs, Addie
Ganz verloren und irgendwie gefunden
Trigo … Was?
Exsquisai – moi
Vorsicht vor Spind 702
Addie van Winkle
(Fast) allein zu Haus
Grace-los
Lächerlich
Shimmer and Shine
Sieben Jungs
Die fünf Flirtregeln
Lächeln wie ein Schnabeltier
Tanz mit mir
Adeline sucht nicht den Superstar
Countdown zur Katastrophe
Entschuldigungen und Bitten
Die große Suche
Auffrischungen und Zusammenbrüche
Keine Zeit für Selbstmitleid
Pfefferminz-Schokolade-Finger
Süßer Kaffeeschlamm
Ein Schritt vor, ein Schritt zurück
Getauschte Herzen
Ich würde dich so gern besser kennen
Zwei Nachrichten und ein Vlog
Ein Lachen verändert sich nicht
Eine Tür knallt zu
Der berühmt-berüchtigte Haarschwung
Schleimiger Sumpfball
Die Rückkehr des Seesternkleids
Geister
Ausgeschummelt
Die Zwinkersmiley-Verschwörung
Klick
Neubeginn
Der sicherste Ort
Wolkenschlösser
Die neue (und verbesserte) Addie Bell
BFFs
Die Rückkehr der Sternendame
Danksagung
Für meine Mom, von der ich gelernt habe, immer jung zu bleiben. Und sei es nur im Herzen.
Power-Smoothie-Mixerhirn
In jeder Straße gibt es den einen verrückten Nachbarn. Bei uns ist das Mrs Toodles.
Natürlich ist das nicht ihr richtiger Name. In Wirklichkeit heißt sie Theodora Philippa Beaumont-Montgomery, wenn man den staubigen Stapeln alter Kataloge in ihrem Wohnzimmer glauben darf. Aber wer hat schon die Zeit, so einen Namen auszusprechen? Woher der Spitzname stammt, weiß ich nicht. Im Sherwood Drive nennt sie einfach jeder Mrs Toodles. Das passt gut zu ihr. Sie sieht genauso aus, wie man sich jemanden namens Mrs Toodles vorstellt, und sie spricht auch so.
Die langen, silbergrauen Haare trägt sie hochgesteckt unter einem winzigen Hut, bei dem ich mich schon öfters gefragt habe, ob sie ihn einer Puppe geklaut hat. Darunter lugen einige Strähnen hervor, als ob die Haare versuchen, ihrem wirren Kopf zu entfliehen. Viele Fältchen umrahmen ihre hellblauen Augen, und sie trägt immer ihren gesamten Schmuck. Angeblich, weil sie Angst davor hat, dass ihr jemand die Stücke klaut, die sie nicht am Leib trägt.
Von meinen Eltern weiß ich, dass sie an sogenannter Demenz leidet – eine Krankheit, die das Hirn so durcheinanderwirbelt, dass man nicht mehr weiß, was real ist und was nicht. So hat es mir zumindest Mom erklärt. Wenn ich jemanden über Mrs Toodles’ »Zustand« reden höre, stelle ich mir immer einen Mixer vor, in dem ihre Gedanken herumgeschleudert werden wie die Zutaten für Moms eklige grüne Power-Smoothies. (Mom versucht mich immer dazu zu bewegen, die auch zu trinken. Allerdings misstraue ich allem, was nach Teichschlamm aussieht.)
Mrs Toodles tut mir leid. Sie hat keine Kinder, und alle anderen Mitglieder ihrer Familie sind schon gestorben. Ich hab auch noch nie Besucher bei ihr gesehen. Soweit ich weiß, bin ich ihre einzige Freundin. Ich gehe mindestens einmal pro Woche zu ihr, weil sie die allerbesten Geschichten erzählt und mir immer Limo und Plätzchen anbietet. Die Limo rührt sie aus einem Pulver an und die Plätzchen aus Backmischungen, aber lecker sind sie trotzdem.
Eigentlich müsste ich schon längst bei ihr sein, weil heute Donnerstag ist und ich sie immer donnerstags besuche, aber ich bin spät dran. Ich habe ihr gesagt, ich käme gegen fünf. Jetzt ist es zwei Minuten nach sechs, und ich stehe bis zu den Knien in einem Haufen aus Pullovern, Leggings und Kleidern, die alle vollkommen untragbar sind. Ich bin auf der Suche nach dem perfekten Geburtstagsoutfit für die Schule morgen, aber bisher ohne Ergebnis. Dass ich in genau fünf Stunden und achtundfünfzig Minuten zwölf werde und trotzdem noch in der Kinderabteilung einkaufen muss, ist auch nicht besonders hilfreich. Mom schwört, dass mein Wachstumsschub kurz bevorstehen muss, aber mein Körper weiß offensichtlich nichts davon, denn ich bin immer noch klein, dürr und peinlich flachbrüstig.
Um ehrlich zu sein, ist es schwierig, sich auf einen Geburtstag zu freuen, wenn sich absolut nichts verändert hat. Klar, es ist toll, dass ich wieder ein Jahr älter werde. Ich hatte schon das Gefühl, ich müsste für den Rest meines Lebens elf bleiben! Aber wo sind die Beweise, dass ich älter werde? Wo sind die Fakten? In meinem BH jedenfalls nicht.
Dass ich die Jüngste in meiner Klasse bin, macht es auch nicht besser. Der Stichtag für die Schuleinführung war der 15. September. Mein Geburtstag ist am 14., also bin ich gerade noch so reingerutscht, aber alle anderen sind älter als ich. Und diese Tatsache wird schmerzlich deutlich, wenn wir uns der Größe nach aufstellen müssen und ich immer am Ende stehe.
Als mein Blick auf meinen Nachttisch mit dem Wecker fällt und mir bewusst wird, wie viel ich zu spät komme, gebe ich die Suche nach dem perfekten Outfit auf. Es war sowieso ein hoffnungsloses Unterfangen. Ich schnappe mir den Plastikbehälter von seinem angestammten Platz im untersten Regal meines Schranks und gehe nach unten. Als ich am Ende des Flurs an Rorys Zimmer vorbeigehe, bemerke ich die halb geöffnete Tür. Das ist komisch, denn meine Schwester lässt nie ihre Tür offen, nicht mal einen Spaltbreit. Sie ist sechzehn und befindet sich gerade in einer supergeheimen Spionagephase, wo niemand irgendetwas über ihre Angelegenheiten erfahren darf, ich schon gar nicht.
Verbissen achtet sie darauf, dass bloß niemand ihr Zimmer betritt. Man könnte fast glauben, dass sie da drin ausländische Raketencodes entschlüsselt oder so. Rory badet sich sogar im Badeanzug, was ich nur weiß, weil ich einmal versehentlich das Bad betreten habe, als sie gerade in der Wanne lag. Sie hat mich so lange angebrüllt, bis ich mit zugehaltenen Ohren geflüchtet bin wie vor einer Granatenexplosion. Ich hatte echt Sorge, dass sie gleich mit einer Shampooflasche nach mir wirft.
Später, nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, habe ich sie gefragt, warum sie mit Badeanzug in die Badewanne geht. Sie meinte, das wäre wegen perverser Spanner wie mir, die ins Bad geplatzt kämen, wenn andere in Ruhe in der Wanne entspannen wollen. Ich habe zwar versucht, sie davon zu überzeugen, dass ich keine perverse Spannerin bin, aber ihre Meinung stand zu diesem Zeitpunkt schon deutlich fest.
Durch den Türspalt versuche ich, einen Blick in Rorys Zimmer zu erhaschen. Diese Gelegenheit bekomme ich nicht oft. Sie ist nicht da. Ich achte darauf, die Tür nicht anzufassen, falls sie später alles auf Fingerabdrücke überprüft.
Im Zimmer sieht es aus wie in einem Saustall. Auf der Kommode liegen kreuz und quer teure Schminkutensilien herum, und ihre Klamotten sind überall verstreut.
Ich seufze. Wenn ich solche Klamotten wie Rory hätte, würde ich sie besser behandeln und sie nicht einfach in Haufen auf dem Fußboden herumliegen lassen. Und was würde ich nicht alles für eine von ihren Lidschattenpaletten geben. Sogar mit einer blöden Tube Lipgloss wäre ich schon zufrieden. Aber nein. Meine Eltern sind da streng. Kein Make-up vor der Highschool. Das letzte Mal, als ich versucht habe, mit einem Hauch von Wimperntusche in die Schule zu gehen, waren drei Tage Hausarrest das Ergebnis.
Das ist eben der Unterschied zwischen einer (fast) Zwölfjährigen und einer Sechzehnjährigen. Mit sechzehn ist alles besser.
Meine Schwester ist beliebt und wunderschön und kauft ihre Klamotten in der Jugendabteilung und hat ein Auto und einen süßen Freund der Woche, der sie in aufregende Orte wie das Human Bean ausführt, das Café in der Stadt, wo alle Teenager hingehen. Im Gegensatz zu mir. Ich bin ein sommersprossiger, kraushaariger, flachbrüstiger Loser, der zu Hause herumhängt und mit den Eltern Brettspiele spielt, während mein Dad, der König des nutzlosen Wissens, über die Geschichte von Monopoly referiert.
Ich springe immer zwei Stufen auf einmal nehmend die Treppe hinab und kürze durchs Wohnzimmer zur Haustür ab. Mom kann es nicht leiden, wenn ich mit Schuhen durchs Wohnzimmer laufe, weil es immer supersauber gehalten werden soll, falls mal ganz besondere Gäste auftauchen. Was nie der Fall ist.
»Ich geh rüber zu Mrs Toodles!«, verkünde ich und klemme mir den Plastikbehälter unter den Arm, damit ich die Tür aufziehen kann. »Bist du gerade mit Schuhen durchs Wohnzimmer gelaufen?«, ruft Mom.
»Nein!«, lüge ich und schlüpfe hinaus, ehe sie vielleicht aus der Küche kommt, um das zu kontrollieren.
Trotz ihres Power-Smoothie-Mixergehirns ist Mrs Toodles meine Lieblingsnachbarin, und ich freue mich immer auf die Besuche bei ihr. Sie erinnert mich an eine alte Königin, die man aus ihrem Reich vertrieben hat und die jetzt auf der Suche nach Untertanen, die sie verehren, im Land herumreist. Sie ist skurril und lustig und kombiniert die merkwürdigsten Lebensmittel. Als ich sie letzte Woche besucht habe, hat sie sich gerade ein Erdnussbuttersandwich mit Gurke schmecken lassen. Es hat total eklig gerochen, und ich musste die ganze Zeit über durch den Mund atmen. Aber das ist es mir wert, denn jedes Mal, wenn ich sie besuche, erzählt sie mir eine ihrer phantastischen Geschichten. Am besten gefällt mir die von dem kleinen Mädchen, das der Hexe das Brot aus dem Ofen klaut. Zur Strafe verwandelt die Hexe sie in eine Ziege. Oder die von dem Jungen, der aus ganz besonderen Bauklötzen einen Turm bis zum Himmel gebaut hat, aber dort oben war es ihm zu kalt, also hat er den Turm wieder eingerissen.
Mir gefällt, wie ihre Augen aufleuchten, wenn sie an die magischen Stellen kommt. Und wie ihre Stimme sich hebt und senkt, als ob sie die Geschichte singt, statt sie nur zu erzählen. Früher habe ich geglaubt, dass diese Geschichten wahr wären. Jetzt, mit zwölf – genauer gesagt, mit fast zwölf, in fünf Stunden und dreiundfünfzig Minuten – weiß ich es natürlich besser.
Mrs Toodles wohnt drei Häuser weiter, zwischen den Lesters und den Tuckers. Die Tuckers haben einen Sohn in meinem Alter. Jacob geht zwar in meine Klasse, aber ich meide ihn wie die Pest, weil er total kindisch ist und gern mit allen möglichen Körperteilen Furzgeräusche erzeugt. Außerdem stinkt er. Obwohl er vermutlich auch nicht schlimmer riecht als die anderen Jungs in meiner Klasse. Warum ist das eigentlich so? Duschen sich Siebtklässler nicht?
Als ich bei Mrs Toodles ankomme, steht sie im Vorgarten und erklärt gerade Mr Tucker, Jacobs Vater, dass einer der Nachbarn ihre Katze im Pool ertränkt hat.
Mrs Toodles hat keine Katze.
Auch keinen Swimmingpool. In ihrem Garten gibt es im Prinzip nichts weiter als welkes Gras und einen Birnenbaum, der ihren eigenen Angaben nach seit 1982 nicht mehr getragen hat.
»Und die Polizei weigert sich, Ermittlungen anzustellen!«, beschwert sie sich beim armen Mr Tucker, der ganz wild darauf wirkt, wieder nach Hause zu gehen. Vermutlich ist er bloß rausgekommen, um die Post zu holen oder so, und wurde von Mrs Toodles in eine ihrer Verschwörungstheorien verwickelt. »Weil Whiskers erst seit zwölf Stunden verschwunden ist, sagen sie.«
Vermutlich stammt das aus einer Krimiserie. Manchmal verwechselt sie die Realität mit dem, was sie im Fernsehen sieht.
Ich beschließe, Mr Tucker aus seinem Elend zu erlösen. Deshalb stelle ich den Plastikbehälter aufs Gras und mache mich bemerkbar. »Hi, Mrs Toodles!«
Sie dreht sich um, und sofort lächelt sie strahlend. »Mademoiselle Adeline!«, flötet sie. Mrs Toodles ist vermutlich der einzige Mensch auf der Welt, der mich bei meinem vollen Namen ruft – einer der vielen Gründe, warum ich sie so mag.
Sie richtet ihr winziges Hütchen, kommt zu mir herüber und umarmt mich. Über ihre Schulter hinweg sehe ich, wie Mr Tucker mir dankbar zuwinkt und schnell im Haus verschwindet.
Ich erwidere die Umarmung und atme den vertrauten Geruch nach Zitrone und Babypuder ein. »Alles Gute zum Geburtstag!«, singt sie und lässt mich los.
»Danke, aber das ist erst morgen.«
Sie tippt mir mit dem Zeigefinger auf die Nasenspitze. »Ich weiß.« Dann neigt sie den Kopf und betrachtet mich, als sähe sie mich heute zum allerersten Mal. »Meine Güte, du wächst ja schneller als Unkraut. Allmählich wirst du eine richtige kleine Dame.«
Ich runzle die Stirn. »Nein. Werde ich nicht.«
Das sagt sie jede Woche. Vermutlich liegt es eher daran, dass sie schrumpft. Genau genommen kann ich das sogar beweisen. Ich messe mich jeden Tag am Türrahmen meines Zimmers. Seit Monaten bin ich keinen Zentimeter gewachsen. Immer noch bin ich lediglich einen Meter vierzig groß, was übrigens der Durchschnittsgröße einer Zehnjährigen entspricht. Ich hab’s nachgeschlagen.
Sie mustert mich aus zusammengekniffenen Augen, als ob sie ein nicht mehr ganz frisches Stück Rindfleisch inspiziert, das ihr der Fleischer andrehen will. »Bist du sicher?«
Um das Thema zu wechseln, schnappe ich mir schnell den Plastikbehälter vom Boden. »Hier, für Sie, Mrs Toodles. Fünfzig. Genau, wie Sie wollten.«
Sie hebt den Deckel an und schreit freudig auf, als sie den Inhalt sieht.
Der Behälter ist bis zum Rand mit leeren Toilettenpapierrollen gefüllt.
»Adeline!«, kreischt sie und kneift mich in die Wange. Sie nimmt mir den Behälter aus den Händen und hält ihn liebevoll im Arm wie ein Baby. »Du bist so ein Schatz! Ich werde sie in Ehren halten.«
Bevor ihr jetzt glaubt, dass sie wirklich total durchgeknallt ist, weil sie sich so über Toilettenpapierrollen freut, sollte ich vielleicht erklären, dass Mrs Toodles daraus Weihnachtsbaumanhänger bastelt. Ihr würdet staunen, wie viele Sachen man aus einer Papprolle machen kann. Also sammle ich bei uns zu Hause leere Rollen für sie. Ich weiß, nicht gerade die glamouröseste Aufgabe der Welt, aber es macht sie glücklich.
»Komm mit rein, meine Liebe. Ich hab Plätzchenzimt gemacht!«
Ich folge Mrs Toodles ins Haus und bemühe mich, nicht zu lachen. Ganz offensichtlich meint sie Zimtplätzchen, aber sie vertauscht häufig die Wörter, genau wie sie manchmal Realität und Fiktion vertauscht.
Sie stellt den Behälter auf den Esstisch und verschwindet in der Küche, um mir Plätzchen und Limonade zu holen. Ich sehe mich in ihrem vollgestellten Haus um. Alles ist genau wie immer. Als hätte sie in ihrem gesamten neunundachtzigjährigen Leben noch nie etwas weggeworfen. Sie schwört zwar Stein und Bein, dass sie jedes einzelne Stück hier braucht, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, was sie mit zehn Messingkerzenleuchtern, drei Lampenschirmen ohne Lampen, sieben riesigen Katzenfiguren und fünf altmodischen Telefonen, die nicht mal eingestöpselt sind, machen will. Ganz zu schweigen von dem Stickbild, auf dem der Schriftzug »Home, sweet Gnom« und das Bild eines winzigen roten Gnoms vor einem pilzförmigen Haus darunter zu sehen ist.
Seit meinem ersten Besuch vor fünf Jahren hat sich hier nichts verändert. Was erklärt, warum mir das mysteriöse Objekt auf dem Esstisch neben meinem Toilettenpapierrollenbehälter sofort ins Auge fällt. Aus einem sonderbaren Grund bin ich nicht in der Lage, den Blick abzuwenden.
Letzte Woche stand das definitiv noch nicht hier. Ist es neu? Oder war es einfach nur irgendwo versteckt?
Ich bahne mir einen Weg über einen kniehohen Stapel alter Kataloge und gehe darauf zu. Bei genauerer Betrachtung stellt sich das mysteriöse Objekt als Schmuckschatulle heraus. Eine sehr alte Schmuckschatulle. Die goldfarbenen Beine haben die Form von eleganten Drachen. Zahllose winzige Edelsteine verzieren den Deckel, auf den dunkelblauen Seiten prangen viele weiße Sterne. Und im Schloss an der Vorderseite steckt ein Messingschlüssel mit einem Strahlenkranz.
Sie ist mit Abstand das Coolste, was ich je in diesem Haus gesehen habe. Das meiste hier ist einfach nur Müll. Aber diese Schatulle … Die ist etwas ganz Besonderes. Das erkenne ich sofort.
Neugierig öffne ich den Deckel, und in diesem Moment höre ich etwas. Ein weit entferntes, gehauchtes Geräusch, wie der Gesang einer Frau. Schnell klappe ich den Deckel wieder zu, und das Geräusch verstummt.
Mrs Toodles kommt mit einem Tablett voller Plätzchen und Limonade aus der Küche zurück. Sie bewegt sich ungefähr so schnell wie eine Schnecke auf Krücken, aber ich bin mir nicht sicher, ob das an ihrem hohen Alter oder dem Gewicht ihres Schmucks liegt. Als sie das Tablett auf dem Tisch abstellt, klappern ihre Armreifen.
»Aha«, sagt sie wissend und sieht hinüber zur Schatulle. »Wie ich sehe, hat la Boîte aux Rêves Cachés dich bereits auf sich aufmerksam gemacht. Das ist ein hervorragendes Zeichen.«
Natürlich habe ich nicht die blasseste Ahnung, wovon sie da spricht. Seit diesem Schuljahr habe ich Französischunterricht, aber bisher haben wir lediglich die Wochentage gelernt und wie man sich ein Schinkenbaguette bestellt.
Es ist nichts Neues, dass Mrs Toodles französische Wörter in ihre Sätze einstreut. Sie wurde in Frankreich geboren und ist erst als junges Mädchen in die USA gekommen, hat also früher ständig Französisch gesprochen. Jetzt schimmert es immer nur stückchenweise durch, in kleinen, zusammenhanglosen Fetzen, so wie der Rest der Dinge in ihrem Smoothiegehirn.
»Was ist das?«, frage ich und schaffe es tatsächlich irgendwie, den Blick von dem Schmuckkästchen loszureißen. Doch selbst jetzt spüre ich noch seine Gegenwart. So, als ob es mich beobachtet.
Ganz vorsichtig hebt Mrs Toodles das blau-goldfarbene Kästchen hoch und hält es schützend in ihrer faltigen, ringgeschmückten Hand wie ein kleines, verletztes Vögelchen. »Setz dich, Adeline«, sagt sie mit funkelnden Augen. »Heute Abend werde ich dir eine ganz besondere Geschichte erzählen.«
Magie im Herzen
»Wusstest du«, beginnt Mrs Toodles in ihrer üblichen schrulligen Art, »dass ich eine entfernte Verwandte der Sternendame bin?«
Wie immer sitzt sie am Kopfende des Tisches und ich daneben. Ich stopfe mir Zimtplätzchen in den Mund und spüle sie mit aus Pulver zusammengerührter zuckriger Limonade hinunter.
Sprachlos schüttele ich den Kopf. Mrs Toodles hat bisher noch nie in einer ihrer Geschichten selbst eine Rolle gespielt.
»Die Sternendame«, fährt sie fort und hält auch weiterhin das mysteriöse Kästchen im Schoß, »oder la Dame Étoilée, wie sie auf Französisch heißt, war eine mächtige Hexe, die als persönliche Mystikerin für Königin Marie Antoinette eingestellt wurde. Weißt du, wer Marie Antoinette war?«
Ich nicke. »Rory hat mal einen Film über sie gesehen. Sie besaß viele Schuhe.«
Mrs Toodles lacht kehlig. »Das ist wohl wahr. Sie war eine junge, leichtfertige Königin mit vielen Luxusartikeln und einer Unmenge Diener. Aber la Dame Étoilée – die Sternendame – musste vor dem Rest des Hofes geheim gehalten werden.«
»Warum?«, murmele ich durch meinen Mund voller Plätzchenkrümel.
»Weil sie eine Hexe war. Und Menschen im achtzehnten Jahrhundert standen der Hexerei nicht allzu positiv gegenüber. Doch nach dem Tod von Königin Marie Antoinette wurde die Identität der Sternendame enthüllt, und sie wurde verurteilt. Man hat sie hingerichtet und ihr Haus bis auf die Grundmauern niedergebrannt. All ihre Habseligkeiten wurden vernichtet.« Mrs Toodles’ Blick fällt auf das Kästchen in ihrem Schoß. »Bis auf das hier.«
Unwillkürlich schnappe ich nach Luft.
»Es heißt la Boîte aux Rêves Cachés«, fährt sie fort. »Das Kästchen der versteckten Träume. Die Tochter der Sternendame hat es aus ihrer Hütte gerettet, und seit damals wird es über Jahrhunderte hinweg immer von der Mutter an eine Tochter oder Enkelin weitergereicht, natürlich geheim. Meine Großmutter hat es an ihrem zwölften Geburtstag bekommen. Meine Mutter wiederum an ihrem zwölften Geburtstag. Genau wie ich. Und da ich kinderlos bin, habe ich lange auf jemanden gewartet, an den ich es weitergeben kann.«
Ihr Blick wandert jetzt vom Kästchen zu mir.
Überrascht blinzle ich. »Ich? Sie wollen es mir schenken?«
Mrs Toodles nickt, und ich spüre einen Kloß im Hals.
»Aber warum?«, bringe ich heraus. Mrs Toodles macht ein schnalzendes Geräusch mit der Zunge und winkt mich näher zu sich heran. Ich beuge mich vor.
»Weil du«, flüstert sie und wirft argwöhnisch einen Blick über ihre Schulter, obwohl wir beide allein im Haus sind, »daran glaubst.«
Sie lehnt sich zurück und wirkt sehr stolz auf ihr Geständnis. »Das wusste ich schon vom ersten Tag an. Ich habe es in deinen wunderschönen grünen Augen gelesen.«
Obwohl ich stark versucht bin, ihr zu sagen, dass ich blaue Augen habe, lasse ich es bleiben. Letztendlich ist es egal. Es ist ja nicht so, als wäre ihre Geschichte wahr. Das sind sie nie. Schließlich glaubt die Frau, ihr Nachbar hätte eine imaginäre Katze in ihrem imaginären Pool ertränkt. Ganz offensichtlich ist sie nicht wirklich der Nachkomme einer Mystikerin aus dem achtzehnten Jahrhundert.
»Du«, fährt sie fort, »hast Magie im Herzen.«
Ich kann nicht anders, ich muss über das Kompliment ein wenig lächeln. »Was meinen Sie mit Magie?«, frage ich. »Wieso glauben Sie, ich hätte Magie im Herzen?«
Sie schnaubt entrüstet, als wäre die Antwort auf meine Frage völlig offensichtlich. »Weil das Kästchen der versteckten Träume sonst nicht funktionieren würde.«
»Nicht funktionieren?«, wiederhole ich. Ich spüre, wie die Neugier in mir blubbert wie kochendes Wasser. Obwohl ich weiß, dass es nicht wahr ist, obwohl ich mir wieder und wieder sage, dass man mit (fast) zwölf zu alt ist, um an solche Geschichten zu glauben, kann ich nicht anders. Ich beuge mich noch weiter vor und frage: »Was genau macht das Kästchen denn?«
Mrs Toodles grinst mich verschmitzt an und beugt sich so weit zu mir, dass wir uns an der Stirn berühren und ich ihr tief in die blauen Augen sehen kann. »Ach Adeline, du Dummerchen«, sagt sie geheimnisvoll. »Es erfüllt Wünsche.«
Seesterne und Zwiebelatem
Am Morgen klingelt mein Wecker um sechs. Stöhnend drücke ich die Schlummertaste und ziehe mir das Kissen über den Kopf. Ich bin so müde. In der Nacht zuvor habe ich ganz schlecht geschlafen. Stundenlang habe ich mich hin und her gewälzt und über die Geschichte der Sternendame nachgedacht.
Jedes Mal, wenn ich die Augen zugemacht habe, konnte ich wieder die Stimme von Mrs Toodles in meinem Kopf hören; wie einen Geist, der durch die Korridore schwebt und dabei immer und immer wieder dasselbe flüstert: »Es erfüllt Wünsche.«
Bevor ich zum Abendessen zurück nach Hause ging, hat sie mir die Schatulle überreicht. »Du musst lediglich deinen Geburtstagswunsch auf einen Zettel schreiben und ihn mit dem Schlüssel darin einschließen«, hat sie mir mit funkelnden Augen erklärt. »Den Rest übernimmt das Kästchen der versteckten Träume.«
Dann stand sie auf, nahm das Tablett und ging damit zurück in die Küche, als wäre nichts passiert. Als hätte sie nicht gerade eine riesige Bombe platzen lassen.
Lange stand ich schweigend da, starrte das Kästchen an und dachte über ihre Worte nach. Eine hingerichtete Hexe? Eine magische Schmuckschatulle?
Ganz offensichtlich ist das nur ein Märchen, sagte ich mir. Ganz offensichtlich ist nichts davon wahr. Ganz offensichtlich erfüllt das Kästchen keine Wünsche.
Aber einen Moment später, als ich gerade auf dem Weg zur Haustür war, kam Mrs Toodles aus der Küche, zog mich in ihre Arme und flüsterte mir etwas ins Ohr. Ihre Stimme klang plötzlich ganz anders als sonst. Weniger drollig und kindlich. Ernst. »Egal, was du tust«, sagte sie eindringlich, und ich spürte ihren warmen Atem an meinem Ohr. »Egal, was du dir wünschst, versteck den Schlüssel am sichersten Ort, den du kennst. Wenn du ihn verlierst, wird dein Wunsch auf ewig in dem Kästchen eingeschlossen sein.«
Mein Wecker klingelt erneut. Ich strampele die Decke weg und rolle mich unter lautem Gähnen aus dem Bett. Warum müssen wir an unserem Geburtstag zur Schule gehen? Das müsste gesetzlich verboten werden oder so. Schließlich haben wir doch auch am Geburtstag von George Washington oder Martin Luther King Jr. schulfrei, warum also nicht an unserem eigenen?
Meine beste Freundin Grace hat Glück. Sie ist im Sommer geboren und muss nie an ihrem Geburtstag in die Schule. Allerdings hat sie zu ihrem neunten Geburtstag mal drauf bestanden, dass wir bei ihrer Feier lauter Experimente in der Küche durchführen. Meiner Meinung nach war das totale Verschwendung eines idealen Sommergeburtstags, denn es war im Prinzip nichts anderes als Unterricht.
Auf dem Weg ins Bad fällt mein Blick auf die blau-goldfarbene Schmuckschatulle auf meiner Kommode. Ich bleibe stehen und betrachte sie. La Boîte aux Rêves Cachés hat Mrs Toodles sie genannt. Das Kästchen der versteckten Träume. Aus irgendeinem Grund hab ich beinahe das Gefühl, als ob … als ob … es nach mir ruft.
O nein! Werde ich jetzt auch verrückt? Fühlt es sich so an, wenn man den Verstand verliert? Ist Demenz etwa ansteckend? Ich stopfe das Kästchen in die unterste Schublade meiner Kommode und gebe dem Fach mit dem Fuß einen Schubs, um ganz sicherzugehen, dass es geschlossen ist. Dann gehe ich ins Bad. Ich muss mich fertigmachen.
Allerdings habe ich immer noch keine Ahnung, was ich anziehen soll. Ihr wisst ja, dass heute mein Geburtstag ist. Es geht also um eine wichtige Entscheidung. Nachdem ich zwanzig Minuten lang unschlüssig vor meinem Kleiderschrank gestanden habe, kommt Mom rein und nimmt mir die Entscheidung ab.
Sie hat mir ein blau-weiß gestreiftes Kleid mit einem riesigen Glitzerseestern auf der Brust ausgesucht.
Das ist nicht unbedingt das, was mir für meinen großen Tag vorgeschwebt hat, aber ich habe auch keine bessere Idee, denn für alles, was ich gern tragen würde, müsste ich erst mal dreißig Zentimeter wachsen, wie von Zauberhand Brüste bekommen und mich dann aus Rorys Kleiderschrank bedienen können. Alle drei Faktoren sind unwahrscheinlich.
Also bleibt mir wohl nur das Seesternkleid.
Meine Haare sind die nächste Katastrophe. Das Problem bei lockigen Haaren ist, dass man im Prinzip nicht besonders viel damit anfangen kann. Sind die lockigen Haare obendrein auch noch unkontrollierbar kraus, dann kann man absolut gar nichts damit anfangen, abgesehen von einem festen Knoten mit einer Million Haarklemmen, damit nicht überall Strähnen abstehen.
Ich starre mein Spiegelbild an und stöhne laut. Mit dem maritimen Look, der langweiligen Frisur und den Hunderten Sommersprossen im Gesicht (die ich wegen der blöden Kein-Make-up-vor-der-Highschool-Regel nicht abdecken darf), könnte ich mir genauso gut ein Schild umhängen, auf dem »Alles Gute zum Geburtstag, Loser« steht.
Oder zurück auf die Grundschule gehen, wo ich hingehöre.
Ich schnappe mir einen Bleistift vom Tisch und stelle mich mit dem Rücken an den Türrahmen. Dann markiere ich die höchste Stelle meines Kopfes am Holz.
Genau, wie ich vermutet habe: Ich bin keinen Zentimeter gewachsen.
»Addie!«, ruft Mom von unten. »Wir kommen zu spät! Beeil dich!«
Seufzend nehme ich meinen blau-weiß gepunkteten Rucksack und sause nach unten, um mich dem zu stellen, was vermutlich der schlimmste Geburtstag aller Zeiten werden wird.
Grace und ich hätten eigentlich mit einer Woche Abstand geboren werden sollen. Unsere Mütter haben sich beim Geburtsvorbereitungskurs getroffen, also kennen Grace und ich uns genau genommen schon aus dem Mutterleib. Vermutlich ist das der Grund für unsere enge Freundschaft. Dass Grace im Sommer Geburtstag hat, liegt daran, dass sie ein Frühchen war. Ich dagegen kam genau zum errechneten Geburtstermin zur Welt. Mom behauptet, an diesem Tag wäre ich zum letzten Mal pünktlich gewesen.
Als ich nach unten komme, ist Dad bereits fort, was ziemlich normal ist. Er geht jeden Morgen um Punkt halb sieben zur Arbeit. Mom trinkt gerade ihren moosfarbigen Power-Smoothie aus, als ich in die Küche platze.
»Alles Gute zum Geburtstag!«, flötet sie und hält mir einen Bagel entgegen, der ziemlich lieblos in ein Stück Küchenpapier gewickelt ist.
»Ein Bagel?«, frage ich. »An meinem Geburtstag?«
»So ist das halt, wenn man Verspätung hat«, erklärt sie mir. »Wenn du ein bisschen früher runtergekommen wärst, hätte ich dir etwas Besonderes zum Frühstück machen können.«
»Vielleicht würde ich motivierter aufstehen, wenn ich einen Hund hätte.«
Mom wirft mir einen genervten Blick zu. »Netter Versuch.«
Schmollend nehme ich den Bagel und laufe hinter ihr her zur Garage. Keine Ahnung, warum ich geglaubt habe, das Argument mit dem Hund könnte an diesem Tag etwas bewirken. Schließlich hat es die letzten dreihundert Mal auch nicht funktioniert. Keine Ahnung, warum sich meine Eltern so gegen einen Hund wehren. In unserer Familie hat niemand eine Tierhaarallergie, und ich hab versprochen, ihn zu füttern und mit ihm Gassi zu gehen und auch alles andere zu erledigen, was gemacht werden muss, aber aus irgendeinem Grund weigern sie sich trotzdem.
Ich klettere auf den Rücksitz von Moms SUV und starre auf das traurige kleine Frühstück in meiner Hand. Der Bagel ist noch nicht mal getoastet und steckt voller Zwiebelstückchen. Ich hasse Zwiebelbagel. Ohne Zusätze sind sie mir lieber, oder höchstens mit Sesam bestreut. Von den Zwiebeln kriege ich Mundgeruch, aber weil ich kurz vorm Verhungern stehe, beiße ich trotzdem rein und schwöre, mir in der Schule sofort von jemandem Pfefferminzbonbons geben zu lassen.
Da der Bus für die Mittelschule an unserem Haus sehr früh vorbeikommt, fahre ich nur auf dem Heimweg mit dem Schulbus. Morgens bringen uns abwechselnd meine Mom und Grace’ Mom zur Schule. Heute ist Freitag, also sind wir dran. Als wir bei Grace vorfahren, steht sie schon wartend am Bordstein. In der Hand hält sie einen weißen Pullover, was ich ein bisschen merkwürdig finde, denn sie trägt bereits einen Pullover.
»Alles Gute zum Geburtstag!«, sagt sie und steigt ein. »Ich hab heute Morgen ganz starke Klamottenschwingungen empfangen. Da dachte ich mir, dass du das hier vielleicht gebrauchen könntest.« Sie wirft mir den Pullover zu.
Manchmal können Grace und ich die Gedanken der anderen lesen. Allerdings klappt das nie, wenn wir es bewusst versuchen, sondern immer nur zufällig. Normalerweise würde Grace so etwas als Blödsinn abtun. Sie vertraut extrem auf wissenschaftliche Methoden und braucht in der Regel handfeste Beweise, bevor sie etwas glaubt, aber aus irgendeinem Grund erscheint ihr unsere Gedankenleserei als völlig selbstverständlich. Vielleicht, weil es so häufig passiert; so was lässt sich nur schwer ignorieren. Möglicherweise ist das ja Beweis genug für sie.
Dankbar nehme ich den Pullover entgegen und ziehe ihn über mein peinliches Seesternkleid. Es ist zwar keine vollständige Rundumerneuerung meines Outfits, aber eine deutliche Verbesserung gegenüber vorher ist es auf jeden Fall. Ich fange gerade an, mich trotz meines Ensembles ein wenig besser zu fühlen, als Grace sich zum Anschnallen umdreht und ich den supertollen Zopf entdecke, zu dem sie ihre Haare heute Morgen geflochten hat.
Grace ist eine Flechtkünstlerin. Sie denkt sich alle möglichen kunstvollen Muster aus. Heute hat sie ihre langen, sandblonden Haare zu einem wuscheligen Seitenzopf gebändigt, der auf dem Kopf beginnt und weit bis über ihre Schulter reicht. Unwillkürlich berühre ich meinen einfachen braunen Haarknoten. Plötzlich fällt mir wieder ein, warum ich überhaupt erst so schlechte Laune hatte.
Wobei ich niemals die Geduld für so einen Zopf aufbringen würde. Vermutlich würde ich ständig durcheinanderkommen und dann einfach aufgeben. Grace dagegen ist extrem geduldig und akkurat. Deshalb spielt sie auch besser Trompete als ich. Wir haben beide in der dritten Klasse mit dem Unterricht angefangen, aber sie ist schon vier Stufen weiter als ich. Unsere Musiklehrerin meint, ich müsste häufiger Tonleitern üben, aber Tonleitern sind unglaublich langweilig. Ich würde viel lieber ein Lied spielen. Allerdings klappt das nur, wenn man die Tonleitern drauf hat, und so schließt sich der Kreis.
Als Mom losfährt, sehe ich Grace’ kleine Schwester Lily aus dem Haus kommen. Sie wartet auf den Bus zur Grundschule. Lily ist acht und treibt Grace in den Wahnsinn. Mit der Brille und den Affenschaukelzöpfen sieht sie wirklich süß aus, aber vermutlich würde ich anders denken, wenn sie meine Schwester wäre und immer ohne zu fragen meine Serien vom Rekorder löschen und den Rest von den guten Cornflakes essen würde.
Trotzdem winke ich ihr zu, und sie winkt breit grinsend zurück.
»Ich freu mich so auf heute Abend«, sagt Grace. »Ich hab schon ganz viele Ideen!«
Jedes Jahr an unseren Geburtstagen veranstalten Grace und ich eine Pyjamaparty. Am Wochenende gibt es immer eine normale Geburtstagsfeier mit anderen Gästen, aber den Abend unseres tatsächlichen Geburtstags verbringen wir schon gemeinsam, seit wir fünf waren. Nur wir beide.
»Ja!«, ruft Grace und hüpft auf und ab, soweit es ihr Sitzgurt zulässt. »Wir müssen unbedingt mit unserem Tanz weitermachen. Ich hab ein paar neue Ideen für den Refrain, die dir bestimmt gefallen werden. Und dann machen wir natürlich wieder einen Schlafsack-Hindernisparcours. Das versteht sich ja von selbst. Außerdem hab ich ein tolles Muster für ein Freundschaftsarmband gefunden, das will ich unbedingt ausprobieren, und …«
Grace ist nicht zu stoppen. Obwohl ich lächle und nicke, höre ich schon gar nicht mehr zu. Keine Ahnung, was mit mir los ist. Normalerweise reicht schon die bloße Erwähnung unserer grandiosen Pyjamapartys, um mich aus einem Stimmungstief zu holen, aber heute nicht. Vielleicht liegt es am Schlafmangel, aber aus irgendeinem Grund ermüdet es mich, Grace über das reden zu hören, was wir normalerweise bei unseren Pyjamapartys machen. Aber nicht körperlich müde, eher geistig. Ich meine, die laufen seit Jahren immer gleich ab. Will sie denn nicht mal was Neues ausprobieren?
Mom scheint meine schlechte Stimmung zu spüren, denn sie schaltet mein Lieblingslied von Summer Crush ein, um mich aufzumuntern, Best Day Ever. Und offenbar funktioniert es, denn nur kurz darauf tanzen Grace und ich auf unseren Sitzen herum und singen lauthals mit: »Between you and me, I know this will be the best day ever! Ever! Ever!«
Addie und der fürchterliche, schreckliche, grauenvolle, miese Geburtstag
Okay. Berrin Mack, der Leadsänger von Summer Crush, hat sich vollkommen geirrt. Heute ist definitiv nicht der beste Tag aller Zeiten. Im Gegenteil, vermutlich ist es der schlimmste Geburtstag, den man erleben kann.
Zuerst komme ich zu spät zum Matheunterricht, weil Asher O’Neil, ein Blödmann aus meiner Klasse, unbedingt vor meinem Spind Bulle spielen muss. Schnaubend rammt er mich immer wieder, wenn ich versuche, mich ihm zu nähern, als wäre ich ein Matador mit einem Umhang. Irgendwann gebe ich auf und gehe ohne meine Bücher zum Unterricht, was mir natürlich Ärger mit dem Lehrer einbringt.
Am Ende der zweiten Stunde, als wir uns gerade an der Tür anstellen, rülpst Teddy Rucker laut. Alle Jungs finden das unglaublich lustig. Ich ziehe mir den Kragen meines Kleides über die Nase und kämpfe gegen den Brechreiz an. Es stinkt widerlich. Hat der zum Frühstück vergammelte saure Gurken gegessen oder was?
Im Naturkundeunterricht sollen wir ein Laborexperiment durchführen, und statt den Anweisungen im Buch zu folgen und die Chemikalien in der angegebenen Reihenfolge in das Becherglas zu füllen, halte ich es für einfacher und schneller, sie alle gleichzeitig hineinzuschütten. Ich bin ein großer Fan von Abkürzungen. Mein Motto lautet: Wenn es einen schnelleren Weg gibt, warum soll ich den nicht gehen? Grace nennt es Faulheit. Ich nenne es Effizienz. Warum soll ich zum Beispiel die Treppe nehmen, wenn ich mit dem Fahrstuhl viel schneller oben ankommen kann? Warum sollte ich mein Zimmer aufräumen, wenn ich einfach alles in den Schrank schieben kann und so schneller fertig bin?
Offensichtlich gibt es jedoch ein paar Dinge im Leben, auf die man mein Motto nicht anwenden sollte. Wissenschaftliche Experimente zum Beispiel. Was sich ein paar Minuten später bewahrheitet, als das Becherglas mit einem dicken, fluoreszierenden, orangeroten Glibber darin direkt vor meiner Nase explodiert.
Zum Glück trage ich eine Schutzbrille.
Weniger Glück habe ich bei der Note. Ich bekomme eine Sechs. Und Grace’ wunderschöner weißer Pullover ist jetzt mit neonfarbenem Schleim bespritzt.
Außerdem haben wir heute Sport. Das bedeutet, dass ich meine Sportsachen anziehen muss. Ich hasse meine Sportklamotten. Darin sieht man meine dürren Beine, die immer noch von peinlichen blonden Haaren bedeckt sind, weil Mom findet, ich bin zu jung, um mir die Beine zu rasieren.
Als ich mir in der Umkleide gerade Shorts und ein weites T-Shirt überziehe, um wenigstens zu verdecken, wie erbärmlich flachbrüstig ich bin, fällt mein Blick auf Clementine Dumont auf der anderen Seite des Raumes. Sie spricht gerade mit einer ihrer Freundinnen über einen superromantischen Film, den sie am vergangenen Wochenende gesehen hat, und bindet dabei ihre langen, blonden Haare zu einem wuscheligen Knoten auf dem Kopf zusammen. Wenn ich mir so eine Frisur machen würde, sähe ich vermutlich aus wie eine der Gestalten aus der Muppet Show.
»Und der Typ im Film war so heiß, dass ich beinahe richtig ins Schwitzen gekommen bin«, berichtet sie ihrer Freundin.
Das andere Mädchen seufzt. »O Mann, den muss ich mir unbedingt ansehen.«
Clementine nickt. »Noch besser ist es, wenn du mit einem Jungen hingehen kannst. Das ist der perfekte Film für ein Date.« Sie schnappt sich ein rotes Hoodie aus ihrem Spind und zieht es über den schicken schwarzen Sport-BH, den sie nicht nur wegen des sportlichen Looks trägt. Sie braucht ihn tatsächlich. Clementine hatte ihren Wachstumsschub schon vor drei Jahren. Ihre Eltern bestehen offensichtlich nicht darauf, dass sie sich frühestens auf der Highschool schminkt, denn sie trägt schon seit der fünften Klasse Lidschatten, Wimperntusche und Lippenstift. Und sie rasiert sich die Beine. Manchmal frage ich mich, ob sie wirklich zwölf ist, denn sie sieht eher wie sechzehn aus. Ich hab sogar das Gerücht gehört, dass sie mit einem Neuntklässler von der Highschool geht, den sie im Einkaufszentrum kennengelernt hat. Angesichts der Jungs auf unserer Schule kommt mir das wie eine sehr kluge Entscheidung vor.
Ich würde sie gern fragen, ob das Gerücht stimmt, aber wir haben keinen Kontakt, weil wir im Prinzip überhaupt nichts gemeinsam haben. Worüber sollten wir da schon reden? Sie trägt Kajal und flirtet in Einkaufszentren mit Jungs. Ich veranstalte immer noch Pyjamapartys und bastele Freundschaftsarmbänder.
Daher bin ich in der Mittagspause nicht wirklich in Stimmung, mir noch mehr von Grace’ abgedroschenen, kindischen Ideen für unsere Pyjamaparty anzuhören. Ich bin so wild auf einen Themenwechsel, dass ich sogar regelrecht dankbar bin, als Jacob Tucker an unseren Tisch kommt. Normalerweise versuche ich, mich von ihm fernzuhalten. Wegen der Geruchsbelästigung.
»Hi, Addie«, sagt Jacob und setzt sich zu uns. Die Hände hält er hinter dem Rücken versteckt. Er wirkt ein bisschen peinlich berührt und verlegen, und sein Gesicht nimmt gerade eine merkwürdige rote Farbschattierung an.
»Hi, Jacob«, gebe ich argwöhnisch zurück.
Eine Strähne seiner ungewaschenen Haare fällt ihm ins Gesicht. »Ich … äh … hab gehört, dass du heute Geburtstag hast. Also hab ich dir ein Geschenk mitgebracht.«
Er zieht die Hände hinter dem Rücken hervor, und ich entdecke darin eine Dose meiner Lieblingslimo. Die nette Geste trifft mich so unvorbereitet, dass ich einen kleinen Aufschrei nicht unterdrücken kann.
Woher weiß Jacob Tucker, dass ich Traubenlimo mag?
Und wo hat er die her?
In der Schule wird keine Limo verkauft, und Traubenlimo ist nicht leicht zu bekommen. Die meisten Supermärkte führen sie gar nicht. Mom muss mir meine normalerweise in der Nachbarstadt besorgen.
»Wow, Jacob«, zwinge ich mich schließlich zu einer Reaktion. »Vielen Dank. Das ist echt lieb von dir.«
Er zuckt mit den Schultern. Sein Gesicht verfärbt sich von Sekunde zu Sekunde mehr. »Nicht nötig. Ich hoffe, sie schmeckt dir.«
Gierig nehme ich ihm die Dose aus der Hand. Jacob macht einen Schritt nach hinten und beobachtet, wie ich den Finger unter die Lasche schiebe und sie nach oben drücke.
Die Limo schießt aus der Dose wie Wasser aus einem kaputten Feuerhydranten. Der Strahl trifft mich mitten ins Gesicht, geradewegs in die Nase. Der Rest tropft auf meine Kleidung.
Schreiend lasse ich die Dose fallen. Sie rollt in der Cafeteria herum, als wäre sie von einem Dämon besessen. Immer noch schießt Limo heraus.
In diesem Moment höre ich das Gewieher. Es kommt vom übernächsten Tisch, wo sich ein paar Siebtklässler schlapplachen und Jacob die Fäuste zum Anstoßen hinhalten.
»Wie lang hat er das Ding denn geschüttelt?«, will einer von ihnen in einer Lachanfallpause wissen.
»Zwanzig Minuten oder so«, behauptet ein anderer.
Mürrisch nehme ich mir ein paar Servietten aus dem Ständer auf dem Tisch und versuche, Grace’ Pullover abzuwischen, der jetzt sowohl mit neonorangefarbenem Schleim als auch mit Traubenlimo beschmiert ist.
Happy Birthday to me.
Alles über alles
Bäh.
Warum müssen Mittelschuljungs nur so kindisch sein? Rorys Freunde würden nie so etwas Fieses tun. Was daran liegt, dass sie alle zur Highschool gehen. Sie sind praktisch schon Männer. Ich hingegen muss mich mit diesen blöden Jungs herumschlagen, die glauben, wenn sich ein Mädchen Traubenlimo in die Nase spritzt, wäre es das Lustigste auf der Welt.
Als der Bus mich zu Hause absetzt, bin ich so weit, dass ich den gesamten Geburtstag am liebsten abblasen würde. »Ich bleibe jetzt in meinem Zimmer, bis ich sechzehn bin«, verkünde ich meiner Mom beim Betreten des Hauses. »Was genau in eintausendvierhundertundeinundsechzig Tagen ist, falls du das wissen wolltest.«
Mom legt gerade Wäsche zusammen und sieht stirnrunzelnd auf. »Wow, das ist aber lange. Dann rufe ich vermutlich besser bei JoJo’s an und storniere unsere Reservierung für heute Abend. Schade. Ich hatte mich schon auf Pizza mit Jalapeños und Ananas gefreut.«
Stimmt ja. Ich habe ganz vergessen, dass wir an diesem Abend in mein Lieblingsrestaurant gehen. Und Pizza mit Jalapeños und Ananas klingt eigentlich ziemlich gut.
»Schön«, erwidere ich mürrisch und gehe zur Treppe. »Dafür komme ich raus. Aber das war’s dann auch!«
Um sechs Uhr klopft Dad an meine Tür und singt: »Scheint der Mond hell und breit, ist es endlich Pizzazeit, am Geburtstag …«
Ich verdrehe die Augen und gehe an ihm vorbei. »Hör auf damit, Dad.«
»Wusstest du«, fragt er unbeeindruckt, während er mir folgt, »dass Amerikaner durchschnittlich ungefähr zehneinhalb Kilo Pizza pro Jahr essen?«
»Faszinierend«, murmele ich und steige die Treppe hinunter.
Dad ist von einer Radiosendung namens Alles über alles besessen. Im Prinzip reden da zwei Männer eine Dreiviertelstunde lang über völlig willkürliche Dinge. Dad hält es für die interessanteste Sendung der Welt und hat es praktisch zu seiner Lebensaufgabe gemacht, sein neuerworbenes Wissen mit dem Rest der Familie zu teilen.
Überrascht stelle ich beim Einsteigen ins Auto fest, dass Rory allein ist, ohne Verabredung. Das ist ziemlich selten.
»Wo ist denn …?«, setze ich an, merke aber, dass ich gar nicht weiß, wie der aktuelle Freund der Woche heißt.
»Henry«, beendet sie grummelig meinen Satz. »Mom hat gesagt, er darf nicht mit.«
Mom dreht sich auf dem Beifahrersitz um und wirft Rory einen strengen Blick zu. »Heute hat deine Schwester ihren besonderen Tag. Da geht es um sie, nicht um eine Verabredung.«
Rory verschränkt die Arme und starrt zum Fenster hinaus. »Meinetwegen. Dann muss er sich wenigstens nicht den ganzen Abend Dads Erklärungen über Tupperware anhören.«
»Hey! Henry fand es doch total spannend, als ich ihm erzählt hab, wie Earl Tupper sein Wissen als Chemiker genutzt hat, um buchstäblich die Zukunft des Plastiks neu zu gestalten«, wirft Dad verteidigend vom Fahrersitz aus ein.
»Nein, Dad«, widerspricht ihm Rory. »Er wollte nur höflich sein.«
»Wirklich?« Dad klingt ehrlich enttäuscht.
»Wirklich.«
Ich muss zugeben, dass ich erleichtert bin, dass Henry heute Abend nicht dabei ist. Er ist so ziemlich der süßeste Junge, den ich je gesehen habe, und ich will mir nicht dauernd Gedanken darüber machen, ob meine Haare wild abstehen oder mir Pizzakäse aus dem Mund hängt. Obwohl ich mein glitzerndes Seesternkleid und Grace’ vollgeschleimten Pullover ausgezogen habe, fühle ich mich immer noch alles andere als glamourös, und neben Rorys Freunden werde ich ständig daran erinnert, wie uncool ich doch bin.
JoJo’s Pizza ist nicht gerade ein Nobelrestaurant, aber trotzdem komme ich hierher am allerliebsten. Ich mag die extradicke Kruste und dass man Honig dazu bekommt, um sie einzutauchen. Außerdem machen sie hier die besten Kräuterlimo-Shakes der Stadt. Vermutlich, weil sie ihre eigene Kräuterlimo brauen.
»So!«, sagt die Kellnerin enthusiastisch, als sie uns zu einer Sitznische führt. »Wie ich höre, feiert heute jemand Geburtstag!«

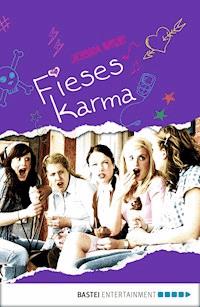
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










