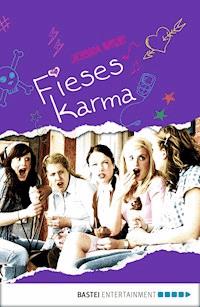6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Rebellion der Sterne
- Sprache: Deutsch
Ist es zu spät für eine friedliche Rebellion auf Laterre? Teil 2 der mitreißenden Science Fiction um drei junge Menschen, die das Schicksal in den Wirren der Revolution zusammenführt Mit Feuer und Blut ergreift eine neue Macht Partei in der Rebellion auf Laterre: Die militante Gruppe »Die rote Narbe« scheint vor keiner Gewalttat zurückzuschrecken, um die Regierung zu stürzen. Für die Freunde Marcellus, Chatine und Alouette steht fest, dass sie ihre charismatische Anführerin vom Gefängnismond Bastille befreien müssen, wenn die friedliche Revolution noch eine Chance haben soll. Doch Chatine hat noch einen ganz anderen Grund, sich freiwillig für den gefährlichsten Teil der Mission zu melden. Zur selben Zeit ist Marcellusʼ machthungriger Großvater auf der Suche nach einer neuartigen Waffe, die der Regierung einen ungeahnten Vorteil verschaffen könnte. Während die Situation auf Laterre sich immer weiter zuspitzt, steht für einen der Freunde schließlich noch sehr viel mehr auf dem Spiel als das Schicksal eines ganzen Planeten … »Zwischen brennenden Welten« ist die Fortsetzung des Science-Fiction-Romans »Die Rebellion von Laterre« und der 2. Teil der SF-Reihe »Die Rebellion der Sterne« der amerikanischen Autorinnen Jessica Brody und Joanne Rendell.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 961
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jessica Brody / Joanne Rendell
Zwischen brennenden Welten
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Carina Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Drei Abtrünnige. Gejagt vom Régime. Dazu bestimmt, den Planeten zu retten.
Laterre steht am Rande eines Krieges. Der Dritte État setzt sich vehement gegen die Ungerechtigkeiten des korrupten Systems zur Wehr. Der Patriarche versucht mit aller Gewalt, die Unruhen zu unterdrücken, während eine neue militante Fraktion eine Reihe tödlicher Angriffe startet.
Zur selben Zeit ist Marcellusʼ machthungriger Großvater auf der Suche nach einer neuartigen Waffe, die der Regierung einen ungeahnten Vorteil verschaffen könnte.
Während die Situation auf Laterre sich immer weiter zuspitzt, steht für Marcellus, Alouette und Chatine plötzlich mehr auf dem Spiel als das Schicksal eines ganzen Planeten …
»Eine exzellente Neuinterpretation – voller Emotionen, Intrigen, Romantik und Revolutionen.« Stephanie Garber zu »Die Rebellion von Laterre«
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Überblick Band 1, Die Rebellion von Laterre
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
TEIL 2
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
TEIL 3
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
TEIL 4
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
TEIL 5
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
TEIL 6
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Danksagung
Für Jessica Khoury,
unseren Leuchtstern in der dunkelsten Nacht
L’état, c’est moi.
(Der Staat bin ich.)
– Louis XIV.
Überblick Band 1, Die Rebellion von Laterre
Marcellus Bonnefaçon:
Zweiter État. Offizier des Ministères. General Bonnefaçons Enkel und Sohn des berüchtigten Verräters und Mitglieds der Rebellengruppe Vangarde, Julien Bonnefaçon. Marcellus war ein treues Mitglied des Régimes, bis er herausfand, dass sein Großvater seinem Vater vor siebzehn Jahren ein Verbrechen anhängte, das diesen ins Gefängnis brachte. Marcellus nimmt nun an, dass sein Großvater außerdem für den Mord an Marie Paresse verantwortlich ist und dass er plant, gewaltsam die Herrschaft über das Régime an sich zu reißen.
Chatine Renard:
Dritter État. Eine geschickte Diebin, die aus einer kriminellen Familie stammt. Sie wuchs in den Frets von Vallonay auf, nachdem die Renards aus der Minenstadt Montfer fortzogen, als Chatine noch ein Kind war. In den letzten zehn Jahren gab sie sich als Junge namens Théo aus, um den Blutbordellen zu entgehen, die es auf junge Frauen abgesehen haben. Sie wurde von General Bonnefaçon angeheuert, um seinen Enkel Marcellus auszuspionieren. Doch später wurde sie in die Bastille, das Gefängnis auf dem Mond, geschickt, da sie sich weigerte, dem General den Standort der Vangarde preiszugeben.
Alouette Taureau (alias Madeline und »Kleine Lerche«):
Dritter État. Tochter des gesuchten Kriminellen Hugo Taureau. Allerdings fand sie kürzlich heraus, dass Hugo nicht ihr leiblicher Vater ist. Als kleines Kind übergab ihre Mutter sie den Renards, die sie misshandelten. Es war Hugo, der sie rettete und in das Refuge der Schwesternschaft brachte: einen geheimen, unterirdischen Bunker, wo sie von den Schwestern aufgezogen wurde. Zwölf Jahre lang war Alouette dort für die Erhaltung der Bücher aus der Ersten Welt verantwortlich. Aus ihnen lernte sie auch, das Vergessene Wort zu lesen. Vor Kurzem fand Alouette heraus, dass hinter der Schwesternschaft in Wahrheit die Rebellentruppe Vangarde steckt und das Refuge ihnen als Geheimversteck dient.
Hugo Taureau (alias Jean LeGrand):
Dritter État. Alouettes Adoptivvater und gesuchter Krimineller. Ehemaliger Gefangener 2.4.6.0.1. Er kannte Alouettes Mutter gut. Vor Kurzem musste er nach Reichenstaat fliehen, nachdem er von seinem Erzfeind Inspecteur Limier gefasst wurde und nur knapp entkommen konnte.
Inspecteur Limier:
Zweiter État. Cyborg und Chef des Policier-Reviers in Vallonay. Jahrelang jagte er den entflohenen Häftling Hugo Taureau, den er vor Kurzem im Verdure-Wald ausfindig machte und gefangen nahm. Dort wurde er jedoch von Alouette außer Gefecht gesetzt, sodass Hugo entkommen konnte.
General Bonnefaçon:
Zweiter État. Marcellus’ Großvater und Julien Bonnefaçons Vater. In seiner Rolle als Leiter des Ministères und oberster Berater des Patriarchen ist er einer der mächtigsten Männer auf Laterre. Als Marcellus seinen Großvater damit konfrontierte, eine Spionin angeheuert zu haben, um ihn zu überwachen, schlug der General Marcellus brutal zusammen. Er ist ein gnadenloser Stratege, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Macht im Régime mit allen Mitteln an sich zu reißen.
Julien Bonnefaçon:
Zweiter État. General Bonnefaçons Sohn und Marcellus’ Vater. Er war ein Mitglied der Vangarde und wurde von seinem Vater für den Terroranschlag auf eine Kupfermine verantwortlich gemacht, bei der 600 Arbeiter ums Leben kamen und die der Rebellion des Jahres 488 ein Ende setzte. Zur Strafe wurde er in die Bastille geschickt, als Marcellus noch ein Baby war, und starb dort. Er hinterließ Marcellus jedoch eine Nachricht, die diesen zu Mabelle Dubois führte.
Mabelle Dubois:
Dritter État. Sie war Marcellus’ Kindermädchen und brachte ihm heimlich Lesen und Schreiben bei. Als Marcellus elf Jahre alt war, wurde Mabelle als Spionin der Vangarde entlarvt und in die Bastille geschickt. Marcellus’ Vater hinterließ seinem Sohn eine Nachricht, die ihn nach Montfer führte. Dort traf er auf Mabelle, die inzwischen aus dem Gefängnis geflohen war. Sie versuchte vergeblich, ihn dazu zu bewegen, der Vangarde beizutreten.
Patriarche Lyon Paresse:
Erster État. Der Monarch Laterres und direkter Nachfahre der Gründerfamilie Paresse. Lyon lebt im Grand Palais in Ledôme und interessierte sich schon immer mehr für die Jagd als für die Führung des Régimes – bis seine Tochter Marie vergiftet wurde. Der Patriarche verdächtigt Citoyenne Rousseau, die inhaftierte Anführerin der Vangarde, seine Tochter ermordet zu haben.
Matrone Véronique Paresse:
Erster État. Ehefrau des Patriarchen Paresse und Mutter des Premier Enfants Marie Paresse. Vor dem entsetzlichen Tod ihrer Tochter verbrachte sie die meiste Zeit mit der neuesten laterrianischen Mode und ihrem Lieblingsgetränk: Champagner.
Premier Enfant Marie Paresse:
Erster État. Tochter des Patriarchen und der Matrone und einzige Erbin des Régimes. Kurz vor ihrem dritten Geburtstag wurde Marie vergiftet. Daraufhin wurde die Himmelfahrt für den Dritten État abgesagt, was zu Aufständen in der Bevölkerung führte.
Nadette Epernay:
Dritter État. Gouvernante des Premier Enfants. Sie wurde des Mordes an Marie Paresse und der Mitgliedschaft der Vangarde angeklagt und bald darauf mit dem Hinrichter (auch »die Klinge« genannt) öffentlich hingerichtet.
Citoyenne Rousseau:
Dritter État. Ehemalige Anführerin der Vangarde. Im Jahr 488 führte sie eine Rebellion an, die das Régime stürzen und die Unterdrückung der niederen États beenden sollte. Doch sie wurde gefangen genommen und in die Bastille geschickt, wo sie die letzten siebzehn Jahre in Einzelhaft verbrachte.
Madame und Monsieur Renard:
Dritter État. Kriminelles Paar und Eltern von Chatine, Azelle und Henri. Ehemalige Besitzer der Jondrette, einer Pension in Montfer. Sie zogen vor zehn Jahren nach Vallonay, wo Monsieur Renard die berüchtigte Délabré-Bande gründete. Nachdem Hugo Taureau in den Frets gesichtet wurde, kidnappten ihn die Renards, um das auf ihn ausgesetzte Kopfgeld zu kassieren. Doch sie wurden stattdessen von Inspecteur Limier verhaftet.
Azelle Renard:
Dritter État. Älteste Tochter der Renards und Schwester von Chatine und Henri. Als gesetzestreue Angestellte in einer Télé-Haut-Fabrique träumte sie davon, die Himmelfahrtslotterie zu gewinnen und zum Zweiten État aufzusteigen. Doch die Fabrique wurde bombardiert, und Azelle starb gemeinsam mit elf anderen Arbeitern bei dem Anschlag.
Henri Renard:
Dritter État. Jüngstes Kind der Renards, Bruder von Chatine und Azelle. Chatine glaubte jahrelang, ihr Bruder wäre tot, bis sie vor Kurzem herausfand, dass ihre Eltern Henri verkauft hatten, um ihre Schulden abzubezahlen.
Sergent Chacal:
Zweiter État. Ein dickköpfiger Policier aus Vallonay, der Inspecteur Limier untersteht. Chacal ist skrupellos, grausam und verteilt gerne Schläge mit seinem Schlagstock.
Commandeurin Vernay:
Zweiter État. Die engste Freundin von General Bonnefaçon und ehemalige Commandeurin des Ministères. Sie wurde auf einer fehlgeschlagenen Mission getötet, wo sie Königin Matilda von Albion (Laterres langjährige Feindin) ermorden sollte. Seit ihrem Tod hat General Bonnefaçon Marcellus darauf vorbereitet, ihren Platz als Commandeur einzunehmen.
Roche:
Dritter État. Ein Waisenjunge – auch Oublié genannt –, der in den Frets in Vallonay aufwuchs. Er wurde kürzlich verhaftet, da er Nachrichten für die Vangarde schmuggelte. In dem Versuch, seine Unschuld zu beweisen, brachte Marcellus Chatine dazu, Roche zu befragen, was allerdings dazu führte, dass er in die Bastille gesperrt wurde.
Die Schwestern des Refuge:
Eine geheime Schwesternschaft, die das Vergessene Wort und eine riesige Bibliothek aus Büchern der Ersten Welt beschützen. Ihre Anführerin ist Principale Francine. Die zehn Schwestern leben in einem Bunker unter den Frets und tragen Perlenketten, sogenannte »Andachtsperlen«, um den Hals. Alouette lebte zwölf Jahre lang bei ihnen und wurde von ihnen ausgebildet. Bis vor Kurzem war ihr nicht bewusst, dass die Schwestern gleichzeitig die Anführerinnen einer Rebellengruppe namens Vangarde sind.
Die Vangarde:
Eine Rebellengruppe, die nach der Gefangennahme ihrer Anführerin Citoyenne Rousseau tot geglaubt wurde. Sie verbrachten die letzten siebzehn Jahre im Verborgenen, rekrutierten neue Mitglieder und bereiteten sich auf eine neue Rebellion vor. Das Refuge unter den Frets ist ihre Zentrale. Zwei ihrer Agentinnen – Schwester Jacqui und Schwester Denise – wurden kürzlich gefangen genommen, als sie versuchten, in das Büro des Directeurs der Bastille einzubrechen, um ihre Anführerin zu befreien.
TEIL1
ROUSSEAU
Wie Blumen, die sich einer Sol zuwenden, kamen sie zu ihr. Wie Vögel, die einem warmen Luftstrom folgen, fanden sie sie. Wie die Fische im Ozean schwammen sie in ihrem Kielwasser. Mit ihren Worten öffnete sie ihnen die Augen, und mit der Wahrheit fand sie einen Weg in ihre Herzen. Sie zeigte ihnen, dass Macht kein schwerer Stein war, der sie von außen erdrückte und nie fortbewegt werden konnte. Macht befand sich auch in ihren Körpern, sie lag in ihren Händen und ihren Gedanken und wartete nur darauf, entdeckt zu werden.
Doch ihre Botschaft war eine Bedrohung für all jene, die Stille bevorzugten.
Jene, die Gehorsam verlangten.
Also beraubten sie sie ihrer Stimme und versuchten, ihren Namen auszulöschen.
Aus den Chroniken der Vangarde, Band 1, Kapitel 1
Kapitel 1
MARCELLUS
Marcellus Bonnefaçon bewegte sich wie ein Schatten unter Schatten. Er duckte sich unter Kabeln hindurch und huschte um leere, rostige Käfige herum, die weit offen standen wie unheimliche, hungrige Mäuler. Mit jedem Schritt durch die verlassene Mine schlug sein Herz schneller, fühlte er sich mehr wie der Verräter, zu dem er geworden war.
Wie sein Großvater es immer vorhergesehen hatte.
Du hattest recht, Grand-père. Ich bin genau wie mein Vater.
Regentropfen spritzten aus den Pfützen am Boden auf, als Marcellus einen umgestürzten Förderturm umrundete, der verbogen und verrostet auf dem unebenen Boden lag. Die alte Kupfermine war seit siebzehn Jahren nicht mehr in Betrieb, doch es fühlte sich an, als stünde sie schon seit Jahrhunderten leer. Es war ein unheimlicher und unheilvoller Ort mit endlosen Reihen klaffender Schachteingänge, düster und leer wie schwarze Löcher in einer Galaxie. Vor zwei Wochen noch wäre Marcellus vielleicht umgekehrt. Vor lauter Furcht wäre er zurück in seine extravaganten, hell erleuchteten Zimmer im Grand Palais geflüchtet. Doch das war vorbei. Wie hätte er einen Rückzieher machen können, wenn ihm der winzige rote Sarg des Premier Enfants noch so frisch in Erinnerung war? Wenn der blaue Fleck an seinem Brustkorb immer noch schmerzte?
Alles hatte sich verändert. Seine Sinne waren geschärft. Er sah, hörte und roch intensiver. Seine Augen waren endlich weit geöffnet.
Und die Welt hatte sich rot gefärbt.
Ein dunkles, blutiges Rot.
Die Farbe des Todes. Die Farbe des Zorns. Die Farbe des Feuers.
Aber du lagst auch falsch, Grand-père. Ich kann mich nämlich wehren.
Während Marcellus sich einen Weg an einer alten Aufbereitungsanlage entlang bahnte, erhaschte er einen Blick auf sein eigenes Spiegelbild in der metallenen Außenverkleidung der Maschine. Vor Schreck wäre er beinahe zusammengezuckt. Er erkannte sich kaum wieder. Der junge Mann, der ihn von der verzogenen Wand anstarrte, war viel zu ungepflegt. Zu rebellisch. Er war nicht mehr der konservative, gehorsame Offizier, zu dem sein Großvater ihn in den letzten achtzehn Jahren erzogen hatte.
Bevor Marcellus an diesem Abend den Grand Palais verlassen hatte, hatte er sich das Gel aus dem dicken dunklen Haar gewaschen, sodass es nun lockig und zerzaust war. Er hatte den gestohlenen Minenmantel angezogen und Schlamm auf seine Wangen und seinen Hals geschmiert. Eine gute Tarnung. Diesen Trick hatte ihm eine Fret-Ratte beigebracht. Jemand, den er einmal gekannt hatte.
Doch gerade versuchte er, nicht an Chatine Renard zu denken.
Zumindest nicht allzu viel.
Marcellus sah zum Himmel auf, in der Hoffnung, einen Blick auf den Mond zu erhaschen, der das Gefängnis beherbergte. Doch er sah nichts als eine düstere, wogende Masse. Die ewige Wolkendecke Laterres machte es unmöglich, je etwas anderes zu sehen.
Es gab keine Sols. Keinen Mond. Kein Licht. Es war ein Himmel ohne Sterne.
Doch heute Nacht brauchte Marcellus weder die Sterne noch den Mond, um seinen Weg zu finden. Dafür hatte er sein Feuer. Eine rot glühende, heiße Flamme, die tief in seinem Inneren entzündet worden war. Und er war sicher, dass sie nie wieder erlöschen würde.
Außerdem hatte er natürlich Anweisungen erhalten. Mysteriöse Worte, die auf einem Blatt Papier standen. Worte, die ihn in den frühen Morgenstunden zu dieser verlassenen Mine gelockt hatten.
Ich treffe dich am Anfang vom Ende.
Marcellus folgte einem schmalen Pfad durch eine Ansammlung zerfallener Gebäudeüberreste. Hier türmte sich haufenweise Schutt: einsame Stiefel, zersplitterte Helme, verwesende Jacken, eine blutbesudelte Rollbahre.
Manche Leute glaubten, dass es in der alten Kupfermine spukte. Dass die Geister der sechshundert Arbeiter, die bei dem Bombenattentat vor siebzehn Jahren ums Leben gekommen waren, immer noch hier waren. Ewig unter der Erde gefangen.
Marcellus wollte das nicht glauben. Doch als er durch diesen verlassenen Ort lief, verstand er, warum nie jemand herkam.
Tod, Trauer und verlorene Lebenszeit suchten diesen Ort heim.
So etwas wollte niemand sehen.
Doch Marcellus musste es sehen.
Diese Mine war der Grund, warum sein Vater, Julien Bonnefaçon, die letzten siebzehn Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht hatte.
Die mysteriösen Anweisungen hatten Marcellus genau hierhergeführt. Dessen war er sich sicher.
Der Anfang vom Ende. Für seinen Vater. Für die Vangarde. Für die Rebellion im Jahr 488.
Die unheimliche Stille wurde plötzlich von hallenden Schritten durchbrochen. Panisch zog Marcellus sich die Kapuze seines gestohlenen Mantels über den Kopf und duckte sich in einen der rostigen Metallkäfige. Das Tragseil über seinem Kopf knarrte und quietschte. Marcellus’ Magen machte einen Satz, als er einen Blick in den zweihundert Mètre tiefen Schacht unter sich warf. Er sog scharf die Luft ein und verhielt sich so still wie möglich, in der Hoffnung, dass die Schritte nicht zu einem Androiden gehörten.
Es bedürfte nur eines einzigen Scans, und seine Verkleidung würde auffliegen. Seine biometrischen Daten würden sofort erkannt werden. Seine Identität aufgedeckt. Und dann wäre alles vorbei. Die riskante Aufgabe, die vor ihm lag, wäre dann nicht mehr wichtig. Nichts wäre dann noch wichtig, denn er würde sich kurz darauf in der Bastille wiederfinden. Auf dem Mond mit all den anderen Verrätern.
Die Schritte kamen immer näher. Marcellus lauschte in die Dunkelheit, sein Herz hämmerte in seiner Brust. Er spähte unter seiner Kapuze hervor und versuchte zu erkennen, woher das Geräusch kam, doch plötzlich wurde es wieder still.
Hatte er es sich nur eingebildet? Das hätte ihn nicht sonderlich überrascht. Nach den Ereignissen der letzten paar Wochen hatte er sich alle möglichen grässlichen Dinge ausgemalt. Seine blühende Fantasie hielt ihn nachts wach. Seit der Trauerfeier hatte er kaum geschlafen.
Eine feuchte Brise zerrte an seinem Mantel. Als er ein leises Quietschen ganz in der Nähe hörte, trat Marcellus aus dem klapprigen Käfig heraus und kniff die Augen zusammen, um etwas in der Dunkelheit zu erkennen. Er konnte gerade so eine kleine, baufällige Hütte ausmachen, deren Tür schief in den Angeln hing und leicht hin und her schwang. Marcellus schob die kalten, zitternden Finger in seine Manteltasche und zog eine kleine Packung Streichhölzer hervor. In der eisigfeuchten Luft schlug der erste Versuch fehl, doch beim zweiten Mal stoben Funken auf und verwandelten sich rasch in eine hell leuchtende Flamme. Marcellus schirmte sie mit einer Hand ab und hielt das Licht in Richtung der Hütte, bis er eine mit Schlamm auf die Tür gemalte Markierung entdeckte.
Zwei schräge Linien zogen sich wie ein Trichter nach unten und trafen sich schließlich in der Mitte.
Der Buchstabe V, erinnerte Marcellus sich aufgeregt. Er war also am richtigen Ort.
Das Dach des Gebäudes war eingefallen, und die rostigen Wände schienen sich unter dem auffrischenden Wind zu biegen. Marcellus stieß die marode Tür auf und trat ein.
Die Schatten verschlangen ihn. Seine Augen brauchten einen Moment, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Dann sah er sie.
Sie saß auf einer Holzbank, die Hände im Schoß verschränkt, den Kopf so gedreht, dass Marcellus ihr Profil erkennen konnte. Ein Gesicht, das in seinen dunkelsten ebenso wie in seinen hellsten Erinnerungen wohnte. Als sie sich ihm zuwandte, verzogen sich ihre Lippen zu einem warmen, vertrauten Lächeln. »Marcellou. Ich hatte gehofft, du würdest kommen.«
Marcellus’ Knie gaben nach. Er sank vor seiner ehemaligen Gouvernante zu Boden, als ihn auf einen Schlag all die Gefühle überkamen, die er in den letzten sieben Jahren unterdrückt hatte. Wut, Frust, Verrat, Bedauern, Reue und Sehnsucht.
Letztere überlagerte alles andere. Mabelle war als Verräterin des Régimes gebrandmarkt worden. Als Spionin des Feindes. Es war ihm nicht erlaubt, sie zu vermissen oder etwas anderes als Hass für sie zu empfinden. Aber, bei den Sols, wie sehr er sie vermisst hatte.
Es gab so viel zu sagen, doch während er vor ihr kniete, konnte er nichts anderes hervorbringen als: »Es tut mir leid, es tut mir so leid.«
Wofür entschuldigte er sich? Dafür, dass er sie wie eine Kriminelle behandelt hatte, als er sie vor drei Wochen in Montfer getroffen hatte? Dass er die Lügen seines Großvaters über sie geglaubt hatte, obwohl sie sein Herz zerfetzt hatten? Dass er sie an jenem Tag vor sieben Jahren nicht gerettet hatte, als die Androiden sie fortschleppten?
Er kannte die Antwort.
Für all das.
Und noch mehr.
Da spürte er Mabelles Hand auf seinem Kopf. Sanft und beruhigend. »Ist schon gut, Marcellou. Es ist alles gut.« Für den Bruchteil einer Sekunde verpuffte die Wut, die mittlerweile ständig in seinem Inneren wütete. Er fühlte sich sicher. Er fühlte sich geborgen. Die klapprige und windgepeitschte Hütte hatte sich in einen warmen Ort verwandelt, einen vertrauten Ort voller Liebe und Licht. Plötzlich war er wieder der kleine Junge, der zu Mabelles Füßen spielte, während sie ihm aus einem der Bücher vorlas, die sie in den Palais geschmuggelt hatte.
»Weiß jemand, dass du hier bist?«, fragte Mabelle in plötzlich ernstem Tonfall. »Ist dir jemand gefolgt?«
Marcellus dachte kurz an die Schritte, die er zuvor gehört hatte. Inzwischen war er allerdings überzeugt, sie sich nur eingebildet zu haben.
»Nein.«
»Bist du sicher?«, fragte Mabelle. »Der General hat überall auf dem Planeten Spione, die für ihn arbeiten.«
So schnell zerplatzte die Seifenblase. Marcellus wurde zurück in die Gegenwart katapultiert. Die Realität prasselte auf ihn ein: die löchrige Hütte, der kalte, unebene Boden, auf dem er kniete, Mabelles eingefallenes, wettergegerbtes Gesicht und die zersplitterte Bank, auf der sie saß. Auch die Wut flutete seinen Geist von Neuem, und er sah rot.
»Ich weiß über seine Spione Bescheid«, murmelte er und dachte an Chatine. »Ich war vorsichtig.« Er stand auf. »Ich habe meinen Télé-Com nicht mitgenommen. Ich habe den Palais durch die Öffnungen im Zaun verlassen, die du mir gezeigt hast, als ich noch klein war. Und ich habe mein Moto weit weg von der Mine geparkt.«
Mabelle stieß scharf die Luft aus. »Gut. Guter Junge.«
Bei dem Lob verzogen Marcellus’ Lippen sich unwillkürlich zu einem Lächeln. Mabelle mochte in der Bastille um ein ganzes Menschenleben gealtert sein, doch sie war immer noch dieselbe Frau, die ihn elf Jahre lang aufgezogen hatte.
Sie klopfte neben sich auf die Bank, und Marcellus setzte sich.
»Ich muss zugeben, ich war nicht ganz sicher, ob du kommen würdest«, sagte sie, während der Wind zornig an den Wänden riss und der Regen durch die Risse im Dach tropfte.
»Wäre ich auch fast nicht«, sagte er. Als Mabelle eine Augenbraue hob, lächelte er verlegen und erklärte: »Ich habe eine Weile gebraucht, um die Nachricht zu entziffern.«
Als er das Stück Papier gefunden hatte, das jemand ihm während einer Patrouille in den Frets in die Tasche hatte gleiten lassen, war es ihm zuerst unleserlich erschienen. Dass er Lesen und Schreiben geübt hatte, war über sieben Jahre her, und er hatte Stunden damit verbracht, die Linien und Kurven mit den Fingerspitzen nachzufahren, bis die Erinnerungen zurückgekommen waren. Wie der Text eines alten Liedes. Sobald man die ersten Töne summte, kam das ganze Lied zurück.
Vielleicht hatte er das Vergessene Wort doch nicht völlig vergessen.
»Du bist jetzt hier. Das ist alles, was zählt«, sagte Mabelle und nahm seine Hand in ihre. Einst hatte sie seine kleine Kinderhand vollständig umfasst, doch nun fühlte sie sich unglaublich klein an. Doch sie war warm. Das einzig Warme an diesem trostlosen Ort.
Marcellus nickte und versuchte, sich von ihren Worten trösten zu lassen.
In Wahrheit hatte er gehofft, viel früher eine Nachricht zu bekommen und sie schneller zu entziffern. Sie hatten bereits so viel Zeit verloren. General Bonnefaçon hatte inzwischen für so viel Aufruhr gesorgt und so viel … Tod. Das Premier Enfant – die kleine Marie Paresse – befand sich auf einer Reise ohne Rückkehr zu Sol 2. Nadette Epernay war für den Mord an dem kleinen Mädchen angeklagt und hingerichtet worden. Wer war als Nächstes dran? Wie viele Leben würde der General opfern, um an die Macht zu gelangen?
»Ich habe das Video gesehen«, sagte Marcellus hastig, als der vertraute Zorn abermals in ihm aufstieg. »Der Beweis, dass mein Vater nichts mit dem Anschlag auf diese Mine zu tun hatte. Ich habe die Mikrokamera in dem Gemälde an der Wand deines alten Zimmers im Grand Palais gefunden, genau wie du gesagt hast. Ich weiß jetzt, dass mein Großvater meinem Vater die Schuld zugeschoben hat, obwohl in Wirklichkeit er und der vorherige Patriarche hinter dem Anschlag stecken.«
Mabelle nickte. »Es freut mich, dass du endlich die Wahrheit erkannt hast.«
»Wir müssen ihn aufhalten«, sagte Marcellus mit Nachdruck. »Nein, nicht nur aufhalten. Wir müssen ihn zerstören. Er hat mich hintergangen. Er hat meinen Vater hintergangen. Jeden auf diesem Planeten. Er muss gestürzt werden.«
Er atmete einmal tief durch und sprach dann endlich die Worte aus, die ihm seit zwei Wochen durch den Kopf gingen. Vielleicht sogar schon sein ganzes Leben lang. Vielleicht waren sie immer da gewesen. Tief in seiner DNA verborgen, hatten sie nach ihm gerufen. Hatten nur darauf gewartet, dass er aufwachte und sie endlich hören würde. »Ich will mich der Vangarde anschließen.«
Ein Anflug von Stolz huschte über Mabelles Gesicht, wurde aber schnell von einer ernsten, warnenden Miene ersetzt. »Marcellus, das ist eine sehr wichtige Entscheidung, die du nicht leichtfertig treffen solltest. Es ist gefährlich, sich uns anzuschließen. Damit riskierst du alles, was du kennst und liebst. Dein Zuhause. Deine Arbeit. Deine Familie.«
»Ich habe keine Familie«, fuhr er sie an. »Mein Vater starb im Kampf für die richtige Seite. Und meine Mutter starb an gebrochenem Herzen. Du bist meine einzige Familie. Und was mein Zuhause und meine Arbeit angeht: Beides ist mir völlig egal. Das Régime, das Ministère, meine Beförderung zum Commandeur, diese verfluchte Offiziersuniform. Ich bin damit fertig. Ich bin fertig damit, dem General wie ein pflichtbewusster, treuer Enkelsohn hinterherzurennen. Ich bin fertig damit, in seine Fußstapfen treten zu wollen. Es ist an der Zeit, dem Pfad zu folgen, dem ich schon die ganze Zeit über hätte folgen sollen.«
Mabelle warf ihm einen mitfühlenden Blick zu. »Marcellus, es wird deinen Vater nicht zurückbringen, wenn du der Vangarde beitrittst.«
Mit geballten Fäusten sprang Marcellus auf. »Ich tue das nicht, um meinen Vater zurückzubringen. Ich tue es, um sein Andenken in Ehren zu halten.« Er nickte in Richtung der schiefen Tür, die zurück in die Mine führte. »Um ihrer aller Andenken in Ehren zu halten. Um den General zu besiegen. Ich will dort weitermachen, wo mein Vater aufgehört hat. Ich bin jetzt bereit. Ich werde kämpfen. Ich werde Nachrichten überbringen. Und rekrutieren. Ich werde wenn nötig durch das ganze Système Divin reisen, nach Usonien, Kaishi, Reichenstaat, wo immer mich die Vangarde hinschickt. Ich werde den Palais morgen verlassen. Ich werde –«
»Marcellou.« Mabelle hob eine Hand, um ihn zum Schweigen zu bringen. Sie sah aus, als litte sie Schmerzen. »Du verstehst nicht. Wir verlangen keins dieser Dinge von dir.«
Marcellus blinzelte verwirrt. Panik stieg in ihm auf. Es war ihm nie in den Sinn gekommen, dass die Vangarde ihn abweisen könnte. »Aber in Montfer hast du gesagt … du hast gesagt, dass ich zu dir kommen soll, wenn ich die Wahrheit kenne. Dass ich mich euch anschließen könne.«
»Ja, das ist richtig. Wir brauchen dich, Marcellus. Aber nicht als Spion da draußen.«
Seine Verwirrung verwandelte sich in Entsetzen. Plötzlich wurde ihm ganz schwindelig.
Ihm war schlecht. Und kalt. Er schüttelte den Kopf. »Nein, das kann ich nicht, ich –«
»Du bist der Einzige, der sich unbemerkt in seiner Nähe aufhalten kann.«
Marcellus fuhr sich mit gekrümmten Fingern durchs Haar und ließ Mabelles Worte sacken. »Du willst, dass ich zurückgehe? Du verlangst von mir, mit ihm im selben Raum zu sein und so zu tun, als wäre nichts passiert? Als wäre er unschuldig? Ich kann doch jetzt nicht mehr so blind sein wie früher.«
»Nicht blind«, widersprach Mabelle ihm. »Das Gegenteil. Deine Augen werden weit offen sein. Wir brauchen dich im Palais. Seit meiner Festnahme vor sieben Jahren ist es uns nicht mehr gelungen, jemanden hineinzuschleusen. Und nun ist es wichtiger als je zuvor.«
Marcellus schluckte und glaubte, sich jeden Moment übergeben zu müssen.
»Warum, glaubst du, habe ich dir die Nachricht im Häftlingsanzug deines Vaters geschickt?«, fuhr Mabelle fort. Sie sprang ebenfalls auf und zwang ihn auf diese Weise, sie anzusehen. »Du musst begreifen, dass wir nichts davon vorhergesehen haben. Wir dachten, wir würden gegen das Régime kämpfen, gegen den Patriarchen, ein fünfhundert Jahre altes korruptes System. Die Vangarde wusste bis vor wenigen Monaten nicht, dass der General ebenfalls gegen das Régime kämpft. Jetzt sehen wir uns nicht nur einem, sondern zwei Feinden gegenüber. Und deine Uniform ist kein Fluch. Sie ist ein Geschenk. Ein Schlüssel, um dahin zu gehen, wo niemand anderes hingehen kann. Um General Bonnefaçon zu besiegen und ihn davon abzuhalten, das Régime zu übernehmen, brauchen wir deine Augen und Ohren. Du musst weiter den pflichtbewussten, treuen Enkel des Generals spielen.«
Mabelles Blick war so intensiv und stechend, dass Marcellus wegsehen musste. Er versuchte, seine Atmung unter Kontrolle zu bringen, doch es war, als würde er versuchen, den draußen wütenden Sturm zu zähmen.
»Wusstet ihr, dass er plante, das Premier Enfant zu ermorden?«, flüsterte er im scharfen Tonfall.
»Nein«, sagte Mabelle energisch. »Nicht, bevor es zu spät war.«
»Aber ihr habt Beweise, oder? Dass er Marie umgebracht hat? Die können wir benutzen. Wir können sie dem Patriarchen zeigen und meinen Großvater verhaften lassen und –«
»Wir haben keine Beweise. Genau wie du haben wir nur Vermutungen. Und unseren Instinkt.«
»Also ist es das, was ihr von mir wollt. Ich soll euch Beweise liefern, die ihn schuldig sprechen?«
Mabelle schüttelte den Kopf. »Du wirst nichts finden. Der General ist ein sehr gerissener, vorsichtiger Mann. Er wird seine Spuren so gut verwischt haben, dass der Mord nie auf ihn zurückzuführen sein wird.«
Marcellus schloss die Augen, als weitere Erinnerungen auf ihn einprasselten. Nadettes Kopf, der mit einem dumpfen Aufprall in eine Metallkiste fiel. Maries winziger Sarg, der ins All geschossen wurde.
»Möge sie bei den Sols ruhen.«
»Woher wisst ihr es?«, entfuhr es Marcellus.
Mabelle runzelte verwirrt die Stirn.
»Du hast gesagt, dass die Vangarde erst seit ein paar Monaten weiß, dass der General auch gegen das Régime kämpft. Woher wisst ihr das?«
Mabelle seufzte und sah verloren aus. »Wir haben Informationen darüber erhalten, dass der General an etwas arbeitet. An etwas Schrecklichem und Zerstörerischem, das alle Bewohner dieses Planeten in Lebensgefahr bringt.«
Ein eisiger Schauer lief Marcellus den Rücken herunter. »Was?«
Für einen Augenblick wanderte Mabelles Blick aus dem Fenster, als gäbe es dort draußen etwas, aus dem sie Kraft schöpfte. »Er lässt eine Waffe bauen.«
Marcellus glaubte, der Planet würde unter seinen Füßen wegkippen. Hatte es sich wohl so angefühlt, als die Bombe hier vor siebzehn Jahren explodiert war? Als ob der Boden unter den Füßen der Arbeiter nachgab? Als ob der Himmel herabfallen würde? Als ob sie nie wieder atmen könnten? Er brauchte mehrere Sekunden, um sich wieder zu fangen. Seine Worte klangen abgehackt. »Was für eine Waffe?«
»Das wissen wir nicht«, antwortete Mabelle. »Aber wir glauben, dass er damit zum letzten Schlag ausholen wird. Er plant, damit endgültig die Kontrolle zu übernehmen. Unsere Informationen kommen von einer Quelle, die direkt mit dem General zusammenarbeitet. Leider wurde die Agentin, die in Verbindung mit der Quelle stand, vor zwei Wochen vom Ministère festgenommen.«
»Die beiden Frauen«, rief Marcellus, als ihm plötzlich klar wurde, wovon sie sprach. Er erinnerte sich an die zwei Vangarde-Agentinnen, die er auf dem Revier befragt hatte. Die hochgewachsene, die sich Jacqui nannte, und die kleinere mit den dunklen Haaren, die kaum sprach. »Sie haben versucht, ins Büro des Gefängnisdirecteurs einzubrechen.«
»Ja«, bestätigte Mabelle. »Eine von ihnen heißt Denise.«
»Die mit der Narbe im Gesicht?«
Mabelle nickte. »Sie war früher einmal ein Cyborg, bevor sie der Vangarde beigetreten ist.«
Früher einmal?
Plötzlich ergaben ihre grässlichen Narben, die Linien, die sich über ihre linke Wange zogen, mehr Sinn. Marcellus hatte keine Ahnung gehabt, dass man die Implantate eines Cyborgs entfernen konnte. Er hatte immer angenommen, dass diese Leute nach der Operation ihr Leben lang Cyborgs blieben.
»Sie war die Einzige, die wusste, wie man die Quelle kontaktieren kann«, fuhr Mabelle fort. »Wir haben unsere einzige Möglichkeit verloren, herauszufinden, woran der General arbeitet und wie wir ihn aufhalten können.«
Marcellus’ Kehle wurde ganz trocken. Die beiden Agentinnen waren nur wenige Stunden, nachdem Marcellus sie befragt hatte, aus dem Revier verschwunden.
»Ich weiß nicht, wo sie sind«, sagte er verzweifelt. »Der General hat irgendwo eine geheime Einrichtung. Er hat mir nicht viel darüber verraten. Ich weiß nur, dass wichtige Gefangene manchmal einfach so verschwinden und Tage oder Wochen später völlig gebrochen wiederauftauchen. Manchmal kommen sie auch gar nicht mehr zurück.« Er schluckte. »Tut mir leid.«
»Ist schon in Ordnung«, sagte Mabelle. »Diese Information ist sehr hilfreich. Wir werden versuchen, sie zu finden, aber in der Zwischenzeit brauchen wir jemanden, der diese Waffe ausfindig macht.« Sie sah Marcellus vielsagend an.
»Das ist also meine Aufgabe?« Angst breitete sich in seinem Magen aus. »Herauszufinden, woran er arbeitet?«
»Was es ist. Wo er daran arbeitet. Mit wem er zusammenarbeitet. Wann er fertig sein wird. Was auch immer du herausfinden kannst. Wir haben viele Ressourcen darauf verwendet und bisher noch keinen Erfolg gehabt.«
Die schiere Unmöglichkeit dieser Aufgabe schien Marcellus zu erdrücken. Er massierte sich die Schläfen. »Wenn die Vangarde nichts findet, warum glaubst du dann, dass es mir gelingen wird?«
Ein wissendes Lächeln umspielte Mabelles Lippen. »Weil ich dich großgezogen habe, mon chéri. Ich kenne dich und ich glaube an dich.«
Marcellus begann, in der Hütte auf und ab zu laufen. »Aber der General verdächtigt mich sowieso schon, mit euch unter einer Decke zu stecken. Er hat sogar ein Mädchen aus den Frets angeheuert, um mich auszuspionieren. Er misstraut mir längst.«
»Dann musst du doppelt so hart arbeiten, um ihn von deiner Loyalität zu überzeugen.«
Marcellus knurrte frustriert. »Er ist der größte Militärstratege, den dieser Planet je gesehen hat! Wenn er herausfindet, dass ich ihn ausspioniere, wird er … er …« Marcellus schüttelte sich. »Dann wärt ihr alle in Gefahr.« Zum ersten Mal, seit er in dieser Nacht den Palais verlassen hatte, fühlte er sich hoffnungslos.
»Nur so können wir ihn aufhalten«, sagte Mabelle, und Marcellus hörte die Endgültigkeit in ihrer Stimme heraus. Es erinnerte ihn daran, wie sie früher immer reagiert hatte, wenn er als kleines Kind mit ihr hatte verhandeln wollen, um abends noch fünf Minuten länger aufzubleiben.
Doch das hier war völlig anders. Sie handelten keine längere Spielzeit aus. Hier ging es um sein Leben.
»Was ist mit der Gefangenen?«, fragte er verzweifelt. »Die Agentin, die als Einzige weiß, wie man eure Quelle kontaktiert. Wenn ich herausfinden kann, wo mein Großvater sie festhält …«
»Dann werden wir natürlich versuchen, sie zu befreien«, sagte Mabelle. »Aber solche Dinge dauern lange, und die Zeit läuft uns davon. Wir müssen die Waffe finden, und zwar sofort.«
Marcellus verengte die Augen zu Schlitzen. »Ihr würdet wirklich versuchen, sie zu befreien?«
»Ja.«
»Wie Citoyenne Rousseau?«
Mabelle wurde still, ihr Gesichtsausdruck glich nun einer ruhigen Seeoberfläche.
Im Ministère war es kein Geheimnis, was die beiden Agentinnen vorgehabt hatten, als sie ins Büro des Gefängnisdirecteurs eingebrochen waren. Sie hatten das Sicherheitssystème der Bastille lahmlegen wollen, um die inhaftierte Anführerin der Vangarde, die während der Rebellion im Jahr 488 Tausende Menschen hinter sich versammelt hatte, zu befreien. Es war ihnen nicht gelungen, doch der General war sicher, dass die Vangarde es wieder versuchen würde.
Doch falls Mabelle etwas über einen weiteren Versuch wusste, gab sie es nicht preis.
»Ist das nicht euer großer Plan?«, bohrte Marcellus weiter nach. »Rousseau zurückzubringen, sodass ihr eine neue Revolution anzetteln könnt?«
»Das darf ich leider nicht sagen.«
»Warum nicht?«, fragte Marcellus leicht empört.
»Du musst verstehen, Marcellus, dass du neu bei uns bist«, sagte sie sanft. »Du wurdest noch nicht dazu ausgebildet, unsere Geheimnisse für dich zu behalten.«
Marcellus wusste genau, was sie damit meinte. Wenn er geschnappt wurde, konnten sie nicht darauf zählen, dass er sie nicht verraten würde. Er bohrte sich die Fingernägel in die Handflächen. »Kannst du mir nur noch eine Sache sagen?«
Ein leises Lächeln huschte über Mabelles Züge. »Kommt darauf an, was es ist.«
Marcellus schloss die Augen und versetzte sich in Gedanken zurück in den zugigen Gang von Fret 7. Dort war er vor zwei Wochen zum letzten Mal dem Mädchen namens Alouette Taureau begegnet. Vor seinem inneren Auge sah er wieder, wie sie vor ihm zurückwich. Wie sie ihre dunklen Augen schockiert und ungläubig aufriss, als er ihr die Wahrheit sagte: dass sie unbewusst jahrelang bei der Vangarde gelebt hatte.
»Da war dieses Mädchen«, flüsterte er. Doch dann erinnerte er sich an den Namen, der auf dem kleinen Schild an ihrer Perlenkette gehangen hatte. »Kleine Lerche.« Marcellus öffnete die Augen. »Welche Rolle spielt sie in alledem? Bitte sag mir, dass sie nicht Teil von irgendetwas Gefährlichem sein wird.«
Als er Mabelles Reaktion sah, zog sich sein Magen schmerzhaft zusammen. »Die Kleine Lerche ist …« Sie hielt inne und sah zu Boden. »Sie gehört nicht mehr zur Vangarde.«
Alles Blut wich aus Marcellus’ Gesicht. »Was? Was meinst du damit? Ich dachte, dass sie …«
»Sie ist fortgegangen.«
»Fort?«, wiederholte. »Wohin ist sie gegangen?«
»Damit musst du dich nicht befassen«, sagte Mabelle ruhig. »Es geht ihr gut. Wir werden dafür sorgen, dass sie sicher ist.«
Das Atmen wurde immer schwerer, als die Realität ihrer Worte über Marcellus hereinbrach. »Aber …«
»In der Geschichte dieses Planeten haben wir alle unsere Rolle zu spielen, Marcellus. Und im Moment ist es deine Rolle, die Waffe zu finden. Wenn du dich entscheidest, dich uns anzuschließen.« Mabelle zog langsam einen Fuß über den Boden der Hütte und malte eine Linie in den Schlamm. »Wenn du diesen Auftrag annimmst, schwörst du uns und unserer Sache die Treue. Du verpflichtest dich, mit uns für ein besseres Laterre zu kämpfen und auch, dem neuen Planeten gegenüber treu zu bleiben, nachdem wir unser Ziel erreicht haben.«
Marcellus starrte wie betäubt auf die Linie, die Mabelle auf den Boden gemalt hatte. Schließlich erkannte er, was sie darstellen sollte.
Es war eine Hälfte des Symbols, das er vorhin auf der Hüttentür entdeckt hatte.
Die Hälfte eines Buchstabens.
Sie wartete darauf, dass er ihn vervollständigte.
Marcellus begann zu schwitzen. Als er wieder sprach, klang seine Stimme leise und resigniert. »Der General ist allen immer drei Schritte voraus.«
»Und aus diesem Grund musst du es tun. Damit wir ihm voraus sein können. Damit er niemandem mehr wehtun kann.«
Marcellus legte eine Hand auf seinen Brustkorb, an die Stelle, wo sein Großvater ihn wieder und wieder getreten hatte. Die Erinnerung daran, wie er auf dem kalten Marmorboden im Büro des Generals gelegen hatte, ließ ihn zusammenzucken. Geschlagen. Erniedrigt. Besiegt.
»Sieh dich an! Du bist erbärmlich. Du kannst dich nicht mal wehren.«
Plötzlich entzündete sich der Funke in seinem Inneren wieder. Die Flammen loderten auf. Bei dem Gedanken daran, in den Palais zurückzukehren, die kratzige weiße Uniform anzuziehen und seinem Großvater ins Gesicht zu blicken, raste Marcellus’ Herz. Doch er wusste, dass er nicht mehr tatenlos zusehen konnte, wie der General den Planeten entzweiriss.
Er war nicht mehr der verängstigte, hilflose Junge am Boden. Dieser Marcellus Bonnefaçon war verschwunden. Verbrannt in den schwelenden Überresten der Lügen seines Großvaters. Marcellus war an jenem Tag wiedergeboren worden. Als er sich von dem kalten, harten Boden erhoben und die Wahrheit über seinen Großvater – über seine Vergangenheit, seine Täuschungen und Spielchen – herausgefunden hatte, war er zu einer anderen Person geworden. Zu jemand Stärkerem. Jemand Wütenderem. Zu jemandem, der sich wehrte.
Durch die zersprungenen Fenster der Hütte sah Marcellus, dass sich das erste Morgenlicht einen Weg durch die Dunkelheit der Nacht bahnte. Die drei Sols gingen auf. Ihr Licht verwandelte Laterres dicke Wolkendecke in ein glühendes Flickenmuster aus Gold-, Orange- und Grautönen.
Mabelle trat näher an Marcellus heran. Ihre braunen Augen funkelten im Licht der Dämmerung. »Schwörst du es?«
Marcellus straffte die Schultern und zog seinen Fuß mit einer raschen, entschiedenen Bewegung über den Boden. »Ich schwöre es.«
Beide sahen auf das nun vollständige V am Boden herab, als stünde es in Flammen. Als wäre es in den Boden gebrannt worden. Es war ein Buchstabe, der auf Laterre bereits vor Hunderten von Jahren seine Bedeutung verloren hatte. Doch nun hatte er plötzlich die Macht, den Planeten aus seiner Umlaufbahn zu werfen und die Sterne des gesamten Système Divin neu anzuordnen.
Marcellus konnte Mabelles Lächeln nicht ganz deuten, als sie sagte: »Willkommen bei der Vangarde.«
Er stieß den Atem aus und hatte in diesem Moment das Gefühl, ihn achtzehn Jahre lang angehalten zu haben. Dass er nun zur Vangarde gehörte, mochte seinen Vater nicht zurückbringen, doch Marcellus hatte sich Julien Bonnefaçon noch nie näher gefühlt als jetzt.
Kapitel 2
MARCELLUS
Auf dem Grand Boulevard im Zentrum von Ledôme herrschte reges Treiben. Mitglieder des Zweiten État gingen spazieren, bummelten, trafen sich mit Freunden und stellten ihre neuesten modischen Errungenschaften zur Schau. Croiseure und Motos flitzten die Straße hinauf und hinunter und luden ihre Passagiere bei einem der Hunderten Geschäfte und Restaurants ab, die die Allée säumten.
Marcellus lenkte sein Moto an der Opéra und dem Musée der Ersten Welt vorbei, bevor er in der Nähe eines großen Kreisels anhielt, an dem der Grand Boulevard endete. Von hier zogen sich viele kleine Straßen in alle Richtungen wie Speichen an einem altmodischen Rad. Er zupfte am Kragen seiner steifen Offiziersuniform, die ihm schier die Luft abzudrücken schien.
Bevor er nach Ledôme zurückgekehrt war, hatte er sich den Dreck vom Gesicht gewaschen und war wieder in die ihm so verhasste weiße Hose und Jacke geschlüpft. Einmal mehr war er Offizier Bonnefaçon, Enkel des großen Generals César Bonnefaçon und Sohn des berüchtigten, toten Verräters Julien Bonnefaçon. Wieder einmal war er Laterres angehender Commandeur, ein pflichtbewusster Diener des Ministères.
Und heute würde er seinem Großvater in die Augen schauen und so tun müssen, als ob er nicht gerade sein Leben dem Vorhaben gewidmet hätte, den General zu Fall zu bringen.
Vor Angst war ihm ganz schlecht. Es war ein unmögliches Unterfangen. Er konnte nicht anders, als zu glauben, dass die Vangarde einen schrecklichen Fehler beging, indem sie ihm diese Aufgabe übertragen hatte. Der General war zu gerissen, zu strategisch versiert und hatte zu viele Geheimnisse. Wie sollte Marcellus jemals diese mysteriöse Waffe finden? Wo sollte er überhaupt mit der Suche beginnen?
Er seufzte und sah zum Turm der Paresse-Familie auf, der in der Mitte des Kreisels in den Himmel ragte und alle Straßen, Parks, Manors und Gärten überblickte. Sein Bau war vor zwanzig Jahren vom ehemaligen Patriarchen Claude Paresse in Auftrag gegeben worden, um das laterrianische Régime zu feiern.
Früher einmal war er Marcellus’ Lieblingsbauwerk gewesen.
Der Anblick des majestätischen Turms, so riesig und scheinbar unzerstörbar, hatte ihn einst inspiriert.
Doch heute fühlte sich das Bauwerk viel zu groß, pompös und falsch an, wie alles andere in Ledôme. Jetzt konnte Marcellus die Wahrheit hinter alldem sehen: ein Turm, der für Jahrhunderte der Unterdrückung und Ungleichheit stand. Ein Wahrzeichen, das die elitäre Gesellschaft Laterres feierte, die das Glück hatte, unter dieser klimakontrollierten Kuppel im Luxus zu leben, während der Rest des Planeten verhungerte und erfror.
Heute machte der Turm Marcellus nur noch wütender.
Er stieß sich vom Boden ab und raste den ganzen Weg zurück zum Grand Palais. Nachdem er sein Moto an der Docking-Station vor den Toren abgestellt hatte, ging er den Rest des Weges zu Fuß. Er zählte die kleinen Ornamente in Form von Fleurs-de-Lys ab, die jeden Zaunpfahl zierten, bis er an einem ankam, der ein wenig verbogen war. An dieser Stelle kletterte er über den Zaun und schlüpfte unbemerkt durch die unsichtbare Lücke im Schutzschild. In Gedanken dankte er Mabelle dafür, vor vielen Jahren für diesen Fluchtweg gesorgt zu haben.
Er erinnerte sich an das erste Mal, als sie ihm die verbogenen Blumen gezeigt hatte. Er war noch klein gewesen, und sie hatte ein Spiel daraus gemacht. »Welche sehen anders aus als die anderen?«
Erst Jahre nachdem Mabelle als Spionin der Vangarde entlarvt und gefangen genommen worden war, hatte Marcellus verstanden, dass sie mehrere Blumen absichtlich verbogen hatte, um die Orte zu markieren, an denen sie das Schild, das das Palais-Gelände schützte, außer Kraft gesetzt hatte. So konnte sie ungehindert und unbemerkt kommen und gehen, wann sie wollte.
Marcellus benutzte den Dienstboteneingang und nahm eine der Treppen zum Südflügel, wo er und sein Großvater lebten. Als Leiter des Ministères und oberster Berater des Patriarchen stand General Bonnefaçon eine eigene Unterkunft im Palais zu. Früher hatte Marcellus das als Ehre empfunden und sich privilegiert und besonders gefühlt. Nun fühlten sich die Wände hier eher wie die Gitterstäbe eines Gefängnisses an. Und die weitläufigen, großzügig ausgestatteten Zimmer, an denen er vorbeikam, erinnerten ihn nur daran, dass sein morgendlicher Besuch in der Kupfermine ganz anders als geplant verlaufen war.
Als er sich vor ein paar Stunden aus dem dunklen, noch schlafenden Palais geschlichen hatte, hatte er geglaubt, nie wieder hierher zurückzukehren. Der Gedanke, sich nie mehr im selben Raum wie sein Großvater aufhalten zu müssen, hatte ihn angetrieben. Er hatte gedacht, er würde als Mitglied der Vangarde all das hinter sich lassen können. Genau wie sein Vater.
Doch nun war er wieder hier. Zurück an diesem Ort, der ihn zu ersticken drohte. Während die Lügen seines Großvaters die Luft verpesteten, in jeder Faser eines jeden Wandteppichs steckten.
»Zugang gestattet.« Seine Zimmertür öffnete sich, und Marcellus senkte die Hand, die er vor das biometrische Schloss gehalten hatte. Mit großen Schritten eilte er zu seinem Bett, ließ sich darauf fallen und schrie in eins seiner Seidenkissen. Laut und heftig, bis sein Hals brannte und die zweifelnden und hilflosen Stimmen in seinem Kopf verstummten.
»Bist du bald fertig?«
Marcellus sprang vom Bett auf und sah sich panisch um. Das Herz schlug ihm bis zum Hals, als er seinen Großvater neben der Balkontür stehen sah. Seine breite Silhouette wurde von dem künstlichen Sol-Licht erhellt, das hinter ihm durch einen Schlitz zwischen den Vorhängen hereinfiel.
»G-G-Grand-père«, stotterte Marcellus. Wie lange hatte der General dort gestanden? »Was machst du denn hier?«
»Ich habe auf dich gewartet«, antwortete sein Großvater kühl.
Marcellus’ Herzschlag beschleunigte sich, während ihm tausend mögliche Straftaten durch den Kopf schossen.
Wusste der General, wo er gewesen war?
Marcellus warf einen verstohlenen Blick auf sein unordentliches Bett, wo er gerade noch gelegen und einen Wutanfall gehabt hatte. Sein Großvater hatte es mitbekommen.
»Du hast deine AirLinks nicht beantwortet.«
Der General nickte in Richtung des Télé-Coms, der auf Marcellus’ Nachttisch lag. Obwohl die Ortungsfunktion deaktiviert war, hatte Marcellus das Gerät zur Sicherheit zurückgelassen.
»Ja … äh …« Marcellus wünschte, er könnte sich wenigstens dieses eine Mal mit dem General unterhalten, ohne zu stottern. »Ich wollte nur kurz ein bisschen frische Luft schnappen und … habe ihn vergessen.«
Sein Großvater hob eine Augenbraue. »Außerdem hat Chacal mir berichtet, dass er dich gestern nicht in der Télé-Haut-Fabrique angetroffen hat, wo du den letzten Terroranschlag untersuchen solltest.«
Ein Sturm braute sich in Marcellus’ Brust zusammen. Sein Großvater hatte ihn zum leitenden Offizier der Untersuchung ernannt. Bei dem Anschlag auf die Fabrique waren zwölf Arbeiter ums Leben gekommen, darunter Chatines Schwester, und sie wussten immer noch nicht, wer dafür verantwortlich war. Doch Marcellus war so damit beschäftigt gewesen, die Nachricht der Vangarde zu entschlüsseln und sich auf das Treffen mit Mabelle vorzubereiten, dass er seine Offizierspflichten vernachlässigt hatte. Er hätte allerdings nicht gedacht, dass diese Ratte Chacal ihn bei seinem Großvater anschwärzen würde.
Marcellus bemühte sich, seinen Gesichtsausdruck so ausdruckslos wie möglich zu halten, während er fieberhaft nach einer Ausrede suchte. »Es tut mir leid, Grand-père, seit der Trauerfeier bin ich nicht mehr ganz ich selbst gewesen.«
Der kühle Blick aus haselnussbraunen Augen bohrte sich in Marcellus. »Muss ich dich daran erinnern, dass Laterre sich gegenwärtig in einer äußerst prekären Lage befindet?«
Und das haben wir alles nur dir zu verdanken, dachte Marcellus bitter, schüttelte aber den Kopf und murmelte: »Nein, General.«
»Die Unruhen wachsen. Der Dritte État gerät außer Kontrolle. Sie rebellieren nun beinahe täglich. Und da Inspecteur Limier immer noch verschollen ist, müssen alle verfügbaren Kräfte hundert Prozent geben.«
Der Leiter des Policier-Reviers in Vallonay war vor zwei Wochen verschwunden. Er war in den Verdure-Wald aufgebrochen, um zwei gesuchte Kriminelle festzunehmen, und nie zurückgekehrt.
»Dies ist ein denkbar schlechter Zeitpunkt, um faul und abgelenkt zu sein, Marcellus.«
Marcellus spürte, wie sein Blut zu brodeln begann. Er ballte die Hände zu Fäusten, verspürte den starken Drang zuzuschlagen. Doch er erinnerte sich an Mabelles Worte.
»Dann musst du doppelt so hart arbeiten, um ihn von deiner Loyalität zu überzeugen.«
Marcellus schluckte seinen Zorn herunter. »Natürlich, Grand-père. Ich bitte um Verzeihung. Es wird nicht wieder passieren.«
Der General musterte ihn eingehend, ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. Das war ein Anzeichen dafür, dass er sich mit etwas zurückhielt. Ohne ein Wort zu sagen, trat er vor und streckte eine Hand nach Marcellus’ Gesicht aus. Marcellus zuckte zusammen, als sein Großvater mit einem Finger über seine Wange fuhr. Als er die Hand zurückzog, konnte Marcellus Schlamm an seiner Fingerspitze erkennen. Die Überreste seiner Tarnung.
Einen langen, spannungsgeladenen Moment starrten beide darauf.
Schließlich brach sein Großvater die Stille. »Du musst jetzt sofort mit mir kommen.«
Der Raum begann sich zu drehen. Marcellus wünschte, er könnte sich an etwas festhalten. Er dachte kurz darüber nach, wegzurennen. Er warf einen raschen Blick zum Balkon und überlegte, ob er einen Sprung in den Innenhof darunter überleben würde.
»Warum?«, flüsterte er.
Der General seufzte schwer. »Der Patriarche will, dass wir mit ihm jagen gehen.«
Jagen?
Drei volle Sekunden lang war Marcellus sicher, sich verhört zu haben.
»Mach deinen Statusreport für die Untersuchung des Vorfalls in der Fabrique fertig und sieh zu, dass du präsentabel bist.« Der General nickte missbilligend in Richtung Marcellus’ schlammverschmierten Gesichts, drehte sich um und schritt aus dem Zimmer. »Wir treffen uns in einer halben Stunde im Foyer.«
Sobald die Tür ins Schloss fiel, stieß Marcellus scharf die Luft aus. Endlich konnte er wieder frei atmen. Er rannte ins Badezimmer und spritzte sich eiskaltes Wasser ins Gesicht. Dann drehte er sein Kinn nach rechts und links, um sicherzugehen, dass er auch die letzten Matschreste entfernt hatte. Nachdem er sein Gesicht abgetrocknet hatte, wandte er sich zur Tür. Doch er sah etwas im Augenwinkel und hielt mitten in der Bewegung inne.
Er fuhr herum und starrte in eine Ecke seines Badezimmers. Neben der Toilette brach sich das Licht auf einer einzelnen Fliese. Als kleiner Junge hatte er sie aus Versehen gelöst und seitdem als Geheimversteck benutzt. Als Mabelle ihm das Vergessene Wort beigebracht hatte, hatte er dort die zusammengefalteten Blätter versteckt, auf denen er seine Buchstaben übte. Nun befand sich dort die Mikrokamera, die er vor zwei Wochen in Mabelles altem Zimmer gefunden hatte. Der Beweis dafür, dass sein Großvater vor siebzehn Jahren die Bombardierung der Kupfermine in Auftrag gegeben hatte.
Sein Herz klopfte schmerzhaft in seiner Brust, als er die Fliese anstarrte.
Was hatte sein Großvater in seinem Zimmer gewollt? Hatte er wirklich nach ihm gesucht? Oder nach etwas anderem?
Langsam und zögerlich ging Marcellus zur Toilette, kniete sich auf den Boden und hob die lose Fliese mit den Fingernägeln an.
Eigentlich brauchte er gar nicht nachzuschauen. Er wusste bereits, was er dort sehen würde.
Nichts.
Dort war nichts.
Die Mikrokamera war fort.
Kapitel 3
CHATINE
Chatine Renard hatte ihr Leben lang gewusst, was Dunkelheit war. Seit dem Moment ihrer Geburt vor achtzehn Jahren hatte sie sie umgeben, an ihr gehaftet wie ein feuchter Umhang. Doch nichts war vergleichbar mit der Finsternis, die zweihundert Mètre unter der Oberfläche des Mondes lauerte. Es war eine Dunkelheit, wie Chatine sie noch nie gesehen hatte. Ein lebendiges, atmendes Wesen. Eine Düsternis, die in ihre Knochen kroch und ihre Lungen verätzte.
Es war die Art von Dunkelheit, die die Toten auferstehen ließ.
Der Androide schloss die Tür des Metallkäfigs mit einem lauten Knall, der in Chatines Wirbelsäule widerhallte. Der Aufzug senkte sich mit einem grauenvollen Quietschen langsam herab. Mit jedem Centimètre klapperten Chatines Zähne heftiger. Nicht wegen der Temperatur. Hier unten war es glücklicherweise wärmer als auf der Mondoberfläche. Doch wenn Chatine seit ihrer Ankunft eins gelernt hatte, dann war es, dass die Kälte nicht das Einzige war, das einen hier zum Schaudern brachte.
Der Aufzug hielt an, und die Tür öffnete sich quietschend. Dahinter tat sich ein Labyrinth aus düsteren Gängen auf, das sich vom Hauptgang in alle Richtungen erstreckte. Zwei weitere Schläger standen Wache. Ihre orangefarbenen Augen blitzten in der Finsternis auf.
Menschliche Wachen trauten sich nicht auf den vermaledeiten Mond. Das Gefängnis war nur mit Androiden besetzt, während irgendein überbezahlter Directeur alles von seinem gemütlichen Büro in Ledôme überwachte.
»Einreihen«, befahl einer der Androiden. »Nach unten schauen. Nicht sprechen. Nicht rennen.«
Chatine hätte beinahe laut geschnaubt. Rennen? Meinte er das ernst? Wohin sollten sie denn laufen? Die zerklüfteten Wände und tief hängenden Decken der Minentunnel zogen sich in Schlangenlinien durch das Gestein unter der Bastille, führten aber nirgendwohin. Sie endeten alle in einem kalten, dunklen Nichts.
Außerdem war Chatine sowieso kaum in der Lage, sich morgens aus ihrem Stockbett zu kämpfen. Ihr Körper hatte sich noch nie so nutzlos angefühlt, so schwer und zerschlagen. Ihr Kopf pochte ständig, ihr Mund war stets staubtrocken, jeder Centimètre ihres Körpers schmerzte, und egal, wie müde sie am Ende ihrer täglichen zwölfstündigen Schicht war, sie konnte nie genug Schlaf bekommen.
Die Häftlinge nannten es die Grippe. Chatine verstand eindeutig, warum. Es fühlte sich so an, als ob sich all ihre Organe, einschließlich ihres Gehirns, im unbarmherzigen Griff eines Schraubstocks befanden. Das kam durch die dünne Luft auf dem Mond. Chatine hatte gehört, dass es bis zu sechs Monate dauern konnte, sich an das neue Klima zu gewöhnen.
Sie war erst seit zwei Wochen hier.
Die Häftlinge stellten sich in einer Reihe auf und schlurften durch den Tunnel. Neben ihnen gingen die Androiden auf und ab, ihre Schritte hallten laut von den Wänden wider, die Rayonettes in ihren Armen funkelten bedrohlich im schwachen Licht. Wie jeden Tag nahm Chatine sich eine Kopflampe und Spitzhacke und folgte ihnen tiefer in die Dunkelheit. Mit jedem Schritt rumpelten die Wände unheilvoll um sie herum.
Chatine hasste das Knirschen und Knacken, das von oben kam und das Gestein zum Beben brachte. Jedes Mal drohten die zweihundert Mètre soliden Steins über ihr einzustürzen. Sie hatte von Gefangenen gehört, die bei Zyttrium-Explosionen ums Leben gekommen waren. Es waren die ersten Geschichten, die man Neuankömmlingen in der Bastille erzählte.
Sie hielt inne, blickte auf und zuckte zusammen, als Staub und losgetretener Schutt auf ihr Gesicht regneten.
»Insassin 51562«, ertönte eine Androidenstimme. »Nach unten schauen und weitergehen.«
Chatine senkte den Blick und schlurfte weiter. Heute schienen sie ewig zu laufen. Es ging tiefer, als Chatine je in die Tunnel vorgedrungen war. Das Licht ihrer Kopflampe erhellte die düsteren Tiefen der Mine nur notdürftig, und je weiter sie sich vom Haupttunnel entfernten, desto finsterer wurde es.
Chatine schob den Ärmel ihrer Insassenuniform hoch und berührte den Bildschirm in ihrem Unterarm. Er leuchtete auf und bot ihr eine weitere dürftige Lichtquelle. Die Télé-Häute konnten in der Bastille nur eingeschränkt benutzt werden. Es gab keine Übertragungen, keine AirLink-Nachrichten, keine offiziellen Kundgebungen, keine Himmelfahrtspunkte oder Marken. Hier auf dem Mond dienten die Häute nur dazu, den Wärtern einen Überblick über die Arbeitszeit und die Häftlinge zu verschaffen. Und Chatine war nun eine von ihnen. Auf Laterre hatte sie die Funktion ihrer Télé-Haut manipuliert, doch das hatten die Androiden bei ihrer Ankunft wieder rückgängig gemacht. Chatine warf manchmal trotzdem noch gern einen Blick auf den kleinen Bildschirm in ihrem Unterarm. Er erinnerte sie daran, warum sie hier war. Warum sie alle hier waren. Das kleine rechteckige Gerät war ihr in den Arm eingepflanzt worden, als sie noch klein gewesen war. Es war der Grund, warum das Régime jedes Jahr Millionen ausgab, um dieses sol-verlassene Gefängnis zu unterhalten.
Sie brauchten die Télé-Häute, um den Dritten État in Schach zu halten.
Und sie brauchten Zyttrium, um die Häute herzustellen.
Die letzten bekannten Zyttrium-Vorkommen im ganzen Système Divin befanden sich auf dem Mond.
Metall blitzte im schwachen Licht auf, und die Prozession der Insassen kam endlich zum Stehen. Vor ihnen erhoben sich riesige Maschinen, die Tunnel ins Gestein gruben und die Wände aufrechterhielten. Sie bewegten sich nicht, lagen dort wie riesige, schlafende Monster.
»Jeder Insasse muss einhundert Gramme Zyttrium ausgraben«, verkündete der Chatine am nächsten stehende Android. Gemurmel setzte unter den Gefangenen ein.
»Einhundert Gramme?!«, rief einer von ihnen. »Das ist doppelt so viel wie gestern.«
»Nicht sprechen!«, drohte der Androide. Seine unheimliche, monotone Stimme hallte von den tief hängenden Decken wider, sodass sie noch weniger menschlich als sonst klang. »Nach unten schauen. Graben.«
Schweigend stellte Chatine sich vor der Tunnelwand auf und ließ ihre Spitzhacke darauf niedersausen. Nach jedem Schlag hielt sie inne und wartete, lauschte, hielt die Luft an. War heute der Tag, an dem die Stimme in ihrem Kopf sie nicht besuchen kommen würde? War sie endlich nicht mehr verrückt?
Chatine wusste nicht, was schlimmer wäre: endgültig den Verstand zu verlieren oder die völlige Stille in ihrem Kopf ertragen zu müssen.
Doch nach dem zehnten Schlag hörte Chatine sie wieder. Sie kroch aus den tiefsten, dunkelsten Winkeln ihres Geistes.
»Brrr! Ist das kalt hier unten. Viel kälter als auf Laterre.«
Chatines Schultern sanken erleichtert herab. Azelle war wieder da. Wenigstens ein weiterer Tag auf dem Mond, den sie nicht ganz allein überstehen musste.
»Wie ist es möglich, dass du noch nicht erfroren bist, Chatine?«, fragte die Stimme.
Chatine antwortete nicht. Sie antwortete der Stimme ihrer toten Schwester nie. Doch genau wie als sie noch gelebt hatte, hielt es Azelle nicht davon ab weiterzureden.
»Hast du gehört? Heute musst du viel mehr als sonst ausgraben. Du wirst ewig hier sein. Wie sollt ihr denn bitte hundert Gramme an einem Tag schaffen?«
Chatine hielt ihre Kopflampe auf den Brocken am Boden, den sie gerade aus der Wand geschlagen hatte. Es war keine Spur des blau glühenden Zyttriums zu entdecken. Sie hatte die anderen Häftlinge über die Knappheit des Bodenschatzes flüstern hören. Sie sprachen darüber, wie sie jede Woche tiefer und tiefer in die Minen mussten und die Karren jeden Abend mit weniger Ausbeute hervorkamen.
»Ich erinnere mich daran, dass das auch in der Télé-Haut-Fabrique ein Problem war«, sagte die tote Azelle. »Es gibt nicht genug Zyttrium, um neue Häute herzustellen. Sie haben versucht, es vor uns geheim zu halten, aber wir sind ja nicht dumm. Wir haben gesehen, dass die Transporteure weniger gebracht haben. Was glaubst du, wie viele der Gefangenen hier sind, weil sie wirklich eine Straftat begangen haben? Wie viele sind nur hier, weil das Ministère mehr Leute zum Graben brauchte?«
Chatine musterte die Insassen im Tunnel und fragte sich, ob Azelle recht hatte. Lag ihrem Aufenthalt hier nicht auch viel mehr als der schwindende Vorrat an Zyttrium zugrunde? Chatine hatte Azelle nie als besonders schlau oder aufmerksam gesehen. Doch wenn sie hier nachts in ihrem kalten, feuchten Gefängnisbett lag, fragte sie sich oft, ob sie ihre Schwester unterschätzt hatte. Vielleicht war Azelle Renard viel mehr gewesen, als Chatine geahnt hatte.
Natürlich würde sie es jetzt nie mehr herausfinden. Alles wegen eines Anschlags auf die Fabrique, in der Azelle gearbeitet hatte.
»Es stinkt ziemlich hier unten«, fuhr Azelle mit ihrem Gebrabbel fort. »Noch viel schlimmer als in den Frets.«
Das brachte Chatine beinahe zum Lächeln. Sie wusste, dass Azelle nicht wirklich mit ihr sprach. Wahrscheinlich war es nur ein weiteres Symptom der Grippe. Ein Symptom, das sie willkommen hieß. Im Gegensatz zu den furchtbaren Kopfschmerzen und Schwindelanfällen. So hörte sie wenigstens etwas anderes als das monotone Hämmern der Spitzhacken und die unheimlichen Echos und Vibrationen, die darauf folgten.
Und es lenkte sie von Henri ab.
Denn die tote Azelle würde sich nie trauen, nach ihm zu fragen.
Ein Geist lenkte sie von dem anderen Geist ab.
»Wird es von jetzt an wohl jeden Tag so sein?«
Chatine hob die Hacke und ließ sie auf die Wand niederfahren. Zu ihren Füßen sammelten sich immer mehr lose Brocken.
»Wie lange müssen wir hier unten sein? Es ist echt dunkel. Ich dachte nicht, dass es so finster sein würde. Kalt, ja. Davon sprechen alle. Aber niemand erwähnt, wie düster es ist.«
Chatine seufzte und schlug abermals zu, während sie sich von Azelles Geplapper einlullen ließ.
»Äh, Verzeihung. Hörst du mich? Oder ignorierst du mich nur? Ich werde ziemlich oft ignoriert.«
Chatine hielt mitten in der Bewegung inne, die Hacke über dem Kopf erhoben. Sie sah nach rechts, wo ihr ein mageres Mädchen in einem viel zu großen Minenmantel eifrig zuwinkte, um ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Wie lang hatte sie schon mit Chatine gesprochen? Sie hörte sich genau wie Azelle an.
»Ich weiß, dass wir uns nicht unterhalten dürfen«, fuhr das Mädchen mit gesenkter Stimme fort.
»Du hast recht«, fuhr Chatine sie an und warf einen vorsichtigen Blick über die Schulter, um nach Androiden Ausschau zu halten. »Dürfen wir nicht.«
»Aber ich werde langsam echt verrückt«, sagte das Mädchen. Sie schüttelte den Kopf. Ihr Helm war ihr ebenfalls viel zu groß, sodass er hin und her schwankte und ihre Kopflampe gefährlich wackelte. »Niemand spricht mit mir. Es ist mein erster Tag, und keiner hat auch nur ein einziges Wort zu mir gesagt.«
Chatine seufzte wieder. Natürlich hatte sie das Glück, neben einem Plappermaul arbeiten zu müssen.
»Und warum sind alle hier so fies?«, fragte das Mädchen.
»Sind sie nicht«, flüsterte Chatine barsch. »Sie sind müde und gereizt. Und sie wollen nicht abgeknallt werden, weil sie sich unterhalten haben.«
»Ich heiße Anaïs«, fuhr das Mädchen ungerührt fort. Offenbar hatte sie Chatines Worte als Einladung aufgefasst, weiterzuplappern. »Und du?«
Chatine antwortete nicht. Vielleicht würde das Mädchen irgendwann aufgeben, wenn sie sie ignorierte.
»Kommst du aus Vallonay?«
Chatine grub weiter.