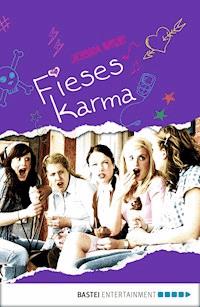6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Rebellion der Sterne
- Sprache: Deutsch
Drei junge Menschen – ein Planet im Chaos einer blutigen Revolution – ein gemeinsames Schicksal: »Die Rebellion von Laterre« von Jessica Brody ist eine atemraubende Mischung aus Liebes-Geschichte und Science Fiction mit Figuren, die dich noch lange begleiten werden. Vor 500 Jahren versprach der Planet Laterre der Menschheit Hoffnung. Doch heute verhungern die Armen in den Straßen, während Wolken die Sterne verbergen und die herrschende Elite jedes Aufbegehren rigoros bestraft. Die Revolution wird sich dennoch nicht aufhalten lassen. Und alles wird von drei jungen Menschen abhängen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Chatine ist eine Diebin, ein Kind der Straße, die alles tun würde, um dem brutalen Regime zu entkommen – einschließlich des Ausspionierens von Marcellus, dem Enkel des mächtigsten Mannes der Welt. Marcellus wird von seinem Großvater darauf vorbereitet, die Macht zu übernehmen. Doch seit dem Tod seines Vaters, der als Verräter starb, plagen Marcellus immer stärkere Zweifel. Denn sein Vater hat eine kryptische Nachricht hinterlassen, die nur eine Person lesen kann: ein Mädchen namens Alouette. Alouette ist in einer unterirdischen Zuflucht aufgewachsen, wo sie die letzte Bibliothek der Welt bewacht. Und sie hütet ein Geheimnis, das Laterre endgültig ins Chaos der Revolution stürzen wird. Als das Schicksal Chatine, Marcellus und Alouette zusammenführt, ist nur eines gewiss: Die Zukunft von Laterre wird von ihren Entscheidungen abhängen, und davon, was sie zu opfern bereit sind: Liebe – oder Freiheit?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 787
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jessica Brody / Joanne Rendell
Die Rebellion von Laterre
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Carina Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vor 500 Jahren versprach der Planet Laterre der Menschheit Hoffnung. Doch heute verhungern die Armen in den Straßen, während Wolken die Sterne verbergen und die herrschende Elite jedes Aufbegehren rigoros bestraft. Die Revolution wird sich dennoch nicht aufhalten lassen. Und alles wird von drei jungen Menschen abhängen, die unterschiedlicher nicht sein könnten:
Chatine ist eine Diebin, ein Kind der Straße, die alles tun würde, um dem brutalen Regime zu entkommen – einschließlich des Ausspionierens von Marcellus, dem Enkel des mächtigsten Mannes der Welt.
Marcellus wird von seinem Großvater darauf vorbereitet, die Macht zu übernehmen. Doch seit dem Tod seines Vaters, der als Verräter starb, plagen Marcellus immer stärkere Zweifel. Denn sein Vater hat eine kryptische Nachricht hinterlassen, die nur eine Person lesen kann: ein Mädchen namens Alouette.
Alouette ist in einer unterirdischen Zuflucht aufgewachsen, wo sie die letzte Bibliothek der Welt bewacht. Und sie hütet ein Geheimnis, das Laterre endgültig ins Chaos der Revolution stürzen wird.
Als das Schicksal Chatine, Marcellus und Alouette zusammenführt, ist nur eines gewiss: Die Zukunft von Laterre wird von ihren Entscheidungen abhängen, und davon, was sie zu opfern bereit sind: Liebe – oder Freiheit?
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil 2
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil 3
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Teil 4
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Teil 5
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Teil 6
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Danksagung
Für unsere drei Sols –
Benny, Brad und Charlie
»L’homme est né libre, et partout il est dans les fers.«
(»Der Mensch wird frei geboren, und überall liegt er in Ketten.«)– Jean-Jacques Rousseau
Teil 1
Himmelfahrt
Das Système Divin bot Hoffnung. Hoffnung für die Bewohner einer sterbenden Welt. Mit seinen drei wunderschönen Sols und zwölf bewohnbaren Planeten würde das wundersame Sol-System zu ihrem neuen Zuhause werden. Ein Neuanfang. Ein Ort, an dem zwölf mächtige Familien ein neues Leben beginnen konnten. Die Familie Paresse war eine dieser Familien, und Laterre war ihr neuer Planet.
Hoch oben auf einem Hügel baute die Familie ihren Grand Palais unter einer riesigen Kuppel, die das Klima im Inneren regulierte. Im Flachland am Fuße des Hügels lebten die von ihnen ausgewählten Menschen. Die prächtigen Schiffe, die diese Arbeiter einst durch die Galaxien hergebracht hatten, wurden zu ihren Behausungen.
Sie hatten Glück.
Zumindest am Anfang.
Aus den Chroniken des Schwesternordens, Band 1, Kapitel 3
Kapitel 1
CHATINE
In der Marsch regnete es seitwärts. Die Tropfen fielen hier nie gerade vom Himmel. Immer nur schief. So krumm und schief und korrupt wie die Leute hier. Schwindler und Betrüger und Crocs allesamt.
Jeder kann ein Heiliger sein, bis er zu hungrig dafür wird.
Chatine Renard hockte hoch über alledem und beobachtete den Menschenstrom, der sich langsam über den gut besuchten Marktplatz ergoss wie geronnenes Blut durch eine Vene. Sie saß rittlings auf einem hervorstehenden Metallbalken, der einst das Dach des alten Frachtschiffs gestützt hatte.
Das hatte man Chatine zumindest erzählt – dass die Frets einst gigantische fliegende Schiffe gewesen waren, die durch die Galaxie geglitten waren, um ihre Vorfahren nach Laterre zu bringen, dem kältesten und feuchtesten der zwölf Planeten des Système Divin. Doch Jahre der Vernachlässigung und des schief fallenden Regens hatten die aus Perma-Stahl bestehenden Wände und Decken zerfressen und aus den Passagierschiffen leckende, schimmelnde Behausungen für die Armen gemacht. Und dieses Frachtschiff war zu einer dachlosen Markthalle geworden.
Chatine zog sich ihre Kapuze tiefer ins Gesicht, in dem Versuch, ihr Gesicht zu verbergen. In den letzten paar Jahren hatte sie bestürzt festgestellt, dass ihre Wimpern länger und ihre Brüste voller geworden waren. Ihre Wangenknochen waren markanter und ihre Nase schmaler und spitzer geworden, was ihr sehr missfiel.
Sie hatte sich Schlamm ins Gesicht geschmiert, bevor sie heute in die Marsch gekommen war. Doch jedes Mal, wenn sie in einer Pfütze oder dem Metall einer halb in sich zusammengefallenen Wand einen Blick auf ihr Spiegelbild erhaschte, zuckte sie zusammen, da sie trotzdem noch viel zu sehr wie ein Mädchen aussah.
So lästig.
In der Marsch war heute viel mehr los als sonst. Chatine beugte sich vor und legte sich flach auf den Bauch. Mit den Armen umklammerte sie den Balken und beobachtete die unzähligen Gesichter, die unter ihr vorbeizogen. Es waren immer dieselben. Arme, geknechtete Seelen wie sie, die auf kreative Art versuchten, sich ein bisschen zu ihrem wöchentlichen Lohn dazuzuverdienen. Oder ihre Nachbarn um einen oder zwei Larg zu erleichtern.
Neuankömmlinge gab es selten in der Marsch. Niemanden, der nicht zum Dritten État gehörte, interessierten die zerrupften Kohlköpfe und schäbigen Steckrüben, die hier zum Verkauf angeboten wurden. Außer natürlich Inspecteur Limier und seine Armee von Policier-Androiden, deren Aufgabe es war, die öffentliche Ordnung zu wahren. Ansonsten wurden die Frets und der Marktplatz in ihrem Zentrum um jeden Preis von allen gemieden, die nicht hier lebten.
Deshalb erregte der Mann im langen Mantel auch sofort Chatines Aufmerksamkeit. Sein Reichtum stand ihm geradezu ins Gesicht geschrieben: ein gut gepflegter schwarzer Bart, dunkles Haar, gebügelte Kleidung und funkelnder Schmuck.
Ganz sicher Zweiter État.
Chatine hatte noch nie jemanden aus dem Ersten État außerhalb von Ledôme gesehen. Die Biokuppel, deren Klima im Inneren reguliert wurde, stand hoch oben auf dem Hügel außerhalb der Hauptstadt Vallonay und schirmte den Ersten État von Laterres unaufhörlichem Regen ab.
Und von den Elendsvierteln am Fuße des Hügels.
Chatine musterte den Mann eingehend, nahm Notiz von jeder Naht und jedem Knopf. Ihr geschulter Blick blieb an dem goldenen Medaillon hängen, das wie ein Köder von seinem Hals baumelte. Sie musste nicht näher herangehen, um zu erkennen, dass es ein Relikt aus den Letzten Tagen war, das jemand aus den schwelenden Überresten eines sterbenden Planeten gerettet hatte. Die Mitglieder des Zweiten États liebten Überbleibsel aus der Ersten Welt.
Mindestens zweihundert Larg, überschlug Chatine im Kopf. Genug Geld, um eine ganze Familie aus dem Dritten État wochenlang zu ernähren.
Aber es würde nicht lange dauern, bis die anderen Crocs in der Marsch den Schatz ebenfalls entdeckt hatten und handeln würden. Chatine musste schneller sein.
Sie packte den Metallbalken mit beiden Händen, schwang ihre Beine über eine Seite, stieß sich ab und landete lautlos in Hockstellung auf dem Gittersteg unter ihr. Sie befand sich nun direkt über dem Mann, der weiter auf den Marktplatz vordrang und dabei den Hühnern auswich, die auf der Suche nach Essensresten zwischen den Ständen umherstreiften. Sein Blick wanderte von rechts nach links, als ob er sich ein möglichst genaues Bild von seiner Umgebung machen wollte.
Einen Moment lang fragte sich Chatine, was er wohl hier zu suchen hatte. Hatte er sich auf seinem Rückweg nach Ledôme verlaufen? Oder war er hier, um irgendwelche krummen Geschäfte abzuschließen?
Doch dann erinnerte sie sich, dass heute Himmelfahrtstag war. Er war sicher nur ein Aufseher irgendeiner Fabrique, gekommen, um seine Arbeiter zusammenzutreiben, die blaumachten und sich in der Hoffnung, bei der heutigen Himmelfahrt ein neues Leben zu gewinnen, mit Krautwein betranken.
»Ein neues Leben gewinnen?«, murmelte Chatine und lachte bitter auf.
Leichtgläubige Idioten allesamt.
Sie schlich über die gitterförmig angelegten Fußwege und Rampen über den Köpfen der Passanten, duckte sich geschickt unter kaputten Wasserrohren hindurch und sprang über breite Spalten im zerkratzten Gitterboden. Währenddessen ließ sie den Mann nicht aus den Augen, darauf bedacht, nie weiter als ein paar Schritte hinter ihm zurückzubleiben.
Endlich verlangsamte er seine Schritte vor Madame Dufours Marktstand, nahm eine Aprikose aus seiner Tasche und biss so herzhaft hinein, dass ihm der Fruchtsaft in den Bart tropfte. Chatine lief das Wasser im Mund zusammen. Sie hatte erst ein Mal in ihrem Leben eine Aprikose probiert, als eine Kiste von einem Transporteur gefallen war, der Obst von den Treibhäusern nach Ledôme brachte.
Chatine beobachtete, wie Madame Dufour den Mann mit unheilvoller Faszination von Kopf bis Fuß musterte. Die alte Croc leckte sich förmlich die Lippen, angesichts einer dermaßen leichten Beute.
Jetzt oder nie.
Chatine duckte sich unter dem kaputten Geländer hindurch, stieß sich mit beiden Händen am Rande des Stegs ab und machte einen Salto über den Rand.
Ihr Körper schnellte vor, sie fiel drei Mètre und bekam geschickt den Balken unter ihr zu fassen. Sie stemmte sich daran hoch, bis ihre Hüften gegen den Balken drückten und sie ihre Balance gefunden hatte.
Jetzt befand sie sich nur noch einen Mètre über dem Kopf des Mannes. Dank des geschäftigen Treibens auf dem Marktplatz hatte niemand sich die Mühe gemacht, nach oben zu schauen.
»Was für ein bemitleidenswerter Anblick«, sagte der Mann und biss noch einmal in seine Aprikose. Er versuchte noch nicht einmal, seine Abscheu zu verbergen. Das taten Leute aus dem Zweiten État so gut wie nie. Chatine hatte immer geglaubt, dass es wohl daran lag, dass sie in der Mitte feststeckten – sie gehörten nicht wirklich zur herrschenden Klasse, zählten aber auch nicht zu den elendigen Verlierern ihrer eigenen. Das war der Grund für die schamlose Arroganz des Zweiten États. Sie waren fast noch unausstehlicher als der Erste État.
Fast.
Chatine sah nach links und begutachtete die leeren Kisten, die neben Madame Dufours Stand hoch aufgestapelt standen. Sie robbte den Balken entlang, bis sie sich direkt darüber befand. Dann beugte sie sich vor, drehte sich kopfüber einmal um den Balken und sprang mit den Füßen voran nach unten.
Der Aufprall war lauter als erwartet. Die Kisten polterten zu Boden und trafen auch den Mann, der ächzend auf die Knie fiel.
Chatine reagierte schnell. Sie landete in Hockstellung und krabbelte rasch durch das Chaos, bis sie den Mann erreichte und ihn hilfsbereit auf die Füße zog. Er war so damit beschäftigt, sich Staub und Kohlblätter vom Mantel zu klopfen, dass er gar nicht bemerkte, wie sie ihm das Medaillon vom Hals stahl.
»Geht es Ihnen gut, Monsieur?«, fragte Chatine in ihrem freundlichsten Tonfall, während sie die Halskette in ihrer Tasche verschwinden ließ.
Der Mann würdigte sie kaum eines Blickes, während er seinen Hut zurechtrückte. »Es geht mir gut, Junge.«
»Sie müssen vorsichtig sein in der Marsch, Monsieur. Es ist hier nicht sicher für jemanden Ihres Standes.«
»Merci«, sagte er geringschätzig und warf Chatine die Aprikose zu, die er kurz zuvor noch gegessen hatte.
Sie fing sie auf und lächelte ihm dankbar zu. »Vive Laterre.«
»Vive Laterre«, antwortete er, bevor er sich abwandte.
Chatine grinste den Rücken des Mannes an, drehte sich auf dem Absatz um und steckte die halb aufgegessene Aprikose in ihre Tasche. Sie musste ihre ganze Willenskraft aufbringen, um die Frucht nicht augenblicklich zu verschlingen.
Sie wusste, dass der Mann das Medaillon wohl kaum vermissen würde. Er hatte sicher zehn ähnliche Schmuckstücke in seinem Anwesen in Ledôme. Aber ihr bedeutete es alles.
Es würde alles verändern.
Der Wind frischte auf, fuhr heulend zwischen den Ständen hindurch und stach in Chatines Haut. Sie zog ihren zerlumpten schwarzen Mantel enger um sich und versuchte vergeblich, sich gegen die Kälte zu schützen. Aber die Löcher und aufgetrennten Nähte ihrer Kleidung waren nicht das Problem. Es war ihr Hunger, die Rippen, die durch ihre Haut stachen. Ihr geschwächter Körper konnte sich nicht mehr selbst warm halten.
Doch nach der fetten Beute, die sie gerade gemacht hatte, machte ihr das nicht mehr allzu viel aus.
Während Chatine sich auf den Südausgang der Marsch zubewegte, sich zwischen den Ständen hindurchschlängelte, an denen verschimmelte Kartoffeln, schleimiger Lauch und stinkender Seetang von den Docks verkauft wurden, schienen ihre Schritte leichter als sonst.
Ihr Gang war hoffnungsvoller.
Doch kurz bevor sie über die Rampe ging, die einmal die Ladezone des alten Frachtschiffs gewesen war, spürte Chatine, wie sich eine Hand schwer auf ihre Schulter legte. Sie hielt abrupt an und schauderte.
»Wie nett von dir, einem Mitglied des Zweiten États zu Hilfe zu eilen«, sagte eine kalte, roboterartige Stimme. »So eine ritterliche Geste habe ich noch nie von einem Renard gesehen.«
Die Art, wie er ihren Nachnamen betonte, ließ Chatine zusammenzucken.
Sie schloss die Augen, nahm all ihren Mut zusammen und setzte ein unbekümmertes Lächeln auf, bevor sie sich zu ihm umdrehte.
»Inspecteur Limier«, sagte sie. »Eine Freude, wie immer.«
Seine steinerne Miene veränderte sich nicht. Das tat sie nie. Durch die schaltungstechnischen Implantate in seiner linken Gesichtshälfte war es dem Inspecteur so gut wie unmöglich, Emotionen zu zeigen. Chatine fragte sich oft, ob der Mann überhaupt lächeln konnte.
»Ich wünschte, ich könnte dasselbe von dir behaupten, Théo.« Sein Tonfall war vollkommen emotionslos.
Nur ihre Eltern nannten sie Chatine. Alle in den Frets kannten sie unter dem Namen Théo. Sie selbst hatte sich vor zehn Jahren so genannt, als sie in die Hauptstadt Vallonay gezogen waren und Chatine entschieden hatte, dass das Leben eines Jungen viel unkomplizierter war als das eines Mädchens.
Chatine schnalzte mit der Zunge. »Tut mir leid, dass Sie so über mich denken, Inspecteur.«
»Was hast du dem freundlichen Monsieur gestohlen?«, fragte Limier. Seine halb menschliche, halb roboterartige Stimme klickte bei jedem harten Konsonanten.
Chatine lächelte erneut. »Was meinen Sie bloß, Inspecteur? Ich bin doch nicht so dumm, in die Hand zu beißen, die mich füttert.«
Die Worte blieben ihr beinahe im Hals stecken. Aber wenn sie sie davor bewahrten, auf die Bastille abgeschoben zu werden – die Strafe für das Verbrechen, ein Mitglied der oberen Klassen zu beklauen –, dann würde sie sie ausspucken.
Chatine hielt die Luft an, als etwas in der linken Gesichtshälfte des Inspecteurs aufleuchtete. Er verarbeitete die Information, analysierte ihre Worte, suchte nach Hinweisen auf eine Lüge. In den letzten zehn Jahren, die sie in den Frets verbracht hatte, hatte Chatine zu lügen gelernt. Aber es war eine Sache, einen Menschen zu belügen. Einen Cyborg zu belügen, noch dazu einen Inspecteur, der darauf programmiert war, die Wahrheit aufzudecken, war eine ganz andere.
Sie wartete, hielt ihr falsches Lächeln aufrecht, bis das Licht zu leuchten aufhörte.
»Ist das alles, Inspecteur?«, fragte Chatine mit einem unschuldigen Lächeln, während sie ihre Handflächen gegen ihre zerlumpte schwarze Hose presste. Sie hatten zu schwitzen begonnen und wollte nicht, dass seine Sensoren es registrierten.
Sie verfolgte, wie der Inspecteur langsam eine behandschuhte Hand nach ihr ausstreckte. Mit einer sanften Bewegung, die sie bis ins Mark erschütterte, zog er ihre Kapuze zurück, um mehr von ihrem Gesicht freizulegen. Sein elektronisches, orangefarbenes Auge blinkte, während er ihre Gesichtszüge scannte. Sein Blick schien ein wenig zu lange an ihren hohen, femininen Wangenknochen hängen zu bleiben.
Panik stieg in ihr auf. Kann er sehen, wer ich wirklich bin?
Chatine trat hastig einen Schritt zurück, um seiner Reichweite zu entkommen, und zog sich ihre Kapuze wieder ins Gesicht.
»Meine Maman wartet zu Hause auf mich«, sagte sie. »Also, wenn es Ihnen nichts ausmacht, gehe ich jetzt.«
»Selbstverständlich«, antwortete der Inspecteur.
»Danke, Inspecteur. Vive Laterre.«
Als Chatine herumfuhr, fühlte es sich so an, als ob ihr ganzer Körper vor Erleichterung in sich zusammensackte. Sie hatte es geschafft. Sie hatte die Sensoren überlistet. Sie war eine bessere Lügnerin, als sie geglaubt hatte.
»Ich muss nur noch deine Taschen durchsuchen.«
Chatine gefror mitten in der Bewegung. Sie erfasste rasch ihre Umgebung. Sie entdeckte fünf Policier-Androiden in unmittelbarer Nähe. Es waren mehr als sonst, da heute die alljährliche Himmelfahrtszeremonie stattfand. Die Androiden – oder Schläger, wie sie hier genannt wurden – waren fast doppelt so groß wie ein normaler Mensch, und ihre schiefergrauen Exoskelette klickten und surrten bei jeder Bewegung.
Aber Chatine hatte keine Angst vor ihnen. Sie war Policier-Androiden schon viele Male entkommen. Sie waren schnell und stärker als zehn Männer, aber sie hatten auch ihre Grenzen. Zum Beispiel konnten sie nicht klettern.
Vorsichtig wagte Chatine einen Blick nach oben, ohne ihren Kopf zu heben, und dankte den Sols, als sie direkt über sich ein altes Rohr ausmachte.
Auf keinen Fall würde sie sich auf die Bastille verschiffen lassen. Einer ihrer Nachbarn musste dort gerade drei Jahre absitzen, weil er einen schäbigen Sack Steckrüben geklaut hatte. Für den Diebstahl eines Relikts aus der Ersten Welt, noch dazu von einem Mitglied des Zweiten États, würde sie mindestens zehn Jahre bekommen. Und so lange überlebte fast niemand auf dem Mond.
Langsam drehte sie sich zu Limier um. »Natürlich, Inspecteur. Ich habe nichts zu verbergen.« Chatine lächelte erneut, steckte die Hand in ihre Tasche und spürte das Medaillon kühl und glatt an ihrer Haut. Der Inspecteur streckte einmal mehr eine Hand nach ihr aus. Bevor er reagieren konnte, warf Chatine ihm die Aprikose, die der Monsieur ihr geschenkt hatte, direkt ins Gesicht. Seine Implantate blinkten auf, während sein Gehirn versuchte, das heranfliegende Objekt einzuordnen. Chatine rannte los, kletterte auf einen Tisch voll Fabriqueschrott und sprang von dort aus auf das Rohr zu.
Eine Sekunde lang flog sie hoch über dem Inspecteur, den Einkäufern in der Marsch und den Policier-Androiden. Letztere wurden gerade erst auf die Unruhe aufmerksam, die sie stiftete. Als ihre Hände sich um das Rohr schlossen, nutzte sie ihren Schwung, um beide Beine um die rostige Metallstange zu schlingen.
»Paralysiert ihn!«, rief Inspecteur Limier seinen Androiden zu. Sein Blick verfolgte jede ihrer Bewegungen, seine Implantate waren außer Rand und Band, als ob jemand ihn gehackt hätte. »Sofort!«
Die Schläger bewegten ihre massigen Perma-Stahlkörper schwerfällig in Angriffsformation. Chatine wusste, dass sie jetzt schnell sein musste. Einem einzigen Rayonette-Strahl konnte sie ausweichen, aber fünfen? Das würde schwierig werden.
Das Rohr war zu schmal, um darauf zu laufen, also robbte Chatine auf dem Bauch voran, während sie ihre Möglichkeiten abwog. Der Nordausgang kam nicht infrage. Er führte zur Policier-Station von Vallonay, wo sie sicher auf noch mehr Androiden treffen würde. Sie entdeckte einen Gittersteg, etwa drei Mètre von ihr entfernt. Wenn sie ihn erreichte, ohne getroffen zu werden, konnte sie den restlichen Weg bis zum Ostausgang krabbeln, zurück in Richtung von Madame Dufours Stand.
Einen Sekundenbruchteil später spürte sie den ersten Rayonette-Strahl knapp an ihrem Gesicht vorbeizischen. Chatine keuchte auf und robbte schneller. Ein zweiter Androide zielte direkt auf ihr linkes Knie, und sie bereitete sich auf den Schmerz vor. Doch genau im selben Moment stolperte eine Gruppe betrunkener Minenarbeiter mitten unter die Androiden. Sie diskutierten lautstark darüber, wer von ihnen die meisten Himmelfahrtspunkte gesammelt hatte. Einer von ihnen lief mitten in den Androiden hinein, sodass der Strahl knapp Chatines Bein verfehlte.
»Oh, entschuldigen Sie, Monsieur«, lallte der betrunkene Arbeiter und verbeugte sich feierlich vor dem Androiden. Seine Freunde brachen in schallendes Gelächter aus, während Chatine die Chance nutzte und bis zum Ende des Rohrs robbte.
Dank den Sols für starken Krautwein, dachte sie, als sie auf den Steg zusprang. Sie bekam das Geländer gerade mit beiden Händen zu fassen, als ein dritter Rayonette-Strahl von unten abgeschossen wurde. Er streifte ihre linke Schulter.
Der Strahl hatte sie nicht direkt getroffen, doch es reichte. Der Schmerz setzte augenblicklich ein. Es war, als ob jemand mit einem brennend heißen Messer in ihre Haut schnitte. Chatine biss sich auf die Lippe, um nicht aufzuschreien. Der Schrei würde den Androiden nur das Zielen erleichtern.
Wenige Sekunden später spürte sie ihren linken Arm bereits nicht mehr, da der Paralyseur sich durch ihr Blut verteilte. Sie versuchte, ihre Füße über den Rand des Stegs zu schwingen, schaffte es aber nicht. Nun hing sie dort und trat mit den Füßen erfolglos in die Luft.
Die Androiden schubsten Leute aus dem Weg, während sie Chatine immer näher kamen. Mehr Rayonette-Strahlen schossen durch die Luft auf sie zu. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder getroffen würde.
Chatine wusste, dass sie eine Ablenkung brauchte. Direkt vor sich entdeckte sie eine Kiste mit Hühnern. Sie schüttelte ihren linken Arm, um das Gefühl zurückzuholen, das nun langsam, aber sicher auch aus ihren Fingern wich, aber es nützte nichts. Der Paralyseur arbeitete sich schnell durch ihre Muskeln.
Sie verließ sich auf ihre rechte Hand und umklammerte das Geländer, so fest sie konnte. Dann holte sie mit ihren Beinen aus, bis sie genug Schwung hatte, um die Kiste zu erreichen, bog ihren Körper ein letztes Mal so weit wie möglich zurück und trat schwungvoll zu. Die Kiste fiel zu Boden und sprang auf. Die Hühner gackerten und versuchten davonzufliegen, doch mit ihren nutzlosen Flügeln schafften sie es noch nicht einmal, vom Boden abzuheben.
Das Chaos reichte allerdings aus.
Leute schrien durcheinander, der Standbesitzer versuchte verzweifelt, die entkommenen Vögel einzufangen, und die Policier-Androiden kämpften gegen den allgemeinen Aufruhr an. Doch dadurch wurden die Hühner nur noch aufgebrachter. Sie flatterten herum und kratzten die Leute mit ihren scharfen Krallen.
Die Androiden begannen, ziellos umherzuschießen, und trafen dabei mehr Hühner als alles andere. Die getroffenen Vögel fielen reglos zu Boden. Sie würden sich einige Stunden lang nicht bewegen können.
Während die Androiden beschäftigt waren, gelang es Chatine endlich, sich auf den Steg zu ziehen und einhändig über das rostige Metall zu krabbeln, bevor sie einen Metallbalken neben Madame Dufours Stand hinabrutschte.
Sie warf einen Blick zurück und sah, dass die Schläger immer noch dabei waren, sich einen Weg durch die Menge in ihre Richtung zu bahnen. Doch durch die vielen Leute, die sich heute in der Marsch aufhielten, und die wild gewordenen Hühner war das keine leichte Aufgabe.
Madame Dufour funkelte Chatine an, ihre faltigen Arme hatte sie vor der Brust verschränkt.
»Wie der Vater, so der Sohn«, sagte sie und schnalzte mit der Zunge. »Denk an meine Worte, Junge. Du wirst noch vor Ende des Jahres auf dem Mond landen.«
Chatine schenkte ihr ein breites Grinsen, bevor sie sich einen Laib Kohlbrot aus einer von Madame Dufours Kisten schnappte und in Richtung des Ausgangs davoneilte.
»Arrête!« Der Befehl der alten Frau hörte sich wie ein Krächzen an. »Komm zurück, du elendiger Croc!«
»Danke für das Frühstück!«, flötete Chatine.
Und dann, bevor die Androiden sie aufspüren oder Madame Dufour sie packen konnte, war Chatine verschwunden.
Sobald sie eine ordentliche Distanz zwischen sich und den Marktplatz gebracht hatte, drosselte sie ihr Tempo und massierte sich den tauben Arm mit der unversehrten Hand. Es war nicht das erste Mal, dass ein Rayonette-Strahl sie getroffen hatte. Und es würde sicher nicht das letzte Mal gewesen sein. Das Gefühl würde schon bald in ihren Arm zurückkehren.
Chatine griff in ihre Tasche und zog das Medaillon hervor, das sie dem Monsieur aus dem Zweiten État gestohlen hatte. Sie leckte den süßen Aprikosensaft ab und legte den Anhänger dann auf ihre offene Handfläche, um ihn zu begutachten. Zum ersten Mal fiel ihr die reich verzierte, goldene Sol auf, die auf der Oberfläche prangte. Sie sah ganz anders aus als die drei Sols, die im Himmel über dem Système Divin thronten. Dies war eine Sol der Ersten Welt. Ihre leuchtenden, feurigen Strahlen breiteten sich bis zum Rand des Medaillons aus. Chatine legte sich die Kette ehrfürchtig um den Hals und lächelte so breit, wie sie es selten tat.
Seit neun Jahren hatte sie kein Sol-Licht mehr gesehen.
Es war ganz sicher ein Zeichen dafür, dass bald etwas Gutes geschehen würde.
Kapitel 2
CHATINE
Als Chatine den muffigen, kalten Gang entlangging, der zur Couchette ihrer Familie führte, drangen all die vertrauten Geräusche der Frets auf sie ein: Leute, die sich um Essensreste zankten, Kinderfüße, die über den zerkratzten Metallboden tapsten, während sie Verstecken oder Crocs und Schläger spielten, das sporadische Glucken eines Huhns, das sich zu weit von der Marsch entfernt und verlaufen hatte.
Chatine nannte diesen Gang im achten Stock von Fret 7 den »Flur ohne Ausweg«. Zum einen, weil sie jedes Mal, wenn sie unter seiner tief hängenden, rostigen Decke entlangging, daran erinnert wurde, wie eingesperrt und ohne jeden Ausweg alle Bewohner hier waren. Aber hauptsächlich wegen der unzähligen verrosteten Schilder an den Wänden, auf denen »Kein Ausgang« stand.
Zumindest nahm Chatine an, dass das auf den Schildern stand. In Wirklichkeit hatte sie keine Ahnung. Sie konnte sie nicht lesen. Niemand konnte das. Auf ihnen stand das Vergessene Wort. Ein kryptischer Code aus schrägen Strichen und Schlangenlinien, den die Laterrianer langsam, aber stetig vergessen hatten, nachdem die Siedler aus der Ersten Welt hier angekommen waren.
Ebenso wie sie ihre Hoffnungen auf ein besseres Leben vergessen hatten.
Chatine verlangsamte ihre Schritte, steckte eine widerspenstige Strähne ihres hellbraunen Haars zurück unter ihre Kapuze und zog den Laib Kohlbrot aus ihrer Tasche, den sie Madame Dufour gestohlen hatte. Sie brach ihn in zwei Teile und stopfte eine Hälfte sofort in ihren Stiefel, damit sie bloß nicht in Versuchung kam, sie zu essen.
Sie hätte ihren Eltern einfach erzählen können, dass sie heute kein Glück in der Marsch gehabt hatte. Aber Chatine wusste, dass sie sie mit irgendetwas ablenken musste, wenn sie ihr anderes Diebesgut – das Medaillon aus der Ersten Welt – geheim halten wollte. Ihre Mutter würde ihr niemals glauben, dass sie mit leeren Händen aus der Marsch zurückgekehrt war. Wenn Chatine nichts vorzuweisen hätte, würde sie sofort misstrauisch werden. Und wenn Chatines Mutter misstrauisch war, würde ihr Vater anfangen, herumzuschnüffeln. Und nichts Gutes kam je von seiner Schnüffelei.
Chatine starrte auf die armselige Brothälfte in ihrer Hand, und ihr Magen grummelte lautstark. Sie biss ein Stück ab und zwang sich, langsam zu kauen, um mehr davon zu haben. Doch ihr Hunger übernahm schnell die Oberhand. Sie schluckte das halb gekaute Stück herunter, spürte, wie der eklige Blumenkohlteig ihre Kehle hinabglitt, und hob das Brot sofort wieder an die Lippen.
Doch bevor sie ihre Zähne in die harte Kruste des Brots schlagen konnte, ertönte ein schrilles Weinen im dunklen Korridor. Chatine sah auf und entdeckte eine Frau, die auf dem Boden vor einer der Couchettes saß und vergeblich versuchte, ein Baby an ihrer Brust trinken zu lassen. Der Säugling wand sich und stieß einen weiteren schrillen Schrei aus, der durch Chatine hindurchfuhr wie ein stumpfes Messer durch fades, verkochtes Fleisch.
Würde sie jemals ein Baby weinen hören können und sich nicht so fühlen, als ob jemand sie von innen aufriss?
Sie versuchte, das Geräusch auszublenden, doch je mehr sie es versuchte, desto lauter schien das Baby zu schreien.
»Argh!«, stöhnte Chatine. »Kannst du es nicht beruhigen?«
Sie erwartete, dass die Frau zurückkeifen würde. So lief es nun einmal in den Frets. Wut sprang hier von einem Flur zum anderen wie ein Licht, das von endlos vielen Spiegeln reflektiert wurde.
Doch die Frau tat es nicht. Sie blickte Chatine aus dunklen, hoffnungslosen Augen an und begann zu weinen.
»Tut mir leid«, schluchzte sie und vergrub ihr Gesicht in dem schwarzen Flaum auf dem Kopf des Babys. »Er trinkt nicht, weil es nichts mehr gibt. Meine Milch ist versiegt. Mein Körper ist einfach zu hungrig.«
Vor Scham wurden Chatines Wangen heiß. Sie drehte der Frau und ihrem Kind den Rücken zu, machte sich bereit zur Flucht. Sie hätte einen anderen Weg zu ihrer Couchette einschlagen können, sodass sie nicht an ihnen vorbeimusste. Doch ihre Beine rührten sich nicht. Es war, als ob sich der Paralyseur irgendwie von ihrer Schulter in ihrem ganzen Körper ausgebreitet hätte, bis in ihre Füße.
»Mein Mann arbeitet auf der Kartoffelplantage«, erklärte die Frau schniefend. »Er verdient gut, aber er ist verletzt. Meine Marken aus der Fabrique sind einfach nicht genug.«
Die angebissene Brothälfte lag schwer in Chatines Hand. Sie starrte darauf.
Gestohlen.
Weil sie ebenfalls am Verhungern war.
Denn diese Frau war der Beweis, dass man selbst dann verhungerte, wenn man nach den Regeln spielte.
Und das Baby schrie immer noch.
Mit einem frustrierten Knurren fuhr Chatine herum und ging auf die Mutter und ihr Kind zu. Sie hielt nicht vor ihnen an. Sie warf der Frau einfach das Kohlbrot zu und ging weiter.
Chatine hörte, wie die Frau ihr nachrief. »Oh, merci! Merci, chérie! Du wurdest von den Sols geschickt!«
Doch Chatine hielt nicht an. Stattdessen beschleunigte sie ihre Schritte, bis sie schließlich rannte. Die Schreie des hungrigen Babys verfolgten sie den Gang entlang, jagten sie, erinnerten sie viel zu sehr an die Vergangenheit, der sie seit zwölf Jahren zu entkommen versuchte.
Chatine hörte nicht auf zu rennen, bevor sie die Tür zur Couchette ihrer Familie erreichte. Sie atmete schwer, und ihr Magen knurrte schon wieder.
Sie konnte nicht glauben, was sie gerade getan hatte.
Dieses Brot wäre mehr gewesen, als sie in den letzten Tagen zusammengenommen gegessen hatte. Und sie hatte es einfach so fortgegeben, als ob sie Essen im Überfluss hätte. Als ob sie von irgendetwas zu viel hätte.
Chatine schüttelte ihre linke Hand. Das Gefühl kehrte allmählich in ihre Finger zurück. Sie hob die Hand in Richtung des Türschlosses, hielt aber inne, als sie die unverkennbare Stimme ihrer Mutter hörte, die durch die Wand donnerte, die brüchigen Flurwände erzittern ließ und beinahe die kläglichen Überreste der Türen zum Einsturz brachte.
»Fünfunddreißig Prozent?! Du bist verrückt, wenn du glaubst, ich wäre so dumm, dieser alten Croc mehr als ein Zehntel abzugeben!«
Fantastique, dachte Chatine. Sie hat mal wieder schlechte Laune.
Es hörte sich so an, als ob Chatines Vater gerade von seinem letzten Job zurückgekommen war und ihre Eltern sich über die Anteile stritten. Sie stritten sich immer über die Ausbeute.
Chatine griff in ihren Stiefel und zog die andere Hälfte des Kohlbrots hervor. Sie knabberte an den Ecken, bis es so aussah, als wären sie abgeschnitten und nicht abgerissen worden. Als sie die kleinen Brotkrumen auf ihrer Zunge schmeckte, kostete es sie all ihre Willensstärke, sich nicht das ganze Stück in den Mund zu schieben und so zu tun, als hätte es nie existiert.
Erst als sie sich vorbeugte, um das Brot zurück in ihren Stiefel zu stecken, fiel ihr auf, dass ihre schwarze Hose direkt über dem Knie zerrissen war. Es musste passiert sein, als sie über das Rohr gekrabbelt war, um den Androiden zu entkommen.
Chatine seufzte. Ihre Hose war schon so oft mit Metalldrähten von Maschendrahtzäunen und anderen Dingen, die sie in den Frets gefunden hatte, geflickt worden, dass nicht mehr viel Stoff übrig war.
Sie drückte den Rücken durch und lauschte an der Tür. Die Schimpftirade ihrer Mutter schien abgeklungen zu sein. Sie hielt ihren linken Arm vor das Schloss.
»Zugang gestattet.« Der Riegel klickte, und Chatine drückte die Tür lautlos auf und schlüpfte hindurch.
Chatine stellte sich oft vor, dass die Couchettes einst saubere, glänzende Luxuskabinen gewesen sein mussten, mit richtigen Türen und fließendem Wasser und einem Herd, der sich nicht wie ein Schaf anhörte, das gerade in den Wehen lag. Bevor sie zu den heruntergekommenen Slums geworden waren, die sie heute waren.
Die Couchette der Renards war trotzdem noch eine der schöneren in den Frets.
Die Stellung ihres Vaters als Anführer der Délabré-Bande hatte Chatine und ihrer Familie einige zusätzliche Annehmlichkeiten beschert, wie ihre eigene Küche, ihre Lage in einer der höheren Etagen und zwei Schlafzimmer anstatt nur einem. Die meisten Mitglieder des Dritten États hatten noch nicht einmal ihre eigenen Couchettes. Sie schliefen in den alten Frachträumen im Erdgeschoss, eng aneinandergezwängt in schäbigen Kojen, die übereinandergestapelt bis zur Decke reichten.
Keine der Couchettes hatte ein eigenes Badezimmer, und nur jedes zweite Gemeinschaftsbadezimmer funktionierte. So entstand der höchst unangenehme Geruch, der ein allgegenwärtiger Bestandteil des Lebens in den Frets war. Als die Renards von ihrer Pension in Montfer auf der anderen Seite des Planeten nach Vallonay gezogen waren, hatte sich Chatine tagsüber draußen an der einigermaßen frischen Luft herumgetrieben und nachts versucht, sich nicht unaufhörlich zu übergeben. Doch inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt.
Es war erstaunlich, an was man sich alles gewöhnen konnte.
Wie erwartet fand Chatine ihren Vater am Wohnzimmertisch vor, wo er einen großen Haufen glänzender, sol-förmiger Knöpfe zählte. Sie erinnerte sich, dass er einen Einbruch in der Textilfabrique geplant hatte. Dies war eindeutig seine Ausbeute. Chatine wusste anhand ihrer Form, dass es sich um Uniformknöpfe für Offiziere des Ministères handelte. Sie bestanden aus purem Titanium, das ihr Vater höchstwahrscheinlich einschmelzen würde, damit er das wertvolle silbrige Metall als Zahlungsmittel benutzen konnte.
Normalerweise hatten nur Mitglieder des Ersten oder Zweiten États Zugang zu Titanium. Mitglieder des Dritten États wurden mit digitalen Marken bezahlt – auch genannt Larg –, die jede Woche auf ihre Profilkonten überwiesen wurden. Natürlich nur, wenn man auch an seiner zugewiesenen Arbeitsstelle auftauchte, was Chatine und ihre Eltern nie taten.
Chatines Mutter stand über Monsieur Renard gebeugt daneben und verfolgte alles genau.
»Ich kann nicht glauben, dass diese habgierige Frau fünfunddreißig Prozent dafür haben wollte, dass sie eine ihrer Titten gezeigt hat! Für fünfunddreißig Prozent hätte ich eine meiner eigenen Titten zeigen können!«
»Glaub mir, deine alten Titten sind keine fünfunddreißig Prozent wert«, murmelte Monsieur Renard.
Doch ihre Mutter hörte es. Ebenso wie Chatine. Sie versuchte, ihr Lachen zu unterdrücken, doch es gelang ihr nicht. Madame Renards Kopf fuhr herum und entdeckte Chatine. Und noch bevor Chatine reagieren konnte, holte ihre Mutter aus und gab ihr eine schallende Ohrfeige.
Sie stolperte zurück und krachte gegen die Tür der Couchette.
»Verfrickt noch mal!« Chatine rieb sich die schmerzende Wange. »Er hat es doch gesagt, nicht ich!«
»Diese alten Titten haben hier ja wohl mehr Geld verdient als ihr beide zusammen!« Madame Renard schrie nun. Sie fuhr herum und funkelte Chatine an. »Weil ich weiß, wie ich mir zunutze mache, was die Sols mir geschenkt haben.«
Chatine biss sich fest auf die Lippe.
Sie war vor über zwei Jahren sechzehn geworden, und es verging kein einziger Tag, an dem ihre Mutter sie nicht daran erinnerte, wie viele Larg ein gesundes junges Mädchen wie Chatine in Vallonay verdienen konnte. Die Blutbordelle bezahlten fast das Doppelte für Mädchen ihres Alters. Sobald man fünfundzwanzig Jahre alt wurde, begannen die Preise zu sinken.
Doch Chatine zog ihre eigenen Methoden vor. Sie funktionierten. Und solange der Junge namens Théo mehr Larg nach Hause brachte als das Mädchen namens Chatine, konnte sie ihre Eltern überreden, die Lüge aufrechtzuerhalten, dass sie vor achtzehn Jahren einen Sohn und keine Tochter auf die Welt gebracht hatten.
Chatine hätte ihr Blut lieber ins Sekanische Meer fließen lassen, als es an den Ersten État zu verkaufen.
»Was hast du mir mitgebracht?«, fragte Madame Renard, während sie Chatines schwarzen Mantel mit ihren harten, grauen Augen nach verräterischen Ausbeulungen absuchte.
Chatine zog den halben Laib Kohlbrot aus ihrem Stiefel und warf ihn ihrer Mutter zu. Madame Renard fing ihn geschickt mit einer Hand auf und begutachtete ihn, fuhr mit ihren dreckigen Fingernägeln über die Kante, wo Chatine das Brot entzweigebrochen hatte.
»Wo ist der Rest?«, fragte Madame Renard. »Du versuchst besser gar nicht erst, mich auch noch zu beklauen, du wertlose Clocharde.«
Chatine hielt dem herausfordernden Blick ihrer Mutter stand und weigerte sich, Furcht zu zeigen.
»Es war schon so«, sagte sie gelassen.
Die Augen ihrer Mutter verengten sich. Sie glaubte Chatine eindeutig nicht.
»Ich habe es von Dufours Stand mitgehen lassen«, fügte Chatine hinzu. »Du weißt doch, dass man der alten Croc nicht trauen kann.«
Dies schien ihre Mutter zu überzeugen. Sie grunzte und warf das Brot auf den Tisch. Es landete auf dem Haufen Titanium-Knöpfe, die Monsieur Renard immer noch zählte. Sie flogen durcheinander.
»Verfrickt!«, fluchte Monsieur Renard. »Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen.«
»Gut.« Madame Renard spuckte ihm das Wort geradezu entgegen. »Vielleicht findest du ja diesmal die hundert, die du mir noch vom letzten Job schuldest.«
Dann fuhr sie wieder zu Chatine herum. »Guillaume hat mir gesagt, dass heute Morgen neue Leichen in die Leichenhalle gebracht wurden. Cavs, die nur auf dich warten. Du bewegst besser deinen dreckigen Hintern da runter, bevor sie ihre Profilkonten leeren.«
Der Gedanke, wieder einmal in die Leichenhalle zu müssen, ließ Chatine schaudern. Sie hasste alles an diesem Ort. Die geisterhaft stillen Flure. Den Geruch von verwesendem Fleisch. Aber am meisten hasste sie die Cadavres selbst. Diese leeren, blinden Augen schienen immer bis auf den Grund ihrer Seele zu schauen.
Sie wollte widersprechen. Wollte sich weigern zu gehen, doch sie wusste, was passierte, wenn sie ihrer Mutter nicht gehorchte. Ihr Vater mochte der Anführer der berüchtigtsten Bande der Frets sein, aber Madame Renard hatte zu Hause ganz eindeutig die Hosen an.
Chatine ballte die Hände zu Fäusten und verschwand in ihrem Zimmer. Sie zog die Tür hinter sich zu und lehnte sich dagegen. Dann schloss sie die Augen und nahm sich einen Moment Zeit, ihre wütende, unregelmäßige Atmung zu beruhigen.
Reiß dich zusammen, sagte sie zu sich selbst. Nicht mehr lange, dann bist du hier weg.
Sie berührte die kleine Ausbeulung unter ihrem Jackenkragen – das goldene Solmedaillon – und konnte förmlich die Freiheit auf der Zunge schmecken.
Sie schmeckte ganz und gar nicht wie Kohlbrot.
»Hi«, unterbrach eine leise Stimme ihre Gedanken, und Chatine öffnete die Augen. Sie sah ihre ältere Schwester Azelle, die auf ihrem gemeinsamen Bett lag und auf den kleinen Bildschirm starrte, der in ihren linken Arm eingelassen war.
»Warum bist du nicht bei der Arbeit?«, fragte Chatine.
»Nachtschicht«, sagte Azelle, ohne aufzuschauen.
Im Gegensatz zu Chatine verpasste Azelle keinen einzigen Tag an ihrer vom Ministère zugeteilten Arbeitsstelle. Sie arbeitete in der Fabrique, die Télé-Häute herstellte. Dort wurde das Zyttrium-Metall verarbeitet, das in Schiffsladungen aus der Bastille ankam und zu Télé-Häuten weiterverarbeitet wurde, die dann jedes Jahr in die Arme aller Neugeborenen implantiert wurden. Wenn Azelle nicht gerade in der Fabrique arbeitete, war sie meistens hier in der Couchette anzutreffen.
Chatine hätte eigentlich auch in den Fabriquen arbeiten sollen. In der Textilfabrique. Zumindest sagte ihre Télé-Haut ihr das. Doch sie hörte ihrer Télé-Haut sowieso nur selten zu. Sie war davon überzeugt, dass das Ministère die Dinger manipulierte, also manipulierte sie ihres ebenfalls. Sie hatte viele Larg bezahlt, um ihre Télé-Haut zu hacken, sodass auf ihrem Profil Théo Renard stand. So konnte das Ministère sie nicht mehr aufspüren oder ihr jeden Morgen Erinnerungen schicken, dass sie zur Arbeit gehen sollte. Doch es gab einige Mitteilungen – wie offizielle Kundgebungen, Ausgangssperren und die Erinnerung an die allmonatliche Vitamin-D-Injektion –, die sich einfach nicht deaktivieren ließen.
»Wo bist du gewesen?«, fragte Azelle.
»In der Marsch«, antwortete Chatine. Sie öffnete eine Kiste aus Zinn, die neben ihrem Bett stand, und kramte darin herum, bis sie ein Stück Stahldraht gefunden hatte. Sie beugte sich vor und stach das Metallstück hastig durch den Stoff ihrer Hose, um die losen Enden zusammenzuflicken. Es war nicht ihre beste Flickarbeit, aber es war ihr mittlerweile wirklich egal.
»Ich habe gerade mit Noémie von ein paar Türen weiter geairlinkt«, sagte Azelle, ohne den Blick ihrer hellgrauen Augen von ihrem Arm zu heben. »Sie sagte, dass eine Frau in der Fabrique eine Demonstration für höhere Löhne zu organisieren versucht.«
Chatine schnaubte. Sie hatte keine Zeit für Demonstrationen. Das funktionierte doch sowieso nie. Der letzte große Aufstand war im Jahr 488, vor siebzehn Jahren, gewesen. Er war von der Vangarde angezettelt worden, einer Gruppe, angeführt von einer Frau, die sich selbst Citoyenne Rousseau nannte. Tausende Mitglieder des Dritten États waren für diese Frau gestorben, die nun auf der Bastille vor sich hin schmorte. Und für was? Was war schon dabei herausgekommen?
Nichts als ein Haufen Asche.
In Vallonay gab es immer Gerüchte über neue Aufstände. Sie kamen von hoffnungsvollen Idioten, die versuchten, Anhänger zu finden, wie Citoyenne Rousseau es damals im Jahr 488 getan hatte.
»Ich weiß nicht, wie jemand so dumm sein kann, demonstrieren zu gehen«, sagte Azelle.
Chatine ging zum Fußende des Bettes und öffnete eine der metallenen Bodenplatten. Darunter zog sie den Wollbeutel hervor, den sie dort versteckte. Sie machte sich keine Sorgen, dass Azelle sie beobachten könnte. Die Himmelfahrt begann in wenigen Stunden. Das Mädchen würde den ganzen Morgen vor ihrer Télé-Haut hängen.
»Wenn sie geschnappt werden, werden sie sofort auf die Bastille abgeschoben, und das Ministère wird all ihre Himmelfahrtspunkte löschen«, fuhr Azelle fort. »Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen!«
Chatine kämpfte gegen den Impuls an, zu sagen, dass sie sich so einiges Schlimmeres vorstellen konnte, als Himmelfahrtspunkte zu verlieren. Das Letzte, was sie jetzt brauchte, war ein Streit mit Azelle über die Glaubwürdigkeit des allmächtigen Ministères. Ihre Schwester hielt sich streng an die Gesetze und lauschte brav allen Kundgebungen. In Azelles Augen war der Zweite État – und vor allem das Ministère – so mächtig wie die Sols.
In Chatines Augen waren Mitglieder des Zweiten États nicht mehr als leichtgläubige Dummköpfe, die sie beklauen konnte.
Sie griff in den Beutel und schob sich einige Sachen in ihre Jackentaschen. Dabei ging sie in Gedanken jedes einzelne Objekt ihrer Sammlung durch, um sicherzugehen, dass nichts über Nacht verschwunden war. Als Mitglied einer Familie von Dieben und Gaunern konnte man nie vorsichtig genug sein.
Sie kannte einige der Namen und Funktionsweisen der Relikte aus der Ersten Welt – zum Beispiel eine Uhr, einen Bleistift und Sol-Brillen. Andere waren ihr unbekannt, sodass sie sich etwas ausdenken musste. Wie beispielsweise der zusammengebundene Stapel loser Seiten, die mit dem Vergessenen Wort vollgeschrieben waren. Oder das dünne schwarze Rechteck mit dem kleinen Bildschirm, dessen Rückseite aus Metall gemacht war und von dem Chatine fand, dass es wie eine externe Télé-Haut aussah.
Chatine stopfte die restlichen Sachen in ihre Taschen. Dann legte sie den leeren Beutel zurück in das Loch im Boden und schob die Platte wieder darüber. Nachdem sie die Taschen ihres langen schwarzen Mantels abgeklopft hatte, um sicherzugehen, dass es keine allzu auffälligen Ausbeulungen gab, ging sie auf die Tür zu.
»Wohin gehst du?« Azelle war so schockiert, dass sie tatsächlich aufsah. »Himmelfahrt beginnt um halb drei! Willst du nicht mit mir schauen? Was, wenn sie deinen Namen verkünden?«
»Sie werden meinen Namen nicht verkünden«, antwortete Chatine. Wenn es eins auf diesem elendigen, sol-verlassenen Planeten gab, dessen sie sich sicher war, dann war es, dass sie niemals ihren Namen verkünden würden.
»Aber vielleicht doch«, sagte Azelle. »Alle sind gleichwertig in den Augen der Himmelfahrt. Jeder kann ausgewählt werden. Das ist ja das Schöne daran. Du könntest Glück haben. Ehrliche Arbeit für eine ehrliche Chance.«
Chatines Schwester wiederholte das Motto des Ministères Wort für Wort. Dieser Spruch war der Grund, warum Azelle jeden Tag zwei Minuten zu früh in ihrer Fabrique eincheckte. Warum sie arbeitete, bis ihre Hände aufgerissen und ihre Füße voller Blasen waren. Azelle war die Einzige in der Familie, die sich an die Regeln hielt, weil sie die Einzige war, die dem Ministère die »Ehrliche-Arbeit-für-eine-ehrliche-Chance-Philosophie« abkaufte, die sie jedem von Geburt an eintrichterten.
Chatine kannte die Wahrheit. Die einzigen Chancen, die man hier bekam, waren jene, die man sich selbst schuf.
»Ich glaube, dieses Jahr habe ich eine wirkliche Chance«, sagte Azelle und starrte schon wieder auf ihre Télé-Haut. »Ich war jeden Tag arbeiten, habe alle Ministère-Übertragungen gesehen und all meine Arbeitsstunden dokumentiert. In den letzten Monaten habe ich sogar Überstunden in der Fabrique gemacht. Ich habe jetzt fast zweitausendfünfhundert Punkte gesammelt.«
Azelle keuchte und zeigte aufgeregt auf ihren Arm. »Oh meine Sols, schau mal! Sie zeigen Marcellus Bonnefaçon! Ich habe ihn vor Kurzem in der Marsch gesehen. In echt sieht er genauso umwerfend aus wie auf dem Bildschirm.«
Chatine warf einen Blick auf den Arm ihrer Schwester und sah das bekannte Gesicht eines der berühmtesten Mitglieder des Zweiten États: Offizier Bonnefaçon, der Enkel des mächtigen Generals Bonnefaçon. Das Ministère liebte es, Marcellus’ hübsches Gesicht auf allen Télé-Häuten zu zeigen, wann immer sich die Gelegenheit bot. Das taten sie schon, seit er volljährig geworden war und sie ihn endlich zu einem vollwertigen Laterre-Promi machen konnten. Er war fast so berühmt wie der Patriarche und die Matrone höchstpersönlich.
In dem Spot wurden Marcellus’ lächerlich glänzendes dunkles Haar, seine makellose Haut und sein funkelndes Lächeln gezeigt.
Verfrickt, dachte Chatine. Putzt sich der Typ seine Zähne mit Seife? Wessen Zähne sind bitte so weiß?
Azelle tippte mit dem Finger auf den Bildschirm, um die Lautstärke des implantierten Audiochips in ihrem Ohr aufzudrehen.
»Oh«, seufzte sie als Reaktion auf etwas, das Bonnefaçon gerade gesagt hatte. »Er ist so charmant!«
Chatine wusste, dass alle Mädchen in den Frets hoffnungslos in Marcellus verknallt waren, darunter auch ihre Schwester. Eine weitere unerreichbare Sache, von der sie träumen konnten. Doch Chatine verstand einfach nicht, warum. Er war einer der hochrangigsten Mitglieder des Zweiten États, was zwangsläufig bedeutete, dass er hochnäsig, großspurig und verabscheuungswürdig war.
»Wusstest du, dass General Bonnefaçon Marcellus darauf vorbereitet hat, der nächste Commandeur des Ministères zu werden?«, fragte Azelle verträumt. »Das sagen alle in den Frets. Sie glauben, dass er deshalb in letzter Zeit so oft in der Marsch gesehen wurde. Er wird von Inspecteur Limier ausgebildet.«
Chatine schauderte, als sie sich an ihre Begegnung mit dem Furcht einflößenden Cyborg-Inspecteur erinnerte.
»Er wird heute sicher auch zur Himmelfahrt da sein. Gehst du zurück in die Marsch? Vielleicht siehst du ihn ja!«, rief Azelle aufgeregt. »Wäre das nicht unglaublich?«
»Ja«, antwortete Chatine. Und sie meinte es ernst. Marcellus Bonnefaçon war extrem reich. Beim Gedanken daran, was sie ihm abnehmen könnte, falls sie ihn jemals treffen sollte, wurde ihr ganz schwindelig.
Doch sie würde heute nicht mehr zurück in die Marsch gehen. Nicht, wenn sie es nicht musste. Dort würde wegen der Himmelfahrt das reinste Chaos herrschen, von dem sie so weit wie möglich wegbleiben wollte. Sogar Azelle war klug genug, die Himmelfahrt von zu Hause aus zu verfolgen.
Ihre Schwester setzte sich im Bett auf, lehnte ihren Rücken gegen die Wand und verschränkte ihre Beine zu einem Schneidersitz, während sie die ganze Zeit über weiter auf ihre Télé-Haut starrte.
»Oh Sols, bitte wählt diesmal mich. Bitte wählt mich.«
Chatine sah sie mit einer Mischung aus Mitleid und Gereiztheit an. Wenn Azelle nur halb so viel Zeit mit kriminellen Machenschaften wie mit dem Sammeln von Himmelfahrtspunkten verbringen würde, wäre ihre Familie wahrscheinlich schon längst reich.
Chatine vergewisserte sich, dass der unordentliche Dutt an ihrem Hinterkopf vollständig von ihrer Kapuze verdeckt wurde. Sehr bald würde sie ihr Haar an Madame Séezau verkaufen. Die Croc bezahlte gut, und es war ein nicht zu verachtendes Nebeneinkommen für Chatine. Sie hasste nur diese Zwischenphase, wenn ihr Haar so lang war, dass man sie als Mädchen erkennen könnte, aber noch nicht lang genug, um zweihundert Larg dafür zu bekommen.
Azelle seufzte theatralisch, stützte ihr Kinn auf ihre Hand und schaute sich weitere Himmelfahrts-Clips auf ihrer Télé-Haut an.
»Ich meine, wie fantastique wäre es wohl, in Ledôme zu leben? Wo die Sols vierhundertacht Tage im Jahr scheinen.«
»Unechte Sols«, korrigierte Chatine sie.
Doch es war, als ob Azelle sie überhaupt nicht gehört hätte. »Es regnet nie. Und man wohnt direkt neben dem Grand Palais. Man würde bestimmt sogar ab und zu den Patriarchen und die Matrone zu Gesicht bekommen. Ich mag diesen Patriarchen viel lieber als den Alten. Der war immer so ernst und langweilig. Der aktuelle sieht aus, als ob man mit ihm Spaß haben könnte. Und sein Premier Enfant ist so süß! Hast du das Special gesehen, das sie gestern über die Kleine gezeigt haben? Sie wird nächste Woche drei Jahre alt und spricht endlich vollständige Sätze. Sie kann aber immer noch nicht Dritter État sagen. Sie sagt immer Drei État. Ist das nicht einfach nur entzückend? Ich finde, dass sie wie die Matrone aussieht, aber Noémie hat gestern gesagt, dass …«
Chatine verdrehte die Augen und verließ das Zimmer, ohne sich den Rest der Geschichte anzuhören. Sie wusste, dass Azelle wahrscheinlich erst Minuten später bemerken würde, dass sie gegangen war.
Ihre Eltern stritten sich immer noch über die Knöpfe auf dem Tisch, als Chatine zurück ins Wohnzimmer der Couchette kam. Ihre Mutter sah nur kurz auf, um Chatine mit einem bösen Blick zu strafen und ihr den Collecteur zuzuwerfen.
»Ich prüfe ihn, sobald du zurückkommst«, warnte ihre Mutter. »Also komm gar nicht erst auf die Idee, mich zu beklauen.«
Chatine verzog das Gesicht, als sie auf das Gerät in ihrer Hand hinabsah. Ein kalter Schauer lief ihr über den Rücken, als sie an die Aufgabe dachte, die vor ihr lag. Sie sagte sich, dass sie es einfach schnell hinter sich bringen würde. Wenn sie es nicht machte, würden ihre Eltern vielleicht misstrauisch werden und ihren Plan versauen. Sie musste es einfach nur hinter sich bringen. Rein in die Leichenhalle und schnell wieder raus. Danach konnte sie sich um ihre weitaus wichtigere Aufgabe kümmern: einen Besuch beim Capitaine. Sie konnte es kaum erwarten, ihm zu zeigen, was sie heute in der Marsch erbeutet hatte.
Chatine murmelte etwas, das sich nach einer Verabschiedung anhörte, und huschte aus der Couchette. Dann eilte sie den »Kein-Ausweg-Flur« von Fret 7 entlang.
Sobald sie draußen und allein war, tastete sie wieder nach dem Medaillon, dessen Gewicht sie um ihren Hals spürte. Ihr Herz schlug schneller bei dem Gedanken daran, was es bedeutete. Wofür es stand.
Es war ihr Fahrkarte, um diesen elendigen Planeten zu verlassen.
Es war ihre Rettung.
Azelle konnte gerne den ganzen Tag herumsitzen und darauf warten, dass die habgierigen Pomps des Zweiten États ihr halfen. Doch Chatine hatte vor, sich selbst zu helfen.
Kapitel 3
MARCELLUS
Dein Vater ist tot.«
Marcellus Bonnefaçon hörte die Worte seines Großvaters, konnte sie aber nicht verarbeiten.
Tot?
Vater?
Jahre waren vergangen, seit Julien Bonnefaçons Name innerhalb dieser Mauern gefallen war. Und jetzt kam der Satz seinem Großvater so gefühlskalt über die Lippen, als ob Marcellus’ Vaters Tod nur ein unbedeutendes Detail wäre, das kaum der Rede wert war.
Obwohl Marcellus natürlich wusste, dass es wirklich nicht der Rede wert war, nach allem, was sein Vater getan hatte.
Marcellus schaute starr geradeaus. Die Worte seines Großvaters hatten sein Blut eine Sekunde lang zu Eis erstarren lassen, doch er wusste, dass er nicht anhalten durfte. Er wusste, dass er nicht reagieren durfte.
Stattdessen achtete er darauf, seine Schritte an die seines Großvaters anzupassen. Sorgfältig und gesittet. Genauso, wie man es ihm seit seiner Kindheit beigebracht hatte. Sie gingen schweigend den langen Flur im Südflügel des Grand Palais entlang. Kronleuchter mit Tausenden handgearbeiteten Kristallen hingen über ihnen, und der polierte Marmorboden unter ihren Füßen glitzerte und funkelte im morgendlichen Sol-Licht.
In Marcellus’ Kopf kämpften so viele Fragen um Gehör, doch er schubste sie alle von sich, eine nach der anderen. Dies war Teil seines Trainings. Das wusste er. Sei Herr deiner Emotionen. Kontrolliere deine Atmung. Bewahre jederzeit einen kühlen Kopf. Wenn es mehr Details über den Tod seines Vaters gegeben hätte, über die er Bescheid wissen musste, hätte sein Großvater sie erwähnt. Doch als sie den Bankettsaal betraten, konnte Marcellus nicht umhin, einen raschen Seitenblick auf seinen Großvater zu werfen. Seine Gesichtszüge waren unbewegt, nichts deutete darauf hin, dass sein einziger Sohn gestorben war. Marcellus wusste ehrlich gesagt nicht, warum er etwas anderes erwartet hatte. In den siebzehn Jahren, in denen er bei seinem Großvater gelebt hatte, hatte er nur äußerst selten einen Hauch von Trauer auf seinem Gesicht gesehen.
Und das, obwohl der General mehr als genug Leid erfahren hatte.
Einen Augenblick später wurden die Doppeltüren auf der gegenüberliegenden Seite des Bankettsaals aufgerissen, und der Patriarche, gekleidet in seinen üblichen Morgenmantel aus dunkler Seide, stürmte herein. Die in eine violette Seidenrobe gekleidete Matrone und ihre zweijährige Tochter Marie folgten ihm auf den Fuß.
»Guten Morgen, General«, grummelte der Patriarche, ohne Marcellus’ Großvater anzusehen.
»Guten Morgen, Monsieur le Patriarche«, antwortete sein Großvater gelassen.
»Bringen wir es hinter uns.« Der Patriarche nahm auf einem der samtbezogenen Stühle Platz und begann sofort, Essen auf seinen Teller zu häufen.
Wie üblich bog sich die Banketttafel förmlich unter Bergen von Titanium-Platten, auf denen sich novayanischer Räucherlachs, gebratene Wachteln und vom Planeten Usonien importierte Entenpasteten türmten.
Es gab Körbe mit frisch gebackener Brioche, ein Tablett mit den feinsten Würsten vom Planeten Reichenstaat und alle nur erdenklichen Früchte, die am selben Morgen in den Treibhäusern am Fuße von Ledôme gepflückt worden waren.
Der achtzehnjährige Marcellus befand sich noch immer in der Wachstumsphase und konnte gewöhnlich Unmengen von Essen verschlingen, vor allem beim Brunch.
Aber nicht heute. Nicht gerade jetzt.
Stattdessen saß er nur regungslos am Tisch und starrte wie betäubt auf die Brioche auf dem Teller vor sich.
»Dein Vater ist tot.«
Er schaffte es nicht, die Worte seines Großvaters aus seinem Kopf zu verbannen. Obwohl er wusste, dass er aufhören musste, daran zu denken. Sofort. Es waren gefährliche Worte. Gefährliche Gedanken.
Doch sein Geist war ein Verräter.
Genau wie sein Vater.
Endlich griff Marcellus nach seiner Brioche und beschmierte das Gebäckstück mit Brombeermarmelade. Während er ein kleines Stück abbiss und kaute, bemühte er sich, seine Gesichtszüge neutral zu halten. Er wusste, dass dies ein Test war.
Sein Großvater würde seine Reaktion auf die Neuigkeiten analysieren. Jede Regung, jedes scheinbar harmlose Zucken seines Gesichts – in den Augen General Bonnefaçons hatte alles eine Bedeutung. Und das war auch richtig so.
Wenn Marcellus wirklich nächstes Jahr zum Commandeur aufsteigen würde, konnte er es sich nicht erlauben, dass man ihm etwas anderes als unerschütterliche Loyalität zum Régime nachsagte.
»Die Produktion in der Raumfahrtsfabrique ist wieder angestiegen«, sagte sein Großvater mit fester Stimme und geradem Rücken. Während er seinen Wochenbericht erstattete, glitt sein Blick zwischen seinem Télé-Com auf dem Tisch und dem Patriarchen hin und her.
Tot.
Das Wort flatterte weiter in Marcellus’ Gedanken herum wie ein Schwarm Wachteln, aufgeschreckt von einem Schuss eines der antiken Jagdgewehre des Patriarchen.
Marcellus biss ein weiteres Mal von seinem Gebäck ab und bemühte sich, konzentriert auszusehen. Interessiert. Wie ein Commandeur eben aussehen würde. Wie Commandeurin Vernay sicher immer ausgesehen hatte.
»Aber die Produktion in der Textilfabrique stagniert«, fuhr sein Großvater fort.
Der Patriarche stopfte sich ein Stück Lachs in den Mund, wischte sich den Mund mit einer bestickten Serviette ab und legte seine Gabel nieder. »Und warum ist das so, General? Gibt es ein Problem?«
»Der Vorsitzende behauptet, dass weniger Titanium als sonst aus Usonien geliefert wurde, wodurch die Produktion der Knöpfe für die Ministère-Uniformen in Verzug geraten ist –«, begann General Bonnefaçon zu erklären, wurde aber unterbrochen.
»Das ist inakzeptabel«, grunzte der Patriarche. »Wir haben Usonien in seinem Unabhängigkeitskrieg gegen Albion einzig und allein deshalb geholfen, damit unser Zugang zum Titanium nicht länger von dieser verrückten Königin unterbunden wird.«
Marcellus bemerkte, wie sein Großvater den Kiefer anspannte, ein leichtes Pulsieren direkt unter einer seiner perfekt getrimmten Koteletten. Ein Riss in seiner sonst so undurchdringlichen Rüstung war etwas, das man selten zu Gesicht bekam. Doch Marcellus wusste, dass der Usonische Unabhängigkeitskrieg der wunde Punkt des Generals war. Marcellus saß nur aufgrund dieses Krieges in dieser Besprechung auf dem Platz, der eigentlich Commandeurin Vernay zugestanden hätte.
Doch nur einen Augenblick später hatte sein Großvater sich schon wieder unter Kontrolle und seine Maske aufgesetzt: ruhig, aber bestimmt, kühl, aber mit dem Hauch eines höflichen Lächelns. Marcellus brachte seine eigene Miene unter Kontrolle und fragte sich, ob es ihm je gelingen würde, den Ausdruck seines Großvaters nachzuahmen. Ein Gesicht, das nichts preisgab.
Er träumte davon, in der Lage zu sein, nichts von sich preiszugeben.
»Sind Sie sicher, dass es nicht nur eine Ausrede ist?«, fragte der Patriarche, nahm seine Gabel in die Hand und stach damit in eine Pastete. »Vielleicht sind die Arbeiter einfach nur wieder faul.«
»Oh, mon chéri«, sagte die Matrone und hielt inne, um an ihrem Champagnerglas zu nippen. »Du darfst nicht so hart mit den armen Arbeitern ins Gericht gehen. Vielleicht sind sie einfach nur müde. Oder vielleicht brauchen sie eine schöne, kleine Belohnung von uns, um ihre Arbeitsmoral zu steigern und sie wissen zu lassen, dass wir sie unterstützen.« Sie pustete sich eine dunkle Locke aus dem Gesicht, die sich aus der sorgfältig auf ihrem Kopf aufgetürmten Frisur gelöst hatte. »Wir sollten ihnen eine Kiste mit diesem wundervollen Gateau schicken.« Sie versenkte ihren Löffel in dem gigantischen, dreistöckigen Dessert mit rosagrüner Füllung und trennte ein großes Stück ab. »Findest du nicht auch, Marcellus?«
Marcellus war so überrascht, dass ihn jemand ansprach, dass er sich beinahe an seinem Brioche verschluckt hätte. »Sehr gute Idee, Madame la Matrone«, stotterte er.
Die Matrone beugte sich vor und fütterte Marie, das Premier Enfant, mit dem Gateau. Das Mädchen saß auf dem Stuhl neben ihrer Mutter. Ihre dunklen Locken waren mit Seidenbändern geschmückt, die im Sol-Licht glänzten, das durch die hohen Fenster der Banketthalle hereinfiel.
»Mach dich nicht lächerlich, chérie«, sagte der Patriarche. »Wenn du Gateau in eine Fabrique schickst, dann musst du auch Gateau in alle anderen schicken. Es sei denn, du willst einen Aufstand anzetteln. Wie mein verstorbener Vater sagen würde: ›Das ist eine politische Grundregel.‹« Er wechselte einen verschwörerischen Blick mit Marcellus’ Großvater. »Aus ebendiesem Grund sollten Frauen nie einen Planeten regieren, habe ich recht, General?«
Marcellus beobachtete, wie die Matrone ihrem Ehemann einen geringschätzigen Blick zuwarf und noch einen großen Schluck Champagner nahm. Ihr Brunch – und, wie Marcellus annahm, auch die meisten anderen Mahlzeiten – schien einzig und allein aus Champagner zu bestehen.
Ohne die Reaktion seiner Frau zu bemerken, wandte sich der Patriarche gurrend seiner Tochter zu. »Außer mein kleiner Schatz, Marie, das schlauste Mädchen auf ganz Laterre, die eines Tages eine hervorragende Regentin abgeben wird.« Er warf ihr einen lauten, feuchten Handkuss zu, den das Kind ignorierte.
Marcellus kam erst seit ein paar Monaten zu diesen Treffen, fürchtete sich aber bereits jetzt vor ihnen. Nicht nur, weil er mit ansehen musste, wie der Patriarche sich vollstopfte und die Matrone sich in einen melancholischen Vollrausch trank, sondern weil er nie wusste, wie er sich benehmen sollte. Wie er sitzen sollte. Was er mit seinen Händen machen sollte. In diesem Raum fühlte er sich wie ein zappeliges Kind, das in eine kratzige Uniform gesteckt worden war und nun gezwungen wurde stillzusitzen. Als der zukünftige Commandeur des Ministères wurde nicht von Marcellus erwartet, seine Meinung kundzutun. Er musste einfach nur dasitzen, eine stählerne Miene aufsetzen und gut aufpassen, damit er eines Tages etwas beitragen konnte. Doch seine Gedanken schweiften jedes Mal ab. Heute noch öfter als sonst.
»Dein Vater ist tot.«
»Oh du kleiner Racker!« Die Stimme der Matrone brachte Marcellus zurück in den Bankettsaal. Das Premier Enfant stand nun auf seinem Stuhl und stampfte mit den Füßen. »Warum stellst du dich denn auf deinen Stuhl? Du weißt doch, dass Maman es nicht mag, wenn du kletterst. Wir wollen doch nicht, dass du dich verletzt.«
Die Matrone griff nach ihrer Tochter, doch das kleine Mädchen sprang vom Stuhl, schnappte sich zwei Titanium-Löffel vom Tisch und begann, sie aneinanderzuschlagen. Die Matrone seufzte tief und leerte ihr Champagnerglas.
General Bonnefaçon räusperte sich und konzentrierte sich wieder auf seinen Bildschirm. »Die Brotfabrique hat ebenfalls weniger als gewöhnlich produziert, aber das Problem sollte behoben werden, wenn –«
»Oh, Fabrique hier, Fabrique da«, unterbrach die Matrone ihn erneut. »In letzter Zeit sprechen wir nur noch über die Fabriquen. Es ist so unglaublich langweilig. Langweilig, langweilig, langweilig. Und Sie« – sie wedelte mit ihrem Finger in Richtung des Generals und dann des Geräts vor ihm – »tippen immer nur auf diesem dummen Télé-Com herum. Ich hasse es, diese furchtbaren Geräte an meinem Esstisch sehen zu müssen. So störend. So hässlich. So … unterlegen. Technologie ist etwas für schwache Geister. Diejenigen, die nicht selbstständig denken können, benutzen Geräte, die es für sie tun.«
Marcellus schaute aus einem der Fenster der Banketthalle hinaus. Als Oberhaupt des Ministères und höchster Berater des Patriarchen standen General Bonnefaçon und somit auch seinem Enkel gewisse Privilegien zu. Wie beispielsweise ihr eigener Südflügel im Grand Palais. Der Rest des Zweiten États lebte in kleineren, weniger verschwenderischen Manors in Ledôme.
Marcellus war mit diesem schönen Ausblick auf die Gärten des Grand Palais aufgewachsen. Doch heute schien die Landschaft irgendwie düsterer, trotz des künstlichen Sol-Lichts, das vom Télé-Himmel schien.
»Ma chérie«, sagte der Patriarche. »Lass den armen General in Ruhe. Er braucht den Télé-Com für seine Berichte, das ist alles. Du weißt doch, dass er dieses hässliche Gerät nie mit in den Bankettsaal bringen würde, wenn er es nicht müsste.«