
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Baumhaus
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
So kann es nicht weitergehen! Das beschließt die 15-jährige Brooklyn, nachdem sie durch ihre letzte vermasselte Aktion auf dem Polizeirevier gelandet ist. Sie ist einfach nicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen.
Die Lösung? Ein Blog, auf dem ihre Leser für sie entscheiden. Und zwar alles: Von der Wahl der Klamotten über die Lektüre für den Englischkurs bis zu "Wer ist der Richtige für mich?". Ob das wirklich gut geht?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
So kann es nicht weitergehen! Das beschließt die 15-jährige Brooklyn, nachdem sie durch ihre letzte vermasselte Aktion auf dem Polizeirevier gelandet ist. Sie ist einfach nicht in der Lage, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Die Lösung? Ein Blog, auf dem ihre Leser für sie entscheiden. Und zwar alles: Von der Wahl der Klamotten über die Lektüre für den Englischkurs bis zu »Wer ist der Richtige für mich?«. Ob das wirklich gut geht?
Über die Autorin
Jessica Brody begann schon mit sieben Jahren, ihre Geschichten zu »verlegen«, indem sie die Blätter zusammenheftete. Nach ihrem Collegeabschluss in Wirtschaft, Französisch und Japanisch und vier Jahren in der Wirtschaftswelt widmete sie sich dem Schreiben. Seitdem hat sie fünf Romane veröffentlicht, die in zehn verschiedenen Ländern erscheinen. Jessica Brody lebt in Colorado und Los Angeles.
Jessica Brody
Mein Leben voller Fragezeichen
Übersetzung aus dem Englischen von Ann Lecker
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der US-amerikanischen Originalausgabe:
»My Life Undecided«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2011 by Jessica Brody
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2016 by Boje Verlag in der Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: Jeannine Schmelzer
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock/gst, © shutterstock/Robj, © shutterstock/KateMacate
E-Book-Produktion: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-732-52385-6
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Für meine kleine Schwester Terra, weil sie schwere Entscheidungen getroffen hat, und das mit Stil.
Das Leben ist wie ein Kartenspiel.
Man bekommt zwar bestimmte Karten zugeteilt, aber wie man sie ausspielt, bleibt einem selbst überlassen.
Jawaharlal Nehru (Erster Premierminister Indiens)
Prolog
Die Sirenen sind lauter, als ich erwartet habe.
Ganz abgesehen davon, dass ich am Anfang dieser Geschichte nie im Leben mit Sirenen gerechnet hätte. Sonst wäre ich natürlich nie damit einverstanden gewesen.
Hinterher ist man immer klüger.
Echt ätzend.
Aber selbst als meine beunruhigend ruhige beste Freundin Shayne mich darüber informierte, dass sie unterwegs waren, konnte ich nicht fassen, wie laut sie waren. Oder wie … na ja … unübersehbar. Wie Signalfeuer, die die Nacht zum Tag machen, die Nachbarn aus dem Schlaf reißen und jedem in einem Umkreis von acht Kilometern zurufen: »Hey! Ihr da! Schaut mal her! Brooklyn Pierce hat Mist gebaut … mal wieder!«
Warum schicken sie nicht auch noch gleich eine verdammte Pressemitteilung raus?
Andererseits wird diese Sache morgen sowieso für Schlagzeilen sorgen. Zumindest wird sie der meist angeklickte Post auf ein paar örtlichen Blogs werden. Denn, seien wir mal ehrlich, worüber könnte man sonst in dieser langweiligen, kleinen Stadt reden, in der nie irgendwas Aufregendes passiert? Dass die Kirchengemeinde vom Heiligen Soundso seit letzter Woche einen neuen Pastor hat?
Nein, das hier wird auf jeden Fall die Nachricht des Tages werden.
Und ich werde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit das Epizentrum des Skandals sein … mal wieder.
Man könnte wohl sagen, dass ich negative Schlagzeilen wie ein Magnet anziehe. Zu Katastrophen neige, die einen gewaltigen Medienrummel nach sich ziehen.
Als ich zwei Jahre alt war, fiel ich in einen stillgelegten Schacht und steckte zweiundfünfzig Stunden darin fest, während Rettungshelfer rund um die Uhr daran arbeiteten, mich da herauszuholen. Sie mussten durch sechs Meter dickes Felsgestein bohren, weil das Loch im Boden offenbar groß genug für ein elf Kilo schweres Kleinkind war, aber nicht annähernd groß genug für einen fünfundneunzig Kilo schweren Feuerwehrmann in voller Montur.
Die Geschichte war überall in den Nachrichten. Laut Wikipedia war das ganze Land im Ausnahmezustand und verfolgte live im Fernsehen mit, als sie mich aus dem Schacht zogen und in Sicherheit brachten. Mein Fehltritt landete auf den Titelseiten von zwanzig verschiedenen Tageszeitungen und Zeitschriften, meine Eltern erhielten einen Anruf vom Präsidenten höchstpersönlich und es war sogar die Rede davon, aus dem Vorfall eine Miniserie fürs Fernsehen zu machen.
Von dem Moment an war ich landesweit als »Baby Brooklyn, das kleine Mädchen, das in einen Schacht fiel« bekannt. Ein unsicherer, kleinkindgroßer Schritt in die falsche Richtung, und mein Schicksal als Pechvogel war für immer besiegelt. Ich war für immer als Versagerin gebrandmarkt. Obwohl ich mich kein bisschen an den Vorfall erinnern kann, verfolgt er mich bis heute überallhin. Ich bin für etwas berühmt, an das ich mich nie werde erinnern können. Bin in die Geschichte eingegangen für einen sehr unglücklichen Fehltritt.
Meine Eltern erzählen mir seit Jahren, dass ich die falschen Entscheidungen treffe. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Weil, na ja, sie sind meine Eltern. Und seit wann haben Eltern jemals recht, ganz gleich, worum es geht?
Doch allmählich frage ich mich, ob ich vielleicht einfach so geboren wurde. Als wäre schlechtes Urteilsvermögen Teil meiner DNA oder so was. Als wäre ich genetisch darauf programmiert, bescheuerte Entscheidungen zu treffen.
Obwohl meine Mom sich immer die Schuld für den Unfall gegeben hat, war ich es, die es für eine gute Idee hielt – in den sieben verhängnisvollen Sekunden, die sie brauchte, um den Reißverschluss an der Jacke meiner Schwester hochzuziehen –, der kleinen grünen Eidechse vom Wanderweg direkt in den stillgelegten Schacht hinterherzurennen.
Und was habe ich seitdem gelernt? Dreizehn Jahre später? Also, der Anzahl von Einsatzfahrzeugen unterschiedlichster Art entlang der Straße nach zu urteilen … nicht besonders viel.
Daher ziehe ich erst in diesem Moment ernsthaft in Betracht – während ich von heulenden Sirenen, einer auf einen tratschwürdigen Blick erpichten Menschenmenge und dem allgemeinen Chaos einer guten Idee umgeben bin, die sich als sehr schlecht erwiesen hat –, dass meine Eltern möglicherweise doch nicht ganz falsch liegen.
Denn wenn man dir Handschellen anlegt und dich auf den Rücksitz eines Polizeiwagens drückt, bleibt dir irgendwie nicht viel anderes übrig, als dein bisheriges Verhalten zu überdenken.
Völlig verkohlt
Die Polizeiwache riecht nach verbranntem Toast. Als hätte jemand eine Scheibe Brot zu lange getoastet. Vielleicht hängen noch Rußteilchen vom Feuer in meinen Nasenlöchern. Aufmüpfige blinde Passagiere, die sich in meinen Atemwegen festgesetzt haben, wie ein nerviger Gast, der sich lange, nachdem die Party vorbei ist, weigert zu gehen.
Und glaubt mir, die Party ist so was von vorbei.
Ich weiß nicht, wie viel von dem Haus die Feuerwehrleute haben retten können. Als man mich im Polizeiwagen wegbrachte, verschlangen die Flammen das Gebäude immer noch unbarmherzig.
Ich habe das Gefühl, schon seit Ewigkeiten in diesem stickigen kleinen Raum zu sitzen. Es ist wohl der Pausenraum, denn in der Ecke steht ein Tisch mit einer Kanne Kaffee auf einer rostigen elektrischen Heizplatte und alle fünf Minuten kommt ein Polizist herein, schenkt sich einen Styroporbecher voll und sieht mich mit hochgezogenen Augenbrauen an, die ausdrücken: »Mann, hast du einen Ärger am Hals.«
Hier drin gibt es absolut nichts zu tun. Nichts zu lesen und nichts anzuschauen außer der Uhr an der Wand. Und glaubt mir, die ist hundertprozentig kaputt. Sie tickt ungelogen nur alle fünf Sekunden.
Ein dicker Kerl mit schütterem Haar steckt immer wieder den Kopf herein, um mir zu versichern, dass er »sich um alles kümmert« und ich mir »keine Sorgen zu machen brauche«. Angeblich ist er der Sozialarbeiter, dem man meinen Fall zugewiesen hat. Und ich denke bloß: »Toll, jetzt bin ich ein Fall.«
Ich warte die ganze Zeit darauf, dass sie Shayne hereinbringen. Wenigstens könnte ich mich dann mit jemandem unterhalten. Sie stand direkt neben mir, als die Polizei auftauchte … und die Feuerwehrfahrzeuge, und die Krankenwagen, und die Kleinbusse mit den Fernsehteams. Ihre letzten Worte, bevor ich in Handschellen abgeführt wurde, waren: »Mach dir keine Sorgen, Brooks, wir stehen das zusammen durch.«
Aber in den letzten sechs Stunden scheine nur ich das durchzustehen. Oh, und Phil, der »Sozialarbeiter«, der viel zu froh darüber ist, so früh am Morgen hier sein zu müssen. Shayne sitzt vermutlich in einem anderen Raum. So machen sie das immer in Filmen – trennen die Kriminellen, um zu sehen, wer als Erster redet. Na ja, wenn sie glauben, dass ich meine beste Freundin verpfeife, können sie noch lange warten.
Okay, die ganze Sache war zugegebenermaßen ihre Idee. Doch ich habe Ja gesagt. Ich habe alle ins Haus gelassen. Ich habe den Ofen angemacht …
Zum Glück war es nicht unser Haus. Genau genommen war es niemandes Haus. Das war ja das Geniale an der Sache. Zumindest hätte es das Geniale an der ganzen Sache sein sollen. Es ist schon komisch, wie das Wort »genial« eine völlig neue Bedeutung bekommen kann, wenn man um sieben Uhr morgens auf einer Polizeiwache sitzt.
Perspektive.
Auch ätzend.
Denn laut Phil ist die Tatsache, dass es nicht mein Haus war, nicht unbedingt eine gute Sache. Es ist alles furchtbar verwirrend, und ich bin ein wenig überfordert. Alle haben mit Wörtern wie »unbefugtes Betreten«, »Brandstiftung«, »Gefängnisaufenthalt« und »Alkoholkonsum Minderjähriger« um sich geworfen, und ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Na ja, vom »Alkoholkonsum Minderjähriger« abgesehen. Damit bin ich leider ziemlich vertraut. Vor allem jetzt, da die Wirkung des Punschs anfängt nachzulassen und der Kater einsetzt. Glaubt mir, es macht diese Situation kein bisschen besser. In diesem Moment wünsche ich mir wirklich, ich würde Kaffee mögen. Sogar die abgestandene Kanne Kaffee auf dem Tisch in der Ecke scheint mir allmählich eine bessere Option als die wirbelsturmartigen Kopfschmerzen, die sich gerade über meinen Schläfen zusammenbrauen. Ich versuche zu schlafen, indem ich den Kopf auf die Tischplatte lege, aber die harte Holzoberfläche macht das Hämmern nur noch schlimmer. Würde es sie umbringen, mir eine Kopfschmerztablette zu geben? Oder ein Beruhigungsmittel?
Um kurz nach zehn öffnet sich noch einmal quietschend die Tür, und ich rechne schon mit einem weiteren missbilligenden Blick von einem von Colorados Freunden und Helfern. Der uniformierte Polizist, der dem eingravierten Namen auf seiner Dienstmarke zufolge »Banks« heißt, kommt herein, schaut erst auf das Klemmbrett in seinen Händen und dann zu mir und sagt: »Brooklyn Pierce?«
Ich nicke, den hämmernden Kopf weiterhin in die Hände gestützt. »Ja?«
Ich bete, dass er mir gleich mitteilt, dass ich nach Hause gehen kann. Oder dass Shayne im anderen Raum auf mich wartet. Oder dass die »Du kommst aus dem Gefängnis frei«-Fee gekommen ist, um ihren Zauberstab zu schwingen und mich von hier wegzuzaubern.
Aber er sagt nichts von alledem. Stattdessen runzelt er die Stirn und mustert mich mit verwirrter Miene, als würde er versuchen, sich an die Hauptstadt von irgendeinem unbekannten mittelamerikanischen Land zu erinnern. »Du bist nicht zufällig Baby Brooklyn, oder? Das kleine Mädchen, das vor vielen Jahren in einen Schacht gefallen ist?«
Klasse, denke ich mit einem Stöhnen. Genau, was ich jetzt brauche. Berühmt dafür, Schlagzeilen zu machen.
»Ja, das war ich.«
Officer Banks zieht die Augenbrauen hoch, scheinbar beeindruckt von meinem Promistatus. »Wow. Im Ernst? Wie war’s denn so da unten? Hattest du Angst?«
»Ich kann mich nicht daran erinnern«, antworte ich zähneknirschend. »Ich war damals erst zwei.«
Er scheint meinen verärgerten Tonfall gar nicht zu bemerken, denn er redet einfach weiter. »Wie bist du noch mal da unten gelandet? Bist einem Kaninchen oder so was hinterhergerannt?«
»Eidechse«, murmele ich.
»Ich wette, du bereust das mittlerweile?«, bemerkt Banks mit einem Glucksen, das mir auf die Nerven fällt. »Nicht gerade die schlauste Entscheidung der Welt, was?«
»Wollten Sie mir irgendwas Bestimmtes mitteilen?« Ich zeige mit dem Kopf hoffnungsvoll auf sein Klemmbrett.
»Oh, ja«, antwortet er und kehrt in die Gegenwart zurück. »Gute Neuigkeiten. Wie’s aussieht, kannst du nach Hause gehen.«
GOTT sei Dank!
Ich springe von meinem Stuhl auf und stürme auf ihn zu, weil ich am liebsten die Arme um seine korpulente Mitte schlingen und ihn drücken würde. Natürlich reiße ich mich zusammen.
»Danke, danke, danke!«, schreie ich. Es ist wirklich allerhöchste Zeit, dass sie mich aus diesem elenden Loch rauslassen.
Ich denke an mein weiches, bequemes Bett, mein flauschiges weißes Kissen, meinen sauberen Baumwollschlafanzug. Frische Unterwäsche. Zahnpasta und Mundwasser. All die Dinge, die man als selbstverständlich betrachtet, bis man sechs Stunden lang an einem Ort wie diesem festsitzt.
Aber meine Erleichterung ist nur von kurzer Dauer. Denn die nächsten Worte, die aus seinem Mund kommen, sind die furchterregendsten, die ich bisher in dieser Nacht gehört habe. Furchterregender als »Brandstiftung«, furchterregender als »unbefugtes Betreten«, sogar furchterregender als »Gefängnisaufenthalt«.
Officer Banks nimmt das Klemmbrett herunter und schenkt mir ein mitfühlendes Augenzwinkern. »Deine Eltern sind hier.«
Echte Freunde lassen ihre Freunde keine Fajitas kochen
Es ist nicht so, als hätte ich den elterlichen Faktor in dieser Gleichung nicht in Betracht gezogen. Ich habe mich bloß mit voller Absicht entschieden, nicht daran zu denken. Und es vorgezogen, in einer Welt zu leben (wenn auch nur in meiner Fantasie), in der es Eltern einfach nicht gibt.
Es gibt ein Wort für so ein Verhalten, wisst ihr. Man nennt es verleugnen.
»Sie haben noch einen frühen Flug aus Boston erwischt«, erklärt mir der Officer, als er die Tür öffnet und mich durch eine Reihe von Gängen führt.
Boston. Es hat alles mit Boston, Massachusetts, angefangen. Oder, wie mich meine perfekte und vernünftige ältere Schwester, die nie ein Haus niederbrennen würde, schnell verbessern würde, mit Cambridge, Massachusetts. Heimat der Harvard-Universität. Einer Uni für Leute, die guteEntscheidungen treffen. Entscheidungen, aufgrund derer man nicht auf nach verbranntem Toast riechenden Polizeiwachen landet.
Mit anderen Worten, einer Uni für Leute wie Isabelle Pierce.
Und Anfang Oktober findet jedes Jahr ein Wochenende statt, das besonders den stolzen Eltern dieser herausragenden Musterexemplare, die nie ein Haus niederbrennen würden, gewidmet ist. Es nennt sich »Familienwochenende«. Aber man hätte es genauso gut »Elternwochenende« nennen können, denn ich kann mich als offizielles Mitglied der »Familie« nicht daran erinnern, eine Einladung erhalten zu haben. Nicht dass ich hingegangen wäre. Nicht dass es mir auch nur in den Sinn gekommen wäre, hinzugehen. Vor allem, als ich erfuhr, dass »Familienwochenende« auch »Brooklyn hat das ganze Haus für sich allein Wochenende« bedeutet. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass irgendwann beide Bezeichnungen komplett gestrichen und einfach ersetzt werden durch »Das Wochenende, an dem Brooklyn ein Musterhaus niederbrannte«.
Ein Tag, auf den wir irgendwann einmal zurückblicken und gemeinsam darüber lachen können.
Alles klaaaar.
Ich gebe Izzy die Schuld. Wenn sie es nicht auf eine so angesehene und versnobte Uni geschafft hätte, wären meine Eltern nie übers Wochenende weggefahren, und ich hätte nie die Gelegenheit gehabt, Shaynes genialer Idee (jedenfalls schien sie das zu dem Zeitpunkt zu sein) zuzustimmen. Wenn meine Schwester einfach so eine tierische Versagerin wie ich wäre, würde sie vermutlich zu Hause wohnen, auf irgendein lahmarschiges Gemeinde-College im Stadtzentrum von Denver gehen, und nichts davon wäre passiert. Dann würde ich jetzt friedlich in meinem Bett schlafen und die letzten gesegneten Stunden des Wochenendes genießen, anstatt hier zu sitzen und die letzten paar Schritte zu meiner Hinrichtung zu machen.
»DU HAST MEIN MUSTERHAUS ABGEBRANNT?!«
Offensichtlich sieht mich meine Mutter, bevor ich sie sehe, und legt direkt los.
»Wie konntest du so etwas tun?«, brüllt sie, noch bevor ich mit beiden Beinen im Eingang stehe.
»Camille.« Mein Vater legt ihr sanft eine Hand auf die Schulter. »Wir haben uns versprochen, ruhig und vernünftig damit umzugehen.«
»Das war in einer Höhe von zehntausend Metern«, gibt meine Mom knurrend zurück. »Das hier ist der Eingang der Polizeiwache von Parker! Von vernünftig kann hier überhaupt nicht mehr die Rede sein!«
»Es war ein Unfall, ehrlich«, setze ich an, doch mein Dad bringt mich mit einem Blick zum Schweigen, der besagt: »Sei still, wenn du das überleben willst.«
»Ein Unfall?«, brüllt meine Mom. »Ein Unfall! Und in mein Büro zu schleichen, meine Schlüssel zu stehlen und einen Raver in dem Musterhaus meines bisher größten Bauprojekts abzuhalten, war dann wohl auch ein Unfall, ja?!«
Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Mom »Rave« meint, aber ich bin so schlau, sie nicht zu korrigieren. Vermutlich die erste kluge Entscheidung, die ich seit Langem getroffen habe.
Officer Banks räuspert sich, und wir drehen uns alle zu ihm um. Überraschenderweise scheint es ihn kein bisschen zu stören, unserem Familienstreit beiwohnen zu müssen. Vermutlich sieht er so was ständig. Schließlich ist es nicht so, als hätte die Polizei in dieser Stadt irgendetwas Besseres zu tun, als jugendliche »Ravers« zu beenden. Parker, Colorado, ist nicht gerade eine Hochburg des organisierten Verbrechens. Letztes Jahr wurde ein College-Student dabei erwischt, als er Gras aus dem Kofferraum des Geländewagens seiner Mutter verkaufte, und die ganze Stadt redet immer noch über diesen »unglaublichen Skandal«. Leider verheißt das nichts Gutes, was meinen Plan betrifft, diese ganze Angelegenheit einfach aus meinem Gedächtnis zu streichen.
»Lasst uns zu Hause darüber reden«, schlägt mein Dad vor und nickt dem Polizisten entschuldigend zu.
Ohne ein weiteres Wort wirbelt meine Mom herum und stürmt aus der Tür. Ich kann den Rauch praktisch sehen, den sie hinter sich herzieht.
»Wir werden Bob anrufen müssen«, sagt mein Dad, als er auf den Highway 83 fährt. Nachdem ich die ganze Nacht in der Polizeiwache eingesperrt gewesen bin, blendet mich die strahlende Morgensonne. Meine Mom starrt mit leerem Blick aus dem Beifahrerfenster. Eigentlich wirkt ihr Blick nur leer. Ich kenne sie gut genug, um zu wissen, dass Leere das Letzte ist, was gerade in ihrem Kopf herrscht. Diesen Gesichtsausdruck hat sie immer, wenn sie sich von jemandem hintergangen fühlt. Eine beunruhigende Mischung aus Wut, Traurigkeit und »Was habe ich getan, um das zu verdienen?«. Bei dem Blick möchte man sich regelrecht vor Schuldgefühlen übergeben.
»Wer ist Bob?«, melde ich mich mutig zum ersten Mal zu Wort, seit wir die Polizeiwache verlassen haben. Meine Mom hat zu meiner Überraschung noch keinen Ton gesagt.
»Unser Familienanwalt«, antwortet mein Dad.
»Oh«, murmele ich schwach, so niedergeschlagen und emotional erschöpft fühle ich mich. Aber was ich wirklich fragen will, ist: »Wir haben einen Familienanwalt?« Komisch, dass ich das bisher nicht wusste. Vermutlich, weil wir ihn bis jetzt nie wirklich brauchten. Vielleicht sollte ich vielmehr sagen … bis ich kam.
»Ich hoffe, dass er die Anklage wegen Brandstiftung abschmettern kann«, denkt mein Dad laut nach. »Aber die wegen unbefugten Betretens wird sich nur schwer abstreiten lassen. Außer dir hatte sonst niemand Zugang zu den Schlüsseln des Musterhauses. Und was die Anklage wegen Alkoholkonsums Minderjähriger betrifft, lässt sich nichts machen. Als sie dich auf die Wache gebracht haben, war dein Blutalkoholgehalt jenseits von Gut und Böse. Zum Glück ist niemand verletzt worden. Sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich auch noch eine ernstzunehmende Klage am Hals.«
Glück.
Es rauschen gerade Millionen unterschiedlicher Gefühle durch mich hindurch, aber »Glück« ist bestimmt nicht dabei.
Mein Dad fährt durch das Labyrinth von Straßen in unserer Siedlung, bis wir schließlich in unserer Garage parken. Er hat den Motor noch gar nicht abgeschaltet, als meine Mom ihren Gurt löst, die Tür öffnet und ins Haus stapft. Manchmal kommt mir ihr Schweigen schlimmer vor als ihr Geschrei. Und in diesem Augenblick wäre es mir fast lieber, sie würde mich weiter anschreien. Zumindest wüsste ich dann, was sie denkt.
Mein Dad hingegen ist wie immer völlig gefasst. Gelassen. Ausgeglichen. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft er im Laufe meines Lebens die Beherrschung verloren hat. Alle Leute sagen, dass sich meine Eltern perfekt ergänzen würden. Wie ein Luftballon, der an einen Stein gebunden ist. Bis zu diesem Moment hatte ich nie richtig verstanden, was sie damit meinten.
»Was genau bedeutet Brandstiftung?«, frage ich meinen Dad, während ich mich losschnalle, ohne mich vom Platz zu rühren. Obwohl ich es eigentlich kaum erwarten konnte, endlich zu Hause zu sein, habe ich es gerade absolut nicht eilig, reinzugehen.
Mein Dad atmet tief durch. »Es bedeutet, dass sie glauben, du hättest das Feuer absichtlich gelegt.«
Ich spüre, wie mir Panik die Kehle zuschnürt. »Das hab ich nicht!«, kreische ich. »Ehrlich!«
Mein Dad sieht mich im Rückspiegel an. Trotz der Enttäuschung, die seine Miene unübersehbar zeichnet, ist da auch eine Spur von Mitleid. »Ich weiß, Brooks«, sagt er mit einer beunruhigenden Schärfe in seinem sonst herzlichen Tonfall. »Genau deshalb brauchen wir einen Anwalt.«
Genau genommen habe ich das Feuer gelegt. Aber ich lüge nicht, wenn ich sage, dass es ein Unfall war. Auch wenn ich entscheidungstechnisch eine Niete sein mag, bin ich definitiv kein Feuerteufel. Ich dachte bloß, dass Fajitas die Party noch viel besser machen würden. Okay, ich geb’s zu, ich war nicht ganz bei Sinnen, als ich zu diesem Schluss kam. Und ich habe wohl ein für alle Mal bewiesen, dass Punsch trinken und Fajitas kochen einfach nicht zusammenpassen. Vor allem, wenn sich herausstellt, dass das »frische Gemüse«, das man zum Kochen benutzt, aus Plastik ist, wie so viele andere Sachen in einem Musterhaus. Natürlich fingen die »grünen Paprika« und »Tomaten« ziemlich schnell an zu brennen, und die eleganten Stoffservietten, mit denen ich die verkohlten Requisiten aus der Pfanne holte, erwiesen sich als überraschend entzündlich. Und bevor ich wusste, was los war, rannten hundert betrunkene Teenager um das Haus herum und schrien »Feuer!«, und im nächsten Augenblick legte man mir auch schon Handschellen an.
So sollte es eigentlich nicht ablaufen.
Es sollte die Party des Jahrhunderts werden … des Jahrtausends. Ein Ereignis, für das ich in die Geschichte eingehen würde. Das mir einen Platz in der Hall of Fame der Parker Highschool garantieren würde. Zumindest hatte Shayne mir das versprochen.
Oh Gott, Shayne. Ich hoffe, sie halten sie nicht mehr in der Polizeiwache fest. Ihre Eltern haben sie bestimmt schon vor Stunden dort abgeholt. Oder?
Ich schlappe ins Haus, schnappe mir das Telefon von der Ladestation in der Küche und nehme es mit nach oben. Ich habe meine Eltern noch nicht darüber informiert, dass ich ein neues Handy brauchen werde, weil meins unter einem Haufen verkohlter Trümmer inmitten einer unbewohnten, mehrere Millionen Dollar teuren Siedlung begraben ist. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht der richtige Zeitpunkt war, um Forderungen zu stellen.
Ich schließe meine Schlafzimmertür und wähle Shaynes Nummer. Nach dem zweiten Klingeln schaltet es direkt auf ihre Voicemail, weshalb ich eine schnelle und ziemlich hektische Nachricht hinterlasse.
»Shayne«, hauche ich in den Hörer, »ich habe dich auf der Polizeiwache nicht gesehen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass bei mir alles in Ordnung ist. Na ja, größtenteils. Ich bin jetzt zu Hause. Aber wie’s aussieht, muss ich am Montagmorgen vor Gericht erscheinen. Ätzend, was? Es tut mir so leid. Diese ganze Sache ist total scheiße. Ich hoffe nur, dass du nicht zu viel Ärger hast. Wie auch immer, ruf mich an, damit wir über alles reden können. Oh, und ich habe mein Handy bei dem Brand verloren, du musst mich also zu Hause auf dem Festnetz anrufen. Okay. Tschüss.«
Ich lege auf und werfe das Telefon auf den Schreibtisch.
Bitte lass es ihr gut gehen.
Ich fühle mich hundeelend. Wegen allem. Wegen Shayne. Wegen des bevorstehenden Gerichtstermins morgen. Wegen des Musterhauses – oder was einmal das Musterhaus war. Dieses neue Siedlungsprojekt sollte eigentlich der Durchbruch meiner Mutter als Objektentwicklerin werden. Es sollte ihrer Firma den Weg zum Ruhm ebnen.
Vermutlich bin ich nicht die Einzige, die seit heute Abend weg vom Fenster ist.
Als ich schließlich auf meinem Bett zusammenbreche, quälen mich die Gedanken und Bilder, die mir durch den Kopf schwirren. Feuer und Schuldgefühle. Sirenen und Gewissensbisse. Uniformierte Polizisten und ihre missbilligenden Blicke. Obwohl ich völlig erschöpft bin, ist an Schlafen praktisch nicht zu denken. Und obwohl meine Augenlider schwer sind, bleiben sie für den Rest des Morgens offen.
Meine Schuldgefühle halten mich wach.
Nichts für ungut
Shayne sagt immer, dass nur faule Mädchen Pferdeschwanz tragen. Im Fitnessstudio oder zu Hause ist das okay, aber wer in der Schule mit Haaren auftaucht, die durch ein Gummiband gestopft sind, teilt der ganzen Welt mit: »Ich war heute Morgen zu müde, um mir Mühe zu geben.«
Die äußere Erscheinung ist ihr sehr wichtig. Der erste Eindruck zählt. Wie man sich der Öffentlichkeit präsentiert, bestimmt, was Leute von einem halten. Und da alle große Stücke auf Shayne halten, ist es schwer, nicht mitzuschreiben, wenn sie ihre wertvollen Weisheiten von sich gibt. Ich meine, wenn irgendjemand Perfektion und sicheres Auftreten verkörpert, dann Shayne.
Ich will am Montagmorgen nicht aufstehen und mich der Sache stellen, aber ich kann Shaynes Stimme in meinem Kopf hören, wie sie mich daran erinnert, dass es in der Welt des guten Eindrucks keine Feiertage gibt. Keine Krankheitstage. Keinen bezahlten Urlaub. Den Schein zu wahren ist ein Vollzeitjob. Denn wenn man das Glück hat, in Shaynes exklusive Gesellschaft aufgenommen zu werden, betrachten einen die Leute anders. Vermutlich sollte ich vielmehr sagen, dass sie einen ständig betrachten. Denn während all der Zeit, in der wir befreundet gewesen sind, kann ich mich nicht daran erinnern, kein Publikum gehabt zu haben. Shayne ist so was wie eine örtliche Berühmtheit. Die Leute achten auf alles, was sie tut. Und wenn du direkt neben ihr stehst, achten sie auch auf dich.
Wie an vielen anderen lustlosen Tagen ist das der Gedanke, der mich schließlich aus dem Bett und unter die Dusche treibt. Folglich ist das auch der Gedanke, der mich während meines täglichen neunzigminütigen Beauty-Programms anspornt. Die Auswahl des richtigen Outfits ist nur der Anfang. Und allein das kann eine beängstigende Aufgabe sein, weil es das Finden einer Kleiderkombi erfordert, die körperlich vorteilhaft ist, teuer aussieht, trendy, angemessen provokativ und doch für die Schule geeignet, auf keinen Fotos mit der Schlagzeile »Fashion-Polizei« oder Ähnlichem aufgetaucht ist, sowie nicht aus Teilen zusammengesetzt sein darf, in denen man in den letzten zwei bis drei Monaten gesehen worden ist. Dann kommt Make-up, Frisieren, Selbstbräuner auftragen, Polieren, Eincremen, Einsprühen, Bronzen, Augenbrauenzupfen, Feuchtigkeitscreme auftragen – während einem die ganze Zeit eine allumfassende Frage durch den Kopf geht: »Ist das gut genug?« Wenn die Antwort nicht mit einem Ausrufezeichen endet, sollte man schleunigst wieder von vorne anfangen und einen weiteren Versuch starten.
»Okay« reicht nie. »Hammer!« ist die einzige Option.
Und heute muss ich die zusätzliche Frage hinterherschieben: »Kann ich das vor Gericht tragen?«
Anwalt Bob behauptet, er würde mich seit meiner Kindheit kennen. Er sagt, meine Schwester und ich wären früher im Sommer immer zu ihm gekommen, um in seinem Swimmingpool zu schwimmen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und es gibt ihm bestimmt auch nicht das Recht, seine Hand auf mein Knie zu legen, wenn er mit mir spricht. Ich bin jetzt fünfzehn, nicht fünf. Vielleicht war das irgendwann mal eine liebenswerte Geste. Jetzt ist es einfach nur widerlich.
Doch ich beschwere mich nicht, weil er seinen Job, die Richterin davon zu überzeugen, dass ich keine Gefahr für die Gesellschaft darstelle und für meine »Verbrechen« leicht davonkommen sollte, offenbar ziemlich gut macht.
Mal ganz nebenbei, ich kann diesen Ausdruck – »Verbrechen« – wirklich nicht ausstehen. Ich wünschte, sie würden aufhören, ihn in Zusammenhang mit meinem Namen zu benutzen. Aber was kann ich schon tun? Wie sich herausstellt, ist es tatsächlich illegal, den Schlüssel zu einem Musterhaus zu klauen (unabhängig davon, ob deine Mutter die Bauherrin ist oder nicht). Es nennt sich »unbefugtes Betreten«, und dem nicht nachlassenden, finsteren Blick der Richterin nach zu urteilen vermute ich, dass es auch extrem verpönt ist.
Bob kommt offenbar gerade zum Ende seiner kleinen Rede. Er spricht von Feuerwehrberichten und fehlendem Vorsatz. Ich verstehe nur Bahnhof, doch es klingt beeindruckend, und darauf kommt es wohl an. Er endet mit einem gelassenen Kopfnicken und nimmt dann wieder neben mir Platz.
»Ich glaube, es läuft gut.« Bob beugt sich vor und keucht mir ins Ohr: »Der Brandursachenermittler hat bereits bestätigt, dass das Feuer nicht vorsätzlich gelegt wurde, und diese Richterin geht mit Ersttätern immer sehr milde um.«
Es gibt noch ein anderes Wort, das ich nach den vergangenen sechsunddreißig Stunden absolut nicht leiden kann: »Straftäter«. Woher kommt dieser Begriff überhaupt? Es ist nicht so, als hätte ich irgendjemanden bestraft. In dem Haus hat noch nicht mal jemand gewohnt. Es war voller Plastikrequisiten und Fotorahmen mit Bildern von Katalogmodels. Niemand sollte sich von mir bestraft fühlen.
Na ja, außer meiner Mom vielleicht. Sie sitzt im Gerichtssaal in der ersten Reihe. Der »Blick« ist immer noch nicht von ihrem Gesicht verschwunden. Sie hat seit gestern Morgen kaum ein Wort mit mir gewechselt. Ich weiß nicht, ob sie wütend oder deprimiert ist oder einfach an Verstopfung leidet, weil sie in Boston zu viel Muschelsuppe gegessen hat.
Aber glaubt mir, ich habe das nicht getan, um sie wegen irgendwas zu bestrafen. Ehrlich. Ich habe nicht mal an sie gedacht, als ich Shaynes Bitte zustimmte, das Musterhaus für unsere Party zu benutzen. Und vielleicht war genau das das Problem. Vielleicht hätte ich an meine Mutter denken sollen.
Ich hätte wohl an viele Dinge denken sollen.
Wie zum Beispiel, ob ich die restliche Zeit meines zweiten Highschooljahrs hinter Gittern verbringen will.
Meine Mom umklammert fest den Arm meines Dads. Ich kann absolut nicht sagen, auf wessen Seite sie gerade ist. Will sie, dass ich ins Gefängnis gehe? Oder will sie, dass ich mit einer Verwarnung davonkomme? Könnte sie wirklich so wütend sein, dass sie mich hinter Gittern sehen will? Ich meine, ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, aber ich bin immer noch ihre Tochter. Jedenfalls, soweit es mich betrifft.
»Brooklyn Pierce.« Die raue, heisere Stimme der Richterin lässt mich aufschrecken, und ich drehe mich wieder nach vorne. Es besteht für mich kein Zweifel, dass sie sich an mich richtet, weil sie mich direkt ansieht. Nicht meinen Anwalt. Nicht meine Eltern. Sondern mich.
Ich schlucke schwer und versuche das Hämmern in meinen Ohren auszublenden, während ich mein Schicksal erwarte.
»Ich habe viele Fälle gesehen, bei denen Alkoholkonsum Minderjähriger eine wesentliche Rolle gespielt hat«, setzt die Richterin an, wobei eine breite, zerklüftete Linie ihre Stirn zerfurcht, »aber ich habe in den fünfundzwanzig Jahren, in denen ich diesem Gericht vorsitze, noch nie einen so enttäuschenden, beklagenswerten und eklatanten Mangel an Urteilsvermögen seitens einer Jugendlichen erlebt.«
Also das kann nichts Gutes heißen.
Von irgendwo hinter mir höre ich ein Wimmern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es meine Mom ist. Das besänftigende Flüstern meines Dads kann sie kaum beruhigen.
Bob greift nach unten und legt mir wieder seine Hand aufs Knie. Es soll wohl eine beruhigende Geste sein, aber sie macht mich nur noch nervöser.
Die Richterin redet immer noch. »Wenn Sie Ihr Verhalten nicht ändern, junge Dame, und ein wenig gesunden Menschenverstand an den Tag legen, werden Sie mit Bestimmtheit bald wieder in diesem Gerichtssaal landen. Und glauben Sie mir, das nächste Mal werde ich nicht so nachsichtig sein.«
Nachsichtig? Hat sie gerade nachsichtig gesagt? Nachsichtig ist gut, oder? Nachsichtig ist das, worauf wir laut Bobs ständigen Versicherungen hoffen. Nachsichtig bedeutet, dass ich das nächste Jahr nicht in einem orangefarbenen Overall verbringen werde.
»Ich erteile Ihnen nur eine Verwarnung, Ms Pierce«, erklärt die Richterin streng. »Und die spreche ich hiermit aus.«
Juhu! Sie lässt mich mit einer Verwarnung davonkommen!
Innerlich sprudele ich über vor Freude. Ich springe fast übermütig und lachend von meinem Stuhl auf.
»Zweihundert Stunden gemeinnützige Arbeit, und ich will Sie nie wieder in meinem Gerichtssaal sehen.«
Moment mal, WAS?
Der Hammer knallt herunter, und bevor ich irgendetwas sagen kann, erhebt sich Bob von seinem Platz und tätschelt mir mit einem riesigen Grinsen im Gesicht unbeholfen den Kopf. »Wir haben es geschafft, Brooks! Glückwunsch!«
Glückwunsch?
»Aber was hat sie da am Schluss gesagt?«
»Gemeinnützige Arbeit!«, ruft Bob aus, als würde er seiner fünfjährigen Tochter einen Ausflug nach Disney World anpreisen. »Ist das nicht toll?«
»Zweihundert Stunden gemeinnützige Arbeit?« Ich bringe die Worte kaum über die Lippen. »Aber das ist wie … lebenslänglich!«
Bob wischt meine Bedenken mit einer Handbewegung beiseite. »Oh, die werden wie im Flug vergehen. Du wirst schon sehen. Glaub mir, Brooks. Das ist ein gutes Ergebnis.«
»Wirklich?«
Er fängt energisch an zu nicken, während er seinen Ordner zuklappt und in seinen Aktenkoffer steckt. »Du solltest jetzt vor Freude auf und ab springen. Es hätte viel schlimmer kommen können.«
Vermutlich hat er recht. Ich sollte dankbar sein. Sogar meine Mom scheint sich über dieses Urteil zu freuen. Sie schenkt mir ein angedeutetes Lächeln, bevor sie sich zum Gang dreht und den Gerichtssaal verlässt. Sie war wohl doch auf meiner Seite.
Zweihundert Stunden sind aber eine verdammt lange Zeit. Ich glaube, ich würde nicht mal so lange fernsehen wollen. Geschweige denn gemeinnützig arbeiten.
Während Dad Bobs Hand schüttelt und alle möglichen begeisterten Dankesfloskeln von sich gibt, schaue ich mich im Gerichtssaal um, in der Hoffnung, Shayne zu sehen. Sie hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet. Ich kann nur hoffen, dass sie mit allen anderen in der Schule ist.
Aber was, wenn nicht?
Was ist, wenn sie irgendwo in einer dreckigen Gefängniszelle sitzt, weil ihre Richterin nicht so nachsichtig war? Ich weiß einfach nicht, ob ich in dem Fall noch mit mir leben könnte.
Meine Mom, mein Dad und ich verlassen das Gerichtsgebäude und laufen schweigend über den Parkplatz. Als ich im Wagen sitze, werfe ich sofort einen Blick auf die Uhr am Armaturenbrett. Es ist kurz nach zehn. Ich habe schon zwei Unterrichtsstunden verpasst.
Es ist irgendwie ironisch. Jedes Mal, wenn ich mir etwas Schlaues einfallen lassen wollte, wie ich den Unterricht schwänzen könnte, war mir dieses besondere Szenario nie in den Sinn gekommen.
Aber auch wenn es mir total davor graut, den Fuß in dieses Gebäude zu setzen und mich Tratsch, Blicken und Spott auszusetzen, möchte ich unbedingt herausfinden, ob Shayne dort ist. Ob es ihr gut geht. Doch als wir die Schnellstraße entlangfahren und uns der Antwort auf diese Fragen immer weiter nähern, kommt mir ein beunruhigender Gedanke. Wenn sie dort ist – wenn es ihr gut geht –, warum habe ich dann nichts von ihr gehört?
Shaynes Welt
Shayne Kingsley ist der Mittelpunkt des Universums. Das strahlende, glänzende Objekt, um das alles andere kreist. Sollte ihr je etwas Schlimmes zustoßen, würde die Galaxie einfach in sich zusammenfallen. Alles wäre völlig aus dem Lot, und wir würden alle einfach in den Weltraum hinaustrudeln und von einem riesigen schwarzen Loch verschluckt werden.
Shayne und ich sind seit der fünften Klasse befreundet. Und die letzten fünf Jahre waren bei Weitem die besten meines Lebens. Denn wenn Shayne Kingsley einen in ihren Freundeskreis aufnimmt, wird alles einfach besser. Leute behandeln einen wie Adel. Jungs fragen, ob man mit ihnen ausgehen will. E-vites zu Partys von Leuten, die du noch nie getroffen hast, erscheinen auf einmal in deinem Posteingang. Es ist das tollste Gefühl der Welt.
Man könnte sagen, dass alles, was Shayne berührt, zu Gold wird. Wenn man ein Mädchen ist und sie freundet sich mit einem an, ist man praktisch automatisch in der Vorrunde für die Wahl zur Homecoming-Queen. Wenn man ein Typ ist und sie knutscht mit einem, hat man für den Rest seines Lebens keine Probleme mehr, ein Date zu finden.
So ist es gewesen, so lange ich mich erinnern kann. Sogar schon auf der Grundschule. Manche waren skeptisch, ob sie in der Highschool ihre Beliebtheit würde aufrechterhalten können, aber sie zeigte es ihnen allen sehr schnell. Shayne schaffte es schon in ihrem ersten Highschooljahr, das beliebteste Mädchen der Schule zu werden. Und zwar, indem sie mit einem Footballspieler aus der Oberstufe ausging, kaum dass sie einen Fuß in die Schule gesetzt hatte, nur um ihm ein paar Wochen später das Herz zu brechen, als sie ihn wie eine heiße Kartoffel fallen ließ. Doch das ist einfach Teil ihrer Vorgehensweise. Halte sie immer schön auf Abstand. So erweckst du den Eindruck, dass die Jungs hinter dir her sind.
Jetzt geht sie mit einem Studenten, der im zweiten Studienjahr an der Universität von Colorado Boulder ist. Er ist Mitglied in einer der beliebtesten Studentenverbindungen auf dem Campus und lädt sie ständig zu allen ihren fantastischen Partys und Bällen ein.
Aber egal, wen sie datet, Shayne ist schlicht wie ein Magnet. Leute werden einfach von ihr angezogen.
Es muss in der Familie liegen, denn Shaynes Vater ist wahnsinnig erfolgreich. Er ist bei Weitem der reichste Mann in der Stadt. Und einer der wohlhabendsten im ganzen Bundesstaat. Ich weiß nicht so recht, was er beruflich macht – und ehrlich gesagt, glaube ich nicht, dass Shayne es weiß –, doch ganz gleich, was es ist, er macht es gut. Er ist immer kurz vor irgendeinem »großen Abschluss«, über den er nicht reden kann. Und Shayne lehnt sich einfach zurück und schlägt Profit daraus. Sie hat nie zweimal um etwas bitten müssen, das sie wollte.
Ich komme zum Ende der dritten Stunde in der Schule an. Die Gänge füllen sich schnell, als ich mir einen Weg zu Mathe bahne. Zum Glück ist es eines der Fächer, die Shayne und ich zusammen haben. Ich spüre, wie mich Leute anstarren, als ich an ihnen vorbeieile. Sie wissen Bescheid. Sie wissen alle Bescheid. Wie könnte es auch anders sein. Solche Neuigkeiten machen extrem schnell die Runde.
Ich platze in den Raum, gerade als die Glocke läutet, bin aber total enttäuscht, als ich sehe, dass Shaynes Stammplatz leer ist. Ich schleiche zur letzten Reihe und schlüpfe hinter mein Pult. Ein schreckliches Gefühl breitet sich in meiner Magengrube aus. Irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas ist ganz fürchterlich schiefgelaufen.
Das Merkwürdigste ist, dass Mr Simpson Shaynes Namen auslässt, als er die Anwesenheitsliste durchgeht. Er springt direkt von Jason Kim zu Heidi Larson. Als wäre sie einfach ausradiert worden.
Mir kommt es so vor, als würde ich mich in einer Art Paralleluniversum befinden, in dem Shayne Kingsley nicht mehr der Mittelpunkt von allem ist. Eigentlich existiert sie nicht einmal mehr.
Nach der Anwesenheitskontrolle fängt Mr Simpson sofort mit dem Unterricht an und schwafelt aufgeregt über Gleichungen. Dass sie jeweils zwei Seiten haben und sich immer ausgleichen müssen. Ohne Ausnahme.
Doch ich höre kaum zu. In meinem Kopf überschlagen sich die Gedanken. Ich treffe eine schnelle Entscheidung, hebe explosionsartig die Hand und unterbreche Mr Simpson mitten im Satz.
»Ja, Brooklyn?«, sagt er. »Hast du eine Frage?«
»Ähm, ja«, setze ich zögerlich an. »Warum haben Sie Shaynes Namen bei der Anwesenheitskontrolle nicht genannt?«
Er ist offenbar enttäuscht, dass meine Frage nicht themenbezogen ist, antwortet aber trotzdem. »Sie ist in meinen Kurs in der sechsten Stunde gewechselt.«
Diese Information haut mich fast vom Stuhl. »Was? Wann?«
Mr Simpson gibt ein heiteres Lachen von sich, als würde er diesen ganzen Wortwechsel total absurd finden. »Sie hat heute Morgen mit mir darüber geredet. Es gab da irgendeine Überschneidung mit einem ihrer Wahlfächer.«
Das schreckliche Gefühl breitet sich jetzt in meinen Glieder aus, und ich habe Schwierigkeiten, aufrecht in meinem Stuhl sitzen zu bleiben.
»Können wir jetzt mit dem Thema Gleichungen weitermachen?«, fragt er mit einem amüsierten Grinsen.
Ich nicke wie benommen, während ich auf meinem Stuhl immer tiefer rutsche. Innerlich schreie ich.
Sie ist hier.
Ihr geht es gut.
Sie ist nicht im Gefängnis.
Das kann also nur eins bedeuten … sie hat mich absichtlich ignoriert.
Die Charade-Königin
Okay, es muss noch eine andere Erklärung geben. Vielleicht wurde ihr Handy bei dem Brand auch zerstört. Vielleicht hat sie von ihrer Mom Hausarrest bekommen, als diese von der Party erfahren hat, und konnte mit niemandem reden. Ich meine, es lassen sich hier noch viele andere Schlüsse ziehen. Es erscheint mir albern und unvernünftig, automatisch vom Schlimmsten auszugehen.
Ich muss mit ihr reden. Ich kann nicht einfach hier sitzen und wild herumspekulieren. Bis zum Beweis des Gegenteils muss ich einfach darauf vertrauen, dass es einen guten Grund für ihr Verhalten gibt, und ihr die Chance geben, sich zu erklären.
Und zum Glück weiß ich genau, wo sie nach der vierten Stunde sein wird.
Ihr kennt doch diese berühmten Restaurants in L. A. und New York, in die Prominente gehen, um von Paparazzi fotografiert zu werden? Na ja, das beschreibt so ziemlich unsere Highschool-Kantine. Im kleineren Rahmen natürlich.
Es ist der Ort, an dem man sieht und gesehen wird. Wenn man den Kapitän der Footballmannschaft datet, knutscht man dort vor aller Welt mit ihm rum, damit alle Bescheid wissen. Wenn man gerade mit seinem Freund Schluss gemacht hat, setzt man sich dort demonstrativ neben den schärfsten Typen der Schule und flirtet schamlos mit ihm, um zu beweisen, dass man völlig über seinen Ex hinweg ist. Und genau inmitten des ganzen Trubels … steht Shaynes Tisch. Ich weiß nicht, ob sein Standort von Shaynes Wunsch herrührt, im Mittelpunkt des Interesses zu stehen, oder dem Wunsch der Schülerschaft, sie und ihre Freunde genau im Auge zu behalten. Es ist so eine typische Was-kam-zuerst-Geschichte: das Huhn oder das Ei. Aber wie auch immer, da steht er. Im Herzen der Kantine. Ein metaphorischer Scheinwerfer, der die ganze Zeit direkt auf sie gerichtet ist.
Wegen der ganzen, ihr wisst schon, Gerichtsgeschichte hatte ich keine Zeit, mir ein Pausenbrot zu machen, doch ich habe sowieso keinen großen Hunger. Deshalb umgehe ich die Essensschlange und steuere geradewegs auf den Tisch in der Mitte zu. Noch bevor ich ihn erreiche, sehe ich, dass Shayne schon dort sitzt.
Wie immer ist sie von einer Schar Leute umgeben und redet angeregt über die eine oder andere Sache.
Ich atme tief durch und bewege mich langsam auf den Tisch zu. Als ich näher komme, bemerke ich, dass mein Stammplatz auf Shaynes rechter Seite von irgendeinem Mädchen besetzt ist, das ich noch nie gesehen habe. Und ihr gegenüber sitzt noch ein anderes fremdes Mädchen. Als ich den Blick von Gesicht zu Gesicht schweifen lasse, stelle ich fest, dass der ganze Tisch praktisch voller Neulinge ist, von denen ich die meisten nicht einmal erkenne. Ja, da sind auch noch ein paar Leute von der Stammcrew, wie Bailey Reynolds, Krysta Garrett und Brittany Harlow (die ich gerne die siamesischen Drillinge nenne, weil sie immer zusammen sind und genau dieselbe Frisur haben), aber alle anderen sind absolute Newcomer. Leute, die noch vor einer Woche nicht die geringste Chance gehabt hätten, an Shaynes Tisch zu sitzen.
Es ergibt überhaupt keinen Sinn.
Ich beschließe, dass es Zeit ist, ein paar Antworten zu bekommen. Sie kann nicht einfach meine Anrufe ignorieren, sich aus meinem Mathekurs versetzen lassen und einen Haufen Nobodys an unseren Tisch einladen, ohne sich zu erklären. Es ist mir egal, wer sie ist. Deshalb marschiere ich von hinten an sie heran und tippe ihr schroff auf die Schulter.
Sie dreht sich um, und als sie mein Gesicht erblickt, wirft sie mir eines ihrer perfekt einstudierten Schönheitswettbewerbslächeln zu. Ich habe dieses Lächeln bestimmt schon eine Million Mal gesehen. Und mein Herz macht einen Sprung.
Denn ich weiß viel zu gut, dass sie dieses Lächeln immer aufsetzt, um den Schein zu wahren. Es ist eine unaufrichtige, diplomatische Maske, die sie nur trägt, wenn sie besonders unehrlich ist. Dahinter befindet sich … nichts.
»Hey, Brooks«, sagt sie fröhlich, während ihr einstudiertes Lächeln keinen Moment nachlässt.
»Hi, Shayne«, antworte ich und werfe einen Blick auf unseren mir jetzt unvertrauten Tisch. »Ich habe dich gerade in Mathe vermisst.«
»Oh, ja!«, sagt sie und schlägt sich leicht mit der Handfläche gegen die Stirn. »Das hatte ich ganz vergessen, dir zu sagen. Ich musste meinen Stundenplan umstellen, damit ich dieses Eigenständiges-Lernen-Projekt machen kann.«
Voll gelogen.
Shayne würde nie im Leben irgendetwas eigenständig lernen.
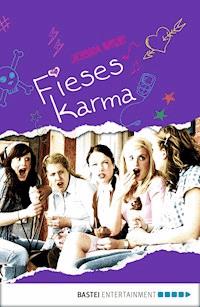

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










