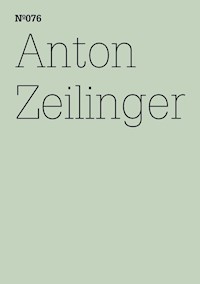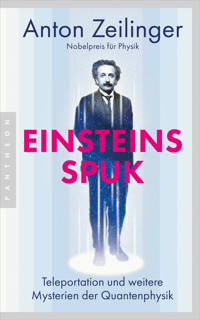
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Der Bestseller vom Gewinner des Nobelpreises für Physik 2022!
Der Wiener Experimentalphysiker Anton Zeilinger, von den Medien häufig als »Mister Beam« apostrophiert, hat mit bahnbrechenden Experimenten bewiesen, dass phantastisch anmutende Gesetzmäßigkeiten unsere Sicht der Welt komplett verändern können. Das Zauberwort heißt Quantenteleportation – ein Phänomen, das landläufig bekannt ist unter der Bezeichnung »Beamen«. Schon Einstein war diese »spukhafte Fernwirkung« bekannt (wenn auch nicht geheuer). Anton Zeilinger nun hat bewiesen, dass Informationen auf entfernte Partnerteilchen ohne ein Transportmedium übertragen werden können – etwa indem ein Lichtquantum am einen Ufer der Donau sich verändert, wenn das damit »verschränkte« Zwillingsteilchen am anderen Ufer eine Messung erfährt. Eine Entdeckung, die nicht nur die Informationstechnologie etwa mithilfe von Quantencomputern grundlegend weiterentwickelt hat. Mit »Einsteins Spuk« hat Anton Zeilinger höchst unterhaltsam und für den Laien verständlich revolutionäre Erkenntnisse der modernen Physik als faszinierende Abenteuergeschichte präsentiert und zugleich eine umfassende Einführung in die Quantenphysik.
Mit vielen Illustrationen und einem aktuellen Nachwort von Anton Zeilinger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Wie funktioniert Teleportation? Welche Experimente hat das Team um Anton Zeilinger durchgeführt, um Photonen zu verschränken? Was ist ein Quantum überhaupt? Und warum verhalten sich Teilchen wie Wellen?
Leicht verständlich und unterhaltsam stellt Anton Zeilinger Schritt für Schritt seine Experimente und die dahinter stehenden Gedanken aus der Quantenphysik dar. Alice und Bob, zwei Physikstudenten, die selbst gerade dabei sind, zu lernen, worum es in der Quantenphysik geht, begleiten den Leser auf seiner Entdeckungsreise in eine Welt voller faszinierender Rätsel und umwälzender Erkenntnisse.
Autor
Anton Zeilinger, geb. 1945, gilt nicht erst seit seinem Bestseller »Einsteins Schleier« als Popstar unter den Naturwissenschaftlern. Nach Stationen am MIT, an den Universitäten Melbourne, Oxford und Innsbruck, den Technischen Universitäten Wien und München und am Collège de France ist er heute Professor an der Universität Wien und am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Seine Arbeit wurde mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen gewürdigt, darunter dem Orden »Pour le Mérite«, dem Forschungspreis der Alexander-von-Humboldt-Stiftung und dem King-Faisal-Preis 2005. 2022 erhielt er den Nobelpreis für Physik.
Anton Zeilinger
Einsteins Spuk
Teleportationund weitere Mysteriender Quantenphysik
Aus dem Englischenvon Friedrich Griese
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die deutsche Fassung wurde vom Autor durchgesehen und ergänzt.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Pantheon Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2005
by C. Bertelsmann Verlag, München
Covergestaltung: Design Team München
unter Verwendung einer Illustration
des Instituts für Experimentalphysik, Universität Wien
KF · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-31469-9V001
www.pantheon-verlag.de
Inhalt
Offenheit und Neugier – ein Vorwort
Danksagung
Prolog: Unter der blauen Donau
Glasfaseroptik und Informationsübertragung in der Telekommunikation
Eine kurze Geschichte des Reisens
Zu Wasser und zu Lande
Der Traum vom Fliegen und von der Raumfahrt
Der Science-Fiction-Traum Teleportation
Der Stoff, aus dem das Licht ist
Licht als Welle
Licht als Teilchen
Schäferhunde und Einsteins Lichtteilchen
Einstein und der Nobelpreis
Ein Konflikt
Alice, Bob und der Doppelspalt
Was ist Materie?
Quantenunschärfe: nur Sache unserer Unwissenheit – oder sind die Dinge wirklich so?
Die Quantenausrede
Laut Heisenbergs Unschärfebeziehung ist Teleportation unmöglich
Rettung kommt von der Quantenverschränkung
Verschränkte Quantenwürfel
Alice und Bob im Quantenlabor
Professor Quantinger über die Polarisation des Lichtes
Polarisation einzelner Lichtquanten
Alice und Bob entdecken Zwillingsteilchen
Johns Vortrag über Einstein, Podolsky und Rosen
Das EPR-Realitätskriterium
Die EPR-Lokalitätsannahme
Das Rätsel der Zwillinge
Johns Geschichte von den lokalen verborgenen Variablen
Verwirrende Ergebnisse
Die Geschichte von John Bell
Verschränkung – ein Quantenrätsel für jedermann
Alice, Bob und ihre unverständlichen Beobachtungen
Schneller als das Licht und in die Vergangenheit?
Die fantastische Quantenwelt
In den Tiroler Bergen
Erwin Schrödinger und Alpbach
Die Quantenlotterie
Quantenlotterie mit zwei Photonen
Quantengeld – das Ende der Geldfälscher
Quantenbits
Ein Quantenbit kann mehr übertragen, als es tragen kann
Die erste Quelle und die ersten Experimente
Die Superquelle
Die Teleportation an der Donau
Der verschlungene Pfad zum Experiment
Teleportation von Nichts
Andere Experimente
Die Zukunft der Quantenteleportation
Reisen durch Teleportation?
Signale vom Himmel über Teneriffa
FAQs
Ausblick
Glossar
Zum Weiterlesen und Weiterhören
Personenregister
Sachregister
Bildnachweis
Offenheit und Neugier – ein Vorwort
Ohne Offenheit und Neugier geht es in der Wissenschaft nicht. Neugier, das brennende Verlangen, herauszufinden, was dahinter steckt, zu versuchen, die Welt zu verstehen. Und Offenheit für das Neue, auch wenn es dem zuwiderläuft, was man eigentlich erwartet hat. Offenheit und Neugier sind vielleicht die wichtigsten Eigenschaften, die ein Wissenschaftler mitbringen muss.
Offenheit und Neugier sind auch das Einzige, was Sie, liebe Leserin und lieber Leser, mitbringen sollten, wenn Sie dieses Buch aufschlagen und zu lesen beginnen. Es wurde ausdrücklich für Nichtwissenschaftler geschrieben. Ich hoffe daher, dass Sie, wenn Sie es beendet haben, einen Einblick in eine neue Welt gewonnen haben, die sich meist einem direkten Zugang durch unser Alltagsverständnis verschließt – die Welt der Quantenphysik.
Sie werden im Folgenden zwei Studenten treffen: Alice und Bob. Die beiden sind selbst dabei zu lernen, worum es in der Quantenphysik geht. Und Sie werden sehen, dass nicht nur Alice und Bob nicht alles verstehen, sondern offenbar sogar ihr Professor manchmal vor Rätseln steht. Sie können sich also beruhigt zurücklehnen, wenn auch Sie nicht alles nachvollziehen können. Darum geht es nicht.
Es geht darum, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und zu sehen, wie moderne Quantenphysik heute im Laboratorium stattfindet. Sie werden erfahren, wie einfach die Experimente im Grunde sind und wie schwierig es trotzdem ist, zu verstehen, was tatsächlich vor sich geht.
Die zweite Absicht des Buches aber ist es, Ihnen zu zeigen, wie viele Fragen noch offen sind. Noch wichtiger als die Änderungen durch neue Technologie werden wahrscheinlich die auf der Quantenphysik beruhenden Änderungen unserer Weltanschauung sein – Änderungen, von denen wir gegenwärtig nur eine grobe Ahnung haben. Diese Vermutung liegt deshalb nahe, weil die Quantenphysik bereits fast ein Jahrhundert alt ist und dennoch bis heute keine einheitliche, zufrieden stellende Interpretation gefunden wurde – wahrscheinlich deshalb, weil die Änderungen weit radikaler sein müssen, als vielen lieb ist.
Zu den Technologien der Zukunft gehören Quantenteleportation und Quantencomputer, aber auch viele andere interessante Ideen. Sie werden ein Gefühl dafür bekommen, was hinter diesen Konzepten steht und welche enormen Entwicklungsmöglichkeiten hier vorhanden sind – insbesondere in der Datenübertragung sowie für superschnelle Rechner. Vieles von diesen Dingen beruht auf einem Phänomen, das Albert Einstein »spukhaft« nannte: Zwei Teilchen können auf viel engere Weise miteinander verbunden sein, als man dies nach dem gesunden Menschenverstand eigentlich erwarten würde. Beobachtung an einem der beiden Teilchen beeinflusst das andere, egal, wie weit es entfernt ist. Heute wissen wir durch viele Experimente, dass diese »Verschränkung« kein Spuk, sondern tatsächlich ein Teil unserer Welt ist. Sie werden in dem Buch genau kennen lernen, worum es sich handelt und wie sich dies zum Beispiel in der Quantenteleportation anwenden lässt.
Einsteins Spuk zeigt meine persönliche Sicht, die sicher nicht von allen Physikern geteilt wird. Ich habe auch nicht vor, die Leserinnen und Leser mit erhobenem Zeigefinger zu belehren. Vielmehr möchte ich, dass wir uns die Dinge gemeinsam ansehen, und dies geschieht eben am besten, indem man den Leuten bei ihrer Arbeit »über die Schulter schaut«. Ich lade Sie daher ein, sich geistig die Ärmel hochzukrempeln und sich auf das Abenteuer Quantenphysik einzulassen. Dass nicht alle Fragen beantwortet werden, möge auch Anregung sein, sich selbst neue Gedanken zu machen.
Einige Teile in Einsteins Spuk beschreiben unmittelbar persönliche Erfahrungen, beispielsweise der Besuch auf Teneriffa. Andere sind fiktiv, wie etwa die Dialoge zwischen Alice und Bob. Aber auch sie beruhen auf tatsächlich durchgeführten Experimenten. Es wird zudem bewusst offen gelassen, an welchem Ort die Geschichte von Alice und Bob spielt. Die Leserin, der Leser wird Hinweise auf mehrere Orte finden. Ebenso sind Alice und Bob nicht nur fiktive Studenten, sondern auch die handelnden Personen in Protokollen der Quantenkommunikation und Quantenteleportation. Ich hoffe, dass die Leser diesen Versuch, Quantenunbestimmtheit auch in den Aufbau des Buches einfließen zu lassen, mit Vergnügen zur Kenntnis nehmen werden.
Es ist meine vielleicht unbescheidene Hoffnung, mit Einsteins Spuk ein wenig dazu beizutragen, dass Sie, liebe Leserin und lieber Leser, das beginnende Quantenjahrhundert als genauso spannend und aufregend empfinden wie der Autor, der selbst sehr neugierig auf die neuen Entwicklungen ist.
Anton Zeilinger, Wien, im Oktober 2005
Danksagung
Einsteins Spuk verdankt seine Entstehung dem Einsatz vieler Menschen, zuallererst den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in meiner Arbeitsgruppe, mit denen ich während der letzten dreißig Jahre zusammenarbeiten durfte. Viele in dem Buch berichtete Ergebnisse sind das Resultat meiner langjährigen Zusammenarbeit mit diesen Wissenschaftlern. Ich empfinde es als besondere Auszeichnung, einen Beruf zu haben, in dem ich einerseits junge Leute in neues Wissen einführen kann, das ich selbst faszinierend finde, und in dem andererseits diese jungen Leute immer wieder faszinierende Ideen und neue Sichtweisen hervorbringen. Gleichzeitig ist meine Gruppe in viele internationale Netzwerke mit anderen Wissenschaftlern weltweit eingebunden. Hier findet ein ständiger Austausch von neuen Ideen und wissenschaftlichen Resultaten statt.
Die Forschungsergebnisse wären nicht möglich gewesen ohne die ständige Unterstützung durch meine Frau Elisabeth, die mir immer den nötigen Freiraum für meine zeitintensive Beschäftigung mit der Wissenschaft gab.
Ganz besonderer Dank gilt Andrea Aglibut, nicht nur für die hervorragende Anfertigung des Manuskripts aus oft verwirrenden Diktaten, sondern auch für ihre Mithilfe bei der Zusammenstellung des Buches sowie für ihre vielfältige organisatorische Unterstützung. Für Recherchen und die genaue Überprüfung meiner Angaben danke ich Bibiane Blauensteiner und vielen anderen, die Material für dieses Buch beigetragen haben.
Ein wesentlicher Bestandteil des vorliegenden Werkes sind die Abbildungen. Die Cartoons sollen den Text nicht nur etwas auflockern, sondern dem Leser wesentliche Punkte intuitiv näher bringen. Hier habe ich mit Thomas Hamann eine sehr interessante Zusammenarbeit gefunden. Physikalische Sachverhalte, vor allem Details von Experimenten, stelle ich in Form von Zeichnungen an der Tafel dar, so wie ich dies in Vorlesungen für Studenten auch mache. Ich hoffe, dem Leser damit ein wenig das Gefühl eines direkten Gedankenaustauschs zu geben. Für die Anfertigung der Fotografien und ihre grafische Ausarbeitung sowie für ihre Hilfe bei Fotorecherchen danke ich Jacqueline Godany.
Ich hatte mich schon sehr lange mit dem Gedanken getragen, dieses Buch zu schreiben. Dafür, dass dieser Gedanke schließlich realisiert wurde, danke ich besonders John Brockman. Der Großteil der Texte wurde von mir auf Englisch verfasst und dann von Friedrich Griese innerhalb von sehr kurzer Zeit ins Deutsche übersetzt, wobei Sibylle Auer als Lektorin für Einheitlichkeit des Gedankenflusses sorgte. Ganz besonderer Dank gebührt aber Johannes Jacob vom Verlag C. Bertelsmann, der mich mit der richtigen Mischung von Geduld und Ungeduld motivierte.
Last but not least gebührt mein Dank allen Institutionen, die durch ihre Unterstützung die wissenschaftliche Arbeit meiner Gruppe über viele Jahre ermöglicht haben. Zu nennen sind hier insbesondere der Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, die Europäische Kommission – und vor allem die österreichischen Steuerzahler.
Es ist unmöglich, hier den vielen Menschen besonders zu danken, von denen ich wichtige Anregungen erhalten habe. Erwähnen möchte ich jedoch meinen akademischen Lehrer Helmut Rauch, der von Anfang an mein Interesse an fundamentalen Fragen förderte und seine Begeisterung dafür an mich weitergab, sowie Michael Horne, der mir die Augen für das faszinierende Phänomen der Verschränkung öffnete, für »Einsteins Spuk«.
Prolog: Unter der blauen Donau
Alljährlich am 1. Januar leitet das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker das junge Jahr ein. Es wird aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins in alle Welt übertragen (Bild 1). Milliarden begeisterter Hörer lauschen den schönen Walzern, Polkas, Ouvertüren und anderen Stücken von Johann Strauß Vater und Sohn und deren Zeitgenossen. Wenn das Programm beendet ist, applaudieren die Zuhörer, doch alle warten noch auf die Zugabe. Dann setzen ganz leise die Streicher ein, und wieder klatschen alle, denn sie erkennen das erwartete Stück. Das Orchester schweigt, und der Dirigent wünscht den Anwesenden und den Zuhörern in aller Welt ein glückliches Neues Jahr. Wieder setzen die Streicher ein, und das Orchester spielt den berühmten Walzer »An der schönen blauen Donau« von Johann Strauß, der oft als inoffizielle Nationalhymne Österreichs bezeichnet wird. Es gibt nicht viele Musikstücke, die zugleich die Freude und die untrennbar mit dem menschlichen Dasein verbundene Melancholie so gut vermitteln können wie diese Musik, die für die großen Bälle des kaiserlichen Wien geschrieben wurde und noch heute alljährlich während der Ballsaison aufgeführt wird.
Bild 1 Neujahrskonzert 2005 im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Die Wiener Philharmoniker unter Lorin Maazel.
Die Anwesenden und die Zuschauer an den Fernsehern ahnen nicht, dass unweit des Goldenen Saals, innerhalb der Wiener Stadtgrenzen, mit modernster Technik ein Experiment durchgeführt wird, das die Vorstellungskraft herausfordert, einerseits mit Ideen, die man bisher nur aus der Science-Fiction kannte, andererseits mit seinen Folgen für das Verständnis der uns umgebenden Welt.
Das Konzert endet mit der letzten Zugabe, dem »Radetzkymarsch« von Johann Strauß, einem der schmissigsten und fröhlichsten Stücke, die je geschrieben wurden. Wir verlassen den Konzertsaal und fahren an die Donau. Es ist ein schöner Wintertag, und es sind nur wenige Menschen unterwegs, weil der 1. Januar ein Feiertag ist. Der Fluss fließt in zwei Armen durch Wien, die eine lang gestreckte Insel umschließen. Um vom Ufer auf die Insel zu gelangen, nehmen wir die Steinspornbrücke, die, weil sie für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist, nicht einmal auf allen Karten verzeichnet ist.
Auf der Insel steuern wir ein graues Gebäude an, das hinter hohen Bäumen versteckt liegt. Hier befindet sich das Pumpwerk der Wiener Kanalisation. Unter dem Fluss verläuft ein großer Abwasserkanal, der beide Seiten miteinander verbindet. Er soll das gesamte Abwasser von der Ostseite der Donau, von den Wienern liebevoll »Transdanubien« (»Jenseits der Donau«) genannt, auf die andere Seite zu einer riesigen Abwasseraufbereitungsanlage pumpen, denn die sehr umweltbewussten Wiener möchten nicht, dass Abwasser direkt in den Fluss geleitet wird und dort die Umwelt gefährdet.
Wir betreten das Gebäude und begeben uns mit dem Fahrstuhl zwei Etagen nach unten. Nun befinden wir uns tiefer als die Wassermassen des Flusses. Nach einem kurzen Gang tut sich ein Tunnel auf, welcher die Flussufer in Transdanubien und im eigentlichen Wien miteinander verbindet. In diesem Tunnel verlaufen parallel Abwasserröhren und zahlreiche Kabel.
Versteckt in der Nähe des Eingangs zu einem der Tunnel erwartet uns eine andere Szene: In einer Ecke stoßen wir auf einen kleinen Raum mit Plexiglaswänden. Drinnen erkennen wir Laserlicht, eine Menge Hightech-Geräte einschließlich modernster Elektronik, Computer und dergleichen (Bild 2). Dort treffen wir Rupert Ursin. Er erzählt uns, er sei Student der Universität Wien und arbeite an seiner Doktorarbeit, die er in Kürze abzuschließen hoffe. Thema seiner Dissertation ist die »Quantenteleportation über lange Distanzen«. Wir bitten ihn, uns kurz zu erklären, was wir hier sehen. »Bei dem Experiment geht es darum, den Quantenzustand eines Lichtteilchens – eines Photons – von der Donauinsel hinüber nach Wien zu teleportieren«, sagt er.
Bild 2 Donaulaboratorium in Wien zur Quantenteleportation. Der Autor diskutiert mit Rupert Ursin einige Punkte des Experiments (oben). Detailansicht des experimentellen Aufbaus (unten).
Als er merkt, dass wir nicht viel verstehen, erläutert er, es sei so etwas Ähnliches wie das »Beamen« in der Science-Fiction, »aber nicht ganz«, fügt er grinsend hinzu, um dann mit einer Erklärung zu beginnen. Wir verstehen noch immer kaum etwas, lauschen ihm aber mit wachsender Faszination. Er verspricht uns für später genauere Auskünfte. Einstweilen möchten wir uns nur ein wenig mit den von ihm benutzten Ausdrücken vertraut machen, uns an den Versuchsaufbau und die hier erforschten allgemeinen Konzepte gewöhnen und die seltsame Umgebung näher kennen lernen.
Die Laser, erfahren wir, dienen hauptsächlich dazu, ganz besondere Photonenpaare zu erzeugen, die miteinander »verschränkt« sind. Diese Verschränkung bedeutet, dass die zwei Photonen eng miteinander verknüpft sind. Wird das eine gemessen, so wirkt sich dies unverzüglich auf das andere aus, gleichgültig, wie weit die beiden voneinander entfernt sind.
Mit der Bezeichnung »Verschränkung« wollte der österreichische Physiker Erwin Schrödinger (Bild 3) im Jahre 1935 einen hochinteressanten Sachverhalt charakterisieren. Albert Einstein hatte kurz vorher in einer Arbeit gemeinsam mit Boris Podolsky und Nathan Rosen gezeigt, dass es nach der Quantenphysik einen hochinteressanten Sachverhalt geben müsste. Wir betrachten zwei Teilchen, die miteinander in Wechselwirkung getreten sind, zum Beispiel bei einem Zusammenstoß, und jetzt wieder auseinander fliegen. Dann kann es sein, dass die beiden noch immer auf sehr enge Weise miteinander zusammenhängen. Beobachtung eines der beiden Teilchen beeinflusst sofort, das heißt mit beliebig großer Geschwindigkeit, den Zustand des anderen. Albert Einstein mochte dies nicht und bezeichnete es als »spukhafte Fernwirkung«. Er hoffte, dass die Physiker einen Weg finden könnten, der diesen Spuk wieder aus der Welt schafft. Erwin Schrödinger dagegen akzeptierte diese Verschränkung als etwas ganz Wesentliches. Er meinte, dass sie uns zwingt, von allen unseren lieb gewordenen Vorstellungen, wie die Welt beschaffen ist, Abschied zu nehmen.
Bild 3 Erwin Schrödinger (links oben), an der irischen Küste bei Dublin, ca. 1942. Albert Einstein (rechts oben) in Princeton, 1953. Unten: John Bell bei einer Fahrt mit der Liliputbahn im Wiener Prater, 1982.
Auf unsere Frage nach dem Zweck der verschränkten Photonen im Experiment erwidert Rupert lächelnd: »Das ist der Zaubertrick.«
Er behält eines der beiden verschränkten Photonen in seinem Minilabor unter der Donau und schickt das andere durch eine Glasfaser an den Empfänger jenseits des Flusses. Dabei spricht er von »Alice« und »Bob«, die einander Photonen schicken und miteinander reden, als seien sie Menschen. Es sind jedoch, wie sich herausstellt, imaginäre Experimentatoren: Alice, die hier in ihrem Labor sitzt, und Bob jenseits des Flusses.
Auf unsere Frage, warum die gerade Alice und Bob heißen, antwortet Rupert, dass ursprünglich Entschlüssler den Sender mit A bezeichnet haben und den Empfänger mit B, entsprechend den ersten Buchstaben des Alphabets. Wegen der einfacheren Sprechweise sind daraus irgendwann Alice und Bob geworden.
Rupert zeigt uns die dünne Glasfaser, durch die das Photon zu Bob geschickt wird – eine ganz gewöhnliche Glasfaser, ähnlich denen, die heute in der Telekommunikation üblich sind.
Durch diese Glasfaser kann man Licht von einem Ort zum anderen schicken. Wir folgen mit den Augen dem Kabel von Ruperts Laser. Es führt durch die durchsichtige Plexiglaswand seines kleinen Labors bis zu der Stelle, wo es sich zu all den anderen Kabeln gesellt, die durch die großen Tunnel unter der Donau verlaufen. Rupert folgt unserem Blick und fragt: »Möchtet ihr sehen, wo es hingeht?«
Glasfaseroptik und Informationsübertragung in der Telekommunikation
Eine Glasfaser besteht offenbar aus zweierlei Glas, damit unterwegs kein Licht verloren geht: Eine dichtere Glassorte in der Mitte ist mit einem Mantel aus einer dünneren Sorte umkleidet (Abbildung 1). Dadurch kann Licht, das in den Kern eingetreten ist, nicht mehr heraus. Es wird von dem Mantel in den Kern zurückgespiegelt, sobald es entweichen möchte. Die Faser ist zudem von einer Reihe äußerer Hüllen aus Kunststoff oder ähnlichem Material umgeben und sieht am Ende aus wie ein ganz gewöhnliches Kabel. Mit solchen Glasfasern kann man Licht über viele Kilometer hinweg leiten.
Abbildung 1 Aufbau einer Glasfaser, wie sie zur Übertragung von Daten mit Hilfe von Licht verwendet wird. Die Faser besteht aus zwei verschiedenen Glassorten. Das Glas im Kern ist optisch dichter. Licht, das sich im Kern befindet, kann daher nicht in den Mantel treten, der aus optisch dünnerem Glas besteht. Solche Glasfasern können gebogen werden und daher Licht leicht um Ecken leiten.
Die Glasfaseroptik brachte einen der großen technischen Durchbrüche unserer Zeit. Zu den Neuerungen, die auf sie zurückgehen, gehört der schnelle Internetzugang, denn der extrem hohe Datenfluss zwischen modernen Computern ist nur durch Lichtwellen zu erreichen. Früher musste man, um Daten zu übertragen, verschiedene Orte auf der Erde mit Stromkabeln verbinden. Der Haken daran ist, dass über solche Kabel nur relativ geringe Datenmengen übertragen werden können. Wären die Computer noch immer durch normale Kupferkabel miteinander verbunden, würde das Herunterladen der heute üblichen großen Dateien eine Ewigkeit dauern.
Die Idee der Glasfasertechnik ist einfach: Statt elektrischem Strom nutzt man Licht als Träger der Information, die von einem Computer zum anderen geschickt wird. Dass Glasfasern sehr viel besser sind als Stromkabel, hat einen einfachen Grund. Er hängt mit einer wichtigen Eigenschaft des Lichtes zusammen, nämlich der Tatsache, dass es schwingt. Licht ist eine Schwingung elektrischer und magnetischer Felder, die sich durch Glas, Luft und sonstige Stoffe fortpflanzt. Es gibt elektromagnetische Felder, die sehr langsam schwingen, und andere, die sehr schnell schwingen. Die Frequenz der Schwingung besagt, wie oft das Feld innerhalb einer Sekunde hin- und herschwingt. Im Grunde verhält es sich mit der Schwingung des Lichtes nicht anders als mit der Schwingung einer Schaukel: Genau wie ein Kind auf einer Schaukel, so schwingt auch das elektromagnetische Feld hin und her.
Man kann auch ein anderes Bild heranziehen, etwa das von Wellen, die sich auf einem Teich oder einem See ausbreiten. Wenn man einen Stein hineinwirft, breiten sich von der Stelle, wo der Stein auftrifft, kleine Wellen aus (Abbildung 2). An diesen Wellen können wir zwei charakteristische Bewegungen beobachten, die grundsätzlich auf alle Wellen zutreffen. Erstens sehen wir, dass die Welle sich auf dem Wasser auf und ab bewegt. Die Häufigkeit, mit der ein bestimmter Punkt der Welle in einer Sekunde auf und ab schwingt, ist die Frequenz der Welle. Zum Beispiel schwingt eine Welle, deren Frequenz fünf Hertz beträgt, fünfmal in der Sekunde auf und ab. Zweitens sehen wir, dass die Welle sich von der Einschlagstelle des Steins nach außen fortpflanzt und in Form von Bergen und Tälern über den Teich eilt. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Bergen ist die Wellenlänge. Bei dieser Wellenbewegung wird aber kein Wasser über den Teich transportiert. Man kann sie vielmehr so verstehen, dass Wassermoleküle durch ihre Bewegung ihre Nachbarn zum Mitmachen anregen. Die Wellenbewegung kann daher als eine gegenseitige Anregung von Teilen der Wasseroberfläche verstanden werden.
Abbildung 2 Wellenausbreitung in einem Teich.
Ähnlich verhält es sich mit einer elektromagnetischen Welle, die sich beispielsweise von einer Funkantenne aus nach außen fortpflanzt. Es gibt eine Folge von elektrischen und magnetischen Feldern, die sich von der Antenne her nach außen ausbreiten, genau wie die Wellen auf dem Teich (Abbildung 3).
Abbildung 3 Licht ist eine elektromagnetische Welle, die sich im freien Raum ausbreitet. Im Bild sieht man eine Momentaufnahme des elektrischen Feldes. Die Länge jedes Pfeils gibt an, wie groß die Stärke des elektrischen Feldes an der jeweiligen Stelle ist. An einer gegebenen Stelle schwingt das elektromagnetische Feld auf und ab. Gleichzeitig breitet sich eine Welle, ähnlich der Wasserwelle im Raum, aus, etwa im Bild von links nach rechts. Mit dem elektrischen Feld verbunden ist ein magnetisches Feld, das im Bild nicht gezeichnet ist. Es steht rechtwinkelig auf das elektrische.
Obwohl die Wasserwelle kein Wasser über den Teich transportiert – und die elektromagnetische Welle auch keinen Strom –, kann man diese Wellen dazu nutzen, um Nachrichten zu verschicken oder allgemein Information zu übertragen. Dies geschieht dadurch, dass man die Welle auf irgendeine Weise verändert. Dabei wird die Information den ausgehenden Wellen durch eine Änderung der Schwingung aufgeprägt. Generell kann die Schwingung auf zweierlei Weise geändert werden: Entweder ändert man die Frequenz – wie oft die Welle auf der Teichoberfläche auf und ab geht – oder die Amplitude der Schwingung – wie weit die Oberfläche sich in einer Schwingungsperiode auf und ab bewegt.
Man kann diese Konzepte leicht spielerisch nachprüfen, indem man die Hand in einer gefüllten Badewanne ganz leicht und langsam auf und ab bewegt. Es entstehen kleine Wellen, die sich ausbreiten. Nun kann man die Hand häufiger schwingen lassen, also die Frequenz erhöhen, ohne etwas daran zu ändern, wie weit sie sich auf und ab bewegt. Dabei bleibt die Höhe der Wellen ungefähr gleich, aber sie schwingen schneller. Ein Empfänger der Wellen kann auf diese Weise eine Nachricht erhalten, wenn wir uns zuvor mit ihm darüber verständigt haben, was die Frequenzänderung bedeutet; er kann sie dann korrekt deuten. Eine höhere Frequenz könnte beispielsweise eine Warnung vor einer Gefahr bedeuten.
Umgekehrt kann man die Höhe, über die sich die Hand auf und ab bewegt, vergrößern, dabei aber die Frequenz unverändert lassen. Nun werden die Wellen tiefer – auch dies eine Veränderung, die ein ferner Beobachter erkennen kann. Tatsächlich werden beide Verfahren, Information in einer Welle zu verschlüsseln, bei elektromagnetischen Wellen benutzt. Das erste wird als Frequenzmodulation bezeichnet und bei der UKW- und Fernsehübertragung benutzt, das zweite als Amplitudenmodulation; es kommt bei der Funkübertragung im Frequenzbereich der Lang-, Mittelund Kurzwellen zum Einsatz.
Ein wichtiger Punkt ist, dass die Informationsmenge, die eine Welle befördern kann, von ihrer Frequenz abhängt. Und zwar kann eine Welle umso mehr Information übertragen, je höher ihre Frequenz ist. Genau deshalb ist Licht ein so geeigneter Informationsträger. Die typische Schwingungsfrequenz von Licht beträgt fast 1015 Hertz. Das sind eine Million Milliarden Schwingungen pro Sekunde. Demgegenüber kann ein Stromdraht in der Regel nur Frequenzen übertragen, die etwa eine Milliarde Schwingungen pro Sekunde nicht übersteigen, und das über nicht zu lange Strecken. Das ist immer noch viel, aber doch eine Million Mal weniger als die Frequenz des Lichtes! Moderne Computer sind daher heute durch Glasfaserkabel verbunden, und nur auf den letzten paar Kilometern bis zum privaten Anwender werden noch Telefondrähte aus Kupfer verwendet.
Rupert benutzt bei seinem Experiment ein Glasfaserkabel, um eines seiner verschränkten Photonen von dem Labor auf der Donauinsel unter dem Fluss hindurch in die Stadt zu transportieren. Mit unseren Blicken folgen wir der Faser in den Tunnel. Da fragt Rupert: »Möchtet ihr sehen, wo es hingeht?« Das möchten wir sehr gern, und damit beginnt unser kleiner Ausflug in den Untergrund von Wien.
Wir betreten zunächst eine Röhre mit einem Durchmesser von etwa vier Metern, die steil abwärts führt. Unter uns verlaufen zwei Rohrleitungen von rund einem Meter Durchmesser, die, wie uns Rupert erklärt, das Abwasser befördern. Auf unser Wohlbehagen wirkt sich das nicht sonderlich aus, weil sie dicht versiegelt sind, auch wenn es ein bisschen seltsam riecht. Man kann bequem aufrecht gehen, aber viel Platz ist nicht. Rechts und links verlaufen Kabeltrassen. In einem dieser Kabel befindet sich unsere kleine optische Faser.
Einer von uns bemerkt: »Genau wie im ›Dritten Mann‹« und erinnert damit an einen der größten Filme aller Zeiten, der im Wien der Nachkriegszeit spielt; zu den großartigsten Szenen gehören wilde Verfolgungsjagden in der Kanalisation der Stadt. Jeden Augenblick rechnen wir damit, dass Orson Welles um die Ecke kommt, und wir haben das von Anton Karas auf der Zither gespielte Harry- Lime-Thema im Ohr.
Als wir nach einiger Zeit an den tiefsten Punkt unserer Wanderung kommen, erklärt uns Rupert, direkt über uns befinde sich der Fluss. Man kann sich kaum der Vorstellung erwehren, was passieren würde, wenn irgendwo ein Riss auftreten und das Wasser der Donau sich über uns ergießen sollte. In welche Richtung würden wir dann laufen? Doch zum Glück passiert nichts, und wir setzen unseren Weg fort, der jetzt leicht ansteigt. Nach einer Zeit, die sich scheinbar endlos dehnt, landen wir wieder in einem kleinen Raum, und als wir uns umschauen, bemerken wir, dass wir nicht nur den Fluss unterquert haben, sondern auch einen kleinen Uferpark, eine Bahnlinie und eine breite Straße.
In diesem Raum tritt die Glasfaser aus ihrer Kunststoffhülle aus und mündet in einen Aufbau, der dem auf der Insel ähnelt, nur dass er viel kleiner ist. Auch hier finden wir einen Computer, einige optische Teile wie Spiegel und Prismen und jede Menge Elektronik. An dieser Stelle, erklärt Rupert, wird das teleportierte Photon gemessen, und vor allem wird geprüft, ob alle seine Eigenschaften und Merkmale teleportiert wurden. Eines der Kabel, die zu Ruperts kleinem Tisch führen, verläuft weiter nach oben und endet auf dem Dach des Gebäudes, in dem wir uns befinden. Rupert erklärt uns stolz, dies sei der klassische Kanal, der Alice mit Bob verbinde. Es ist eine ganz normale Funkverbindung. Das bringt uns ein bisschen durcheinander: wozu dieser klassische Kanal? Was meinte Rupert, als er von verschränkten Photonen sprach? Was ist Teleportation?
Bevor wir diesen Fragen nachgehen, steigen wir auf das Dach des Gebäudes und werden mit einer großartigen Aussicht belohnt. Auf dem anderen Ufer liegt das Gebäude, in dem sich Alice befindet. Dazwischen fließt der Fluss recht schnell dahin. Langsam und stetig ziehen Schiffe vorüber. Ein paar Enten und zwei Schwäne genießen das ziemlich saubere Wasser. Neben unserem Gebäude steht eine kleine Pagode, die von der Wiener Buddhistengemeinde errichtet wurde. Sogleich wenden unsere Gedanken sich philosophischen Fragen zu wie denen, was das alles bedeuten mag, welche Rolle wir im Universum spielen, was wir tun, wenn wir die Welt beobachten, und was das Quant mit alldem zu tun hat.
Nach Westen hin erblicken wir die Hügel des Wienerwalds, die eigentlich die östlichen Ausläufer der Alpen sind, und nach Osten hin den Rand der großen ungarischen Tiefebene. Die Geschichte kommt uns in den Sinn. Wir erinnern uns daran, dass die Türken, von Osten kommend, zweimal vergeblich versuchten, Wien einzunehmen. Wir können uns vorstellen, dass eine gelungene Einnahme der Stadt den Lauf der Geschichte verändert hätte. Dann denken wir darüber nach, dass die Art der Fragen, die wir stellen, die ganz tiefen Fragen, bei denen es um den Sinn unseres Daseins geht, von unserer Kultur – der buddhistischen, der islamischen, der christlichen – abhängen könnte. Es wird kalt an diesem 1. Januar, und wir erlauben uns, allmählich wieder in das moderne Wien zurückzukehren.
Eine kurze Geschichte des Reisens
Zu Wasser und zu Lande
Wenn wir »Teleportation« hören, denken wir gleich an die ideale Art des Reisens. Man verschwindet am Ausgangsort und taucht sofort am Zielort wieder auf. Das wäre die schnellste Möglichkeit des Reisens. Wir sehen uns daher kurz an, wie Menschen gelernt haben, immer schneller immer größere Strecken zurückzulegen. Allerdings sei gewarnt: Teleportation als Reisemittel ist nach wie vor reine Science-Fiction.
Seit jeher erfüllt der Wunsch nach Ortsveränderung die Menschen. Über die längste Zeit der Menschheitsgeschichte mussten sie sich dazu der eigenen Muskelkraft bedienen, sei es, dass sie Strecken zu Fuß zurücklegten, sei es, dass sie Flüsse, Seen oder gar schmale Meerengen durchschwammen. Das ist zwar eine sehr langsame Art der Fortbewegung, aber auf diese Weise haben die Menschen, die ihren Ursprung in Afrika haben, sich über diesen ganzen Kontinent und weiter nach Europa und Asien ausgebreitet. Auch die ersten Amerikaner kamen zu Fuß über die damals bestehende Landbrücke zwischen Sibirien und Alaska.
Zu den größten Umwälzungen kam es, als die Menschen entdeckten, dass man nicht unbedingt die eigene Muskelkraft braucht, um schwimmend oder gehend vorwärts zu kommen. Sie fanden heraus, dass sie, statt selbst zu laufen, ein Pferd für sich laufen lassen konnten und dass sie, statt selbst zu schwimmen, ein Floß oder Boot bauen konnten. Auf einmal waren die Menschen in der Lage, in derselben Zeit sehr viel größere Strecken zurückzulegen. Sie reisten erheblich schneller, und mit Booten konnten sie sogar Ozeane überqueren, was ihnen schwimmend nie gelungen wäre.
Die Entdeckung des Reitens zwischen 3000 und 2000 v. Chr. in Asien war in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Ein berühmtes Beispiel ist die Invasion Ägyptens um das Jahr 1650 v. Chr. durch die Hyksos, einen wilden Stamm aus Asien. Die Ägypter hatten eine der ersten hoch entwickelten Zivilisationen auf Erden, mit einem gottähnlichen Herrscher, dem Pharao, und einem differenzierten Gesellschaftssystem sowie einer Verwaltung, deren Effizienz es ihnen erlaubte, die gewaltigen Pyramiden zu bauen, die zu ihrer Zeit eine ähnliche technische und organisatorische Leistung waren wie das Apolloprogramm, das den Menschen im 20. Jahrhundert erstmals auf den Mond brachte. Doch sie hatten nur ein Landverkehrsmittel: die eigenen Füße. Daher kamen sie nicht sehr schnell voran, obgleich sie große Heere hatten. Da ihre Feinde, die Hyksos, sich zu Pferde sehr viel schneller bewegen konnten, mussten sich die Ägypter geschlagen geben. Ihr Reich wurde von den Hyksos erobert, und sie brauchten rund hundert Jahre, um sie wieder loszuwerden.
Die Entdeckung des Reitens zwischen 3000 und 2000 v. Chr. in Asien war in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Ein berühmtes Beispiel ist die Invasion Ägyptens um das Jahr 1650 v. Chr. durch die Hyksos, einen wilden Stamm aus Asien. Die Ägypter hatten eine der ersten hoch entwickelten Zivilisationen auf Erden, mit einem gottähnlichen Herrscher, dem Pharao, und einem differenzierten Gesellschaftssystem sowie einer Verwaltung, deren Effizienz es ihnen erlaubte, die gewaltigen Pyramiden zu bauen, die zu ihrer Zeit eine ähnliche technische und organisatorische Leistung waren wie das Apolloprogramm, das den Menschen im 20. Jahrhundert erstmals auf den Mond brachte. Doch sie hatten nur ein Landverkehrsmittel: die eigenen Füße. Daher kamen sie nicht sehr schnell voran, obgleich sie große Heere hatten. Da ihre Feinde, die Hyksos, sich zu Pferde sehr viel schneller bewegen konnten, mussten sich die Ägypter geschlagen geben. Ihr Reich wurde von den Hyksos erobert, und sie brauchten rund hundert Jahre, um sie wieder loszuwerden.
Auch der Bootsbau eröffnete den Menschen neue Horizonte. So wären die Entdeckung und Besiedlung Polynesiens und Neuseelands ohne Boote unmöglich gewesen. Dies gilt ebenso in neuerer Zeit für die Entdeckung Amerikas durch die Europäer.
Die Strecke, die der Mensch innerhalb einer gegebenen Zeit zurücklegen konnte, war immer durch die verwendete Technik begrenzt. Hinweise auf die natürliche Grenze der Strecke, die in einem Tag mit Pferden als Transportmittel zu bewältigen war, findet man bis heute. Wenn zum Beispiel die Kaiser ihr Reich von Wien aus bereisten, waren sie stets mit großem Gefolge zu Pferd unterwegs. Da sie ungern nachts reisten, mussten Unterkünfte errichtet werden, die genau eine Tagesreise voneinander entfernt waren. Eine der berühmtesten Tagesetappen ist das schöne Kloster Melk am Ufer der Donau, rund achtzig Kilometer stromaufwärts von Wien gelegen. Hier pflegte zum Beispiel Kaiserin Maria Theresia nach einer Tagesreise von Wien Rast zu machen, wenn sie Richtung Westen reiste. Heute ist Kloster Melk über die Autobahn, die von Wien nach Deutschland führt, in weniger als einer Stunde zu erreichen (Bild 4).
Bild 4 Das Benediktinerstift Melk an der Donau, etwa eine Tagesreise per Pferd von Wien entfernt.
Zum nächsten großen Schritt in der Verbesserung der Reise- und Transportwege kam es durch die Entdeckung, dass man außer der Muskelkraft noch andere Energiequellen nutzen kann. Die Dampfmaschine durchbrach nicht nur die bis dahin durch die Pferdestärke vorgegebene Kraftgrenze, sondern machte auch deutlich, dass die unbefestigten Schotterstraßen von damals für schnelle Reisen nicht geeignet waren. Ursprünglich war die Dampfmaschine als Energiequelle für den Antrieb ortsfester Maschinen wie Mühlen entwickelt worden. Doch als man sie auf Räder setzte, musste man schnelle und ebene Eisenbahnlinien bauen – eine Entwicklung, die ihren bisherigen Höhepunkt in dem superschnellen japanischen »Geschosszug« Shinkansen oder im französischen TGV fand, der mit 515,3 Stundenkilometern im Jahr 1990 den Weltrekord aufstellte.
Aber die Dampfmaschine hatte einen großen Nachteil: Sie ist zwangsläufig sehr schwer und daher nicht geeignet für den Antrieb eines einzelnen Wagens. Der Individualverkehr war deshalb noch eine Zeit lang auf Pferde angewiesen, während die Massenbeförderung auf wichtigen Strecken bereits mit Dampfmaschinen betrieben wurde. Den Durchbruch brachte hier die Entwicklung von Verbrennungsmotoren mit Flüssigtreibstoff, also Benzin- und Dieselmotoren. Und wie schon bei der Dampfmaschine auf Schienen wurde es durch die Entwicklung von schnelleren Wagen mit Benzinmotoren notwendig, ebenere und weniger kurvenreiche Straßen zu bauen, die es den Automobilen erlaubten, schneller zu fahren als die bisherigen Pferdewagen. Die Grenze der Geschwindigkeit, mit der man individuell auf Straßen reisen kann, wird heute nicht mehr von technischen Möglichkeiten der Motorkraft bestimmt, sondern von Sicherheitsüberlegungen. Die Gesellschaft ist nicht bereit, überall beliebige Geschwindigkeiten zuzulassen, weil das mit einer hohen Zahl von Verkehrsopfern verbunden wäre. Gleichwohl ist die Strecke, die man heute in einem Tag auf modernen Autobahnen zurücklegen kann, zehn- bis zwanzigmal länger als diejenige, die man seinerzeit mit der Pferdekutsche bewältigen konnte.
Im Seeverkehr vollzog sich eine ähnliche Entwicklung. Offenbar haben Menschen schon sehr früh erkannt, dass man sich nicht nur auf einem Floß einen Fluss hinuntertreiben lassen, sondern ein Boot auch aktiv mit Muskelkraft antreiben kann. Eine weitere Antriebsmöglichkeit bot hier eine alternative Energiequelle: der Wind, der überall, aber leider nicht zu allen Zeiten weht. Den bedeutendsten Fortschritt brachte die Entdeckung, dass man den Wind sogar nutzen kann, um gegen den Wind zu fahren – eine Tatsache, die nicht unbedingt auf der Hand liegt. Die alten Römer, deren Reich sich über den gesamten Mittelmeerraum erstreckte, und auch viele nach ihnen kannten diese Möglichkeit jedenfalls nicht. Sie mussten immer warten, bis der Wind aus der richtigen Richtung blies. »Erst durch das Kreuzen wurde es möglich, im Zickzackkurs gegen den Wind zu segeln und dadurch unabhängig von der Windrichtung jedes Ziel zu erreichen. Die Entdeckung des Kreuzens geht vermutlich auf die Araber um das Jahr 1000 zurück, wobei es auch Berichte über teilweise weniger effiziente Formen des Kreuzens aus China und Polynesien gibt.«
Dank der Dampfmaschine kam es auch im Schiffsbau zu erheblichen Fortschritten. Der Wind kann vollkommen abflauen, aber ein Dampfschiff kann immer weiterfahren, solange es genügend Kohle an Bord hat.
Einen weiteren bedeutenden Fortschritt brachte auch die Entdeckung, dass man Schiffe bauen kann, die wie ein Wasserskifahrer auf dem Wasser gleiten können. Ähnlich schnell sind auch Schiffe, die von kleinen Tragflächen getragen wird, die gewissermaßen unter Wasser »fliegen«. Solche Tragflügelboote können Geschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern erreichen.
Der Traum vom Fliegen und von der Raumfahrt
Der Traum vom Fliegen ist wohl so alt wie die Menschheit, wenn nicht noch älter. Möglich, dass schon einer unserer vormenschlichen Vorfahren von Baum zu Baum fliegen wollte, und sei es nur, um einem Raubtier zu entgehen, das ihm nachsetzte.
Doch offensichtlich enthält eine der ersten Geschichten – wenn nicht die erste überhaupt – von einem fliegenden Menschen, näm lich die Geschichte von Ikarus im antiken Knossos auf Kreta, bereits die Botschaft, dass Menschen das unbehagliche Gefühl hatten, das Fliegen sei nicht ganz das Richtige für sie. Ikarus, dem sein Vater Dädalus Flügel gebaut hatte, mit denen er sich in die Lüfte erheben konnte, wurde vom Schicksal ereilt, als er der Sonne zu nah kam. Durch die Hitze schmolz das Wachs, das die Federn zusammenhielt, und Ikarus stürzte ins Meer.
Wir wissen heute, dass dieses Kunststück von vornherein unmöglich war. Unsere Arme sind viel zu schwach, um Flügeln welcher Art auch immer genügend Kraft zu geben, damit wir vom Boden loskommen. Dass es aber grundsätzlich möglich ist, vom Boden abzuheben, wurde 1977 von Paul MacCready demonstriert, der in einem extrem leichten Flugzeug, dessen Propeller er mit Pedalen antrieb, aus eigener Kraft startete und eine Strecke von 1,8 Kilometern in einer Achterfigur flog.
Ungeachtet dieses Proof-of-Principle-Experiments brauchen wir aber dennoch andere Energiequellen zum Fliegen. Interessant ist, dass man für eine bestimmte Strecke pro Person in etwa dieselbe Energiemenge benötigt, ob man nun einen Jumbojet oder ein Auto benützt. In beiden Fällen braucht man eine bestimmte Menge Benzin auf hundert Kilometer, sofern der Jumbo voll besetzt ist und in einem Personenwagen vier Personen mitfahren: nämlich jeweils etwa drei Liter pro Person auf hundert Kilometer. Aus aerodynamischen Gründen ist die Geschwindigkeit von Propellerflugzeugen typischerweise rund fünfhundert Kilometer pro Stunde, während die gängigen Düsenflugzeuge nahezu mit Schallgeschwindigkeit fliegen. Diese liegt je nach Luftdichte und damit nach der Flughöhe des Flugzeugs bei rund tausend Kilometern pro Stunde. Wer jemals einen langen Interkontinentalflug mitgemacht hat, wird diese Geschwindigkeit als zu niedrig empfinden. Überschallflugzeuge können leicht mit zweifacher bis dreifacher Schallgeschwindigkeit fliegen. Es ist einer der großen Skandale der Menschheit, dass fast jedes Land, wie arm es auch sei, Überschallflugzeuge für das Militär besitzt, doch der zivile Überschall-Interkontinentalflug nicht zu einem Massenverkehrsmittel geworden ist.
Wenn man wirklich schnell sein möchte, muss man Raketen benutzen. Und das nicht nur, weil Raketen sehr viel schneller sind als Überschallflugzeuge. Ihr eigentlicher Vorteil liegt darin, dass sie die Atmosphäre verlassen und ins All hinausfliegen können, wo es keine Luft mehr gibt.
Wie kann die Rakete im All fliegen? Ganz einfach: Sie stößt sich von den Abgasen ab, die aus den Düsen ihrer Motoren strömen. Diese Gase kann die Rakete natürlich ebenso gut in Luft wie im luftleeren All ausstoßen.
Um einen Eindruck von den unterschiedlichen Verkehrsgeschwindigkeiten zu geben, haben wir in der Tabelle unten ein paar zusammengestellt.
Selbstverständlich sind also Raketen das Transportmittel der Wahl, wenn man zu anderen Sternen reisen möchte. Eine interessante Frage ist, wie lange die Reise zu anderen Sternen dauern würde. Wir wissen ja noch vom Apolloprogramm, das die ersten Menschen auf den Mond brachte, dass der Flug von der Erde zum Mond vier Tage dauert.
Eine Reise mit dem Raumschiff von der Erde zum Planeten Mars, einem unserer engsten Nachbarn im Sonnensystem, würde ähnlich etwa zweihundertsechzig Tage dauern. Unsere Raumfahrer würden sich in dieser Zeit natürlich ziemlich langweilen, aber das tut nichts zur Sache. Sie könnten die Zeit aber auch positiv nutzen und Experimente durchführen, einschließlich der Quantenteleportation, worauf wir noch eingehen werden.
Zeit für die Strecke von Tokio nach New York City
Schwieriger wird es, wenn wir Planeten erreichen wollen, die um andere Sterne kreisen. Die allernächsten Sterne, Proxima Centauri und Alpha Centauri, sind immerhin gut vier Lichtjahre von uns entfernt. Ein Lichtjahr ist die Strecke, welche das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt. Sie beträgt rund 10 000 000 000 000 Kilometer, das sind zehn Millionen Millionen Kilometer. Die Raumsonde Pioneer 10 möge als Beispiel dienen. Sie hat bereits unser Sonnensystem verlassen und würde etwa hunderttausend Jahre brauchen, um diese Sterne zu erreichen. Klarerweise würde dies niemand überleben.
Es gibt aber einen anderen Weg, um die Flugzeit erheblich abzukürzen, nämlich denjenigen, den Raketenantrieb den ganzen Flug über brennen zu lassen, sodass das Raumschiff immer schneller würde. Wäre die halbe Reisestrecke erreicht, würde es sich umdrehen und in die dem Flug entgegengesetzte Richtung feuern. Dadurch würde es immer langsamer, bis es den fernen Stern erreicht hätte. Es ist vorstellbar, dass man auf diese Weise im Prinzip beliebig schnell reisen kann, aber auch hier gibt es Grenzen.
Menschen können nicht beliebig hohe Beschleunigungen aushalten. Ist die Beschleunigung zu hoch, können wir uns nicht mehr bewegen, weil wir immer stärker gegen den Boden der Raumschiffkabine gepresst werden. Am besten wäre es, die Beschleunigung während der ganzen Reise so einzustellen, dass wir immer dasselbe Gewicht haben, als wenn wir uns auf der Erde befänden. Diese Beschleunigung bedeutet, dass sich die Geschwindigkeit der Rakete in jeder Sekunde um den Betrag zehn Meter pro Sekunde erhöht oder erniedrigt, je nachdem, in welche Richtung der Antrieb gerichtet ist – in Flugrichtung oder dagegen. Das Raumschiff würde auf diese Weise beschleunigen, bis es die halbe Strecke zu dem Stern zurückgelegt hätte, und dann seinen Antrieb umkehren, sodass er in die seiner Flugrichtung entgegengesetzte Richtung feuern würde. Auf diese Weise würde es abbremsen. Es zeigt sich, dass eine solche Reise »nur« rund vier Jahre dauern würde, je zwei Jahre für die Beschleunigung und das Abbremsen.
Die höchste Geschwindigkeit, die unser Raumschiff dabei erreichen würde, wäre etwa die doppelte Lichtgeschwindigkeit. Da haben wir aber offenbar einen Fehler gemacht. Die Lichtgeschwindigkeit ist nämlich die höchste Geschwindigkeit, mit der sich gemäß Albert Einsteins Relativitätstheorie etwas bewegen und ausbreiten kann. Unser Raumschiff kann offenbar nicht fortwährend beschleunigen. Je mehr wir uns nämlich der Lichtgeschwindigkeit nähern, desto geringer wird die Beschleunigung, sodass wir niemals imstande sein werden, diese Grenze zu erreichen oder gar zu überschreiten – auch dann nicht, wenn unsere Raketen die ganze Zeit feuern würden. Interessanterweise würden die Raumfahrer im Raumschiff trotzdem ständig dieselbe Kraft, die Erdbeschleunigung, erfahren. Aber unser Raumschiff kann nie schneller sein als die Lichtgeschwindigkeit.
Was passiert nun, wenn wir unser Raumschiff so beschleunigen, dass es der Lichtgeschwindigkeit immer näher kommt? Seine Masse nimmt immer mehr zu, sodass seine Beschleunigung auch dann, wenn die Raketen weiterschieben, immer kleiner wird. Letztlich kann die Lichtgeschwindigkeit nie erreicht werden, weil die Masse des Objekts dann unendlich groß würde.
Offenbar wird die Beschleunigung also immer kleiner, je näher wir der Lichtgeschwindigkeit kommen. Aber warum verspürt die Person im Raumschiff dann immer noch dieselbe Kraft wie bei der Erdbeschleunigung? Das liegt daran, dass die Zeit für die Passagiere im Raumschiff umso langsamer vergeht, je schneller die Rakete sich bewegt. Wir müssen uns jetzt fragen, wie lange es dauern würde, den Stern Alpha Centauri zu erreichen, wenn wir die Lichtgeschwindigkeit als Grenzgeschwindigkeit berücksichtigen. Es stellt sich heraus, dass der Stern Alpha Centauri dann nach einer Reisezeit von etwa sechs Jahren erreicht werden könnte.
Es sieht also so aus, dass ein Raumfahrer, der in unserem vorigen Beispiel die Lichtgeschwindigkeitsgrenze nicht kannte und glaubte, Alpha Centauri in vier Jahren zu erreichen, dort, sagen wir, ein Jahr zu bleiben und dann umzukehren, um für die Rückreise wieder vier Jahre zu brauchen, insgesamt also neun Jahre gebraucht hätte. Das wäre relativ annehmbar, wenn der Raumfahrer mit dreißig Jahren startet; bei der Rückkehr wäre er neununddreißig – kein Problem. Mit der Lichtgeschwindigkeitsgrenze würde dieselbe Reise dagegen rund dreizehn Jahre dauern; dabei würde die Zeit dem Raumfahrer sicherlich lang werden, und das Risiko einer Erkrankung oder sonstiger Schäden würde bestimmt steigen. Doch zum Glück ist das nicht die ganze Geschichte.
Einsteins Relativitätstheorie besagt nämlich zugleich, dass für den Raumfahrer die Zeit umso langsamer vergeht, je schneller er reist. Wenn der Raumfahrer also der Lichtgeschwindigkeit immer näher kommt, vergeht die Zeit für ihn sehr viel langsamer als für jemanden, der auf der Erde geblieben ist und ihn beobachtet. Tatsächlich verlaufen alle zeitabhängigen Prozesse langsamer, sodass nicht nur der Raumfahrer weniger schnell altert, sondern auch alle Uhren langsamer gehen. Der Raumfahrer selbst kann daher, wenn er sich im Raumschiff umschaut, nicht feststellen, dass die Zeit langsamer vergeht. Wenn wir dies berücksichtigen, zeigt sich, dass die Zeit, die er nach seiner eigenen Uhr braucht, um Alpha Centauri zu erreichen, sich auf etwa dreieinhalb Jahre verkürzt, sodass er die Reise nach seiner eigenen Uhr in der relativ kurzen Zeit von acht Jahren vollenden kann!
Bei seiner Rückkehr wird der Raumfahrer nur um acht Jahre gealtert sein, während die Menschen auf der Erde um dreizehn Jahre gealtert sein werden. Hätte der Raumfahrer einen Zwillingsbruder, so wäre dieser jetzt fünf Jahre älter als er. Dies ist das berühmte Zwillingsparadoxon (Abbildung 4), das Albert Einstein entdeckte, als er im Jahr 1905 seine Relativitätstheorie entwickelte. Tatsächlich würden alle Menschen auf der Erde schneller gealtert sein als unser Raumfahrer, aber die paar Jahre Unterschied spielen im Grunde keine Rolle. Sehr viel interessanter wäre es, wenn der Raumfahrer länger fortbliebe.
Abbildung 4 Ein Raumfahrer verlässt die Erde und verabschiedet sich von seinem Zwillingsbruder (oben). Wenn der Raumfahrer zurückkehrt, ist er selbst kaum gealtert, während sein Zwillingsbruder ein alter Mann wurde (unten). Dieses Zwillingsparadoxon ist ein Resultat von Einsteins Relativitätstheorie. Es tritt deshalb auf, weil in bewegten Systemen die Zeit langsamer vergeht.
Wir könnten uns zum Beispiel fragen, wie weit ein Raumfahrer reisen und noch in seiner Lebenszeit zur Erde zurückkehren kann. Wir nehmen auch wirklich an, dass er sein Raumschiff konstant mit Erdbeschleunigung beschleunigt und nach Erreichen der halben Wegstrecke den Schub umkehrt.
Es stellt sich heraus, dass der Raumfahrer auf diese Weise jeden Stern unserer Milchstraße erreichen könnte. Für die am weitesten entfernten Sterne benötigt er nach seiner eigenen Uhr etwa fünfzig Jahre, während auf der Erde bis zu seiner Rückkehr etwa hunderttausend Jahre vergangen sein werden. Natürlich trifft er niemanden mehr an, den er bei seiner Abreise gekannt hatte, aber er würde sehr, sehr berühmt werden. Es stellt sich heraus, dass man auf diese Weise auch Sterne in unserer Nachbarmilchstraße, in der Andromeda-Galaxie, besuchen könnte.
Was wäre die maximale Entfernung, die ein Raumfahrer tatsächlich zurücklegen kann? Nehmen wir an, er fliegt in einem Alter von zwanzig Jahren ab und kann noch weitere hundert Jahre leben, was durch Fortschritte der Medizin sicher möglich sein wird. Wenn er also hundert Jahre nach seiner Uhr hin und zurück unterwegs wäre, könnte er eine Entfernung von etwa hundertsechzig Milliarden Lichtjahren zurücklegen. Dies entspricht, soweit bekannt, dem Durchmesser des derzeitigen Universums. Bei seiner Rückkehr wären allerdings dreihundertdreißig Milliarden Jahre vergangen. Dann hat es keinen Sinn mehr, überhaupt zurückzukehren. Nach unserem jetzigen Wissen wird zumindest unser Sonnensystem dann nicht mehr existieren, vielleicht auch nicht mehr das Universum.
Der Science-Fiction-Traum Teleportation
Offensichtlich brauchen wir für große Entfernungen ein anderes Fortbewegungsmittel. Wir möchten jederzeit überallhin reisen, ohne Beschränkung hinsichtlich der Entfernung. Ist das möglich, zumindest grundsätzlich? Um uns diesen Wunsch zu erfüllen, haben Science-Fiction-Autoren die Teleportation erfunden. Simsalabim, und man verschwindet an einer Stelle, um – simsalabim – in Sekundenschnelle an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Überlegen wir uns einmal, was die Teleportation für uns leisten sollte, ohne hier auf die Frage einzugehen, wie sie eigentlich funktioniert und ob man vernünftigerweise von ihrer technischen Realisierbarkeit ausgehen kann.
Auf irgendeine Weise möchten wir ein Objekt oder gar einen Menschen von einem Ort zum anderen übertragen. Aber was heißt das genau: ein bestimmtes Objekt sein, ein Stück Materie, beispielsweise ein Bleistift oder ein Blatt Papier oder gar ein Mensch? Ein Objekt welcher Art auch immer setzt sich offensichtlich aus etwas zusammen, aus Material dieser oder jener Art. Nehmen wir einen Raumfahrer in weiter Ferne, der unbedingt etwas zu essen braucht. Wir möchten ihm per Teleportation einen knackigen Hamburger zukommen lassen. Was bedeutet es, dass etwas ein Hamburger ist – und nicht ein Turnschuh, ein Stuhl, ein Fußball, eine Brille oder eine Portion Gulasch? In erster Linie kommt es natürlich auf die Zutaten an. Man braucht Rindfleisch, Brot, eine Essiggurke und vielleicht etwas Ketchup. Aber ein Hamburger ist mehr als nur die Zutaten. Man bekommt ja keinen Hamburger, wenn man Rindfleisch, Brot, Gurke und Ketchup in die Küchenmaschine gibt und gründlich vermengt. Die Pampe würde niemand essen wollen. Es kommt also nicht nur auf die Zutaten an, aus denen etwas zusammengesetzt ist, sondern auch auf ihre genaue Anordnung. Das Brötchen soll in zwei Hälften zerteilt sein, auf die untere Hälfte kommt eine Portion Rinderhackfleisch, darauf ein Stück Gurke und etwas Ketchup, und obendrauf dann die andere Brötchenhälfte. Die Information darüber, wie die Zutaten, aus denen der Hamburger besteht, angeordnet sind, ist offenbar ganz wesentlich.
Ein Objekt ist also definiert durch die Zutaten, aus denen es besteht, und durch die Information, wie die Zutaten anzuordnen sind. Es besteht demnach aus Materie und Information oder aus Material und Information. Um also ein Objekt, beispielsweise unseren Hamburger, zu dem fernen Raumfahrer zu teleportieren, benötigen wir zwei Dinge: die Materie, aus der das Objekt besteht, und die Information darüber, wie diese Materie anzuordnen ist. Wir werden sehen, dass die Materie, aus der das Objekt besteht, austauschbar ist. Trotzdem haben wir dann noch immer dasselbe Objekt. Also ist die Information über die Anordnung der Materie das Wesentliche.
Der Stoff, aus dem das Licht ist
Die ersten Teleportationsexperimente wurden mit Licht gemacht. Was ist Licht? Das Licht fasziniert die Menschen seit jeher. Wahrscheinlich haben sie sich schon lange vor der Erfindung der Schrift gefragt, wie es möglich ist, dass wir mittels des Lichtes nahe oder auch weit entfernte Gegenstände wahrnehmen können.
Es gibt jenseits aller Theorie für den Physiker zwei Grundkonzepte, mit denen erklärt werden könnte, wie sich von einer Lichtquelle – sagen wir, der Sonne oder auch einer winzigen Kerze – etwas bis in unsere Augen fortpflanzt, sodass wir den Gegenstand, der das Licht aussendet, wahrnehmen können. Nach dem einen Konzept pflanzt sich das Licht in Form von Teilchen fort, genau wie Materiebröckchen. Nach dem anderen Konzept erreicht uns das Licht in Form von Wellen.
Die einfachste Analogie zum Teilchenkonzept ist die, dass Licht sich fortpflanzt wie eine Pistolenkugel oder eine kleine Murmel. Das einfachste Beispiel für das Wellenkonzept ist das Bild von Wellen, die sich auf der Wasseroberfläche ausbreiten, etwa im Teich.
Mit der Kugel haben wir etwas Lokalisiertes, das sich fortbewegt. Die Kugel ist an einer bestimmten Stelle, und sie bewegt sich auf einer bestimmten Bahn von der Lichtquelle, von dem Gegenstand, den wir sehen, zu unseren Augen. Außerdem kommen die Kugeln eine nach der anderen; das Bild, das wir mit unseren Augen sehen, entstünde dann dadurch, dass die Lichtquelle, etwa die Sonne, viele winzige Lichtteilchen emittiert, die sich zu uns fortpflanzen. Dabei treffen sie beispielsweise auf den Baum auf der anderen Straßenseite, der einige von ihnen reflektiert und streut. Einige landen schließlich in unseren Augen.
Ganz anders die Welle auf der Oberfläche eines Teiches, die nicht lokalisiert ist. Wer einen Stein in einen stillen Teich wirft, sieht eine Welle, die sich schließlich über die ganze Wasseroberfläche ausbreitet (Abbildung 5). Wellen kommen außerdem nicht stück- oder brockenweise vor, sondern können jede beliebige Größe haben. Man bekommt winzig kleine Wellen, wie sie etwa die Beine eines über den stillen Teich gleitenden Wasserläufers auslösen. Oder man bekommt größere Wellen, erzeugt durch dicke Steine, die wir ins Wasser werfen. Die Wasserwellen sind also von stetiger Größe, während Teilchen unstetig sind.
Abbildung 5 Ein Stein löst in einem Teich eine Wasserwelle aus. Die Ausbreitung der Welle geschieht dadurch, dass die Schwingung an einer Stelle eine ähnliche Schwingung in seiner Nachbarschaft anregt.
Es besteht aber ein weiterer, sehr wichtiger Unterschied: Die Wasserwellen brauchen ein Medium, in dem sie sich ausbreiten. Sie sind auf das Wasser angewiesen. Kugeln dagegen können sich auch im leeren Raum ausbreiten. Sie brauchen kein Medium.
Daher die große Frage: Was ist Licht? Welches Konzept gilt hier, das Wellen- oder das Teilchenkonzept? Welche der gerade aufgezählten Merkmale sind tatsächlich Merkmale des Lichtes?
Die Geschichte der Physik ist zu großen Teilen eine Geschichte der Erforschung der Natur des Lichtes. Schon sehr früh haben Wissenschaftler sorgfältig untersucht, welche der Kriterien für Teilchen oder Wellen auf das Licht zutreffen. Im 18. Jahrhundert kam es zu einer großen Auseinandersetzung zwischen den von Isaac Newton angeführten Anhängern des Teilchenbilds und den von Robert Hooke angeführten Verfechtern des Wellenbilds. Damals setzte sich das Teilchenbild durch. Viele sagen, das Gewicht und die Autorität Newtons hätten den Ausschlag dafür gegeben.
Licht als Welle
Im Jahr 1802 führte der englische Arzt Thomas Young ein Experiment durch, das sich als entscheidend für unser Verständnis der Natur des Lichtes erweisen sollte. Es gehört zu den Schlüsselexperimenten in der Geschichte der Naturwissenschaften. Der Versuch an sich ist ganz einfach: Thomas Young schickte lediglich Licht durch zwei spaltförmige Öffnungen in einem Schirm (Abbildung 6).
Abbildung 6