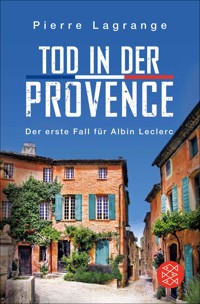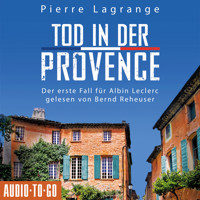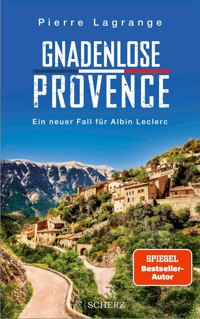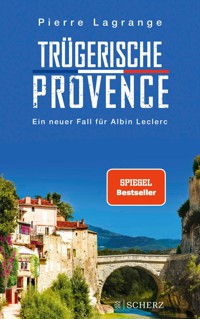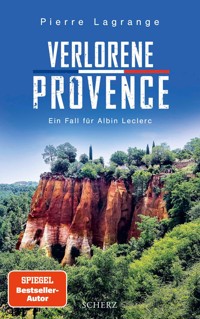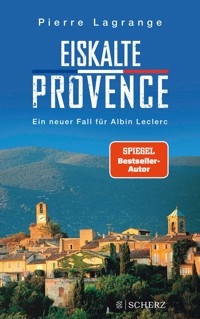
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Ex-Commissaire Albin Leclerc jagt vor Weihnachten einen Killer – der sechste Band der Provence-Krimireihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Die Vorbereitungen für das Weihnachtsfest im Hause Leclerc laufen auf Hochtouren: Überall duftet es nach französischen Köstlichkeiten, und alles ist weihnachtlich geschmückt. Doch Albin ist alles andere als in Weihnachtsstimmung. Da kommt ihm die Anfrage der örtlichen Polizei gerade recht. Die Kollegen sind vor Weihnachten so überlastet, dass sie Albins Hilfe dieses Mal wirklich gebrauchen können. Denn in einer kleinen Hütte wurde eine junge Frau tot aufgefunden – eingehüllt in ein Brautkleid. Der Ex-Commissaire findet bald heraus, dass die Tote zum Clan der Banater gehört hat, die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall des Eisernen Vorhangs massenhaft aus Rumänien nach La Roque eingewandert sind. Und eine Spur führt den Ex-Commissaire zu einer Sekte, die Schreckliches plant ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 383
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Pierre Lagrange
Eiskalte Provence
Ein neuer Fall für Albin Leclerc
Roman
Über dieses Buch
Eine Frau wird in der Nähe von La-Roque-sur-Pernes brutal ermordet aufgefunden – geht in der winterlichen Provence ein Mörder um?
Ex-Commissaire Albin Leclerc findet bald heraus, dass die Tote zum Clan der Banater gehört, die nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Fall des Eisernen Vorhangs massenhaft aus Rumänien nach La Roque eingewandert sind. Und eine Spur führt ihn zu einer Sekte, die nicht nur mit dem Leben ihrer Anhänger spielt, sondern mit dem Leben der Menschen in der gesamten Provence.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Die Bände der Erfolgsserie um den liebenswerten Commissaire Albin Leclerc und seinen Mops Tyson sind im FISCHER Verlag erschienen.
1
Stéphanie war schon einmal um ihr Leben gelaufen. Damals, vor vielen Jahren. Sie war ungefähr acht Jahre alt gewesen, so genau erinnerte sie sich nicht mehr.
Damals war sie vom Spielen bei ihrer Freundin Jeanne gekommen und durch das Dorf nach Hause gegangen. Das Haus ihrer Eltern befand sich außerhalb, etwa einen Kilometer weit entfernt, was nicht viel war. An diesem frühen Abend aber schon.
Es war bereits dunkel und eiskalt gewesen, ein Dezembertag wie dieser, und die engen, steilen Straßen von La Roque-sur-Pernes waren menschenleer gewesen. Nur der Mistral hatte durch die Gassen geweht. Eigentlich war es gar kein Problem, von Jeanne aus heimzugehen. Stéphanie hatte das bereits viele Male getan. Doch an jenem Tag war sie überzeugt gewesen, verfolgt zu werden.
Stéphanie wusste nicht, von wem. Sie war sich nicht einmal sicher, ob es eine menschliche Kreatur war, ein schreckliches Wesen aus einer anderen Welt, ein Mörder oder ein Kinderfänger wie der, vor dem ihre Eltern sie kürzlich gewarnt hatten und der in der Provence sein Unwesen trieb. Wenn jemand mit ihr reden wolle, den sie nicht kenne, dann solle sie schreien und fortlaufen, hatte ihre Mama gesagt. Ja, vielleicht war es dieser Kinderfänger, der unaussprechliche Dinge mit einem tat – Dinge, die in der Phantasie des Mädchens nur unscharf und vage waren. Jedenfalls war sie mit einem Mal davon überzeugt, dass dieser Jemand oder dieses Etwas durch die Straßen des kleinen, alten Ortes, der sich wie ein Schwalbennest an die Felsen schmiegte, wandelte und sie gewittert hatte.
Da waren Geräusche gewesen, die vielleicht nur vom Wind oder von einer Katze stammten, doch schließlich überkam sie die Panik. Stéphanie war losgelaufen, schneller, immer schneller. Einige Male wäre sie beinahe auf dem vom Regen des Nachmittags glitschigen Kopfsteinpflaster ausgerutscht und hingefallen. Doch sie konnte sich jedes Mal wieder fangen und rannte weiter, spürte, wie sich Klauen nach ihr ausstreckten, heißer Atem in ihrem Nacken, ihren Namen wispernd.
Aber Stéphanie wollte nicht sterben. Sie wollte nicht, dass der Kinderfänger sie schnappte und Dinge mit ihr anstellte, ihre Finger abschnitt und aufaß, oder sie in einen Kerker sperrte, wo sie mit Ratten leben musste und nie wieder das Licht erblicken würde, oder … oder noch viel Schlimmeres geschah.
Deswegen lief sie, lief um ihr Leben, und die wenigen Minuten, bis sie auf den Schotterweg zum rettenden Elternhaus einbog, kamen ihr wie eine Ewigkeit vor. Sie klingelte Sturm, presste den Rücken an die Haustür, damit sich bloß keine Hand auf ihre Schulter legen und sie fortreißen konnte. Sie hatte in die Dunkelheit gestarrt, aber nichts ausgemacht außer die Schemen von kahlen Bäumen, vom Weidezaun und die Lichter von La Roque.
Schließlich hatte Mama die Tür geöffnet, und Stéphanie war schnell hineingeschlüpft und hatte erklärt, dass alles in Ordnung und sie nur so außer Atem war, weil sie dringend zur Toilette musste. Aus ihrem Kinderzimmerfenster hatte sie dann nach draußen geblickt, um sich zu versichern, dass der Kinderfänger nicht dort lauerte, um sie zu holen, wenn sie schlief. Und wie es aussah, war dort draußen nichts – entweder, er hatte aufgegeben, oder er war niemals da gewesen und alles nur Einbildung von Stéphanie, einer ihrer Tagträume, die manchmal sehr lebhaft sein konnten.
Doch dieses Mal war es schlimmer, dachte Stéphanie, während sie mit jedem Laufschritt die eiskalte Luft in ihre schmerzenden Lungen pumpte.
Weitaus schlimmer. Und real.
Dieses Mal ging es wirklich um ihr Leben. Denn dieses Mal war tatsächlich jemand hinter ihr her, der unaussprechliche Dinge mit ihr tun oder sie töten würde. Oder beides. Und Stéphanie wusste, wer dieser Mann war.
Sie lief entlang desselben Weges, auf dem sie vor zwanzig Jahren vor einem namenlosen Grauen geflohen war. Die Richtung war dieselbe, denn sie lebte nach wie vor in ihrem Elternhaus, allein. Ihre Eltern waren vor einigen Jahren gestorben.
Es herrschte Halbdunkel, und der kalte Regen prasselte auf ihr Gesicht, hatte die Schlaglöcher auf dem Weg gefüllt und ihre Daunenjacke samt der Jeans und den Boots durchnässt.
Das Haus war so nah – und doch so fern. Stéphanie wusste: Der Moment, in dem sie vor der Tür stoppen, die Schlüssel aus ihrer Hosentasche ziehen und ins Schloss stecken würde, wäre der, in dem der Mann sie zu fassen bekäme. Er war ihr dicht auf den Fersen, schloss mit jeder Sekunde dichter zu ihr auf. Ihre Bronchien schienen platzen zu wollen. Ihre Muskeln brannten. Sie trat in eine Pfütze und versank bis über die Knöchel darin, strauchelte, hörte die schweren Schritte hinter sich und ihren Namen, mit schweren Atemstößen ausgekeucht.
»Stéphanie … Stéphanie, warte, es hat doch keinen Sinn!«
Sie schrie auf, rannte dann umso schneller weiter und bog nach rechts ab in den Wald. Sie hoffte, dass sie ihn dort würde abschütteln können. Vielleicht gewann sie etwas Vorsprung, aber … Aber sie musste ihn loswerden, sich verstecken oder Hilfe finden. Ihr Handy befand sich samt ihrer Geldbörse und der Dienstkleidung in der Umhängetasche, die ihr vorhin von der Schulter gerutscht war, als sie begriff, dass er sie verfolgte. Sie hatte die Tasche verloren und noch gesehen, wie er sie aufgehoben hatte, bevor er ihr hinterherzusprinten begann.
Er war ein Irrer. Ein komplett Verrückter. Das hatte sie immer schon geahnt, und jetzt wusste sie es, jetzt hatte sie den Beweis. Es gab keinen Zweifel mehr. Doch was nutzte das jetzt noch?
Stéphanie sprang über einen Graben, in dem es gurgelte. Das Regenwasser hatte ihn in einen strömenden Bachlauf verwandelt. Der Atem dröhnte in ihren Ohren, stach ihr in die Brust, ebenso wie die Zweige der kahlen Bäume ihr Gesicht peitschten und Dornen die Jacke an den Ärmeln aufrissen. Äste knackten unter ihren Sohlen. Sie sprang über vermooste Stämme – fort, nur fort von hier, in Sicherheit. Hinter ihr klang es, als breche ein großes Tier den Weg durch den Wald.
Ein Tier, das nach ihr rief.
»Stéphanie, warte doch! Wir müssen … reden …«
Aber sie wusste, dass er nicht reden wollte. Er wollte mehr, viel mehr. Hätte er nur reden wollen, dann hätte er das vorher schon tun können, statt sich an ihre Fersen zu heften. Nach der Arbeit hatte er in der Seitenstraße auf sie gewartet, um sie abzufangen. Er war vollkommen durchgedreht, ein Psycho sondergleichen.
Im nächsten Moment versank Stéphanies rechter Stiefel im Morast. Sie wurde im vollen Lauf gebremst. Irgendetwas knackte in ihrem Knöchel. Ein höllischer Schmerz folgte, worauf ihr Körper nach vorne schlug und mit dem Gesicht voran auf dem Boden im nassen Laub aufkam. Der Aufschlag presste ihr fast alle Luft aus dem Brustkorb. Das letzte bisschen entwich, als ihr Verfolger sich mit den Knien voran auf Stéphanies Rücken zwischen die Schulterblätter fallen ließ.
Aus, dachte sie.
Jetzt war alles aus und vorbei.
Ende.
»Stéphanie«, hörte sie zwischen schweren Atemstößen dicht an ihrem Ohr und spürte, dass ihr Kopf an den Haaren nach hinten gerissen wurde, um ihren Hals zu entblößen. »Stéphanie«, grunzte die Stimme, »jetzt wird endlich alles gut.«
2
Der Mann war von Liebe erfüllt.
Trotz der Kälte war er komplett durchgeschwitzt, nachdem er den Körper schließlich ins Trockene gezerrt hatte. Das aus groben Bruchsteinen geschichtete Gewölbe ließ seinen Atem hallen. Die Ritzen zwischen den Steinen ließen kaum etwas von dem schier endlosen Regen durch. Hier drinnen war es trocken.
Der Mann warf Stéphanies Umhängetasche auf den Boden, zog das Smartphone aus der Tasche und schaltete die Taschenlampen-App ein. Er stellte das Gerät auf einen schmalen Sims, ließ sich dann auf den Boden plumpsen, um für einen Moment zu Atem zu gelangen, schloss die Augen und konzentrierte sich auf das Geräusch der prasselnden Tropfen vor dem Eingang.
Dann öffnete er wieder die Augen und betrachtete den vor sich ausgestreckten Körper. Endlich war er mit ihr ganz allein. Endlich konnte er mit ihr tun, was er schon immer mit ihr tun wollte. Endlich würde sie sein werden.
Der Mann wusste, dass es falsch war, aber auf der anderen Seite … Keiner käme auf die Idee, hier an diesem Ort nach ihr zu suchen – falls überhaupt jemals jemand nach ihr suchen würde. Und reden, nun, reden konnte sie jetzt sowieso nicht mehr. Ihre geröteten und gleichzeitig matten Augen standen weit offen. Regentropfen und kleine Erdkrümel hatten sich darin gesammelt. Ihre Lippen waren leicht geöffnet. Man könnte meinen, sie wollte jeden Moment etwas sagen oder andere Lippen dazu einladen, sie zu …
Der Mann beugte sich nach vorn und zu Stéphanie herab. Er presste seinen Mund auf ihren, küsste sie leidenschaftlich und ignorierte den Geschmack nach Blut auf ihrer kalten Zunge. Er strich ihr die nassen Haare aus dem Gesicht und vom Hals, der an der Kehle von seinem Klammergriff dunkel verfärbt war. Sie war so schön. Er würde etwas finden, um diese Würgemale zu verdecken. Und wenn ihr Haar trocken war, dann würde er es kämmen und flechten.
Aber jetzt musste sie erst mal raus aus den nassen Sachen. Er musste sie ohnehin ausziehen, weil er im Etikett und in den Schuhen nach ihrer Größe schauen wollte, wenn er ihr neue, trockene Sachen besorgte.
Der Mann lächelte versonnen, verspürte einen Knoten im Hals und musste beinahe weinen vor Glück. Er betrachtete Stéphanie lange, strich ihr sanft und liebevoll über die bleiche Wange. Sie würde eine so schöne Braut werden.
So schön.
3
Nicolas Aubery führte die kleine Trekkinggruppe im Laufschritt entlang des Chemin de la Grange Neuve in Richtung der D57, die direkt nach La Roque-sur-Pernes führen würde. Von dort aus sollte es eigentlich weiter nach Le Beaucet gehen, aber mal sehen, dachte Aubery, denn das Wetter hatte sich schlagartig verschlechtert. Wenigstens bestand die Handvoll Wanderer aus Profis, die die stillen Tage vor Weihnachten in der Provence verbringen wollten, welche im Winter ihren ganz besonderen Charme hatte – falls die Sonne schien. Ein niederländisches Pärchen war dabei, drei Deutsche, alle etwas älteren Semesters und mit vernünftiger Kleidung und vernünftigem Schuhwerk ausgestattet.
Am Mont Ventoux waren sie bereits gewesen. Auch im Luberon hatten alle ziemlich gut durchgehalten. Deswegen zweifelte Aubery, der die Kapuze seiner knallroten Outdoorjacke nun fester zog, nicht daran, dass ein ordentlicher Guss keinen von ihnen zur Verzweiflung treiben würde. Allerdings wollte auch niemand gern bis auf die Knochen nass werden, wenn er noch ein paar Kilometer vor sich hatte. Und Aubery hatte beim Frühstück schon davor gewarnt, dass das Wetter umschlagen würde – doch keiner hatte zurückgezuckt. Zur Not müssten sie sich eben irgendwo unterstellen.
Das Wetter, dachte Aubery, würde jedenfalls noch schlechter werden, wie ihm ein Blick zum dunkelgrauen Himmel verriet. Es regnete bereits fette Tropfen aus dicken Wolken, die der Wind vom Mittelmeer ins Inland schob. Dazwischen traten jetzt Graupelschauer auf, die sich nach Auberys Einschätzung bald in Hagel verwandeln würden. Der Wetterdienst hatte davor gewarnt und gesagt, dass es kurz vor Weihnachten in den Lagen über achthundert Meter sogar zu Schneefällen kommen könnte und vielleicht einige Tage so bleiben würde.
Na, schönen Dank auch. Das waren keine guten Aussichten für Auberys Gruppe, mochten alle auch noch so hartgesotten sein. Schließlich würde er sie noch drei Tage durch die Provence führen müssen.
Andererseits konnten sie auch keinen Mistral gebrauchen, selbst wenn der Wind die Wolken wieder zurück aufs Mittelmeer pusten und den Himmel freifegen würde. Denn das ging häufig mit Orkanböen einher, die im Dezember ziemlich kalt sein konnten. Wenn ein Hoch über dem Ostatlantik und ein Tief über Norditalien aufeinandertrafen, entstand der Mistral und drängte als Fallwind aus dem Norden in das Rhonetal hinein und an der Küste wieder hinaus. Eingepfercht durch die Alpen im Osten und das Zentralmassiv im Westen, erhielt der Mistral einen Düseneffekt. Meist blieb er nur ein paar Tage, aber im vorletzten Winter hatte der Mistral um die Jahreswende herum fast vierzehn Tage lang geweht, zum Teil mit einhundertzwanzig Stundenkilometern, und in Orange hatten sie Rekordwerte gemessen. Das brauchte in diesem Winter wirklich niemand.
Hagel aber auch nicht, dachte Aubery, der hinter sich ein »Oooh!« von einem der Touristen hörte, als die ersten Körner auf den glitschigen Asphalt trafen und wie Geschosse das Wasser in den Schlaglochpfützen auf dem Chemin de la Grange Neuve aufpeitschten. Besser, sie stellten sich irgendwo unter, dachte Aubery, denn der Hagel tat richtig weh, wenn er auf den Körper traf. Die Körner waren deutlich größer als Erbsen. Er hatte auch schon eine Idee für einen Unterschlupf.
»Hier lang«, rief er und deutete nach rechts.
Die Gruppe folgte ihm auf eine Wiese unter kahlen Bäumen, kurz bevor der Chemin auf die Landstraße traf. Dort befanden sich zwei aus Natursteinen aufgeschichtete Hütten vom Format einer kleinen Scheune, von denen eine zum Teil eingestürzt war. Die Bories genannten Steinhütten hatten früher Bauern oder Hirten Unterschlupf geboten. Sie sollten für Wanderer perfekt sein. In der Provence gab es einige davon, bei Gordes sogar ein ganzes Dorf. Manche sahen wie Bienenkörbe aus, andere, wie die Bories bei La Roque, waren eher Langbauten. Einige stammten aus dem Mittelalter, teilweise gab es sehr viel ältere, andere waren neuer. Es waren reine Zweckbauten gewesen: Auf den Feldern hatten die Bauern Steine gesammelt, um mehr Fläche für die Bebauung von neuem Land zu gewinnen. Diese Steine schichteten sie entweder zu Mauern auf – oder eben zu Schutzhütten wie den Bories, in denen man auch Werkzeug lagern oder Vieh unterbringen konnte.
In der Provence waren die Bories eine Touristenattraktion und ein Ausflugsziel geworden, zumindest während der Hauptsaison im Sommer und im Frühjahr.
Jetzt lief die Trekkinggruppe über die Wiese. Die schweren Schritte schmatzten im nassen Rasen. Sie steuerten auf die erste Steinhütte zu. Sie war eingestürzt wie ein Vulkankegel und würde keinen Schutz vor dem Unwetter bieten. Die zweite wäre besser, dachte Aubery. Er fand den Eingang und duckte sich hindurch ins Innere. Die fünf Touristen folgten ihm nach. Sie keuchten, atmeten schwer, als sie die Hütte betraten. Aubery allerdings verschlug es sofort den Atem. Es roch, als sei hier drinnen ein Tier verendet.
»So ein Glück«, sagte einer der Deutschen und fuhr sich durchs Gesicht, um den Regen abzuwischen. Ein anderer schaltete an seinem Handy die Taschenlampen-App ein, um das Dunkel zu erhellen.
»Na, hoffentlich wird es bald besser«, sorgte sich eine ältere Dame. »Was ist denn das für ein Gestank?«
»Sonst müssen wir ein Taxi rufen lassen«, sagte ihr Mann und zog die Kapuze ab. »Mein Gott, wonach riecht es denn hier?«
Aubery schwieg. Er stand wie versteinert und hielt immer noch die Luft an. Er starrte in die hintere Ecke der Hütte, die Augen weit aufgerissen, unfähig, sich abzuwenden von dem, was er dort sah. Aber schließlich drehte er sich um, hielt sich den Mund mit beiden Händen zu und drängte sich durch die Gruppe seiner Kunden zum Ausgang, um sich im hohen Bogen zu übergeben.
4
Castel und Theroux standen unter einem weit ausladenden Regenschirm. Er war schwarz wie die Wolken, die über den Abendhimmel jagten. Schwarz wie die Skelettfinger der Bäume, die nach ihnen zu greifen schienen, um sie auszuwringen und noch mehr Regen aus ihnen zu pressen. Zum Glück gelang das nicht. Der Regen, der bereits fiel und auf den Schirm prasselte, war Castel genug. Schon seit Tagen herrschte dieses Wetter, und es passte zu ihrer Stimmung und zur Stimmung dieses Ortes.
Castel warf einen Blick auf ihr Handy, sah auf dem Regenradar keine Wetteränderung für die kommenden Stunden und schob es zurück in ihre wattierte Regenjacke. Die Jeans steckten in den Gummistiefeln, gegen die sie ihre Schnürschuhe eingetauscht hatte. Die kurzen Haare waren unter einer Strick-Beanie versteckt. Castel reichte Theroux gerade mal bis zur Schulter. Wie um der Kälte zu trotzen, war er lediglich mit einer Lederjacke bekleidet, unter der er ein mit Aufnähern besticktes Hemd trug. Theroux gehörte zu der Sorte Mensch, denen immer warm war, selbst bei Minusgraden, die aber heute zum Glück nicht herrschten. Dennoch waren es zurzeit gerade mal sechs Grad, und ein kalter Wind sorgte mitsamt der feuchten Luft dafür, dass Castel permanent fröstelte.
Der Bereich um das Steinhaus von La Roque-sur-Pernes war weiträumig abgesperrt. Der schmale Chemin de la Grange Neuve stand voller Fahrzeuge – Dienstwagen von der Police nationale und der Gendarmerie, außerdem die Fahrzeuge der Spurensicherung und der Rechtsmedizin sowie ein Leichenwagen und der vom Notarzt, den man hier jetzt nicht mehr brauchte. Castel und Theroux warteten darauf, dass der Fundort der Leiche von den Forensikern freigegeben wurde, was sehr bald der Fall sein würde.
Bis dahin hatten sich Theroux und Castel die Zeit damit vertrieben, Aussagen und Personalien der Wandergruppe zu notieren und sich das Umfeld der Natursteinhäuser anzuschauen, weswegen Castels Gummistiefel und Therouxs Schuhe voller Matsch waren. Gefunden hatten sie jedoch nichts. Abgesehen davon würde der Regen sowieso jegliche Spuren verwischt haben. In der Hütte hingegen war alles konserviert wie in einer Zeitkapsel.
Wie Castel und Theroux von den Zeugen, der Spurensicherung und dem Notarzt bislang erfahren hatten, erwartete sie dort drinnen eine entsetzliche Szenerie mit einer weiblichen Leiche als Hauptakteurin.
Theroux und Castel merkten auf, als ein kleiner Renault heranrollte. Er parkte am Straßenrand. Der Warnblinker wurde eingestellt. Ein älterer Mann stieg aus, hager, kahler Schädel, dazu eine Wachsjacke. Er spannte einen kleinen Regenschirm auf und ging rasch zu Castel und Theroux, deren signalrote Armbinden mit der Aufschrift »Police« ihm aufgefallen sein mussten.
»Michel Thomas«, stellte er sich mit leiser Stimme vor. Auf Castel wirkte er wie der Gast einer Beerdigung. »Ich bin der Ortsbürgermeister.« Er deutete hinter sich in Richtung La Roque. »Ich möchte mich erkundigen, was geschehen ist. Die Menschen sind beunruhigt. So viel Polizei … Man sprach davon, es sei eine Tote gefunden worden.«
»Wer sagt das?«, fragte Theroux.
»Wanderer. Eine Trekkinggruppe. Sie sind im Ort eingekehrt, um sich aufzuwärmen, zu trocknen, etwas zu trinken und zu essen. Alle waren außer sich.«
Theroux und Castel wechselten einen Blick. Das sprach sich ja schnell herum. Hoffentlich hatten die Zeugen nicht allzu viele Details erwähnt. Andererseits wäre das ein Wunder – bei diesen bizarren Rahmenbedingungen. Zum Glück hatte die Presse noch keinen Wind davon bekommen und störte die Polizei nicht bei der Arbeit. Zumindest noch nicht. Aber das konnte sich sehr schnell ändern.
»Es wurde eine Leiche gefunden«, sagte Theroux. Das Offensichtliche konnte er ruhig zugeben. Angesichts des Fuhrparks und Personenaufgebots erklärte sich ja fast von selbst, dass an Ort und Stelle etwas sehr Schlimmes vorgefallen sein musste.
»Gott«, sagte Thomas.
»Mit dem hat das nicht viel zu tun, fürchte ich.«
»Weiß man … Wissen Sie, wer …«
»Wir wissen noch gar nichts. Und wenn, dann dürften wir nicht darüber sprechen.«
»War es ein Verbrechen?«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Weil … Was man im Ort erzählte …«
»Allem Anschein nach ja.«
»Entsetzlich«, murmelte Thomas und starrte in eine Pfütze. Dann sah er wieder zu Theroux und Castel. »Wenn es irgendetwas gibt, bei dem ich helfen kann …«
»Dann melden wir uns«, kürzte Theroux ab.
»Vermisst man denn jemanden im Ort?«, fragte Castel.
Thomas zuckte mit den Achseln, dachte nach, wog ganz offensichtlich ab, ob er etwas sagen sollte oder nicht, rang sich dann aber durch und sagte: »Die Kleine aus der Wäscherei vom Hotel-Restaurant Banatais ist heute nicht zur Arbeit erschienen. Der Inhaber war außer sich. Das muss nichts bedeuten, aber …«
»Banatais? Was ist denn das für ein Name?«, erkundigte sich Theroux.
»Die Ortsgeschichte«, erwiderte Thomas, als sei das Erklärung genug.
»Wie heißt die Frau?«, fragte Castel.
»Stéphanie Kaufmann.«
»Können Sie sie beschreiben?«
»Sie müsste Mitte zwanzig sein. So groß wie Sie vielleicht, schwarze Haare bis hier.« Thomas markierte einen Strich am Hals. »Immer sehr freundlich. Lebt im Haus ihrer Eltern ganz in der Nähe.«
»Wo ist das?«
»Die Straße runter, aber in die andere Richtung.«
Castel nickte.
»Ist sie … Ist denn … Die Leiche …«, stammelte Thomas.
»Wir wissen noch gar nichts«, wiederholte Theroux. »Und wenn wir etwas wissen müssen, melden wir uns bei Ihnen.«
Thomas nickte.
Castel merkte auf, als der Leiter der Spurensicherung sie heranwinkte und signalisierte, dass sie jetzt den Fundort betreten könnten.
»Tut mir leid«, sagte Castel, »wir müssen jetzt an anderer Stelle weiterarbeiten. Aber vielen Dank für die Informationen.«
Damit ließ sie ihn am Straßenrand stehen und marschierte los. Theroux folgte ihr auf dem Fuß.
Der Kies knirschte unter Castels Schritten. Sie schloss den Regenschirm, duckte sich unter Flatterband der Polizeiabsperrung hindurch und lief dann voran zum Eingang der Steinhütte, wo die Spurensicherung in ihren faserfreien weißen Overalls wartete und Castel und Theroux Platz machte, damit sie eintreten konnten.
Im Inneren sah es aus, als werde gerade ein Horrorfilm gedreht. Doch dieser Horror war sehr real. Brutal real im grellen Licht der LED-Scheinwerfer, die in den Ecken des Raumes auf Stativen standen. Der Gestank war enorm.
Castel zog ein Döschen Anis-Menthol-Paste aus der Tasche, öffnete sie, rieb sich etwas davon unter die Nase und bot Theroux etwas davon an, der aber mit einem Kopfschütteln ablehnte. Castel verschraubte das Döschen wieder und ließ es in der Tasche verschwinden, während sie mit den Augen alles in sich aufsog.
Nichts von dem hier würde sie jemals wieder vergessen können. Es würde sie in Momenten heimsuchen, in denen sie nicht damit rechnete. Es würde in wachen Nächten durch ihre Gedanken blitzen und noch in Jahren immer wieder auftauchen. Wenn sie Blumen sehen würde. Ein weißes Kleid. Immer wieder, dachte sie, würde sie dann an die Borie von La Roque-sur-Pernes zurückdenken müssen und wäre hilflos dabei, es zu unterdrücken.
Der Boden war gespickt mit Markierungen der Spurensicherung. Es würde eine Heidenarbeit sein, sie jeweils zu isolieren, zuzuordnen und nach dem Ausschlussprinzip zu ermitteln, welche Spuren zum Täter und welche zum Opfer gehörten. Die Chancen, etwas Brauchbares zu finden, waren nicht die schlechtesten: Castel ging davon aus, dass die Leiche erst seit wenigen Tagen hier lag und seit der Ablage nur die Trekkinggruppe den Raum betreten hatte – und der Täter.
Die zur Steinhütte gerufenen Gendarmen hatten alle Wanderer geistesgegenwärtig zusammengehalten und nach La Roque ins Trockene gefahren, wo die Forensiker der Gendarmerie und der Police nationale einerseits die Personalien feststellen und andererseits Abdrücke der Schuhprofile anfertigen konnten. Offensichtlich hatten sie die Gruppe in ein Restaurant gebracht. Davon hatte dann der Ortsbürgermeister gehört und war direkt hierhergekommen.
Die Leiche befand sich in der hintersten Ecke der Steinhütte und sah auf den ersten Blick aus wie eine zu groß geratene Flickenpuppe. Sie lag auf einer auf dem Boden ausgebreiteten Bettdecke, die so weiß war wie das Kleid und die Strümpfe, mit denen die Tote bekleidet war. Sie ruhte friedlich auf dem Rücken, die Hände auf dem Bauch gefaltet. In den Händen hielt sie einen welken Strauß. Getrocknete Blumen rahmten sie ein. Außerdem waren ihr welche ins schwarze Haar geflochten.
Die Augen standen offen und starrten ins Nichts. Das Gesicht war geschminkt, doch die Farbe konnte nicht verdecken, dass der Verwesungsprozess des Körpers längst im Gange war. Außerdem musste man kein Rechtsmediziner sein, um die schwarzen Abdrücke am Hals der Frau zu deuten: Sie war gewürgt worden, vermutlich bis zum Tode. Andererseits gab es mehrere dunkle Stellen auf dem Boden, getrocknete Pfützen, bei denen es sich nach Castels Einschätzung durchaus um Blut handeln könnte.
»Sie sieht aus wie eine Braut«, hörte Castel Theroux sagen.
»Ja«, sagte Castel, räusperte sich mit trockener Kehle und sagte es dann noch einmal deutlicher: »Ja, wie eine Braut gebettet.«
»So ein Irrsinn.«
Da hatte Theroux nicht unrecht. Außer dem Tod war es der pure Wahnsinn, der in diesen Mauern eingefangen war, diese Inszenierung der Toten … Castels Magen fühlte sich an, als werde er zusammengepresst. Das hier war keine Tat im Affekt gewesen. So viel stand für sie fest: Das hier war vielmehr von langer Hand geplant worden. Der Mörder hatte umgesetzt, wovon er träumte, sich in aller Ruhe mit der Toten befasst und sich viel Zeit dabei gelassen.
Castels erster Eindruck war, dass der Täter sie erst nach dem Ableben so bekleidet hatte. Alles war makellos sauber. Hätte die Frau in diesen Sachen um ihr Leben gekämpft, wären sie schmutzig, zerrissen, verrutscht. Außerdem musste er die Kleidung irgendwo in der passenden Größe gekauft haben, ebenso die Blumen.
Diese Vorbereitung, die ritualisierten Handlungen, die Zurschaustellung … Castel hatte so etwas noch nie gesehen. Und vielleicht war es nicht das erste Mal, dass der Täter das getan hatte, vielleicht auch nicht das letzte. Zudem die dunklen Flecken auf der Erde …
»Was für eine Freakshow«, sagte Theroux. »Was meinst du: Könnte das die Vermisste aus dem Ort sein?«
Castel zuckte die Achsel. Persönliche Gegenstände der Toten waren bislang nirgends gefunden worden. Es könnte sich um die Vermisste handeln – oder um irgendjemand ganz anderen. Castel fröstelte noch stärker als draußen. Ihr war eiskalt.
Sie sagte: »Wir werden uns Fotos der Vermissten besorgen und sie mit Fotos der Leiche abgleichen.«
Berthe, die Rechtsmedizinerin aus Nîmes, kam jetzt mit ihrem Assistenten herein. Bruno Grinamy, der Leiter der Spurensicherung, begleitete sie. Grinamy müsste eigentlich schon längst im Ruhestand sein. Aber es gab Personalnotstand, weswegen man ihn gebeten hatte, noch etwas Zeit dranzuhängen. Grinamy hatte zugesagt, wahrscheinlich nur allzu gern.
Jetzt blieb er neben Theroux und Castel im Hintergrund stehen, um Berthes Arbeit nicht zu behindern. Sie trug ihre typische Brille mit dem roten Gestell und einen faserfreien Overall, um bei der ersten Leichenbeschau keine Fremdspuren an der Leiche zu hinterlassen. Erst später oder morgen würde sie den Körper auf dem Seziertisch genau untersuchen. Unter ihrer Nase glänzte es. Sie verwendete ebenfalls Mentholpaste gegen den schier unerträglichen Geruch, dachte Castel. Erstaunlich, dass er Theroux überhaupt nichts auszumachen schien.
»Ist sie hier getötet worden?«, fragte Castel.
»Schwer zu sagen«, erwiderte Grinamy und deutete hinter sich. »Wir sind der Meinung, dass es am Eingang Schleifspuren gibt. Der Körper könnte demnach zumindest hierhergebracht worden sein – ob tot oder lebendig, lässt sich daraus nicht schließen. Auf dem Boden befindet sich sehr viel getrocknetes Blut, wenngleich wir auf den ersten Blick keine erkennbaren Verletzungen gefunden haben. Augenscheinlich ist sie aber stark gewürgt worden.«
Die Pfützen, dachte Castel, waren also tatsächlich Blut, wie sie vermutet hatte.
»Habt ihr irgendetwas …«
»Nein«, kürzte Grinamy ab. »Keine persönlichen Dokumente, gar nichts. Über das hinaus, was sich auf der Bettdecke befindet, haben wir nichts weiter gefunden.«
Theroux brummte unzufrieden. Als jemand nach ihm rief, verschwand er nach draußen. Castel beobachtete, wie Berthe den Kopf der Leiche untersuchte. Die Rechtsmedizinerin hatte Latexhandschuhe übergestreift, wendete das Kinn des Opfers nach links und rechts und sprach leise mit ihrem Assistenten, der einige Fotos machte. Sie behandelte die Tote fast schon pietätvoll. Der Eindruck würde sich sicherlich ändern, sobald Berthe ihre Assistenten im Obduktionssaal die Rippenschere und die Knochensäge für die Schädelöffnung zur Hand nehmen ließ.
Berthe sagte immer: »Der leblose Körper ist nur noch eine leere Hülle. Es ist unsere Aufgabe, herauszufinden, was mit ihm geschehen ist und wer dafür verantwortlich ist. Das ist der letzte Respekt, den wir einem Menschen erweisen können.«
Jetzt sagte Berthe beiläufig: »Ich nehme an, dass die Leiche hier bereits vier Tage liegt. Es gibt Male am Hals und dem Anschein nach Einblutungen in den Augen und der Gesichtshaut, was für starkes Würgen spricht. Der Verwesungsprozess ist nicht weit fortgeschritten. Der Geruch kommt in erster Linie davon.« Sie deutete auf die dunklen Flecken auf dem Boden – das getrocknete Blut. Blut roch sehr schnell entsetzlich. Jeder kannte das, wenn er Verpackungen von Lebensmitteln entsorgte, in die vorher Fleisch eingewickelt war. Den Effekt musste man mindestens verhundertfachen, wenn man es mit frischem Blut im Literbereich und anderen Körpersäften zu tun hatte.
»Ich kann noch nicht sagen«, fuhr sie fort, »woher das viele Blut stammt. Die Leiche sieht sauber aus. Es gibt keine Blutflecken auf dem Kleid oder der Decke, aber sehen wir doch mal nach.«
Berthe griff in ihre antik aussehende Ledertasche, ein klassischer Arztkoffer, nahm eine Schere heraus und schnitt damit das Kleid der Leiche am Ausschnitt etwas auf. Sie wollte den Körper offensichtlich nicht bewegen und auf den Rücken drehen, um dort einen Reißverschluss zu öffnen.
Castel konnte nicht sehen, was Berthe sah.
Aber sie hörte Berthe sagen: »Oh. Mein. Gott.«
5
Albin saß am Tresen und hörte der Kaffeemaschine bei der Arbeit zu. Sie fauchte, spritzte, brodelte, keuchte und spuckte. Wobei das Gerät nichts mit einer herkömmlichen Kaffeemaschine zu tun hatte. Auch nicht mit einem Vollautomaten. Vielmehr sah sie so aus, als habe jemand den Motor aus einem amerikanischen Straßenkreuzer der fünfziger Jahre ausgebaut, komplett verchromt und mit jeder Menge Hebeln und Anzeigen ausgestattet. Womöglich könnte man sie sogar in ein U-Boot einbauen und damit einmal quer durch den Atlantik tauchen.
In der glänzenden Oberfläche sah Albin sein verzerrtes Spiegelbild. Er sah es auch in den Christbaumkugeln, die an einem kleinen Strauch hingen, der über dem Tresen baumelte. Irgendwo zwischen diesen beiden Ansichten von Ex-Commissaire und polizeilichem Berater Albin Leclerc befand sich der Stiernacken von Matteo, der das Café du Midi führte. Matteo klapperte mit dickwandigen Tassen und summte eine Melodie mit, die im Radio lief. Und das war der Moment, in dem Albin genug hatte.
»Jetzt reicht’s mir aber, beim besten Willen: Schluss damit«, sagte er und fuhr mit der Hand über das abgewetzte, aber auf Hochglanz polierte Holz der Theke.
»Geh anderen Leuten mit deiner schlechten Laune auf die Nerven«, erwiderte Matteo unbekümmert, platzierte eine Tasse unter dem Chromblock und hantierte an einigen Hebel, als sei er Kapitän Nemo am Steuer der »Nautilus« höchstpersönlich – oder als wollte er eine Zeitmaschine in Betrieb setzen.
»Im Ernst«, sagte Albin und streckte sich. »Ich höre dieses Lied jetzt zum fünfhundertsten Mal.«
»Weil sie es vor Weihnachten eben immer wieder spielen, meine Güte.«
»Das ist aber kein Weihnachtslied.«
»Dummes Zeug.«
»Er singt über eine verlorene Liebe. Sie hat ihn betrogen. Er weint ihr immer noch hinterher und schwört, dass er es nächstes Mal besser weiß. Was, zum Teufel, hat das mit Weihnachten zu tun?«
»Na, er singt Last Christmas. Und Christmas heißt nun einmal Weihnachten.«
»Dann hör halt auf den gesamten Text.«
Albin sah, wie Matteos massige Schultern unter dem Strickpullover, der aus den Achtzigern stammen musste, schlaff zuckten. »Bin ich Engländer? Wenn sie wollen, dass ich ihre Texte verstehe, sollen sie gefälligst Französisch singen.«
Albin rollte mit den Augen und öffnete den Reißverschluss am Kragen seines Troyers. Ihm war warm. Außerdem war es heiß hier drinnen im Café du Midi. Normalerweise saß Albin draußen an einem der Tische unter den Platanen, den Bouleplatz im Rücken, die Straße vor sich, damit er immer genau sehen konnte, was dort vor sich ging und ob jemand Wichtiges kam – wie zum Beispiel Streifenpolizisten, die bei Matteo ihre Pause auf einen Kaffee einlegten und Albin mit Neuigkeiten versorgten. Das Innere der Mischung aus Bar Tabac und Café glich nach Albins Ansicht eher einer Höhle, und das war es auch. Es herrschte zu jeder Jahreszeit ein diffuses Halbdunkel hinter den zum Teil blinden Fenstern. Heute Morgen fiel nur das Licht einer einzelnen Deckenlampe auf die elektronische Kasse, die sich auf einem Stehpult befand, hinter dem in schmalen Regalen Zeitschriften und Zigarettenpackungen aufgereiht waren. Von dort aus betrat man Matteos natürliches Habitat hinter dem Tresen.
Davor standen abgewetzte und zum Teil geflickte Barhocker. Auf einem davon saß Albin. Tyson, Albins Mops, lag darunter und kaute engagiert auf etwas herum, das einmal zu einem anderen Tier gehört hatte. An der anderen Wand gab es drei Sitzplätze auf Bänken. Die Wände waren verblichen, wie die Markise über der Fassade mit abgeblättertem Putz, und von einer undefinierbaren Farbe zwischen Ockerrot und Braun.
Sie waren mit gerahmten Bildern gespickt, deren Glas wahrscheinlich vor mehr als zwanzig Jahren das letzte Mal geputzt worden war. Einige zeigten Zeitungsausschnitte großer Tour-de-France-Siege und Originalfotos von der Etappe, die jedes Jahr durch Carpentras zum Mont Ventoux führte. Andere wiederum waren Berichte über große Boxkämpfe.
Jedenfalls hatte Matteo, der in etwa im gleichen Alter wie Albin war, also Ende sechzig, früher einmal geboxt und war gar nicht schlecht gewesen. Daher die Zeitungsausschnitte. Aber in den Ring würde er niemals wieder steigen, höchstens für seine Herzenspartei. Der einzige Bilderrahmen, der in der Bar geputzt war, zeigte das strahlende Antlitz von Marine le Pen, der Chefin des Front National. Matteo war ein glühender Anhänger von ihr und fand sie mindestens so attraktiv wie Catherine Deneuve in ihren besten Jahren. Na ja. Albins Geschmack war ein anderer, sowohl bei Frauen als auch in der Politik. Wenngleich er sich generell nicht viel aus Politik machte.
Er hatte alle kommen und gehen sehen: Liberale, Konservative, Linke, Rechte, Demokraten, Republikaner, Unparteiische, Christen, Islamisten, Freigeister – doch was die Polizeiarbeit und die Kriminalität anging, machte das alles keinen Unterschied. Gab es weniger Verbrechen mit den Hardlinern? Nein. Wurde die Polizei besser bezahlt und ausgestattet, seit die Rechten so stark waren wie nie? Kein Stück. Gab es weniger Morde mit den Linken? Pustekuchen. Kein Drogenschmuggel mehr? Das Gegenteil war der Fall.
Von daher war es Albin eigentlich ziemlich gleichgültig, wer gerade am Ruder war, denn Kriminalität gab es schon immer und würde es immer geben – vollkommen gleichgültig, ob man die Guillotine wieder einführen würde oder nicht.
»Daran siehst du mal wieder«, sagte Albin und legte sein Smartphone vor sich ab, »dass du doch besser zur Schule gegangen wärst und Englisch gelernt hättest. Dann würdest du dir nicht so ein dummes Zeug vorsingen lassen.«
»Mir gefällt das Lied«, sagte Matteo und wendete sich zu Albin, um ihm dem Kaffee zu servieren.
»Dir ist schon klar, dass der Sänger ein homosexueller Grieche war? Für mich völlig in Ordnung, denn ich bin tolerant. Aber jemand wie du, Matteo? Gefällt mir. Ja. Aber ich wundere mich dennoch ein bisschen.«
Matteo stockte kurz in der Bewegung, setzte dann die Tasse klappernd ab. »Und dann singt er über ein Mädchen, das ihm weggelaufen ist?«
Albin nickte. Der Kaffee duftete betörend – der beste, den man weit und breit bekommen konnte. Albin beschloss, das Thema zu wechseln, und beugte sich über die Tasse. Inhalierte. Phantastisch. Er sagte: »Der Kaffee ist so dünn, dass ich sogar noch den Dreck der letzten vier Jahre auf dem Boden sehen kann.«
»Stärker mache ich ihn für Kunden in deinem Alter nicht«, sagte Matteo. »Keine Lust, dass du mir einen Herzkasper bekommst oder mir deine Frau Ärger macht, wenn du heute Abend nicht schlafen kannst und dauernd zum Pinkeln rausrennst.«
Albin grinste. »Sie macht mich sowieso verrückt.«
»Veronique?«
»Ja. Was meinst du, wie verzweifelt ich sein muss, dass ich mich in diese miese Kaschemme zurückziehe?«
»Was tut sie denn, das dich verrückt macht?«
»Na ja«, sagte Albin und nahm einen Schluck Kaffee. Das Getränk der Götter. Heiß. Schwarz. Stark. Perfekt. »Advent halt. Was soll man sagen?«
Adventszeit. Kurz vor Weihnachten – und das bei einem armen Mann wie Albin, dessen Lebensgefährtin ein Blumengeschäft führte, in dem auch Dekorationen angeboten wurden und die somit an der Quelle für allen möglichen jahreszeitlichen Krimskrams saß, den man im Haus verteilen konnte. Was sie mit Leidenschaft tat. Überall standen Santons herum, kleine Tonfiguren, mit denen man auf den Weihnachtsmärkten in jedem Ort geradewegs totgeworfen wurde.
Veronique besaß Massen davon, teilweise sehr alte Erbstücke aus der Familie. Albin hatte die komplette Inneneinrichtung im Wohnzimmer umwerfen müssen, um Platz für die Krippe zu schaffen, die Veronique für die Figuren aufbauen wollte. Er fand es zwar albern mit diesen Krippen – einen Schafstall direkt neben dem Sofa! –, aber Veronique hatte insistiert, dass die Krippe sein müsse, weil jede Familie, die etwas auf sich hielt, eine habe. Zudem kämen ja an Weihnachten Kinder ins Haus, und damit meinte sie nicht nur Albins Enkelin Clara. Denn zu Weihnachten plante Veronique eine riesige Familienfeier, zu der auch ihre Kinder und deren Kinder kommen würden.
Also dominierte nun eine gewaltige Krippe das Wohnzimmer, und Albin war gezwungen, sich von morgens bis abends den kleinen Jesus anzusehen mitsamt den Heiligen Drei Königen, die der Mutter Maria irgendwelche Gaben brachten.
Der andere Teil vom Wohnzimmer war ebenfalls freigeräumt worden. Dort sollte der Christbaum stehen, den Albin noch besorgen musste. Ihm hätte ja auch einer aus Plastik zum Zusammenstecken gereicht. Aber allein bei der Erwähnung dieser Idee war Veronique wie eine Rakete durch die Decke gegangen und hätte ihm fraglos ihre Freundschaft – und noch mehr – aufgekündigt, wenn Albin nicht schnell eingelenkt und gesagt hätte, dass das nur ein Witz gewesen sei. Tja. Also musste eine verdammte Tanne her.
Abgesehen davon kreisten die Gespräche mit Veronique ausschließlich um Geschenke – was könne man diesem, was jenem schenken, was würde man wohl von wem bekommen, und weswegen dürfte man dann etwas Ähnliches für wen anders nicht kaufen? – und natürlich um das Essen. Es würden etwa zehn Personen kommen, und es würde jede Menge Gänge geben, extra Essen für die Kinder sowie zum Abschluss die traditionellen dreizehn Desserts, mit denen in der Provence jedes Festmahl beendet wurde: Früchte, Nüsse, weißes Nougat, Pralinen, Callisons … Die Confiserien und Supermarktregale quollen in dieser Jahreszeit über. Und nicht nur die. Die Auslagen der Delikatessengeschäfte, der Käseläden und Fleischer und Fischgeschäfte waren randvoll mit Austern, Krebsen, Lammkeulen, Foie gras, Schinken, Fasanen, Wachteln, Wild und vielem mehr. Man konnte meinen, zu Weihnachten hätten die Provenzalen nichts als Essen und Trinken im Kopf – und lag damit vollkommen richtig.
Albin stellte die Tasse wieder ab und blickte Matteo vielsagend an.
»Verstehe«, erwiderte dieser. »Meine Frau ist auch so. Vor allem, seit sie sich mit deiner angefreundet hat. Sie hat den halben Laden leergekauft. Mein ganzes schönes Geld haut sie für diesen Plunder auf den Kopf.«
»Wenigstens fließt dann wieder in meine Tasche, was du mir für dein Gesöff abknöpfst. Am Ende straft Gott eben doch die Betrüger.«
»Zum Glück muss sie gerade eine Zwangspause machen: Sie ist erkältet und liegt flach. Andererseits ein Nachteil, weil ich deswegen zurzeit zu Fuß zur Arbeit muss.«
»Nur, weil sie erkältet ist?«
»Sie kann mich ja nicht fahren.«
»Und dein Auto?«
»Ist in der Werkstatt. Inspektion.« Matteo regte sich auf. »Dauert wegen der Feiertage länger, sagen sie. Stell dir vor: Nee, sagen die dir, wo denken Sie hin? Das schaffen wir doch vor Weihnachten nicht! Und ich sage denen: Ich bin Geschäftsmann! Und die erwidern: Das sind wir doch alle. Vermutlich zögern sie es nur hinaus, weil irgendein Frachter mit Ersatzteilen aus China untergegangen ist. Die legen ihre Kunden doch alle rein: Da fährt man extra französische Autos – und dann pfropfen sie die mit Technik aus Fernost voll!«
»Matteo?«
»Hm?«
»Warum nimmst du nicht den Wagen deiner Frau?«
»Sie fährt auch so eine Reisschüssel wie du. So einen Kia. Ich fahre keinen Kia.«
»Weil er aus Fernost kommt?«
»Ich fahre französische Autos. Fertig.«
»Aber du hast doch gerade eben gesagt, dass die französischen Autos voller Technik aus Fernost …«
»Das ist etwas vollkommen anderes.«
Albin verdrehte die Augen.
»Außerdem«, sagte Matteo und schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Außerdem mag sie es nicht, wenn ich ihren Wagen nehme.«
»Sie verbietet es dir?«
»Sie sagt, dass es sie verrückt macht, wenn im Auto alles verstellt ist – vom Sitz bis zu den Spiegeln. Sie sagt, dass ich selbst schuld bin, wenn ich mein Auto zu dieser Zeit im Jahr zur Inspektion gebe. Außerdem würde es mir nicht schaden, mich mal zu bewegen.«
»Das sind drei sehr gute Gründe, dir das Auto nicht zu geben.«
»Also bitte: Eine Ehefrau, die ihrem Mann das Auto verweigert und ihn mitten im tiefsten Winter auf die Straße jagt!«
»Das macht man halt so mit Straßenkötern wie dir.«
Matteo lachte bitter auf und blickte dann nach draußen, wo es gerade zu regnen aufgehört hatte. »Das Wetter macht einen irre«, sagte er. »Diesen Sommer bist du bei fünfundvierzig Grad verglüht, weil die ganzen Libyer, Algerier und Nigerianer ihr verdammtes Klima aus der Wüste mitgebracht haben. Und diesen Winter erfrierst du und ersäufst im Regen.«
»Sind vermutlich ebenfalls die Algerier dran schuld.«
»Logisch«, sagte Matteo. »Im verdammten Maghreb regnet es ja nicht. Also zaubern sie das mit ihren komischen Geräten herbei.«
»Mit was für Geräten?«
»Sie haben die gesamte Wüste mit Solarzellen vollgebaut und befeuern den Himmel mit Strahlen, um Wolken aufziehen zu lassen. Das versaut das gesamte Weltklima.«
»Wer erzählt denn so einen Blödsinn?«
»Glaub mir«, sagte Matteo verschwörerisch, »da ist mehr im Busch, als wir alle wissen. Und die Regierung hat überall die Finger im Spiel.«
»Du solltest weniger Zeit mit deinen rechten Freunden auf den Parteiabenden zubringen.«
»Tue ich nicht. Keine Zeit für Parteiabende. Aber wir haben Foren. Im Internet.« Matteo zwinkerte.
»Weil bekanntlich alles wahr ist, was im Internet steht«, bemerkte Albin sarkastisch.
»Glaub mir«, Matteo nickte vor sich hin. Er wollte gerade zum Erklären ausholen, als sich die Tür öffnete.
Nicolas Aubery kam mit einer Handvoll Touristen herein, allesamt in leuchtender Outdoor-Kleidung, die man heute »Trekkingoutfit« statt Wandersachen nannte, wie Albin von Aubery gelernt hatte. Er kannte ihn mindestens schon so lange wie Matteo. Aubery war bei der Freiwilligen Feuerwehr und ein ausgesucht guter Tireur beim Petanque. Er hatte früher ein Sportartikel-Fachgeschäft für Wanderbedarf und Mountainbikes geführt. Seit einigen Jahren führte er Touristengruppen den Mont Ventoux und den Luberon hinauf und hinunter, als habe er die Gene einer Bergziege – und wenn er das nicht tat, dann saß er auf dem Fahrrad. Eine Sportskanone, wie sie im Buche stand, und jemand, der Beschäftigung im Ruhestand brauchte, weil er sonst durchdrehen würde, wie er sagte. Genau wie Albin.
Deswegen scheuchte Aubery im Auftrag des Fremdenverkehrsverbandes und des Alpinvereins Touristen durch die Gegend – und wurde dafür auch noch bezahlt, so dass er nach Albins Meinung insgesamt ganz gut zurechtkommen sollte.
Allerdings sah er jetzt schlecht aus. Als habe er drei Tage nicht geschlafen, zu viel getrunken oder sei krank. Die fünf Touristen an seiner Seite wirkten ebenfalls reichlich abgekämpft. Vielleicht auch krank. Eine Virusinfektion? Oder sie waren erledigt vom Wandern und dem verdammten Wetter.
Matteo lupfte eine Braue und hob das Kinn, scannte die Gäste mit dem Blick sowie den Fußboden, der schlagartig nass und schmutzig wurde. Das schien ihm nicht zu gefallen. Die Aussicht auf Umsatz allerdings schon. Er schnappte sich einen Notizblock mit Kugelschreiber und sein Wischtuch, das er im Gehen in der Hintertasche der abgewetzten Jeans verschwinden ließ, bewegte sich um den Tresen herum und ging zu den Touristen, die gerade aus ihren Jacken schlüpften, um auf den Bänken im hinteren Bereich der Bar Platz zu nehmen.
»Leclerc«, sagte Aubery, klopfte Albin kräftig auf die Schulter und beugte sich zu Tyson herab, um dessen Kopf zu kraulen. »Dein Hund verwundert mich immer wieder.«
»Aha?«
»Warum denn ein Mops?«
»Haben mir die Kollegen zur Pensionierung geschenkt. Damit ich was zu tun habe und ihnen nicht mehr auf die Nerven gehe.«
Aubery schmunzelte. »Stimmt, hast du mal erzählt. Die haben sich wohl einen Spaß gemacht. Ausgerechnet ein Mops.«
Ja, dachte Albin, das haben sie. Albin war sehr groß, ein weißhaariger Jean Gabin vom Format eines Kleiderschranks, und der Mops sehr klein.
»Wenigstens«, sagte Aubery, »ist es keiner dieser Handtaschenterrier geworden.«
»Stimmt«, erwiderte Albin. »Du könntest auch einen Hund gebrauchen, so viel, wie du in der Gegend herumläufst.«
»Vielleicht«, antwortete Aubery und zog sich die regennasse Jacke aus, setzte sich neben Albin auf einen Hocker, weil auf den Bänken kein Platz mehr frei war, und rief zur Trekkinggruppe: »Das Café du Midi ist eine Institution in der Stadt. Nirgends gibt es einen besseren Kaffee. Matteo hat goldene Finger.«
Die Touristen nickten, lächelten müde, und Matteo warf Aubery einen mürrischen Blick zu, der sagen wollte: Ich zeig dir gleich meine goldenen Finger!
»Goldfinger. Soso«, murmelte Albin, grinste kurz vor sich hin und fragte dann: »Mistwetter zum Wandern, hm?«
»Allerdings. Wir werden heute einen Indoor-Tag einlegen. Spontan die Bibliothek besichtigen.«
Die Bibliothèque L’Inguimbertine war sehenswert, wie Albin wusste. Er ging selbst oft dorthin. Joseph-Dominique d’Inguimbert hatte sie gegründet, daher der Name. Er war von 1735 bis zu seinem Tod im Jahr 1757 Bischof von Carpentras gewesen. Heute war sie eine Mischung aus Bücherei und Museum, verfügte über Zigtausende Bücher und Handschriften und war in einem alten Krankenhaus untergebracht.
Albin nickte. Er musterte Aubery, betrachtete dann die leise miteinander redenden Touristen sowie Matteo, der schwungvoll mit seinem Notizblock hinter dem Tresen verschwand, um seinen Kaffeeautomaten in Gang zu setzen. Dann blickte er wieder zu Aubery, sah die Augenränder, die blasse Haut.
»Wie geht’s denn sonst so?«, fragte Albin und nippte an der Tasse.
»Ganz gut, danke«, sagte Aubery, wischte sich mit der Hand durchs Gesicht und betrachtete die Innenfläche seiner Hand, die ein wenig feucht war. Reste vom Regen. »Na ja, den Umständen entsprechend.«
»Umstände?«, fragte Albin.
»Hast du noch nichts gehört?«
Albin war alarmiert, gab sich aber Mühe, so gelassen wie möglich zu wirken. »Was sollte ich gehört haben?«
»Du hast doch noch immer Kontakte zur Polizei?«
»Ja.«
»Na, ich rede von der Sache bei La Roque.«
Albin zuckte mit den Achseln und blickte demonstrativ desinteressiert in seinen Kaffee. »Keine Ahnung, was du meinst.«
»Der Leichenfund?«
Albin blickte Aubery fragend an. Dieser erklärte: »Meine Wandergruppe und ich sind gestern vor dem Hagelschauer in die Borie bei La Roque geflüchtet.«
»Ich weiß, wo die ist.«
Und dann erzählte Aubery mit gedämpfter Stimme, was seine Touristen und er dort vorgefunden hatten. Dass die Polizei mit einem Großaufgebot gekommen sei, man Aussagen von allen aufgenommen habe, sogar Schuhabdrücke – und so weiter.
»Ich habe noch nie so etwas Schreckliches gesehen«, sagte Aubery, und damit erklärte sich seine Verfassung sowie die seiner Touristengruppe, die sicherlich in der Hoffnung auf angenehmere Sehenswürdigkeiten in die Provence gekommen war. Eine halbverweste Frauenleiche in einem Brautkleid gehörte gewiss nicht dazu.
Albin leerte den Kaffee. »Gestern war das, sagst du?«
»Ja.«