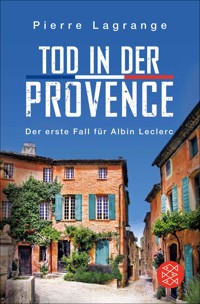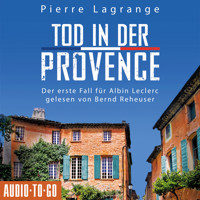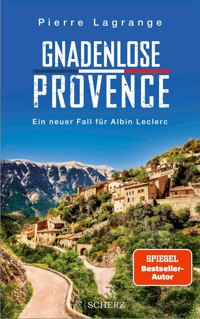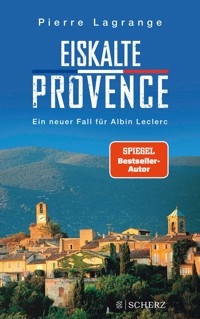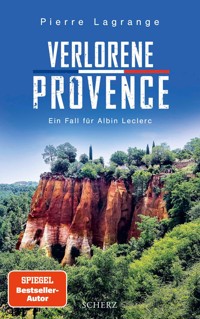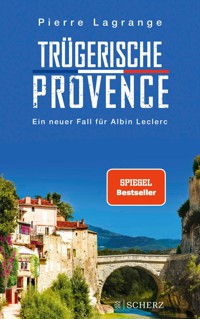
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Ein trügerischer Festspiel-Sommer in der Provence – der siebte Band der Provence-Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Mitten in der Konzertsaison in der Provence verschwinden plötzlich namhafte Musikerinnen. Die Ermittlungskommission unter Leitung von Caterine Castel und Alain Theroux tappt im Dunkeln. Es gibt keine Hinweise oder Forderungen im Zusammenhang mit der Entführung. Obwohl Ex-Commissaire Albin Leclerc mitten in den eigenen Hochzeitsvorbereitungen steckt, kann er es mal wieder nicht lassen: zusammen mit seinem Mops Tyson nimmt er die Spur auf. Als es zu einer weiteren Entführung kommt, und auch die kostbaren Instrumente verschwinden, stellt sich für ihn die Frage, ob in der Provence ein Wahnsinniger unterwegs ist. Die Ermittlungen bringen Albin Leclerc in allergrößte Gefahr ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Pierre Lagrange
Trügerische Provence
Ein neuer Fall für Albin Leclerc
Roman
Über dieses Buch
Festspielsommer in der Provence: In Orange, Aix-en-Provence, Avignon und anderen Städten reiht sich Konzert an Konzert, als plötzlich namhafte Musikerinnen verschwinden. Die Ermittlungskommission unter Leitung von Caterine Castel und Alain Theroux tappt im Dunkeln. Es gibt keine Hinweise oder Forderungen im Zusammenhang mit der Entführung. Obwohl Ex-Commissaire Albin Leclerc mitten in den eigenen Hochzeitsvorbereitungen steckt, kann er es mal wieder nicht lassen: zusammen mit seinem Mops Tyson nimmt er die Spur auf. Als es zu einer weiteren Entführung kommt und auch die kostbaren Instrumente verschwinden, stellt sich für ihn die Frage, ob in der Provence ein Wahnsinniger unterwegs ist, der seine ganz eigene Idee von einem Orchester verfolgt …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Die Bände der Erfolgsserie um den liebenswerten Commissaire Albin Leclerc und seinen Mops Tyson sind im FISCHER Verlag erschienen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
1
Michel Noliot schwitzte wie ein Tier, als er das Messer nahm und zustach. Die Klinge fuhr mitten ins Herz und glitt wie durch Butter in das Fleisch zwischen den Rippen. Ein kurzes Quieken, dann zuckten die Beine und das Augenlicht brach. So schnell ging es. Aus und vorbei.
Trotzdem eine Heidenarbeit bei diesen irrwitzigen Temperaturen. Die Sonne stand hoch und glühte an den Hängen der Nesque-Schlucht. Zwischen Pinien, deren Wurzeln sich wie verdorrte Finger um die grauen Felsen krallten, grobem Buschwerk und wilden Kräutern ging kein einziges Lüftchen. Bis auf das Gluckern des Flusses ungefähr fünfzig Meter tiefer und Noliots Ächzen war es totenstill.
Verdammt, er war nicht mehr der Jüngste, weiß Gott nicht, und auch nicht gerade der Schlankste. Die Haare klebten in Strähnen an seinen Wangen, wo sie eine Allianz mit dem struppigen Bart eingingen. Schließlich zog er das Messer aus dem kleinen Körper und entfernte mit einem Tuch das Blut von der Klinge. Dann nahm er die Baseballkappe mit Tarnmuster ab, fuhr sich mit der flachen Hand über den klatschnassen Schädel und wischte die Finger am Saum seiner olivgrünen Cargohose ab.
Ein Königreich für einen Schluck Wasser, dachte Noliot. Er leckte sich über die trockenen Lippen. Die Feldflasche hatte er im Rucksack, der einige hundert Meter entfernt von hier bei seinen anderen Sachen lag. Na egal, dachte Noliot, er müsste jetzt sowieso dorthin, denn die Beute musste erst mal ausbluten, bevor er weitermachen konnte.
Es war ein stattliches Jungtier, und Noliot hatte verfluchtes Glück gehabt, es zu erwischen. Er war in der Hoffnung durch die Schlucht geschlichen, vielleicht ein paar Hasen zu schießen. Mit einem Wildschwein hatte er ganz und gar nicht gerechnet. Der gar nicht mehr so kleine neugierige Bursche musste sich von der Rotte entfernt haben, um die Gegend zu erkunden – und hatte das Pech gehabt, Noliot vor die Füße zu laufen, der schnell reagieren und einen sauberen Schuss platzieren konnte.
Der Pfeil lag neben der Blutlache, die die Steine dunkel färbte. Noliot hatte ihn eben herausgezogen, bevor er den finalen Stich gesetzt hatte. Die Spitze war rasiermesserscharf und nach wie vor intakt, so dass der Pfeil nochmals verwendet werden konnte. Was gut war, denn diese Pfeile waren sehr teuer und Noliot wirklich kein reicher Mann. Er lebte in einem alten Bruchsteinhaus mit windschiefem Dach, umgeben von Schrott, den er in der Gegend sammelte, auf die Ladefläche seines rostigen Pick-ups lud und für ein paar Euro verkaufte, wenn er einen Abnehmer fand.
Das Essen schoss er sich gelegentlich selbst, was natürlich illegal war. Deswegen verwendete er einen Compoundbogen mit Rollen und einer komplizierten Sehnenstruktur, der sich kinderleicht spannen ließ und absolut geräuschlos war. Er hatte ihn vor einigen Jahren in dem großen Sportartikelmarkt gekauft, wo es alles für die Jagd gab, auch Munition, wenn man welche brauchte. Jagen hatte im Süden des Landes Tradition. Viele Leute hier besaßen ein Gewehr, Noliot natürlich auch. Wenn man wollte, gab es in speziellen Geschäften auch welche zum Leihen. Aber er konnte ja schlecht mit der Schrotflinte herumballern. Das würde sofort auffallen. Zudem war die Schlucht im Sommer voller Touristen, die durch den Fluss wanderten, und Einheimischer, die sich an den Ufern sonnten.
Die Schlucht verlief zwischen dem Mont Ventoux und dem Vaucluse-Hochplateau. Rundherum gab es zwischen Méthamis, Villes-sur-Auzon, Monieux und Sault eine Panoramastraße mit einigen Haltepunkten, von denen aus man spektakuläre Ausblicke ins Tal hatte. Viel befahren war die schmale und an Serpentinen reiche Route allerdings nicht, meistens nur von wandernden Touristen, Radlern oder Motorradfahrern, weil man mit Lastwagen sowieso nicht durch die engen Tunnel passte und es in der Gegend auch nichts zu beliefern gab. Am Anfang war die Gorges de la Nesque kaum als Schlucht wahrzunehmen, und auf dem Weg dorthin konnte man sich kaum vorstellen, dass das Rinnsal entlang der D5 wenige Kilometer weiter einen atemberaubenden, bis zu vierhundert Meter tiefen Canyon in den Fels gefressen hatte.
Wenn man bei Méthamis stoppte, sah man nur den türkisfarbenen Fluss, hellen Kalksandstein und dichten, sattgrünen Wald. Je tiefer man jedoch in die Schlucht vordrang, desto schroffer, höher, karger und einsamer wurde sie. Doch selbst hier würde man einen Schuss noch in einigen Kilometern Entfernung hören können, wenn er zwischen den Felswänden widerhallte. Also besser den Bogen nehmen, der auf kurze Distanz sogar präziser als ein Gewehr war.
Noliot fasste sich ins Kreuz, stöhnte, weil die Kletterei ihm wegen seiner Bandscheibe zu schaffen machte, und steckte das Messer zurück in die Scheide. Er blickte auf das junge Wildschwein und stöhnte innerlich bei dem Gedanken daran, das sicherlich zwanzig Kilo schwere Exemplar bergauf bis zum Auto schleppen zu müssen, wo der Pick-up versteckt im Schatten von Pinien am Rande eines Wirtschaftsweges geparkt war. Der Gedanke an eine gut gefüllte Gefriertruhe wiederum ließ Noliot mit einem Lächeln aufatmen.
Er rollte den Kopf im Nacken, fuhr sich nochmals mit der Hand über den feuchten Schädel und blinzelte in die Sonne. Am Himmel drehten schon zwei Krähen die Runde, die wohl bereits das Blut witterten. Mit dem Blick folgte er ihrem Flug – und stockte, als er auf der anderen Seite der Schlucht hoch oben auf einem Felsplateau etwas aufblitzen sah.
Das mussten die Reflexionen im Glas einer Windschutzscheibe sein. Hielt da jemand an einem Aussichtspunkt, der nur einige hundert Meter von seinem Standort entfernt war? Nein, soweit Noliot die Geographie im Kopf hatte, gab es dort drüben keinen. Mist, dachte Noliot, waren das dann womöglich Gendarmen, Wildhüter oder Förster? Ganz schlecht, wenn die ihn sehen würden.
Rasch hockte er sich hinter einen duftenden Rosmarinbusch, fasste in die Seitentasche seiner Cargohose und zog das kleine Fernglas heraus. Er nahm es hoch, richtete es auf die betreffende Stelle und fokussierte mit dem kleinen Rädchen zwischen den Okularen. Nein, dachte er, das waren weder Wildhüter, Förster noch Gendarmen. Und das Auto, in dessen Windschutzscheibe sich das Licht der Sonne brach, war ein ziviles. Silberfarben, ein SUV. Da war auch ein kleiner Hund zu sehen. War das vielleicht ein Mops? Er hüpfte wie von der Tarantel gestochen im Wagen auf und ab und schien sich von innen regelrecht gegen das Fenster zu werfen. Außerdem sah Noliot zwei Personen.
Vor dem Wagen und mit dem Rücken zur Schlucht stand ein Mann, der im Verhältnis zu dem anderen direkt vor ihm sehr groß wirkte und älteren Semesters zu sein schien, denn er hatte fast schlohweiße Haare. Noliot stockte kurz, als er am Arm des Mannes eine signalrote Armbinde erkannte. Er wusste, dass solche manchmal von der Polizei im Einsatz getragen wurden. Aber das viel größere Problem war etwas ganz anderes. Denn der etwas kleinere Mann hielt dem größeren eine Schrotflinte vors Gesicht. Die beiden schienen miteinander zu reden, aber der Ernst der Lage war vollkommen klar.
Noliot schluckte trocken. Er musste sich entscheiden. Tatenlos zusehen. Weglaufen. Einschreiten. Letzteres war von hier aus kaum möglich. Den Standort der beiden würde er niemals schnell genug erreichen. Einen Pfeil abzuschießen kam auch nicht in Frage, das war die blödeste aller Möglichkeiten. Warum sollte er sich überhaupt da einmischen? Besser nicht, das war viel zu gefährlich. Trotzdem konnte er die Situation nicht ignorieren. Nein, er musste Hilfe holen, unbedingt. Allerdings hatte er sein Handy nicht hier. Es war im Rucksack, der einige hundert Meter entfernt im Gras lag, was nicht viel war. Dennoch würde er bis dahin und bergauf ein paar Minuten brauchen.
Noliot nahm das Fernglas wieder runter und lief los. Er zwängte sich durch das Gestrüpp, stolperte über Felsen und fiel fast hin, rappelte sich wieder auf und erreichte schließlich die Stelle, wo er den Bogen und die anderen Sachen abgelegt hatte. Hektisch öffnete er den Rucksack, durchwühlte ihn nach dem Handy und fand es – ein uraltes Gerät von Nokia, das seinen Dienst noch nie versagt hatte. Allerdings zeigte es nur einen Balken für den Empfang an, kein Wunder hier in der Schlucht, und die Batterie war fast leer.
Noliot wählte gerade den Notruf, als ein Schuss krachte, dessen Echo durch die Schlucht hallte. Er zuckte heftig zusammen, riss die Augen auf und blickte sich um. Am anderen Ende der Leitung hörte er die zerhackte Stimme der Polizeizentrale.
»… endarmerie … Was … ehm … elfen…«
»Noliot hier! Ich bin in der Nesque-Schlucht! Hier geschieht ein Mord!«
»…was … icht … erstehen … erholen?«
»Mord! In der Nesque-Schlucht!«
»…ich … at … ucht? … o … in … Sie?«
Das hatte keinen Zweck. Noliot drückte das Gespräch weg. Er nahm das Fernglas wieder hoch – aber von hier aus war es unmöglich zu sehen, was da los war. Jede Menge Bäume und ein großer Felsen versperrten die Sicht.
Also lief Noliot los, das Handy immer noch in der Hand, zurück zum vorherigen Standort, wo er fast im Blut des Wildschweins ausrutschte. Durch das Fernglas suchte er das Terrain ab. Doch er sah nichts. Nur Landschaft. Kein Lichtreflex, kein Auto, kein Hund, keine Männer. Gar nichts. Allesamt waren verschwunden.
Verflucht, dachte Noliot, wie war das möglich? Hatte er sich das alles nur eingebildet? Nein, das konnte nicht sein. Der Schuss war mehr als deutlich zu vernehmen gewesen. Innerhalb von nur wenigen Minuten, die er das Fernglas nicht zur Hand gehabt hatte, waren die Männer und das Auto fort, und …
Und es lag vielleicht eine Leiche in der Nesque-Schlucht.
Kein Zweifel, der Kerl mit der Schrotflinte hatte abgedrückt. Der Körper des großen weißhaarigen Mannes mit der Polizeibinde war in die Schlucht gestürzt, sein Mörder mit dem silbernen SUV geflohen.
Noliot kaute auf der Unterlippe herum. Starrte das Handy in seiner Hand an. Es kam kein Rückruf von der Polizei, die Zentrale hatte wohl sowieso kein Wort verstanden. Er schob das Handy in die Seitentasche der Cargohose, suchte mit dem Fernglas noch einmal das Terrain ab. Doch ihm fiel nichts weiter auf. Er überlegte, ob er ins Tal einsteigen sollte, um an dem Abhang des anderen Ufers nach dem Toten zu suchen. Doch er entschied sich dagegen. Besser, er mischte sich nicht ein und hielt die Klappe. Alles andere würde ihn nur in Schwierigkeiten bringen. Die Polizei würde ihn zu Hause aufsuchen, und er müsste erklären, was er in der Schlucht an dieser Stelle gesucht habe. Dann würde man womöglich ein zerlegtes Wildschwein in seiner Gefriertruhe finden sowie im Haus einige andere Sachen, die sich Noliot nicht vollständig legal besorgt hatte.
Nein, dem Risiko sollte er sich besser nicht aussetzen. Wenn die Polizei einen ihrer Leute vermisste, dann würde sie schon nach ihm suchen.
Außerdem: Wer sagte denn, dass da drüben wirklich etwas Schlimmes passiert war? Vielleicht waren die beiden ja zusammen ins Auto gestiegen und weggefahren, und der Schuss … Ja, der ging vielleicht bloß in die Luft. War ein Warnschuss. Falls überhaupt. Eventuell waren die beiden nur hergekommen, um ein Gewehr zu testen, und Noliot hatte sich geirrt, die Perspektive ihm einen Streich gespielt, und der andere hatte gar nicht auf den älteren Mann gezielt, sondern es hatte nur so ausgesehen als ob.
Ja. Vermutlich war es so gewesen, dachte Noliot. Er hatte sich das nur eingeredet, ganz bestimmt, und er sollte deswegen besser nicht alle Welt verrückt machen und sich gleichzeitig Probleme an den Hals laden. Nein, er sollte sich besser um seine eigenen Angelegenheiten kümmern.
Abgesehen davon hatte er sowieso ganz andere Sorgen, nämlich dieses Wildschwein zum Auto schleppen, ohne einen Herzkasper oder Kreislaufkollaps zu bekommen. Aber es half ja nichts, dachte Noliot. Er packte das tote Tier am Hinterlauf – und machte sich an die Arbeit.
2
Einige Tage zuvor
Das ganze kulturelle Paris fiel im Sommer im Midi ein, um dort in den Ferien oder an einem verlängerten Wochenende den alljährlichen Festivalreigen zu genießen. Und nicht nur die Pariser Kulturgurus, o nein. Die Musik- und Theaterbegeisterten kamen aus aller Herren Länder. Zigtausende strömten alljährlich wie die Lemminge in die Provence, um sich die zahllosen Aufführungen mit Stars und Sternchen und aufstrebenden jungen Musikern, Orchestern, Ensembles und Dirigenten anzusehen.
Zur Festivalsaison verwandelte sich der komplette Landstrich in eine einzige große Bühne. Überall gab es Konzerte, Theater- und Opernaufführungen unter freiem Himmel oder in historischen Bauwerken. Man mochte Straßentheater oder modernen Tanz? Kein Problem. Man konnte es quasi rund um die Uhr auf einem der vielen Plätze genießen und unter Arkaden mit einem Pastis oder Rosé sitzen, während der Abendhimmel die Farbe von Lavendel annahm.
Wenn man die Oper bevorzugte, bekam man im Théâtre Antique d’Orange die prunkvollsten Inszenierungen vor römisch-antiker Kulisse geboten, vor allem im Rahmen der großen Festspiele Chorégis d’Orange.
Oder doch lieber kleine, feine Kammerkonzerte? Nur zu. Sie waren quasi an jeder Straßenecke, auf Marktplätzen oder in Klöstern zu erleben – zugegeben: in unterschiedlicher Qualität.
Schon im Frühjahr ging es los mit dem Festival de Pâques d’Aix-en-Provence, dem später das Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence als eines der großen europäischen Musikfestspiele auf dem Fuß folgte. Die Konzerte und Aufführungen verteilten sich über die gesamte Stadt, wobei der ehemalige Bischofspalast und die Kathedrale Saint-Sauveur den Kern bildeten. In Arles gab es das Les Suds, à Arles, das alle Plätze der Stadt in Beschlag nahm, inklusive des antiken Theaters. Römische Bauwerke bildeten auch beim Festival de Nîmes zugleich Bühne und atemberaubende Kulisse.
Auch beim Festival d’Avignon war viel zu erleben. Wenngleich der Schwerpunkt hier eher auf Theater und Tanz lag, gab es auch eine Menge Konzerte, die zum Beispiel im Hof des Papstpalastes, aber auch an anderen spektakulären Plätzen der Stadt stattfanden. Zudem schlossen sich regelmäßig andere Orte und Gemeinden wie Villeneuve-lès-Avignon, Boulbon, Vedène, Montfavet, Le Pontet oder Cavaillon mit eigenen Programmen an die Festspiele an. Schließlich gab es noch das feine Luberon International String Quartet Festival mit verschiedenen Schauplätzen, zum Beispiel in Goult, Roussillon, L’Isle-sur-la-Sorgue, Cabrières d’Avignon oder Fontaine-de-Vaucluse.
Genau dort sollte an diesem Abend das renommierte Quatuor Balzac vor der Kirche Saint Véran auftreten. Das Gotteshaus stammte aus dem 11. Jahrhundert und war an der Stelle eines karolingischen Gebäudes mit dem Grab des Heiligen Véran aus dem 6. Jahrhundert errichtet worden. Noch früher hatte sich an dieser Stelle ein Wasserheiligtum befunden, was kein Wunder war, denn in dem Dorf entsprang die Sorgue aus einem Felsmassiv. Die Quelle lag in einer sehr tiefen Höhle und wurde schon in römischer Zeit verehrt. Wie bedeutend die Sorgue für die ganze Region war, sah man schon daran, dass das gesamte Département Vaucluse nach der Gemeinde benannt war, in der sie entsprang.
Auf dem Kirchplatz war an diesem Abend für das Konzert eine kleine, von mittelhohen Boxentürmen flankierte Bühne aufgebaut worden, auf der sich bereits vier Stühle, Notenständer und vier Mikrophone befanden. Es gab eine mobile Umzäunung. Vor der Bühne standen mehrere Reihen von Stühlen in Reih und Glied, auf denen bald die Konzertgäste Platz nehmen würden. Sogar die Avenue Robert Garcin war gesperrt worden, und zwar schon ab dem Kreisverkehr, in dessen Mitte zu Ehren von Francesco Petrarca eine Säule aufgestellt worden war: Der 1304 in Arezzo geborene Dichterfürst, der neben Dante Alighieri und Giovanni Boccaccio zu den wichtigsten Vertretern der frühen italienischen Literatur gehörte und sich vor allem durch seine Liebeslyrik auszeichnete, hatte in der Nähe zur Quelle einen großen Teil seiner Gedichte geschrieben. Er war in den Ort gezogen, in dem auch sein bester Freund lebte, der Bischof von Cavaillon Philippe de Cabassoles, dem damals das Château gehörte, das heute als Ruine pittoresk auf einem Felsen über Fontaine-de-Vaucluse thront.
Etwas abseits des Kirchplatzes befanden sich unter den Platanen einige Stände, an denen man Champagner, Wein und kühle Erfrischungsgetränke sowie kleine Snacks bekommen konnte. Die Theken waren von festlich gekleideten Konzertgästen regelrecht umlagert. Getuschel, Lachen und das Klingen von Gläsern erfüllten den Hof, dessen Steinboden noch die Wärme des Tages abstrahlte. Bald würde die Sonne untergehen und die an allen Seiten des Kirchplatzes aufgestellten Scheinwerfer eingeschaltet werden.
Am Rande des Geschehens stand ein großer, weißhaariger Mann unter einer mächtigen Platane. Er trug einen schwarzen Anzug, dazu ein hellblaues Hemd und eine Krawatte, die ihm etwas zu fest am Hals saß, und hatte sich eine Zigarette in den Mundwinkel geklemmt. Er suchte nach einer Möglichkeit, sich die Gitanes anzuzünden, um vor Konzertbeginn noch schnell eine zu rauchen. Aber wegen der zwei randvollen Gläser mit eiskaltem Champagner in seinen Händen war das nicht gerade einfach, eigentlich sogar unmöglich. Bevor es ein Unglück geben würde, erlöste ihn die deutlich kleinere Frau vor ihm. Sie trug ein elegantes schwarzes Kleid, ein Tuch über den Schultern, hochhackige Schuhe und würde in jedem Fall für Mitte fünfzig durchgehen, obwohl sie bereits über sechzig war. Wortlos schlang sie sich die Leine um das Handgelenk, an deren anderem Ende sich ein Mops befand, der das Treiben nachdenklich betrachtete, und nahm dem Mann die Gläser aus der Hand.
Veronique rollte mit den Augen und sagte: »Albin. Muss das jetzt sein mit der Zigarette?«
Albin nickte, zog das Feuerzeug aus der Hosentasche und steckte die Gitanes an. Er stieß den Rauch durch die Nasenlöcher aus und sagte: »Unbedingt«, bevor er seiner Verlobten eines der Gläser wieder aus der Hand nahm, um mit ihr anzustoßen.
Seine Verlobte.
Teufel auch, dachte Albin, wer hätte gedacht, dass es jemals dazu kommen würde? Der pensionierte Kommissar und die hübsche Blumenhändlerin mit der Audrey-Hepburn-Sonnenbrille in Kürze nicht nur ein Paar, sondern auch Eheleute. Verrückte Welt.
Heiligabend hatte Albin ihr im Beisein der ganzen Familie den Heiratsantrag gemacht, und er fühlte sich als echter Glückspilz, dass Veronique ihn angenommen hatte. Seit der Ring an ihrem Finger steckte, war sie wie ausgewechselt und noch lebhafter als zuvor, was sich zuspitzte, je näher der Termin in der kleinen Kirche in Venasque rückte. Nun stand er in wenigen Tagen bevor, und die Vorbereitungen hatten Veronique so sehr in Beschlag genommen, dass Albin die Notbremse gezogen hatte, um sie auf andere Gedanken zu bringen. Zum Beispiel mit einem Konzert zum Entspannen und Runterkommen. Ein eleganter Abend, der die Routine und den Stress unterbrach. Ein Konzert mit dem weltberühmten Quatuor Balzac, dessen Namen Albin noch nie zuvor gehört hatte.
Nicht, dass sich Albin etwas aus Musik machte, vor allem nicht aus klassischer. In der Hinsicht war er ein regelrechter Kulturbanause, was viele Jahre auch für die Ernährung gegolten hatte. In seiner aktiven Zeit bei der Polizei in Carpentras hatte er sich fast ausschließlich von Mikrowellen- und Dosengerichten sowie Fastfood ernährt, bis er schließlich in den Ruhestand und Veronique in sein Leben getreten war und seine Essgewohnheiten gründlich verändert hatte. Musik war für ihn eigentlich nicht mehr als hübsches Beiwerk, pure Unterhaltung. Aber Victor Picard von der in Fontaine-de-Vaucluse ansässigen Internationalen Petrarca-Gesellschaft, die das Konzert veranstaltete, war der Auffassung, dass sich Albins Meinung mit dem Auftritt des Quatuor Balzac deutlich ändern dürfte. Picard hatte Albin die Karten für heute Abend organisiert. Er und Albin kannten sich von einem Fall, den Albin zu seiner aktiven Zeit nicht mehr hatte lösen können – eine Mordserie an mehreren rothaarigen Frauen –, sehr wohl aber danach im Ruhestand.
Picard stand gerade in einer Traube von Menschen und löste sich aus ihr, weil ein Tontechniker etwas mit ihm zu besprechen hatte, das Picard nach wenigen Augenblicken besorgt und noch etwas mehr wie einen alten Geier aussehen ließ. Vermutlich, nahm Albin an, war das die allgemeine Aufregung vor dem Konzert mit einer so renommierten Truppe. Schließlich ging der Techniker zurück zum Mischpult, und Picard winkte Albin grüßend zu, bevor er herüberkam und sich Veronique mit einem angedeuteten Diener vorstellte. Alte Schule, da konnte man sagen, was man wollte. Picard wirkte nervös, aufgeregt. Seine mit Altersflecken bedeckte Hand war feucht und kalt, als er Albins schüttelte.
»Wie schön, Monsieur Leclerc«, sagte er, »dass Sie und die Frau Gemahlin es einrichten konnten, meiner Einladung zu folgen.«
»Baldige Frau Gemahlin«, sagte Albin.
Veronique lachte, nickte und erklärte: »In wenigen Tagen heiraten wir.«
»Oh, wie entzückend, meine herzlichen Glückwünsche«, erwiderte Picard. »Ja, die Liebe, nicht wahr? Wie wunderbar und ganz im Geiste unseres Mottos heute Abend. Une soirée d’amour. Unser Patron hat zahllose unsterbliche Liebesgedichte geschrieben, die Oden an seine Muse Laura de Noves, die er in der Kirche in Avignon gesehen hat und ihr in unerwiderter, heimlicher Liebe verfiel, denn sie war ja die Gattin des Grafen Hugues de Sade.«
Veronique seufzte selig und lächelte. Albin und Picard wechselten einen Blick. Laura de Noves. Bis vor einigen Jahren hatte Albin keinen Schimmer gehabt, wer das war, genauso wenig wie Francesco Petrarca. Aber das hatte sich in jenem Sommer, als eine weitere Rothaarige in der Provence ermordet aufgefunden worden war, auf dramatische Weise verändert.
»Übertriebene Liebe«, sagte Albin, »kann schon mal im Wahnsinn enden.«
Picard zog ein Taschentuch mit Monogramm aus der Sakkotasche und tupfte sich die Stirn und die Hakennase ab. »Zu viel des Guten ist uns niemals zuträglich.«
Albin nickte und schlürfte am Champagner, bis das Glas leer war. »Geht es denn gleich los?«, fragte er.
Picard ließ das Taschentuch wieder verschwinden. »Wir beginnen etwas verspätet. Wir warten noch auf die zweite Violinistin.«
»Stars lassen gerne auf sich warten«, sagte Veronique, leerte ihr Glas ebenfalls und gab es Albin, der es sich zusammen mit seinem in die linke Hand klemmte und die rechte weiter zum Rauchen nutzte.
Ein Star war diese Kim Ju Lyn wohl in der Tat, wenn man dem Programm glauben konnte. Albin hatte Veronique vorhin im Auto von der außerordentlichen Klasse des international besetzten Quartetts vorgeschwärmt, das schon in Königshäusern und sämtlichen großen Konzertsälen der Welt gespielt hatte. Die französisch-koreanische Violinistin trat zudem als Solistin auf. Veronique hatte Albin den Musikkenner abgekauft, obwohl er nur den Inhalt des Programmflyers wiedergab.
»Ich dachte immer«, sagte Albin und zog an der Gitanes, »Petrarca sei ein Dichter gewesen.«
Picard lächelte und blickte zur Bühne. Drei Musiker standen wartend dahinter. Sie hatten ihre Instrumente dabei und schienen sich mit einem der Techniker zu beratschlagen. Ein weiterer telefonierte, schien aber niemanden zu erreichen und sich darüber aufzuregen.
»Oh«, sagte Picard, »Petrarca hatte einen großen Einfluss auf die Musik. Seine Sonette lieferten zahlreiche Vorlagen, und das nicht nur im 16. Jahrhundert. Claudio Monteverdi schrieb vier Petrarca-Madrigale, Franz Schubert drei Sonette, Franz Liszt und viele andere ebenfalls. Auch Arnold Schönberg hat welche vertont. Natürlich sind das alles Lieder – die Texte wollen ja gehört werden. Dennoch widmen wir den heutigen Abend Petrarca, und wir haben das Glück, dass das Quartett ein Programm mit Werken der Komponisten zusammengestellt hat, die sich seiner angenommen haben. Zudem ist es ja offensichtlich an Literatur orientiert, da es sich nach Honoré de Balzac benannt hat, nicht wahr?«
»Absolut«, sagte Albin und beugte sich nach unten, um die Zigarette auf dem Boden auszudrücken. Er warf Tyson einen Blick zu, der an Albin vorbei zur Bühne schaute.
»Verzeihung«, sagte Picard, nickte Veronique und Albin zu und deutete in Richtung der debattierenden Musiker, »ich glaube, ich sollte einmal nach dem Rechten sehen.«
»Natürlich«, erwiderte Albin.
Im nächsten Moment verschwand Picard.
»Ein reizender und sehr höflicher Mann«, sagte Veronique.
»Das ist er. Ein großer Freund der Literatur.«
»Dich habe ich noch nie mit einem Buch in der Hand gesehen.«
»Weil ich alle wichtigen Bücher schon gelesen habe«, erwiderte Albin. »Noch einen Champagner?«
Veronique lachte und verdrehte die Augen. »Gern«, sagte sie, »solange wir noch auf den Beginn des Konzerts warten müssen. Aber nur noch einen. Sonst bin ich betrunken.«
Albin schmunzelte. »Und willenlos?«
Veronique versuchte, nach Albin zu hauen. »Jetzt geh schon, du schmutziger alter Mann.«
Albin grinste. Tyson blickte zu ihm hoch und schien ebenfalls zu grinsen.
Schmutziger alter Mann. Wo sie recht hat, hat sie recht, schien Tyson zu sagen.
»Mein Lieber«, dachte Albin, »du da unten halt den Ball mal ganz flach.«
Wer? Ich?
»Ich sage nur: Mopsfrau. Mila. Ukraine.«
Tyson blickte wieder zur Seite. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest, Chef.
Schließlich setzte sich Albin in Bewegung, ging im Slalom durch die Stuhlreihen und wich einigen kleinen Grüppchen von wartenden Konzertbesuchern aus, bis er zur improvisierten Theke gelangte, die von einem örtlichen Wirt betrieben wurde. Das Personal war komplett in Schwarz gekleidet und trug lange weiße Schürzen. Die Champagnerflaschen ruhten in großen, silbernen Kübeln voller Eis, die einen allein vom Hinschauen erfrischten. Direkt vor Albin stand ein hagerer Kerl mit rasiertem Schädel, der sich unwirsch umdrehte und mit seinem Orangensaftglas vor Albins Brust stieß. Etwas schwappte über.
»Passen Sie doch auf!«, keuchte der Typ, der etwas kleiner war als Albin. Was nicht schwer war, denn Albin hatte das Format eines Kleiderschranks.
»Ich?«, fragte Albin und untersuchte seine Krawatte. Sie war nach wie vor in tadellosem Zustand. Glück gehabt.
Der jüngere Kerl richtete sich seine Nerdbrille, funkelte Albin an und schlürfte etwas von dem übergelaufenen Saft von seiner Hand ab. Er gab ein genervtes Schnauben von sich und drängte an Albin vorbei. Wenigstens war jetzt ein Platz am Tresen frei.
»Da hätten Sie fast großen Schaden angerichtet, Leclerc, und ein aufstrebendes Talent über den Haufen gerannt«, hörte er eine schnarrende Stimme neben sich. Der Tonfall war sarkastisch.
Albin wendete sich dem Mann zu. Eric Bouyer glich einem schlanken Pavarotti, der die Freude am Leben verloren hatte. Seine Haut war fahl und wirkte teigig. Er war unrasiert, und die grauen Haare standen ihm wirr vom Kopf ab. Sie hatten so dringend einen Schnitt nötig wie sein Anzug ein Bügeleisen. Er hielt einen Zigarillo zwischen den Fingern und betrachtete Albin mit einem Blick, an dem schwer abzulesen war, ob er nun erfreut oder nicht erfreut war, Albin hier zu entdecken. Er schenkte ihm dennoch ein joviales Lächeln und hob sein Glas zum Gruß.
Albin sagte: »Vielmehr hätte der Bursche um ein Haar Schaden an meiner neuen Krawatte und meinem neuen Hemd angerichtet. Beides war nicht gerade preiswert.«
Bouyer schmunzelte und deutete mit der Stirn in die Richtung, in die der Hagere verschwunden war. »Das war Cédric Guerin, ein junger Nachwuchskomponist, der sich für hoffnungsvoll und talentiert hält. Er fehlt zurzeit auf keinem Festival, um auf sich aufmerksam zu machen.«
»PR ist sicher wichtig«, erwiderte Albin und bestellte zwei Champagner.
»Vor allem«, meinte Bouyer, »wenn man der Einzige ist, der von den eigenen Talenten überzeugt ist.«
Albin grinste. »Verstehe.«
Eric Bouyer war ein Insider der Szene, wie Albin wusste. Er war Ruheständler wie Albin, ein früherer Tierarzt, Kulturpolitiker und langjähriges Aufsichtsratsmitglied im Vorstand des Orchestre National Avignon-Provence. Albin kannte ihn von einem einige Jahre zurückliegenden Fall, in dem es um Einbrüche in seiner Praxis und seiner Wohnung ging.
»Mit Ihnen«, sagte Bouyer, »hätte ich bei einem solchen Konzert nicht gerechnet. Normalerweise trifft man fast immer die gleiche Klientel.«
»Ich dachte, es ist eine schöne Abwechslung für meine zukünftige Frau.«
»Gratulation.«
»Danke. Picard hat mir die Karten besorgt.«
»Eine treffsichere Auswahl. Falls das Konzert denn heute überhaupt noch stattfindet.«
»Warum?«
Bouyer deutete in Richtung Bühne, wo sich Picard aufgeregt mit dem Techniker und den Musikern unterhielt. »Es scheint Probleme zu geben.«
»Man wartet wohl auf eine Violinistin aus Korea, die sich verspätet. Kim …«
»Kim Ju Lyn?«
»Genau die.«
»Ohne die können sie in der Tat schlecht spielen«, sagte Bouyer.
»Wie geht’s sonst so?«, fragte Albin und bezahlte.
Bouyer zuckte mit den Schultern. »Man schlägt sich so durch. Seit Lorraines Tod mache ich nicht mehr viel.«
»Oh«, machte Albin und nahm die Gläser. »Ihre Frau ist tot? Das tut mir leid.« Lorraine Bouyer hatte Albin als attraktive und lebenslustige Frau kennengelernt. Sie hatte ein Instrument im Orchester gespielt – war es Geige? Cello? – und hatte Privatunterricht gegeben.
»Krebs«, erklärte Bouyer.
»Wann?«
»Vor einem Jahr ist sie gestorben. Es hat sich lange hingezogen. Um bei ihr zu sein und sie zu begleiten, habe ich die Praxis aufgegeben und mich aus allen Ämtern zurückgezogen. Daher habe ich im Moment nicht mehr viel zu tun.«
»Tut mir sehr leid, das zu hören«, sagte Albin. »Es ist sicher wichtig, etwas zu machen, sich abzulenken.«
»Die Musik hält mich aufrecht.«
»Ein Hund kann helfen. Meine Kollegen haben mir einen zum Ruhestand geschenkt.«
Bouyer lächelte matt und nickte. »Ihr Champagner«, sagte er, »wird warm.«
Albin lächelte ebenfalls. »Einen schönen Abend noch, Bouyer.«
»Ihnen auch.«
Albin setzte sich wieder in Bewegung, ging zurück durch die immer unruhiger werdenden Gäste, die alle mitbekamen, dass hinter der Bühne Aufregung herrschte. Dort unterhielt sich Picard immer noch mit dem Techniker und den Musikern – und ging schließlich mit einem Quartettmitglied und dem Techniker die abgesperrte Straße entlang in Richtung Kreisverkehr.
»Was ist denn da los?«, fragte Veronique, als Albin wieder vor ihr stand, um ihr das Champagnerglas zu überreichen.
Albin zuckte mit den Schultern. »Wie Picard schon gesagt hat: Es scheint offensichtlich Probleme mit der koreanischen Violinistin zu geben.«
»Sie hat doch wohl kein Lampenfieber?«
»Wer weiß«, sagte Albin und stieß mit Veronique an. »Kann ich mir aber nicht vorstellen.«
»Fällt das Konzert denn jetzt aus?«
Albin schlürfte etwas Champagner und zuckte nochmals mit den Schultern.
»Und wohin gehen die nun?« Veronique sah besorgt aus. »Ihr ist doch hoffentlich nichts passiert?«
»Veronique …«
»Ob sie einen Unfall gehabt hat?«
»Liebste …«
»Vielleicht hat sie ja doch Lampenfieber bekommen. Wo sind denn die Musiker untergebracht?«
Albin seufzte.
»In einem Hotel? Hier im Ort? Das wäre ja am wahrscheinlichsten, nicht?«
»Madame Leclerc.«
Veronique drehte sich zu Albin. »Hm?«
»Ich weiß es nicht. Ich habe auf keine deiner Fragen eine Antwort.«
Veronique blickte Albin irritiert an. »Woher solltest du das auch wissen. Ich meine ja nur.«
»Prost«, sagte Albin und stieß nochmals mit Veronique an.
Sie lächelte. »Du hast mich gerade Madame Leclerc genannt.«
»Daran wirst du dich gewöhnen müssen.«
»Ja. Es klingt so ungewohnt. Aber schön.«
»Finde ich auch.«
»Wir müssen übrigens dringend ein paar Dinge umorganisieren. Ich würde gern noch ein paar Veränderungen in der Sitzordnung vornehmen. Ich möchte, dass Manon zusammen mit Charlotte und Nicole und Caterine sitzt, gegenüber dann jeweils Antoine, Paul, Jean und Alain sowie selbstverständlich Matteo und Iris. Clara dann am Kindertisch natürlich, das ist ja klar.«
Manon war Albins Tochter, die mitsamt Albins Enkelin Clara aus Paris vor ihrem psychopathischen Mann geflohen war und nun in der Provence bei Albin lebte. Sie steckte mitten in der Scheidung. Charlotte und Nicole waren Veroniques Töchter, die jeweils auch Kinder hatten. Antoine und Paul hießen ihre Männer. Matteo war Albins Kumpel, der Wirt vom Café du Midi, nebst seiner Frau Iris. Die anderen Erwähnten waren die frischgebackenen Capitaines de Police Alain Theroux und Caterine Castel, die alle nur Cat nannten, mit ihrem Lebensgefährten Jean Villeneuve. Dass Theroux’ Frau kommen würde, war eher unwahrscheinlich: Sie stand kurz vor der Geburt. So oder so sollte mit den ganzen Namen und Personen noch einer zurechtkommen. Albin hatte längst den Überblick verloren, obwohl es ja eigentlich eine sehr überschaubare Zahl an Hochzeitsgästen war.
Veronique hatte die Sitzordnung bereits einige Male umgeworfen. Denn sie wollte nicht, dass Manon, die ohne Partner war, sich irgendwie als nicht dazugehörend fühlen würde, weil Veroniques Kinder und Enkelkinder zahlenmäßig die Oberhand hatten. Albin fand das nicht so wichtig, und er nahm an, dass es Manon ebenfalls gleichgültig wäre. Aber für Veronique spielten die Gewichtung am Tisch, die richtige Balance und Harmonie eine entscheidende Rolle.
Albin beugte sich vor, um Veronique zu küssen und ihren Redeschwall zu stoppen. »Es ist verboten«, sagte er, »heute über derlei Dinge zu reden.«
»Ich weiß«, seufzte Veronique.
Albin lachte. Seine Zukünftige war eine Perfektionistin. Darüber hinaus führte sie ein Blumengeschäft, in dem sie auch stilvolle Dekorationsartikel anbot. Die perfekte Kombination für einen Overkill an Ausstattung ihrer eigenen Hochzeitsfeier. Er hob den Blick und sah Picard, der gerade mit großen Schritten zielstrebig auf Albin zumarschierte und atemlos vor ihm stehen blieb. Er schwitzte, und die Farbe war aus seinem Gesicht gewichen.
»Es … tut mir sehr leid. Madame. Monsieur le Commissaire, kann ich …«
Albin machte eine beschwichtigende Geste. »Excommissaire«, sagte er. »Polizeilicher Berater im Ruhestand. Immer ganz ruhig, Picard. Was ist denn passiert?«
Picards Mund öffnete und schloss sich wie bei einem Fisch auf dem Trocknen. Aus seinen Augen sprach das pure Entsetzen.
»Es ist grauenvoll«, sagte Picard leise. »Einfach … grauenvoll.«
3
Marseille – Stadt der Träume und des Verbrechens, Fischerort und pulsierende Metropole zwischen Armut und Glamour, Tradition und Moderne. Eine Stadt voller Moscheen und Kirchen, errichtet auf griechischen Ruinen, Tor zu Afrika und der Welt, Kloake und Juwel.
Von dem leicht erhöhten Standpunkt aus lag ihr die Stadt regelrecht zu Füßen. Das Pulsieren war bis hierher zu spüren.
Castel fummelte den Autoschlüssel aus der engen Jeans, zu der sie ein olivfarbenes Tanktop und weiße Chucks trug. Sie schloss den Wagen auf, öffnete die Türen und ließ die Hitze entweichen, die sich im Inneren aufgestaut hatte. Dann öffnete sie die Wasserflasche, die sie eben im Automaten gezogen hatte, und blinzelte durch die grün gefärbten Gläser der Pilotensonnenbrille in die Abendsonne, deren warmes Licht sich im Mittelmeer spiegelte. In wenigen Minuten würde sie als feuerroter Ball untergehen.
Im fernen Dunst sah Castel den alten Hafen und das Château d’If, dessen Umrisse mit dem Himmel und den Wellen verschmolzen. San Francisco hatte Alcatraz, »The Rock«, und Marseille hatte seine eigene Felseninsel, die Île d’If, von der ein Entkommen unmöglich schien. In der dortigen Festung hatten zunächst Soldaten gelebt, um die Stadt zu verteidigen, und später eingekerkerte Gefangene – der berühmteste von ihnen Alexandre Dumas’ Graf von Monte Christo – ihr klägliches Dasein gefristet.
So wie es die Menschen im Maison de Retraite Général de Gaulle auf der anderen Seite des Parkplatzes taten, auf dem Castel stand. Der heiße Wind wehte den intensiven Duft von Lavendel aus dem Vorgarten des Alten- und Pflegeheims herüber, der wie ein kleiner Park vor dem früheren Verwaltungsgebäude aus dem vorletzten Jahrhundert angelegt worden war. Die von Bienen umschwirrten Büsche standen jetzt im Juli in voller Blüte. Ihr leuchtendes Lila kämpfte vor der sandfarbenen Fassade mit dem kräftigen Grün der kleinen Stechpalmen, dem Knallpink der Bougainvilleen und den roten Hibiskusstauden um den Sieg im Wettstreit der intensivsten Farben des Tages.
Ja, dachte Castel und leerte die Flasche in einem Zug, es war wirklich schön hier. Unvergleichlich viel schöner als auf der Île d’If. Und trotzdem gab es kein Entkommen von hier. Wie hieß es bei Dante? »Lasst, die Ihr eintretet, alle Hoffnung fahren.« Denn das Heim mochte noch so hübsch sein, von außen wie von innen – es war dennoch eine Vorhölle und das Leben darin trostlos.
Zumindest kam es Castel stets so vor, wenn sie ihre Eltern besuchte, die hier wohnten. Beide waren gerade mal etwas über siebzig. Ihre Mutter war dement. Ihr Vater litt an Multipler Sklerose und hatte vor ein paar Jahren entschieden, dass sie beide hier besser aufgehoben wären, da sie ihrer einzigen Tochter Caterine oder mobilen Pflegediensten nicht zur Last fallen wollten. Was solle er denn machen, hatte Papa gesagt, wenn Mama ihn eines Tages nicht mehr erkennen und in ihrer Verwirrung davonlaufen und nicht wieder nach Hause finden würde – er sei mit seiner Gehhilfe nicht in der Lage, ihr zu folgen. Und er hatte sich für das De Gaulle entschieden, weil hier einige Exmilitärs lebten und außerdem eine Stiftung die Aufenthalte von früheren Soldaten finanziell unterstützte.
Castel war stets deprimiert, wenn sie das Gebäude wieder verließ. Denn hier wurde ihr jedes Mal die Endlichkeit der Dinge vor Augen geführt sowie die Gebrechlichkeit ihrer Eltern. Papa hatte nichts mehr von dem Offizier in Fallschirmjägeruniform, der auf dem Foto auf der Kommode seine kleine Tochter auf dem Arm hielt. Und Mama fragte Caterine jedes Mal, wer sie eigentlich sei, weil sie die inzwischen fast vierzigjährige Frau mit den raspelkurzen Haaren nicht mit der kleinen Tochter aus ihrer Erinnerung übereinbringen konnte.
Von daher war Castels miese Stimmung an diesem strahlenden Tag nicht verwunderlich. Sie wurde auch nicht besser, als sie eine Stimme von hinten ansprach. Castel drehte sich um.
»Marhaba, Castel«, sagte Martinet.
Er kam betont lässig auf sie zu. Allein dafür, dass er sie auf Arabisch grüßte, hätte er ein paar in die Fresse verdient, dachte Castel.
»Leck mich, Martinet«, antwortete Castel.
»Jederzeit.«
Martinet grinste sein gewohnt überhebliches Haifischgrinsen.
Seine schmale Figur steckte in einem beigen Sommeranzug, zu dem er ein weit aufgeknöpftes, hellblaues Hemd trug. Er schob die Sonnenbrille auf der Nase zurecht, fuhr sich durch die mit Gel zurückgekämmten Haare und ließ die rechte Hand dann wieder in der Hosentasche verschwinden. Am linken Handgelenk trug er einen massiven Chronographen. Dort, wo sich bei Castel an der Innenseite eine arabische Tätowierung befand. Es war der Name eines Mannes aus Castels Vergangenheit, auf den Martinet mit dem arabischen Gruß zynisch anspielte.
Martinet stoppte vor Castel. Sein Schatten fiel auf sie. Einige Meter hinter ihm stand ein anderer Mann neben einem silbernen Mercedes mit Marseiller Kennzeichen. Er nickte Castel zu. Sie kannte ihn. Sein Name war Dennier. Er war deutlich massiger als Martinet, hatte gelocktes Haar und trug ebenfalls einen hellen Anzug, der diesen Sommer augenscheinlich zur Ziviluniform der DGSI gehörte – der dem Innenministerium unterstellten Direction générale de la sécurité intérieure, für deren Marseiller Sektion die beiden arbeiteten. Der Inlandsgeheimdienst befasste sich mit Gegenspionage, Terrorismusabwehr, Bekämpfung von Cyberkriminalität und der Überwachung gefährlicher Gruppen und Organisationen. Letzteres war der Spielplatz von Martinet und Dennier.
Es war zwei Jahre her, dass Castel die beiden zum letzten Mal gesehen hatte. Damals ging es um Laila Hadjali – die Schwester des Mannes, dessen Namen sich Castel hatte unter die Haut stechen lassen. Sie konnte Martinet nicht ausstehen, aber er hatte einen gut bei Castel – und wie es aussah, war der Zeitpunkt gekommen, um die Schuld einzuholen. Sie konnte sich keinen anderen Grund vorstellen, aus dem die beiden ihr gefolgt waren – denn das mussten sie. Und es gefiel ihr überhaupt nicht, dass Martinet nun noch mehr Details über ihr Privatleben kannte als zuvor schon.
Castel schwieg, streckte das Kinn vor und starrte Martinet, der gut zwei Köpfe größer war als sie, herausfordernd an. Schließlich brach er die Stille.
»Bertrand Vollant, Tarek Calvar, Tanguy Martin, Leon Dombois«, sagte Martinet.
Castel verschränkte die Arme vor der Brust und zuckte mit den Schultern. Drei der Namen sagten ihr etwas, der vierte nicht.
»Dombois kenne ich nicht«, erwiderte sie. »Die anderen drei sind Polizisten.«
»Dombois auch.«
»Ebenfalls BRI-BAC?«
»Inzwischen alle vier nicht mehr. Dombois und Martin sind bei der Police Nationale, Vollant und Calvar arbeiten für einen privaten Sicherheitsdienst.«
Castel hatte früher bei der Brigade de Recherche et d’Intervention et Brigade Anti-Commando, kurz BRI-BAC, gearbeitet. Die Such- und Eingreiftruppe war eine schwer gepanzerte Spezialeinheit der Polizei, die dann zum Einsatz kam, wenn es richtig ernst wurde. Castel war damals für die Planung, Koordination und Logistik im Hintergrund mit zuständig gewesen. Später war sie als Ermittlerin ins Dezernat für Schwerverbrechen und Bandenkriminalität gewechselt, wo sie so tief in die Scheiße geritten worden war, dass sie sich am Ende als Streifenpolizistin in der Provence wiederfand und dort von unten hocharbeiten musste. An dem Schlamassel trug der Mann, dessen Name in Castels Haut tätowiert war, einen erheblichen Anteil. Er war längst tot, woran wiederum Castel nicht ganz unschuldig war.
»Und?«, fragte sie.
Martinet fuhr sich über die Stirn. Er schwitzte. »Was für eine Hitze, oder? Sogar noch am Abend. Wo soll das hinführen?«
Castel fragte: »Weswegen lauerst du mir hier auf?«
»Dombois, Martin, Vollant und Calvar.«
»Du wiederholst dich. Was ist mit denen?«
»Wir glauben, dass sie zu einer rechten Terrorzelle gehören und haben Hinweise darauf, dass sie im Drogen- und Waffengeschäft tätig sein könnten. Diese Zelle gehört zu einer Gruppierung von Franzosen, die das Staatssystem nicht anerkennen und nach ihren eigenen Regeln leben. Das sind keine rechtsextremen Hardcore-Nazis, eher eine Melange aus Reichsbürgern, Royalisten und Nazis. Wir befürchten, sie bauen zurzeit eine Miliz auf. In jedem Fall planen sie etwas. Sie waren alle vier bei der Legion und haben sich dort kennengelernt, bevor sie zur Brigade gelangten. Ein eingespieltes Team. Gemeinsame Einsätze in Afghanistan, an der Elfenbeinküste und Mali sowie im Inland bei der Anti-Terror-Bekämpfung. Später dann die BRI-BAC, wie du weißt. Sie sind also in der Lage, ziemlich Ärger zu machen, und vermutlich auch willens. Wir haben zurzeit keine Handhabe gegen sie und sind einige alte Fälle durchgegangen. Da sind wir auf etwas gestoßen, das zu einem Einsatz gegen einen Drogenring vor ein paar Jahren in den Cités zurückführen könnte, den du koordiniert hast. Martin, Vollant und Calvar waren daran beteiligt. In der Dokumentation sind uns ein paar Ungereimtheiten aufgefallen, die zu dem Schluss führen könnten, dass von dem damals beschlagnahmten Heroin etwas verschwunden ist und die drei es sich vielleicht unter den Nagel gerissen haben.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Die hatten niemals Zugriff auf …«
»Es geht nicht darum, ob sie sich tatsächlich etwas unter den Nagel gerissen haben. Es bietet uns einen Hebel, um bei Ihnen Hausdurchsuchungen vorzunehmen.«
»Was soll ich da tun?«
»Wir brauchen eine Aussage von dir über den Ablauf des damaligen Einsatzes, die unseren Verdacht untermauert, damit wir ein Go bekommen.«
»Und wenn ich nichts Entsprechendes zu sagen habe?«
»Es ist ganz einfach und tut nicht weh. Wir unterhalten uns. Zeichnen deine Aussage auf. Den Rest sehen wir dann. Abgesehen davon«, sagte Martinet und lächelte schwach, »glaube ich, dass ich etwas gut bei dir habe.«
Castel schwieg. Sie erinnerte sich an damals. An Laila Hadjali, daran, was Martinet und Dennier getan hatten. Sie nickte.
»Perfekt. Das ist mein Mädchen«, sagte Martinet. »Ich melde mich.«
Er grüßte Castel, indem er sich an die Stirn tippte, und schwirrte ab zu seinem wartenden Kollegen. Castel sah ihm nachdenklich hinterher, bis er ins Auto stieg und den Parkplatz verließ. Auch sie musste jetzt endlich losfahren, um sich nicht zu verspäten.
Sie hatte eine Verabredung mit ihrem Lebensgefährten zum Abendessen in Aix-en-Provence, wo er als Kurator im Musée Granet arbeitete. Sie merkte auf, als das Handy in der Hintertasche ihrer Jeans summte. Sie zog es heraus, sah auf das Display, las den Namen des Anrufers und ging dran.
»Castel«, sagte die Stimme von Albin Leclerc. »Wo auch immer Sie sich gerade herumtreiben: Schwingen Sie die Hufe und kommen nach Fontaine-de-Vaucluse. Sofort. Und bringen Sie Theroux am besten gleich mit.«
4
Das »Bastide de la Lézardière« lag unmittelbar am Ortsausgangsschild und wäre Castel in der Dunkelheit fast gar nicht aufgefallen, wenn Theroux ihr nicht den Google-Maps-Standort geschickt hätte. Direkt nebenan grenzte eine weitere Ferienanlage an das Areal. Auch bei Tag wäre man schnell an der kleinen Residenz vorbeigefahren. Das Werbeschild an der schmalen Einfahrt war kaum zu erkennen, und zur Straße hin wirkten die verfallene Mauer und die graue Bruchsteinfassade nicht besonders einladend. Als sie einbog, sah sie zwei Polizeifahrzeuge der Gendarmerie, die davor parkten, zudem ein Rettungswagen und ein Fahrzeug von der Rechtsmedizin. Castel erkannte auch den Privatwagen von Theroux. Den von Leclerc sah sie nicht. Er hatte sich wohl entschieden, doch besser den offiziellen Kräften das Feld zu überlassen, und war mit seiner Zukünftigen nach Hause gefahren. Offensichtlich lernte er langsam loszulassen.
Besser so, dachte Castel.