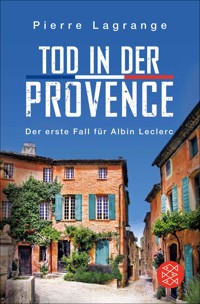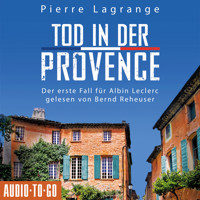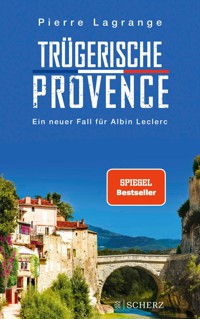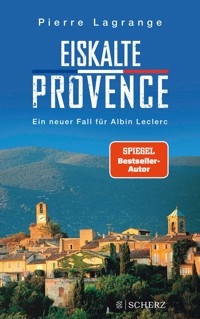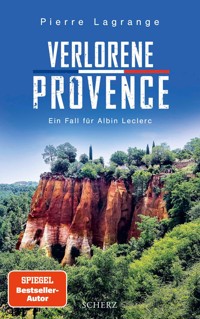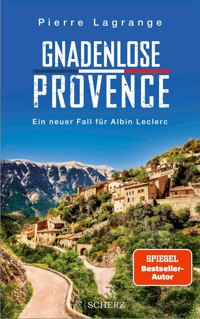
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Eine gnadenlose Tat erschüttert die Provence – der achte Band der Provence-Krimi-Reihe von Bestseller-Autor Pierre Lagrange Zahllose Radsportler sausen im Sommer durch die Provence – und ein Scharfschütze zieht einen nach dem anderen aus dem Verkehr. Die Ermittler Castel und Theroux sind geschockt und haben keinen Schimmer, um wen es sich bei dem Täter handeln könnte. Albin Leclerc, Commissaire im Ruhestand, erfährt von den Vorfällen, während er seine Flitterwochen auf Martinique verbringt. Kaum zurück, stürzt er sich in die Ermittlungen. Er befürchtet, dass der Schütze sich bisher nur aufwärmt und es auf die Tour de France abgesehen hat, die in Kürze durch Carpentras führen wird. Ein Rennen um Leben und Tod beginnt, bei dem sich herausstellt: Die Hintergründe sind finsterer als gedacht ... Ex-Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence: die Provence-Krimi-Reihe Band 1: Tod in der Provence Band 2: Blutrote Provence Band 3: Mörderische Provence Band 4: Schatten der Provence Band 5: Düstere Provence Band 6: Eiskalte Provence Band 7: Trügerische Provence Band 8: Gnadenlose Provence Band 9: Unheilvolle Provence
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 397
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Pierre Lagrange
Gnadenlose Provence
Ein neuer Fall für Albin Leclerc
Roman
Über dieses Buch
Während Albin Leclerc die Flitterwochen auf Martinique verbringt, hat es in der Heimat ein Scharfschütze auf Radsportler abgesehen. Castel und Theroux haben keinen Schimmer, wer hinter den Taten steckt. Als Leclerc von der Reise zurückkehrt, nimmt er sogleich die Ermittlungen auf. Er befürchtet, dass es der Schütze auf die Tour de France abgesehen hat, die in Kürze durch Carpentras führen wird. Ein Rennen um Leben und Tod beginnt, bei dem sich herausstellt: Die Hintergründe sind finsterer als gedacht ...
Ex-Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence – die Provence-Krimi-Reihe.
Band 1: Tod in der Provence
Band 2: Blutrote Provence
Band 3: Mörderische Provence
Band 4: Schatten der Provence
Band 5: Düstere Provence
Band 6: Eiskalte Provence
Band 7: Trügerische Provence
Band 8: Gnadenlose Provence
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. In dieser malerischen Kulisse lässt der Autor seinen liebenswerten Commissaire Albin Leclerc gemeinsam mit seinem Mops Tyson ermitteln.
Inhalt
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Epilog
Seien Sie gespannt [...]
1
Das war kein Tag zum Sterben, dachte Gaspard Lacroix und ließ sich bergab rollen. Graue Felsen strichen an ihm vorbei, sattgrüne Pinien. Er ließ den Lenker für einen Moment los und fühlte sich frei wie ein Vogel. Nichts als das Sirren der Rennradreifen war zu hören. Die Sonne glühte am strahlend blauen Himmel über der Provence. Gleichzeitig war die Luft frisch und angenehm, was bei der anhaltenden Hitzewelle in diesem Sommer ausschließlich am Fahrtwind lag. Er strich wie ein Seidentuch über Lacroix’ verschwitzte Haut. Sie war braun gebrannt und mit einigen Altersflecken gesprenkelt.
Wenn er sich auszog, um zu duschen, wirkte sein Teint manchmal albern, denn natürlich gelangte die Sonne nicht an die Stellen, die vom Trikot und der Radlerhose, den Socken und Schuhen bedeckt waren. Seine Frau Louise hatte längst aufgegeben, darüber Witze zu machen und ihn mit einem dieser Models zu vergleichen, die an Pigmentstörungen litten und wegen der besonderen Färbung ihrer Haut in Szene gesetzt wurden. Lacroix sah seit Jahren so aus – spätestens, seit er nach der Pensionierung wieder obsessiv radelte: braune Arme und Beine, braunes Gesicht – und der Rest kalkweiß.
Nein, kein Tag zu sterben, sagte er sich erneut und ignorierte den stechenden Schmerz im Brustkorb. Er kam und ging, wie es ihm gefiel. Gaspard Lacroix beruhigte sich meist damit, dass oft Rückenmuskeln oder Wirbel solches Stechen auslösen konnten. Sein Arzt hatte es ihm erklärt: Der Körper war es nicht gewohnt, Schmerzen im Inneren zu verorten. Wenn es Probleme auf der außen liegenden Seite eines Muskels gab, spürte man das am Rücken. Traten Probleme auf der inneren Seite auf, spürte man das in der Brust. Mit seiner Pumpe sei jedenfalls alles in Ordnung und Radfahren auch mit knapp siebzig Jahren gut fürs Herz und den Kreislauf, wenn man es nicht übertrieb. Denn sonst könnte es durchaus bedenklich sein.
Gaspard Lacroix aber hatte es sein Leben lang übertrieben. Schon seit seiner Jugend, was sich irgendwann rächen würde, das war ihm klar. Aber er konnte nicht anders. Das Radfahren war eine Sucht, körperlich und mental. Als er noch in Avignon bei der Polizei gewesen war, hatte es ihm stets geholfen, eine Runde zu radeln, um zu entspannen und sich abzulenken.
Sich auf andere Gedanken bringen – das sollte er nun ebenfalls tun, dachte er und bewegte den Kopf nach links und rechts, ließ es im Nacken knacken, streckte die Schultern nach hinten und spürte, dass das Stechen nachließ. Also wieder einmal falscher Alarm, wie hätte es auch anders sein sollen?
An diesem Morgen drehte Lacroix seine übliche Runde von knapp vierzig Kilometern, die von Carpentras über Mazan, Mormoiron, Caromb und wieder zurück führte. Anschließend würde er sich mit Louise ein zweites Frühstück gönnen, etwas im Garten arbeiten und abends dann noch eine Runde drehen. Was sollte er auch schon groß anderes anstellen mit seiner vielen freien Zeit?
Immerhin warf ein großes Ereignis seinen Schatten voraus, die Tour de France, und die sorgte wenigstens im Moment für Abwechslung. Lacroix verfolgte sie im Fernsehen und in anderen Medien. Als junger Mann wäre er selbst gerne ein Profi geworden, aber dazu hatte es nicht gereicht.
In diesem Jahr stand ein besonderes Ereignis an. Die Tour würde die Mont-Ventoux-Etappe fahren. Sie stand nicht oft auf dem Programm, aber sie war legendär. Genauso wie der legendäre Berg selbst, der wie ein grauer Riese über der Provence thronte. Lacroix war selbst einige Male hinauf auf den Gipfel gefahren – so wie zahllose andere Hobbyradler. Es war ein harter Kampf, den Berg zu bezwingen, und umso süßer war der Sieg. Im Jahr 1951 stand der Mont Ventoux erstmals auf dem Programm der Tour, seither insgesamt siebzehnmal, und stets hatte der Ventoux für absolute Höhepunkte gesorgt. Aber auch für Tiefpunkte, allen voran der Tod von Tom Simpson, der kurz vorm Ziel dehydriert gestorben war – eine Folge von Alkohol und Aufputschmitteln. Selbst den legendären Eddy Merckx hatte der Berg geschafft: Er brach 1970 auf dem Gipfel zusammen und musste ins Sauerstoffzelt.
Die Route verlief bei dieser 12. Etappe der Tour von Nîmes über Sorgues und Carpentras nach L’Isles-sur-la-Sorgue, wo sie eine große Kurve beschrieb und dann über Pernes-les-Fontaines, Saint-Didier, Mazan und Bédoin zum Ventoux führte, was rund hundertfünfzig Kilometer waren.
Wer den Berg hinauffuhr, der wusste, worauf er sich einließ – ob Profi oder Amateur. In Bédoin wimmelte es an manchen Tagen nur so von Radfahrern aus aller Herren Länder. Lacroix hatte einmal die Zahl von siebenhunderttausend Radlern pro Jahr gelesen, die den Ventoux bezwingen wollten und sich auf die zweiundzwanzig Kilometer lange Fahrt bei einer durchschnittlichen Steigung von acht Prozent begaben, wobei insgesamt eintausendsechshundertsiebenundsiebzig Höhenmeter zu überwinden waren. Man brauchte dazu körperliche Fitness, viel Wasser und einen eisernen Willen. Und auf den letzten Kilometern, hoch oben in dem grauen Geröllfeld, das für den Berg so typisch war, war man ganz mit sich allein, da lenkte kein Baum und kein Strauch mehr ab. Man fühlte sich wie auf dem Mond und fuhr direkt in den Himmel hinein. Es gab keinerlei Schatten, die Sonne flirrte über dem glühenden Asphalt, es war ein Kampf Mensch gegen Natur und Mensch gegen sich selbst.
Abgesehen von der Legende Ventoux brachte die Tour sowieso jede Menge Trubel mit sich. Es war ein irrer Zirkus, und die Gastronomen, Hoteliers und Fremdenverkehrsverbände rieben sich bereits die Hände. Das Medienecho war gigantisch. Die PR, das Marketing und das Renommee, ein Ort der Tour zu sein, waren enorm. Jedes Dorf und jede Stadt entlang der Strecke hatten die Chance, sich von der besten Seite zu präsentieren und in den Medien erwähnt oder sogar mit kurzen Clips porträtiert zu werden. Abgesehen davon, von einem Millionenpublikum weltweit gesehen zu werden, schrieb man sich in die Annalen der Sportgeschichte ein und bot den Rahmen für Zigtausende von Zaungästen, die die Tour live miterleben wollten.
Ein solcher würde Gaspard Lacroix ebenfalls sein. Er hatte sich noch nie eine Ventoux-Etappe entgehen lassen, wenn die Tour schon einmal direkt vor seiner Haustür vorbeiführte. Und, zum Teufel, er freute sich darauf, in diesem Jahr noch mehr als sonst, was seine Gründe hatte, denn natürlich würde er Benny Boux die Daumen drücken und ihn anfeuern – so wie jeder aufrechte Provenzale, das war ja wohl klar. Der Junge war knapp über zwanzig Jahre alt, fuhr seine erste Tour und galt als eine große Hoffnung. Außerdem kam er von hier, genauer gesagt: aus Bédoin, und war ein sympathischer junger Mann, der viel für den Sport tat und den Nachwuchs förderte. Immer wieder besuchte er seine Heimat im Vaucluse und warb an Schulen für das Radfahren, ließ sich mit Kindern fotografieren, spendete Geld und aktivierte bei seinen Sponsoren Fördersummen, damit sich Jugendliche aus benachteiligten sozialen Schichten in Radlergruppen formieren konnten. »Besser im Sattel auf der Straße als woanders«, sagte Benny stets. Zudem war er ein hübscher Bursche, ein echter Medienliebling, der gelegentlich mit Fotomodels gesehen wurde und außerdem für einen sauberen Radsport eintrat.
Ob es das überhaupt gab im Profibereich? Lacroix wollte seine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Kaum vorstellbar, dass derart übermenschliche Leistungen, wie sie heutzutage bei der Tour de France und anderen Rennen gefordert wurden, ohne Hilfsmittel abrufbar waren. Und natürlich waren einige Präparate sogar erlaubt. Vielleicht reichte es also aus, sich vorzustellen, dass sich alles, was in Benny Boux’ Team geschah, wenigstens innerhalb der legalen Grenzen bewegte.
Lacroix ließ sich noch einige Meter rollen. Das Engegefühl in der Brust war gänzlich fort. Also trat er wieder in die Pedale, denn nach einer sanften Kurve folgte nun ein Anstieg, der sich über ein paar Kilometer erstrecken würde und seine ganze Aufmerksamkeit verlangte. Ein Trecker, der einen mit Lavendel beladenen Anhänger zog, kam ihm entgegen und hüllte ihn in eine intensive Duftwolke ein. Lacroix beschleunigte und hielt den Atem an, bis er sicher sein konnte, dass der Geruch wieder verflogen war. Mormoiron hatte er hinter sich gelassen und fuhr jetzt auf der D224, der Route de Saint-Pierre, in Richtung Saint-Pierre-de-Vassols. Das schmale graue Band der Straße durchschnitt die grüne und an einigen Stellen von Felsen gesprenkelte Landschaft wie eine Narbe. Schließlich erreichte er nach der Steigung eine langgezogene Gerade und konnte wieder etwas lockerlassen. So war es doch stets im Leben, oder nicht? Ein Wechselspiel aus Anstrengen und Lockerlassen. Erst wurde es stets schlimmer, bevor es wieder besser wurde. Ein beständiges Auf und Ab.
Genau, dachte Gaspard Lacroix, als ihn ein Lichtblitz von links irritierte.
Es war das Letzte, was er sah, bevor er begriff, dass heute doch ein Tag zum Sterben war.
2
Castel schob einen Kaugummi in den Mund, zerknüllte das Papier und ließ es in der Jeanstasche verschwinden. Sie schob die Pilotenbrille ins Haar, das sie inzwischen halblang trug. Der etwas femininere Touch gefiel ihr gut. Sie hatte genug von dem Tomboy-Schnitt der vergangenen Jahre. Die alten Chucks trug sie aber immer noch. Ebenso das schlichte, helle Longshirt mit der Knopfleiste. Die Ärmel waren hochgeschoben. Über dem rechten hatte sie die signalrote Binde mit der Aufschrift »Police« befestigt.
An der linken Hand trug sie einen silbernen Chronographen mit Metallarmband, der das arabische Tattoo auf der Innenseite des Handgelenks verdeckte. Sie hatte keine Lust mehr, ständig darauf angesprochen zu werden. Ihr war nichts Besseres eingefallen, als es mit einer fetten Uhr zu verdecken. Der Zeitanzeiger hatte ihrem Kollegen Alain Theroux Respekt eingeflößt, der auf solche Dinge abfuhr. Er stand drüben bei den anderen Polizisten und trug ebenfalls eine Armbinde, außerdem eines dieser Hemden mit zahllosen Aufnähern, die Anfang des neuen Jahrtausends einmal modern gewesen waren. Gerade ließ er sich irgendetwas erklären, wozu er sich Notizen machte.
Castel rollte den Kaugummi von der einen Backe zur anderen, kickte einen Stein zur Seite und schob die Hände in die Gesäßtaschen der Jeans. Sie sah nach links, nach rechts, drehte sich um die eigene Achse und ließ den Blick über ein Weinfeld schweifen, das an die ihr gegenüberliegende Straßenseite angrenzte. Hinter ihr ging es hangaufwärts. Rechts führte die voll gesperrte Straße nach Saint-Pierre, links ging es nach Mormoiron. Vor ihr auf dem Asphalt lagen das Rennrad und sein Fahrer in einer getrockneten Blutlache.
Die Spurensicherung untersuchte das Umfeld, während der Fundort bereits wieder freigegeben war und die Rechtsmedizin ihre Arbeit verrichtete. Berthe und ihr Team waren aus Nîmes gekommen, um das Offensichtliche zu bestätigen: Ein Radfahrer war getötet worden, und zwar durch einen seitlichen Schuss in den Kopf. Gemäß der Ausrichtung des Körpers und des Fahrrads war der Mann, den Cat auf Mitte sechzig schätzte, auf dem Weg nach Saint-Pierre gewesen. Was bedeutete, dass der Schütze wohl aus Richtung des Weinfeldes geschossen haben musste.
Es war noch völlig unklar, ob er ein Gewehr oder eine Pistole benutzt oder womöglich sogar aus einem fahrenden Auto geschossen hatte – zum Beispiel aus der Gegenrichtung kommend oder bei einem Überholvorgang.
Die Leiche war von einem Lkw-Fahrer entdeckt worden, der zunächst von einem Unfall mit Fahrerflucht ausgegangen war. Aber vor Ort hatte die Gendarmerie sehr schnell gesehen, dass der Radfahrer erschossen worden war, eine entsprechende Meldung abgesetzt und die Straße abgesichert. Schließlich waren Castel und Theroux angerückt, die sich eigentlich gerade mit einer Einbruchsserie in leer stehende Ferienhäuser befassten und zu einigen Zeugenbefragungen aufbrechen wollten. Aber das musste nun warten.
Castel machte mit dem Kaugummi eine Blase, ließ sie platzen. Theroux war mit seiner Unterhaltung fertig und kam herüber. Obwohl er eine übergroße Sonnenbrille mit goldglänzendem Gestell trug, war ihm der Schlafmangel anzusehen. Er war kürzlich erneut Vater geworden. Die Belastung setzte ihm offensichtlich zu. Die Kleine trug den Namen Valerie. Castel erinnerte sich gut daran, wie Theroux freudestrahlend bei der Hochzeitsfeier der Leclercs aufgetaucht war und die frohe Botschaft verkündet hatte.
Heute Morgen hatte Alain bereits sein Leid darüber geklagt, dass Valerie Verdauungsstörungen habe und die Nächte die Hölle waren. Zu allem Überfluss hatte sich auch noch sein Sohn beim Skateboardfahren vorgestern das Schienbein gebrochen, und außerdem war zu Hause die Klimaanlage ausgefallen, was bei dieser Gluthitze kein Vergnügen war.
Theroux blähte die Backen, nahm die Sonnenbrille ab und rieb sich die Augen. »Gaspard Lacroix, verflucht noch eins.«
Castel kaute. »Und?«
»Wie und?«
Castel zuckte mit den Achseln. »Ist das der Name des Toten?«
»Habe ich doch gesagt.«
»Du hast nur den Namen erwähnt. Was weiß ich, das könnte ja jeder sein, zum Bespiel einer der Gendarmen.«
Theroux blickte Castel an, als habe sie ihm gerade eine Dreisatzaufgabe mit vier Unbekannten aufgegeben. Er war ein ausgezeichneter Polizist, aber manchmal stand er ziemlich auf der Leitung. Dann war es so, als würden Informationen wegen irgendeiner gebrochenen Lötstelle in seinem Gehirn falsch übersetzt oder nicht ankommen.
»Nein«, erwiderte er, »die heißen anders. Steht doch auf ihren Namensschildern.«
»Alain …«
»Was gibt’s denn da noch mehr zu sagen?«
»Alain, können wir uns …«
»Gaspard Lacroix, habe ich gesagt. Ist doch klar, was ich damit meine.«
Castel machte noch eine Kaugummiblase und ließ sie erneut platzen. »Also, der Tote ist ein Mann namens Gaspard Lacroix.«
»Der Gaspard Lacroix.«
Castel zuckte wieder mit den Schultern. »Den Namen habe ich noch nie gehört.«
»Was?«
»Nein, noch nie gehört.«
Theroux dachte kurz nach, nickte dann und sagte: »Okay, das muss vor deiner Zeit in Carpentras gewesen sein, als du noch in Marseille gearbeitet hast. Gaspard Lacroix ist ein früherer Kollege, ein Expolizist.«
»Oh«, machte Castel. »Nicht gut.«
»Ganz und gar nicht gut«, sagte Theroux. »Er hatte seine Papiere dabei, sein Handy ebenfalls. Wir haben ihn eindeutig identifiziert. Berthe kennt ihn auch. Er ist vor drei Jahren in Pension gegangen, hat zuvor bei der Police Municipale in Avignon gearbeitet, lebte aber in Carpentras.«
Ein getöteter Kollege, ob Ex oder nicht – das setzte bei der Polizei eine ganz andere Dynamik in Gang als bei sonstigen Mordfällen. Es weckte den Korpsgeist und eine große interne Anteilnahme. Natürlich war es nicht so, dass sich die Polizei sonst weniger Mühe gab. Doch wenn es einen Kollegen erwischte, hatte es einen von ihnen erwischt. Es war persönlich.
Schließlich merkte Castel auf, als sie eine Geste von Berthe sah, die sie und Theroux zu sich winkte. Beide traten zu ihr und zu der Leiche, die gerade von Berthes Assistenten gefilmt wurde wie zuvor schon von der Spurensicherung – es war später immer besser, Standbilder von Videos als einzelne Fotos zu haben.
Berthe nahm ihre Lesebrille ab und tauschte sie gegen das Modell mit dem knallroten Rahmen. Die Sonne schien ihr nichts auszumachen. Einen Moment später kam auch Bruno Grinamy herüber, der die Spurensicherung leitete. Er trug einen weißen faserfreien Overall. Der Reißverschluss war aufgezogen und darunter ein pinkfarbenes Poloshirt zu sehen. Grinamy schwitzte. Eigentlich wollte er schon längst im Ruhestand sein. Aber man hatte ihn gefragt, ob er nicht noch etwas verlängern wollte, weil es personelle Probleme gab. Grinamy hatte eingewilligt, aber angekündigt, dass in diesem Jahr endgültig Schluss sei und er nicht länger den potenziellen Nachfolgern im Wege stehen wolle. Seine Glatze glänzte in der Sonne.
»Also«, sagte Berthe, »nach der Erstbeschau würde ich sagen, dass uns später bei der Obduktion keine größeren Überraschungen ins Haus stehen sollten. Ich bin der Meinung, dass der Mann links oberhalb des Ohres von einem Schuss getroffen wurde, der seinen Helm auch beim Austritt durchdrang. Dann stürzte er tot vom Rad. Das Ereignis dürfte vielleicht zehn Meter von unserem Standort entfernt stattgefunden haben. Dann ist er – je nach Tempo – noch etwas gerollt und über die Straße geschlittert. Er war in jedem Fall sofort tot. Da es ein Durchschuss war, müsste es noch ein Projektil geben.«
Grinamy nickte und seufzte. Das bedeutete für sein Team, dass sie eine Nadel im Heuhaufen suchten. Dennoch klang er zuversichtlich und sagte: »Auf der anderen Straßenseite ist ja ein Felshang. Das sollte nicht allzu schwer werden. Die Kugel dürfte sich in den Stein gebohrt haben, oder sie ist abgeprallt.« Immerhin besser und chancenreicher, dachte Castel, als ein leeres Feld oder einen Wald absuchen zu müssen, was Tage dauern konnte.
Theroux wandte sich an Berthe: »Gibt es eine Vermutung, welche Art Waffe verwendet wurde?«
»In Anbetracht der Verletzungen würde ich annehmen, dass es eine Waffe mit hoher Durchschlagskraft war. Also eher ein Gewehr als eine Pistole.«
Castel drehte sich in Richtung des Weinfeldes und deutete dorthin. »Also hielt sich der Schütze vermutlich im Weinfeld zwischen den Rebstöcken auf und hat von dort aus auf Gaspard Lacroix geschossen. Das nächste Gebäude dort hinten ist einige hundert Meter entfernt.«
»Einige hundert Meter«, sagte Grinamy, »sind mit dem richtigen Gewehr keine Entfernung.«
Castel nickte. »Aber von dort aus wäre der Winkel ein anderer gewesen, oder? Wäre der Schütze dort gewesen, dann hätte der Schuss eher die Stirn getroffen.«
»Richtig«, sagte Grinamy und sah sich um. »Sehen wir doch mal gemeinsam nach«, meinte er dann, zog zwei Packungen mit Überziehern für die Schuhe aus der Tasche und gab sie Castel und Theroux.
Ein paar Minuten später gingen sie durch das Feld, nachdem Grinamy auf der Fahrbahn die Zone markiert hatte, in der Lacroix wohl von der Kugel getroffen worden war. Die übrigen Forensiker hatten bereits begonnen, in diesem Abschnitt an den Felsen nach dem Projektil zu suchen, und nutzten dazu auch ein Metallspürgerät.
Im Weinfeld nahm sich Castel eine Furt vor, Grinamy und Theroux jeweils die parallel verlaufenden. Castel fixierte den Blick auf die trockene Erde, ohne dass ihr etwas auffiel. Sie gingen etwa zweihundert Meter weit, bis sie das Ende erreichten, wechselten dann auf drei neue Furten und gingen wieder zurück.
»Stopp«, sagte Grinamy nach zirka zehn Metern. Offensichtlich hatte er etwas bemerkt. »Sieht so aus«, sagte er, »als ob sich hier zertretene Erde befindet.« Castel drängte sich zwischen einigen Rebstöcken hindurch zu Grinamy und sah, was er meinte: zerbröselte Krume. Theroux steckte seinen Kopf durch die Blätter und sah es nun ebenfalls. Schließlich gingen sie zu dritt seitlich der betreffenden Furt, um dort keine Spuren zu zerstören, spähten zwischen den Reben hindurch, bis Grinamy schließlich ein Stoppzeichen gab. Er deutete auf einen sehr deutlich zertretenen Bereich. Cat schätzte, dass er sich etwa hundert Meter von der Straße entfernt befand.
»Könnte sein«, sagte Grinamy, »dass wir den Standort des Schützen gefunden haben. Ich lasse das gleich alles sichern und von meinen Leuten untersuchen.«
Castel nickte und blinzelte in Richtung Straße. Mit einem Gewehr und einem darauf montierten Zielfernrohr wäre es durchaus möglich, jemanden zu treffen – wenn der Radler in einem mittleren Tempo fuhr und man Übung beim Schießen hatte.
Dennoch fragte sie Grinamy: »Muss man ein Profi sein, um aus dieser Entfernung ein Ziel zu treffen?«
»Nicht unbedingt«, sagte Grinamy. »Ein sauberer Kopfschuss bei einem sich bewegenden Ziel allerdings – tja, das spricht durchaus für Erfahrung. In jedem Fall braucht man ein gutes Gewehr mit einer entsprechenden Zielvorrichtung und etwas Übung. Ein Jäger vielleicht. Möglicherweise wurden auch mehrere Schüsse abgefeuert.«
Castel nickte. »Ein Jäger … Kann das ein Unfall gewesen sein?«
»Das wäre schon ein ziemlicher Zufall. Der Schuss ist zu gut platziert, Cat.«
»Wenn der Schütze hier auf der Lauer gelegen hat«, sagte Theroux, »muss er gewusst haben, dass Lacroix entlang der Straße radeln wird. Vielleicht ist das seine übliche Route. Was wiederum bedeuten würde, dass der Schütze Gaspard Lacroix entweder gekannt oder genau studiert hat. Vielleicht jemand, der aus alten Tagen noch eine Rechnung mit ihm offen hat?«
»Kann sein«, meinte Castel. »Vielleicht ging es aber auch nur darum, irgendwen zu treffen.«
Der Gedanke, dass jemand einfach so auf einen beliebigen Radler geschossen haben könnte, war erschreckend. Denn bei einem gezielten Mord war mit dem Tod des Opfers die Angelegenheit für den Täter in der Regel erledigt. Außerdem gab es Motive, die man ermitteln konnte, was irgendwann zum Täter führte. Aber wenn jemand wahllos schoss, ging es um pure Mordlust, und der Täter würde erneut zuschlagen. Solche Heckenschützen tauchten als Serientäter gelegentlich auf – vor einigen Jahren war in den USA ein Sniper-Team unterwegs gewesen, das viele Menschen getötet oder schwer verletzt hatte.
Castel fragte: »Sind Scharfschützen nicht oft zu zweit? Einer, der schießt, ein anderer, der spottet?«
»Durchaus«, meinte Grinamy. »Aber nicht zwingend. Als Jäger bist du auch allein unterwegs, und wir haben es hier nicht mit einer Distanz von mehreren hundert Metern zu tun, wo du alles Mögliche wie den Wind berechnen musst.«
Castel nickte erneut, kaute auf ihrem Kaugummi, beobachtete, wie Grinamy sich streckte und ins Kreuz fasste.
»Verdammte Bandscheibe«, murmelte er. »Wird Zeit, dass ich meinen Hintern in einen Liegestuhl am Strand schwinge und mich nicht mehr bücken muss.«
»Ende des Jahres ist es so weit?«, fragte Castel.
Grinamy nickte. »Ja. Dann lasse ich es mir endlich gutgehen. Auf Martinique.«
3
Martinique.
Insel der Träume.
Weiße Strände und türkisfarbenes Wasser mit einer Temperatur von siebenundzwanzig Grad. Lächelnde Menschen in bunter Kleidung, Palmen, Regenwald und ein Vulkan im Zentrum. Ein kleines Stück Frankreich mitten in der Karibik, voller Lebensfreude, fernab von allem Wahnsinn und Stress. Tropisches Eiland mit Rumdestillerien und Bananenplantagen, wo Kokosnusswasser direkt aus der geknackten Frucht serviert wurde und die kreolische Küche ein tägliches Festmahl lieferte. Die Krebse, Fische und Langusten waren so frisch und köstlich, dass man denken konnte, sie wären freiwillig direkt aus dem Wasser auf den Teller gehüpft – mit einem kurzen Umweg über Kochtopf oder Pfanne. Gleichzeitig waren Käse, Wein und Baguette so selbstverständlich wie in Frankreich. Man konnte in der Landessprache reden, mit Euros bezahlen und das Savoir-vivre mit karibischer Lässigkeit garnieren.
Die Unterwasserwelt war faszinierend. Von Tunneln durchzogene Korallenriffe, Schwämme, üppige Gorgonien, knallbunte Fische, Rochen, Delfine, Schildkröten – ein wahrer Garten Eden mit zahlreichen Tauchrevieren. Die Natur über dem Wasser war nicht viel schlechter. Dreihundertfünfzig Kilometer Küste und über tausend Meter hohe Berge vulkanischen Ursprungs, Urwälder und Palmen, Palmen und Palmen. Es gab weiße Sandstrände, es gab schwarze Sandstrände. Und von den Hängen des erloschenen Vulkans Montagne Pelée stürzten Wasserfälle in die Tiefe. Zahllose Boote lagen in den kleinen Häfen. Es gab Ausflüge auf Katamaranen, auf denen man Inselhopping zu den übrigen Antillen betreiben konnte. Stand man am Strand, dann wusste man, dass das Festland Hunderte Kilometer weit entfernt war. Um einen herum gab es nichts als die Karibik. Man war fernab von allem, mitten im Nirgendwo, und alle Sorgen verblassten vor dem großen Blau.
Martinique.
Insel der Träume.
Insel der tödlichen Langeweile.
Albin bestellte sich den zweiten Ti Punch an der Strandbar. Das war das Nationalgetränk, eine Mischung aus Rum, Limette und Rohrzucker. Je besser der Rum, desto besser der Punch, und Martinique hatte in Sachen Rum so einiges zu bieten, wie Albin in den vergangenen Tagen gelernt hatte. Die Einheimischen tranken den Ti warm. Albin nicht. Er ließ sich wie immer ein paar Eiswürfel ins Glas füllen und hielt es sich gegen die Stirn, um sich zu erfrischen, bevor er einen Schluck trank.
Es war heiß. Heiß und schwül. Das lag an der Jahreszeit.
Eigentlich hatte Albin wegen des besseren Klimas in der Karibik erst im kommenden Frühjahr zur Hochzeitsreise aufbrechen wollen. Dann hatten er und Veronique sich allerdings darauf verständigt, doch eher zu fliegen: Einerseits waren Flitterwochen mehr als ein halbes Jahr später keine wirkliche Hochzeitsreise mehr. Veronique musste außerdem an ihr Geschäft denken. Albins Tochter Manon hatte zwar zugesichert, während der zwei Wochen einzuspringen. Aber Veronique meinte, dass es Manon sicherlich leichter fallen würde, wenn sie in den Sommerferien verreisen würden, weil Manon dann weniger Stress hätte und Clara mit in den Laden nehmen könnte. Für Albins Enkelin begann nach der Vorschule nun bald die Grundschulzeit.
Manon war mit ihr bei einem Tag der offenen Tür gewesen und hatte sich alles angeschaut. Außerdem hatte sie sich glänzend mit einer Lehrerin namens Giselle Lussac unterhalten, die sie bereits aus dem Geschäft kannte, weil sie regelmäßig zum Blumenkaufen kam. Sie war etwas älter als Manon, doch ihre Tochter Josefine und Clara besuchten dieselbe Vorschule, wo sie sich ebenfalls schon einige Male über den Weg gelaufen waren. Giselle hatte Manon außerdem einen Job in der Nachmittagsbetreuung in der Schule angeboten, wo eine Stelle frei geworden war. Nichts Besonderes, aber immerhin. Manon würde den Job wahrscheinlich annehmen.
Sie und Giselle hatten sich einige Male getroffen und angefreundet, zumal die Kinder sich bestens verstanden. Auch Castel war ein- oder zweimal zu der Damenrunde gestoßen. Albin gefiel das nicht besonders – also: dass Manon Freundschaften schloss, schon. Aber dass sie so eng mit einer Quasi-Kollegin wie Castel war … Albin war kein Freund davon, Privates mit Dienstlichem zu vermischen – wenngleich Veronique ihm schon häufiger gesagt hatte, dass er ja selbst nichts anderes tat und er sich außerdem nicht so albern anstellen und den jungen Frauen ihren Spaß lassen sollte.
Jedenfalls hatte Albin dem Vorziehen des Urlaubs selbstverständlich zugestimmt und seine gletscherblaue Badehose eingepackt – ein Geschenk von Manon. Es handelte sich um dasselbe Modell, das Daniel Craig als James Bond getragen hatte, was wiederum eine Anspielung auf eine Badehose von Sean Connery in »007 jagt Dr. No« war – dem ersten Bond überhaupt mit der legendären Szene zwischen Connery und Ursula Andress an einem karibischen Strand auf den Bahamas. Albin hätte sich allerdings gewünscht, dass man in die Shorts die Figur von Daniel Craig mit eingebaut hätte. Aber so weit waren die Textilhersteller leider noch nicht.
Heute trug er genau diese Badehose und darüber ein ausgeblichenes Polohemd, um seine Schultern zu schützen – er hatte einen leichten Sonnenbrand. Er fuhr sich über die Stirn. Aus den Musikboxen klang basslastiger Reggae.
Albin trank einen Schluck. Dann nahm er Platz auf einem Hocker. Die Bar war aus verwittertem, in Pastellfarben gestrichenem Holz gebaut und hatte ein Dach aus Palmenblättern. Für Albins Geschmack wirkte alles zu abgewrackt, um authentisch zu sein, denn der Rest des Fünfsternehotels war piekfein. Innerhalb der Anlage war die Realität sowieso eine andere als außerhalb, und die Kluft zwischen gutverdienenden Touristen und der armen Bevölkerung war erheblich. Das nahm man sofort wahr, wenn man sich außerhalb bewegte und mit dem Leihwagen herumfuhr. Es mochte alles noch so traumhaft erscheinen, aber die sozialen Probleme lagen auf der Hand.
Auf den übrigen Hockern saßen vitale und attraktive Männer und Frauen im Schatten und befassten sich mit Drinks, Salaten und ihren Handys. Der Strand davor war mit Sonnenschirmen und Liegen übersät. Auf einer aalte sich Veronique, las ihren dritten oder vierten Schwedenkrimi, brutzelte in der Sonne und wendete sich von Zeit zu Zeit wie ein Steak, um einen gleichmäßigen Teint zu erzielen. Und ehrlich gesagt, wenn er sie da so in ihrem Leopardenmusterbikini betrachtete: Mit den jungen Hüpfern in der Clubanlage konnte sie auch als über Sechzigjährige locker mithalten, was Albin ihr bereits einige Male gesagt hatte. Sie hatte sich mit Küssen bedankt und mit dem Hinweis seinen Bauch getätschelt, dass er in seiner James-Bond-Badehose auch nicht schlecht wäre. Na ja. Was man in den Flitterwochen so sagt.
Flitterwochen.
Veronique Leclerc, fasste man das?
Manchmal musste sich Albin noch zwicken. Nie im Leben hätte er gedacht, dass er noch einmal heiraten würde. Aber er hatte die Entscheidung noch keinen Moment lang bereut. Ganz im Gegenteil. Es fühlte sich gut und richtig an.
Albin ließ sich vom Barhocker rutschen und verfluchte sich ein weiteres Mal, dass er die Schlappen bei den Liegen vergessen hatte. Der Sand war heiß wie eine Herdplatte, weswegen Albin zunächst das obere Drittel seines Drinks abschlürfte, damit nichts überschwappte, wenn er über die glühende Fläche huschte.
Genau das tat er dann und spürte, wie seine Fußsohlen mit jedem Schritt heißer und heißer wurden – bis es nicht mehr zu ertragen war und er endlich das Wasser erreichte, wo der Sand hart und feucht und kühl war. Was für eine Wohltat. Er stieg bis zu den Knien ins kristallklare Meer, drehte sich dann herum, so dass er die Karibik im Rücken und den Strand vor sich hatte. So stand er häufig da, mal in die eine, mal in die andere Richtung blickend, und dabei hatte er sich gestern auch die Schultern verbrannt – ausgerechnet am vorletzten Urlaubstag. Veronique merkte noch nicht einmal auf. Sie war vollkommen vertieft in die Abgründe der Fälle der skandinavischen Ermittler. Albin hatte kürzlich kommentiert, dass bei der Vielzahl von schwedischen Mordfällen eigentlich schon das halbe Land entvölkert sein müsste, worauf Veronique bloß abgewinkt und »Pscht« gemacht hatte. Zum Zeitvertreib hatte Albin kürzlich selbst angefangen, einen zu lesen, aber schon nach dreißig Seiten aufgegeben. Es kam ihm blödsinnig vor, bei strahlendem Sonnenschein und guter Laune etwas über depressive Ermittler bei Schneeregen in Schweden zu lesen. Er hatte kurz die letzten Seiten gecheckt, um sich zu vergewissern, dass er mit seinem Verdacht bezüglich Mordmotiv und Täter richtiggelegen hatte, und das Buch dann wieder Buch sein lassen.
Tja. Und jetzt stand er wieder einmal da an seinem Lieblingsplatz: ein auf die siebzig zugehender Ex-Commissaire vom Format eines Kleiderschranks mit schlohweißem Haar und seinem Drink in der Hand und betrachtete den Strand in dem Wissen, dass er mittlerweile jedes Sandkorn beim Vornamen kannte. Albin dachte über den Gangsterkönig Louis Rey nach, der sein Lebensende gerne als Besitzer einer Bar an einem karibischen Strand verbracht hätte. Er dachte an Bruno Grinamy von der Spurensicherung, für den Martinique stets ein Traumziel war und der Albin überhaupt auf die Idee mit der Insel gebracht hatte.
Allerdings gab es oft eine massive Diskrepanz zwischen Wirklichkeit und Phantasie. Klar, die Insel war wunderschön. Keine Frage. Allerdings fühlte sich Albin komplett auf sich selbst zurückgeworfen. Er wurde ja daheim schon unruhig, wenn er einmal ein paar Minuten lang nichts zu tun hatte und nichts mit sich anzufangen wusste. Mit dem Unterschied, dass er sich dort ablenken konnte, und sei es nur dadurch, dass er mit Tyson Gassi ging.
»Dann wird es Zeit«, hatte Veronique beim Abendessen im Hotel gesagt, »dass du zu genießen und zu entschleunigen lernst und dir mal überlegst, was du dir für ein schönes Hobby zulegen könntest. Wie wäre es denn mit Malen?«
»Malen?«, hatte Albin erwidert, wobei ihm fast die Gabel aus der Hand gefallen wäre. »Ich? Malen in der Karibik wie Gauguin auf Tahiti? Hier gibt es Malkurse?«
»Ich meine ganz generell, Albin. Warum denn nicht? Oder werde Bildhauer. Lass deinen Gefühlen freien Lauf und forme sie in Ton oder Stein.«
»Hier gibt es nur Strand. Ich kann doch keine Sandburgen bauen. Was sollen die Leute denken?«
»Aber genau darum geht es ja, mein Lieber«, hatte Veronique gemeint. »Du kannst nicht immer alles in dich hineinfressen. Du musst es rauslassen. Ich akzeptiere ja, dass du nicht darüber sprechen magst, aber da wäre Malen doch ein Weg? Oder fang mit Golf an. Oder Tennis. Da kannst du dann mal ordentlich zuschlagen und tust auch noch etwas für die Gesundheit.«
Das Hotel bot in der Tat Golfkurse auf einem Platz in der Nähe an. Tennisplätze gab es ebenfalls. Kürzlich war Albin für einen Moment versucht gewesen, sich darauf einzulassen, war dann aber bei der Vorstellung zurückgeschreckt, mit einem Racket Löcher in die Luft zu schlagen wie Jacques Tati in »Die Ferien des Monsieur Hulot« oder mit dem Driver den Rasen zu pflügen. Abgesehen davon: Er spielte ja noch nicht mal ernsthaft Boule, obwohl er von einigen Teams umworben wurde, denn er war gar nicht schlecht im Pétanque.
»Frau«, hatte er erwidert, »ich muss mir nichts suchen, um Dampf abzulassen. Schon gar nicht, wenn ich dabei karierte Hosen tragen und in Elektromobilen herumfahren muss. Ich bin auch kein René Lacoste und erst recht kein Rodin oder Gauguin.«
Veronique hatte gelacht und gesagt, dass sie es ja nur gut mit ihm meine. Und dafür liebte er sie. Dafür – und für noch viel mehr.
Allerdings half ihm das jetzt auch nicht gegen die Langeweile, dachte Albin und trank einen Schluck Ti Punch. Natürlich gab es unangenehmere Orte, um sich zu langweilen, klar. Und er langweilte sich ja auch nicht permanent. Sie hatten schon großartige Ausflüge unternommen, waren einkaufen gewesen, hatten einige Orte erkundet, Spaß gehabt – alles schön und gut. Jedoch stellte Albin schlicht und ergreifend Tag für Tag fest, was er ohnehin schon vorher gewusst hatte: dass er für das Strandleben und das süße Nichtstun einfach nicht geschaffen war.
Abgesehen davon fehlte ihm Tyson. Kaum zu glauben, aber als Albins Kollegen ihm den Mops zum Ruhestand geschenkt hatten, damit er in seiner Freizeit etwas zu tun hat, war er sich reichlich veralbert vorgekommen. Er, Albin, der mit seiner Größe und Schulterbreite so gerade durch eine Tür passte, und dann dieser kleine Hund mit dauerhaft besorgtem Gesichtsausdruck. Ihn hatte zunächst eher eine Art Hassliebe mit dem Tier verbunden, aber das hatte sich rasch geändert. Albin hatte sich sogar einen SUV gekauft, weil er der Meinung war, dass man als Hundebesitzer ein geländegängiges Fahrzeug mit viel Laderaum besitzen sollte. Das hatte sich als falsch erwiesen, denn SUVs waren recht groß und hoch und Möpse eher klein und kaum in der Lage, selbständig in den Kofferraum zu springen.
Tyson war im Lauf der Zeit zu einem Gefährten geworden, zu einem Freund, mit dem Albin seine Überlegungen teilte und der darauf sogar antwortete. Also: Natürlich tat er das nicht wirklich. Tyson war bloß ein Hund. Es war eher ein Dialog mit sich selbst – wenngleich Albin oft das Gefühl hatte, dass Tyson ihn verstand oder zumindest in der Lage war, menschliche Signale aufzufangen und darauf zu reagieren.
Jedenfalls war Tyson nicht hier. Albin hatte ihm den langen Flug nicht zumuten wollen und auch nicht das Klima. Zunächst hatte sich seine Tochter Manon um Tyson kümmern wollen, und Clara war ganz Feuer und Flamme gewesen. Aber dann hatte Castels Lebensgefährte Jean Villeneuve angeboten, Tyson in Pension zu nehmen. Er besaß bereits einen Mops – genauer gesagt: eine schwarze Möpsin namens Mila. Er nahm sie meist mit zur Arbeit ins Musée Granet in Aix-en-Provence, wo er als Kurator arbeitete. Außerdem habe Mila dann Gesellschaft und Tyson ebenfalls. Schließlich hatte sich das Angebot als die praktikabelste aller Lösungen erwiesen – wenngleich Albin einen Vorbehalt hatte: Er wusste, dass Tyson ein Auge auf Mila geworfen hatte.
Gelegentlich erkundigte sich Albin nach seinem Hund. Zum Beispiel heute morgen, aber Castel hatte nicht auf seine WhatsApp reagiert. Auch nicht auf die nächsten fünf.
Albin trank noch einen Schluck. Dann zog er mit der freien Hand das Handy aus der vorderen Eingrifftasche seiner Badeshorts und wählte Castels Nummer. Vielleicht war sie jetzt erreichbar. Auf Martinique war es später Vormittag. Fünf Stunden Zeitunterschied zu Frankreich – das sollte passen.
Es dauerte ewig, bis sie schließlich dranging.
»Hallo, Albin«, sagte sie. Ihre Stimme klang etwas gehetzt, aber kristallklar, obwohl ein kompletter Ozean zwischen ihnen lag. Die Stimme wurde ins Weltall zu einem Satelliten geworfen und strahlte dann punktgenau zurück auf Albins Handy. Verrückte Technik.
»Castel. Ich benötige aktuelle Informationen über das Wohlbefinden meines Hundes.«
»Sie haben doch gestern und vorgestern schon geschrieben und angerufen …«
»… und Sie haben heute mehrere meiner Nachrichten ignoriert. Also, was ist da los?«
»Es ist gar nichts los, und Tyson geht es gut. Immer noch.«
»Er hält sich weiterhin von Ihrem Mopsluder Mila fern?«
»Also wirklich, Albin, Sie rufen mich deswegen an?«
Albin kommentierte das nicht. Aber: Ja. Natürlich. Denn die beiden Tiere waren nicht kastriert, weswegen er Castel und ihrem Freund Jean Villeneuve die Zusage abgerungen hatte, ein besonderes Auge auf die beiden zu haben – nicht, dass da hinter Albins Rücken frivole Dinge vor sich gingen, und dann stand man plötzlich da mit zwei Handvoll Welpen und wusste nicht, wohin damit.
»Außerdem«, sagte Castel, »bin ich gerade beschäftigt, und Sie sind im Urlaub, und …«
»Womit denn beschäftigt?«, fragte Albin.
Er hörte Castels Seufzen. »Sie sind in den Flitterwochen, Mensch.«
»Das weiß ich selbst.«
»Genießen Sie die Ruhe, und …«
»Castel. Ich höre es an Ihrem Tonfall und daran, dass Sie sich herauswinden wie ein Aal. Irgendetwas ist da los, richtig?«
Castel schwieg einen Moment. Schließlich erklärte sie: »Wir sind gerade an einem möglichen Tatort. Ein Radfahrer wurde erschossen.«
»Ach«, erwiderte Albin und trank einen großen Schluck Ti Punch. Das Zeug begann langsam zu wirken – vor allem, wenn man mitten in der prallen Sonne stand. »Wo?«
»Auf dem Weg zwischen Mormoiron und Saint-Pierre. Das Opfer ist ein Gaspard Lacroix. Wie es aussieht, wurde er aus dem Hinterhalt mit einem Gewehr erschossen, während er sich auf einer Radtour befand.«
Albin dachte nach. Irgendetwas klingelte bei dem Namen.
»Lacroix«, sagte Castel, »war früher Polizist. Er war im Ruhestand.«
»Gaspard Lacroix aus Avignon? Von der Police Municipale? Wohnt in Carpentras?«
»Aber ja, genau dieser Gaspard Lacroix. Sie kannten ihn? Wen kennen Sie eigentlich nicht?«
»Kennen wäre zu viel gesagt. Ich weiß, wer er ist. Man lief sich dann und wann im Einsatz über den Weg, hat sich auf dem Markt freundlich gegrüßt. Als Sie noch am Daumen lutschten, fing er schon Verbrecher. Er war ein leidenschaftlicher Radfahrer. Ich habe ihn einige Male mit dem Auto überholt. Er saß auf dem Sattel, wann immer er konnte. Ein Schuss aus dem Hinterhalt?«
»Richtig. Ein Kopfschuss aus einer Entfernung von rund hundert Metern, schätzen wir.«
»Während er fuhr?«
»Ja. Sieht so aus.«
»Allein?«
»Es scheint so. Aber ich muss jetzt Schluss machen. Und Tyson geht es immer noch gut, keine Sorge.«
»Ich bin in zwei Tagen zurück. Ihr müsst überprüfen, ob es Personen aus Lacroix’ Vergangenheit gibt, die möglicherweise noch eine Rechnung mit ihm offen haben. Ein Schuss aus dieser Distanz auf ein sich bewegendes Ziel spricht außerdem für einen Schützen mit Erfahrung. Vielleicht ein Jäger.«
»Albin …«
»Er muss Lacroix’ Gewohnheiten gekannt oder studiert haben …«
»… Albin …«
»… und es ist verwunderlich, denn er hätte Lacroix auch einfacher aus dem Weg räumen können. Das muss man nicht aus hundert Metern Entfernung tun, während er radelt. Warum würde sich jemand eine solche Mühe machen, jemanden zu töten? War es nur ein Schuss? Waren es mehrere?«
»Albin! Es reicht jetzt! Wir wissen das alles sehr gut selbst – und Sie sind jetzt, bitte schön, im Urlaub! Ich hätte es Ihnen gar nicht erzählen sollen, ich Idiotin! Sie sind unverbesserlich!«
»Sind Sie nicht.«
»Ich rede von Ihnen!«
»Und ich von Ihnen. Sie sind keine Idiotin. Sie sind gelegentlich mal eine Zimperliese, aber das ist auch alles.«
Castel gab ein genervtes Geräusch von sich. »Schönen Urlaub noch«, fauchte sie und beendete das Gespräch.
Albin steckte das Handy wieder ein, leerte das Glas und sog einen Eiswürfel in den Mund, den er mit der Zunge hin und her bewegte. Gaspard Lacroix, da schau an. Albin trat aus dem Wasser und fühlte sich leicht beschwipst. Noch einen Cocktail sollte er besser nicht trinken.
Er nahm Anlauf und hastete über den kochend heißen Sand, bis er die Liegen unter den Sonnenschirmen erreichte – das Leclerc-Lager. Rasch setzte er sich hin und hob die Füße an. Veronique, die in der prallen Sonne lag, legte ihr Buch beiseite und lachte.
»Du solltest dich mal sehen, wenn du so über den Sand läufst. Als würdest du auf rohen Eiern gehen.«
»Würden da rohe Eier liegen«, sagte Albin und wischte sich den Sand von den Zehen, »dann wären die längst gekocht.«
»Warum ziehst du keine Schlappen an?«
»Vergessen.«
»Mit wem hast du telefoniert?«
»Das hast du gesehen?«, fragte Albin und legte sich auf die Liege.
»Wenn ein fast zwei Meter großer Mann in nur zehn Metern Entfernung im Meer vor einem in der direkten Sichtachse steht, kann das passieren, Albin.«
»Castel war dran. Sie haben einen Mordfall.«
»Oh?«, machte Veronique.
Albin berichtete ihr, was er erfahren hatte.
Veronique fragte: »Wie furchtbar. Und deswegen ruft sie dich in den Flitterwochen an und bittet um Rat?«
»Nein. Ich habe sie angerufen und nach Tyson gefragt.«
»Aber dem geht es doch gut. Du hast sie doch gestern schon deswegen gelöchert.«
»Ich weiß«, sagte Albin, streckte sich aus, schloss die Augen und genoss das leichte Gefühl von Schwindel, die Wirkung der beiden Gläser Ti Punch. »Aber es hätte sich von gestern auf heute eine Veränderung von Tysons Situation ergeben können.«
Veronique grinste und schüttelte den Kopf. Dann nahm sie sich wieder ihren Krimi vor und las zwei Seiten.
»Vielleicht«, sagte sie schließlich, ohne von dem Buch aufzublicken, »ist der Scharfschütze ein Serienmörder und steht in keinerlei Verbindung zum Opfer. In jedem Fall hat das Motiv nichts mit dem zu tun, von dem ihr zunächst annehmt, es sei das Richtige.«
Albin schlug die Augen auf. »Was?«, fragte er. »Wie kommst du denn darauf?«
Veronique blätterte um und zuckte mit den Schultern. »Weil es doch meistens so ist. Außerdem hinterlassen Täter immer Spuren. Kein Mensch ist ohne Schatten.«
»Bitte?« Albin setzte sich auf.
»Sagt Kommissar Kurt Wallander. Der muss es ja wissen, nicht?«
Albin schlüpfte in seine Schlappen und stand auf.
»Wohin gehst du?«, fragte Veronique.
»Zur Bar«, erwiderte Albin.
Meine Frau, die schwedische Profilerin, dachte Albin. Er brauchte dringend einen weiteren Ti Punch.
4
Am nächsten Morgen saßen Theroux und Castel schon früh im Büro vor den Computern. Theroux hatte bereits drei Kaffee intus, wirkte aber immer noch müde. Die Sonne schien unerbittlich durch das Fenster. Castel hatte die Standklimaanlage eingeschaltet. Es würde ein weiterer heißer Tag werden.
Sie blähte die Backen und atmete tief durch, während sie mit dem Drehstuhl etwas zurückrollte und die Arme hinterm Kopf verschränkte. Sie und Theroux waren die Listen durchgegangen, die sie von den Kollegen aus Avignon erhalten hatten. Sie zeigten an, mit welchen Fällen Gaspard Lacroix in den Jahren vor seiner Pensionierung befasst gewesen war – es waren Hunderte, aber alles Kleinkram. Bei der Police Municipale, der Stadtpolizei von Avignon, war er mit Diebstählen, Verkehrssündern, Unfällen, Schlägereien, Alkoholkontrollen, Zwangseinweisungen und ähnlichen Delikten befasst gewesen. Im Prinzip konnte hier jeder Beteiligte in Betracht dafür kommen, mit Lacroix noch eine Rechnung offenzuhaben. Eine Sisyphusarbeit.
Beide merkten auf, als sich die Tür öffnete und Claude Montfavet eintrat, der massige Chef de Police. Er trug seine randlose Brille auf der Nasenspitze, ein hellblaues Kurzarmhemd und außerdem eine rote Pappkladde unterm Arm. Montfavet sagte nie viel. Meist nur das Allernötigste.
»Schönen Gruß von Staatsanwalt Luc Bonnieux. Er erwartet so schnell wie möglich Ergebnisse, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen kann.«
Theroux schnaufte. »Der fehlt uns noch.«
»Ein Expolizist wurde getötet – was erwartet ihr?«, erwiderte Montfavet, zuckte mit den Schultern und warf die Kladde auf Castels Schreibtisch. »Beschusstest.«
»So schnell?«, fragte Castel. Normalerweise konnte das Tage dauern.
Wieder zuckte Montfavet mit den Schultern.
Castel schlug die Mappe auf und überflog die Ergebnisse. Montfavet erläuterte: »Die Spurensicherung hat drei Projektile vom Kaliber .308 Winchester gefunden. Eines davon traf. Die Kugeln fanden sich im Abstand von rund fünfunddreißig Metern. Wenn Lacroix mit einer Geschwindigkeit von zirka zwanzig Stundenkilometern fuhr und in Anbetracht des wahrscheinlichen Winkels, bedeutet es hochgerechnet, dass die Schüsse innerhalb von sechs bis acht Sekunden abgefeuert wurden. Also recht schnell nacheinander. Das .308 ist eines der am weitesten verbreiteten Jagdkaliber. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem verwendeten Gewehr um eine Bergara B14 – eine ebenfalls nicht seltene Mischung aus Jagd- und Sportgewehr. Es gibt unterschiedliche Typen der Waffe. Genaueres bekommen wir noch.«
Castel schloss die Mappe.
Theroux dachte nach. »Wenn drei Schüsse abgefeuert wurden«, sagte er, »dann spricht das nicht unbedingt für einen geübten Schützen. Beim Schießen auf ein mobiles Ziel muss man das Fernrohr entsprechend einstellen. Dabei hat der Schütze etwas nicht richtig gemacht. Außerdem war es riskant, denn er musste damit rechnen, dass der erste Schuss nicht trifft – beziehungsweise in Kauf nehmen, dass Lacroix bloß verletzt wird und auf die Straße stürzt. Dann hätte er aber nicht mehr nachsetzen können, oder? Aus dem etwas abschüssigen Weinfeld heraus wäre der Winkel dann zu flach gewesen und wahrscheinlich der Randbewuchs der Straße im Weg. Entweder hatte er das nicht ins Kalkül gezogen – oder er ging in jedem Fall davon aus, dass er Lacroix voll erwischen wird. Eine solche Selbstsicherheit würde wiederum für einen geübten Schützen sprechen, der sich etwas zutraut, aber vielleicht einfach aus der Übung ist. In jedem Fall können wir ausschließen, dass es sich um einen Jagdunfall oder einen Querschläger gehandelt hat. Die drei Geschosse wurden gezielt abgefeuert. Lacroix sollte sterben.«
»Nicht schlecht für einen übermüdeten Mann«, meinte Castel und lächelte.
»Also«, fragte Montfavet, »wir konzentrieren uns nach wie vor auf einen Täter aus Lacroix’ polizeilicher Vergangenheit?«
»Es gibt ungefähr zweitausend Personen, die in Frage kommen könnten«, antwortete Castel. »Wenn nicht mehr: vom Parksünder bis zum Verbrecher. Wir müssten uns jeden Einzelfall ansehen.«
Montfavet nickte. »Die aus Avignon sollen bei der Durchsicht helfen. Was sagt die Ehefrau?«
Castel verzog das Gesicht und erklärte es Montfavet. Als sie und Theroux gestern mit Louise Lacroix darüber sprechen wollten, ob ihr Mann Feinde gehabt hatte, ob irgendjemand ihm gedroht hatte, war sie im Schock über den Tod ihres Mannes nicht ansprechbar gewesen. Eine Nachbarin war gekommen, Familienangehörige, auch der Notarzt. Deswegen wollten sie heute noch einmal vorbeifahren – genau genommen: jetzt gleich.
»Dann halte ich euch nicht auf«, sagte Montfavet und wandte sich zur Tür. »Und nicht vergessen: Bonnieux braucht irgendetwas. Egal was. Hauptsache, er kann vor die Kameras treten.«
»Wenn’s nichts Wichtigeres gibt«, stöhnte Theroux, stand auf und nahm seinen Kram.
»Nein«, sagte Montfavet und schloss die Tür. »Wichtigeres gibt’s nicht.«
5
Castel und Theroux parkten am Ende des Chemin du Martinet in einer Art Wendehammer, der lediglich mit Kies bestreut war und an dem ein paar Abfallcontainer standen. Die Straße bis dorthin war sehr schlecht und sehr eng. Es passten kaum zwei Fahrzeuge aneinander vorbei. Eine äußerst ruhige Wohngegend mit großen, in der Regel umzäunten Grundstücken. Sie stiegen aus und gingen auf das Tor zu, das zum Haus der Lacroix’ führte.
Der angrenzende Zaun des Nachbargrundstücks wirkte neu und professioneller als der grüne Maschendraht, der das Gelände der Lacroix’ einfasste. Schilder mit der Aufschrift »Défense d’entrer« wiesen darauf hin, dass der Besitzer keinen Wert auf ungebetene Gäste legte – nicht, dass irgendjemand das fast mannshohe Hindernis ohne Hilfsmittel überqueren könnte. Fehlte nur noch Stacheldraht. Auf der anderen Seite arbeitete jemand mit einer elektrischen Heckenschere und stellte das Gerät ab, als Castel und Theroux gerade am Tor klingeln wollten.
»Wer sind Sie?«, schnarrte eine Stimme aus dem Gebüsch, ohne dass jemand zu sehen war.