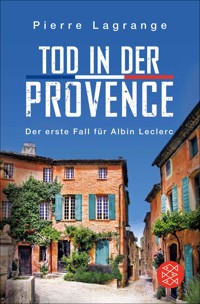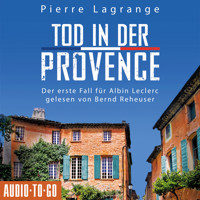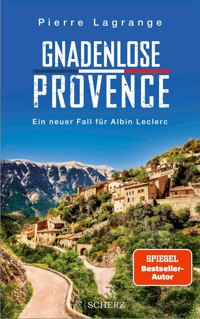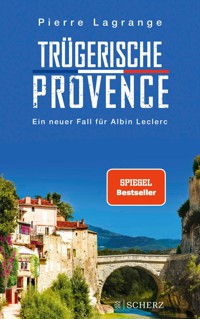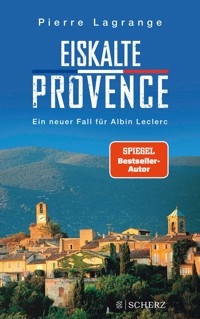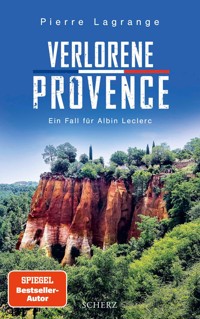Mörderische Provence / Schatten der Provence – Zwei Fälle für Commissaire Albin Leclerc in einem Band E-Book
Pierre Lagrange
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Commissaire Leclerc
- Sprache: Deutsch
Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence. Entdecken Sie zwei spannende Kriminalfälle von SPIEGEL-Bestsellerautor Pierre Lagrange Mörderische Provence (Commissaire Albin Leclerc 3): Commissaire Albin Leclerc bekommt einen Anruf: Ein alter Freund bittet ihn um Hilfe, denn seine Tochter ist verschwunden. Gemeinsam mit seinem Mops Tyson begibt sich Albin auf Spurensuche. Die Ermittlungen führen ihn zu einem provenzalischen Schlosshotel, wo er undercover einem fiesen Komplott auf die Schliche kommt. Bald schon hat er eine heiße Spur und macht eine grauenhafte Entdeckung … Schatten der Provence (Commissaire Albin Leclerc 4): Kurz vor Carpentras geht ein Überfall auf einen Kunsttransport mit wertvollen Gemälden schief. Im Versteck der Räuber entdeckt die Polizei einen unbekannten Cézanne und einen Van Gogh. Alles weist darauf hin, dass sie aus einem geheimen Depot mit Nazi-Raubkunst stammen. Mit seinem Mops Tyson mischt Ex-Commissaire Albin Leclerc sich in die Ermittlungen ein – und ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Doch als es Tote gibt, gerät Albin selbst ins Visier der Täter. Plötzlich geht es für ihn um Leben und Tod …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 896
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Pierre Lagrange
Mörderische Provence / Schatten der Provence
Zwei Fälle für Commissaire Albin Leclerc in einem Band
Sammelband
Über dieses Buch
Commissaire Albin Leclerc ermittelt in der Provence. Entdecken Sie zwei spannende Kriminalfälle von SPIEGEL-Bestsellerautor Pierre Lagrange
Mörderische Provence (Commissaire Albin Leclerc 3): Commissaire Albin Leclerc bekommt einen Anruf: Ein alter Freund bittet ihn um Hilfe, denn seine Tochter ist verschwunden. Gemeinsam mit seinem Mops Tyson begibt sich Albin auf Spurensuche. Die Ermittlungen führen ihn zu einem provenzalischen Schlosshotel, wo er undercover einem fiesen Komplott auf die Schliche kommt. Bald schon hat er eine heiße Spur und macht eine grauenhafte Entdeckung …
Schatten der Provence (Commissaire Albin Leclerc 4): Kurz vor Carpentras geht ein Überfall auf einen Kunsttransport mit wertvollen Gemälden schief. Im Versteck der Räuber entdeckt die Polizei einen unbekannten Cézanne und einen Van Gogh. Alles weist darauf hin, dass sie aus einem geheimen Depot mit Nazi-Raubkunst stammen. Mit seinem Mops Tyson mischt Ex-Commissaire Albin Leclerc sich in die Ermittlungen ein – und ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Doch als es Tote gibt, gerät Albin selbst ins Visier der Täter. Plötzlich geht es für ihn um Leben und Tod …
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Pierre Lagrange ist das Pseudonym eines bekannten deutschen Autors, der bereits zahlreiche Krimis und Thriller veröffentlicht hat. In der Gegend von Avignon führte seine Mutter ein kleines Hotel auf einem alten Landgut, das berühmt für seine provenzalische Küche war. Vor dieser malerischen Kulisse lässt der Autor seinen liebenswerten Commissaire Albin Leclerc gemeinsam mit seinem Mops Tyson ermitteln.
Inhalt
Buch 1 Mörderische Provence
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
Buch 2 Schatten der Provence
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
Leseprobe des fünften Bandes
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
Pierre Lagrange
Mörderische Provence
1
Ryan Grévais goss etwas Weißwein in ein Glas und dachte über die Frauen nach, die er gerne töten würde. Er erinnerte sich außerdem an die, die bereits in Fässern voller Säure aufgelöst worden waren. Ihm war etwas nostalgisch und melancholisch zumute, eine merkwürdige Stimmung an einem so schönen Tag wie heute. Er stellte die Flasche zurück in den großen amerikanischen Kühlschrank, nahm einige Eiswürfel aus dem Gefrierfach, gab sie in das Glas und schlüpfte aus seinem blauen Zweireiher mit den goldenen Knöpfen. Er warf ihn im Gehen mit einer Bewegung aus dem Handgelenk über eines der Ledersofas im Wohnzimmer der altehrwürdigen Villa, sah sich selbst im Spiegel im Foyer und schmunzelte amüsiert, als er die Treppe hinaufging. Ohne das Sakko sah er aus wie ein Arzt. Wie ein Schönheitschirurg, so ganz in Weiß mit dem weit aufgeknöpften Hemd, der gesunden, gebräunten Haut darunter und dem Brusthaar in der Farbe von Asche.
Nahezu lautlos bewegte er sich in den Wildlederslippern über den flauschigen Teppich im oberen Stockwerk, roch den Duft der Lilien, die in eleganten, schlanken Vasen steckten. Der schwere Siegelring kratzte über das beschlagene Kristallglas, als er sich im Arbeitszimmer setzte und beschloss, seine Stimmung ein wenig zu heben. Er klappte den Laptop auf, der auf einem schweren Jugendstilsekretär stand, und öffnete die Website eines namhaften Unterwäscheherstellers. Seine Hände waren feucht und kalt. Er klickte sich durch die Galerie und blieb am Bild eines ausgesucht hübschen Models hängen, vergrößerte es etwas und fragte sich, wie lange das Mädchen es wohl aushalten würde, wenn er mit einem Akkuschrauber ihren Fußknöchel bearbeitete oder die Wirbel des Rückgrats. Sicher nicht besonders lange. Das taten die wenigsten. Nur die wirklich Guten schafften das für eine Weile – die mit starkem Charakter und unbedingtem Willen zum Überleben. Dieser Wille ließ sich unter den Schmerzen jedoch meist recht schnell brechen. Dann jammerten und wimmerten sie und flehten darum, dass es schnell vorbei wäre und man sie endlich umbringen möge.
Daran war Grévais aber nicht gelegen. Er ließ sich gerne Zeit, und dazu war erstklassiges Material erforderlich. Denn wenn sie so schnell einknickten und sich selbst aufgaben – das verdarb doch den Spaß und außerdem alle Mühe, die man sich machte. Was hatte man von einem Boxkampf, der schon nach einer Runde beendet war? Was genau war das Vergnügen am Betrachten von nicht einmal zehn Sekunden dauernden Hundertmeterläufen? Nein, Grévais empfand sich in dieser Hinsicht eher als Marathonmann, der im Ring stets über die volle Rundenzahl ging.
Er kam zu dem Schluss, dass die kalifornische Schönheit auf dem Foto schon nach einigen Minuten aufgeben würde. Sie wirkte zu zerbrechlich, obwohl ihre Kurven sie üppig erscheinen ließen. Ihr Blick war aufgesetzt und nur für die Kamera selbstbewusst und herausfordernd. Was jenseits davon lag, sagte Grévais, dass sie bereits kriechen und heulen würde, wenn man bloß mit der Bohrmaschine vor ihren Augen herumfuchtelte, ein paarmal den Elektromotor aufheulen ließ und ihr skizzierte, was man mit einem Rasiermesser und ihrem Gesicht so alles anstellen könnte. Wobei an Kriechen und Heulen nichts verkehrt war. Zeigt ihnen die Instrumente, hieß es, und genießt die Vorfreude.
Er nippte an seinem Glas und warf einen Blick aus dem offen stehenden Fenster, strich sich mit zittrigen Fingern durch das graumelierte Haar. Es war ein strahlender Tag. Licht flutete wie flüssiges Gold in das Zimmer. Langsam senkte sich der Abend über das Land. Die blaue Stunde war nicht mehr fern. Draußen im Garten bereiteten die Kinder und Yvonne das Barbecue vor. Ein paar Geschäftspartner würden erscheinen, außerdem Freunde wie die Briards, Clément Baladier von Baladier International mit seiner Entourage sowie Lina Cloutenier, die Erbin des Textilimperiums. Vermutlich würde sie wieder einen ihrer marokkanischen Toyboys mitbringen und als persönlichen Assistenten oder Chauffeur vorstellen.
Grévais hörte die Rufe von Yvonne, die Anweisungen gab, wo welche Tischdecken zu platzieren seien und an welchen Stellen sie Kerzen wünschte und an welchen nicht. Er lächelte. Er war ein glücklicher und sehr reicher Mann. Wenn da nur nicht dieser entsetzliche Druck in seinem Kopf wäre und dieser unkontrollierbare Drang, den niemand außer ihm verstehen würde. Dabei war es im Grunde so einfach: Jede Form von Druck provozierte eine Reaktion. Presste man hinten auf eine Zahnpastatube, kam vorne Zahnpasta heraus. Ließ man hingegen den Schraubverschluss zu und trat auf die Tube, platzte sie auf. Ähnlich verhielt es sich bei Menschen. Grévais trug in seinem Job bei der Bank enorme Verantwortung und hatte außerdem diese, na ja, diese sehr besonderen und sehr prägenden Erlebnisse in seiner Vergangenheit gemacht. Daher war es besser für alle, wenn er von Zeit zu Zeit Druck abließ und seinen speziellen Bedürfnissen nachgab. Ansonsten würde er früher oder später wie eine Autobombe explodieren und alles in seiner Nähe zerfetzen.
Grévais wandte sich wieder dem Laptop zu. Er trocknete sich die schmalen Hände mit den manikürten Fingernägeln an der hellen Leinenhose und klickte die Galerie mit den Unterwäsche-Mädchen weg.
Stattdessen öffnete er eine andere Website, die deutlich versteckter war, und wechselte auf eine mit mehreren Firewalls abgesicherte Leitung. Sie verband ihn mit einem Darknet-Server. Dorthin gelangte nur, wer vorher eine persönliche Einladung erhalten hatte und wer sich außerdem überprüfen ließ, um akzeptiert zu werden und die notwendigen Passwörter zu erhalten.
Auf der Website, die wie ein Forum gestaltet war, suchte Grévais nach einem bestimmten Verzeichnis und schaute sich dann einige kurze Filmclips an, um seine Stimmung weiter zu heben. Die Videos waren in einem karg eingerichteten Raum aufgenommen worden. Einige Stühle, deren roter Samtbezug in einem geradezu obszönen Kontrast zu dem sehr schäbigen Zimmer stand, waren im Kreis aufgebaut und mit Beobachtern besetzt, deren Gesichter im Halbdunkel verborgen waren. Die meisten trugen Anzüge. In der Mitte des Kreises baumelte der von einem Spot beleuchtete nackte Körper einer Dunkelhäutigen. An den Handgelenken befand sich ein Strick, dessen anderes Ende an einem Fleischerhaken unter der Decke verknotet war. Ein sehr schlanker Mann, der eine schwarze Ledermaske trug, ging um die Frau herum und schlug dann und wann mit einem Rohrstock auf sie ein, was sie zum Schreien brachte. Die Zuschauer beugten sich interessiert vor. Einige schienen zu lächeln. Lust und Schmerz, dachte Grévais, kann ja so nahe beieinanderliegen. Und die Macht über beides war wie süßer Nektar, übertroffen nur noch davon, zwischen Leben und Tod zu entscheiden. Eine Entscheidung, die – wie Grévais wusste – auf den weiteren Filmausschnitten getroffen wurde und nicht zugunsten der Farbigen ausging.
»Ryan, kommst du endlich!«, hörte er die Stimme von Yvonne aus dem Garten.
Grévais keuchte. Sein Puls raste auf einmal heftig. Die Brust verengte sich, als würde sie von einem Schraubstock zerquetscht. Er schnappte nach Luft und riss die Augen weit auf. Starrte auf die Bilder an den Wänden. Die Gemälde von der Provence. Die afrikanischen Masken. Er rang nach Luft und zählte rückwärts von zehn bis eins, um sich wieder zu beruhigen.
Er wischte sich ein weiteres Mal die Hände an der Hosennaht trocken und klickte sich zurück auf die Foren-Oberfläche. Ihm fiel das Symbol für den Newsletter auf, der ankündigte, dass es in Kürze einige neue und sehr besondere Angebote geben würde. Das klang vielversprechend, dachte Grévais. Geradezu aufregend, und hoffentlich würde es nicht allzu lange dauern, denn er musste unbedingt etwas tun. Wirklich äußerst dringend.
Schließlich schloss er die Website und kappte die Verbindung ins Darknet. Er loggte sich aus, klappte den Laptop lächelnd zu und ging runter in den Garten. Die Gäste würden bald kommen – und sich fraglos alle darüber wundern, warum Ryan Grévais so unverschämt gutgelaunt war.
2
Sommer in der Provence. Sommer in Gordes. Die Gastronomie glühte wie das ganze Land. Und Isabelle Lefebvre hatte das Gefühl, hier im Les Cuisine du Château am Place Genty Pantaly direkt gegenüber der Festung im Zentrum des Vulkans zu stehen, als sie die letzte Rechnung des Abends kassierte. Es waren Ferien. Der Laden brummte wie der Teufel, was auch für die anderen Restaurants des kleinen Ortes galt, dessen alte Häuser wie Schwalbennester auf einen großen Felsen der Monts de Vaucluse gepfropft worden waren und sich um die massive Festung aus dem Jahr 1031 gruppierten. Die Gassen waren eng, die Hitze des Tages staute sich dort bis nach Mitternacht. Tagsüber waren sie von Touristen angefüllt, die außer den Restaurants die Galerien frequentierten, von denen es hier traditionsgemäß viele gab: Marc Chagall hatte in Gordes gelebt, Victor Vasarely und andere. Das hatte einige Spuren hinterlassen.
Davon abgesehen, gab es in unmittelbarer Nähe viele Sehenswürdigkeiten wie das Zisterzienserkloster Abbaye de Sénanque mit seinen Lavendelfeldern, die noch heute von Mönchen bewirtschaftet wurden, deren gregorianischen Gesängen man zur Mittagszeit lauschen konnte. In der Gegend befanden sich zudem exklusive private Landsitze mit Swimmingpools, Fünf-Sterne-Ferienhäuser und die Bories – merkwürdige Häuschen, die wie aus grauen Steinen gebaute Iglus aussahen und bei denen es sich wohl um saisonale Unterkünfte der Landbevölkerung handelte.
Und mittendrin im Auge des Hurrikans das Les Cuisines du Château, dessen letzte Gäste nun gingen und Isabelle ein ordentliches Trinkgeld gaben.
Sie hatte gefühlte fünfhundert Portionen Foie Gras, Rinderfilet mit Roquefortsauce, Seebarsch aus dem Ofen und Tartes Tatin serviert. Dabei war das Les Cuisines eher klein – ein überschaubares Eckrestaurant mit weinroten Markisen, hölzernen Fensterläden in derselben Farbe und einer hübschen Außenterrasse, auf der ebenfalls weinrote Stühle an kleinen Bistrotischen standen. Wenn allerdings alle davon besetzt und nur zwei Bedienungen draußen im Einsatz waren – so wie heute –, dann schien es, als sei der Laden doppelt oder dreimal so groß.
Weswegen Isabelle völlig erschlagen war. Sagte man nicht, dass es Anfang dreißig bergab ging? Dann war sie voll auf der Talfahrt nach diesem Tag, denn auch wenn sie bequeme Sneakers und nur ein Tanktop getragen sowie sich zwischendurch immer wieder mit Deo aufgefrischt hatte: Ihre Füße taten weh, und sie war durchgeschwitzt. Sie räumte die letzten Teller ab und schlängelte sich durch das enge Innere, wo die Holzbalken an der Decke so weiß gestrichen waren wie das große alte Regal an der Wand, in dessen mit kleinen Kreidetäfelchen ausgezeichneten Fächern jede Menge Weinflaschen standen, als handle es sich um Ausstellungsobjekte.
»Ich kann nicht mehr«, keuchte sie zu Matthieu, der gerade die Abrechnung machte. Sie öffnete ihren Pferdeschwanz und fuhr sich durch das kastanienbraune Haar. Zu Hause würde sie ausgiebig duschen – und dann einfach umfallen.
Matthieu nickte müde. »Was für ein Tag«, sagte er. »Mach Schluss, Isa.«
Was sie sich nicht zweimal sagen ließ. Sie griff nach dem kleinen Rucksack mit ihren Sachen, verließ das Restaurant und machte sich auf den Weg um die hohe Mauer der Festungsanlage herum zu ihrem Auto. Die Straßen und Gassen des Ortes waren menschenleer.
Schon nach ein paar Schritten an der kühlen Luft fühlte sich Isabelle erfrischt, obwohl ihre Beine schmerzten wie nach einem Marathon. Seit sie sich vor drei Jahren von Georges getrennt hatte, war sie Single und hatte nach dem Studium der Kunstgeschichte ein Anschlussstudium in Aix-en-Provence aufgenommen. Sie jobbte als Führerin im Papstpalast in Avignon und als Kellnerin im Les Cuisines. Das reichte aus, um klarzukommen. Für Privates blieb da keine Luft mehr, und nach der Geschichte mit Georges, der sie wegen einer jüngeren Frau verlassen hatte, hatte sie sowieso die Nase gestrichen voll von Beziehungen. War man mit dreißig Jahren etwa schon so alt, dass man sich gegen eine Zwanzigjährige austauschen lassen musste? Nein, die Kerle konnten Isabelle vorerst gestohlen bleiben.
Natürlich gefiel dieses lockere und etwas unstete Leben ihrem Papa überhaupt nicht. Er sagte das nie direkt, das war nicht seine Art. Doch er stellte sich für seine einzige Tochter schon etwas anderes vor als das Leben einer Dauerstudentin, die sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser hielt. Er wünschte sich fraglos, dass sie in ihrem Alter endlich auf eine gerade Spur gelangte und in ruhigeres Fahrwasser kam – in ihrem Alter … Und er hätte es auch lieber, wenn es einen anständigen Mann an ihrer Seite gäbe. Tja, wie das bei Vätern immer so ist: Erst wollen sie, dass niemand ihre Prinzessin auch nur ansieht, und hinterher fürchten sie, dass keiner sie mehr will.
Isabelle stellte den Rucksack auf den Beifahrersitz und ließ den Wagen an. Sie legte den ersten Gang ein und gab Gas. Sie fuhr durch die schmale Rue de la Combe und ließ die Seitenfenster herab. Die Fassaden der alten Häuser warfen das Röhren des kleinen Motors zurück. Aus den Boxen des Autoradios klang ein altes Lied von Radiohead: »Creep« – einer ihrer Lieblingssongs. Sie stellte die Musik lauter und steuerte mit nur einer Hand am Lenkrad durch die enge Nadelkurve am Ausgang des Ortes, in der das blaugekachelte Objekt von Victor Vasarely stand, dem in Gordes einmal ein Museum gewidmet gewesen war. Dann weitete sich der Blick von der Route de Cavaillon aus. In der hügeligen Landschaft ging es hier steil hinab auf die vom Mondlicht erfüllte Ebene unterhalb von Gordes, über der ein sternenklarer Himmel schien.
Isabelle bog nach rechts ab, wo ein Hinweisschild anzeigte, dass es zur Abbaye de Sénanque ging und bis Venasque noch sechzehn Kilometer waren. Schier endlos erscheinende Mauern, die aus kleinen grauen Steinen aufgeschichtet worden waren, begrenzten die Straße.
Sie reduzierte das Tempo, weil direkt vor ihr ein weißer Lieferwagen fuhr, ein Sprinter oder etwas in der Art. Das fehlte ihr noch. Vermutlich würde der den ganzen Weg durch die engen Serpentinen vor ihr herzuckeln. Ganz großartig, jetzt konnte sie eine halbe Stunde lang auf die schmutzige und verbeulte Flügeltür am Heck des Transporters starren.
Sie befand sich mittlerweile außerhalb jeglicher Bebauung. Rechts, hinter der flachen Steinmauer, gab es nur dichtes Gebüsch, abschüssiges Gelände und Olivenbäume, links nichts als graue Felsen und verbranntes Gras. Die Fahrbahn wurde zunehmend schlechter. Als ein längerer kurvenfreier Abschnitt kam, stieg die Straße an, und der Sprinter wurde langsamer. Der Tacho zeigte nur noch eine Geschwindigkeit von fünfzig Stundenkilometern an.
Isabelle machte ein genervtes Geräusch und scherte leicht nach links aus, um zu prüfen, ob sie überholen konnte. Es sah ganz gut aus. Aber da der Sprinter fast in der Mitte der Fahrbahn fuhr, wäre es zu gefährlich. Sie wollte gerade hupen, um ihn auf sich aufmerksam zu machen, als eine der Hecktüren vor ihr aufsprang.
Isabelle riss erschrocken die Augen auf und umklammerte das Lenkrad. Aber es stürzte ihr keine Ladung entgegen. Stattdessen leuchteten ihre Scheinwerfer wie ein Spot in das panisch verzerrte Gesicht einer Frau, die sich durch den Spalt zu zwängen schien und Isa anstarrte. Ihre Haut war dunkel und glänzte. Es sah aus, als würde etwas an ihren Handgelenken baumeln.
»Gott!«, zischte Isa und dachte: Die wird doch nicht etwa … Sie wird doch nicht …
Die Frau schien Isabelle etwas zuzurufen. Und dann sprang sie aus dem Lieferwagen.
Isabelle sah, wie sie mit den Beinen auf der Fahrbahn aufkam. Isabelle schrie auf und riss das Steuer nach rechts, um dem Körper auszuweichen, der jetzt an ihrem Wagen vorbeiwirbelte. Der Fiat bockte und sprang, als seine Räder am Fahrbahnrand auf die Mauer trafen. Sie spürte einen harten Schlag am Lenkrad. Rechts zweigte eine schmale Straße ab. Der Lieferwagen bremste plötzlich. Die offen stehende Hecktür rasierte Isabelle den Außenspiegel ab. Es gab ein kreischendes Geräusch, als der Fiat an der Mauer entlangraste und Metall auf Stein traf. Dann machte der Wagen einen weiteren Satz, als die Mauer zu Ende war, geriet auf die Abzweigung – und kippte dann auf dem abschüssigen Gelände zur Seite, ohne zum Stillstand zu kommen.
Isabelle wurde wie eine Puppe hin und her geschleudert. Es krachte mehrmals laut unter dem Wagen. Dann stand die Welt Kopf. Äste und Zweige schlugen gegen den Wagen, der sich um seine eigene Achse zu drehen schien. Erneut kreischte Metall. Kunststoff krachte. Die Scheibe zersplitterte. Etwas schlug in Isabelles Gesicht. Der Motor jaulte, zischte und schnaufte.
Dann passierte auf einmal gar nichts mehr. Alles war still.
Einige Momente, Minuten oder Jahre später schreckte Isabelle auf. Ihr Gesicht tat weh, ebenso ihr rechtes Bein, und sie konnte kaum noch atmen. Sie wurde sich ihrer Situation bewusst. Eine Frau war aus dem vor ihr fahrenden Lieferwagen gesprungen. Isabelle war ausgewichen, um sie nicht zu überfahren. Dabei hatte sie einen Unfall gehabt und sich …
… überschlagen!
Sie versuchte, sich zu orientieren, was ihr einigermaßen gelang. Der Fiat schien auf dem Kopf zu liegen und in die dichten Büsche hinabgerutscht zu sein, wo er von Stämmen gehalten wurde. Äste stachen ins Innere. Einer davon musste Isas Wange erwischt haben, die sich feucht und klebrig anfühlte. Der Airbag hatte sich aufgeblasen. Der Sicherheitsgurt schnitt ihr die Luft ab. Sie erstickte sich mit ihrem eigenen Gewicht.
Hektisch suchte Isabelle nach dem roten Knopf an der Arretierung, um den Gurt zu lösen. Sie fand ihn. Der Gurt löste sich, und Isabelle fiel auf das Dach, schlug sich den Kopf an und verkeilte sich halb.
Dann hörte sie Geräusche. Etwas Schweres bahnte sich den Weg durch das Unterholz.
»Hilfe«, wimmerte sie, unfähig, sich aus ihrer Lage zu befreien. Ihre Haut kratzte über Splitter von Verbundglas, die überall verstreut waren. »Hilfe!«
Sie kniff die Augen zusammen, als sie vom Licht einer Taschenlampe geblendet wurde.
»Und jetzt?«, fragte eine tiefe männliche Stimme.
Eine andere wandte sich an Isabelle: »Sind Sie verletzt?«
»Ja«, wimmerte sie. »Bitte, helfen Sie mir …«
»Tja«, sagte die tiefe Stimme wieder und wiederholte: »Und jetzt?«
»Wir können die hier nicht liegen lassen. Sie hat die Schlampe gesehen und den Wagen und alles.«
»Also packen wir sie ein?«
»Ja, wir packen sie mit ein. Den Fiat entdeckt hier eh kein Mensch, so tief, wie der im Gebüsch steckt.«
»Und wenn sie nicht zu gebrauchen ist?«
»Sehen wir dann. Nicht unser Problem.«
Isabelle versuchte angestrengt, sich aus ihrer Position zu befreien. Was ihr nicht gelang. Worüber redeten die da? Was waren das für Typen, um Himmels willen? Und was war das eben für eine Frau gewesen, die aus dem Lieferwagen …
Im nächsten Moment spürte Isabelle, wie kräftige Hände an ihre Fußgelenke fassten, um sie durch die zerborstene Frontscheibe des Fiats unsanft nach draußen zu ziehen.
3
Albin pfiff die Melodie des Liedes mit, das im Küchenradio lief. Es ging darin um irgendetwas, das mit »Happy« zu tun hatte. Das passte zu seiner Stimmung. Albin war heute bestens aufgelegt. Er hatte gut geschlafen, war früh aufgestanden und hatte sich bislang nicht gelangweilt. Stattdessen hatte er ausgiebig an seinem geheimen Plan gefeilt und war wieder und wieder jedes Detail Schritt für Schritt durchgegangen. Denn es kündigten sich spektakuläre Ereignisse an: Er, Albin Leclerc, Commissaire im Unruhestand und Mopsbesitzer, würde das Abendessen kochen.
Auf der Arbeitsplatte lag ein Stück Fleisch. Davor stand Albin mit dem Messer in der Hand. Mensch kontra Bestie. Jäger und Beute. Wie in Hemingways Der alte Mann und das Meer oder Melvilles Moby Dick – mit dem Unterschied, dass es bei Hemingway und Melville jeweils um sehr widerborstige und große Tiere ging und in Albins Fall lediglich um ein mittelgroßes Stück Schweinehüfte, von der keine Gegenwehr zu erwarten war. Er freute sich schon jetzt auf Veroniques überraschtes Gesicht, wenn sie von der Arbeit im Blumenladen heimkommen würde, der Tisch bereits gedeckt und der Braten à la provençale samt mediterranem Gemüse servierfertig war.
Albin hatte sich früher nie etwas aus Essen gemacht und konnte eigentlich gar nicht kochen. Als er noch im aktiven Dienst bei der Kripo in Carpentras gewesen war, hatte er sich vornehmlich von Mikrowellen- und Dosengerichten ernährt. Was Veronique nicht tolerierte. Seit sie in sein Leben getreten war, hatte sich ohnehin so einiges geändert – nicht nur die Ernährung. Jedenfalls war es ihr erklärtes Ziel, Albin beizubringen, wie man ein vernünftiges Essen zubereitete. Sie würde daher völlig von den Socken sein, wenn er sie mit einem ohne jede Unterstützung angefertigten Gericht überraschte.
Tyson, sein Mops, lag auf dem Küchenboden und kaute an einem Knochen. Auch der Hund hatte so einiges in Albins Leben verändert. Nicht, dass sich Albin darum gerissen hätte. Die Kollegen hatten ihm Tyson zum Ruhestand geschenkt, damit er als Pensionär beschäftigt war und niemandem mehr auf den Geist ging. Dass sie ausgerechnet einen Mops für Albin auswählten, der ein normannischer Schrank von fast zwei Metern Größe mit schlohweißem Haar und dem Gesicht eines faltigen Sofakissens war – na ja, sie hatten sich fraglos darüber amüsiert.
Tatsächlich war der kleine Kerl Albin längst ans Herz gewachsen. Er hatte sich sogar einen SUV gekauft, weil man seiner Meinung nach als Hundebesitzer solch ein Auto haben sollte. Wobei sich in der Praxis herausgestellt hatte, dass der Geländewagen viel zu groß war und der Mops immer in den Kofferraum gehoben werden musste, da die Klappe zum Hineinspringen für das kleine Tier zu hoch war.
Tyson war Albins ständiger Begleiter, der nicht mehr von seiner Seite wich. Auch in der Mission Schweinebraten. Er hatte Albin zum Schlachter in der Rue Vigne in Carpentras begleitet – der Boucherie Brunet – und eine Scheibe Wurst ergattert, während Albin die Waren in der Auslage betrachtet hatte wie Schuhe bei Prada und sich versichern ließ, dass das ausgewählte Fleisch von vornehmster Herkunft war und das dem Schlachter persönlich bekannte Schwein sein Leben mehr oder weniger freiwillig hergegeben hatte.
Und nun rieb Albin das Stück Braten mit Salz ein – mit exklusivem Fleur de Sel, das in Albins Vorstellung von einem Weisen der Salzherstellung dem Meer entrissen worden war, in dessen Familie sich das geheime Wissen um die Kunst des Salzschöpfens von Generation zu Generation vererbt hatte. Zumindest war das Salz entsprechend teuer gewesen. Ähnlich verhielt es sich mit dem Pfeffer, der angesichts seines sprichwörtlich gepfefferten Preises vermutlich im Austausch gegen eine Kiste feinster Perlen auf einer Rudergaleere aus Indien nach Madagaskar geschifft und dann von Karawanen durch den Orient nach Frankreich transportiert worden war. Die Kräuter waren hingegen umsonst gewesen. Albin hatte sie selbst gepflückt. Rosmarin und Thymian wuchsen schließlich überall, sogar in seinem Garten.
Schließlich schnitt er das Gemüse klein – Auberginen, Zucchini, Tomaten und einige Paprikaschoten vom Gemüsemann, bei dem Veronique auch immer kaufte. Er legte den Braten in eine Auflaufform und schob ihn in den auf hundertachtzig Grad vorgeheizten Backofen, wo er dann knapp zwei Stunden lang garen sollte. Das Gemüse gab er in eine Pfanne und stellte den Herd an, um es schon einmal anzubraten. Dann müsste er es nur noch aufwärmen, sobald Veronique erschien. Er goss etwas Olivenöl dazu, rührte alles um und wartete, dass die Herdplatte heiß wurde. Dabei stellte er sich mit einem Lächeln auf den Lippen vor, wie Veronique um die Ecke kommen und in der Bewegung erstarren würde, wenn sie Albin jetzt so in der Küche sähe. Sie war etwas jünger als er mit seinen inzwischen sechsundsechzig Jahren, aber nicht viel, und sie war schon Großmutter. Wenngleich man sich das kaum vorstellen konnte. Veronique würde für höchstens Anfang fünfzig durchgehen. Sie trug ihre Haare meist zum Bauernzopf geflochten und dazu eines ihrer geblümten Sommerkleider sowie eine Audrey-Hepburn-Sonnenbrille auf der Nase.
Albin rührte weiter in der Pfanne herum und schaute zu Tyson. Tyson blickte nachdenklich zurück.
»Da schnallst du ab, mein Freund, hm? Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht hinbekomme«, murmelte Albin.
Tyson merkte auf, als Albins Handy klingelte. Albin seufzte, ließ von der Pfanne ab und ging ins Wohnzimmer, wo sein Smartphone lag. Das Display zeigte eine unbekannte Nummer an. Albin ging dran.
Als sich Bertrand Lefebvre meldete, klappte Albin der Unterkiefer herab.
»Lefebvre?«, fragte er. »Du lebst noch?«
»Ja«, antwortete Lefebvre mit einem heiseren Lachen. »Ich boxe mich so durch. Wie geht’s dir, mein Lieber?«
»Meistens gut.«
»Das höre ich gerne«, erwiderte Lefebvre und machte eine Pause.
Wie lange hatten sie nicht mehr miteinander gesprochen? Und sich wann zum letzten Mal gesehen? Es musste sicher zehn Jahre her sein, überlegte Albin. Lefebvre war inzwischen vermutlich ebenfalls im Ruhestand. In jedem Fall war es eine ziemliche Überraschung, ihn wie aus heiterem Himmel am Telefon zu sprechen. Und wenn Lefebvre sich die Mühe machte, Albins Nummer herauszufinden und nach so langer Zeit anzurufen, dann brannte ihm fraglos etwas auf den Nägeln. Was auch immer das wäre: Albin würde sich darum kümmern und ihm alle Aufmerksamkeit widmen, denn er stand tief in Lefebvres Schuld. Der Mann hatte bei Albin nicht nur einen Stein im Brett, sondern einen ganzen Kieslaster. Die Gründe dafür lagen lange zurück.
Albin ging raus auf die Terrasse, wo eine Packung Gitanes und ein Feuerzeug auf dem kleinen Bistrotisch lagen. Normalerweise durfte er nicht einmal hier rauchen. Veronique zwang ihn dazu, es vor der Haustür zu tun. Aber wenn die Katze aus dem Haus war …
Er steckte sich eine an und fragte: »Bist du immer noch bei der freiwilligen Feuerwehr?«
»Seit zwei Jahren im Ruhestand«, erwiderte Lefebvre. »Mit mir können die nichts mehr anfangen.«
Albin paffte eine Wolke Qualm in den Himmel. Er kannte das Gefühl. »Und die Tankstelle?«
»Habe ich verpachtet. Bringt mir ein bisschen zusätzliches Geld zur Rente.«
»Mhm«, brummte Albin, nach wie vor in Gedanken vertieft.
Er erinnerte sich daran, wie sie früher immer bei Lefebvre die Streifenwagen getankt und gewaschen hatten. Wenn es Kleinigkeiten zu reparieren gab, erledigte er das in der angeschlossenen Werkstatt. Aber nachdem die Autos komplizierter geworden waren und hochgezüchteten Computern glichen, war das nicht mehr möglich gewesen. Außerdem hatte die Polizei irgendwann aufgrund von Sparmaßnahmen die Tankstelle gewechselt und war seit einigen Jahren Großkunde bei einer Kette.
»Woher hast du meine Nummer?«, fragte Albin.
»Habe ich von Theroux.« Lefebvre räusperte sich. »Hör mal«, fuhr er fort, »ich will nicht lange herumreden. Ich möchte dich um Hilfe bitten. Ich habe ein Problem.«
»Welches?«, fragte Albin.
»Meine Tochter«, sagte Lefebvre sehr leise, »ist verschwunden.«
»Verdammt«, murmelte Albin. »Was ist passiert?«
»Ich weiß es nicht. Sie kam vor drei Tagen nicht von der Arbeit zurück. Sie kellnert in Gordes. Ich wollte dringend etwas mit ihr besprechen, kann sie aber telefonisch nicht erreichen. Sie erschien auch nicht mehr im Restaurant. Isabelle ist wie vom Erdboden verschluckt.«
»Habt ihr engen Kontakt?«
»Wenig. Wie man so Kontakt zu seiner erwachsenen Tochter hat.«
»Hast du eine Vermisstenmeldung …«
»Natürlich«, kürzte Lefebvre ab. »Aber ich mache mir Sorgen, dass sich die Polizei nicht richtig darum kümmert. Abgesehen davon … Es passiert so viel. Nichts ist mehr wie früher.«
»Ja«, erwiderte Albin.
Er verstand die Befürchtungen. Er wusste, wie viele hundert Vermisstenmeldungen Jahr für Jahr eingingen und wie damit umgegangen wurde – zunächst abwartend und beruhigend, wenn es keinen hinreichenden Verdacht darauf gab, dass eine Straftat vorlag, der Vermisste schwer krank oder suizidgefährdet beziehungsweise minderjährig war oder es irgendwo einen Unfall gegeben haben könnte. Das machte Angehörige verständlicherweise nervös, und sie nahmen schnell an, die Polizei sei faul oder gleichgültig. Aber die Erfahrung zeigte, dass die allermeisten Vermissten rasch wieder auftauchten, und die Gründe ihres Verschwindens klärten sich schnell. Ein spontaner Urlaub, der Besuch von Freunden, ein kurzer Klinikaufenthalt sowie mangelnde Kommunikation darüber – es gab mannigfaltige harmlose Ursachen. Aber natürlich auch sehr ernste.
Albin zog an der Zigarette und entließ den Rauch durch die Nase. Einen ganzen Schwall offenbar, denn er stand regelrecht in einer Qualmwolke.
»Lefebvre«, sagte er. »Die Kollegen tun fraglos, was zu tun ist. Aber wir sollten reden. In Ordnung?«
»Ja. Danke.«
Albin beendete das Gespräch, nachdem sie den Treffpunkt und eine Zeit am Abend vereinbart hatten, paffte, und während er sich noch dichter einnebelte, dachte er nach. Er konnte sehr gut nachvollziehen, wie Lefebvre sich fühlte. Die Angst eines Vaters um seine Tochter. Das verstand man wirklich nur dann, wenn man selbst Kinder hatte, und Albin hatte schließlich …
Tyson stand in der Terrassentür, starrte Albin an und gab ein heiseres Bellen von sich. Das tat er sonst nie. Einen Moment später verstand Albin, dass der dichte Rauch nichts mit seiner Gitanes zu tun hatte.
»Verdammt«, fluchte er, warf die Zigarette auf den Rasen und stürzte ins Haus.
Im Wohnzimmer und vor allem in der Küche sah es aus, als habe eine Spezialeinheit einige Nebelgranaten gezündet. Aus der Pfanne, in der Albin das Gemüse anbraten wollte und die er über dem Telefongespräch völlig vergessen hatte, schoss der Rauch in dichten, stinkenden Schwaden heraus. Albin kniff die Augen zusammen, hielt die Luft an und fasste nach dem Griff. Er riss die Pfanne vom Herd, wollte sie schon im Waschbecken löschen, dachte jedoch noch daran, dass eine Fettexplosion die Folge sein könnte. Also sprintete er mit der Pfanne in der Hand nach draußen auf die Terrasse und stellte sie auf den mediterranen Natursteinplatten ab. Er packte sich den Gartenschlauch, nahm drei Schritte Abstand und überprüfte, ob Tyson sich hinter ihm in Sicherheit befand. Was der Fall war.
»Deckung«, raunte er dem Mops zu. Dann drehte er den Schlauch auf und richtete den Wasserstrahl auf das brennende Gemüse. Das heiße Metall zischte und fauchte. Noch dichterer Qualm stob in den Himmel. Dann wurde das Zischen leiser und verstummte. Der Dunst lichtete sich.
Albin stellte den Schlauch wieder aus und riskierte einen Blick auf den verkohlten Inhalt der mit Wasser gefüllten Pfanne. Er sah eine eklige schwarze Brühe, die sich zum Teil auch auf die Steinplatten ergossen hatte.
Er seufzte und fuhr sich mit der Hand durchs Gesicht.
Unter »Ablöschen«, überlegte er, verstand man beim Kochen vermutlich etwas anderes.
4
Die Sonne war bereits untergegangen, aber es war noch hell. Der Papstpalast in Avignon und der große Platz davor waren in ein diffuses Zwielicht getaucht. Albin, der eben an einem Tisch zu Füßen des imposanten Bauwerks im Café In & Off Platz genommen hatte, betrachtete das Bauwerk. Er hatte den Palast noch nie gemocht. Er erinnerte ihn an eine der in Felsen geschlagenen Festungen aus dem Film »Der Herr der Ringe«, in dem Zwerge und Elben sich gegen Heere von Monstern zur Wehr setzten. Gut, das Palais des Papes war wohl mit Vorsatz als Trutzburg konzipiert worden. Philipp der Schöne hatte Anfang des 14. Jahrhunderts das Papsttum für seine Zwecke nutzen und nach Frankreich verlagern wollen, als man Clemens den V., Erzbischof von Bordeaux, zum Stellvertreter Petri auf Erden wählte. Avignon schien als Sitz angemessen. Also wurde die Stadt in eine gigantische Baustelle verwandelt. Sieben Päpste hatten in der schrecklichen Festung residiert. Permanent gab es irgendwelche Kriege, und der Papstsitz war Albins Meinung nach somit architektonischer Ausdruck einer Zeit, in der Schießscharten und Monstranz wichtiger gewesen waren als Eleganz. Schließlich zog der Heilige Stuhl zurück nach Rom, und während der Französischen Revolution hatten die Wahnsinnigen die schmucken Säle im Papstpalast kurz und klein gehauen, so dass es heute drinnen aussah wie in jeder anderen stinknormalen, schmucklosen Ritterburg.
Albin nippte an einem Glas, das mit einem eher durchschnittlichen, aber spektakulär teuren Rosé gefüllt war – fraglos eine pekuniäre Reminiszenz an den exklusiven Ort. Man bezahlte die Aussicht mit. Er ließ den Blick erneut über die betongraue Fassade des Palastes mit seinen Arkaden und Türmen gleiten.
Wie ein frühneuzeitliches Parkhaus, dachte er und sah zu Tyson, der unter dem Tisch auf dem Bauch lag und das Treiben vor sich verfolgte. Der gesamte Platz war mit hellem Stein gepflastert, was einem bei senkrechtem Sonneneinfall fast das Augenlicht nahm. Schließlich erblickte Albin eine gedrungen wirkende Person, die sich vom anderen Ende des Platzes zielstrebig seinem Tisch näherte.
Bertrand Lefebvre trug eine alte Jeans und ein verwaschenes Hemd, dessen hellgrauer Farbton dem seiner Haut glich. Lefebvre war nicht sehr groß. Sein Hals schien praktisch nicht vorhanden zu sein. Die Unterarme waren kräftig, und am Handgelenk schnitt sich das Armband einer Uhr tief ins Fleisch – fast so, als wollte sich Lefebvre die Pulsader abklemmen. Als er bei ihnen angekommen war, grüßte er Albin mit einer angedeuteten militärischen Geste und warf einen Blick auf Tyson, bevor er sich an den Tisch setzte.
»Du hast einen Hund?«, fragte Lefebvre.
Albin bestätigte das und erklärte gleichzeitig, was es mit Tyson auf sich hatte: dass ihm die Kollegen den Mops zum Abschied geschenkt hatten, damit ihm als Pensionär nicht langweilig wurde.
Lefebvre bestellte eine Flasche Wasser und sagte: »Danke, dass du dir etwas Zeit nimmst.«
»Keine Ursache. Zeit habe ich mehr als genug.«
Lefebvre sagte: »Meine Frau ist verrückt vor Sorge. Deshalb dachte ich, es ist besser, sich hier zu treffen als zu Hause, wo sie zuhört.«
»Verstehe«, erwiderte Albin, beugte sich vor und zog eine Gitanes aus der auf dem Tisch neben seinem Weinglas liegenden Schachtel, um sie anzuzünden und einen Schwall Rauch in den Abendhimmel zu pusten.
»Ich hoffe, ich halte dich nicht vom Abendessen ab, Leclerc?«
Albin verneinte. »Wir essen früh.«
Er dachte daran, wie er vorhin die verdammte Bratpfanne geschrubbt hatte, damit Veronique nichts von dem Malheur mitbekam und er einen neuen Anlauf mit dem Gemüse nehmen konnte. Als er gerade damit begonnen hatte, hatte er Geräusche an der Tür gehört, und Tyson war losgeschossen wie ein geölter Blitz, um Veronique zu begrüßen, die eher nach Hause kam als erwartet.
»Was ist denn hier los?«, fragte sie freudig.
»Das wollte ich ebenfalls fragen«, sagte Albin.
»Du kochst doch nicht etwa? Du ganz allein?«
»Ich wollte dich überraschen.«
Veronique klatschte in die Hände und lächelte. »Das ist aber süß von dir. Was machst du denn? Warum riecht das so angebrannt?«
Sie marschierte zum Backofen, warf einen Blick hinein, stellte sich auf die Zehenspitzen, linste in die Auflaufform und scannte innerhalb eines Augenblicks die gesamte restliche Küche inklusive der Pfanne auf dem Herd, in der sich neues Gemüse befand.
Bevor Albin etwas sagen konnte, fragte Veronique: »Einen Schweinebraten mit Gemüse? Und was ist das? Fleur de Sel? Woher hast du denn das? Und den Pfeffer? Hast du das alles extra gekauft? Wann hast du denn das besorgt? Hast du das Fleisch vorher angebraten? Du musst es vorher kross anbraten, damit es nicht trocken wird. Warum ist denn das Gemüse in der Pfanne? Das kannst du doch zu dem Braten geben, kurz bevor er fertig ist?«
Albin ließ die Kaskade der Fragen über sich ergehen und öffnete jeweils den Mund, um eine davon zu beantworten, und schloss ihn wieder, als schon die nächste Frage kam.
»Woher hast du das Fleisch? Doch nicht aus dem Supermarkt?«
»Brunet.«
»Bist du verrückt? Weißt du, was der für Preise nimmt?«
»Ja. Sicher, ich habe ja be…«
»Und das Salz und den Pfeffer? Hast du eine Ahnung, wie teuer das ist?«
Albin zuckte mit den Achseln. »Natürlich. Ich habe es ja gekauft …«
Veronique gab ihm einen Kuss auf die Wange. »Du hast es lieb gemeint und wolltest es besonders gut machen. Ich freue mich. Aber es reicht völlig aus, wenn du normales Salz und normalen Pfeffer nimmst und das Gemüse zehn Minuten lang in die Form gibst, wenn der Braten fast fertig ist.«
»Aha.«
Veronique schnupperte. Sie schaute erneut in den Backofen und fragte: »Komisch, warum riecht das so verbrannt?«
Albin warf Tyson einen Blick zu. Tyson schaute verschwörerisch zurück. Albin sagte: »Verbrannt? Keine Ahnung …«
Veronique betrachtete Albin mit einem amüsierten Lächeln und einem Blick, der alles oder nichts bedeuten konnte, aber vermutlich sagte, dass sie genau wusste, dass irgendetwas schiefgegangen sein musste.
»Ich freue mich wirklich«, sagte sie, »dass du mich überraschen wolltest. Ich sollte dich wirklich einmal zu einem Kochkurs anmelden.«
»Mich?«
»Ja.«
»Zu einem Kurs?«
»Aber natürlich. Solche gibt es immer wieder in guten Restaurants. Ein Wochenendkurs.«
»Hm«, hatte Albin gemacht und zu Tyson geschaut. Aus irgendwelchen Gründen hatte es so ausgesehen, als würde der freche Mops grinsen.
Das tat er jetzt nicht mehr. Er lag weiterhin auf dem Bauch und betrachtete das Treiben auf dem Platz, lupfte ab und zu eine Augenbraue und leckte sich schnaufend über die Lefzen.
Lefebvre trank das Glas Wasser fast in einem Zug leer und goss sich nach.
»Wegen Isabelle«, sagte er dann und ließ den Satz offen.
»Erzähl mir alles genau«, sagte Albin.
Lefebvre tat es und erklärte ihm, was er bereits unternommen und mit wem er gesprochen hatte. Demnach hatte Isabelle spät in der Nacht Feierabend in einem Restaurant in Gordes gemacht, war mit ihrem Auto losgefahren – und anschließend verschwunden. Ihr Wagen war nirgends aufgetaucht. Ihre Wohnung, für die Lefebvre einen Zweitschlüssel besaß, hatte sie jedenfalls nicht erreicht, wofür seiner Meinung nach unter anderem das unbenutzte Bett sprach sowie die Tatsache, dass nirgends Sachen lagen, die sie bei der Arbeit getragen hatte. Telefonisch war sie nicht erreichbar. Das Handy war ausgestellt. Sie reagierte nicht auf Kurzmitteilungen und nicht auf E-Mails. Ihr Verschwinden hatte Lefebvre bei der Polizei in Avignon gemeldet und bislang nur gehört, dass Isabelle in kein Krankenhaus der Umgegend eingeliefert worden war und sich zurzeit auch niemand dort mit unbekannten Personalien aufhielt. Es hatte sich zudem kein Unfall ereignet, in den Isabelles Auto verwickelt gewesen sein könnte. Und so weit, dass die Polizei ihre Bankdaten durchleuchten würde, um zu überprüfen, ob es Bewegungen auf ihren Konten gab und ob ihre Kreditkarte benutzt oder Geld abgehoben worden war, waren die Ermittlungen noch nicht fortgeschritten.
Lefebvre ging das alles viel zu langsam. Albin erklärte ihm, warum es so langsam ging, und schloss seine Erklärungen mit dem Hinweis: »Neunzig Prozent aller Vermissten tauchen innerhalb von einer Woche wieder auf, und alles klärt sich. Es sind gerade drei Tage vergangen.«
»Und was ist mit den übrigen zehn Prozent?«
»Bei denen dauert es länger, oder sie tauchen nicht wieder auf.« Den Hinweis, dass man einige auch tot auffand, sparte sich Albin. Fraglos marterte der Gedanke daran Lefebvre ohnehin.
»Ich habe Angst, dass etwas geschehen sein könnte, Leclerc.«
»Was könnte denn passiert sein?«
Lefebvre zuckte mit den Achseln. Dann sagte er: »Ich glaube nicht, dass sie sich etwas angetan hat. Dazu ist sie nicht der Typ, und sie hat auch keinen Grund dafür. Glaube ich. Hoffe ich.« Lefebvre schnaubte, schüttelte den Kopf und drehte das Glas in den fleischigen Händen hin und her. »Andererseits …«
»Andererseits?«
»Andererseits ist es merkwürdig. Als ich die Vermisstenanzeige aufgab, hat mich die Polizei routinemäßig nach Isabelles Freundinnen und Bekannten gefragt und nach ihrem Exfreund, nach den Namen von Arbeitskollegen und danach, wo sie sich möglicherweise aufhalten könnte. Da habe ich gemerkt, dass ich das alles gar nicht so genau weiß. Ich meine: Sie führt ihr eigenes Leben, und was bekommst du davon schon noch mit? Entweder sie erzählen dir etwas davon, oder sie erzählen dir nichts, und du musst darauf hören, was ungesagt bleibt und zwischen den Zeilen mitschwingt. Na ja, und dann geschieht etwas, und du merkst, wie wenig du eigentlich wirklich über ihr Leben informiert bist – obwohl sie doch deine Tochter ist und du alles über sie wissen solltest.« Lefebvre schluckte schwer, räusperte sich und trank dann etwas Wasser.
Albin dachte an seine eigene Tochter, Manon, die in Paris lebte, und an seine Enkelin Clara. Wie auch zu seiner Exfrau hatte er zu beiden seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt. Manon war mit Gilles, einem schmierigen Autoverkäufer verheiratet, bei dem es sich Albins Meinung nach um einen Psychopathen handelte. Gilles schlug Manon regelmäßig, was sie vehement abstritt. Doch Albin kannte die Anzeichen von häuslicher Gewalt und hatte sich Gilles vor einigen Jahren vorgeknöpft – was ziemlich nach hinten losgegangen war und damit endete, dass Manon jeden Kontakt zu ihrem Vater abbrach. Inzwischen gab es eine kleine Annäherung: Manon hatte mit Albin kürzlich einige unverfängliche SMS gewechselt sowie ein aktuelles Foto von sich und Clara geschickt, das Albin inzwischen als Hintergrund auf seinem Smartphone nutzte.
»Ich weiß, was du meinst«, erwiderte Albin und stieß einen Schwall Rauch durch die Nase aus.
Lefebvre nickte schwach.
Albin fragte: »Was glaubst du, wo Isabelle steckt oder was geschehen sein könnte?«
Lefebvre zuckte die Achseln. Die Glocken der Kathedrale, die oberhalb des Papstpalastes auf einem felsigen Vorsprung errichtet worden war, schlugen neun Uhr. Die riesige vergoldete Statue der Jungfrau Maria auf der Spitze des Kirchturms hielt schützend und segnend ihre Hände über die Stadt und funkelte im Zwielicht.
»Ich weiß nicht«, sagte Lefebvre. Sein Blick war beunruhigt und fahrig. »Vielleicht hat ihr ein verfluchter Vergewaltiger auf dem Parkplatz in Gordes aufgelauert, sie überwältigt und in ihrem Wagen entführt. Oder jemand hat ihr an der Straße aufgelauert – ein Anhalter, bei dem es sich um einen Verbrecher handelte.« Lefebvre stellte das Wasserglas ab, knetete die Hände und kaute auf den Backenzähnen. »Oder ihr Ex. Irgendetwas eskalierte, und …« Lefebvre boxte sich klatschend mit der Faust in die Handfläche.
»Das sind jeweils die schlechtesten Alternativen«, sagte Albin. »Was wären die besten?«
»Keine Ahnung. Eine Freundin rief an, die Probleme hat. Isabelle fuhr zu ihr. Aber dann wäre sie nicht drei Tage fort, ohne ein Lebenszeichen von sich zu geben.«
»Sie könnte mit der Freundin in Urlaub gefahren sein. Direkt von der Arbeit zum Flughafen.«
»Niemand weiß etwas von einer Reise.«
Albin nickte. Die Kollegen von der Polizei würden das fraglos noch überprüfen, wenn sie es nicht schon längst getan hatten.
»Meiner Frau«, sagte Lefebvre, »geht es wirklich nicht gut. Sie nimmt wegen der ganzen Situation im Moment Valium. Sie hat zu hohen Blutdruck, weißt du. Ich will nicht, dass sie sich noch mehr aufregt.«
Albin nickte, dann fragte er: »Bertrand, wie kann ich dir helfen? Was soll ich tun?«
»Na ja, ich dachte, du hast noch gute Kontakte zur Polizei und könntest ein paar mehr Informationen erhalten und denen Feuer unter dem Hintern machen. Vielleicht fällt dir auch noch irgendetwas ein, woran die nicht denken …«
Albin nickte erneut. Er beugte sich vor, um die Zigarette auszudrücken. Dann fasste er zur Seite, um in die Einkaufstasche aus Stoff zu greifen, die über seiner Stuhllehne hing. Darin trug er in der Regel ein paar Leckerchen für Tyson, einige Kackbeutel sowie seine persönlichen Sachen umher. Veronique fand die Tasche schrecklich und hatte Albin einmal ein Herrentäschchen aus Leder zum Umhängen schenken wollen. Aber bevor er sich mit so etwas auf der Straße blicken ließ, würde er lieber nackt gehen.
Albin nahm einen Schreibblock hervor, an dem ein Kugelschreiber klemmte, löste den Kuli, klappte den Block auf und legte ihn auf den Tisch.
»Ich helfe dir, so gut ich kann«, sagte Albin. »Und jetzt erzähl mir noch mal alles von vorne und ganz genau.«
5
Isabelle kam mit einem Stöhnen zu sich und dachte im ersten Moment, sie sei erblindet. Um sie herum war alles dunkel. Ihr Körper fühlte sich an wie mit Beton ausgegossen, die Augenlider waren schwer wie Blei. Ihr tat alles weh. Sie wollte laut schreien, besann sich aber eines Besseren, als ihr einfiel, wie sie hierhergelangt war. Zwei Männer hatten sie verschleppt. Diese Männer könnten noch hier sein – wo auch immer dieses Hier war.
Isabelle erinnerte sich an den Unfall und an die Frau, die aus dem Wagen vor ihr gesprungen war. Sie erinnerte sich daran, wie man sie an den Fußgelenken gepackt hatte, um sie aus dem Autowrack zu ziehen. Wie lange war das her? Stunden? Tage? Wochen? War sie so lange bewusstlos gewesen, oder hatte man ihr etwas gegeben?
»Nein«, hörte sie sich selbst wimmern.
Etwas war mit ihrem Bein gewesen. Ein greller, stechender Schmerz war ihr durch die Glieder und direkt ins Gehirn gefahren. Einige Momente später hatte sie gespürt, dass sie durch das Unterholz geschleppt wurde. Sie wollte sich wehren und um Hilfe schreien, aber beides gelang ihr nicht. Sie war wie narkotisiert, betäubt. Dann schlug ihr Körper hart auf, und sie fand sich in einer Art Raum wieder. Ein Raum, in dem sie nicht allein war. Sie lag halb auf dem Körper von jemandem. Sie sah dunkle Haut. Nasse Haut. Klebrige Haut. Dann ein Gesicht. Das Gesicht der Frau, die ihr entgegengesprungen war.
»Es tut mir leid«, flüsterte die Frau atemlos. »Es tut mir leid.«
Isabelle wollte antworten und sich bewegen, brachte aber nur ein Wimmern zustande. Dann krachte etwas hinter ihr. Die Welt wurde dunkel. Es hatte einen heftigen Ruck gegeben. Ein Motor war aufgeröhrt, und das Echo eines Liedes hatte in Isabelles Ohren nachgehallt, bevor sie bewusstlos geworden war: »I don’t belong here …«
Isabelle atmete schwer und schnell, während sie daran zurückdachte. Ihr Bein. Was war mit ihrem Bein? Sie wischte sich durch die von getrockneter Tränenflüssigkeit verklebten Augen, bemerkte den Kratzer an der Wange und tastete vorsichtig ihren Unterschenkel ab. Sie spürte einen Verband oder ein Pflaster sowie schlagartig einen Druckschmerz, als die Kuppen ihrer Finger über das Material strichen. Jedenfalls schien nichts gebrochen zu sein.
Isabelle lauschte in die Finsternis. Ihr Atem war unnatürlich laut. Es klang, als ob sie sich in einem leeren Raum befand. Ihre Finger strichen über den Boden, der staubig, kalt und aus Stein gefertigt zu sein schien. Außerdem fühlte sie etwas Weiches – sie lag darauf. Eine Matratze? Ja, vermutlich.
Sie richtete sich ächzend auf, hörte wiederum ihre eigenen Körpergeräusche überlaut – zudem ein Rauschen und Pfeifen in ihren Ohren. Ihre Wirbelsäule stieß gegen etwas Hartes. Sie tastete nach hinten und spürte kalten Stein. Sie atmete schneller, panisch, ihre Augenlider flatterten. In all der Dunkelheit konnte sie inzwischen feine Unterschiede im Schwarz ausmachen. Dunkle Grautöne traten hervor.
Isabelle blickte nach oben. Weit über sich sah sie etwas, das an verblichene, in ein Dach eingelassene Fenster oder Oberlichter erinnerte. Von da kam Licht. Mondlicht. Als sie sich zur Seite drehte, erkannte sie ein weiteres kleines Fenster. Es war vergittert und in etwa zwei Metern Höhe in die Wand eingelassen, deren Putz abbröckelte. Dahinter kam bloßes Mauerwerk zum Vorschein. Direkt gegenüber befand sich eine Tür. Isabelle schleppte sich dorthin. Ihre Finger strichen über das rostige Metall. Es gab nirgends einen Griff. Isabelle versuchte, gegen die Tür zu stoßen. Sie erschien massiv und bewegte sich kein Stück. Es gab ein hohles Geräusch, als sie mit der Faust dagegenschlug.
Sie steckte in einem Gefängnis, das wurde ihr jetzt klar. In einem Raum, der gerade groß genug für die Matratze war und in dem es nach Staub, Moder und altem Öl roch.
Ein eiskalter Schauder durchlief sie. Wieder löste sich ein Stöhnen von ihren Lippen, und sie hielt sich selbst den Mund zu, um ein Aufschluchzen zu ersticken. Sie vernahm zwischen ihrem stoßartigen, erstickten Atmen ein leises Pochen von irgendwoher, konnte aber den Ursprung nicht verorten. Es vermischte sich mit dem Rauschen des eigenen Blutes in ihrem Kopf.
Isabelles Magen verkrampfte sich. Sie beugte sich zur Seite, weil sie dachte, sich übergeben zu müssen. Ihre Stirn stieß gegen die Tür, was den Schmerz in ihrem Kopf explodieren ließ und gleichzeitig dafür sorgte, dass der Brechreiz wieder verschwand. Sie löste die Hände vom Mund und umfing sich selbst mit den Armen, tastete sich ab, blieb dann einige Minuten lang regungslos stehen und versuchte, sich in der Dunkelheit zu sortieren sowie einen klaren Gedanken zu fassen.
Sie hatte einen Unfall gehabt, weil eine Frau aus dem Lieferwagen vor ihr gesprungen war. Die Frau wollte fliehen. Dann hatten zwei Männer – waren es wirklich zwei gewesen? – Isabelle aus dem Autowrack gezerrt und in den Lieferwagen verfrachtet. Darin befand sich auch die Frau, die vorher herausgesprungen war. Man hatte sie wieder eingefangen und Isabelle dazu. Sie erinnerte sich an nichts, was danach geschehen war. Vermutlich war sie bewusstlos geworden. Und dann war sie an diesen Ort gebracht und in eine Art Kerker gesteckt worden, wo man sie nun gefangen hielt …
Was war das nur für ein Ort?
Sie dachte an die Worte ihres Vaters, der lange Jahre bei der Feuerwehr gewesen war. Schon als Kind hatte er ihr immer wieder eingeimpft: Ruhe bewahren. Bei jeder Katastrophe: Ruhig bleiben. Nicht in Panik verfallen. Orientiere dich. Dann handle.
Orientiere dich … Soweit Isabelle es in der Dunkelheit beurteilen konnte, war der Raum bis auf die Matratze vollkommen leer, klein, aber recht hoch. Sowohl durch das Oberlicht als auch durch das vergitterte Fenster konnte sie den Nachthimmel sehen. Der Raum mochte vielleicht zu einer alten Lagerhalle oder einer verlassenen Fabrik gehören, wofür der Boden sprach, der aus Beton zu sein schien, sowie das Oberlicht. Das gab es eher in industriellen Bauten. Der Geruch nach Staub und Öl sprach ebenfalls dafür – vielleicht hatte sogar hier in diesem Raum eine Maschine gestanden? Nein, dazu war er zu klein. Eher hatte man hier etwas gelagert. Außerdem, überlegte Isabelle, war sie nicht geknebelt worden. Wahrscheinlich deswegen nicht, weil sie ohnehin niemand durch das vergitterte Fenster hören würde, wenn sie schrie. Das sprach dafür, dass das Gebäude sich weit außerhalb, in einer menschenleeren Gegend befinden musste.
Isabelle blickte wieder zum vergitterten Fenster in der Seitenwand. Es war nicht verglast. Die Nachtluft strömte herein. Der Wind in den Baumkronen war leise zu vernehmen. Die Gitter wirkten neu und waren, im Gegensatz zur Tür, nicht rostig. Das Metall erschien glatt und glänzte schwach. Die Matratze schien ebenfalls nicht alt zu sein. Isabelle stieß mit der Zehenspitze dagegen und testete die Federung mit der Hacke. Nein, da war nichts erschlafft. Die Matratze war neu.
Wenn man sie in einem solchen Raum gefangen hielt und außerdem eine Wunde an ihrem Bein verarztet hatte – was bedeutete das alles? Warum war sie gefangen und entführt worden? Was hatten diese Leute mit ihr vor? Was war mit der Frau, die aus dem Wagen gesprungen war und mit Isabelle in dem Lieferwagen gesteckt hatte?
Isabelle hielt die Luft an. Wieder vernahm sie das leise Pochen – unmöglich zu sagen, woher es kam.
»Hallo?«, flüsterte Isabelle.
Ihre Stimme war dünn wie Pergament. Ihre Kehle fühlte sich wund und trocken an. Sie musste husten, verkrampfte sich und ruckte nach vorn. Wiederum schlug ihr Kopf gegen die Tür. Sie presste ihre Wange und das Ohr fest dagegen, tastete mit den Händen die Oberfläche ab. Dort, wo sich ehemals ein Schlüsselloch befunden haben musste, fühlte sie wulstiges Metall – eine Schweißnaht. Die Öffnung war verschlossen worden.
»Hallo?«, fragte sie dann sehr viel lauter gegen das massive Metall und lauschte dem Geräusch ihrer eigenen Frage hinterher. Sie schlug mit den Handflächen so fest gegen die Tür, dass es schmerzte.
Erneut hörte sie ein Pochen. Es kam von rechts, aus der Seitenwand ihrer Zelle! Oder besser: von dahinter! Isabelle machte einen Schritt in Richtung der Wand. Sie presste ihr Ohr gegen die Mauer und schlug mit der Hand dagegen. Mit einem Klopfgeräusch wurde geantwortet.
»Hallo!«, rief Isabelle. Und hörte jetzt eine leise Stimme. Eine weibliche Stimme, die merkwürdigerweise von draußen zu kommen schien und nicht weit entfernt wirkte. So, als ob es … Als ob es neben ihrer Zelle eine weitere gab, vielleicht ebenfalls mit einem in die Wand eingelassenen Fenster, durch das jemand zu ihr rief.
»Hallo? Geh ans Fenster!«
Isabelles Herz schlug ihr bis in den Hals. Sie starrte zum Fenster hinauf. Sie ignorierte ihr schmerzendes Bein, zog an der Matratze, ächzte und faltete sie an der Wand unter dem Fenster zusammen. Dann stellte sie sich drauf – was zumindest dafür sorgte, dass sie nun bis zum Kinn an die Fensteröffnung gelangte. Sie sog die frische Luft tief ein. Plötzlich konnte sie nicht mehr verhindern, dass sich ihre Angst aufs Heftigste Bahn brach.
Sie schrie, von einem Weinkrampf geschüttelt: »Wo bin ich? Wo bin ich? Ich will hier raus! Um Gottes willen!«
Ihre Finger griffen fest um die daumendicken Gitterstäbe am Fenster und versuchten, daran zu rucken und das Gefängnis aufzubrechen. Vergeblich.
»Wo bin ich?«, schrie Isabelle erneut. »Ich will raus! Lasst mich raus, ihr verdammten Schweine!«
Mit den Fäusten hieb sie auf die Stäbe ein, was nur dafür sorgte, das Isabelle sich selbst weh tat. Schließlich verließ sie alle Kraft. Sie sackte weinend in sich zusammen, rollte sich wie ein Embryo auf der Matratze zusammen und wollte sich eine nicht vorhandene Decke über den Kopf ziehen.
Die Stimme der fremden Frau drang durch zu Isabelle.
»Es tut mir so leid«, sagte die Stimme. Sie klang weit entfernt und doch so nah. Wie durch Watte. »Es tut mir so schrecklich leid.«
Isabelle richtete sich wieder auf. Sie schrie das Fenster an: »Was? Was, verdammt, tut dir leid?«
»Es tut mir leid«, sagte die Frau, »dass du wegen mir da hereingezogen worden bist.«
Isabelle stockte. Die Frau aus dem Lieferwagen – sie war ebenfalls hier. Sie war nebenan. Sie steckte ebenfalls in einem Gefängnis. Isabelle stand auf, klappte die Matratze noch einmal zusammen, stellte sich auf die Zehenspitzen und presste ihre Wange gegen die Gitter und ihr Gesicht zwischen zwei Stäben hindurch. Sie sog die frische Luft in die Lungen, zog die Nase hoch und räusperte sich.
»In was?«, fragte sie in die Nacht hinaus. »In was bin ich hereingezogen worden? Wer bist du? Warst du mit mir in dem Lieferwagen? Wer sind die? Was haben die mit uns vor?«
»Ich bin Sara«, erwiderte die Stimme. »Ja, ich war in dem Wagen. Ich weiß nicht, wer die sind. Ich weiß nicht, was sie vorhaben, aber ich glaube …«
»Was?«, fragte Isabelle laut. »Was? Was glaubst du?«
Ein tiefes Seufzen. »Ich … ich glaube, sie halten uns hier gefangen, um uns weh zu tun. Und um uns zu töten.«
6
Am nächsten Morgen fuhr Albin nach Gordes. Es war noch sehr früh, gerade acht Uhr, doch Veronique war bereits im Geschäft, um eine neue Ladung Blumen in Empfang zu nehmen. Albin konnte die Gewächse inzwischen einigermaßen voneinander unterscheiden – also: Er verwechselte nicht länger Tulpen mit Lilien oder Gerbera, worüber Veronique sich ziemlich aufgeregt hatte, ihn später aber lobte, nachdem er wenigstens die wichtigsten Blumen benennen konnte.
Im Radio liefen die Nachrichten, die alles Mögliche über die verrückte Lage in der Welt brachten, was Albin nur am Rande interessierte. Politik war nie sein Ding gewesen. Völlig egal, wer gerade irgendwo gewählt oder nicht gewählt worden war – es wurde weiterhin gestohlen, gemordet, betrogen und gelogen. Daran hatte auch der lange Ausnahmezustand in Frankreich nach den Anschlägen von Paris nichts geändert, was Albins These bewies: Selbst wenn jeder fünfte Bürger ein Polizist wäre, hätte die Polizei immer noch alle Hände voll zu tun und würde herumhüpfen wie dieser Holden Caulfield aus dem Buch, das Albin als Jugendlicher verschlungen hatte: Der Fänger im Roggen. Darin wurde ein Traum beschrieben, in dem Holden in einem Feld stand und Kinder davor bewahren musste, sich wie die Lemminge in einen Abgrund zu stürzen, was ein Ausdruck seiner Furcht vor dem Erwachsenwerden war. So ähnlich wie dieser Holden war sich Albin früher oft im Dienst vorgekommen. Kriminalität war wie ein nie versiegender Strom. Man konnte sie nicht mit einem Staudamm stoppen. Sie suchte sich wie Wasser stets ihren Weg. Man konnte lediglich versuchen, sie einigermaßen unter Kontrolle zu halten. Wenn man mehr als das tun wollte, drehte man entweder durch oder bekam so etwas Neumodisches wie einen Burn-out. So war das eben, und Albin hatte den jungen Polizisten, die ganz neu im Job waren, immer gesagt: Das Strafgesetzbuch ist eure Bibel, lasst nichts zu nahe an euch heran, denn wenn ihr zu lange in den Abgrund starrt, starrt der Abgrund irgendwann zurück. Was Albin ihnen nicht verriet, war, dass er manchmal selbst an dieser Klippe stand, hinabstarrte und zu verstehen versuchte, was, zum Teufel, mit diesen Leuten da unten in der Hölle eigentlich los war und was sie antrieb. Das brauchte jedoch niemand zu wissen. Hinterher hielten die ihn noch für empfindlich oder so einen Quatsch.
In Gordes hielt Albin auf dem Parkplatz am Château und stieg aus. Er öffnete den Kofferraum mit der Fernbedienung, ging um den Wagen herum und hob Tyson heraus, bevor er die Klappe wieder schloss und den Mops anleinte. Schließlich schlenderte er ein wenig durch den Ort. Er sah, dass das Restaurant, in dem Isabelle arbeitete, noch geschlossen war – kein Wunder um diese Uhrzeit. Er genoss die frische Luft, die sich fraglos binnen der nächsten zwei Stunden deutlich aufheizen würde, ließ Tyson an einer Platane sein Geschäft verrichten und überlegte, welchen Rückweg Isabelle von der Arbeit genommen haben würde und wo sie vermutlich ihr Auto parkte.
Seiner Meinung nach kamen der Parkplatz am Château in Betracht, wo auch sein Wagen stand, sowie zwei weitere, weil sie allesamt in der Nähe des Restaurants lagen, in dem Isabelle arbeitete. Sie alle hatten die Gemeinsamkeit, dass man den mitten im Ort liegenden Kreisverkehr passieren musste, um zu ihnen zu gelangen – und ebenfalls, wenn man Gordes wieder verließ. Vom Kreisverkehr aus gab es drei Abfahrten. Eine Richtung Osten, die damit uninteressant war. Die anderen beiden gingen jeweils nach Norden, und zwar in Richtung Venasque. Die eine Strecke führte über Murs dorthin, die andere über Sénanque und von Venasque aus dann schließlich in Richtung Carpentras.