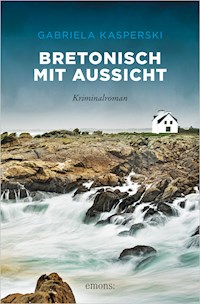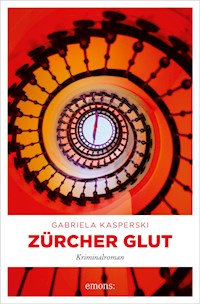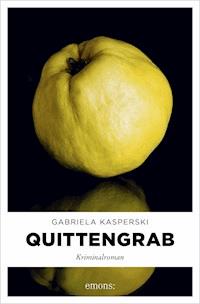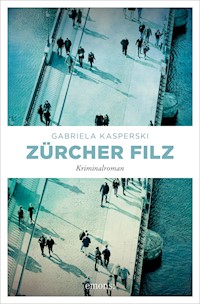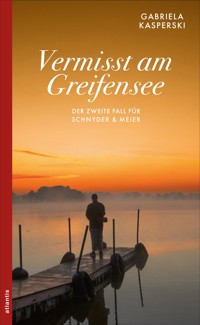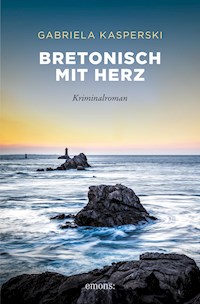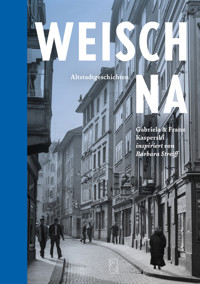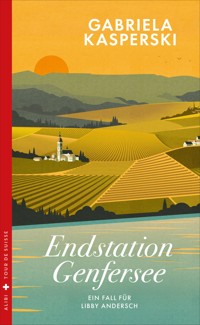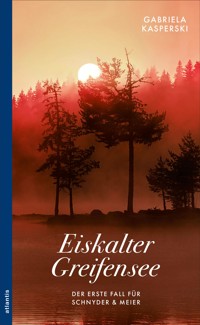
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Schnyder & Meier
- Sprache: Deutsch
Am Morgen des dritten Advent wird am verschneiten Ufer des Greifensees die Geigenlehrerin Isadora Heller tot aufgefunden, seltsam herausgeputzt mit Hut und silbernem Schal, aber mit Wanderschuhen an den Füßen. Werner Meier von der Kantonspolizei Uster verdächtigt ihre Schwiegertochter Jane: Ein Motiv hatte sie - Zeugen berichten von einem Streit -, und am Tatort ist sie auch gewesen, denn sie war es, die die Leiche beim Joggen entdeckte. Janes Freundin, die Psychologiestudentin Zita Schnyder, ist von ihrer Unschuld überzeugt und beginnt Nachforschungen anzustellen. Dann gibt es eine zweite Tote: Annemarie Dieci, eine der beliebtesten Frauen in Waldbach und Leiterin der Laufgruppe, zu der auch Zita und Jane gehörten. Meier und Schnyder stoßen auf eine verwirrende Geschichte, die weit in die Vergangenheit reicht. Meier recherchiert intuitiv, Schnyder hält sich an Fakten, aber beide sind eigenwillig - und sie verlieben sich ineinander. Doch dann gerät Zita in die Hände des Mörders…
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriela Kasperski
Eiskalter Greifensee
Der erste Fall für Schnyder & Meier
Kriminalroman
atlantis
Für Franz, Flo, Beni und Samira
Jane rannte keuchend durch den Waldbacher Wald, den Blick starr in die Morgendämmerung gerichtet. Sie nahm nichts von der Schönheit wahr – nicht die verschneiten Tannen und auch nicht die glitzernden Eiszapfen, die in bizarren Formen den Weg säumten. Abrupt hielt sie inne. Dicht vor ihr stand ein Reiher. Elegant hob er ein Bein und sah sie an, atemlos erwiderte sie seinen Blick. Nach einer Weile, die ihr wie eine Ewigkeit erschien, klappte der Vogel die Flügel aus und schwang sich in die Luft.
Für einen Augenblick war es totenstill. Bis sich Jane umdrehte und zurücklief, ihren eigenen Fußspuren folgend. Endlich erreichte sie die kleine Lichtung, wo eine eigenartige Gestalt starr im jungfräulichen Schnee lag. Jane ging näher. Und noch näher. Der Hut und der silberne Schal waren unverkennbar, ihre Schwiegermutter hatte beides mit Stolz und Würde getragen.
Gott sei Dank ist sie tot, dachte Jane. Nun kann der alte Besen nicht nach Waldbach ziehen. Und niemand wird von Paddy erfahren.
Sonntag
ScarLett Hammer, die Wetterfee des Privatsenders Greifensee Total, zwinkerte; ein Klümpchen Wimperntusche hatte sich in ihrem Auge festgesetzt.
»Fuck!« Kameramann Sven fuhr aus seinem Dämmerschlaf. Wenn sie die Aufzeichnung nicht bald im Kasten hatten, mussten sie live auf Sendung. Und Sven hasste das, besonders am frühen Sonntagmorgen und ganz besonders mit ScarLett, die immer für eine Überraschung gut war.
Aber die Wetterfee moderierte sich mit strahlendem Lächeln durch ihre anderthalb Minuten: »In der zweiten Tageshälfte kann es nochmals zu neuem Schneefall kommen. Die Wetterlage ist zurzeit extrem extrem.«
Sven stöhnte auf. ScarLett hatte zwar ihrem Namen entsprechende Hammerbrüste und ein ultracharmantes Lächeln, aber eindeutig ein Sprachproblem – der Chef stand eben mehr auf Titten als auf Sprache. ScarLett zwinkerte erneut. Eine Träne samt Klümpchen löste sich vom unteren Lidrand. Sven hielt den Atem an. Sie drehte den Kopf und linste von der Seite in die Kamera. Das konnte sie wie keine andere, und so lief die Träne unbeachtet in ihre Halsgrube.
»Zum Schluss noch einen Hinweis an alle Walker, Jogger und Hundehalter: Wenn Sie rausgehen, packen Sie sich warm ein, und tun Sie es gleich, später kann es zu spät sein.« Sie hielt beide Arme hoch, so wie sie das jedes Mal tat. »Viel Spaß, trockene Füße und tschau bis in einer Stunde, wenn es wieder heißt: Im Wetter-Bett mit ScarLett.«
Zita Schnyder schreckte aus alkoholgeschwängertem Tiefschlaf hoch und schlug sich den Kopf an. »Verdammt!« Noch immer hatte sie sich nicht an die Dachschräge gewöhnt, obwohl sie seit bald drei Monaten hier wohnte. Ihre Augen waren verquollen, halb blind tastete sie nach dem brummenden Telefon. Als sie die Nummer sah, stöhnte sie auf. Gunnar Hodler! Sie hatte es geahnt. Nach acht endlosen Jahren Studium hatte sie im letzten Sommer ihre Masterarbeit in Angriff genommen. Familienkonstellationen im modernen Frauenroman war das Thema, das ihre beiden Fächer Anglistik und Psychologie vereinte. Da sie in ihrer WG in Zürich nicht zum Arbeiten kam, war sie vorübergehend an den Greifensee gezogen, sie, die das Landleben eigentlich hasste. Das Projekt konzentriertes Schreiben war dennoch super angelaufen. Bis zu dem Moment, als ihre langjährige Mentorin plötzlich eine Frühgeburt erlitten hatte. Und der Stellvertreter, Gunnar Hodler, in Erscheinung getreten war: Ein phantasieloser Mittfünfziger, der schon das Thema an sich für verfehlt hielt. Als Zita den Abgabetermin nicht einhalten konnte, hatte er die Frist zähneknirschend verlängert. Montag um neun – das war sein ultimatives Angebot. Und daran erinnerte er sie jetzt, an einem Sonntagmorgen kurz vor sieben. So ein Idiot!
Zita kuschelte sich wieder in die warme Decke. Gestern Abend hatten sie eine tolle Party gefeiert, ihre Zimmerwirtin Helen Himmel hatte richtig zugeschlagen. Es war das erste Mal, seit ihr Mann Heinrich vor zwei Jahren gestorben war, dass sie so viele Leute eingeladen hatte. Das halbe Dorf war gekommen, und die Letzten waren erst um drei Uhr früh gegangen. Zitas Freundin Eski hatte sämtliche Vorurteile, das Landleben sei langweilig, begraben – besonders angesichts des jungen Försters Max Reinhard, mit dem sie sich den ganzen Abend ein Glas Punsch geteilt hatte. Eski, bei der sogar eine pflegeleichte Wohnzimmerpalme nach drei Tagen die Wedel hängen ließ, interessierte sich plötzlich brennend für alle Vorgänge in der Natur. Eski und der Förster, was für eine Schnulze. Zita verzog den Mund und richtete sich schwerfällig auf. Elender Kater, unmöglich, so zu arbeiten. Ihr Blick blieb an der Trainingshose hängen, die auf einem Kleiderhaufen lag. Ob sie joggen gehen sollte?
Nachdem sie damals die ersten Tage hier in völliger Einsamkeit vor ihrem Laptop verbracht hatte, gebeutelt von einer fürchterlichen Landdepression, hatte Helen sie zum Lauftreff geschickt. »Jetzt stell dich nicht so an. Du wirst sehen, es bringt dich auf andere Gedanken.« Äußerst widerwillig hatte sich Zita überreden lassen. Aber die Ladies trabten locker, redeten dabei miteinander, die Stimmung war großartig. Und Zita hatte mitgehalten. Am Ende erfuhr sie, dass sie erstaunlicherweise acht Kilometer zurückgelegt hatte. Beflügelt von ihrem persönlichen Rekord war sie auch zum nächsten Training gegangen und hatte Jane kennengelernt. Jane war einige Jahre älter als sie, mager und klein, sprach kaum und lief leidenschaftlich. Nachdem Zita und sie mehrere Wochen lang nebeneinanderher gerannt waren und Jane alles über Zita wusste – das endlose Studium, die kurzlebigen Affären, die selbst diagnostizierte Beziehungsneurose –, begann auch Jane zu erzählen. Sie stammte aus Schottland, hatte drei Jungs im Alter von fünf bis zwölf, in einem früheren Leben war sie bei einer Nachrichtenagentur in Edinburgh angestellt gewesen. Sie litt unter dem Machogehabe ihres Mannes, unter den Teenagerallüren ihres ältesten Sohnes und unter der Anwesenheit ihrer Schwiegermutter Isadora, die einen Kurzbesuch spontan verlängert hatte. Angeblich, um die musikalische Erziehung der Jungs voranzutreiben – sie war eine renommierte Geigenlehrerin. Jane schilderte die Zustände in ihrem Haushalt mit Galgenhumor, trotzdem kam sie Zita ziemlich unglücklich vor. Um sie abzulenken, hatte sie Jane zu Helens Party eingeladen. Jane war tatsächlich aufgetaucht. Unschlüssig zuerst, nur auf Zitas Drängen hin hatte sie den Mantel abgelegt. Aber nach einem Glas Punsch war sie aufgetaut und mit dem Volleyballtrainer Paddy ins Gespräch gekommen. Mit ihm hatte sie dann erstaunlicherweise den ganzen Abend geflirtet, obwohl er um Jahre jünger war als sie. Jane, der kleine Feger, wer hätte das gedacht?
Zita lachte auf. Es ging ihr viel besser, ihr Kopf brummte kaum noch. Sie griff nach ihrer Trainingshose: Eine kleine Runde durch den Schnee, dann würde sie sich ans Korrigieren machen.
Werner Meier stand unter der Dusche und sang. Er war bestens gelaunt – sein erster freier Sonntag seit Langem. Da die Kantonspolizei Uster chronisch unterbesetzt war, wurde Meier oft für Wochenenddienste eingeteilt. Was ihm gar nicht so ungelegen kam, so lief er nicht Gefahr, sich über seine gescheiterte Ehe und sein abgebrochenes Kunststudium den Kopf zu zerbrechen. Auf den heutigen freien Sonntag allerdings hatte er sich gefreut. Er wollte die Buddha-Ausstellung im Rietbergmuseum in Zürich besuchen und abends würden er und seine drei Freunde mit ihrem Streichquartett erstmals öffentlich auftreten. Ein großer Moment, auch wenn es nur ein Kirchenkonzert in der kleinen Gemeinde Waldbach war. Dort gab es nämlich den Hirschen, wo er gerne ein Feierabendbier trank, und Vreni Hugentobler, die Wirtin, die immer ein warmes Abendessen für ihn bereithielt, selbst wenn die Küche schon geschlossen war. Da hatte er auch Dorfpfarrer Keller kennengelernt, der neu war, innovativ, bemüht, die Menschen in die Kirche zu locken und von der Idee eines Adventskonzerts sofort begeistert gewesen war.
Meier schmetterte den Triumphmarsch aus Aida gegen die Kacheln. Wasser und Seife liefen ihm in den Mund, er gurgelte sich noch durch einen Takt, bevor er zwangsläufig verstummte. Beim Abtrocknen sah er missbilligend auf seinen Bauch. Ich muss abnehmen. Ab sofort ist das Frühstück gestrichen und morgen fange ich an zu joggen. Als er aus dem Fenster sah, staunte er: Alles war verschneit, die Häuser wie von einer gewaltigen Puderzuckerschicht bedeckt, auf der gewöhnlich sehr befahrenen Hauptstraße schlingerte ein einziges Auto. Ein verzauberter Wintertag, wie schön!
Meier pfiff noch einige Takte des Marsches, bevor er aus seinem reich bestückten CD-Regal Glenn Goulds Goldberg-Variationen auswählte. Unterwegs in die Küche kam er an seinem neuen Anzug vorbei, den er im Weihnachtsverkauf erstanden und bis jetzt nicht aus der Tüte genommen hatte. Der erste Anzug seit Jahren! Meiers bevorzugte Uniform waren Jeans und ein passendes T-Shirt, ergänzt durch eine Lederjacke.
Glenn Goulds virtuose Finger hüpften über die Tasten, und Meier stand vor dem Küchenschrank. Vielleicht ein kleines Müsli? Das machte nicht dick und stillte den Hunger, der an ihm nagte, seit er sich eben vorgenommen hatte, nichts mehr zu essen. Er füllte eine Schüssel mit Flocken und goss Milch dazu; der Kaffee lief bereits durch die Maschine. Die Sonntagszeitung schenkte er sich, schließlich hatte er frei. Dafür schaltete er den kleinen Fernseher ein, der neben dem Mikrowellengerät stand und ihm während seiner seltenen Kochorgien Gesellschaft leistete. Als Meier ScarLetts großzügiges Dekolleté erblickte, pfiff er anerkennend. Eine Anzüglichkeit, die ihm diebisches Vergnügen bereitete und die er sich nur leistete, wenn er allein war. ScarLett verhaspelte sich wie üblich beim Wort Wetterlage und meinte charmant verlegen, dass es bald wieder megamäßig schneien würde. Meier grinste, goss den Kaffee in eine Tasse und schäumte Milch darüber. Da wurde das Wettersignet unvermittelt vom Newsflash unterbrochen. Ein aufgeregter Moderator verkündete, dass der bekannte Politiker Anton Marti bei der gestrigen Anti-Weihnachtskommerz-Demonstration getötet worden sei.
»Schtärnesiech!«
Meier verschüttete das Schokoladenpulver und blickte gebannt auf den Bildschirm. Vermummte Gestalten, die sich im Schneefall erbitterte Duelle lieferten, von gedämpften Geräuschen untermalt. Bizarr, wie aus einem Spielfilm. Übergangslos folgte der nächste Beitrag, ein Porträt von Anton Marti, dazwischen die Stimme des Moderators, der wissen wollte, ob er wieder auf Sendung sei. Das Ganze wirkte chaotisch, offenbar waren die Macher von Greifensee Total ziemlich überfordert.
Meier schaltete den Fernseher aus, seine gute Laune verflog. Nicht aus Kummer über Marti, sondern weil sein freier Tag auf dem Spiel stand. Im Geist sah er bereits seinen Chef Fausto Signorelli, der einen Großeinsatz anordnete und sich dabei schwungvoll über den kahl geschorenen Schädel strich. Automatisch tastete Meier nach seinem Handy. Aber dieses lag samt Hose im Wäschekorb. Im Badezimmer schlugen ihm eiskalte Luft und der Klingelton entgegen. Einen Augenblick lang zögerte er. Einfach ignorieren? Im Rietbergmuseum würde ihn keiner vermuten, offiziell hatte er frei. Sein Pflichtbewusstsein siegte. Er ließ Müsli und Milchkaffee stehen und eilte los.
»So, fertig.« Helen Himmel hängte das feuchte Küchentuch an seinen Platz und sah sich zufrieden in der aufgeräumten Küche um. Das Fest hatte einen wahren Energieschub in ihr ausgelöst. Zum ersten Mal seit langer Zeit war ihr Haus wieder von Fröhlichkeit und Lärm erfüllt gewesen. Heinrich hätte sich gefreut. Dies hatten ihr ihre beiden Söhne Samuel und Jonas versichert, die auch da gewesen waren. Das allein genügte, um Helen glücklich zu machen. Sie hing an ihren Kindern und vermisste sie jeden Tag, besonders seit auch Nesthäkchen Marie vor einem halben Jahr ausgezogen war und Helen auf Anraten ihres Nachbarn Pablo Liimes den Dachstock an die Studentin Zita Schnyder vermietet hatte.
Auf dem Weg ins Wohnzimmer schaltete Helen den Fernseher ein, gleich würde das Wetter kommen. Hoppla, es war schon auf Sendung! Helen trat näher und lachte herzlich über ScarLetts Versprecher. Sie war ein Fan der Wetterfee, die ihren großen Busen so stolz in die Kamera hielt. Helen musterte das hautenge Top bewundernd, irgendwann würde sie auch so mutig sein. Vielleicht sogar schon diesen Abend: Pfarrer Keller hatte sie nämlich zum Adventskonzert eingeladen, höchstpersönlich.
Summend füllte Helen die Spülmaschine mit den letzten Gläsern. Plötzlich hielt sie inne. Wo war eigentlich die Flasche mit Pablos Quittenschnaps? Gewöhnlich stand sie ganz vorne im Regal, gleich neben dem alten Wecker. Aber da war sie nicht. Helen gab die Suche nach kurzer Zeit wieder auf; der Schnaps würde vermutlich beim Putzen des übrigen Hauses auftauchen. Aus ihrer Kräuterteesammlung wählte Helen eine Eisenkraut-Pfefferminz-Mischung und deckte den Tisch. Zopf, Butter, Johannisbeermarmelade: Helen frühstückte für ihr Leben gern gemütlich und ausgiebig. Sie wollte sich gerade setzen, als ihr einfiel, dass sie ihrer Freundin Bescheid geben sollte. Susanna Maag war auch in Waldbach aufgewachsen. Eine Zeit lang hatten sie sich aus den Augen verloren, bis sie vor einigen Jahren mit ihrem Mann Christian wieder ins Dorf gezogen war. Sie hatte ein Reinigungsinstitut eröffnet, das prächtig anlief. Aber dann war die Wirtschaftsflaute gekommen, Susanna musste ihre Angestellten entlassen und alles alleine machen. Das unangenehme Gefühl, das Helen zu Beginn überkommen hatte, wenn ihre alte Schulkameradin bei ihr putzte, war schnell der Freude gewichen, gemeinsam zu arbeiten. Denn Helen half natürlich immer mit. Die Vorstellung, auf dem Sofa zu dösen, während Susanna schuftete, erschien ihr völlig absurd.
Helen tippte Susannas Handynummer ein. Die freundliche Stimme der Mailboxdame teilte ihr mit, die Teilnehmerin sei zurzeit nicht erreichbar. Helen sah auf die Uhr. Halb acht, vielleicht war das noch etwas früh zum Putzen, immerhin war Sonntag. Sie beschloss, die Zeitung zu holen und sich eine Pause zu gönnen.
Pablo Liimes beobachtete, wie sich seine Nachbarin in Nachthemd, Faserpelz und Gummistiefeln durch den Schnee zum Briefkasten kämpfte. Typisch Helen, im Morgengrauen ins Bett und schon wieder munter. Er selbst war kein Frühaufsteher, aber nach einem Albtraum hatte er nicht mehr einschlafen können. Langsam ging er zur chromglänzenden Kochinsel, gefolgt vom wedelnden Basko. Mit einer knappen Geste befahl er dem Hund, sich hinzulegen. Er brühte einen Espresso auf und trank ihn viel zu heiß, dann kehrte er zu seinem Arbeitstisch zurück. Als er die Schleifmaschine ansetzte, fräste er eine wüste Kerbe ins Metall. »Jesus fucking Christ!« Er ließ das Gerät sinken. Konzentration war heute ein Ding der Unmöglichkeit. Aber spielte das eine Rolle? Er konnte tun und lassen, was er wollte.
Vor zwei Jahren war Pablo aus den USA nach Waldbach heimgekehrt. Er hatte die alte Spinnerei seiner Eltern in ein loftartiges Wohnatelier umbauen lassen und jeden Auftrag, von den Spengler- bis zu den Malerarbeiten, im Dorf vergeben. Die Bewohner dankten es ihm mit Achtung und Respekt, beim Aufrichtefest tranken sie seinen selbst gebrannten Schnaps. Und keiner war ihm böse, wenn ihm die Frauen etwas zu tief in die Augen schauten. Manchmal kam eine bei ihm vorbei, genoss einen italienischen Kaffee und bat ihn wegen ihrer Blumen um Rat. Denn Pablo war nicht nur Künstler, sondern auch ein begnadeter Gärtner. »Das ist unfair«, pflegte Helen zu jammern. »Ich arbeite mir den Rücken krumm, trotzdem werden meine Rosen von jeder Laus befallen, während du deine Pflanzen einmal intensiv anschaust, und schon gedeihen sie prächtig.«
Pablo stellte sich erneut an die lang gezogene Fensterfront. Als ihm Helen mit der Sonntagszeitung zuwinkte, reagierte er nicht. Ein Frühstück mit ihr war das Letzte, was er sich jetzt wünschte. Er atmete auf, als sie hinter ihrer adventlich geschmückten Haustür verschwand.
Sein Handy klingelte. Er zuckte zusammen. Dann machte sich Erleichterung in ihm breit. Sie musste es sein. Niemand sonst würde sich trauen, ihn so früh anzurufen.
Susanna Maag starrte auf ihr Handy. Wieso ging er nicht ran? Er musste doch wissen, dass sie es war.
»Schatz, was machst du?«
Schnell ließ Susanna das Telefon in die Tasche ihres Bademantels gleiten, obwohl sie nichts zu befürchten hatte: Ohne seine Brille war ihr Mann Christian blind wie ein Maulwurf. Außerdem war er völlig verschlafen, vergangene Nacht hatte er zu viel getrunken und zu lange Karten gespielt.
»Warum bist du schon auf, Schatz? Es ist doch viel zu früh.« Sein Atem verursachte ihr Übelkeit.
»Ich muss aufs Klo.« Sie ging ins Badezimmer, schloss die Tür hinter sich und atmete tief durch. Dann tastete sie erneut nach dem Handy.
»Ich mach uns mal Kaffee!«, rief Christian.
Vertraute Geräusche drangen zu ihr. Ein Filter wurde eingelegt, Kaffeepulver reingeschüttet, Wasser abgemessen: zwei Tassen für sie, eine für ihn. Schlurfende Schritte, der Fernseher wurde eingeschaltet, dann ertönte die fröhliche Stimme der Wetterfee.
Susanna tippte die Wahlwiederholung an. Auch diesmal meldete sich nur die Mailbox. »Verdammt noch mal!« Wütend warf sie das Handy ins Waschbecken.
»Susanna, ist alles in Ordnung?«, fragte Christian ängstlich.
Endlich ging die Tür wieder auf. Susanna stand da, hellwach, die eisgrauen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden. Durch das Oberteil ihres schwarzen Trainingsanzugs zeichneten sich ihre Brüste ab. Christian seufzte, zu gerne hätte er sein Gesicht darin vergraben. Als ahnte sie seine Gedanken, zog sie ein unförmiges T-Shirt darüber. Hinter ihnen verkündete die Wetterfee, dass die Schneefälle früher als ursprünglich vorausgesagt wieder einsetzen würden.
»Ich muss los, Annemarie wartet sicher schon.«
»Du willst bei diesem Wetter joggen?«
Susanna schlüpfte in die Turnschuhe. »Soll ich dir ein Geheimnis verraten?«
Christian nickte erleichtert. Ihre schlechte Stimmung schien verflogen.
»Ich will Annemarie beim Silvesterlauf schlagen.«
»Das wirst du auch, mein Schatz. Du bist die Größte!«
Er trat näher, doch sie drehte sich weg. Der zärtliche Augenblick war verflogen, bevor er begonnen hatte.
Susanna eilte zur Tür, ihren Rucksack eng an den Rücken geschnallt. »Nachher geh ich noch bei Helen vorbei und helfe ihr beim Aufräumen. Vor dem Nachmittag musst du nicht mit mir rechnen«, rief sie ihm aus dem Treppenhaus zu.
Annemarie Dieci und Georg Reinhard lagen in dem etwas zu schmalen Bett, das im Schlafzimmer stand, seit sie vor über dreißig Jahren geheiratet hatten, und tranken Milchkaffee aus einer gemeinsamen Tasse.
»Das war wirklich ein schönes Fest«, meinte Georg und strich seiner Frau eine braungraue Strähne aus der Stirn.
Annemarie antwortete nicht.
»Was ist denn los mit dir, hat es dir nicht gefallen?«
»Doch, doch …« Sie setzte sich auf.
Beinahe wäre die Flüssigkeit übergeschwappt, Georg konnte die Tasse gerade noch retten. »Ach so«, lächelte er. »Du überlegst, ob du heute vielleicht noch einige Kilometerchen mehr schaffst als gestern.«
Annemarie nickte zögernd. Eigentlich hatte sie an etwas ganz anderes gedacht, aber darüber wollte sie jetzt nicht reden. Georg hatte recht, bis zum Silvesterlauf blieb nur noch wenig Zeit. In der kommenden Woche würde sie täglich trainieren. Seit einem halben Jahr war sie Frührentnerin, Opfer einer Sparrunde der Zürcher Regierung. Ihren Job als Sportlehrerin am Gymnasium Waldstadt vermisste sie immer noch. Gleich an ihrem ersten arbeitslosen Tag hatte sie eine Laufgruppe gegründet mit dem Ziel, den Zürcher Silvesterlauf und später mal den New Yorker Marathon zu bestreiten. Für Annemarie war klar, je härter die Bedingungen, desto größer die Herausforderung.
»Willst du wirklich in den Wald, bei dem Wetter?«, fragte Georg, als hätte er ihre Gedanken gelesen.
»Natürlich! Du gehst ja später auch.«
Georg war der Förster von Waldbach. Seit dem verheerenden Sturm Lothar pflegte er regelmäßig jene Stellen zu kontrollieren, die für Spaziergänger gefährlich werden konnten.
»Da liegst du völlig falsch.« Er lachte und kuschelte sich in die Kissen. »Max hat gestern Nacht eine Runde gemacht.«
Max war Georgs und Annemaries Sohn, der bald die Arbeit seines Vaters übernehmen würde. »Aber Max hat doch den ganzen Abend diese dürre Stadtpflanze nicht aus den Augen gelassen.«
Georg schmunzelte. »Du bist vielleicht ein gehässiges Muttertier. Das Mädchen heißt Eski und ist sehr nett. Sie hat Max begleitet.«
Annemarie schlug ihre Bettdecke zurück. »Ach so, ein romantischer Waldspaziergang im Schnee. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass er dabei einen klaren Kopf hatte?« Sie stand auf. »An deiner Stelle würde ich nochmals gehen.«
Georg schaute ihr zu, wie sie sich das schreckliche T-Shirt mit der Aufschrift des örtlichen Sponsors überstreifte. Gerne hätte er sie wieder zu sich ins Bett gelockt. Doch aus Erfahrung wusste er, dass sie nichts vom Laufen abhielt. Was ihn nicht wirklich betrübte, denn danach war sie manchmal einem angereicherten Nachmittagsschläfchen nicht abgeneigt.
»Ich habe großes Vertrauen in Max. Er hat die Bäume bestimmt gründlich überprüft, auch wenn seine neue Flamme dabei war. Du weißt doch, wir Reinhard-Männer sind die Könige des Multitasking.«
Er hatte noch nicht fertig gesprochen, als die Sonntagszeitung auf seinem Kopf landete.
»Georg Reinhard, du bist ein selbstgerechter Wichtigtuer! Darf ich dich an die Nacht erinnern, in der wir zwei zwischen Tannenwurzeln lagen, während eine ganze Rehherde die Waldstraße blockierte?«
»Und wärst du nicht gewesen, würde sie heute noch dort stehen. Aber das war eine Ausnahme.« Er deutete auf die Zeitung. »Hast du das gesehen? Der Marti wurde gestern ermordet.«
Annemarie, ihr Stirnband zurechtzupfend, schüttelte den Kopf. »Ermordet? Du glaubst auch alles, was dieses Käseblatt schreibt. Schau dir doch den Marti mal an: dick und untrainiert. Er hatte vermutlich einen Herzinfarkt, weil er einige Schritte zu Fuß gehen musste. Geschieht ihm recht, diesem Manipulator.«
Georg unterdrückte eine Antwort. Anders als seine Frau war er mit Martis Politik in bestimmten Bereichen durchaus einverstanden. Dass solche Meinungsverschiedenheiten zu keinem Streit führten, war ein Zeugnis ihrer reichen Beziehung.
Annemarie zog die Turnschuhe an, die sie immer in die Nähe der Heizung stellte, damit sie geschmeidig blieben. »Wenn gestern jemand einen ermordet hat, dann Christian Maag den Pablo«, murmelte sie.
Georg antwortete nicht, er war in den Artikel über Marti vertieft.
»So viel zum Thema Reinhard-Männer und Multitasking. Ich bin in zwei Stunden wieder da. Würde mich über ein spätes Frühstück freuen.«
Er nickte. »Eier und Speck. Geht in Ordnung, Boss!«
Zu diesem Zeitpunkt beobachtete Marie Himmel, Helens Tochter, den schlafenden Elias Heller. Seine Mundwinkel zuckten, es sah aus, als würde er weinen. Marie legte ihm die Hand auf die Stirn, sogleich glätteten sich die Falten. Sie lehnte sich zurück. Das Feuer im Kamin war erloschen. Morgenlicht sickerte hellgrau durch die beiden Fenster, die auf den Greifensee hinausgingen. Ein Lächeln umspielte ihre Lippen, als sie daran dachte, wie sie Elias gestern auf der Fete ihrer Mutter kennengelernt hatte.
Dabei hatte Marie gar nicht gehen wollen. Ihre Brüder Samuel und Jonas hatten sie überredet. Paddy, ihr ehemaliger Trainer, würde dort sein. Selbst wenn sie Waldbach keine Träne nachweinte, den Volleyballklub vermisste sie. Und so war Marie in die fröhlich pulsierende Party geplatzt. Bereits im Flur gab es ein Riesengedränge, halb Waldbach schien eingeladen zu sein. Marie hatte die Runde gemacht, da ein Wort gewechselt, dort ein paar alte Kollegen begrüßt. Bis sie ihre Mutter entdeckt hatte, die in einem unmöglichen Sackkleid viel zu nah neben einem Typen mit schmuddeliger Mähne stand. Beide grinsten wie Idioten. Und dann sah Marie, wie sich ihre Finger berührten. Fuck! So eine Schlampe! Sie hatte kein Recht, zusammen mit diesem Riesen Suppe aus der Schüssel zu schöpfen, die eigentlich ihrem Vater gehörte! Marie hatte sich abgedreht und ein Glas Punsch in sich hineingeschüttet. Und gleich noch eins.
»He, Marie, wie geht’s?« Paddy stand vor ihr. »Ich stell dir einen Kumpel vor, Elias, er ist neu hier.«
Elias hatte gefragt, ob sie die Gastgeberin sei.
Sie hatte den Kopf geschüttelt. »Meine Alte.«
»Hast du Probleme mit ihr?«
Sie hatte genickt.
Er hatte gelächelt. »Das kenn ich.«
Es war Liebe auf den ersten Blick. Sie waren in die Bibliothek gegangen, die im hinteren Teil des Hauses lag. Stundenlang hatten sie dort gesessen. Irgendwann rückten sie enger zusammen, irgendwann küssten sie sich, und irgendwann beschlossen sie zu gehen. Als sie an der Fotowand vorbeikamen, war Elias stehen geblieben. Da hingen unzählige Bilder in verschiedenen, zum Teil sehr kunstvollen Rahmen. Marie hasste die Wand; sie zeigte ihren Vater, ihre Mutter, ihre Brüder, sie selbst. Beweise dafür, dass sie mal eine fröhliche Familie gewesen waren.
Plötzlich war Elias’ Blick an einem Bild hängen geblieben. »Wer ist das?«
»Mein Vater.« Sie hatte auf den lachenden Mann mit dem korrekten Seitenscheitel gezeigt. »Warum willst du das wissen?« Bevor Elias antworten konnte, hatte Helen den Raum betreten. Stinksauer, weil Marie sie nicht begrüßt hatte. Typisch ihre Alte. Sie stritten eine Weile, bevor Marie an den angetrunkenen Kartenspielern vorbei nach draußen gestürmt war. Elias war ihr gefolgt. Zusammen waren sie durch die klirrende Winternacht zu seinem Haus gewandert, das hinter Bäumen versteckt dicht am Ufer des Greifensees lag.
Es war heller geworden. Marie seufzte. Elias murmelte etwas und legte den Arm um sie. Hätte sich Marie umgesehen, hätte sie den Fotorahmen erblickt, der aus der Bauchtasche von Elias’ Kapuzenjacke ragte.
Fausto Signorelli, der Chef der Kapo Uster, stand im großen Sitzungszimmer und stellte eine Task Force zusammen. Er hatte viel zu wenig geschlafen, was bei ihm keine Müdigkeit, sondern Hyperaktivität auslöste. Am Abend vorher war er mit Frau und Kindern auf Schwiegerelternbesuch im Tessin gewesen, als er aus dem Radio vom Tod seines Parteikollegen Anton Marti erfahren hatte. In knapp drei Stunden war er von Lugano nach Uster gerast. Dort war Anton Marti ermordet worden, dort befand sich dessen Familiensitz. Und das hieß, dass hoffentlich die Kapo, zu deren Chef Signorelli erst vor einigen Monaten gewählt worden war, die Ermittlungen leiten würde.
Signorelli klatschte in die Hände. Seine Mitarbeiter stellten die Pappbecher ab und wandten sich ihm zu. Im Hintergrund lief ein Fernseher, die Berichterstattung über den Fall Marti wurde gerade von der Wettervorhersage abgelöst. Auf Signorellis ungeduldiges Zeichen hin beeilte sich Margret Gut, die gute Seele vom Empfang, das Gerät leiser zu stellen. Da sie jedoch die Tasten verwechselte, war ScarLetts fröhliches Lispeln einen Augenblick lang ohrenbetäubend laut zu hören.
Signorelli klatschte erneut. »Los, Leute!« Er ließ die Rollladen herunter, schaltete den Beamer ein und erklärte anhand einer Power-Point-Präsentation, wie er sich die Ermittlungen vorstellte. Ein bewunderndes Murmeln erfüllte den Raum. So etwas hätte der alte Chef, Hannes Sutterlütti, nie zustande gebracht.
Plötzlich öffnete sich die Tür, und Werner Meier trat ein.
Während der Fahrt ins Büro hatte er sich mit den Goldberg-Variationen ein wenig über den Verlust des freien Sonntags hinweggetröstet. Schwungvoll, Goulds Spiel noch im Kopf, ging er auf seinen Lieblingsplatz in der linken hinteren Ecke zu, übersah jedoch das Kabel und stolperte. Die Projektion wackelte bedenklich, und der Laptop fiel mit lautem Scheppern zu Boden.
Einen Augenblick lang war es still.
»Porca miseria!«, flüsterte Signorelli schließlich.
Allgemeines Geraune setzte ein, unterdrücktes Lachen war zu vernehmen. Endlich fand jemand den Schalter, und die ganze Bescherung wurde in helles Neonlicht getaucht. Der Laptop lag da, das Gehäuse unnatürlich nach hinten gedrückt, leicht abstehend. Signorelli versuchte einen Neustart. Natürlich blieb der Bildschirm schwarz, und einen Augenblick sah es so aus, als ob Signorelli das Gerät an die Wand schmeißen würde. »Affangulo! Meier, was haben Sie sich dabei gedacht?«
»Das Kabel … Es lag ein wenig unglücklich. Kann mir mal jemand ein Klebeband reichen?«, antwortete Meier ruhig.
Die anderen sahen betreten auf den Fernseher, wo eine Wettergraphik anhaltenden Schneefall prophezeite.
»Wie ein Elefant sind Sie hereingetrampelt. Was machen Sie überhaupt hier? Sie haben doch frei.«
»Ich wurde angerufen«, antwortete Meier.
»Das war ein Fehler, Sie hatten fünf Wochenenden hintereinander Dienst. Die Überzeiten können Sie gar nicht mehr abarbeiten.«
Meier antwortete nicht. Er umwickelte die Gelenke des Laptops mit Klebeband, das ihm Margret Gut gereicht hatte. Es sah absurd aus. Plötzlich klingelte ein Handy in melodischen Intervallen.
»Ich habe doch gesagt: keine Störungen«, sagte Signorelli.
»Der Empfang muss bedient werden«, meinte Margret entschuldigend. Nervös fingerte sie in ihrer Gürteltasche.
»Er läuft wieder«, sagte Meier in diesem Augenblick. »Bitte sehr, Sie können weitermachen.«
Alle wandten sich ihm zu. Der Beamer projizierte groß Signorellis Bildschirmschoner – ein Foto seiner Frau Aurelia beim Stillen. Signorellis wütender Blick erstickte jegliche Kommentare im Keim.
»Hast du das gesehen?«, fragte Helen und zeigte auf die Schlagzeile der Sonntagszeitung.
»Nein, Helen, ich schlafe noch.« Zita zog sich die Troddelmütze über die Ohren. »Und wenn ich etwas lese, dann nur meine Masterarbeit. Morgen muss ich die Korrekturfassung …«
»Ich weiß«, unterbrach sie Helen. »Trotzdem geht das Leben um dich herum weiter.« Sie deutete auf die Zeitung, während sie nach einem Stück Zopf griff. »Anton Marti ist ermordet worden.«
»Geschieht ihm recht.«
Helen sah Zita missbilligend an.
»Schau nicht so, Helen. Du willst doch nicht ernsthaft behaupten, dass du diesen Idioten gemocht hast. Er war gegen den Umweltschutz, gegen die EU und gegen alle Ausländer. Mit solchen Ansichten lebt man gefährlich.«
Helen musste lachen. »Aber ich wünsche niemandem den Tod.« Sie strich eine dünne Schicht Butter auf ihr Brot.
Zita lief das Wasser im Mund zusammen. »Ja, du nicht, weil du eine friedliebende Seele bist, darum bist du auch nicht in der Politik. Was ist denn passiert?«
»Anton Marti ist gestern offenbar in eine Demonstration geraten. Nun vermutet man, dass die Militanten das Durcheinander ausgenutzt und ihn ermordet haben.«
»Es könnte aber auch ein Wurfgeschoss der Polizei gewesen sein.«
Helen nahm einen Löffel Johannisbeermarmelade und verteilte die dunkelrote Masse liebevoll auf dem weichen Brot. »Es wäre Ironie des Schicksals – Marti von den eigenen Mannen gemeuchelt.«
Zita grinste. »Genau. Eine tolle Schlagzeile! Sag mal, hast du meine neuen Turnschuhe gesehen?«
»Wenn du die Schuhschachtel meinst, die seit Tagen herumsteht – die habe ich nicht angerührt.«
Zita ging durch den Flur und sah sich suchend um. Das örtliche Sportgeschäft hatte den Mitgliedern der Laufgruppe die teuren Joggingschuhe gratis offeriert. Als Gegenleistung mussten sie violette T-Shirts mit der zitronengelben Aufschrift Gesponsert von Fischli Sport tragen. Zita hatte sich geweigert, was ihr jeweils eine amüsierte Ermahnung der Trainingsleiterin Annemarie eintrug.
»Das war wirklich eine tolle Party gestern«, sagte sie, als sie, mit ihren alten, abgelatschten Turnschuhen bewaffnet, in die Küche zurückkehrte.
Helen sah von der Zeitung auf. »Nicht wahr? Ein rundum gelungener Abend. Und alle meine Kinder waren da.«
»Ja, deine beiden Söhne habe ich gesehen. Aber ich konnte sie nicht unterscheiden, sie gleichen sich wie Zwillinge.«
Helen lächelte stolz. »Das war schon früher in der Schule so. Sie sind nur neunzehn Monate auseinander.«
»Marie habe ich nicht kennengelernt.«
Über Helens Gesicht huschte ein Schatten. »Sie war ja auch nur kurz da.«
Zita musterte sie neugierig. Helens Familie war ihr immer unnatürlich friedlich erschienen: die Söhne, welche die Mutter regelmäßig besuchten, der Tod des Ehemanns, den Helen so gut verarbeitete. Irgendwo musste da ein Hund begraben sein. Vermutlich war es Marie, die sich in den knapp drei Monaten, seit Zita hier wohnte, noch nie hatte blicken lassen.
»Genug davon«, sagte Helen abschließend und schenkte sich Tee nach. »Sag mal, du willst doch nicht bei dem Wetter zum Training?«
»Dein Quittenpunsch verstopft mir das Hirn, da hilft nur frische Luft.«
»Aber ScarLett hat weiteren Schnee angesagt.«
»Du meinst die Wetterfee mit der Lispelstimme, die ihr Hirn im Ausschnitt trägt? Entschuldige, aber der Tusse glaube ich kein Wort.«
»Zita!« Helen war echt sauer. »ScarLett ist eine hochintelligente Frau.«
»Das glaubst auch nur du. Ehrlich, Helen, du weißt, dass ich dich sehr gern habe, aber mit ScarLett liegst du völlig falsch. Die ist eine Beleidigung für unser Geschlecht.«
Sie stritten noch eine Weile, während Zita die Schnürsenkel verknotete. Bei ScarLett schieden sich die Geister, und das wussten beide. Zita hatte schon ein ganzes Training damit verbracht, sich mit ihren Laufkolleginnen über die Wetterfee zu streiten, die nicht nur bei Männern, sondern auch bei Frauen eine große Fangemeinde hatte.
Schließlich wandte sich Helen wieder der Zeitung zu. »Da steht, der geplante Sonntagsverkauf in Uster findet statt, aber mit verstärkter Polizeipräsenz. Das wird ein schönes Chaos geben.«
»Wo gibt es ein Chaos?«, ertönte eine tiefe Stimme aus dem Flur.
Zita zuckte zusammen. Noch immer hatte sie sich nicht daran gewöhnt, dass Helen ihre Haustür grundsätzlich nicht abschloss. Im Türrahmen stand ein groß gewachsener Mann. Er trug einen schwarzen Lodenmantel, in seiner grau-schwarzen Mähne glitzerten Wassertropfen.
»Oh, guten Morgen, Pfarrer Keller.« Helen stand auf und schüttelte dem Besucher die Hand. Neben ihm sah sie winzig aus.
Er deutete auf seine Füße, die in selbst gestrickten Wollsocken steckten. »Ich habe die Schuhe draußen gelassen, sie sind voll Schnee.«
»Ach, kommen Sie herein. Möchten Sie einen Tee?« Helen stand bereits am offenen Geschirrschrank und griff nach einer Tasse. Der goldgelben, die für spezielle Besucher reserviert war, wie sie Zita einmal anvertraut hatte.
Pfarrer Keller sah sich um. »Sie sind eine fleißige Frau, Helen Himmel. Noch nicht mal acht Uhr, und alles ist aufgeräumt.«
»Wenn Engel putzen …« Sie kicherte und schob ihm einen Stuhl hin.
Er wirkte unschlüssig. »Ich bin eigentlich gekommen, um zu helfen.«
»Ach was. Susanna erledigt die Feinarbeit. Wir sind ein eingespieltes Team. Jetzt setzen Sie sich.« Plötzlich stockte sie. »Müssten Sie nicht in der Kirche sein?«
Pfarrer Kellers dröhnendes Lachen erfüllte die ganze Küche. »Gut kombiniert, Watson. Was macht ein Pfarrer am Sonntagmorgen bei Helen Himmel?« Er nahm ihr die Tasse ab. »Ich hatte bereits einen Gottesdienst und muss erst um zehn Uhr wieder am Altar stehen.«
»Dann schenken Sie mir Ihre Gegenwart zwischen zwei heiligen Akten. Ich fühle mich geehrt.«
»Ich geh dann mal«, sagte Zita, die sich überflüssig vorkam.
Pfarrer Keller wandte ihr sein faltiges Gesicht zu. »Bei dem Schnee? Sie sind eine sportliche junge Dame.«
Sie winkte ab. »Ich muss mir meinen Kater aus dem Leib rennen.«
»Heute Abend findet ein Konzert in der Kirche statt. Ein Streichquartett. Vielleicht haben Sie Lust zu kommen?«
»Das geht nicht. Ich habe ein Date. Mit meinem Korrekturprogramm.«
Sie rannte los.
Hinter sich hörte sie Pfarrer Keller und Helen lachen.
Ein paar Minuten später joggte Zita durch den Winterwald. Ihr steifer Gang wurde lockerer, und sie begann, den Ausflug zu genießen. Vereinzelt vernahm sie das Zwitschern der Vögel, Schnee fiel von den Bäumen. Zita atmete tief ein und erhöhte das Tempo, was auf dem verschneiten Weg nicht ganz einfach war. Beim Lauftreff legte sie eine Pause ein. Ihr Atem bildete kleine Wolken.
Erstaunt bemerkte sie am Rand des Parkplatzes ein Auto, das wie Janes Rostlaube aussah. Komisch, wieso stand es um diese Zeit im Wald? Plötzlich hörte sie hinter sich ein Geräusch. Sie schrak zusammen. Im Bruchteil einer Sekunde wurde ihr bewusst, dass sie noch nie allein durch den Wald gejoggt war. Nun vernahm sie sogar ein Keuchen. Verdammt noch mal, da war doch jemand. Adrenalin schoss ihr durch die Adern, Panik breitete sich in ihr aus. Sie lief los, ohne sich umzusehen. Gleich würde man sie überfallen! Das hatte sie nun davon – wäre sie bloß in der Stadt geblieben, hätte sie nur nie dieses Studium angefangen, wäre sie nur als Junge auf die Welt gekommen.
»Zita!«
Ihr Verstand brauchte einige Zeit, um zu begreifen, dass der Verfolger sie offenbar kannte. Endlich blieb sie stehen und drehte sich um. Als sie die Frau erblickte, fielen ihr fast die Augen aus dem Kopf. »Jane? Bist du das?«
Tatsächlich, es war ihre Laufkollegin. Jane deutete mit heftigen Armbewegungen in die Richtung, aus der sie gekommen war.
»Was ist los mit dir? Bist du immer noch betrunken?«
Als wäre es das vereinbarte Stichwort, beugte sich Jane zur Seite und erbrach sich in den Schnee.
»Scheiße.« Zita schluckte ihren Ekel hinunter, Jane ging es offensichtlich sehr schlecht. »Komm, du musst dich setzen.«
Sie führte Jane zu einer Bank, wischte den Schnee weg. »Hey, was ist denn los?«
Jane schwieg.
»Was machst du hier? Du müsstest doch zu Hause bei deinen Kindern sein. Hütet deine Schwiegermutter sie an einem heiligen Sonntagmorgen?«
Unvermittelt schoss Jane hoch und rannte wieder los. Ohne zu überlegen, folgte ihr Zita, konnte jedoch kaum Schritt halten. Sie bekam Seitenstechen, spürte, wie ihre Beine schwer wurden. Da blieb Jane stehen. Zita konnte ihr gerade noch ausweichen, bevor sie kopfüber landete, nicht im Schnee, sondern auf einer Art Matte. Sie rappelte sich hoch. Und erblickte ein starres Auge in einem weißblauen Gesicht. Entsetzt schrie Zita auf. »Was ist das?«
Vor ihr lag eine Gestalt im Schnee. Sie trug eine Art Umhang. Um den Hals einen silbernen Seidenschal. Ein Schlapphut lag daneben, so als ob ihn ein Ritter vor dem Kampf zur Seite gelegt hätte. »Oh Scheiße! Die ist verletzt oder tot. Schnell, wir müssen einen Arzt rufen. Und die Polizei!«
Jane wimmerte auf. »Das ist meine Schwiegermutter!«
»Was?«
Jane nickte.
»Und was macht sie hier mitten im Wald in diesem komischen Aufzug?« Ohne Janes Reaktion abzuwarten, beugte sich Zita über die Frau und versuchte, ihren Puls zu ertasten. Da war nichts. Sie überlegte blitzschnell. »Los, gib mir deinen Autoschlüssel.«
Doch Jane schüttelte den Kopf.
Hatte sie nicht alle Tassen im Schrank? Hier ging es um Leben oder Tod. »Und warum nicht?«
»Meine Schlüssel sind zu Hause. Ich habe keine Ahnung, warum mein Auto hier im Wald steht.«
»Also gut, dann laufe ich los.«
»Nein!«, schrie Jane entsetzt und begann, hin und her zu schaukeln, die Arme um den Oberkörper geschlungen.
Zita wurde wütend. »Wir müssen dringend Hilfe holen, und ich habe kein Handy dabei.«
Jane fummelte in ihrer Jacke herum, und holte ein Handy heraus.
Zita war fassungslos. »Bist du verrückt? Warum hast du nicht längst einen Krankenwagen gerufen?«
»Ich weiß nicht … mit dem Handy rufe ich nur meine Kinder an. Und Mike.«
Zita riss ihr das Gerät aus der Hand und wählte die Notfallnummer.
Im Sitzungszimmer der Kapo war Fausto Signorelli damit beschäftigt, seine Einteilung zu ändern, denn es hatte sich herausgestellt, dass er vergessen hatte, die aktuellen Dienstpläne zu berücksichtigen. Als Margret Guts Handy erneut klingelte, warf er ihr einen vernichtenden Blick zu. Trotzdem nahm sie den Anruf entgegen. »Da ist jemand aus Waldbach«, sagte sie einen Moment später. »Eine Frau meldet eine Tote im Wald.«
Wie auf Befehl sahen alle zu Boden. Keiner hatte Lust, an diesem eisigen Wintertag einen möglichen Tatort zu sichern.
Signorellis Blick blieb an Meier hängen. »Übernehmen Sie das, wenn Sie schon hier sind.« Ohne Meiers Antwort abzuwarten, wandte er sich wieder seiner Einteilung zu. Die Zeit drängte. Draußen lief ein Politikermörder herum, und er wollte ihn fassen.
Meier verließ das Sitzungszimmer. »Leg das Gespräch in mein Büro, Gritli. Aber erst in zwei Minuten, ich muss vorher noch was erledigen.«
Vor dem Snackautomaten blieb Meier stehen. Doch die Fächer waren leer, logisch, es war Sonntag. Ärgerlich entschied sich Meier für eine Dose Cola. Dann ging er in sein Büro, wo das Telefon bereits klingelte.
»Meier.«
»Endlich«, sagte eine Frauenstimme. »Das hat ja ewig gedauert! In dieser Zeit könnten locker zehn Morde passieren.«
»Dürfte ich um Ihren Namen bitten?«, fragte Meier gereizt.
»Hier liegt eine Tote«, erwiderte die Frau, ohne auf seine Frage einzugehen.
»Sind Sie sicher, dass die Frau tot ist?«
»Ich bin kein Arzt.«
»Wieso behaupten Sie dann, dass sie tot ist?«
»Sie hat so einen starren Blick. Reicht Ihnen das, Herr Commissario?«
Meier überhörte die ironische Anrede. »Also, dann sagen Sie mir doch, wo Sie sich befinden.«
»Im Wald.«
»Geht das etwas präziser?«
»Hier sieht alles gleich aus.«
Meier trommelte mit dem Bleistift ungeduldig auf sein Notizbuch. »Ich weiß, aber Sie müssen mir irgendwelche Anhaltspunkte nennen.«
»Keine Ahnung. Es ist im Wald, verdammt noch mal! Da haben die Wege keine Namen, und wenn, dann würde ich sie nicht kennen.«
»Wie sind Sie denn dahin gekommen?«
»Ich bin Jane hinterhergerannt.«
»Wer ist Jane?«
»Meine Freundin, Jane Heller.«
»Die Tote?«
»Nein, das ist ihre Schwiegermutter.«
»Die Tote ist die Schwiegermutter von Frau Heller?«
»Genau.«
»Und Frau Heller ist auch dort?«
»Das habe ich doch gesagt. Sind Sie eigentlich taub?«
»Nein«, sagte Meier trocken. »Ich versuche bloß herauszufinden, wer Sie sind und wo Sie sich befinden.«
»Hören Sie, ich bin völlig hysterisch. Ich will, dass sofort jemand kommt.«
Meier musste lachen. Immerhin verfügte die Frau über ein gewisses Maß an Selbsteinschätzung.
»Warum grinsen Sie so blöd?«
Meier ignorierte die Frage. »Würden Sie jetzt bitte versuchen, mir den Weg zu beschreiben?«
»Zum Parkplatz des Joggingtreffpunkts in Waldbach. Dort zweigt ein Pfad ab, in Richtung Greifensee.«
»Na also, das war doch ganz einfach. Rühren Sie sich nicht von der Stelle, wir sind gleich bei Ihnen.«
»Das will ich hoffen. Ich frier mir hier den Arsch ab!«
Meier konnte ein weiteres Lachen nur knapp unterdrücken. »Noch etwas«, sagte er, während er bereits vor der Landkarte stand, welche die gesamte Umgebung im Großformat zeigte. »Wie heißen Sie eigentlich?«
»Zita Schnyder. Mit einem Z wie Zürich. Und Schnyder mit Ypsilon.«
Meier legte auf. Er fragte sich, wie diese Zita aussah. Ihre Stimme hatte sympathisch geklungen, trotz der Hysterie. Und ihre Selbstsicherheit gefiel ihm.
Die Cola in einer Hand, knöpfte er mit der anderen den Mantel zu und verließ das Büro. Den alten roten MG hatte er genau vor dem Haus geparkt. Plötzlich fiel ihm ein, dass er die Gummistiefel nicht dabeihatte. Skeptisch musterte er seine polierten Lederschuhe – nicht gerade passend für einen zugeschneiten Wald.
Mittlerweile war es kurz nach neun, und Pfarrer Keller wurde dringend in der Kirche erwartet.
Bevor er ging, legte er einige Flugblätter auf den Tisch. »Das Konzert wird bestimmt sehr schön. Der zweite Geiger ist ein Polizist aus Waldstadt. Sehr netter Mann übrigens, manchmal trinkt er im Hirschen ein Bier. Das Quartett gibt es schon länger, aber bei uns treten sie zum ersten Mal öffentlich auf.«
Helen lächelte. Sie hatte eigentlich überhaupt nicht mehr aufgehört zu lächeln, seit der Pfarrer ihre Küche betreten und eine Tasse Tee nach der anderen getrunken hatte. Dann sah sie auf die Uhr. »Ach du meine Güte, wie die Zeit vergeht! Susanna kommt jeden Moment.«
Sie stand auf und warf einen Blick aus dem Fenster. Pfarrer Keller trat neben sie. Es fing wieder an zu schneien. Noch fielen die Flocken vereinzelt, aber am Horizont türmte sich eine dunkelgraue Wand auf.
»Dann hatte sie recht«, bemerkte Helen.
»Wer hatte recht?«
»ScarLett, die Wetterfee. Sie trifft fast immer ins Schwarze.«
Der Pfarrer, trotz oder wegen seines Berufs ein absoluter Realist, verzichtete darauf, Helen auf das Team von Meteorologen hinzuweisen, das mit Sicherheit ScarLetts Ansagen bis ins letzte Detail vorbereitet hatte. Er griff nach seinem Hut.
»Einen Augenblick. Ich habe etwas für Sie«, sagte Helen und ging durch den Flur.
»Ein Adventsgeschenk?«, fragte Pfarrer Keller und folgte ihr. Neugierig schaute er sich um; in dem Zimmer war er noch nie gewesen. Auf drei Seiten war es gesäumt von Bücherregalen, die bis unter die Decke reichten. Die vierte Wand war voller Fotos.
Helen ging zu einem kleinen Beistelltisch, auf dem Berge von getrockneten Gräsern lagen. Sie griff sich ein Büschel und begann, die Enden mit einer dünnen Schnur zu umwickeln. »Lavendel«, sagte sie. »Das Einzige, was in meinem Garten so wächst, wie ich es will. Vielleicht können Sie den in der Kirche an die Wand hängen.« Sie reichte dem Pfarrer einen dicken Strauß.
Er vergrub seine Nase darin. Tatsächlich, die getrockneten Blüten rochen nach Sommer, nach Sonne, nach Leichtigkeit. »Vielen Dank«, sagte er und schüttelte Helen kräftig die Hand.
»Keine Ursache. Sie können noch mehr haben, wenn Sie wollen. Sie sehen ja …« Plötzlich erstarrte sie.
»Was ist?«
»Nichts.« Immer noch stand sie regungslos da und wirkte noch kleiner, als sie ohnehin war. Dann fasste sie sich wieder. »Diese Kinder«, seufzte sie. »Manchmal denke ich, es hört nie auf.«
»Die Sorgen?«
»Sie werden nicht weniger. Dabei hab ich gehofft, ich hätte es hinter mir.«
»Ist es so schlimm? Oder vielleicht nur viel Lärm um nichts?«, fragte der Pfarrer.
»Es geht um meine Tochter Marie. Sie wollte ein Foto mitnehmen, und ich hab’s ihr verboten. Aber sie hat es trotzdem getan.«
»Das war nicht nett von ihr.«
»Ach, ich bin selber schuld. Natürlich hätte ich es ihr einfach geben sollen. Aber ich hänge eben an allem, was mit Heinrich zu tun hat.« Sie ging durch den Flur wieder zurück. »Marie leider auch. Das ist unser Problem.«
»War es ein wertvolles Foto?«
»Nicht besonders. Es hatte eher nostalgischen Wert. Mein Mann war drauf zu sehen. Und viele alte Freunde – versammelt um eine schöne Frau.«
»Um Sie, wie ich annehmen darf.«
Helen schüttelte den Kopf. »Nein, nein. Im Grunde genommen ist es absurd, dass es so lange da hing. Marie kann es gerne haben.« Sie öffnete die Haustür, ein Schwall kalter Luft drang herein. »Solange nur ein Foto und der Quittenschnaps verschwinden …«
Der Pfarrer hatte den Lavendelstrauß auf den Boden gelegt und zog seine Wanderschuhe an. »Was?«
»Die Flasche ist einfach nicht mehr da. Vermutlich werde ich sie im Putzschrank wiederfinden. Oder in einem Schuhregal.«
»Das will ich hoffen«, meinte er und richtete sich auf. »Ihr Quittenschnaps ist der beste der Welt.«
»Nicht wahr? Mein Nachbar Pablo hat ihn gebrannt. Das war die letzte Flasche.«
»Dann müssen wir auf den nächsten Sommer hoffen«, sagte der Pfarrer und hob den Lavendelstrauß auf. »Vielleicht können Sie mich mal mit Pablo bekannt machen. Im Pfarreigarten steht ein Zwetschgenbaum, und meine Köchin meint, der sei sehr fruchtbar. Aber sie hat wohl eher an Kuchen und Marmelade gedacht als an Schnaps.«
Helen lächelte. »Ich werde es ausrichten. Dann können Sie ihm ja heimlich zehn Kilo vorbeibringen. Das machen fast alle im Dorf.« Helen zog ihre Jacke an. »Ich begleite Sie bis zum Zaun.«
Sie liefen zusammen durch den Garten. Ab und zu fiel eine vereinzelte Flocke vom Himmel. Vom Wald her näherten sich zwei Gestalten.
»Sieh mal an«, scherzte Pfarrer Keller. »Da kommt schon der nächste Besuch.«
Er drückte Helen zum Abschied die Hand und stapfte in Richtung Dorf, das brummende Handy in seiner Tasche ignorierend. Er wusste ohnehin, dass es sein überängstlicher Mesner war, der sich Gedanken machte, wer wohl die Predigt halten würde.
Helen blieb am Gartentor stehen und sah zu, wie Susanna und Annemarie durch den Schnee rannten. Es sah lustig aus, wie Bälle mit Beinen, die immer wieder wegzurutschen drohten. »Unglaublich«, rief sie ihnen zu. »Sonntagmorgen, es schneit, und ihr seid schon am Trainieren!« Sie deutete auf Susannas Rucksack. »Wieso hast du denn das Ding auf dem Rücken?«
Susanna zog die Handschuhe aus und klemmte sie zwischen die Beine. »Ich brauche meine speziellen Putzlappen, das weißt du doch. Außerdem verstärkt der Rucksack den Trainingseffekt«, antwortete sie. »Heute sind wir sogar die lange Strecke um den See gelaufen. Obwohl ich gestehen muss, dass ich kaum aus dem Bett gekommen bin. Du musst irgendwas in deine Bowle getan haben, die war teuflisch.«
»Mein Geheimrezept. Holundersirup und Quittenschnaps.«
»Ich hätte es wissen müssen, es hat einfach zu gut geschmeckt, um harmlos zu sein.« Susanna seufzte gespielt vorwurfsvoll. Dann zwinkerte sie Helen zu. »Aber du bist auch schon auf und hattest bereits Besuch.« Sie deutete in Richtung des Pfarrers, der nur noch als winziger Punkt am Horizont zu sehen war.
»Er wollte mir beim Aufräumen helfen«, verteidigte sich Helen.
»Ach, nennt man das heute so?«
Annemarie, die bisher geschwiegen hatte, sah Susanna von der Seite an. »Ich glaube, du hältst besser den Mund. Wie du gestern mit Pablo geflirtet hast …«
Helen nickte. »Dabei solltest du wissen, dass bei ihm nichts zu holen ist. Wie lange kennst du ihn schon? Fünfzig Jahre?«
Susanna lachte. »Na und? Ich kann es doch immer wieder probieren. Außerdem hat es keiner gesehen.«
»Da irrst du dich«, widersprach Annemarie. »Nachdem du nach Hause gegangen bist, hat mich Christian gefragt, ob er vor Pablo Angst haben muss.«
»Und was hast du ihm geantwortet?«
»Was wohl? Dass Pablo und du zusammen die Schulbank gedrückt habt und dass so was natürlich ein Band fürs Leben schafft. Dass er sich aber beruhigt zurücklehnen und weiter Karten spielen kann, denn wenn du was mit Pablo hättest anfangen wollen, hättest du es schon vor Jahren gemacht.« Sie sah Susanna prüfend an. »Es ist doch so, oder nicht?«
»Natürlich«, entgegnete Susanna unbeschwert. »Jetzt spielt doch nicht Moralapostel! Ihr wisst genau: Das mit Pablo und mir ist eine ewige Liebesgeschichte ohne Happy End. Ganz im Gegensatz zu Pfarrer Keller und Helen. Wie ist es, wann dürfen wir mit der Hochzeit rechnen?« Sie wandte sich Helen zu, die tatsächlich rot anlief.
»Er war nur hier wegen der Werbung für das Kirchenkonzert.« Sie drückte Annemarie und Susanna je einen Flyer in die Hand, die sie rasch geholt hatte. »Einer der Musiker ist ein Bekannter von ihm.«
Annemarie warf einen Blick darauf. »Ich würde gerne kommen, aber Georg … ihr wisst ja.«
Natürlich, Annemaries Mann mochte nur Jazz. Das war der Vorteil, dass sie sich seit so vielen Jahren kannten: Sie brauchten kaum etwas zu erklären.
In der Ferne läuteten die Kirchenglocken.
Annemarie zog das Stirnband zurecht. »Jetzt muss ich nach Hause. Georg macht mir ein spätes Frühstück.«
Sie nickte ihren Freundinnen zu und lief los. Am Waldrand vernahm sie ein Bellen, und ein schwarzes Etwas schoss auf sie zu. Es war Pablos Hund Basko, der freudig an ihr hochsprang. Annemarie begrüßte ihn gebührend, bevor sie sich Pablo zuwandte, der durch den Schnee stapfte, die schwarze Strickmütze wie immer tief in die Stirn gezogen, die Sonnenbrille vor den Augen.
»Auch schon unterwegs?«, fragte sie statt einer Begrüßung. »Ist spät geworden gestern, nicht wahr?«