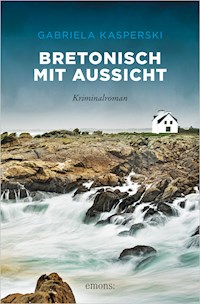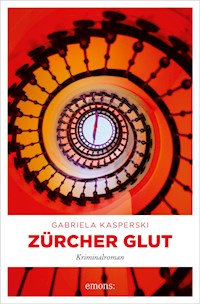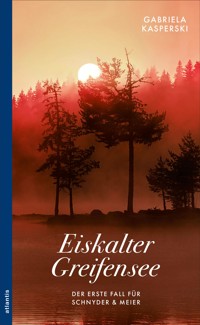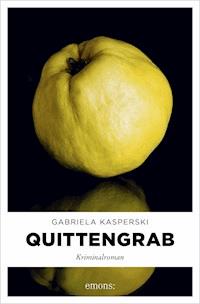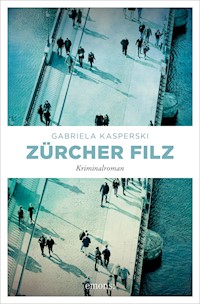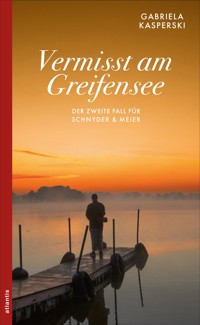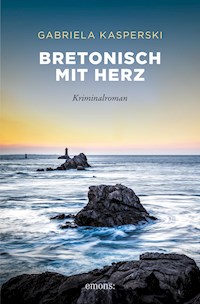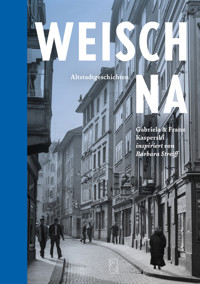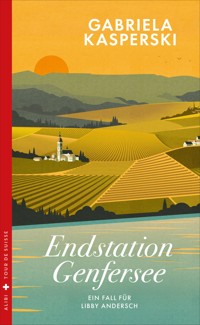Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Emons VerlagHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tereza Berger
- Sprache: Deutsch
Ein feinsinniger Wohlfühlkrimi zum Mitfiebern und Entspannen. Buchhändlerin Tereza Berger begleitet Commissaire Gabriel Mahon zu einer Hochzeit auf Ouessant, der westlichsten Insel Frankreichs. Doch die geplante Zeremonie steht unter keinem guten Stern, denn der Bräutigam ist verschwunden, ein Sturm zieht auf, und an den Klippen werden tote Vögel gefunden – mit Protestzeilen gegen das Windparkprojekt, für dessen Umsetzung die Braut verantwortlich ist. Hat es jemand auf das Paar abgesehen? Tereza stellt Nachforschungen an und macht eine grausige Entdeckung …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben. Den Sommer verbringt sie seit vielen Jahren in der Bretagne.
www.gabrielakasperski.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Sandra Radl
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
ISBN 978-3-98707-061-7
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
À Nadine A.
Für Nicole L.
Der Leuchtturm
Der Felsen wächst ins Meer hinaus,
Und aus der Spitze, Meilen entfernt,
Erhebt sich des Leuchtturms Gemäuer,
Ein Kissen aus Feuer bei Nacht, aus Wolken bei Tag.
Sogar von weit weg kann ich sehen,
Wie am Fuß die Gezeiten tosen und brechen,
Unsäglicher Zorn, auf und ab,
In weißer Gischt, mit zitterndem Gesicht.
Und wenn es dann Abend wird, schau!
Wie das Licht im Purpur der Dämmerung erstrahlt,
Wie alles glänzt und scheint und blendet,
So hell, als wäre es nicht von dieser Welt!
Henry Wadsworth Longfellow
Prolog
Ouessant, Phare du Stiff, 16.Juni 1896
Ich erwache mit einem Ruck. Der Turm bebt, ganz tief im Inneren, wie er es sonst nur bei zehn Beaufort tut. Der Löffel zittert, die Lampe rutscht, ein Klirren in der Luft. Ich reibe die Augen, stehe auf und trete ans Fenster. Wie ein dichter Vorhang hat sich der Nebel ausgebreitet und wabert um den Turm. Mir ist kalt, das Herdfeuer ist erloschen, die Kaffeekanne leer. Die Uhr ist um zweiundzwanzig Uhr zweiundfünfzig stehen geblieben.
Ich verlasse die Küche und steige am Maschinenraum vorbei nach oben. Der Sturm am Vortag war heftig, eine der Fensterscheiben in der Lukarne weist einen Riss auf. Ich trete hinaus auf die Galerie. Es ist, als ob ich auf einem Segelmast stehen würde, um ins unendliche Niemandsland zu segeln. Ich muss husten.
»Das Wetter ist Gift für deine Lunge«, hat mich Vovone gemahnt. Sie keift viel in letzter Zeit, sie ist unglücklich.
»Eines Morgens, wenn du heimkommst, ist sie mit dem Boot davongerudert«, sagt Fanch.
In Richtung Süden blitzt es. Ein kurzer schmutzig gelber Strahl, vielleicht fünf Meilen entfernt, in der Nähe der Pierres Vertes, der »Grünen Steine«. Ist das ein Schiff?
Ich blinzle, schaue noch mal hin. Da ist diese Nebelwand. Sie kommt näher, sie pulsiert. Sie winkt mir zu. Hierher, hab keine Angst, trau dich. Aber ich weiß, der Nebel ist schlimmer als jeder Sturm, gefährlicher als jedes Unwetter. Er kommt heimlich, überrascht dich von hinten, zieht die Farbe aus den Blumen und den Glanz aus den Augen. Und wieder ist da dieser Knall.
»Ich muss zum Arlan-Strand, es ist ein Unglück passiert.«
Ich steige die Treppe hinunter. Trete hinaus. Immer geradeaus über die Wiese bis zur Straße. Ich durchquere die Landspitze und erreiche den Strand. Er ist schmal, aber flach. Es ist Flut, regelmäßig schieben sich die Wellen ans Ufer.
1
»Gabriel Mahon lässt mich sitzen, ich hätte es wissen müssen.« Suchend sah ich durch die Frontscheibe des Elektromobils. Von Mahons Royal Enfield Bullet, einem Motorrad von nostalgischem Charme mit lautem Motor, war weder etwas zu sehen noch zu hören. »Er wollte um sechs hier sein. Irgendwas unglaublich Wichtiges wird ihm dazwischengekommen sein. Einmal mehr.«
Schon vor einem knappen Jahr hatte mich Gabriel Mahon, der örtliche Commissaire, mit dem ich einige Abenteuer erlebt hatte, eingeladen, ihn auf die Insel Ouessant zu begleiten, die westlichste und stürmischste Insel Frankreichs. Der Sohn eines Freundes sollte heiraten. Das Fest und damit der Ausflug waren immer wieder verschoben worden, aber nun sollte es wunderbarerweise endlich so weit sein.
Wir hatten uns direkt am Quai von Camaret-sur-Mer verabredet, wo die Fähre am äußersten Pier des Fischerhafens zur Abfahrt bereitstand. Obwohl es unanständig früh war, hatte sich schon eine Schlange gebildet, plaudernde Menschen, voller Erwartung auf die Überfahrt, die eine gute Stunde dauern sollte.
»Wer zu spät kommt, kriegt nur noch die miesen Plätze, hat Gabriel gedroht«, sagte ich zu Isidore Breonnec, der den Fahrersitz neben mir verlassen hatte, um sich an der Ladefläche des Elektromobils zu schaffen zu machen.
Isidore war mein Mann fürs Grobe, ein Handwerker, der buchstäblich alle Probleme löste, selbst die unlösbaren. Seit meiner Ankunft auf der Halbinsel vor zwei Jahren war er mir bei der Renovierung der »Villa Wunderblau« behilflich gewesen.
»Pech für ihn, würde ich sagen.«
Isidore sah mich an. »Wieso seid ihr denn nicht zusammen gekommen?«
»Ich bin nicht mit ihm liiert, wie du weißt.«
Sein Grinsen war unmissverständlich. Mit einem ächzenden Laut hievte er den Koffer auf den Boden. »Mensch, Tereza, was hast du denn alles mitgenommen? Ist doch nur für vier Tage.« Er rückte sein blaues Käppi zurecht und holte die E-Zigarette hervor.
»Eine Frau muss vorbereitet sein«, sagte ich, packte die legendäre Boule-rouge-Tasche, die ebenfalls aus allen Nähten platzte, und stieg aus. Als Merguez, der Hund, eine liebenswürdige Trottoir-Mischung, mir folgen wollte, hielt ich ihn zurück. »Stopp, mein Lieber. Du bleibst bei Isidore.«
In meiner Abwesenheit würde er den Hund hüten, während meine Mitarbeiterin Sylvie – eine Deutsche aus Heidelberg, hier gestrandet wie ich – den Rest übernahm. Dabei handelte es sich um das »DEJALU«, die erste deutsch-englische Buchhandlung der Bretagne.
»Genieß es, Tereza«, hatte Sylvie gesagt. »Seit unserem Shakespeare-Festival klebst du hier fest.«
Die dramatischen Umstände um »Un goût de Shakespeare – Salon littéraire de Camaret-sur-Mer« hatten unserem Laden letzten Sommer ganz ordentliche Aufmerksamkeit verschafft. Von überallher kamen seither die Touristinnen und Touristen, um Bücher zu kaufen, Kaffee zu trinken und zu plaudern. Das Geschäft mit antiquarischen Trouvaillen war gewachsen, kein Tag verging, ohne dass nicht jemand anrief und mich um eine Einschätzung bat. Die vielen Originale, die auf bretonischen Dachböden und in Kellern auftauchten, entpuppten sich zwar meist als Kopien oder Fälschungen, aber eine Schrift vom Ortspoeten Saint-Pol-Roux hatten wir so erfolgreich veräußern können, dass sich unsere finanzielle Lage verbessert hatte – anstatt schief lag sie nur noch halb schief. Was es mir erlaubt hatte, im Winter nicht wie sonst für Aushilfsarbeiten nach Zürich zu fahren, sondern hierzubleiben. Mit dem Resultat, dass ich im Garten der »Villa Wunderblau« zu Beginn der Hauptsaison in einer Woche das Gästehaus eröffnen würde, mit hauseigener Quelle und inmitten von Lavendel, Thymian und Brombeerbüschen.
Ein Schiffshorn tönte über den Platz, der sich vom ehrwürdigen, etwas baufällig wirkenden Hafengebäude bis zu den Landungsplätzen erstreckte. An einem kleinen Kiosk gab es ein Gedränge, und der Duft nach Kaffee und frischen Croissants erinnerte mich daran, dass mein Frühstück ausgefallen war.
»Die Fähre fährt in einer Viertelstunde.« Isidore blickte zum Pier, wo die Leute dabei waren, über einen steilen Steg ins zweistöckige Fährschiff einzusteigen.
»Das sind sicher mehr als zweihundert«, stellte ich fest.
Er nickte. »In der Hauptsaison ist das jeden Morgen so. Ouessant ist beliebt, obwohl man es sich erkämpfen muss. Und heute herrscht noch mehr Seegang als üblich. Bist du wellentauglich, Tereza?«
»Hallo? Ich bin am Zürichsee aufgewachsen. Schwimmen ist mein zweites Naturell. Außerdem übertreibst du. Das Meer sieht friedlich aus, eine flache Scheibe, kaum aufgewühlt.«
Mit der Expertise konnte ich Isidore nicht überzeugen. »Die Überfahrt hat es in sich, am schlimmsten ist die Passage zwischen Ouessant und dem Archipel von Molène. Das ist die vorgelagerte Inselgruppe, die aus einer bewohnten Insel und vielen kleinen Inselchen besteht. Auch gestandenen Seefahrern wird da schlecht.«
Mal sehen, wie Gabriel sich schlägt, dachte ich.
Isidores Handy klingelte. Seine Freundin wollte wissen, wo er blieb. »En route, chérie.«
Er machte Anstalten, meinen Koffer zur Anlegestelle zu schleppen.
»Lass mal, dafür gibt’s die praktischen Rollen. Merci mille fois und gibt acht auf Merguez.«
»Aber sicher, Tereza, bring mir dafür Fotos von den Leuchttürmen mit. Von jedem eines.« Ouessants Leuchttürme waren weitherum bekannt. »Sean ist der Helikopterpilot der Insel. Er zeigt euch bestimmt die Umgebung von oben. Wenn du Glück hast, lädt er dich auf einen café au lait im Laternenraum ein, dreihundertsechzig Grad Wasser und Windstärke fünf.«
»Bewahre, ich mag Boden unter den Füßen. Und Sean hat vermutlich anderes zu tun, er will heiraten. Es soll ja eine typisch bretonische Hochzeit geben.«
»Die Hochzeit, die hätte ich doch glatt vergessen.« Isidore verzog das Gesicht, als hätte er in eine Pariser Gurke gebissen. »Am 16. Juni, ausgerechnet, ein besseres Datum hätte ihnen nicht einfallen können. Ich hoffe, dass dann auch alles wie geplant über die Bühne geht.«
»Warum nicht? Was meinst du damit?«
Isidore ließ die Frage in der Luft hängen, indem er mir die obligaten drei Küsschen gab. »Vergiss, was ich gesagt habe, Tereza. War blöd von mir.« Er machte sich ans Einsteigen.
»Grüß mir meinen Cousin, den schlimmen Auguste Breonnec.«
»Den schlimmen Auguste? Wie erkenne ich ihn?«
»Auf Ouessant kennt jeder jeden.«
Damit war Isidore weg, das Letzte, das ich sah, war Merguez’ wedelnder Schwanz.
Was er wohl mit dem Hinweis auf das Hochzeitsdatum gemeint hatte?
Ich wusste über die Brautleute nur das, was Gabriel mir erzählt hatte. Also fast nichts. Sean war der Sohn seines Freundes Patrick, den Gabriel bei seinem ersten Besuch auf Ouessant vor vielen Jahren kennengelernt hatte. Er war sofort von der Insel fasziniert gewesen und immer wieder hingefahren, seine Ex-Frau hatte die Begeisterung geteilt. An dem Punkt hatte ich mich freiwillig aus dem zähen Gespräch ausgeklinkt, wie immer, wenn sie erwähnt wurde.
Ich musste Isidore missverstanden haben, entschied ich. Auch wenn ich die Sprache mittlerweile sehr gut beherrschte, die verschiedenen Bedeutungen der Wörter und vor allem die Zwischentöne, der Text unter dem Text, waren mir oft noch fremd. Außerdem hatte ich keine Lust, mir meine Laune verderben zu lassen.
Im Westen leuchtete der letzte Abendstern, während der Himmel im Osten von lichtem Blau war, darauf verstreut feine Schäfchenwolken, bald würde die Sonne aufgehen.
»Bonjour, Tereza.« Ayala stoppte ihr Rad neben mir.
Ich machte große Augen. »Du hier? Ich dachte, du kommst erst nächste Woche.«
Ayala und mein Sohn Kai waren ein Paar, er lebte in Berlin, sie lebte hier, die beiden pendelten, und wenn sie weg war, hütete ich mit Begeisterung ihre Tochter Mathilde. Die Kleine nannte mich Omi Tereza und beriet mich in Sachen Kinderbuchliteratur. Ich liebte sie so abgöttisch wie meine anderen beiden Enkel, die Kinder meiner Tochter Lovis. Sie hatten sich in Australien niedergelassen, aber schon in einer Woche würden sie herkommen, zum traditionellen Sommerurlaub und zur Eröffnung des Gästehauses.
»Ab dem Wochenende ist herrlichstes Surfwetter angesagt.« Ayala hatte eine Surfschule in der Nähe von Camaret-sur-Mer, den Sommer über war sie sehr gefragt. »Ich habe den Saisonstart aufgrund der Wetterlage vorverlegt, und die Workshops sind voll.«
Sie war wie immer eine Augenweide, die gelben Turnschuhe, die sie zur bunt gemusterten Latzhose trug, bildeten einen Kontrast zu ihrer dunklen Haut, ihr Haar war kunstvoll zu dichten kleinen Zöpfen geflochten. »Aber ein Platz lässt sich immer frei machen, falls du Lust hast.«
Schwungvoll zog ich den Haltegriff aus dem Rückteil des Koffers. »Schade, so ein Pech, aber ich bin nicht hier.« Dass ich mich mit dem Surfen schwertat, war ein Dauerthema zwischen uns.
»Wanderst du aus?«, fragte Ayala mit Blick auf mein Gepäck.
»Wir fahren zu einer Hochzeit.«
»Mit ›wir‹ meinst du …«
»Gabriel und mich.«
Ihr Zwinkern wirkte spöttisch. »Und wo ist der Ring?«
»Der Sohn seines besten Freundes heiratet. Gabriel ist mit der Familie sehr verbunden. Patrick, der Vater, fährt auch eine Royal Enfield Bullet. Und Sohn Sean ist als Helikopterpilot manchmal für die Police nationale in Brest im Einsatz.«
»Ich weiß«, sagte Ayala. »Ich kenne die Braut, Nathalie Dumoulins.«
Mir blieb der Mund offen stehen. »Hättest du mir gleich sagen können, bevor ich die Familiengeschichte deklamiere.«
Sie ging nicht darauf ein. »Wo steckt Gabriel überhaupt?«
»Er kommt gleich.« Ich fixierte Ayala. »Was ist mit der Hochzeit? Du hast so eigenartig geklungen.«
»War nicht meine Absicht.«
Im Lügen war sie sehr schlecht. »Ayala, spuck es aus. Die Fähre fährt gleich los.«
»Frag Gabriel.«
»Das ist eine gute Idee, er wird mir sicher alles ausführlich darlegen.«
Sie verstand meine Ironie. »Details kriegst du auch von mir nicht.«
»Ayala …«
Sie gab nach. »Zwischen Sean und Nathalie war es anfänglich ein coup de foudre.«
Also eine Blitzliebe. »Das kann ja sehr romantisch sein. Ich denke da an Tom Hanks und Meg Ryan.«
»In ihrem Fall geht’s mehr in Richtung Romeo und Julia.«
»Klingt nach Drama.«
»Na ja, es gibt auf der Insel gerade eine Art Klimastreit.«
»Du meinst, Streik?«
»Nein, Streit. Patrick, Seans Vater, ist nicht im selben Lager wie Nathalie.«
»Der Bräutigam-Vater gegen die Braut?«
Sie schickte sich an, auf ihr Rad zu steigen.
»Hiergeblieben. Jetzt wird’s interessant. Was ist mit Gabriel?«
»Der versucht zu vermitteln.«
Hatte ich mich verhört? »Darin ist er ja stark.«
»Könnte ein Grund sein, warum er dich dabeihaben wollte.«
»Und nicht, weil er mich so scharf findet? Da fühle ich mich echt geehrt.«
Ihr Lachen war ansteckend. »Es wird sicher alles gut laufen, Nathalie postet zumindest auf Instagram Bilder vom Kleid, von der Kirche, vom Dorfplatz. Ich wollte am Samstag auch rüberkommen.«
»Wie toll, dann habe ich jemanden zum Reden. Falls Gabriel sich in Männerschweigen an der Bar hüllt.« Etwas wollte ich noch wissen. »Woher kennst du Nathalie?«
»Ich habe mal einen Kurs bei ihr besucht, ökologisches Windsurfen. Sie ist Pariserin. Umweltwissenschaftlerin.«
»Sie ist aus Paris? Und Sean ist ein Ouessantin? Das wird ja immer besser: Die Pariser gegen die Bretonen, der Konflikt ist unüberwindbar.«
»Du bist der beste Gegenbeweis. Keine drei Jahre hier und schon kaufen auch die Französinnen bei dir ein.« Damit radelte Ayala endgültig davon. »Schöne Überfahrt! Viel Wind ist angesagt!«, rief sie über die Schulter zurück. »Es könnte stürmisch werden!«
Ich sah ihr nach. Ein Sturm, ein Klimastreit und die Braut aus Paris – das klang genau nach meinem Geschmack.
Ich machte mich auf zum Pier, der plötzlich wie leer gefegt war. Die Rollräder erwiesen sich wegen der vielen Kiesel als unpraktisch. Gabriels Informationen über die Kleidergebräuche bei einer bretonischen Hochzeit waren sehr spärlich gewesen, worauf ich Sylvies Rat eingeholt hatte.
»Du musst für alle Fälle vorsorgen«, hatte sie gemeint.
Das Resultat war ein viel zu schwerer Koffer.
Am Anfang des Piers schob ich eine Pause ein, um Atem zu schöpfen. Die letzten Fahrräder wurden ins Schiff verladen. Ein Vater scheuchte seine vier Kinder, vom Kleinkind bis zum Teenager, an Bord.
»Spielt nicht rum, bei Mama tut ihr das auch nicht.«
Ein Horn verkündete die baldige Abfahrt.
Keuchend kam ich beim Steg an und traute meinen Augen nicht, als er direkt vor meiner Nase hochgeklappt wurde.
»Stopp, arrêtez! Ich will auch noch mit.«
Drei Kerle in Windjacken und gelben Westen hielten inne.
»Haben Sie eine Reservierung?«, fragte mich der eine. Laut, um den Schiffsmotor zu übertönen.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, die hat mein …« Ja, was war Gabriel Mahon denn nun? »… mein Begleiter.«
Der Älteste der drei, mit blauer Kapitänsmütze und geringeltem Shirt unter der schweren Windjacke, holte eine Liste hervor. »Sind Sie Tereza Berger?«
Ich nickte.
»Mahon hat Sie angemeldet.«
Immerhin. »Wo ist er denn?«
Vom Oberdeck blickten unzählige Gesichter auf mich herunter, zuvorderst der Vater mit den vier Kindern.
»Mahon ist bereits auf der Insel«, sagte der Kapitän. »Ich soll Ihnen ausrichten, dass Sie zum Hotel kommen sollen.«
Das war doch mal ein Anfang. »In welches?«
Er ließ den Steg wieder runter. »Einfach rumfragen. Auf Ouessant führen alle Wege ans Ziel.«
Halb zog, halb schob ich den Koffer über die Planken und betrat die Fähre.
»Und so wollen Sie überfahren?«
Die drei betrachteten mein luftiges Sommerkleid, die Jeansjacke, die sich nicht schließen ließ, und die Flipflops.
Die übrigen Passagiere waren alle wettertauglich gekleidet, fiel mir auf, mit Windjacken, Schals und Rucksäcken. Sogar gestrickte Mützen waren darunter. Das sah mehr nach einem Trip nach Spitzbergen aus als nach einem sommerlichen Bootsausflug. Hättest dich eben informieren und nicht alles dem abwesenden Reiseleiter überlassen sollen, dumme Nuss.
»Und das sollen wir Ihnen auch noch übergeben.«
Es war ein dickes gelbes Couvert.
»Ein Geschenk, für mich?«
»Von Mahon mit einem Gruß. Sie wüssten dann schon, was Sie damit anfangen sollen.«
Ich steckte das Couvert ein, beeilte mich, ins Innere zu kommen, und betrat die großräumige, gänzlich leere Fährkabine mit mehr als genug Raum für den Koffer und freien Fensterplätzen. Wie komfortabel und wie gut, dass die anderen sich oben auf dem Deck um die Aussicht im Fahrtwind stritten. Darauf konnte ich verzichten, ich würde auf der Insel bestimmt genug davon bekommen.
Ich setzte mich und schrieb Gabriel eine lapidare Nachricht: »Ich bin hier, du nicht.«
Die Antwort kam postwendend. »Sorry, ich bin schon gestern Abend rübergefahren, meine Anwesenheit war erforderlich.« Den Grund führte er nicht aus. »Ich hole dich am Hafen ab.«
»Und was ist in dem Couvert?«
»Eine Art Geschenk.«
Das Brummen wurde lauter, alles begann zu vibrieren, langsam verließ das Schiff das Hafenbecken und tuckerte die Halbinsel entlang. Der Blick auf Camaret-sur-Mer war phantastisch. Die Segelschiffe, im frühmorgendlichen Schlaf schaukelnd wie Schwäne. Die Tour de Vauban, der restaurierte altrosa Wehrturm, die Hafenzeile der bunten Häuser, die Bäckerei, die Crêperie, die Kunstgalerien, auf dem Hügel die traditionell weißen oder schiefergrauen Häuser, der felsige Vorsprung, der Wald, das Leuchtturmkloster und über alldem das federleichte Blau der bretonischen Himmelskuppel … nie hatte Camaret malerischer ausgesehen. Ziemlich nahe rauschten wir an einem kleinen Turm vorbei.
»La balise, der kleine Bruder vom Leuchtturm«, erklärte eine geschäftig wirkende Frau mit kurzem grauem Haar, Regenzeug und den blauesten Augen der Welt, die nach mir die Kabine betreten hatte. Samt einem prallen Einkaufswagen steuerte sie einen Platz ganz vorn in der Mitte an.
»Da schaukelt es am wenigsten.« Sie wies auf die zerkratzten Plexiglasscheiben. »Sicht hat man hier drin wenig, leider.«
»Das ist kein Problem für mich«, sagte ich. »Ich habe ein Geschenk bekommen.« Ein Beben erfüllte mich. »Ziemlich unerwartet. Das will ich mir jetzt anschauen. Das Meer läuft mir ja nicht davon.«
Ein Nicken, die Frau vertiefte sich in »Ouest-France«, die bretonische Tageszeitung, während meine Finger einen Moment über dem Couvert verharrten. Theaterkarten, ein Fotoalbum … ein Liebesbrief?
Es war ein Buch. Kein sehr originelles Geschenk für eine Buchhändlerin. Auf dem Buchdeckel war ein zweimastiges Schiff abgebildet, halb versunken in einem stürmischen Meer, während drei Menschen darum kämpften, sich über Wasser zu halten, ein Mann, eine Frau und ein Kind, alle mit verzerrten, schockstarren Gesichtern.
Der Titel lautete: »Reise in die Hölle – eine Novelle von M.Abel.«
Super. Deutlicher konnte ein Wink mit dem Zaunpfahl nicht sein. Den beiliegenden Zettel hätte ich gar nicht gebraucht.
»Kannst du das lesen, Tereza, und mir sagen, was du davon hältst?«
Ein letzter Blick nach draußen, einmal den Anblick der Iroise, wie das Meer hier genannt wurde, in mich aufsaugen, bevor ich mir die höllische Geschichte zu Gemüte führte.
Reise in die Hölle/Kapitel 1 AUFBRUCH IN KAPSTADT
Kapstadt, 28.Mai 1896
In Alice Wilkinsons kleiner Kehle gurgelte es bedrohlich, bevor sie die Milch in einem Bogen ausspie, ohne dass Mabel, ihre Gouvernante, irgendetwas dagegen tun konnte. Die Flüssigkeit hätte auch einfach das Holztäfer an der Wand bespritzen können, wo das Missgeschick leicht zu beseitigen gewesen wäre. Mit geradezu unheimlicher Präzision traf sie jedoch alles, was die Schiffsreise antreten sollte. Die Seemannsmütze von Alices Bruder, den Lackschuh ihrer Schwester, die Griffe der drei Handkoffer, sogar ein Ohr von Pudel Honey. Das meiste aber landete auf dem Oberteil von Mabels Arbeitgeberin, der Mutter der drei Kinder, Celia Wilkinson. Der Fleck breitete sich auf dem dunklen Stoff der taillierten Reiserobe aus wie auf Löschpapier.
Celias graue Augen weiteten sich, sie blickte nach oben, zur Galerie aus Zedernholz, dann zu Mabel. Das Wichtigste für Celia war, die Kinder zu schützen. Mabel verzieh ihr dafür ihr gelegentliches Gehabe.
Hilf mir, Mabel. Der nicht ausgestoßene Schrei ihrer nachgezogenen Lippen erzählte vom Schmerz der Nacht, den Striemen auf dem Bauch, den Narben unter den langen Ärmeln. Gleich würde Colin Wilkinson herunterkommen. Gnade ihnen Gott, wenn er das Missgeschick entdeckte.
Alice klammerte sich an die Glasflasche. Sie war die Jüngste, bald drei Jahre alt. Ihre beiden Geschwister, George und Fiona, zwölf und zehn, stellten sich hinter Celia, Honey winselte. Erneut erklang das bedrohliche Gurgeln.
»Beruhig dich, Alice.« Celia versuchte, die Kleine auf den Arm zu nehmen. Alice ignorierte ihre Mutter, rührte sich nicht von der Stelle.
»Was sollen wir tun?« Celia sah verzweifelt aus.
Mabel war um vier Uhr morgens aufgestanden, hatte dafür gesorgt, dass die am Vortag gepackten Koffer und Körbe auf den Wagen verladen wurden, hatte die Kinder angezogen und Proviant bereitgestellt, da es bis zum ersten Abendessen an Bord viele Stunden dauern würde. Nun wollte sie bloß noch die Kutschenfahrt zum Hafen überstehen, das Schiff besteigen und sich in irgendeiner Ecke zusammenrollen.
Aber Celia blickte zu Mabel, ihre Kinder blickten zu Mabel, sogar Honey blickte zu Mabel.
»Wir müssen das putzen«, sagte sie schließlich. »Warum ist in Alices Flasche überhaupt Milch?«
George stotterte eine Antwort. »Va…Vater hat sie g…gemacht. Zum Frühstück.«
Dass Alice keine Milch vertrug, wollte Colin Wilkinson nicht einsehen. »Wir sind Farmer. Da ist Milch wie Gold.« Und gleich darauf pries er jeweils seine Verdienste als Handelskaufmann, er sei der Erste der Wilkinsons, der es wirklich zu etwas gebracht hatte.
»Was ist da unten los?« Wie befürchtet, ertönte seine Stimme laut und vorwurfsvoll von der Galerie. »Ihr solltet längst im Wagen sitzen. Oder hast du es dir anders überlegt, Celia, meine Liebe?«
Panik breitete sich aus wie grüner Atem. Alice unterdrückte ein Schluchzen, verloren stand sie da, eine kleine besudelte Gestalt auf weiß-schwarzem Marmorboden.
»Mabel«, sagte Celia, »sieh nur, was du getan hast.« Ihr Blick flehte: Nimm es bitte auf dich.
Eigentlich hätte sich die ganze Familie in Kapstadt niederlassen sollen, Fiona und George besuchten eine britische Schule, sie waren in die städtische Gesellschaft eingeführt worden. Aber Celia vertrug das feuchttropische Klima nicht, bekam Atemnot, und der Arzt hatte dringend zur Heimreise geraten.
»Sputet euch. Ich muss ins Büro.« Wilkinson polterte die Treppe herunter. Mit dem Prachtbau in Bellville, einem der besten Stadtteile Kapstadts, konnte er die Leute vielleicht täuschen, nicht aber mit seinem Gang, der den Schaffarmer immer verraten würde.
»Dann stellt euch mal auf, für den großen Abschied.«
Wilkinson hielt unvermittelt auf halber Treppe inne, im Strahl der Morgensonne, im Blickfeld von Familie und Personal, das sich vor dem großen Portal aufgereiht hatte. Mabels Kolleginnen bildeten das unterste Ende, traurig die eine, missmutig die andere.
Dass Mabel mitfuhr, war dem Zufall geschuldet. Das Los hatte entschieden, wer Mutter und Kinder auf der Schifffahrt begleiten durfte. Mabel freute sich, drei Wochen Freiheit auf der Drummond Castle, dem Segelschiff, das am 17. Juni in London ankommen sollte. Wie es für sie weiterging, davon hatte Mabel keine Ahnung. Nur dass sie niemals nach Afrika zurückkehren würde.
Durch die geschnitzten Pfeiler des Geländers sah sie Wilkinsons Gurt. Er war aus Leder, die Messingschnalle schien matt, schmutzig, mit einem dunklen Film überzogen. Als Wilkinson weiterging und vor der letzten Treppenbiegung für einen Moment aus ihrem Blickfeld verschwand, öffnete Mabel blitzschnell ihr einziges Gepäckstück, mehr Seesack als Koffer. Ganz oben waren die Geschenke für ihre Mutter und ihre Schwester.
»Fangt auf.«
Sie warf das orange Halstuch Celia zu, das grüne Fiona. Die kleine Alice hüllte sie in den altrosa Seidenschal mit Fransen ein, nahm sie auf den Arm und ließ das »Eau Impériale«, für das sie ein Monatsgehalt hergegeben hatte, zu Boden fallen. Die Parfumflasche zerschellte in tausend Scherben. Alle erstarrten und schauten zu, wie die Flüssigkeit sich ausbreitete. Der Vorgang war ein ähnlicher wie eben. Nur gewann das Zitronenparfum gegen den Gestank der gespienen Milch.
Welches war die beste Strafe für diese ungeschickte Gouvernante? Diese Frage las Mabel in Wilkinsons Miene. Ihm hier zu Diensten zu sein oder drei Wochen lang ohne Tageslicht und ordentliche Toilette in der dritten Klasse der Drummond Castle dem Geschaukel der atlantischen Wellen ausgesetzt zu sein?
»Ein Missgeschick, Sir«, sagte sie laut und wich seinem Blick nicht aus. »Ich habe dafür Ihre Gürtelschnalle geputzt.« Das hatte sie leise angefügt, sodass nur er es hören konnte.
»Da ist jetzt ein Fleck. Meine Frau wird es Ihnen vom Lohn abziehen.« Damit stieg Wilkinson über die Scherben und schritt zum Eingangsportal.
Ich habe ein wenig gewonnen, dachte Mabel. Ihr feines Lachen war das Zeichen zum Aufatmen. Die Kinder flüsterten, Honey schwänzelte, das Personal räusperte sich, alle kamen in Bewegung.
Danke, Mabel, signalisierten Celias Augen.
Es folgte ein Hin und Her, bis alle draußen waren und sich vor dem Wagen aufgestellt hatten, damit Wilkinson jedem Kind einen Nasenstüber geben konnte, während das Handgepäck verstaut wurde. Dann wandte er sich an Celia.
»Die besondere Aufgabe, die ich dir anvertrauen wollte.«
Er gab einem Diener ein Zeichen. Der brachte eine hölzerne Kassette, vielleicht zwanzig Zentimeter lang und zehn Zentimeter hoch. Wilkinson beugte sich zu Celia und flüsterte ihr etwas ins Ohr. Sie wurde noch blasser, als sie ohnehin schon war.
Er küsste sie auf die Stirn. »Der Schmuck ist sehr wertvoll. Nicht dass du auf die Idee kommst, den zu tragen.« Er hatte es ganz leise gesagt und doch laut genug, dass Mabel es gehört hatte.
»Kommen Sie, Mylady. Das Schiff wartet«, sagte sie.
Sie stiegen ein, die Tür klappte zu, und der Fahrer fuhr los.
Adieu, Wilkinson, dachte Mabel, auf Nimmerwiedersehen. Durch das Rückfenster sah sie, wie er immer kleiner wurde.
***
Am Hafen herrschte konzentrierte Aufregung. Das zweimastige Dampfschiff, aus dessen Kamin in der Mitte dunkle Rauchwolken stiegen, war zur Abfahrt bereit. Wegen der Gezeiten hatte der Kapitän auf eine vorgezogene Abfahrt gedrängt, die Besatzung und alle anderen Reisenden waren bereits eingestiegen. Der Schiffsoffizier an der Brücke hatte den Tisch zusammengeklappt und musste der Wilkinsons wegen die Passagierliste nochmals aus der Mappe holen. Brummend schaute er nach, hakte Celia und die Kinder ab. Blieb noch Mabel.
»Sie kommt zu uns in die erste Klasse«, befand Celia.
»Nope. Sie ist für die dritte Klasse gebucht.« Der Offizier spie etwas Tabak auf den Boden.
»Mein Mann wird den Zuschlag übernehmen, keine Sorge.«
So würdig hatte Mabel sie selten erlebt.
»Aber …«
»Das ist ein Befehl.«
Mit einer ärgerlichen Geste steckte der Offizier die Liste ein, nachdem er Mabels Namen durchgestrichen hatte. »Machen Sie, was Sie wollen. Auf diesem Schiff ist diese Person nie gewesen.«
»Danke«, sagte Mabel. »Für die erste Klasse bin ich gern unsichtbar.«
Auf dem Weg nach oben erblickte sie am Rand des Zwischendecks einen jungen Mann mit Offiziersmütze und schwarzem Haar, der seinen Seesack deponierte, bevor er an die Reling trat und gierig schnupperte.
»Kohle, Salz und Meer … der Duft der Freiheit.«
»Wohin reisen Sie?«, rief ihm Mabel zu, in einem Anflug von Kühnheit.
»Nach London.« Mit einer wendigen Bewegung übersprang er das Geländer und landete neben ihr auf der Brücke. Nur etwas weiter links, und er wäre viele Meter in die Tiefe gefallen. »Und Sie, Mylady?«
Er denkt, ich bin ein feines Fräulein. »Mein Name ist Mabel Blair. Aus Glasgow.«
»Orel Pindy, aus Brest. Ich bin der Fünfte Offizier.«
»Und was macht ein Fünfter Offizier?«
»Es ist erst meine zweite Anstellung. Ich bin für die Rettungsboote zuständig und für den Ausguck.«
»Und wonach gucken Sie aus?«
»Nach dem Glück.« Er deutete einen Luftkuss an. »Und nach spitzen Felsen, Untiefen und Raubfischen, damit Sie heil in London ankommen.«
Mabel wurde rot. »Oh, dann werde ich Sie nicht weiter ablenken. Nicht dass wir untergehen.«
2
Ich ließ das Buch sinken. Warum in aller Welt schickte Gabriel mir eine Novelle über eine Schiffsreise, die, wenn man dem Titel Glauben schenkte, in einem Untergang endete? Ich war zutiefst konsterniert. Andererseits interessierte es mich, was mit dieser Mabel passierte und vor allem mit der kleinen Alice.
Bei dem Gedanken an die gespuckte Milch wurde mir ein wenig übel. Das lag aber nicht nur an meiner Phantasie. Nachdem mein Schiff, die Fähre, richtig Fahrt aufgenommen hatte, war es nämlich vorbei mit der angenehmen Reise. Ich begriff, was Isidore mit seiner Frage nach meiner Wellentauglichkeit gemeint hatte. Das hier war La Mer d’Iroise, wo Atlantik, Nord- und Keltische See sowie der Ärmelkanal aufeinandertrafen und wo die Meeresgöttin Morwen lauerte, immer bereit, einige schiffbrüchige Männer in den Abgrund zu reißen. So zumindest wurde es in der mir bekannten Sage kolportiert.
Durch einen Riss im Plexiglas landeten salzige Spritzer auf meinem Gesicht, vom Motor her zog der Dieselgeruch in Schwaden in die Kabine. Isidores Ratschlag, etwas zu frühstücken, fiel mir ein. Auch damit hatte er recht gehabt.
»Gut durchatmen.« Die Frau mit dem Runzelkranz um die blauen Augen sah mich an. »Und nicht lesen. Lesen ist Gift.«
Zu schwach für Protest, packte ich die Novelle ein und holte die Wasserflasche raus, die mir in der Folge fast aus den Fingern fiel. Der ganze vordere Teil des Schiffes stieg an, nur um gleich darauf wieder zu fallen und erneut zu steigen.
Fallen, steigen, fallen, steigen.
Mit höchster Konzentration hielt ich den Vorgang noch einige Male durch, bis sich mein Magen synchron zum Bootsboden hob und ich es nur knapp auf die Passagiertoilette schaffte. Danach war sie sauberer als davor, zum Glück hatte ich die nötigen Putzutensilien in der Boule-rouge. Im Spiegel über dem winzigen Waschbecken studierte ich meine Gesichtsfarbe, grünlich blass beschrieb sie am besten.
Als ich wieder draußen stand, kam der geringelte Schiffer vorbei und riet mir, aufs Oberdeck zu gehen. »So wie die anderen auch, so wie das eigentlich jeder vernünftige Mensch tut. Die Kabine überleben nur echte Ouessantininnen.«
Ein ungeschriebenes Gesetz offenbar. Und noch etwas fiel mir auf, trotz des vernebelten Hirns: Die »Ouessantine« schien eine eigene Spezies zu sein, eine Unterform der üblichen Bretonin. Mehr als schwierig für diese Pariser Braut, da reinzukommen, dachte ich.
Den Versuch, nach oben zu gelangen, gab ich auf, als mir auf der Treppe der Saum des Sommerkleids um den Kopf geweht wurde und ein Ratschen die reißende Naht verriet. Rückwärts ging ich wieder hinunter und stellte mich neben einen Träger in die Meeresluft. Als der Kapitän einen Halt ankündigte, freute ich mich zu früh, die malerische Insel, an der wir anlegten, war Molène. In der aufgegangenen Morgensonne sah ich zweistöckige Häuser, die sich entlang eines kleinen Hafens gruppierten, im Zentrum eine schiefergraue Kirche mit spitzem Turm. Einige Passagiere stiegen aus, einige stiegen ein, wir warteten länger als geplant.
Nun komme überhaupt erst das Schlimmste, kündigte der Kapitän an.
»Hier stürmt es immer. Die Gezeiten schlagen Saltos, und die Strömung ist die stärkste der Welt. Dafür bieten drei Leuchttürme, die auf Felsen mitten ins Meer gebaut wurden, einen spektakulären Anblick.«
Der mir leider vergönnt blieb. Über die folgende Viertelstunde legte ich den Mantel des Schweigens. Eine Achterbahnfahrt war ein Klacks dagegen.
»Letzter Halt vor Amerika!«, scherzte der Kapitän, als wir endlich in den Hafen einbogen. »Herzlich willkommen auf Ouessant, am Port du Stiff. Wir freuen uns, Sie bei der Rückfahrt wieder an Bord begrüßen zu dürfen. Beachten Sie bitte bei Ihrem Aufenthalt, dass ein Wetterwechsel ansteht.«
»So ein Blödsinn.« Die Stimme gehörte dem Familienvater mit dem vollgepackten Rucksack, der Schlafmatte und dem Zelt, der von seinen vier Kindern umrahmt wurde. »Meine App sagt, es bleibt schön.«
»Woher kommen Sie?«, fragte der Kapitän.
»Aus Paris.«
»Keine Ahnung, die Meteorologen da.«
Bis ich meinen Koffer endlich von Bord hatte, hatte sich die Menschenmenge, die gleich nach der Ankunft den winzigen Hafen überschwemmt hatte, wieder aufgelöst. Von Gabriel weit und breit keine Spur, was mir nicht unrecht war, ich brauchte eine Dusche und frische Kleider.
Aus der Boule-rouge holte ich ein Band, um mein Haar zusammenzuhalten. Als ich die Sonnenbrille hochschob, trieb mir der Wind Tränen in die Augen. Ich zerrte den Koffer bis zum Quai, wo nur noch die Kinder und der Vater standen, in eine Auseinandersetzung mit dem Chauffeur eines Elektrolieferwagens vertieft.
»Aber ich meine nicht die Campingplätze, wir wollen in der Natur übernachten, unter freiem Himmel.« Sein Französisch war unterirdisch schlecht, mit einem unüberhörbaren Schweizer Akzent.
Der Chauffeur blieb bei seiner Meinung. »Wild campen ist so verboten wie eine Windkraftanlage. Unsere Insel ist ein Naturschutzgebiet und basta.«
»Aber ich habe das früher immer so gemacht. Und Tom Harper hat mir gesagt –«
»Tom Harper, der blaue Maler?«
»Wieso blau? Er ist sehr seriös.«
»Der hat keine Ahnung von den Inselgesetzen. Er ist ein Auswärtiger.«
»Er lebt und arbeitet hier seit zwanzig Jahren …«
»… und hat in der Zeit kein einziges Bild fertiggebracht.« Der Tonfall des Chauffeurs sagte, was er davon hielt.
»Komm, Papa.« Das älteste der Kinder, ein Mädchen mit wilden Locken und oranger Trainingsjacke, zog den Vater mit sich. »Wir müssen unsere Fahrräder abholen. Und dann suchen wir ein Airbnb. Ich will endlich den ersten Posten finden.« Sie ging voraus, die Geschwister hinterher.
»Wann kommt der Sturm?«, fragte der Vater den Chauffeur leise. »Ich will die Kinder nicht beunruhigen, wissen Sie. Meine Ex-Frau hat ihnen diesbezüglich Angst eingejagt.«
Das stimmte den Chauffeur milder. »Gegen Abend. Machen Sie Geocaching? Ihre Kinder sind ja bestens ausgerüstet.« Tatsächlich, an sämtlichen Rucksäcken baumelten Fahrradhelme, plastifizierte Landkartenausschnitte, Stifte, Ferngläser und Kompasse.
Der Vater stellte sich als David Zürcher vor, ein Schweizer wie ich, der seit Kurzem in Paris lebte. »Mein alter Freund Tom weiß nichts von meinem Besuch. Wir wollen ihn überraschen.«
»Dann sehen Sie sich mal vor. Tom ist ziemlich unflexibel. Liefere ich ihm die Getränke nicht genau zum verabredeten Zeitpunkt, krieg ich ein Problem.«
Damit tippte der Chauffeur sein Käppi an, David folgte den Kindern in Richtung Fahrradverleih, und ich nutzte den Moment, um nach einem Taxi zu fragen.
»Hier ist fast alles autofrei«, erklärte der Chauffeur. »Sind Sie seine neue Frau?«
Er meinte David. »Nein, ich bin Tereza Berger.«
»Tereza? Sie? Wirklich?« Er schien von mir gehört zu haben. »Ich hatte Sie mir anders vorgestellt.«
»Ah ja?« Schöner, größer, jünger?
Er nahm das Käppi vom Kopf. »Herzlich willkommen auf der Insel.«
Nachdem ich die Halbglatze bemerkt hatte, fielen mir auch die schwieligen Hände und der gekräuselte Bart auf, und ich ahnte, wen ich vor mir hatte.
»Sie müssen Isidores Cousin sein.«
»Sie sprechen vom schlimmen Breonnec aus Camaret?« Sein eigener Witz brachte ihn zum Schmunzeln. »Richtig. Ich bin der Breonnec von Ouessant. Auguste für meine Freunde.« Wir schüttelten die Hände. Es zeigte sich, dass er über den Verlauf der Renovierungsarbeiten an der »Villa Wunderblau« bestens informiert war. »Nur noch die Naturdusche und die Gäste können eintrudeln. Danach stehen dann die neuen Regale für den Laden an.«
Ich nickte. »Mein Haus bleibt eine Baustelle.«
»Isidore freut’s. Hier gibt’s übrigens auch eine kleine Buchhandlung, ›Finis Terrae‹ heißt sie. Das Ende der Welt. Einfach der Nase nach, alles sehr überschaubar auf Enez Eusa.« Die Art, wie er die bretonische Bezeichnung der Insel aussprach, klang wie eine gutturale Opernarie.
»Der Name soll von einer griechischen Göttin stammen?«
»Göttlich auf gute und schlechte Weise. Wir sind die Insel des Lichts, der Frauen und der Schiffsunglücke.« Er musterte das verschmutzte Revers meiner Jeansjacke. »Sie hatten auch eines.«
»Nicht der Rede wert«, beeilte ich mich zu sagen. »Sie können mich nicht mitnehmen, stimmt’s?« Ich deutete auf das vollgestopfte Auto.
»Leider.« Er schüttelte den Kopf. »Bei mir passt keine Sau mehr rein.«
Merci. Er merkte nichts von seinem Fauxpas. »Alles voller Getränke. In Lampaul vorn wird eine Hochzeit gefeiert. Drei Tage lang dauern die Festlichkeiten. Heute die Vorfeier, morgen die Trauung, am Samstag das große Fest.«
»Deswegen bin ich ja hier. Hat Isidore das nicht gesagt?«
»Er erwähnte nur eine charmante braunlockige Lady mit einer Gabe, Geheimnisse zu lüften.«
Das ging mir runter wie bretonische Butter. Nur eine Fahrgelegenheit brachte es nicht ein. In dem Punkt unterschied sich Auguste von Isidore. Was nicht ging, das ging nicht.
»Mieten Sie ein Fahrrad bei Rosies Fahrradverleih. Das brauchen Sie ohnehin. Ich hoffe, Sie haben gute Schuhe und einen Regenschutz dabei. Es wird stürmisch.«
»Das ist es doch schon jetzt.« Der Wind zerrte so, dass ich die Boule-rouge an mich drücken musste.
»Ach was, das hier ist unser tägliches Brot, heut Nacht geht’s dann richtig los, sagt mein linker Zeh. Der kann das Wetter besser voraussagen als ›Yaelles Météo‹. Und das will was heißen, Yaelles täglicher Bericht ist auf Ouessant Kult. Sie arbeitet außerdem auf dem Leuchtturm Stiff. Und Rosie ist ihre Mutter. Kenavo. Bis bald. Bei Seans Hochzeit.«
Er brauste davon, eine Staubwolke hinterlassend. Ich musste kurz rekapitulieren, was er mir da mitgeteilt hatte. Die Mutter einer Wetterfrau namens Yaelle hatte einen Fahrradverleih, und sie könnte mir eines ausleihen.
***
»Bicyclette Rosie«, stand auf der gezimmerten Bretterbude. In der Senke war es wunderlich warm und windstill, selbst die drei Flaggen wirkten schlapp. Die linke zeigte das schwarz-weiße bretonische Wappen, in der Mitte gab es eine fahrradfahrende Rose, und die dritte war so zerknittert, dass ich die Buchstaben nur mit Mühe entziffern konnte. »Eolienne, non merci«, stand da. Was zu Deutsch so viel hieß wie: »Windkraftanlage, nein danke«. Auch Auguste hatte eben die Windkraft erwähnt. Ob man dafür war oder dagegen, schien ein Thema zu sein auf der Insel. Vielleicht handelte es sich dabei um den von Ayala erwähnten Streit.
»Bonjour?«, rief ich.
In dem Moment schob sich eine Wolke vor die Sonne, der Schatten wanderte über die platt gedrückte Wiese und den staubigen Kies und landete bei einer schlanken Frau mit Stirnfransen und Tattoo auf dem Unterarm, in kariertem Hemd, Trekkingboots und Weste.
»Bonjour.« Es war besagte Rosie. »Haben Sie reserviert?« Es sei hier so üblich, per App.
Als ich verneinte, runzelte sie die Stirn.
»Ich kann Ihnen leider nur noch das hier anbieten.«
Ein viel zu großes und ziemlich abgewracktes E-Bike.
»Die vordere Bremse funktioniert verzögert, benutzen Sie den Rücktritt.«
Während sie einen Anhänger montierte, suchte ich nach meiner Kreditkarte. Vergessen, sie musste zu Hause auf dem Küchentisch neben dem nicht getrunkenen Milchkaffee liegen.
»Macht nichts«, meinte sie. »Sie können abends vor der Rückfahrt bezahlen.«
Ich klärte sie darüber auf, dass ich keine Tagestouristin sei.
»Dachte ich mir schon, bei dem Koffer. Ferien?«, fragte sie, während sie meine Angaben in ein Tablet übertrug.
Nachdem ich die Hochzeit erwähnt hatte, hielt sie mit Tippen inne.
»Sie meinen die Hochzeit von Sean?«
Als ob eine Kreissäge auf Metall ausgerutscht wäre, so hatte ihre Stimme geklungen, und wie Auguste erwähnte sie nur den Namen des Bräutigams. Eine Pariserin heiratete einen Ouessantin, so wie es aussah, war der angekündigte Sturm längst da. Es lag mir auf der Zunge, mich nach der Braut zu erkundigen.
»Und wer sind Sie?«, fragte Rosie.
Ich stellte mich vor. »Mein Begleiter ist bereits hier. Er hätte mich abholen sollen.«
Darauf gab Rosie keine Antwort. Mit einer Beißzange beugte sie sich wieder über die Anhängerkupplung. Ihre Bewegungen waren kräftig, die Unterarme angespannt, das Muskelspiel brachte die Rosenblätter des Tattoos zum Zittern.
»Gehören Sie zur Familie des Bräutigams?«, fragte ich, bemüht um Konversation, da wir im Verlauf der Hochzeitsfeierlichkeiten vielleicht als Gäste am selben Tisch sitzen würden.
»Mein Mann Ludovic war Seans Onkel. Er ist vor zwei Jahren gestorben.«
»Das tut mir leid.«
»Schon in Ordnung.«
»Es ist bestimmt nicht einfach, allein auf so einer Insel.«
»Das war ich vorher auch.« Das klang nicht fröhlich. Das ganze Gespräch entwickelte sich in eine ungute Richtung. Ich suchte einen neuen Ansatz.
»Sie haben eine Tochter, hat mir Auguste erzählt.«
»Yaelle.« Es war die richtige Frage gewesen. Ihre Stimme wurde warm und weich. »Sie und Sean kennen sich, seit sie Babys waren. Außerdem ist sie unsere Wetterfrau.«
»Ihre Sendung heißt ›Yaelles Météo‹, habe ich gehört.« Zum Glück kann ich mir Namen gut merken.
»Genau.« Rosie lachte stolz. »Und sie ist Leuchtturm-Chefin auf dem Stiff.« Sie zeigte nach oben zum Hügel. »Der liegt dahinten. Ist mein Lieblingsturm. Wir haben ja fünf. Die fünf Leuchttürme von Ouessant. Der Créac’h, der Nividic, der Jument, der Kéréon und der Stiff.«
Sie hatte die Namen ausgesprochen, als ob es ihre Geschwister wären.
»Und den Stiff sieht man von hier?« Noch während ich das Handy rausholte, stellte ich mich auf die Zehenspitzen. Von jedem Leuchtturm ein Foto für Isidore, lautete mein Auftrag.
»Nein. Aber er muss Ihnen bei der Anfahrt aufgefallen sein.«
»Vermutlich war ich da gerade auf der Toilette«, sagte ich und steckte das Handy wieder ein.
»Dann sind Sie die mit dem Missgeschick? Ich hab’s schon gehört.«
Auch sie wusste es also. Hier reisten die Neuigkeiten noch schneller als in Camaret-sur-Mer.
»Kann jedem passieren«, sagte sie mit einem Blick auf meine verschmutzte Jacke.
Ein Wechselbad, dieses Gespräch.
Sie hob den Koffer in den Anhänger und erklärte mir das Gangsystem. Einen Fahrradhelm hatte sie nicht im Angebot, dafür gab es eine weiße Schirmmütze mit der gleichen Anti-Windkraft-Aufschrift wie auf der Flagge.
»Oute ich mich so als Gegnerin?«, fragte ich. »Ist das riskant?«
»Es ist die einzig richtige Haltung. Wir sind eine kleine Insel, eine Windkraftanlage wäre verheerend.«
»Sie sprechen von einem Windrad, das Energie erzeugt?«
»Der Mast wäre fünfundvierzig Meter hoch, mit den Rotorblättern siebenundsechzig. Ein Schandmal.«
»Dafür hätten Sie Elektrizität. Ein gesuchtes Gut heutzutage.«
»Sind Sie dafür?« Ihr Blick war vernichtend.
Ich hatte mich zu weit vorgewagt auf ein Terrain, von dem ich keine Ahnung hatte. Der einzelne Sonnenkollektor auf dem Dach der »Villa Wunderblau« war wohl nicht zu vergleichen mit einer Anlage dieses Ausmaßes. Andererseits, für erneuerbare Energien konnte man schon mal ein Opfer bringen.
»Also keine Befürworterin?«, wiederholte sie die Frage.
»Noch nicht. Ich bin kaum eine Stunde hier.«
Sie reagierte nicht auf meinen Scherz, während ich mein Haar unter die Mütze stopfte. Die Schrift spiegelte sich im Fenster der Bretterbude. »Eolienne, non merci.« Etwas zu gut leserlich für meinen Geschmack. Ich würde das Ding loswerden, sobald ich außer Sichtweite war.
»Und bitte.« Rosie gab dem Bike einen Klaps auf den Sattel.
Einmal noch das Handy kontrollieren. Keine Nachricht von Gabriel.
»Hier ist ein Funkloch«, sagte Rosie. »Das ist typisch Ouessant. An völlig unerwarteten Orten haben Sie Empfang, an anderen gar nicht. Passen Sie auf, dass Sie nicht verloren gehen.«
War das eine Drohung gewesen? Ihr Lächeln blieb freundlich, auch wenn es die Augen nicht mehr erreichte.
»Am besten fahren Sie direkt zu Ihrem Hotel.«
Ich erzählte, dass ich keine Ahnung hätte, wo ich untergebracht war.
»Probieren Sie es im ›Comtesse‹, die meisten Hochzeitsgäste sind da.« Rosie ging in die Bretterbude und kam mit einem Paket zurück. »Können Sie das Sophie-Anne mitbringen? Sie ist die Besitzerin und weiß Bescheid.«
Mein Versuch, das Rad in Bewegung zu setzen, scheiterte. Eine ziemliche Leistung bei einem E-Bike. Die Vermutung, dass der Akku defekt war, wies Rosie von sich. Auch der zweite Versuch ging daneben. Die Straße war zu steil, zu sandig und der Anhänger zu schwer.
Rosie schlug mir vor, die ganze Aktion abzubrechen und Koffer samt Anhänger dazulassen. »Monsieur Mahon kann ihn ja später abholen.«
Ich hatte seinen Namen nicht genannt. »Sie kennen ihn?«
Ihr Nicken erstaunte mich nicht. »Er hat dauerhaft ein Zimmer im ›Comtesse‹ gemietet.«
Davon hatte er mir nichts erzählt.
»Außerdem hatte ich dienstlich mit ihm zu tun.« Rosies Handbewegung ging zu der Flagge mit der Nein-Parole. »Erst haben unsere Gegner die Flagge da zerfetzt, danach wurde eine ganze Kiste gestohlen.« Sie zeigte in Richtung eines Schuppens. »Wir lagern sie hier, und nun sind sie weg.« Sie erklärte mir, dass sie die Präsidentin des gegnerischen Komitees sei, es gäbe zum Glück nur wenige Befürworter, und die würden ihre Meinung auch noch ändern, notfalls unter Androhung von Gewalt.
Das fand ich einseitig und ziemlich krass. »Windkraft ist doch eigentlich was Gutes. Gibt’s keinen geeigneten Flecken, um so was aufzustellen? Einen Ort, an dem der Mast und die Rotoren niemanden stören?«
»Sie stören überall. Jede Pflanze ist geschützt. Und jedes Tier. Eine Windkraftanlage zerstört das Land, auf dem sie gebaut wird, und massakriert die Vögel.«
Dass Windkraft Vögel gefährdete, hatte ich mir nie überlegt. Es war keine angenehme Vorstellung.
Rosie trat so nah zu mir, dass ich die Goldfüllung eines Zahnes sehen konnte. »Passen Sie auf, Tereza Berger. Sie betreten eine eigene Welt. Die Welt der Stürme, der Gezeiten, der Feen, der Teufel, Himmel und Hölle zugleich. Solche wie Sie kommen an, um wieder abzureisen. Und diejenigen, die bleiben, machen die Gesetze.«
»Aber gibt es keine Möglichkeit, die Vögel zu schützen?« Meine beiden Kinder hatten sich dem Umweltschutz verschrieben. Die Debatten hatten auf mich abgefärbt. »Es könnte doch interessant sein, wenn die Insel autark würde.«
»Nicht so.« Sie duldete keinen Widerspruch. »Wir werden uns durchsetzen. Und wer sich uns in den Weg stellt, ist dran.«
3
Das Gespräch ging mir nach, als ich den Berg hinaufradelte. Dass der Konflikt die Leute von Ouessant beschäftigte, zeigte sich in den vielen Flaggen mit Aufschrift, die die Häuser am Wegrand schmückten.
Als mich oben der Gegenwind mit voller Wucht traf, vergaß ich die Sache vorübergehend. Der Elektromotor funktionierte nicht, wie ich merken musste, irgendetwas war mit dem Bike nicht in Ordnung. Außerdem hatte ich keine Ahnung, wo ich war.