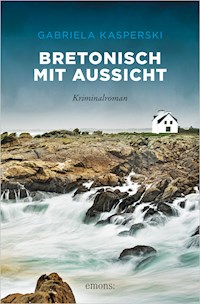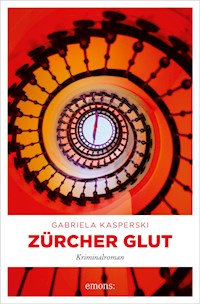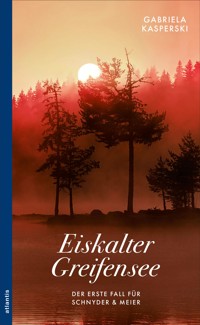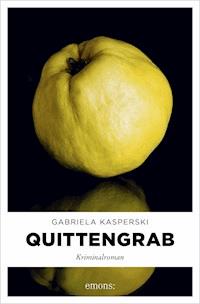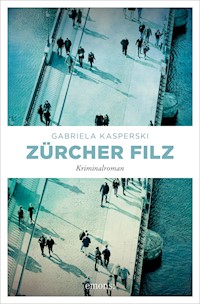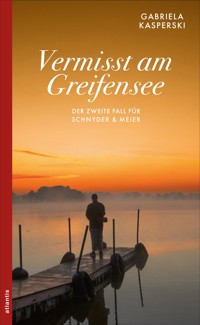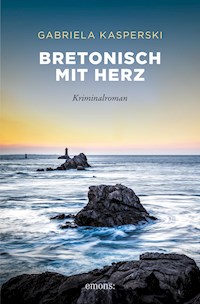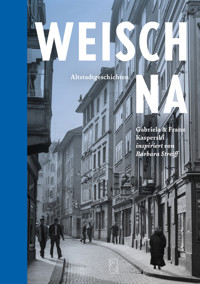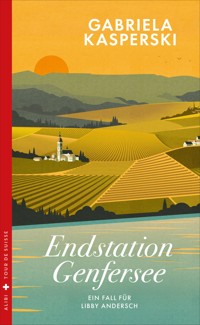Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tereza Berger
- Sprache: Deutsch
Die charmanteste Buchhändlerin Frankreichs auf Mördersuche. Mitten in den Hochzeitsvorbereitungen von Tereza Berger und Gabriel Mahon zeigt sich die raue Seite der Bretagne: Am wilden Strand von La Palue auf der Halbinsel Crozon wird eine tote Surferin angeschwemmt. Surfen ist dort verboten, die Brandung ist zu gefährlich. Als die Surflehrerin Ayala unter Verdacht gerät, beginnt die Unfalltheorie zu wackeln, und Terezas Spürsinn ist gefragt. Sie entdeckt, dass die Brandung so manches Geheimnis verbirgt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben. Den Sommer verbringt sie seit vielen Jahren in der Bretagne. 2024 erhielt sie den »Zürcher Krimipreis« für ihren Roman »Zürcher Verstrickungen«.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2025 Emons Verlag GmbH
Cäcilienstraße 48, 50667 Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock/Gregory Guivarch
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-275-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Susann
As if the Sea should partAnd show a further SeaAnd that, a further, and the ThreeBut a presumption be, Of Periods of Seas, Unvisited of Shores, Themselves the Verge of Seas to be, Eternity, is Those.
Emily Dickinson
Hopetown, 1866
»Ein kleiner Junge namens Erasmus Jacob lebte mit seinen Eltern auf einer Farm in der Nähe der südafrikanischen Stadt Hopetown am Ufer des Oranjeflusses. Eines Tages, so erzählt man sich, stieß Erasmus unter der gelben Erde auf Gestein. Es wurde Kimberlit genannt, der blaue Grund, The Blue Ground. Er fand einen unscheinbaren Kiesel. Das war der erste Diamant, der später verkauft wurde. Ihm sollten viele weitere folgen, womit der Diamanthandel geboren war.«
Diese Geschichte wurde zur Legende. Nur stimmte sie nicht, in Wirklichkeit hatte sie sich anders zugetragen. Erasmus hatte nämlich einen Freund, Louis. Louis und seine Eltern arbeiteten auf der Nachbarsfarm. Sie sollten nach Cape Town umsiedeln, einer Stadt im Süden, nah am Meer. Am Vorabend der Abreise entdeckten Louis und Erasmus zwei Kiesel. Nachdem sie die staubige Kruste mit Nägeln heruntergekratzt hatten, entpuppte sich der eine Stein als durchsichtig, der andere als blau.
»Du willst sicher den da«, sagte Erasmus.
Louis nickte. »Ich nenne ihn den blauen Stern, The Blue Star.«
»Dann ist meiner der silberne«, erwiderte Erasmus. »Immer wenn es dunkel wird, halte ich ihn in der Hand und denke an dich.«
Sie umarmten sich. Der Abschied war schwer. Sie waren zusammen gewesen, seit sie als Säuglinge in dasselbe Bettchen gelegt worden waren.
Louis steckte den Stein in seinen Lederbeutel mit den besonderen Dingen, zur Pfeife des Großvaters, dem Milchzahn eines Löwenbabys und einem bunten Stofftuch seiner verstorbenen Schwester.
»Wenn ich Heimweh habe, nach der gelben Erde und dem trockenen Wind, berühre ich den Beutel und spüre den Stein, wie meinen Herzschlag.«
Eine letzte Umarmung.
»Bye, Louis, bye, Blue Star«, sagte Erasmus. »Wir sehen uns bald wieder.«
Aber sein Wunsch sollte nie in Erfüllung gehen.
1
Dienstag
Ich blickte durch die verdreckten Fenster des Lokalbusses, und mein Herz wurde weit. Es war einer dieser Tage, an denen der Himmel noch etwas blauer war als üblich, das Meer noch etwas mehr glitzerte als sonst und die Sonne ihre Strahlen wie einen durchsichtigen Seidenvorhang über das Dorf ausbreitete und Häuser, die Hafenmole und die Hügel in diesem Licht scheinen ließ, für das mir die Worte fehlten. Meine Ziehenkelin Mathilde, stolze fünfzehn Jahre alt, hatte es so ausgedrückt: »Als ob der liebe Gott mal ein Glas Orangensirup über die Welt gekippt hätte«, genauer gesagt über Camaret-sur-Mer auf der Presqu’île de Crozon im Finistère, au bout du monde, am Ende der Welt. Von den Bretonen pen ar bed genannt, was so viel hieß wie »der Anfang von allem«.
Ob Ende oder Anfang … ich betrachtete es als meine Heimat. Am Sonntag würde ich im Garten meiner Villa Wunderblau still und leise und ganz für mich allein das fünfjährige Jubiläum feiern.
Die letzten vier Monate hatte ich in Sydney bei meiner Tochter Lovis, ihrem Mann und meinen Enkelkindern verbracht. Winnie und Katie, zwei und drei Jahre alt, sowie Säugling Wenzel, der seinen Geburtstermin pünktlich eingehalten hatte. Lovis hatte sich ein Rudel gewünscht, und sie hatte es bekommen. Das Familienleben war wunderbar gewesen, aber nun freute ich mich auf meinen Alltag. Auf meine Bücher, meine Kundschaft … und abends auf einen Besuch von Gabriel Mahon.
Gabriel war mein Lebensabschnittspartner seit bald einem Jahr. Eigentlich hatte er mich in Brest abholen wollen. Aber er war nicht aufgetaucht, eine Nachricht hatte er auch nicht geschickt – vermutlich ein Notfall, die kriminelle Energie auf Crozon machte keine Sommerpause. So schillernd Gabriels Augen waren, so wenig begabt war er in Kommunikation. Wie er es zum Commissaire gebracht hatte und ein Team von mehreren Leuten führen konnte, war vielen ein Rätsel. Ich jedoch kannte mittlerweile seine verborgenen Qualitäten.
»Voilà, Tereza. Bitte sehr!«
Der Busfahrer namens Anatole hatte meinen Koffer auf den Boden gehievt. Ich packte immer zu viel ein, ein Überbleibsel aus der Zeit, als die Kinder klein waren und ich als alleinerziehende Mutter für jede Gelegenheit gewappnet sein wollte. Davon zeugte auch die umgehängte Boule-rouge, meine Tasche für alle Fälle, ein Unikat, das trotz der Geräumigkeit aus allen Nähten platzte.
»Merci, Anatole.«
Ich kannte das gesamte Busteam. Seit mein Auto, eine alte Ente namens DD, den Geist aufgegeben hatte, war die Fortbewegung für mich ein Problem geworden. Den geplanten Kauf eines E-Mobils hatte ich aus finanziellen Gründen verschieben müssen. Auch wenn ich meine Buchhandlung DEJALU liebte, so brachte sie wenig ein. In unserer Kasse herrschte dauerhafte Ebbe, ein Wunder, dass wir überlebten.
Wir, das waren ich und Sylvie Meerwein, meine Mitarbeiterin und Freundin. Aus Heidelberg und auf Crozon gestrandet wie ich, war sie heute Morgen mit Partner Aimon und Motorrad nach Deutschland aufgebrochen. Wir gaben uns sozusagen die Klinke in die Hand. Dass sie zu meinem Jubiläum am Sonntag nicht hier sein würde, schmerzte mich, aber anders ginge es nicht, eine Familienangelegenheit, hatte sie gemeint.
Bevor ich den Heimweg unter die Füße nahm, stellte ich mich an den Rand der Hafenstraße. Wie mir dieser Anblick gefehlt hatte! Gesäumt von bunten Häusern zog sich die weite Bucht auf der linken Seite in einem Bogen bis zu dem kleinen Damm und der Seefahrerkirche Notre-Dame-de-Rocamadour, die unmittelbar am Wasser stand. Rechts dann am Comptoir und dem Hafengebäude vorbei bis zum Fähranleger nach Ouessant. Immer wenn ich die Boote sah, packte mich die Sehnsucht, diese wildeste aller Inseln wieder mal zu besuchen. Aber ich hatte es nie mehr geschafft, der Sturm vor einem Jahr hatte mir einen allzu plastischen Eindruck hinterlassen, ab Windstärke sieben wurde mir mulmig. Nicht nur in Brest, auch hier auf der Halbinsel hatte es am Vorabend gestürmt, das hatte mir Anatole unterwegs erzählt. Wobei die Wasseroberfläche jetzt spiegelglatt war, es herrschte absolute Windstille. Typisch Bretagne eben.
Gerade wollte ich mein Gepäck greifen, als ich aufgehalten wurde.
»Coucou, Tereza!«
Die Stimme gehörte Vivienne Danieau, der Lokalreporterin von Breizh News, einem überregionalen Medienportal. Vivienne hatte durch das offene Fenster ihres Vans gerufen, der je nach Bedarf in ein mobiles Radiostudio umgebaut werden konnte. Nun parkte sie etwas weiter vorn, stieg aus und kam auf mich zu. Sie schenkte mir une grosse bise, eine riesige Umarmung mitsamt Kuss. »Wie schön, du hast mir gefehlt.«
Wir waren ein schräges Gespann. Vivienne, mehr als zwanzig Jahre jünger als ich, mit glattem Haar, bleich, immer ganz in Schwarz gekleidet, ein Überbleibsel aus ihrer Zeit als Gothic Girl, und ich mit meinen Flatterröcken und der ausufernden Figur. Aber wir mochten uns, außerdem hatten wir gemeinsam schon zur Lösung einiger von Gabriels Fällen beigetragen. »Thelma and Louise im Kampf gegen die Ferienhausmafia«, hatte France Ouest vor einem Jahr getitelt, nach der Verhaftung von Xavier Amèr, dem gierigen Ferienhausvermittler.
Als Erstes wollte ich wissen, wie es Merguez ging, meinem Hund, den Vivienne und ihr Partner in meiner Abwesenheit gehütet hatten.
»Prächtig. Er ist ein richtiger Bar-Hund geworden, fester Bestandteil des Café des Beaux Arts.«
Es war das schönste Café am Platz und unsere heimliche Dorfzentrale. Nachdem wir verabredet hatten, dass ich Merguez später bei ihnen abholen würde, erzählte sie mir die jüngste Neuigkeit.
»Heute Nacht hat es einen Anschlag aufs Redaktionsbüro gegeben. Während des Sturms, stell dir vor. Jemand hat einen Stein ins Fenster geworfen und eine Drohung an die Hausmauer gesprayt.« Das Büro befand sich im ersten Stock des Cafés, direkt an der malerischen Place Saint-Thomas, im Herzen Camarets. Während Basile unten wirtete, führte Vivienne über ihm die Redaktion, und im zweiten Stock lebten sie, ein perfektes Arrangement. »Wir haben bereits alles gesäubert, so gut es ging. Die Hassbotschaft hat sich an Climat Crozon gerichtet.«
Das sei eine junge Klimabewegung, über die sie nicht nur berichte, sondern der sie auch angehöre. »Eine Gegnerschaft hat sich formiert, und die schrecken nicht vor Warnungen und Sachbeschädigungen zurück. ›Dégage, Climat Crozon‹, stand da.«
Was so viel hieß wie »Verpiss dich«. Nicht höflich, so was auf eine Hausmauer zu sprühen.
Sie sei auf dem Weg zur Polizei, um Anzeige zu erstatten.
Nebst der Mauer und der Fensterscheibe sei auch der frisch geschliffene Holzboden ihres Büros beschädigt. »Ein Wasserschaden, weil es durch die zerschmetterte Scheibe reingeregnet hat. Und dass die Kamera und mein Laptop noch funktionieren, ist reines Glück.«
Der Vorfall löste bei mir Beklommenheit aus. Noch gar nicht lange war es her, dass auch ich auf ähnliche Weise bedroht worden war, keine angenehme Situation.
»Was genau ist denn Climat Crozon, und warum habe ich noch nie davon gehört?«
Die Gruppierung sei ein Zusammenschluss von verschiedenen Kleininteressenten, sie habe sich im Frühjahr nach meiner Abreise nach Sydney formiert und sei seither kontinuierlich gewachsen. Sie setze sich für klimafreundliches Bauen ein und für Fahrradwege, von denen der erste in Betrieb genommen sei. Eine längst nötige Maßnahme, denn das Radfahren auf den kurvigen, engen Straßen der Halbinsel war eine ständige Herausforderung.
»Das neueste Thema ist die Sicherheit an Stränden«, fuhr Vivienne fort. »Du weißt, das Badeverbot.«
Auch diese Diskussion kannte ich. Auf Crozon gab es wunderbare Surfstrände, die gleichzeitig Ort von gefährlichen Strömungen waren. Surfen wurde geduldet, Baden war nicht erlaubt. Eigentlich. Doch es existierte keine Aufsicht, und niemand hielt sich daran. Nach jedem Unfall – zum Glück passierten sie selten – kamen Rufe nach einer Regulierung auf, aber dies versandete regelmäßig wieder.
Vivienne drückte mir ein paar Aufkleber in die Hand, die Skizze eines Strandes und blau tanzende Buchstaben: »Climat Crozon«.
»Die kannst du gern verteilen. Übermorgen Abend halten sie oben in Crozon eine Informationsversammlung ab, ich mache einen Bericht darüber. Komm doch auch, Tereza.«
Ich notierte mir den Termin. »Und hast du einen Verdacht, wer es gewesen sein könnte?«
Vivienne hatte einen, und er war schon sehr konkret. Sie hatte eine weitere Gruppierung, genannt »die Pfotenfreunde«, auf dem Schirm. Diese setze sich für das Recht ein, jederzeit mit den Hunden an alle Strände gehen zu dürfen. »Ekelhaft militant sind die. Und nicht kompromissbereit.«
»Na ja, ich spaziere auch gern mit Merguez am Wasser lang«, warf ich ein.
Vivienne winkte ab. »Natürlich wird man dafür Lösungen finden, genau darum machen wir die Versammlung.«
»Und was ist mit der Groupe des Anciens?«
Bei der Erwähnung verschloss sich Viviennes Gesicht. Ich biss mir auf die Lippen: Erst denken, dann sprechen, Tereza.
Die einflussreiche Vereinigung bestand vor allem aus älteren Herren, auch Viviennes Vater Erwann gehörte ihr an. Er war als Professor in Paris tätig gewesen und seit seiner Pensionierung wieder ins Gemeindegeschehen involviert. Früher hatte er in einer kleinen Mühle in Richtung Pointe de Dinan gewohnt, nach seiner Rückkehr hatte er sich ein Haus im Hauptort Crozon gekauft. Er und Vivienne waren sehr distanziert, seinen sturen Konservatismus fand sie zum Kotzen, wie sie mal geäußert hatte. Die Vorstellung, er könnte hinter einem Anschlag auf das Büro seiner Tochter stehen, war dennoch befremdlich.
»Tut mir leid, Vivi«, sagte ich. »Ich bin sicher, dein Papa würde niemals so etwas tun.«
Sie wich einer Antwort aus. »Damit soll sich Gabriel auseinandersetzen. Warum hat er dich eigentlich nicht abgeholt?«
Als sie meine Miene sah, prustete sie los. »Da ist ihm wohl was dazwischengekommen. Ärgere dich nicht, bei dem Sturm gab’s viele Überschwemmungen, er kommt sicher bald. Am besten wirfst du schon mal die Kaffeemaschine an.«
Sie kannte Gabriels Vorliebe für meine Espressos.
Bevor Vivienne aufbrach, fiel ihr noch etwas ein. Eine Freundin habe auf dem Dachboden ihrer Großmutter ein Buch gefunden, das möglicherweise eine Antiquität sein könnte. Alles Sagen von der Halbinsel Crozon, mit Illustrationen. Sie würde es mir überlassen, gratis, ich bräuchte es nur abzuholen.
Das war eine gute Nachricht. Der Handel mit antiquarischen Büchern war eine wichtige Einnahmequelle für unseren Laden.
Vivienne hatte ihr Handy rausgeholt und zeigte mir ein Bild des Buchumschlags. Er wirkte abgegriffen, nebst einer kleinen Felsformation, die aus dem Meer wuchs, war ein Stein zu sehen, der auffiel wegen seiner bläulich schimmernden Farbe. Es sah interessant aus.
»Ich hole es gleich ab, wo wohnt deine Freundin denn?«
»In La Palue.«
La Palue war ein Dorf in der Nähe des gleichnamigen Strandes. Er galt als der Surfstrand schlechthin, weitherum bekannt, keine fünfzehn Kilometer entfernt. Und doch war ich noch nie da gewesen, wie ich Vivienne gestand.
»Aber du lebst seit fünf Jahren hier.«
Tja, so war das. Wenn die Welt klein war, wurden die Distanzen groß. Ich hatte zwei Lieblingsstrände ganz in der Nähe und keinen Grund, ins »Ausland« zu fahren, wie ich die Gegend um La Palue nannte.
Ich schrieb mir die Adresse auf und kündigte an, in der Mittagspause vorbeizufahren. Dann ging ich endlich nach Hause.
2
Am Dienstag war Markttag, schon von Weitem sah ich die Stände, das Menschengedränge, ich roch Erdbeeren und scharfe Gewürze, darunter lag ein Hauch von Meeresbrise.
Direkt vor meiner Buchhandlung hatte sich ein junger Biobauer platziert, Max, der wie üblich Kirschtomaten und Büffelmozzarella feilhielt.
»Hei, Tereza«, grüßte er mich, als hätte er mich vor einer Woche zum letzten Mal gesehen. Wie immer drückte er mir ein Büschel Basilikum in die Hand, als Dank dafür, dass ich ihn meine Toilette benutzen ließ.
Da fiel mir der Aufkleber an seinem Stand auf. Die Strandskizze, die tanzenden Buchstaben, Climat Crozon schien bereits etabliert zu sein.
»Machst du auch bei denen mit?«
Max nickte. »Bin sogar im Vorstand. Wegen der Biodiversität. Und wir sind gegen jegliche Form von industrieller Giftsprüherei.«
Die Pestizide waren in der Bretagne ein heißes Thema. Ich hatte die Debatte vor meiner Abreise verfolgt. Schädlingsbekämpfungsmittel gegen etwas teureres Gemüse – für mich war der Fall klar, selbst wenn meine Kasse fast leer war. Was aber war mit großen Familien, die sich Bio schlicht nicht leisten konnten?
»Klimaschutz, Strandsicherheit, Fahrradwege, natürlicher Dünger … ihr habt explosive Themen auf der Agenda. Ziemlich viele, wie mir scheint.«
»Die Gegner sind militant. Kürzlich hat jemand unsere Scheunen besprüht.«
Sein Hof lag am Eingang der Halbinsel, etwa fünfundzwanzig Kilometer von hier entfernt. Ich erzählte ihm von dem Anschlag auf Viviennes und Basiles Café. »Du solltest es auch der Polizei melden.«
Kunden kamen, und er war abgelenkt.
Ich zog den Koffer in den Vorgarten. Die Hortensien waren explodiert, weiße, hellblaue und pinkfarbene Kugeln, die Pastellversion der Landesflagge. Als ich den Briefkasten leeren wollte, bekam ich eine Textnachricht von Gabriel. Mit einem lapidaren Sorry entschuldigte er sich für sein Fernbleiben am Flughafen. Viviennes Vermutung erwies sich als richtig, er sei wegen der Sturmschäden die ganze Nacht unterwegs gewesen und immer noch im Relais des Pêcheurs beschäftigt.
Das Relais war seine Stammkneipe, unten im Hafen von Morgat, dem mondänsten Ort unserer Halbinsel, ein Paradies mit Palmen und Atlantikblau. Eine Schließung während der Hochsaison wäre eine Katastrophe gewesen.
»Kein Thema«, schrieb ich zurück. »Anatole, der Busfahrer, war sehr nett.«
Die Antwort waren drei Ärger-Emojis und das Angebot für eine Wiedergutmachung. Er habe eine Überraschung für mich, die er mir im Atlantique präsentieren würde. Damit meinte er kein angesagtes Restaurant, sondern mein Zimmer im obersten Stock der Villa Wunderblau, mit Meersicht … und breitem Bett.
Na gut, ich wollte mal nicht so sein. Außerdem schätzte ich Gabriels Pflichtbewusstsein. Eigentlich ermittelte er für die Police nationale im Bereich Verbrechen, im Sommer konnte sich das jedoch mit den Aufgaben der Gendarmerie vermischen. Wenn die Lieblingskneipe unter Wasser stand, vertauschte mein Liebster schon mal die Leder- mit Gummistiefeln und packte einen Schlauch auf den Rücksitz der Royal Enfield Bullet, seines Motorrads.
»Ist die Buchhandlung geschlossen?«, fragte eine junge Stimme. Sie gehörte einem Mädchen mit Ringelshirt, dem bretonischen Touristenlook.
»Nein, nein, willkommen im DEJALU.«
Ich griff nach der Post und öffnete die Flügel der Ladentür. Tief atmete ich den Geruch nach Papier, Staub und Schokolade ein. Ein rascher Blick bestätigte mir, dass Sylvie alles bestens hinterlassen hatte: Auf dem Büchertisch stapelten sich Neuheiten, Wanderführer und bretonische Sagen, an der Wand hingen neue bunte Wimpel und örtliche Malerei, die blauen Regale, ganz genau eingepasst in den Raum, waren gut gefüllt. All das und noch viel mehr hatte Isidore Breonnec gebaut. Er war vor einem Jahr gestorben, und ich konnte es immer noch nicht fassen.
Ich berührte das geschliffene Holz und wurde wehmütig. Aber da weitere Kundschaft auftauchte, blieb mir keine Zeit zur Trauer.
Bis dreizehn Uhr beriet ich ununterbrochen Kaufwillige und solche, die nur Umgebungstipps wollten, dann hängte ich ein Schild in die Tür. In Camaret-sur-Mer war die Mittagspause heilig und höchst willkommen.
In meiner gemütlichen Wohnküche machte ich mir einen café avec énormément du lait, setzte mich an den großen Holztisch und atmete erst mal tief durch. Es war erstaunlich und auch irgendwie erschreckend, wie schnell die Reise von mir abgefallen und ich wieder in den Alltag eingetaucht war. Um die Erinnerungen lebendig zu halten, schrieb ich an Lovis und schickte meinen Enkelkindern eine Runde Fotos von der Kaffeemaschine, dem Salzfass und der Aussicht auf die Marktstände. Da sie schliefen, würde ich morgen erfahren, wie ihnen meine Küche gefiel.
Dann sah ich die vielen Schreiben aus dem Poststapel durch. Eines trug einen amtlichen Stempel und den Absender der Gemeinde. Bestimmt betraf es die Cabane Wunderblau, mein kleines Ferienhaus im rückwärtigen Teil des Gartens. Die Renovierung war mit Isidores Tod vor Abschluss stehen geblieben. Obwohl ich die Einnahmen dringend gebraucht hätte, war ich wie gelähmt gewesen. Dass mir die Gemeinde die Bewilligung zur Vermietung immer noch nicht geschickt hatte, war mir wie ein Zeichen des Himmels erschienen. Solange die nicht da war, musste ich nicht aktiv werden.
Aber das Schreiben drehte sich nicht um Hausvermietungen, es war vom Einwohnermeldeamt. Man wies mich darauf hin, dass ich als Ausländerin unter eine neue Steuerpflicht falle, wenn ich hier eine Immobilie, in meinem Fall sogar drei, besitze: die Villa Wunderblau, das DEJALU – der Anbau war früher eine Garage gewesen – und die Cabane. Die Forderung, eine Nachzahlung, bewegte sich im fünfstelligen Bereich.
Ich ließ das Schreiben sinken, dabei konnte es sich nur um einen Irrtum handeln. Aber ein Telefonat mit dem zuständigen Amt – ich erwischte die Person kurz vor Büroschluss – ergab, dass alles seine Richtigkeit hatte.
»Als Schweizerin sind Sie nicht in der EU«, meinte eine flache Stimme, die mich auf der Stelle in Rage brachte.
»Aber ich lebe seit fünf Jahren hier. Ich bezahle auch Abgaben für meinen Umsatz.« Buchhaltung konnte ich wie keine Zweite.
»Es geht um Ihren Status. Die Unterlagen besagen, dass es Ihr Zweitwohnsitz ist.« Natürlich, ich hatte immer ein Bein in der Schweiz behalten, was bislang kein Problem gewesen war. »Sie brauchen eine Niederlassung. Das müssen Sie online beantragen, gemäß den Vorgaben.«
Sie diktierte mir eine Abfolge von Buchstaben und Zahlen.
»Ich werde das gleich in die Wege leiten.«
Sie warnte mich, dass es eine Weile dauern würde, wobei es sich dabei um Monate bis Jahre handelte. »Die Zahl der Anträge ist seit dem Brexit angestiegen.«
Na ja, der Brexit war ja länger her, außerdem betraf er mich nicht. »Sie haben mich falsch verstanden, ich bin aus der Schweiz. De la Suisse.«
»Die Schweiz gilt als Drittstaat.« Die Stimme sagte es so, als würden wir ausschließlich mit Suchtmitteln und Waffen handeln.
Auf mein leicht hysterisches Lachen reagierte sie nicht.
»Wenn ich diesen Antrag stelle, wird dann die Verfügung aufgehoben?«
»Nachträglich ja. Sie bekommen alles zurück.«
Aber ich wollte nichts zurück, ich wollte nichts bezahlen. Weil ich gar nicht so viel hatte.
»Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Rentenkasse zu beleihen.«
Ein illusorischer Vorschlag. Giorgio, mein Ex, war freischaffender Modemacher, das bisschen, das ich bekommen hatte, war für die Ausbildung der Kinder draufgegangen. Meine Rente waren das DEJALU und die Cabane Wunderblau.
»Sie können auch für ganz zurück in die Schweiz und als Touristin herkommen.«
Langsam wurde es mir zu bunt. Das hier war mein Leben, verstand die Stimme das nicht?
»Das ist keine Option.«
»Für das Finanzamt ist nicht bezahlen auch keine Option. Sollten Sie der Forderung nicht nachkommen, müssen Sie das Land innert einer Woche verlassen.«
Nachdem ich aufgelegt hatte, schimpfte ich laut und lange, das Wort merde kam mehrfach vor.
»Hello?«
Als ich mich umdrehte, stand Gabriel im Türrahmen. Die Erwähnung von Anatole, dem Busfahrer, hatte ihn aufs Motorrad getrieben. Er war unrasiert, bleich und verschwitzt unter dem abgenutzten Ledermantel. Wie hatte ich mir unser Wiedersehen ausgemalt, aber nun konnte ich die Umarmung kaum genießen.
Er ließ mich los. »Wenn du merde sagst, ist was passiert.«
Ich fasste das Gespräch mit der Beamtin zusammen, während ich ihm seinen Espresso machte, so wie er ihn mochte.
»Das klingt nach einer KI«, sagte er. »Vermutlich war da niemand am Telefon. Die Systeme sind mittlerweile ganz gut, wenn alles nach Plan läuft. Bei einem Sonderfall wie dir werden sie ungenau.«
Ich war also ein Sonderfall. Irgendwie nicht das, was ich hören wollte.
»Ich zahle jedes Jahr Steuern auf meine Einnahmen. Kannst du was tun? Von Behörde zu Behörde?«
Ohne das Schreiben gelesen zu haben, schüttelte er den Kopf.
»Die Bestimmungen wurden kürzlich geändert. Es ist tatsächlich so, dass du als Ausländerin extra bezahlen musst, wenn du hier ein Haus als Zweitwohnsitz hast.« Er setzte sich an den Tisch und trank einen Schluck Espresso.
»Aber ich führe darin ein Geschäft und kurble den lokalen Handel an.«
»Das spielt für die Ausländersteuer keine Rolle, Tereza.«
»Ausländerinnensteuer, in meinem Fall. Wenn du es gewusst hast, wieso hast du mich nicht gewarnt?«
Statt einer Antwort klopfte er auf den Stuhl neben sich. »Setz dich zu mir.«
Aber ich war viel zu aufgeregt. Außerdem fiel mir etwas ein. Als Schotte gehörte Gabriel ebenfalls zu den Drittstaaten-Dealern.
»Du bist auch betroffen. Wie hast du es gelöst?«
»Ohne Problem.«
»Weil du Polizist bist?«
Er kniff den Mund etwas zusammen. »Ich habe einen EU-Pass.«
Mein Erstaunen war groß. »Seit wann?« Hatte ich weltpolitisch etwas verpasst? Das Unabhängigkeitsreferendum der Schotten?
Er druckste herum. »Meine Ex-Frau war Französin. Über sie bin ich nach der obligatorischen Frist schnell zu einem Pass gekommen.«
Nathalie hatte sie geheißen, seine Ex, die schöne Yogalehrerin, die bei unserem ersten Zusammentreffen unter dramatischen Umständen gestorben war.
»Dann bist du ja fein raus«, sagte ich trocken.
»Und du auch.« Er stand wieder auf und nahm meine Hand. »Wenn wir heiraten, kriegst du den Pass.«
Ich erstarrte. Was hatte er da eben gesagt? »Du machst mir einen Heiratsantrag?«
»Ein Pass ist doch ein guter Grund. Ich wüsste keine andere, der ich die Staatsbürgerschaft lieber anbieten würde.«
Für einmal erreichte mich sein bröckliger Charme nicht. »Das ist sehr nett von dir.« Ich zog meine Hand zurück. »Aber weißt du, ich kriege das hin. – War das deine Überraschung für mich?«
Er nickte. »Die Gemeindepräsidentin höchstpersönlich hat mich über die Gefahr informiert, die dir droht. Darum habe ich in deiner Abwesenheit alles organisiert. Die Hochzeit, meine ich. Es fehlt nur noch dein Geburtsschein, ich wollte nicht in deinen Sachen herumwühlen.« Er lachte so breit, wie ich es noch nie bei ihm gesehen hatte. »Ich habe auch schon sämtliche Formulare ausgefüllt, die von der Mairie haben geholfen. Da sie uns kennen, haben sie eine Ausnahme gemacht.«
Irgendwie klang das nicht mehr nur nach einem Scherz. »Da muss man doch was unterschreiben«, sagte ich schwach. »Hast du etwa meine Unterschrift gefälscht?«
»Wofür hältst du mich? Darum bin ich ja gleich hergekommen. Du brauchst nur noch den Stift in die Hand zu nehmen, deinen Pass und deinen Geburtsschein rauszusuchen und bei der Mairie vorbeizubringen.« Er blickte auf seine Armbanduhr. »Heute Nachmittag haben sie offen bis achtzehn Uhr. Sie erwarten dich bereits, sie bieten ein Eilverfahren an, das sonst nur hohen Politikern und den Wohlhabenden vorbehalten ist. Und dann, my hen«, er deutete einen Kniefall an, »wenn du magst, treffen wir uns am Sonntag vor dem Altar.«
»In Crozon?«, fragte ich, so perplex, dass mir nichts anderes einfiel.
»In der Seefahrerkapelle von Camaret.«
»Seit wann bist du ein Seefahrer?«
»Mehr im übertragenen Sinn. Weil wir doch beide durch die Stürme des Lebens gesegelt sind.« Er lachte schon wieder. »Ich übertreibe natürlich. Nein, es gibt noch einen anderen Grund. In Brest finden dieses Wochenende die Fêtes maritimes statt.« Auf seinem Handy zeigte er mir Fotos von unzähligen Segelbooten, die im Hafen von Brest ankerten.
»Echt jetzt? Anlässlich unserer Hochzeit machen die eine Regatta für die ganze Region? Chapeau, Gabriel.«
Er musste einen Hauch Sarkasmus herausgehört haben. »Nein, natürlich nicht. Es ist ein wichtiges Fest für die Seefahrerei. Einer der Kapitäne ist ein Freund von mir. Er kommt über die Rade de Brest gesegelt und hat versprochen, mich mit dem Boot zur Kapelle zu fahren. Er wird mein Trauzeuge sein.«
Mir blieb die Spucke weg. »Dein Trauzeuge? Wie nett. Kenne ich den Mann?«
»Es hat sich nicht ergeben, er war auf den Meeren unterwegs. Aber er stammt aus meiner Heimat.« Das war Aberdeen.
»Und aus welchem Grund hast du mir nie von ihm erzählt, wenn ihr doch beste Freunde seid? Ich meine, das müsst ihr sein, wenn er dein Trauzeuge ist.« Ich spürte, wie ich irgendwo, tief in meinem Innern, zu kochen begann. »Und meine Trauzeugin? Wen hast du dir da gedacht?«
Gabriel wich ein wenig zurück. »Du wählst, wen du magst, da würde ich dir nie reinreden. Du hast ja viele Freundinnen. Sylvie …«
»Die ist nicht da. Mit Aimon auf Motorradtour nach Deutschland, wegen eines Trauerfalls. Vergessen?«
»Nein, das heißt …« Er tippte auf dem Handy herum, als wollte er Sylvie anrufen und sie zurückbeordern.
»Untersteh dich«, sagte ich. »Die haben Wichtigeres zu tun.«
»Vivienne … oder Ayala?«
Ayala Ngkachana war die Surflehrerin von Camaret, mit der mich auch privat viel verband.
»Hast du sie etwa schon angefragt?«
»Sicher nicht. Es soll ja eine Überraschung sein. Aufs Standesamt gehen wir am Samstag, sie haben vormittags für Sonderfälle geöffnet. Und am Sonntag in die Kirche.«
Ich sollte mich gebauchpinselt fühlen, aber mir wurde immer elender. »Am Sonntag? Es ist der 14. Juli, sprich: der Nationalfeiertag, dieses Bötchenfest und das Finale der Fußball-EM. Das ist ganz schlechtes Karma. Ist dir nicht eingefallen, dass deine Gäste an dem Tag vielleicht etwas anderes vorhaben?«
Meine Argumente prallten an ihm ab. »Die Messe ist am Morgen, wir feiern am Nachmittag, und bis zum Finale sind wir fertig.«
»Du willst das anschauen?«
»Beim Public Viewing. Vielleicht ist England ja dabei.«
»Du bist Schotte.«
»Wir haben einen neuen Premierminister. Sein erster Besuch galt uns.«
Ich wurde immer fassungsloser. Nicht nur, dass er mir eine Überraschung bereitete, die ich absolut nicht wollte, er hatte es auch so organisiert, dass er später mit seinen Freunden im Relais das Fußballspiel schauen konnte.
Stille breitete sich aus.
»Und was sollen wir tragen?«
»Du meinst die Ringe? Ich habe sie bestellt. Einen für mich, einen für dich. Diesmal passt er.« Er wurde nicht gern an die Schmach erinnert, dass er mir den ersten Ring zu klein gekauft hatte.
»Ich meine die Kleidung.«
Er musterte mich, vom Kopf bis zu den Zehen und wieder zurück, ein intensiver Blick, unter dem ich normalerweise erglüht wäre. »Ich finde, der Rock passt doch gut.«
»Dieses geflickte Sommerfähnchen?«
»Du siehst in allem schön aus.«
»Gabriel«, sagte ich. »Ich werde ganz sicher nicht in einem Rock mit schmutzigem Saum und im T-Shirt heiraten.«
Er strahlte auf. »Das heißt, du hast Ja gesagt.«
»Nein.«
»Das heißt, nicht in dem Rock, aber prinzipiell ja.«
»Das hast du falsch verstanden.« Meine Stimme, das merkte ich selbst, klang wie ein Eis-Smoothie aus Essig.
»Aber es zeigt doch, wie sehr ich dich liebe«, stammelte er, als hätte er meine Gedanken gelesen.
»So läuft das nicht, Gabriel. Ein Heiratsantrag ist keine One-Man-Show. Du hättest mich fragen sollen.«
»Dann hättest du Nein gesagt.«
Aus einem guten Grund: Ich hatte nie mehr heiraten wollen, einmal hatte mir gereicht. Dies war keine Laune, sondern ein Grundsatz. Eine Ehe überfrachtete eine Beziehung. Auch Gabriel sollte es besser wissen, die Ehe mit Nathalie war von Anfang an unglücklich verlaufen. Wie kam er bloß auf die Idee? Dass ich keine Kinder mehr in die Welt setzen würde, musste ihm doch klar sein.
»Ich bin Oma, verdammt.«
»Eine sehr sexy Oma.« Er zog ein Dossier mit Unterlagen aus seiner Ledertasche und legte es auf den Küchentisch. »Schau es dir wenigstens mal an.«
Von drüben klingelte die Ladentür. Dann trat jemand unter großem Getöse ein.
3
»Unser Kommissariat steht unter Wasser«, erklärte Emil Vanderbrouke seine Aufregung, nachdem Gabriel und ich in den Laden gelaufen waren und Emil mich begrüßt hatte. Er war der örtliche Gendarm, der dieses Jahr zu Gabriels Assistenten befördert worden war. Das bedeutete, dass er im Sommer in Doppelfunktion für die Gendarmerie und für die Police nationale unterwegs war. Von Parksündern bis zu Erbschleichern, alles fiel in seine Domäne. Das hatte den kleinen Mann wachsen lassen, er füllte seine Uniform aus wie nie zuvor, dazu trug er Turnschuhe und die polizeiübliche dunkelblaue Schirmmütze. Die zog er nun vom Kopf und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Es hat reingeregnet. Das komplette Chaos. Viele Akten sind durchweicht. Und das Schlimmste: kein Internet mehr. Wir haben es eben gemerkt, als Vivienne von Breizh News eine Anzeige gegen unbekannt im Kommissariat erstatten wollte.« Es folgte eine ausführliche Beschreibung der Schmierereien am Café des Beaux Arts. »Es geht gegen Climat Crozon.«
Ich unterbrach ihn. »Wenn ihr eine Untersuchung einleitet, könnt ihr auch Biobauer Max befragen, der vom Stand direkt beim DEJALU. Er hat was von Sachbeschädigungen erzählt.«
Gabriel sah zu Emil. »Wir brauchen ein funktionierendes Büro!«
Emil erklärte, Yuna versuche zu retten, was zu retten sei.
Er meinte die Dritte im Bunde, die Mitarbeiterin namens Yuna, die letztes Jahr zum Team gestoßen war. Sie stand immer etwas zu nah neben Gabriel und schaute zu ihm auf, als wäre sie ein junges Rotkehlchen und er der Futtersammler.
»Yuna wusste, dass du hier bist, Gabe. Ich habe dich telefonisch nicht erreicht. Es ist der Tag der Katastrophen. Nebst den Überschwemmungen und den Vandalenakten ist eine Vermisstenanzeige reingekommen.«
Bevor sich Gabriel dazu äußern konnte, betrat eine weitere Person das DEJALU, eine Dame in einem blendend weißen Leinenkleid, mit dunklen, schön frisierten Locken und Augenringen in einem ansonsten makellosen Gesicht.
Emil stellte sie uns vor. »Das ist Madame Marie Garnier aus Paris. Sie haben oben in Crozon ein Haus gebaut und verbringen zum allerersten Mal den Urlaub mit der ganzen Familie hier. Ihre Tochter Délfine wird vermisst.«
Ein vermisstes Kind? Gabriel straffte sich. Im Bruchteil einer Sekunde verwandelte er sich vom linkischen Brautbewerber in den engagierten Commissaire.
»Was heißt das genau?«, fragte er. »Ist sie nicht nach Hause gekommen?«
»Nein, darum bin ich ja hier.« Marie Garnier griff zu ihrer Handtasche. Selbst ich, die ich keinen Wert auf Luxusmarken legte, erkannte, dass es ein Chanel-Modell war. Von ihrem Reichtum zeugten auch die dezente Perlenkette um den Hals, die passenden Ohrringe und die schmale Golduhr. Sogar das Handy, das sie nun konsultierte, wirkte in ihren Fingern wie ein Edelschmuckstück.
»Das ist sie.«
Auf dem Foto war eine junge Frau im Profil zu sehen, schwer zu erkennen, vom Stil her sah die Aufnahme aus wie ein Selfie.
»Aber … wie alt ist sie denn?«, fragte Gabriel.
»Einundzwanzig.«
Ich schnappte heimlich nach Luft. In welchem Alter hatte Marie Garnier sie bekommen? Mit elf?
»Sie ist in den sozialen Medien unterwegs.« Sie steckte ihr Handy wieder ein. »Manche bezeichnen sie als Influencerin, eigentlich studiert sie Jura. Meine Kinder sind begabt. Ludovic, Délfines jüngerer Bruder, ist ein bekannter Schachspieler. Er war zu Hause, im Gegensatz zu ihr.«
Gabriel und Emil wechselten einen Blick, ich sah, wie bei beiden augenblicklich Entspannung eintrat. Eine einundzwanzigjährige Influencerin aus bestem Hause, die eine Nacht auswärts verbracht hatte? Dafür konnte es sehr plausible Gründe geben.
»Können Sie beschreiben, wann genau Sie Ihre Tochter zum letzten Mal persönlich gesehen haben?«, fragte Gabriel.
»Sie hat den SUV ausgeliehen, ich habe sie wegfahren sehen. Etwa um zwanzig Uhr.«
»Mit dem SUV meinen Sie Ihr Auto?«
»Den Familienwagen.«
Die Garniers stammten aus Paris. Wozu brauchen sie in der Stadt so eine Kiste?, fragte ich mich. Meine Ziehenkelin Mathilde hatte mir verboten, ein neues Auto zu kaufen, wenn es nicht mindestens hybrid war. Weil meine Mittel nur für einen klimafeindlichen Gebrauchtwagen reichten, fuhr ich seit gut einem Jahr Rad.
»Délfine hat aber auch ein eigenes Auto. Ein kleineres.«
Familie Garnier hatte eine lockerere Beziehung zum Fahrzeugbesitz als ich.
»Und trotzdem lieh sie den SUV aus …«, sagte Gabriel.
»Um das Surfbrett zu transportieren, nehme ich an.«
»Eigenartig, dass sie damit unterwegs war, gestern war Sturm.«
»Als sie wegfuhr, war es noch schön.«
Das konnte ich mir gut vorstellen, selbst alteingesessene Bretonen wurden immer wieder von der Schnelligkeit der Wetterwechsel überrascht.
Gabriel wollte das Foto noch mal sehen. »Es wurde an einem Strand aufgenommen. – Wo ist das, Emil?«
Der runzelte die Stirn. »Schwierig zu sagen, aus der Perspektive. Es könnte La Palue sein. Oder Lostmarc’h, vielleicht sogar der Goulien-Strand. Pflegt Ihre Tochter ihre Fotos zeitnah hochzuladen?«
Marie Garnier verzog den Mund, kleine Falten entstanden, eine Art Kerben, die sie um zehn Jahre altern ließen.
»Das weiß ich nicht.«
»Könnte sie es auch früher gemacht haben?«
»Sie ist gestern am späten Nachmittag angekommen.«
Wieder ein Blickwechsel.
»Sie wollte sich mit Freunden treffen. Erst als sie heute Mittag immer noch nicht in der Küche erschien, haben wir gemerkt, dass sie ihr Bett gar nicht berührt hat.«
»Und der SUV?«
»Der war wieder da. Sonst hätte ich ja reagiert. Es geht nicht, dass sie das Auto entführt.«
»Aber, verzeihen Sie die Frage, was ist daran besonders? Dass Ihre Tochter über Nacht wegbleibt. Sie ist volljährig.«
»In Paris ist es normal. Aber hier? Sie kennt sich nicht aus. Und es herrscht eine ziemliche Wildnis. Kamikaze-Straßen, Strände ohne sanitäre Einrichtungen. Ein Drittweltland, eigentlich.«
Ich sah, wie Emil zusammenzuckte. Als Urbretone und hier geboren, verstand er diese recht überhebliche Einschätzung als Beleidigung.
Gabriels Miene hingegen blieb stoisch. Dennoch ahnte ich, was er dachte: Wenn alle jungen Erwachsenen, die eine Nacht wegblieben, als vermisst gemeldet würden, wären sie vierundzwanzig Stunden am Tag damit beschäftigt.
Er räusperte sich. »Hat sie am Handy die Ortungsfunktion aktiviert?«
»Ich überprüfe meine Tochter nicht.«
Na ja.
Gabriel warf mir einen Blick zu. Du bist doch Mutter, wie handhabst du das?, fragten seine Augen.
Ich hob die Schultern, was so viel hieß wie: Die sind erwachsen, da ist mein Einfluss nur noch klein.
Sein Handy summte. Nachdem er die Nachricht gelesen hatte, gab er Emil ein Zeichen und verschwand mit einem Winken in meine Richtung.
Marie Garnier hatte sich dieweil umgesehen, den Büchertisch und die bunten Wimpel erspäht. »Aus welchem Grund haben Sie mich eigentlich hierhergeführt, Monsieur Vanderbrouke, das ist doch kein Kommissariat.«
Nun war es an Emil, sich zu räuspern. »Das Kommissariat … genau … es befindet sich im hinteren Teil des Gartens, ein Provisorium. Tereza Berger stellt uns liebenswürdigerweise ihre Cabane zur Verfügung, bis unsere Büros wieder trocken sind. Du hast doch Internet, nicht wahr, Tereza?«
Was hatte er da gesagt, sie wollten die Cabane kapern?
»Kommst du mal, Emil? Entschuldigen Sie, Madame Garnier, wir müssen was klären.«
Ich zog ihn in die Küche. »Hast du sie noch alle? Ich stelle die Cabane sicher nicht zur Verfügung.«
Er machte einen auf bettelnden Vierbeiner. »Bitte, Tereza, kannst du uns aushelfen? Die Cabane ist ideal gelegen, man erreicht sie diskret durch den Garten, und von hier aus sind wir schnell überall.«
Genau darum wollte ich sie an TouristInnen vermieten.
»Im Gegenzug kriegst du die Bewilligung.« Er klopfte auf seine Brusttasche. »Ich habe sie hier, bereits unterschrieben.« Er beugte sich vor. »Und die Polizei bezahlt Miete.« Die Zahl, die er mir ins Ohr flüsterte, war in Ordnung. »Ich habe dich mehrfach angerufen, aber du bist nicht rangegangen.«
»Ich habe gerade einen Heiratsantrag von einem Verrückten bekommen, darum war ich verhindert.«
Emil blickte mich an, als ob ich selbst verrückt wäre.
»Wo ist er überhaupt hin?«, fragte ich. »Ich meine Gabriel.«
Er erklärte, dass in Crozon eine weitere Sachbeschädigung gemeldet worden sei, beim Labor, das chemische Analysen durchführte, sei die Außenwand beschmiert worden.
Da klingelte mein Handy. Viviennes Freundin, die aus La Palue. Sie warte auf mich, wegen der Buchantiquität, sie habe danach noch etwas vor.
Willkommen zu Hause, dachte ich. Im ganz normalen Alltag.
4
In hohem Tempo fuhr ich Minty, mein Rad, in Richtung Saint-Hernot, wo die Straße zum Dorf La Palue abzweigte. Es ging ein Stück bergauf. Schon nach kurzer Zeit war ich in Schweiß gebadet, mein Herz hämmerte, ich spürte das Blut in meinem Kopf. Die Strecke verlangte mir alles ab, aber selbst als es noch steiler wurde, gab ich nicht auf. Ich musste einfach Dampf ablassen, zu viel war in zu kurzer Zeit passiert.
Emils Angebot hatte ich angenommen, obwohl mir davor graute, die Polizei permanent im Hintergarten zu haben. Die Sache mit den Heiratsunterlagen verdrängte ich jedoch, die hatte ich in den hintersten Winkel der Küchenschublade geschoben.
La Palue war ein schöner Weiler. Penty reihte sich an Penty, bretonische Natursteinhäuser, praktisch alle renoviert, mit hellblauen Fensterrahmen und Fensterläden sowie Vorgärten voller Hortensien, Ringelblumen und Lavendel, rosa, lila, orange, eine Explosion von Farben.
»Hallo, Tereza.«
Viviennes Freundin war so jung wie sie, ebenfalls eine Rückkehrerin, das Haus hatte sie von ihrer Grandmaman geerbt, wie sie sagte. Sie war dabei, es in eine Pension zu verwandeln.
»Kein Airbnb, ein Bed and Breakfast, so wie früher, die sind jetzt wieder angesagt.«
Das antiquarische Buch, das ich nach einem Kaffee überreicht bekam, war im Jahr 1900 gedruckt worden, in einer limitierten Auflage von zehn Stück. Es trug den Titel: »Enez iroise – Insel-Sagen aus der Iroise«. Die Iroise umfasste den Atlantik zwischen der Île de Sein und der Île de Ouessant. Vorn auf dem Titelbild waren aber nicht diese Inseln zu sehen, sondern ein blauer, ovaler Stein, sowie eine Felsformation, die aus sechs kleinen Hubbeln bestand. Sie wurden »Erbsenfelsen« genannt, les Tas de Pois oder auf Bretonisch: Taz ar Piz. Sie ragten in der Verlängerung der Landzunge von Pen Hir schroff aus dem Meer und waren sowohl von der Camaret-Seite als auch von der Crozon-Seite aus zu sehen.
Ich tippte auf den Buchdeckel. »Weißt du, worum sich die Geschichten drehen?«
»Altes Sagenzeug, nicht mein Ding. Ich glaube, jeder dieser Felsen hat einen eigenen Hintergrund.«
Das klang abenteuerlich, ich nahm mir vor, das Buch zu lesen, bevor ich es weiterverkaufte.
»Sind die vom Sturm heute Nacht?«, fragte ich beim Abschied und zeigte auf einige herumliegende Äste.
»Genau.« Viviennes Freundin erzählte, dass sie so was noch nie erlebt habe. »Von null auf hundert. Da waren Surfer unten am Strand, ich will nur hoffen, dass die rechtzeitig reingekommen sind.«
Beim Stichwort Surfer fiel mir Délfine Garnier ein. Von einer vermissten Surferin hatte Viviennes Freundin aber nichts verlauten lassen. Andererseits könnte es nicht schaden, mich etwas umzuhören. Mir blieb noch ein wenig Zeit, bis ich den Laden am Nachmittag wieder aufmachte.
Zu Fuß ging ich über einen Pfad hinunter an den Strand, der an der Stelle nur über eine steile Treppe zu erreichen war. Es herrschte beginnende Flut, eine breite, schimmernde Fläche, die Wellen rollten in rhythmischen Abständen jedes Mal ein Stück weiter in Richtung Düne, alles ging fließend ineinander über und verschmolz zu dieser unendlichen Weite, die ich so liebte.
Der Sand zog sich bis zu einer Felsformation, die man bei Niedrigwasser passieren konnte, bei Flut jedoch würde der Durchgang verschwinden. Der Strand dahinter hieß Lostmarc’h. Er wurde von der gleichnamigen, etwas erhöhten Landzunge begrenzt. Da war eines der Inselheiligtümer zu finden: eine Reihe von mehreren Gesteinsbrocken, in regelmäßigen Abständen angeordnet, mit einem Menhir von überragender Größe an der Spitze, selbst von hier, über einen Kilometer entfernt, gut zu erkennen. Ein Menhir war ein in prähistorischer Zeit aufgerichteter Stein, der damals eine Grenze markiert oder auf ein Dorf aufmerksam gemacht hatte. Das Exemplar hier behielt den Atlantik Tag und Nacht im Auge. Er war über zwei Meter groß und stand aufrecht, ein Riese mit Fernsicht, der Herr der heranrollenden Brandung, des weißen Schaumes und der Gischt, der Strände und einer kleinen Insel. Sie lag vielleicht einen Kilometer vom Ufer entfernt und war umtost von Wellen, solchen mit sanften Rundungen, solchen mit kämpferischen Spitzen, steilen, flachen, nervösen – die ganze Palette, die das Herz der Surfenden höherschlagen ließ. »Wenn nicht Hawaii, dann La Palue«, hatte ich mal auf einem Werbebanner gelesen, und was soll ich sagen, es machte Sinn.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich hinausstarrte. Schließlich riss ich mich von dem Anblick los.
Neben einem Pfosten mit einem Schild, das das Schwimmen und Baden verbot, prangte eine Tafel, auf der mit Reißzwecken ein von der Gischt ziemlich verwaschenes Plakat wegen der Feier zum Nationaltag angepinnt war.
»Sind Sie interessiert?«
Die Stimme gehörte einer Frau in weißen Arbeitsklamotten, und sie meinte eine Tabelle, auf der die Wasserqualität beurteilt und öffentlich kommuniziert wurde. Ihre blonden Locken wurden von einem Tuch im Marilyn-Monroe-Stil zusammengehalten, eine Sonnenbrille verdeckte ihr halbes Gesicht. In der Hand hielt sie eine Art Gitter mit verschiedenen gefüllten Plastikbehältern.
»Ich habe schon vor zwei Wochen die Messungen vorgenommen, und ich bin sicher, dass es auch diesmal keine Beanstandung gibt. Die Wasserqualität ist exzellent.« Sie strahlte, als ob es ihr persönliches Verdienst wäre.
Auf mein Nachfragen präsentierte sie sich als amtliche Chemikerin des Departements Finistère, eine Spätberufene, an der Uni sei sie immer die Älteste gewesen.
»Dies ist mein erster Job nach dem Studium, und dann bin ich gleich das ganze Jahr am Meer, mit eigenem Labor, besser geht’s doch nicht.«
Hatte Emil nicht ein Labor erwähnt? Ich stellte die etwas abrupte Frage, ob sie am Morgen gesprühte Parolen auf der Fassade entdeckt hatte.
»Woher wissen Sie davon?«
Ich erklärte meine Verbindung zu Emil.