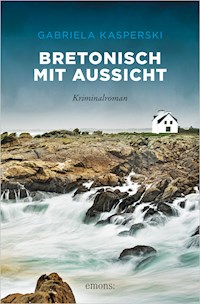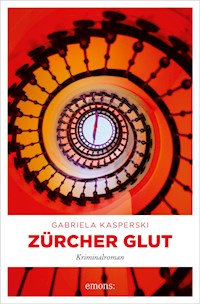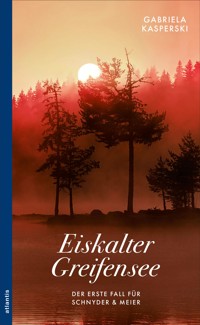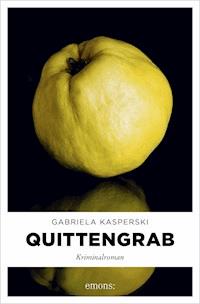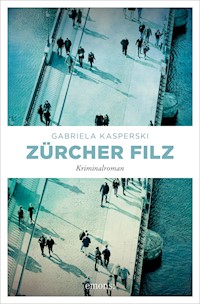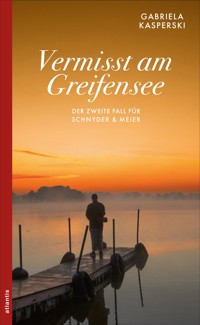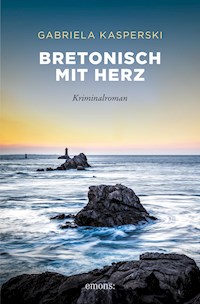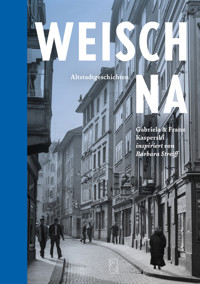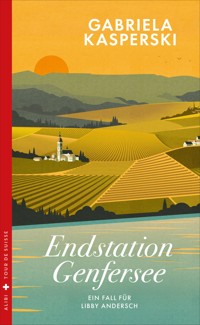Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tereza Berger
- Sprache: Deutsch
Band 5 der Krimiserie um die charmanteste Buchhändlerin Frankreichs. Im Naturschutzgebiet in der Nähe von Camaret-sur-Mer brennt in der flirrenden Sommerhitze ein Ferienhaus aus. Mit der Instandsetzung betraut wird Isidore Breonnec, allseits bekannter Handwerker und Herzensbrecher. Als er tot auf der Baustelle aufgefunden wird, sitzt der Schock tief. Commissaire Mahon ermittelt, und ausgerechnet eine treue Mitarbeiterin von Buchhändlerin Tereza Berger gerät unter Verdacht. Auf der Suche nach dem wahren Täter dringt Tereza tief in die Scheinidylle der Ferienhausvermietung ein. Zu tief?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben. Den Sommer verbringt sie seit vielen Jahren in der Bretagne.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: shutterstock.com/Aastels
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
Lektorat: Susann Säuberlich, Neubiberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-130-0
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Gérard Drévillon, † 28.12.
O Breizh, ma Bro, me ’gar ma Bro,
tra ma vo mor ’vel mur ’n he zro,
ra vezo digabestr ma Bro!
Oh, Bretagne, mein Land, ich liebe mein Land,
wie das Meer es umgibt, einer Mauer gleich,
so soll es frei sein, mein Land!
Bretonische Hymne
Prolog
Camaret-sur-Mer, 19. September 1944
Ein Horn ertönte, das Schiff unter der Aufsicht eines englischen Offiziers stach ins dunkelblaue Meer.
»Nein, nicht losfahren!« Selimène rannte über den Hafenplatz von Le Fret zur Anlegestelle. »Jacques, bleib hier!«
»Selimène, bist du verrückt?« Eine Hand packte sie und stoppte ihren Lauf. »Sei froh, dass sie endlich verschwinden, diese stinkigen Läuse.«
Laurent, der alte Fischer, zog sie an die Seite, weg von den etwa fünfzig Einheimischen, die verfolgten, wie das Schiff mit deutschen Kriegsgefangenen und der Familie Kéravel losfuhr. Die Überfahrt nach Brest würde eine halbe Stunde dauern, und der Meeresboden war mit Minen gespickt.
Wenn sie sich überlegte, wie es ihrem Freund Jacques, dem jüngsten Sohn der Kéravels, auf dem Boot ergehen würde, war Selimène versucht, ins Meer zu springen, um ihn zu retten. Was ein Irrsinn gewesen wäre, sie würde erschossen werden oder ertrinken. Und dabei hatte der Gedanke sie beherrscht, seit die ersten deutschen Soldaten das Wirtshaus direkt am Hafen von Le Fret okkupiert und Jacques’ Eltern zu ihren Bediensteten gemacht hatten. Jacques war nicht mehr zur Schule gekommen und hatte Selimène nur noch heimlich treffen können, meist in der Nähe des kleinen Dorfes Kersiguénou, wo sie wohnte. Er nannte »ihren« Strand La Boule bleue. Die blaue Kugel von Kersiguénou.
»Weil bei dir die Sonne immer ein wenig mehr strahlt als auf dem Rest der Halbinsel.«
Vor einigen Tagen war er mit der Nachricht gekommen, dass Fallschirmjäger der Alliierten gelandet waren.
»Engländer und Amerikaner, sie haben sich Zugang zum Gasthaus verschafft und die Deutschen gefangen genommen.« Er hatte sie umarmt. »Bald ist es vorbei.«
Aber die Pläne für eine gemeinsame Zukunft hatten sich zerschlagen, als Jacques zusammen mit den Eltern und den Geschwistern verhaftet worden war.
»Was schaust du so traurig, Selimène«, sagte Laurent, der Fischer. »Das Schiff ist weg. Die kommen nicht mehr.« Er machte ein Kreuzzeichen.
»Aber warum die Kéravels?«, fragte Selimène. »Sie sind Bretonen wie wir.«
»Verräter. Sie haben die Deutschen bei sich wohnen lassen.«
»Sie wurden gezwungen.«
»Trotzdem hatten sie Butter. Und wir Algenkuchen.«
»Was wird mit ihnen passieren?«
Laurent senkte den Blick. »Vergiss Jacques.«
»Es ist ungerecht«, sagte Selimène mit erstickter Stimme.
»Wer hat gesagt, dass das Leben gerecht ist?« Laurent nickte ihr zu. »Lauf nach Hause zu deiner Mutter. Feiert.«
***
Die Tränen kamen erst später, als Selimène neben dem alten Ziegenstall ganz am Ende des Grundstücks ihrer Eltern auf der Düne stand. Der Stall war geschützt durch hohes Dünengras, vom Weiler her sah man ihn so wenig wie vom Strand aus. Die Soldaten hatten diesen besonderen Ort nie entdeckt, was ein großes Glück war. Hier hatten Jacques und sie ein kleines Häuschen bauen wollen, die Pläne hatte Selimène im Kopf.
Sie trat einen Schritt vor, um den Strand in seiner ganzen Breite zu sehen. Woge um Woge brandete heran. Die Gischt brach und floss wie ein silberner Teppich über den weißen Sand, bevor sich das Wasser wieder zurückzog, Algenhaufen hinterlassend, auf die sich die Möwen stürzten. Weit draußen stand eine Figur, die Silhouette dunkel gegen das Orange der sinkenden Sonne, reglos, versunken in dem immerwährenden Spektakel. Auch wenn Sturm und Unwetter herrschten, abends, kurz vor Sonnenuntergang, wurde es hier wieder hell, ein Fenster zum Himmel.
»Jacques!«
Selimènes Schrei brachte die Möwen zum Schweigen. Sie rannte über den Sand, an dem handgeschriebenen Schild vorbei, das auf die Minen aufmerksam machte. Aber je näher sie der Figur kam, desto mehr löste sie sich auf.
»Bleib!«
Selimène sprang und tauchte tief, mit offenen Augen, wie sie das meistens tat. Da bemerkte sie wieder die Gestalt. Es war nicht Jacques. Es war die Meerprinzessin. Ihr Name war Dahut, und sie war ihr schon mal erschienen, vor vielen Monaten. Sie hatte ihr Schutz versprochen, ihr und ihrer Familie. Dafür hatte sie ihr auch ein Versprechen abgenommen.
»Pardon«, schrie Selimène, »ich habe es nicht geschafft!«
Sie tauchte auf und krallte die Zehen in den Sand, während sie verfolgte, wie die Prinzessin von Welle zu Welle hüpfte, bis sie direkt vor ihr stehen blieb. Ihre Nasenflügel bebten, ihre Wimpern ebenso, die ganze Gestalt bebte. Während die Augen glühten, als ob der letzte Strahl der Abendsonne durch sie hindurch bis zu Selimène gelangen sollte.
»Du wirst jede Mine ausgraben, bis das Land wieder sicher ist. Und du wirst keine Fremden mehr an diesen Strand lassen. Hörst du, keine Fremden! Heute in einem Jahr und ab dann jedes Jahr werde ich da sein, um unseren Pakt zu erneuern.«
1
Camaret-sur-Mer, Samstag, 15. Juli
Immerblauer Himmel, die Gischt der Brandung, die leuchtende Kugel der Sonne auf ihrem trägen Sinkflug – ich, Tereza Manon Elektra Berger, saß auf einem Felsvorsprung der Presqu’île de Crozon, diesem paradiesischen Fleck bretonischer Erde, und erlebte einen Sonnenuntergang vom Feinsten. Der Fels hieß Château de Dinan, Kastell von Dinan, und war ein von den Gezeiten geformtes Felsschloss, das auch bei schönstem Wetter von Wind und Wellen umtost war. Um es zu erreichen, hatten wir über einen Pfad balancieren müssen, der so schmal war, dass selbst mir, die ich schwindelfrei war, der Atem stockte. Aber es hatte sich gelohnt. Und wie.
»Vielen Dank«, sagte ich zu Gabriel Mahon. Er war der örtliche Commissaire der Police nationale, eingewandert aus Schottland, in seiner Art ähnlich wie das Gestein hier – verwittert bis bröcklig – und ziemlich sexy. Vor allem jetzt, da er eine Papiertüte aus der Tasche seines Ledermantels zog.
»Ein Croissant? Abends um neun?«
Statt einer Antwort übergab er mir die Tüte und kraulte das dichte Fell von Merguez, meinem Hund, der zwischen uns lag und einen wohligen Pups von sich gab.
»Jetzt fehlt nur noch der café avec énormément du lait.«
Dass ich meinen Milchkaffee mit sehr viel Milch und sehr wenig Kaffee trank, wusste Gabriel mittlerweile.
»Mach jetzt auf, Tereza.«
In dem zerknitterten Papier fand ich keine Kalorienbombe, sondern ein schmales Couvert mit einem Ring. Ein schlichter silberner Ring von runder Form mit einer feinen, eingravierten Zeichnung.
»Ein Triskel … Erde, Luft, Wasser, meine Elemente.«
Als Gabriel keine Anstalten machte, mir den Schmuck über den Finger zu streifen, tat ich es selbst. Vor einigen Wochen hatten wir das gleiche Spiel gespielt, nur war jener Ring nicht für mich bestimmt gewesen, und Gabriel hatte offensichtlich Ersatz besorgt. Auf halbem Weg blieb der Ring jedoch stecken.
Gabriel wirkte etwas ratlos. Seit er von der Insel Ouessant zurückgekehrt war, hatte er jede Nacht bei mir im Atlantique, dem Dachzimmer der Villa Wunderblau, verbracht.
»Wir können ihn umtauschen.« Er steckte den Ring in die Manteltasche.
Seine Augen hatten dieselbe Farbe wie das Meer, La Mer d’Iroise, wo der Kanal, die irische See und der Atlantik sich in einem wilden Wirbel zusammenfanden. Die Farbe hieß Glaze. Sie war geheimnisvoll und wunderbar, und ich war ihr verfallen. Bis Merguez erneut pupste.
»Ich weiß nicht, was er gefressen hat«, sagte ich und versuchte, mein verwehtes Haar in einen Knoten zu fassen. »Wahrscheinlich im Laden.«
Immer wieder kam es vor, dass die Kundinnen Merguez mit Leckerlis vollstopften, weil er so artig vor den Buchregalen lag. In jüngster Zeit allerdings eher selten, die Bücherverkäufe hatten mehr als gedümpelt. Die Hitzewelle war der Grund dafür, wir hätten Eis oder Ventilatoren in unser Angebot aufnehmen sollen.
»Hundepupse sind die schlimmsten. Die trotzen jedem Wind.« Gabriel gab mir über Merguez hinweg einen Kuss. Und, was soll ich sagen, meine Geldsorgen wären vergessen gewesen, hätte uns nicht ein Handyklingeln aus der Stimmung gerissen.
»Shit, was will der von mir?«
Bevor Gabriel den Anruf wegdrückte, konnte ich nicht umhin, den Namen auf dem Display zu lesen. Mael Abelas. Wenn der Leiter des Bauamts von Crozon nach Feierabend anrief, war es vermutlich dringend. Neben der Bürgermeisterin war er die wichtigste Person im Ort. Ich kannte ihn nur vom Sehen, da Isidore Breonnec die Bewilligungen vom Bauamt jeweils für mich einholte. Isidore war ein waschechter Camarétois und ein handwerklicher Alleskönner, außerdem ein lieber Freund. Er wollte später vorbeikommen und mit uns anstoßen.
Als Gabriels Handy zum dritten Mal klingelte, stand er auf und entfernte sich, um den Anruf anzunehmen.
Ich raffte die Jeansjacke um mein geblümtes Kleid, rappelte mich ebenfalls hoch und ging vorsichtig zu Sylvie Meerwein, meiner Freundin und Arbeitskollegin, die sich während unseres kleinen Intermezzos am Picknickkorb zu schaffen gemacht hatte. »Hast du mir das Geld mitgebracht?«, fragte ich.
Sie zog einen Schein aus der Tasche ihres Overalls, ihrer Arbeitskluft. »Zweihundert Euro, danach ist die Barkasse leer.«
Sylvie kümmerte sich um die Buchbestellungen und den Verkauf, während ich häufig für unsere antiquarische Abteilung unterwegs war, um auf Dachböden und in Kellern verstaubte Trouvaillen sicherzustellen.
»Nicht nur die Barkasse ist leer, auch mein Konto«, sagte ich.
»Nicht mehr lange, dann geht’s los mit den Vermietungen der Cabane Wunderblau.«
Die Cabane Wunderblau war der ehemalige Gartenschuppen, den wir in ein kleines vermietbares Ferienhäuschen umbauten. Die Fertigstellung hatte sich wegen unvorhergesehener Herausforderungen wie dem nicht vorhandenen Zufluss zur Naturdusche verzögert, was mein Budget überstrapazierte.
»Die Agentur Amèr hat mich übrigens kontaktiert«, fuhr Sylvie fort.
»Der Name sagt mir etwas.«
»Du kennst vielleicht Xavier Amèr. Seine Katamaranausflüge sind legendär und immer ausgebucht. Und er ist der beste Kitesurfer der Halbinsel.« Sie deutete aufs Meer hinaus, wo ein Surfer mit seinem Brett aus dem Wasser schoss und durch die Brandung zum Strand zurückkreuzte. »Das muss er sein. So wie er surft keiner.«
»Und was will der von uns?«, fragte ich.
»Er und seine Schwester Aude haben eine Ferienhausvermittlung.«
Bei der Erwähnung bekam ich ein ganz klein wenig schlechte Laune. Bislang hatte mich das Geschäft mit den Vermietungen wenig interessiert. Aber man hatte mir erzählt, es sei ein echtes Haifischbecken.
»Erfolgreich?«
»Sehr. Sie haben angeboten, die Cabane Wunderblau in ihren Katalog aufzunehmen.«
Das ging mir eindeutig zu schnell. »Wir wissen nicht, wie lange der Bau noch dauert.«
»Ist ihnen wurscht. Sie suchen die leckersten Häuser der Halbinsel.«
Leckere Häuser? Ein typischer Sylvie-Ausdruck.
»Das will ich nicht. Wir machen die Vermietung selbst. Ich habe einen großen Bekanntenkreis.«
»Das sagst du immer. Aber bis jetzt hat sich niemand gemeldet. Du musst doch Geld verdienen, Tereza.« Sylvie beugte sich zu mir, sodass ihr Haar meine Nase kitzelte. »Die Amèrs haben ein riesiges Kundennetzwerk in Deutschland. Damit die Cabane sich rentiert, brauchen wir auch Gäste im Oktober oder im April. Sie würden uns alles abnehmen, wir hätten nichts zu tun mit den Daten und dem ganzen Kram. Und das Beste: Sie haben einen eigenen Putzbetrieb. Les Jeunes de Ménage, die sollen top sein.«
»Wie viel wollen sie dafür?«, fragte ich.
»Fürs Putzen?«
»Ich meine die Provision. Fürs Vermitteln.«
»Das ist Verhandlungssache. Bei dir wären es vermutlich etwa zwanzig Prozent.«
»Ganz schön viel.«
In dem Moment tauchte Aimon auf, Gabriels bester Freund. Mit einer Flasche Schaumwein und Pappbechern balancierte er in voller Motorradmontur über die Felsbrücke.
»Hei, Gabe.« So nannte er Gabriel, der sein Telefonat beendet hatte und wieder zu uns kam.
»Aimon, mein Freu…«
»Mein Medienstar«, übertönte Sylvie Gabriel. Sie und Aimon waren seit mehreren Jahren ein Paar. »Wie ist es gelaufen bei den Breizh News?«
Aimon hatte bei dem Radiosender an einer Diskussion über Abwanderung in Küstengebieten teilgenommen.
»Eine Katastrophe.« Er als Vertreter der alten Generation hatte mit zwei Jungen diskutiert, einer Studentin aus Rennes und einem Schreiner aus Paris. Er war sichtlich aufgewühlt und erzählte, während Gabriel erneut einen Anruf bekam.
»Ich kapiere diese Jungen nicht. Die sind beide abgehauen. Keine Bildungs- und Arbeitsmöglichkeiten hier, sagen sie. Und dabei ist im Sommer so viel zu tun. Im Relais zum Beispiel suchen sie seit Wochen eine Arbeitskraft. Vergeblich.«
Das Relais des Pêcheurs war eine Kneipe im Hafenstädtchen Morgat, wo Aimon mit Gabriel und anderen jeweils sein Feierabendbier trank.
Sylvie machte eine skeptische Miene. »Das Relais ist eng, und es stinkt, der Lohn ist mager. Da zu arbeiten ist echt keine Perspektive.«
»Verwöhntes Pack. Wir sind früher morgens zum Fischen, mittags zum Bauen und nachts zum Servieren.«
»Und im Winter, wenn der Tourismus schläft?«, fragte ich.
»Dann haben wir Netze geflickt …«
»… und die Ersparnisse des Sommers aufgebraucht«, sagte Sylvie. »Darum lebst du bis heute von der Hand in den Mund.«
»Ich habe mein Motorrad, meine Motte und mein Haus. Was will ich mehr?« Mit der Motte meinte er Sylvie.
»Ein renoviertes Haus, zum Beispiel. Dein Dach leckt, es regnet herein.«
»Isidore kümmert sich darum. Er hätte übrigens längst hier sein müssen.«
Ich blickte zum Küstenwanderweg, der sich gut sichtbar vom Campingplatz her über das Plateau bis zu unserem Standort zog, aber da war niemand unterwegs.
Sylvie entwich ein Laut. »Er wird wohl wieder illegale Nachtarbeit machen … und hat uns vergessen.«
»Warum bist du so abschätzig?«, fragte ich und blickte sie erstaunt an. »Und was meinst du mit illegal?«
Schweigen. Sylvie wollte mir nicht antworten.
»Nein, sag, warum illegal? Sylvie?«
»Nichts. Erzähl ich dir ein anderes Mal.«
Gabriel, der den Anruf beendet hatte, mischte sich ein. »Der Breonnec kommt nicht? Wunderbar.«
Dass er Isidores und meine Vertrautheit nicht sonderlich mochte, war ein offenes Geheimnis.
»Prost allerseits«, sagte Aimon, der nichts von der Spannung gespürt hatte. »Lasst es euch schmecken.«
Aber Gabriel hatte keine Zeit mehr. »Ich muss gehen. Es brennt.« Er zeigte in Richtung Camaret-sur-Mer. »Schaut mal!«
Ich kniff die Augen zusammen. »Tatsächlich, eine Rauchwolke.«
»Bei den Dünen von Kersiguénou«, stellte Aimon fest. »Ein Feuer im Schilf? In den Büschen, im Dünengras?«
Gabriel wusste es genauer. »Mael Abelas hat mir durchgegeben, dass es sich um das Haus von Selimène Lacroix handelt.«
»Wer ist das?«, fragte Sylvie.
»Die Gründerin von Notre littoral, das ist die Naturschutzorganisation Crozons.«
Selimène Lacroix mit dem wilden grauen Haar und der Latzhose war eine beeindruckende Person, die ich flüchtig kannte. Sie hatte mal bei mir im DEJALU ein Buch gekauft.
»Der Rauch wird immer mehr«, sagte Gabriel. »Ich muss mir das anschauen. Sylvie, Aimon, könnt ihr Tereza nach Hause bringen?«
Es war unser freier Abend, und ich hatte nicht vor, den wegen eines Brandes allein zu verbringen. »Ladet bitte gern Merguez in der Villa Wunderblau ab. Ich fahre bei Gabriel mit.«
2
Die Fahrt mit Gabriels Motorrad, einer alten, aber äußerst charmanten Royal Enfield Bullet, verlief schnell, und keine Viertelstunde später hielten wir vor dem Ortsschild von Kersiguénou.
»Ich frage kurz nach, wo die Abkürzung zu Selimènes Haus ist«, sagte Gabriel und bedeutete mir abzusteigen. »In diesem Dorf gibt es jede Menge winziger Sträßchen, da verfahre ich mich immer.« Er griff zum Handy und rief jemanden an, während ich abstieg.
Nachdem ich den Helm abgenommen hatte, blickte ich mich um. Auf der einen Straßenseite waren mehrere Steinhäuser aneinandergebaut, auf der anderen begann die Dünenlandschaft.
»Komm, Tereza, ich kann hier parken.« Gabriel schob das Motorrad in die gekieste Einfahrt des einzigen frei stehenden Hauses. Es war wie die anderen ein Penty, aber renoviert, mit großflächigen Fenstern, herrschaftlicher Ausstrahlung und einem Garten voller lila Orchideen und pinkfarbener Hortensien.
»Agentur Amèr«, las ich auf dem Schild neben dem blechernen grünen Briefkasten. »Ihr Zuhause in den Ferien. Seien Sie willkommen.«
Das also war die Agentur, von der Sylvie eben gesprochen hatte. Und der gut trainierte Mann mit den nassen dunklen Locken, der auf uns zueilte, musste Xavier Amèr sein.
Nach einer hastigen Vorstellung folgten wir ihm über die Straße zu den Dünen. Die gesuchte Abkürzung entpuppte sich als schmaler Weg, eingerahmt von Bäumen und dichtem Gebüsch, die eine Art natürlichen Tunnel bildeten. Diesen durchliefen wir schweigend und so schnell, dass ich mich konzentrieren musste, um nicht zu stolpern. Obwohl die Abendsonne immer noch hoch am Himmel stand, war es hier düster und kalt, und ich war froh, als wir wieder draußen waren.
Direkt vor uns erhob sich ein hohes Gebäude, aus dessen Dach Rauch quoll. Der Wind hatte eine Pause eingelegt, die Rauchglocke waberte an Ort und Stelle, es wirkte wie eine Teekanne kurz vor einer Explosion.
»Ist das ein Reetdach?«, fragte ich.
Xavier Amèr bejahte. »Wenn sie den Brand nicht gestoppt kriegen, wird es gefährlich. Der Frühling war heiß, das Stroh ist ausgetrocknet, es braucht nur wenig, eine defekte Leitung oder ein Streichholz, und schon … Puff!«
»Und Selimène Lacroix?« Ich wagte nicht, daran zu denken. »Ist sie zu Hause?«
»Ich hoffe nicht. Sie wohnt offiziell nicht mehr da, weil eine Renovierung im Gang ist. Aber ab und zu schaut sie vorbei.«
Er blickte alarmiert zu Gabriel, der bereits wieder telefonierte. Der normalerweise kaum hörbare schottische Akzent verriet mir sein Stresslevel.
Eine Sirene schwoll an, über die geteerte Straße, die sich zwischen den Häusern den Hügel hinunterwand, näherte sich ein Feuerwehrwagen und hielt nur wenige Meter von uns entfernt. Sechs Männer in Overalls sprangen heraus.
Gabriel trat zum Hauptmann, erkennbar am Helm, der im Gegensatz zu den anderen golden war. Eine Flamme schoss unvermittelt aus dem vorderen Teil des Daches, das gleißende Orange hob sich vom samtblauen Himmel ab.
Der Feuerwehrhauptmann gab pantomimisch einen Befehl, der eine Kaskade von Aktionen in Gang setzte. Ein Schlauch wurde ausgerollt, eine Leiter ausgefahren, zwei Feuerwehrleute rannten in Richtung Meer, während zwei weitere mit Atemschutzmasken und bewaffnet mit Löschdecken und Feuerlöschern durch einen seitlichen Eingang im Haus verschwanden.
»Ist das nicht riskant?«, fragte ich.
»Sie müssen erstens ausschließen, dass jemand da drin ist, und zweitens den Brandherd finden. Sollte das Feuer durchschlagen, würde der Dachstuhl abbrennen.«
Als der erste Strahl aus einem Schlauch spritzte, traf er mein Kleid, meine Jacke und meine Stoffturnschuhe. Gleich darauf brachte das Wasser die Flammen zum Tanzen, und glühende Asche regnete auf die Umgebung, sodass Xavier und ich zurückwichen.
Gabriel hatte aufgelegt. »Ein zweites Löschkraft-Team ist im Anflug. Tereza, Xavier, könnt ihr solange die Leute da oben zurückhalten?« Er deutete in Richtung Straße, wo sich ziemlich viele Menschen versammelt hatten, alle in verschiedenen Stadien der Bekleidung.
»Aber gern.«
Nachdem einige Feriengäste kaum Französisch verstanden, erläuterte ich die Lage auf Deutsch und Englisch, während ich gleichzeitig in meiner Tasche wühlte. Die Boule-rouge, ein Original aus einem gleichnamigen Laden in Zürich, enthielt alles, was ich zum Überleben brauchte, in dem Fall war es ein buntes Wollknäuel, das ich Xavier zuwarf, um eine improvisierte Absperrung zu errichten. Jäh wurde ich durch den Feuerwehrhauptmann unterbrochen, der zu uns hochlief.
»Sie im nassen Kleid, was tun Sie da?«
Erst als er den Helm abgenommen hatte, erkannte ich ihn. Es war Mael Abelas, der offenbar nicht nur der Baudepartements-Vorsteher, sondern auch Chef der Feuerwehr war. Deswegen also hatte er Gabriel angerufen. Er war groß, mit kantigem Kinn und silbergrauem Haar, und nicht gut auf mich zu sprechen.
»Das ist ein Brandplatz, verschwinden Sie.«
Ich kam nicht dazu, ihm zu erklären, dass ich als Begleitung des diensthabenden Commissaire hier war.
»Gehen Sie nach Hause, geht alle nach Hause. Jetzt! Das ist ein Befehl!« Ohne abzuwarten, ob ihm jemand Folge leistete, eilte er wieder nach unten zu seinen Leuten.
Mittlerweile hatte sich der Himmel im Osten zu einem satten Tintenblau verfärbt, und davor zuckten die Flammen. Es sah irre aus.
Ein weiterer Schlauch wurde ausgerollt.
»Wo kriegen die das ganze Wasser her?«, fragte ich Xavier. »Vom Meer?«
Es lag bestimmt einen halben Kilometer entfernt. Dass wir die Uferlinie von hier sehen konnten, war nur der kleinen Anhöhe zu verdanken.
»Nein, im Wald ist eine source.«
Er meinte eine natürliche Quelle, die aus dem Boden sprudelte und für alle zugänglich war. Auch wir hatten eine im Garten, sie war mehr wert als Gold.
»Was denken Sie, Xavier, ist das Feuer unter Kontrolle? Ich sehe nur noch sehr viel Rauch und keine Flammen mehr.«
Er wirkte skeptisch. »Der Dachstuhl besteht aus uralten, wurmstichigen Balken. Er hätte längst ersetzt werden müssen, aber es ist ein historisches Gebäude. Das ist problematisch, weil …«
»… die Renovierung teuer wird«, sagte ich. »Ich kenne das gut.«
»Haben Sie auch ein Reetdach?«, fragte er.
»Nein, dafür habe ich mal auf dem Dachboden eines Reetdachhauses die zweihundertjährige Ausgabe eines Gedichtbands von Marie de France ergattert. Am meisten ist mir mein erster Gedanke geblieben: Da kann man nur beten, dass es niemals brennt.«
Mein Handy klingelte. Gabriel. Ich trat einen Schritt beiseite.
»Gerade habe ich verifiziert, dass sich Selimène im Altersheim des Leuchtturmklosters von Sœur Nominoë aufhält. Sag das bitte weiter.«
Was für eine gute Nachricht! Sœur Nominoë war eine bejahrte Nonne, die ich sehr mochte. Ich teilte viele Erinnerungen mit ihr. Eine meiner emotionalsten war, wie wir die Asche meiner Großtante Annie von einem Kliff in den atlantischen Wind geworfen hatten. Während ich Nominoë jahrelang beinahe täglich gesehen hatte, war sie in den letzten Monaten durch den Aufbau eines Altersheims absorbiert gewesen. Es sollte älteren Leuten die Möglichkeit geben, ihre Häuser zu verlassen, um Platz zu schaffen für die jüngere Generation.
Als ich wieder bei Xavier stand, gab ich die Entwarnung durch.
»Zum Glück.« Er war sichtlich erleichtert. »Jetzt kann ich es ja gestehen: Sie wollte heute noch Blumen vorbeibringen, für die Gäste.«
So erfuhr ich, dass Selimène das leer stehende Haus über die Agentur Amèr für drei Wochen an Sommergäste vermietet hatte.
»Sie haben sich verspätet, weil sie in Paris die TGV-Verbindung verpasst haben. Meine Schwester hat sie am Bahnhof Brest abgeholt. Sie kommen gerade an.«
Er deutete zu einem offenen Jeep, der hinter den beiden Löschfahrzeugen zum Stillstand kam. Die Chauffeurin, Xaviers Schwester Aude, trug Küstenlook mit Strickmütze. Neben ihr saß eine Frau mit Millimeterschnitt und Spaghettiträgern, auf der Hinterbank eingequetscht eine weitere Frau, in einem beigen Regenmantel wesentlich unscheinbarer als die andere, sowie zwei Mädchen, die eine im Teenageralter, die andere an eine Barbiepuppe geklammert.
»So ein Scheißdreck«, sagte Aude mit lauter Stimme. Sie stieg aus, nahm Brille und Mütze ab und schüttelte ihr rotblondes Haar.
»Entschuldigen Sie mich.« Xavier eilte zum Jeep, wo Aude sogleich begann, auf ihn einzureden. Seine Antwort nervte sie sichtlich. Dennoch machte sie weiter, bis er abwinkte und an dem improvisierten Absperrband vorbei auf Mael Abelas zuging, der mittlerweile bei Gabriel stand.
Aude folgte ihm, ohne zu zögern. Zu meinem Erstaunen begrüßte sie nicht nur Abelas, sondern auch meinen Liebhaber mit den ortsüblichen schnellen Doppelküssen, gleich darauf zettelte sie erneut eine Diskussion an. Im allgemeinen Durcheinander gelang es mir, unauffällig so nahe zu kommen, dass ich alles verstehen konnte.
Das Gespräch drehte sich um die Ursache des Brandes.
»Es ist die Folge der Hitze«, sagte Aude gerade. »Strohdächer sind gefährlich.«
Gabriel sah es anders. »Die meisten Brände sind menschengemacht. Was ist mit den Renovierungsarbeiten?« Er deutete auf einen kleinen Bagger, der an der Seite stand.
»Die pausieren gerade«, sagte Aude, »solange die Gäste da sind, wird nicht gebaut.«
»Was wird denn überhaupt gemacht?«
»Eine Totalsanierung.«
»Deine Putzleute waren heute im Haus, Aude«, sagte Abelas. »Habe ich gehört.«
Sie nickte. »Les Jeunes de Ménage, genau. Sie haben nichts Ungewöhnliches vermerkt. Sie sind super geschult, ich lege meine Hand für sie ins Feuer.« Aude lächelte. »Das ja nun fast gelöscht ist.«
»Weißt du, was Selimène im Dachstock gelagert hat?«, fragte Mael Abelas weiter. »Seit der Gründung von Notre littoral haben sich da vermutlich Unterlagen von Jahrzehnten angesammelt.«
»Ich wollte sie überreden, alles bei euch im Gemeindehaus zu archivieren, aber vergeblich. Auch im Rest des Hauses gab es viel Krimskrams, wir mussten eine ganze Lastwagenladung wegbringen, um es vermietbar zu machen. Dabei haben wir ein Leck im Dach entdeckt, das Wasser ist monatelang reingelaufen. Die Reparatur habe ich bereits veranlasst. Was für ein Glück, dass alles feucht war, stellt euch vor! Vermutlich hat sich das Feuer darum nicht weiter ausgebreitet.«
Diese Aude war ein ziemliches Früchtchen, fand ich. Unterschwellig hatte sie gerade das Gerücht in die Welt gesetzt, dass an dem Brand nicht sie und ihr Putzteam schuld seien, sondern der demente Messie Selimène Lacroix.
Das konnte ich so nicht stehen lassen. Auch wenn ich Selimène nicht persönlich kannte – wir Frauen helfen uns hier.
»Kann es Brandstiftung gewesen sein?«, fragte ich und tat naiv. »Ich meine, das Dach ist ziemlich hoch, vielleicht hat es jemanden gestört. Wegen der Aussicht, ihr wisst schon.«
Stille war eingetreten, alle drehten sich zu mir um.
»Es ist eine Möglichkeit, nicht?«, fuhr ich fort. »Ich habe mal von einem Brand gelesen, in der Zeitung, hier in der Nähe, es ging auch um ein historisches Gebäude –«
Gabriel unterbrach mich. »Das werden wir untersuchen.« Er klang genervt.
»Und wer ist diese Expertin? Stell uns doch vor, Gabriel«, sagte Abelas. Als das passiert war, musterte er mich von Kopf bis Fuß. »Sie sind also Tereza Berger? Ich habe schon einiges von Ihnen gehört.«
Der süffisante Ton ärgerte mich. »Während Sie mir völlig unbekannt sind. Aber ich habe selten mit der Gemeinde Crozon zu tun.«
»Sie haben doch umgebaut? Die entsprechenden Bewilligungen laufen alle über uns. Falls nicht, wäre es illegal.«
Der Stapel Unterlagen auf meinem Schreibtisch fiel mir ein und wie ich Isidore alle paar Tage gedrängt hatte, sich mit mir hinzusetzen.
»Machen wir im Winter, Tereza«, hatte er jedes Mal geantwortet. »Dann haben wir alle Zeit der Welt.«
»Natürlich habe ich die Bewilligungen.« Ich blickte Abelas in die Augen. »Bei mir ist alles superlegal, vielen Dank.«
Wind war aufgekommen und wehte Qualm und Rauch in unsere Richtung. Gabriel nahm mich am Arm und lotste mich von der Gruppe weg.
»Tereza, spinnst du?«, zischte er. »Was mischst du dich ein? Das sind Interna, die wir hier besprechen.«
»Aber diese Aude Amèr … die darf dann?« Sie erinnerte mich irgendwie an Gabriels verstorbene Ex-Frau, die schöne Yogalehrerin Nadège. Ob ich es wagen konnte, ihm das zu sagen? »Egal.« Der andere Punkt war mir wichtiger. »Sollte es Brandstiftung gewesen sein … die kehren meist an den Schauplatz zurück.«
Mit meiner Amateurinnenanalyse schockte ich Gabriel sichtlich. »Geh jetzt bitte«, sagte er.
Aber ich dachte nicht daran. Selimène Lacroix war eine Persönlichkeit, ihre Stiftung Notre littoral etwas Einzigartiges. Dass ausgerechnet ihr Haus brannte, schien mir verdächtig.
3
Die Menge war kleiner geworden, diejenigen, die geblieben waren, standen in Grüppchen zusammen. Während ich ein Stück weit den Hang hinaufstieg, um mir einen Überblick zu verschaffen, erinnerte ich mich an einen Brand, der in meinem ersten Jahr hier in der Nähe passiert war. Wo bloß?
Als ich beim Googeln auf meinem Handy nicht auf Anhieb fündig wurde, hinterließ ich Vivienne Danieau eine Nachricht. Sie war kaum Mitte zwanzig und bereits Moderatorin, Redakteurin und Sendechefin von Breizh News. Wir hatten verschiedene Herausforderungen gemeinsam überstanden. Auch als Journalistin war sie top. Wenn sie ein Thema aufgriff, konnte man sicher sein, dass es kurze Zeit später von den großen Sendern übernommen wurde.
»Die haben alle so pikiert reagiert, als ich von Brandstiftung sprach, dass da etwas dran sein könnte. Kannst du bei euch im Archiv nachschauen, ob du was findest über rätselhafte Brände an der Küste?«, bat ich sie.
Ich erreichte einen Platz mit einer Bank und bunten Blumen, eine Art Mini-Aussichtsplattform. Angrenzend daran standen einige Einfamilienhäuser, das auffälligste war eine Villa mit geschwungenem Eingangsportal und Palmen wie im Süden.
In der Einfahrt entdeckte ich ein mir bekanntes Gesicht. Es gehörte Corentin Lehenaff, einem schmalen, leicht gebückten, aber agilen jungen Mann, der als Mitarbeiter im Bauamt fungierte. Kennengelernt hatte ich ihn aber wegen seiner Tätigkeit für einen zwielichtigen Anwalt in Brest.
Er war ins Gespräch vertieft mit einem stämmigen Typen, dessen prollige Ausstrahlung im Gegensatz zu seinen violetten Birkenstocksandalen und seiner perlenden Sprache stand.
Eindeutig Paris, dachte ich. Mittlerweile lebte ich lang genug hier, um den Unterschied zum gutturalen Klang des Bretonischen zu erkennen.
Etwas abseits von den beiden stand eine Frau in einem steifen Kleid, mager und makellos.
»Sind Sie von hier?«, fragte ich, nachdem ich sie angesprochen und mich vorgestellt hatte.
»Unser Haus.« Sie deutete auf die Villa, die neben dem protzig wirkenden Eingangsbereich auch neobretonische Merkmale wie das Granitdach oder die Fensterläden aufwies. Ungewöhnlich waren der ockerfarbene Anstrich und die hohe Gartenmauer. »Ich habe auf der Terrasse gelesen, als ich den Rauch bemerkt habe. Er quoll durch ein offen stehendes Fenster direkt unter dem Dach von Selimènes Haus. Darauf habe ich meinen Mann angerufen. Sie hatten gerade eine Feuerwehrübung, darum waren sie so schnell hier.«
»Sie sind eine Heldin. Es hätte schlimm werden können.«
»Merci. Sie sind die Erste, die das erwähnt.« Ein kurzes Lächeln, dann stellte auch sie sich vor. »Myrthe Abelas.«
Oha. Die Frau das Bauamt-Vorstehers.
»Ich kenne Ihren Mann.«
Die Reaktion wirkte etwas gequält. »Wer kennt ihn nicht?«
»Und sind Sie von hier?«
»Mein Mann ja. Bei mir hört man es auch noch nach vielen Jahren … ich bin aus Paris.«
Ich griff in meine Boule-rouge-Tasche und zog eine Tafel Grain de Sail heraus. Die mit Sel de Guérande, dem körnigen Salz, und der dunklen Schokolade.
»Ich brauche was Süßes. Sonst kippe ich um. Mögen Sie?«
Sie nahm ein Stück, was mich erstaunte.
»Das Schlimmste ist vorbei«, sagte sie. »Außer dem Dach scheint alles in Ordnung. Aber die Feriengäste werden kaum einziehen können.«
Ich folgte ihrem Blick hinunter zu der Touristenfamilie, die etwas verloren um den Jeep herumstand.
»Hérvé wird sich freuen.«
»Wer ist Hérvé?«
»Unser Nachbar, ein alter Schulfreund von mir.« Damit meinte sie den rundlichen Mann mit den Birkenstocks, der immer noch mit Corentin Lehenaff diskutierte.
»Wieso sollte er sich freuen?«
»Er hatte Angst, es würde laut werden und seine Gäste könnten sich beklagen. Man hört hier oben recht viel, es ist ein wenig wie ein Trichter.«
»Vermietet er auch?«
Sie zeigte auf ein wesentlich unscheinbareres Häuschen, dessen Grundstück an die Mauer der Villa anschloss. Im Garten stand ein Campingwagen mit Stühlen und einem kleinen Plastiktisch.
»Jeden Sommer zieht er in den Camper da und vermietet das Haus dauerhaft an ein Ehepaar aus dem Süden.«
»Und wieso geht er in der Zeit nicht nach Paris? Wieso lebt er im Garten?«
Sie zuckte die Schultern. »Er hat gern den Überblick.«
»Vielleicht könnte er mir ein paar Tipps geben.«
Ich erzählte Myrthe von der Cabane Wunderblau. Da Corentin Lehenaff gerade davoneilte, nutzte ich die Gelegenheit, machte einige Schritte und stellte mich Hérvé vor.
»Sie sind vom DEJALU?« Er musterte mich neugierig. »Aber kürzlich waren Sie nicht da.« Ziemlich grob riss er einen Grashalm aus und begann, darauf herumzukauen. »Eine Deutsche hat mich beraten.«
»Sie meinen Sylvie, meine Mitarbeiterin. Was haben Sie denn gekauft?«
»Nichts. Ich lese keine Bücher.«
Nicht sehr sympathisch, der Mann.
»Und was war der Grund für Ihren Besuch? Wenn Sie keine Bücher mögen?«
»Bei mir im Haus muss dies und das gemacht werden, darum sollte ich einen Handwerker treffen, der gerade bei Ihnen zugange war.«
»Meinen Sie vielleicht Isidore Breonnec?«
Hérvé bejahte und riss erneut einen Grashalm aus. »Er hat den Termin nicht eingehalten, und das war gut so, wie sich zeigt. Er hat nämlich auch im Dach von Selimène gewerkelt, übles Flickwerk. Ein richtiger Monsieur Bricolage.«
»Isidore arbeitet für Selimène?«
Er nickte. »Er soll den Dachstock ausbauen.« Das passte ihm ganz offensichtlich nicht. Er fixierte mich wütend. »Wissen Sie, wie man unseren Dorfteil nennt? La Boule bleue de Kersiguénou. Die blaue Kugel. Weil es hier immer schöner ist als im Rest der Bretagne. Aber was nützt der blaue Himmel ohne Aussicht? Eine Schande war dieses Dach von jeher. Eigentlich sollte es bei einer Renovierung tiefer gelegt werden. Es würde mich jedoch nicht wundern, wenn Monsieur Bricolage ein Feuerchen entfacht hätte, um die Bestimmungen zu umgehen.«
Was streute dieser Idiot hier für Gerüchte? »Wenn Selimène seine Auftraggeberin ist, hat sie bestimmt nicht vor, sich über Bestimmungen, die sie selbst kreiert hat, hinwegzusetzen.«
Hérvé spuckte das zerkaute Gras aus. »Ich habe es auf jeden Fall dem Commissaire berichtet.«
Myrthe Abelas war dem Gespräch stumm gefolgt, nun räusperte sie sich. »Das hört sich für mich nach Denunzierung an, Hérvé.«
»Halt die Klappe, Myrthe! Isidores windigen Plänen kommt der Brand gelegen.«
Es reichte mir. Ich schrieb Isidore eine SMS und bat ihn um ein Treffen bei mir zu Hause. »Dringend. Hier ist die Kacke am Dampfen, und zwar im wörtlichen Sinn.«
»Tereza Berger?«, sagte Hérvé. »Ihr Typ ist gefragt.«
Xavier war ein Stück weit den Weg hochgekommen und rief meinen Namen. Ich konnte nicht schnell genug von Hérvé wegkommen. Anstatt den Weg zu nehmen, kletterte ich die Böschung hinunter.
»Wir haben ein Problem«, sagte Xavier, als ich bei ihm ankam.
Der Himmel war dunkel geworden, der Wind hatte schon wieder gedreht, und der Brandgeruch war nur noch schwach wahrnehmbar.
»Es ist der Höhepunkt der Hochsaison, da ist kein Bett mehr frei, unsere Gäste stehen auf der Straße.« Er zeigte auf die beiden Kinder und die Frauen. »Wären Sie bereit, die vier aufzunehmen?«
4
»Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause«, sagte ich. »Bis morgen.«
Als die Tür hinter mir ins Schloss fiel, verharrte ich einen Augenblick. Hatte ich einen Fehler gemacht, Team Elke, wie ich die gestrandete Touristenfamilie heimlich getauft hatte, als Feriengäste zu mir einzuladen?
Nach meiner spontanen Zusage hatte uns Xavier Amèr mit dem Jeep zur Villa Wunderblau gefahren. Eingequetscht zwischen die schweigsame Teenagerin und die dauerquasselnde Fünfjährige hatte ich mich auf der Hinterbank so schmal wie möglich gemacht, während die Frauen, Elke mit dem Millimeterschnitt und Anna mit dem Regenmantel, vorn neben Xavier saßen. Für mein spontanes Einspringen hatten sie sich mit keinem Wort bedankt, und eben hatten sie mich förmlich aus meiner Cabane hinausgedrängt. Ich war nicht mal dazu gekommen, ihnen zu erklären, dass die Toilette leicht verstopfte, das Plastikpicknickgeschirr im Küchenschrank ein Provisorium und die aufblasbare Matratze im kleinen Zimmer nicht zum Springen geeignet war.
Andererseits war der Mietbetrag, den mir Xavier angeboten hatte, so hoch, dass ich fast zwei Monate davon leben konnte. Außerdem war es eine Notsituation. Tereza Manon Elektra Berger würde keine Obdachlosen im Stich lassen.
Ich ging gerade die kleinen Tritte hinunter, als ich bemerkte, dass Isidore bereits im Garten auf mich wartete, wie immer mit Käppi, Halstuch, hellblauem Hemd, Shorts und Flipflops.
»Saludo, ma chère.«
Die beiden Küsschen waren Routine, aber die Umarmung fühlte sich warm an, zum Reinsinken.
»Deine Jeansjacke ist feucht, und du stinkst nach Rauch«, sagte er. »Hast du ein Lagerfeuer gemacht und ein paar Würstchen gegrillt?«
»Erklär ich dir gleich. Ich habe dich mindestens zehn Mal angerufen. Wo warst du denn?«
Im Schein der von Nachtfaltern umschwirrten Halogenlaterne wurde er ein wenig rot. »Ich habe auf eine Freundin gewartet, es hat länger gedauert.«
Eine Freundin? Ich kannte drei seiner Ex-Freundinnen, aber nicht seine aktuelle.
»Also hast du es noch nicht gehört?«
Während wir zusammen zum Hintereingang der Villa Wunderblau schlenderten, klärte ich ihn auf.
»In Kersiguénou hat’s gebrannt? In der Villa Selimène?« Er blieb stehen. »Schlimm?«
»Das Reetdach hat es erwischt. Ein Glück, dass die Feuerwehr so schnell gekommen ist. Stimmt es, dass du da arbeitest?«
»Ich? Na ja …« Er hob eine Hand und verschob sein Käppi, um sich zu kratzen. »Selimène und ich kennen uns seit ewig. Ich helfe ihr manchmal aus, ist wie bei dir, du weißt.«
»Manche meinten eben, du wärst fahrlässig gewesen.«
Das traf ihn sichtlich. »Wer sagt so was?«
Ich hatte das Gefühl, es sei besser, Hérvé nicht beim Namen zu nennen. »Ich habe es im Vorbeigehen aufgeschnappt. Sie nennen dich Monsieur Bricolage und meinen es nicht positiv.«
»Unsinn.« Plötzlich bemerkte ich Hektik-Flecken im Ausschnitt seines Hemdes. »Alles nur Gewäsch! Das Dach hat ein Leck, da stehen Eimer rum. Vor dem nächsten großen Regen wollte ich eine Lösung finden.«
»Warst du heute tagsüber da?«
Er zögerte. »Vielleicht, ich weiß es nicht mehr. Was machst du für ein Theater, Tereza? Glaubst du denen etwa?«
Sein Telefon klingelte. Als er den Namen auf dem Display sah, wandte er sich ab und ging ein paar Schritte in den Flur, bevor er den Anruf annahm.
»Hallo? Oui. Wo warst du? Ich hab auf dich gewartet«, sagte er mit leiser Stimme. Fast die gleichen Worte, die ich ihm gegenüber benutzt hatte.
»Aber nein, ma puce.«
Ein eigenartiger Kosename. Ma puce hieß »mein Floh«.
»Was stehst du da rum, Tereza, und schaust mich an wie Merguez?«, flüsterte er, die Hand auf dem Mikrofon seines Telefons. »Ich brauche etwas Privatsphäre.«
»Dann geh in die Küche.«
Ich wartete, bis er verschwunden war, bevor ich meinerseits Gabriel anrief. Er meldete sich sofort.
»Der Brand ist weitgehend gelöscht, nun schieben wir Wache.«
»Du kommst also nicht zu mir?« Hoffentlich hörte er die Erleichterung nicht heraus. Ich wollte unbedingt vermeiden, dass er auf Isidore traf.
»Ich würde gern, aber gleich kommt ein Brandexperte vorbei, wegen der Ursache. Ich muss dabei sein, verstehst du?«
»Okay. Und habt ihr schon einen Verdacht?«
Das interessierte mich brennend, vor allem seit ich wusste, dass Isidore auf dem Dachboden gearbeitet hatte.
»Möglicherweise haben wir einen defekten Elektroanschluss gefunden. Aber auch deine Theorie der Brandstiftung steht im Raum.«
Was hatte ich getan? Mein Herz stolperte. »Das war doch nur so dahergeschwafelt, musst du nicht ernst nehmen. Wer sollte hier ein Haus anzünden?«
»Das ist in der Tat die Frage. Sobald wir die Ursache im Detail ergründet haben, sind wir einen Schritt weiter.«
Nachdem wir aufgelegt hatten, betrat ich den Anbau, in dem das DEJALU untergebracht war. Es handelte sich um eine ehemalige Garage, die wir über die vergangenen Jahre gänzlich umgebaut hatten. Wie jedes Mal hatte der Raum eine beruhigende Wirkung auf mich. Er war rechteckig, mit zwei großen Schaufenstern und Aussicht auf die Hauptstraße. Die Wände waren mit gut gefüllten Holzregalen bestückt, in der Mitte thronte ein Tisch aus Strandholz, leicht uneben, mit Astlöchern und versteinerten Muscheln, auf dem sich englische Krimis, deutsche Liebesromane, Wanderführer, Fotobände sowie ein bretonisches Sagenbuch stapelten. Es duftete nach Vanille, Kaffee und Büchern. Es war mein persönliches Paradies auf Erden.
Während ich einen Bücherstapel zurechtrückte, vernahm ich aus der Küche Isidores Stimme, und mir wurde klar, dass die Durchreiche, wo tagsüber allerlei Gebäck stand, einen Spaltbreit geöffnet war.
»Mais non, ma puce, das geht nicht.«
Ich war gar nicht für Lauschen, aber das war eine Steilvorlage.
»Ich kann doch nicht … nein, ich …«
Er hörte wieder zu, bevor er erneut sprach. »Also gut, einverstanden. Sushi soll es sein. Ich liebe dich.«
Oh, là, là, dachte ich.
Er legte auf, nur um sofort einen zweiten Anruf zu starten, bei dem seine Stimme sachlicher klang. »Morgen hole ich das Gerüst, kein Problem. Auf Wiedersehen.« Noch ein Anruf. Diesmal sprach er zärtlich, wie mit einem Kind. »Chérie, es tut mir leid, ich muss bei Tereza was flicken …«
Die Stimme sank zu einem Murmeln. Oder war es eine Melodie? Sang er ein Lied? Ein Wiegenlied? Eine französische Version von »Schlaf, Kindlein, schlaf«? Dieselbe Freundin, eine andere Freundin? Auf jeden Fall schien sie mich zu kennen, danach zu urteilen, wie er meinen Namen genannt hatte.
Ein Jaulen aus der Küche nahm mir die Entscheidung, ob ich mich bemerkbar machen sollte, ab. Es war Merguez, der mich an der Tür schwanzwedelnd begrüßte.
»Nur nicht so wild, mein Lieber.«
Sylvie und Aimon waren also hier gewesen und hatten ihn wie verabredet hiergelassen.
»Und, fertig telefoniert?«, fragte ich Isidore. »Magst du einen Kaffee? Du bekommst auch meine Lieblingstasse.«
»Kaffee geht um jede Uhrzeit.« Wie aufs Stichwort schlug die Turmuhr von Camaret Mitternacht. »Morgen will ich früh raus, damit ich bei Selimène den Schaden begutachten kann.«
War er noch ganz bei Trost? »Du kannst da nicht aufkreuzen, das Haus ist von der Feuerwehr und der Polizei gesichert.«
»Sobald die abziehen, gehe ich rein. Ein offenes Dach ist nicht gut für ein Haus.«
»Trotzdem musst du abwarten.« Irgendetwas war mit ihm. Ich musste eine List finden, um ihn zum Sprechen zu bringen. »Leistest du mir Gesellschaft beim Essen?«
Als er nickte, öffnete ich den Kühlschrank. Auch hier machte sich die Ebbe auf meinem Konto bemerkbar. Ich vermied die Supermärkte, kaufte auf dem Markt, mit Sonderrabatt für die Einheimischen, und ab Sonntag aß ich nur noch Reste.
»Du kannst wählen. Schokolade? Oder Frischkäse in Olivenöl, drei Kirschtomaten mit Basilikum, etwas Baguette von gestern und die letzten Merguez.«
Isidore stand sonst auf die getrockneten Würstchen, die meinem Hund den Namen gegeben hatten. Diesmal jedoch lehnte er ab und begnügte sich mit seinem Kaffee, den ich ihm in meiner gelben Lieblingstasse mit dem roten Herz servierte.
Wir setzten uns an den Tisch, und er sah zu, wie ich die Vorräte dezimierte, bis nur noch ein Basilikumblatt im Öl schwamm. Zum Abschluss schenkte ich uns je ein Glas Bier ein, Breizh Bio, eine Eigenmarke von Basile vom Café des Beaux Arts. Basile war einer der wenigen Jungen, die zurückgekommen waren, um sich hier etwas aufzubauen. Darum kaufte ich alle Getränke bei ihm, selbst wenn ich das Geld dafür aus der Trinkgeld-Kaffeekasse zusammenklauben musste.
»Jetzt erzähl mal … seit wann arbeitest du für Selimène?«
Isidore war irritiert, mein munterer Ton hatte ihn nicht täuschen können. »Ist das ein Verhör?«
»Eine Befragung. Sieh es als Training an, wenn dir Gabriel auf die Pelle rückt.«
»Gabriel? Kommt der etwa her?« Der Schreck stand ihm ins Gesicht geschrieben.
»Keine Sorge, er macht Brandwache.« Ich stellte mein Glas weg. »Aber möglicherweise wird er bei dir nachfragen. Also?«
»Seit wann ich für Selimène arbeite? Schon als Schuljunge habe ich mir bei ihr mit Hilfsarbeiten ein Taschengeld verdient. Einer meiner Cousins hat sie gekannt und mich zu ihr geschickt. Ihr Grundstück ist schwer zu bewirtschaften, es geht bis zum Strand hinunter, der Teil der Anse de Dinan ist.«
»Und die Anse de Dinan …?«
»… ist die kleine Bucht, an der auch Kersiguénou liegt. Sie reicht von der Pointe de Pen Hir und den Erbsenfelsen bis zum Château de Dinan.«
Damit meinte er die Felsenburg, auf der ich mich mit Sylvie, Gabriel und Aimon getroffen hatte. Was erst wenige Stunden her war, kam mir vor wie Jahre.
»Also ist Selimène Großgrundbesitzerin?«
»Einerseits hätte sie das Land schon für Abermillionen verkaufen können, andererseits gibt es ein Problem mit dem Grundbuchamt, weil die Grenzen nicht klar eingezeichnet sind. Zum Glück benennt eine Sage das ganze Gebiet, inklusive eines umstrittenen Ziegenstalls, ganz klar als Selimènes Eigentum.«
»Eine Sage? Als Beweis?«
»Natürlich.« Er nickte heftig. »Bretonische Sagen haben immer einen wahren Kern und beziehen sich auf tatsächliche Gebäude, Gegenstände oder Ländereien, das wissen auch die vom Grundbuchamt.«
In den vergangenen Jahren hatte ich verschiedene hiesige Sagen sozusagen hautnah erlebt, von der Geschichte von Morwen, der Meeresgöttin, die Männer in ihre Strömungen hinabzog, bis zu Poulipiquet, einer charmant verschlagenen Zwergin im Wald von Morgat.
»Erzähl sie mir.«
Isidore lehnte sich zurück, beim Geschichtenerzählen war er in seinem Element. »Es geht um Ys, du weißt schon, die prunkvolle Stadt, die nach einem höllischen Sturm im Atlantik versunken sein soll, mitsamt der Königstochter Dahut, die von ihrem Vater verraten wurde. Allerdings existieren verschiedene Angaben über den genauen Ort. Die Suche danach ist wie bei Nessie, dauernd kommen neue Hinweise dazu. Am häufigsten wird die große Bucht von Douarnenez genannt, zu der auch Morgat gehört.«