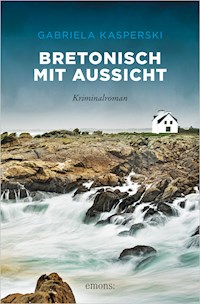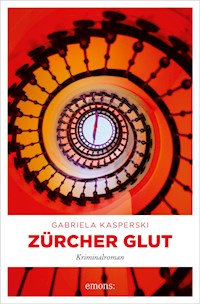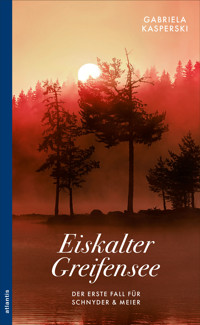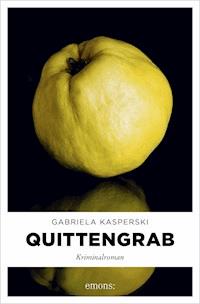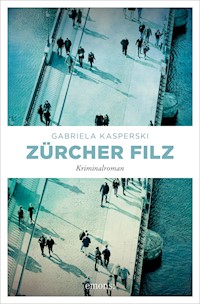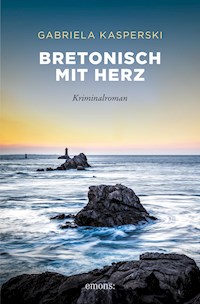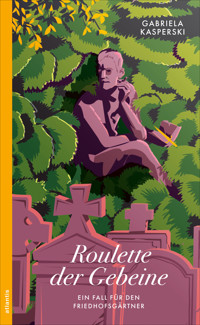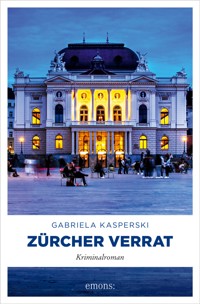
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schnyder & Meier
- Sprache: Deutsch
Ein mitreißender Krimi, der Licht auf ein dunkles Stück Schweizer Geschichte wirft. Absolut fesselnd und eindringlich erzählt. Auf dem Sechseläutenplatz werden zu Mittsommer live Arien von der Opernhausbühne übertragen. Doch das musikalische Schauspiel kommt zu einem jähen Ende, als ein Mann tot im Orchestergraben aufgefunden wird. Werner Meier, der im Publikum sitzt, übernimmt die Ermittlungen. Zeugen wollen die Chorleiterin Lou Müller als Täterin erkannt haben. Lou flüchtet, und eine Verfolgungsjagd beginnt, bei der Meier und seine Partnerin Zita Schnyder eine düstere Geschichte aufdecken, deren Ursprung im Zürich des Zweiten Weltkriegs liegt..
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gabriela Kasperski war als Moderatorin im Radio- und TV-Bereich und als Theaterschauspielerin tätig. Heute lebt sie als Autorin mit ihrer Familie in Zürich und ist Dozentin für Synchronisation, Figurenentwicklung und Kreatives Schreiben. Den Sommer verbringt sie seit vielen Jahren in der Bretagne. 2024 erhielt sie den »Zürcher Krimipreis« für ihren Roman »Zürcher Verstrickungen«.
www.gabrielakasperski.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig. Die Institution Opernhaus ist lediglich Schauplatz, es gibt keine Verbindungen zu aktuellen oder vergangenen Inszenierungen, Berufsleuten oder AmtsträgerInnen.
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: stock.adobe.com/Bogdan Lazar
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-212-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Für Franz, Flo, Beni und Samira.
Der Schmetterling
Der letzte, der allerletzte,
so kräftig, hell, gelb schimmernd,
als würden sich die Tränen der Sonne
auf einem weißen Stein niederlassen.
So ein tiefes, tiefes Gelb
er hebt sich ganz leicht nach oben.
Er verschwand weil, so glaube ich,
weil er der Welt
einen Abschiedskuss geben wollte.
Pavel Friedmann, 4. Juni 1942, Ghetto Theresienstadt
Prolog
Als der Reisebus auf den Parkplatz bog, versteckte er sich hinter einem Würstchenwagen und beobachtete die wenigen Leute, die ausstiegen. Er rieb sich über die Augen. Die Müdigkeit ließ sich nicht vertreiben, auch nicht, als er sich Wasser aus einer Flasche über die Stirn und den Dreitagebart goss.
Die Frau reiste mit leichtem Gepäck, der Rucksack war alles, was sie dabeihatte. In gutem Tempo lief sie los. Er warf einen Blick auf das Pissoir, entschied sich dagegen und folgte ihr in gebührendem Abstand. Die Uferlinie lag vielleicht zwanzig Meter entfernt hinter einer brusthohen Steinmauer, niedrig genug, dass die Gischtspritzer ungehindert bis zu ihnen getragen wurden. Einmal bückte sie sich und strich über den Boden. Er wartete, bis sie weitergegangen war, um nachzuschauen, was ihr Interesse geweckt hatte. Es war eine kleine Messingplatte mit einer Inschrift in walisischer Sprache. Das Wort Flüchtlingscamp stand drauf, dazu der Ortsname, Beaumaris in Wales.
Sie kamen zum Dorfrand. Links tat sich das Meer auf, eine schimmernde eisgraue Fläche, fast wie ein See. Die Häuser wurden weniger, und der Wind wehte so heftig, dass das Gehen schwierig wurde. Entlang einer akkurat geschnittenen Rasenfläche erreichte sie eine Einfahrt, die zu einem Flachdachgebäude mit hohen Fenstern führte. Salz lag in der Luft und Dieselöl. Sein Magen knurrte, der Duft nach gebratenem Speck hatte ihn gestreift, ein englisches Frühstück käme ihm jetzt gelegen.
Als er sich nach ihr umschaute, hatte sie sich in den Schatten eines Baumes zurückgezogen, wo sie weder vom Haus noch von der Straße im Blickfeld war. Das, sagte er sich, ist die Gelegenheit. Er spannte seine Muskeln an.
1
Sonntag
Lou Müller stand am Rand der Terrasse des Opernhauses. Es war später Sonntagnachmittag. Was sich ihr hier darbot, war ein Bild für die Ewigkeit: lichtblauer Himmel, der See und ein Meer von Menschen. Sitzende, stehende, liegende, kleine und große Menschen, alle auf dem Sechseläutenplatz versammelt, um ein Spektakel zu erleben. Opera Air, eine Liveveranstaltung zu Mittsommer. Populäre und weniger bekannte Arien wurden aus dem Innenraum von der Bühne auf eine Leinwand vor der Treppe gestreamt, das Opernensemble war mit dem Berufschor, dem Metrochor und einigen Solistinnen vertreten und wurde unterstützt vom Ballett.
Applaus und Jubel brandeten auf, als die nächste Nummer angekündigt wurde: Der Lokomotivführer aus der Weihnachtsaufführung sang zusammen mit Jim Knopf und der Prinzessin Li Si.
Auffallend entzückt von dem Gesang war ein kleines Mädchen. Es wiegte sich ganz vorne im Takt der Musik. Es war Lily, das jüngste Mitglied des Zauberchors für Kinder, den Lou vor einem knappen Jahr gegründet hatte. Am kommenden Dienstag würde Lily bei der Macbeth-Premiere auf der Bühne stehen. Vieles war möglich, seit Han Ly Spartenleiterin der Oper war; ein Chormädchen mit einer Hörbehinderung war nur ein Beispiel, ein sehr berührendes allerdings. Neben Lily stand ihre Mutter, Zita Schnyder, im Freizeitlook, in Shorts mit T-Shirt. Obwohl sie sehr beschäftigt mit ihrem Beruf und den Kindern war, hatte sie beim Abholen von Lily immer Zeit für einen kleinen Schwatz gefunden. Vielleicht könnte ich sie mal auf einen Kaffee treffen, dachte Lou und winkte ihr zu. Sie war nicht sicher, ob sie es bemerkt hatte.
Lous Blick blieb an einem Mann hängen. Er stand in der Mitte des Platzes, sicher fünfzig Meter von ihr entfernt, und wuchs aus der Masse heraus. Sofort begann ihr Herz zu klopfen, zu laut und zu schnell. Ihr wurde kalt, ihre Beine waren wie gelähmt. Gleich wäre er bei ihr, würde sie packen und mit sich schleifen. Wehrte sie sich, würde seine Faust ihre Wange treffen. Sie hörte das Knacken der Knochen, spürte die Flüssigkeit auf ihrer Haut. Sie blinzelte. Der Mann war weg, sie hatte sich getäuscht. Atem und Herzschlag beruhigten sich. Unangenehm, sagte sie sich, ein Déjà-vu, nicht real. Sie musste husten. Etwas lag in der Luft, die Linden vermutlich. Applaus ertönte, begeisterter Applaus, auch die Jim-Knopf-Nummer war angekommen. Gleich kämen die Carmen-Arie, das Duett aus der Zauberflöte und zum Schluss das Finale des ersten Aktes von Macbeth, als Vorgeschmack auf Dienstag, ein musikalisches Schmankerl, wie der Inspizient Hollunderbäumer zu sagen pflegte.
Lou strich das Haar nach hinten und zupfte ihren Sommermantel zurecht. Er war zu warm, aber er gab ihr ein Gefühl von Sicherheit. Sie drehte sich um, überquerte die Terrasse, ging die Treppe hinunter, dem Haus entlang und um die Ecke bis zum Bühneneingang auf der Rückseite, eine unscheinbare Glastür.
»Guten Abend, Lou«, grüßte sie der Pförtner Benno Stanek. Seine Augen blitzten, sein Bart war gestutzt, er hatte sich in Schale geworfen. Ein ausgewähltes Publikum durfte später, nach dem Schlussapplaus, einen Augenschein hinter der Bühne nehmen, und er wollte, wie er das jeweils nannte, »eine gute Falle machen«.
»Gleich kommt die Vorpremiere von Macbeth, Hollunderbäumer hat die Chöre eingerufen. Die Hexen sind bereit.«
»Ich glaube, ich bin zu nervös zum Zuschauen. Vielleicht setze ich mich in die Kantine. Ich wollte ohnehin was trinken.«
»Spinnst du, Lou? Es ist auch dein Werk! Nie war der Metrochor besser. Sie schlagen sogar den Berufschor, wenn du mich fragst.« Das war ein schönes Kompliment.
Sie bedankte sich und betrat das »Atrium«. Die Kantine war voll besetzt.
»Was machen die?«, murmelte Lou vor sich hin.
Sie meinte zwei junge Frauen mit Handys, die gerade von der Regieassistentin backstage geführt wurden.
»TikTok-Videos«, sagte eine Stimme.
Es war Han Ly. Wie immer in fließendem Schwarz. Neben ihr kam sich Lou vor wie ein Trampeltier.
»Seit wann sind wir auf TikTok?«
»Seit heute. Wir wollen die Jugendlichen ins Boot holen.«
Han eilte davon, während Lou nach hinten in ihre Garderobe ging, die sie mit dem Leiter des Berufschors teilte. Dass sie dieses Anrecht hatte, war neu. Für Lou war es wichtig, der blaue Blechschrank mit ihrem Namen bedeutete ein Stück Identität. Sie trank einige Schlucke direkt vom Wasserhahn, dabei fiel ihr Blick auf den Dirigentenstock. Sie holte ihn aus der Hülle und schwang ihn zu einer liegenden Acht, dann zu einer stehenden. Dies wiederholte sie so lange, bis die Finger rund liefen und sich die Linien in der Luft genau am richtigen Ort befanden. Beim letzten Mal stellte sie sich auf die Zehen und zeigte so nach oben, dass die Stabspitze fast die Decke berührte.
»Zweiter Aufruf fürs Finale.« Hollunderbäumers Stimme tönte durch den Lautsprecher.
Lou steckte den Stab zurück in die Hülle. Sie würde ihn erst am Dienstag brauchen.
»Macbeth, Akt eins. Roncalli auf den Berg. Berufschor bereit. Metrochor bereit, Tänzerinnen bereit. Das kleine Orchester auf links. Toi, toi, toi, Leute.«
Lou trat hinaus und ging den Flur entlang. Als sie um die Ecke bog, war er wieder da, der Mann. Er hob die Hand und schnitt sich pantomimisch die Kehle durch. Dazu lächelte er. Ein Augenzwinkern, und wieder war er weg.
2
Zita Schnyder und ihr Sohn Finn standen im sonntags geöffneten Supermarkt Stadelhofen an der Kasse für den Self-Check-out. Zita hatte ihrer Familie einen besonderen Snack versprochen, Finn begleitete sie beim Einkauf, Theo und Lily waren bei ihrem Partner Werner Meier auf dem Sechseläutenplatz geblieben. Meier war Fan von klassischer Musik, und Lily sang im Zauberchor mit. Den Platz hatte sie bekommen, weil die Chorleiterin Lou Müller Inklusion eingeführt hatte und Zita Lily mit ihrer Hör- und Sprechbehinderung genau im richtigen Moment angemeldet hatte. Das Singen war das absolute Glück für sie. Es berührte Zita jedes Mal, ihre Tochter zu beobachten, wie sie sich in den Tönen wiegte und dazu ihren ganz eigenen Lily-Sound kreierte.
Ein Text von Meier kam herein. »Theo hat Hunger. Wo bleibt ihr?« Dieser Ton. Sollte sie pampig antworten? Ach was.
Es ging drei Schritte vorwärts, an einer Tiefkühltruhe vorbei. Als Zita einige Cornet-Glacés herauspflückte, wurde sie von einer Kinderhand festgehalten. »Die sind von Nestlé. Die Marke boykottieren wir.«
Finns blaue Augen starrten sie durch die Brillengläser an.
Zita überlegte kurz und legte das Eis wieder zurück. »Dann hol Dinkelkekse, wir brauchen was Süßes.«
Als Finn zurück war, wurde endlich eine Zahlstelle frei. Der nächste Text kündigte sich an.
»Wann kommst du? Lily will sich mit mir hinter die Bühne schleichen, ich kann Theo nicht allein lassen.«
Eine blöde Idee, dachte Zita, bei so einem Anlass.
»Geh bitte schon mal vor zu Papa«, sagte Zita. »Er lässt sich von Lily um den Finger wickeln.«
Finn wusste, was sie meinte, und machte sich auf, während Zita die Einkäufe scannte, nur um zu merken, dass sie ihr Portemonnaie samt Karten nicht dabeihatte. Es steckte im Rucksack, den Lily als Sitzunterlage benutzt hatte, wegen des harten Granitbodens.
Zita blieb nichts anderes übrig, als die Transaktion abzubrechen. Dabei wurde sie von einer Verkäuferin aufgehalten. Kontrolle, meinte sie. Stichprobe. Ein Hin und Her entstand, die Leute schauten.
»Darf ich das für Sie auslegen?« Die Stimme kam von einem sportlichen Mann.
»Ich kenne Sie. Genau wie ich warten Sie manchmal bei der Probebühne vom Opernhaus auf Ihre Tochter.«
Er bezahlte mit seiner Karte, und Zita packte alles in eine Tüte. »Wie kann ich es Ihnen zurückgeben?«
Nach einer Probe, fand er, er wisse aber nicht, wann er seine Tochter wieder abhole, das müsse er erst mit der Mutter klären. Zita verstand den Code hinter den Worten: geschiedener Vater mit reduzierten Betreuungsrechten.
»Sie wartet übrigens drüben beim Opera Air. Ich nehme an, Sie gehen auch dahin.«
Zusammen fuhren sie mit der Rolltreppe nach oben und betraten den Stadelhofen, der direkt an den Sechseläutenplatz angrenzte. Das Orchester und vor allem die Stimme der Sängerin erfüllten den Raum zwischen den Häusern und dem Bahnhofsgebäude mit der Carmen-Arie von Bizet »L’amour est un oiseau rebelle«. Sie berührte, verführte, war wild und voller Sehnsucht, mit einem Hauch von Traurigkeit. Zita konnte ein Stück Leinwand sehen, einige Werbebanner und daneben einen Polizeiwagen. Diskret, aber sicher, dachte sie, typisch Zürich. Sie gingen am Brunnen vorbei, im Gespräch stellte sich heraus, dass der Mann Zita auch als Keynote Speakerin kannte.
»Sagen Sie, hätten Sie Zeit für einen Espresso?«
Warum nicht, dachte Zita. Seine Augen glitzerten.
Sie stellten sich bei dem Take-away neben ihrer Lieblingsbuchhandlung erneut in eine Schlange.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte Zita nach der nächsten Runde Komplimente. »Da gibt’s doch einen Hintergedanken.«
Das Glitzern verstärkte sich. »Einen Vortrag in meiner Firma. Zum Thema Gender. Dass ich Sie getroffen habe, kann kein Zufall sein.«
Er habe den Austausch mit Finn mitgehört und ihre Gelassenheit, mit der sie auf dessen Forderungen eingegangen war, bewundert. »Sie leben Ihre Überzeugungen im Alltag, genau das suche ich.«
Das Honorar, das er ihr vorschlug, war verführerisch hoch. Es wären die halben Sommerferien.
»Ich überlege es mir.«
Auf der Leinwand war Carmen zu einem Ende gekommen. Der Applaus rauschte nur so, aus dem Innern des Opernhauses übertrug er sich auf den Platz, wie eine Welle, die alle mitriss.
»Toller Song«, sagte er.
Während sie den Kaffee austranken, plauderten sie über den Chor und über das Macbeth-Projekt, wo die Kinder Fledermäuse spielen würden. Als Zita Lou Müller rühmte, bedauerte er, dass er die Chorleiterin noch nie persönlich getroffen habe, weil eben, seine Ex-Frau habe die Aufgabe an sich gerissen, einen Kontakt habe er auch nicht. Darauf gab sie ihm die Nummer des WhatsApp-Zauberchor-Gruppen-Chats. »Ich glaube, da ist Lou auch dabei.«
Er lächelte zum Abschied.
»Ich muss los. Sie hören von mir.«
Weg war er. Zita blickte zur Leinwand, wo Papageno und Papagena mittlerweile virtuos um die Wette tirilierten und für Lacher sorgten. Was für eine tolle Dramaturgie, dachte Zita. Erst Emotionen pur, nun the comic relief, die Befreiung durch Komik. Als sie sich einen Weg durch die Menge in Richtung Leinwand bahnte, wurde ihr bewusst, dass sie keine Ahnung hatte, wie der Mann mit den glitzernden Augen hieß, und dass sie ihm gerade eine vertrauliche Information weitergegeben hatte.
3
Lou ging zum Requisitenraum, wo sie durch eine kleine Luke direkt auf die Bühne schauen konnte. Der Auftakt des Orchesters war wuchtig, voller Instrumenteneinsatz. Während sich der Vorhang hob, mussten alle auf der stockdunklen Bühne ihre Plätze aufsuchen. Ein Wispern, ein Schieben, ein Scharren. Die Solisten eilten zu den Stühlen in die Mitte, die Oberhexe wartete auf dem Berg, die Berufschorleute und die Tänzerinnen verteilten sich auf der Schräge, noch etwas ungelenk, schließlich zeigten sie es zum ersten Mal.
Macbeth wurde von einem Lichtkegel erfasst, dann kam die Lady dazu. Das war der Einsatz für den Metrochor.
»Gebt alles«, flüsterte Lou und blies eine Haarsträhne aus dem Gesicht.
Von den Seiten quollen die Sängerinnen und Sänger auf die Schräge, die Oberhexe durchschritt die Menge, alle wirbelten durcheinander, nur eines im Sinn: Macbeth den Kopf zu verdrehen. Zu Beginn waren die Stimmen noch etwas wackelig, dann verschmolzen sie zu einem Körper. Am Dienstag, dachte Lou, bei der Premiere, wird’s noch besser, dann sind da noch die Fledermäuschen. Sie lächelte. Es war ein Erfolg. Auch für sie. Han Ly hatte im letzten Gespräch angetönt, dass Lou für den Berufschor vorgesehen war, da der jetzige Leiter in Rente ging. Eine fix bezahlte Stelle, geregelte Arbeitszeiten und ein Lohn. Während vorne auf der Bühne Macbeth seinen Bariton aufdrehte, bemerkte sie Manfred Bolli, den Requisiteur. Er nickte ihr zu.
»Gut, nicht?«, formten seine Lippen. »Diese Stimme, dieses Vibrato, dieses Klangdach.«
Lou musste schon wieder husten. Was war das nur?
»Hast du Wasser?«, flüsterte sie.
Bolli schüttelte den Kopf. »Außer du willst Macbeths Todestrank.«
»Lieber nicht.« Der Hustenreiz ließ sich nicht mehr unterdrücken.
»In der ›Kapelle‹ ist ein Wasserhahn.« Er hatte ihr eine Trinkflasche in die Hand gedrückt. »Ist meine, kannst sie ausleihen.«
Lou eilte über die Seitenbühne in Richtung Kapelle, einem winzigen Raum, in dem neben einem Waschbecken die Tagespläne sowie die Requisiten- und Bühnenbildregister hingen. Wieso er Kapelle hieß, konnte niemand sagen. Kaum hatte sie die Tür geöffnet, wurde sie gepackt und hineingedrängt.
Es war Anselm, in dem Cordanzug, den sie damals mit ihm gekauft hatte. Er umklammerte sie von hinten. »Was hast du mit dem Requisiteur am Hut?«
Wieso war er hier? Stanek hatte strengste Order, ihn nicht einzulassen.
»Ich dachte, du bist Chordirigentin, keine Requisitenschlampe.«
Nicht auf ihn eingehen, keine Kommunikation.
»Du ignorierst mich?«, zischte er ihr ins Ohr. Er zog die Tür hinter sich zu, dann drehte er sie um, seine Hand umfasste ihren Kiefer. Mit seinem ganzen Gewicht presste er sich an sie. »Ich vermisse dich.« Er begann sie mit der anderen Hand zu würgen. Ihr Herz pochte laut, ihre Augen quollen hervor. Der Kehlkopf schmerzte.
»Ich hole Charlotte. Die Behörden stehen hinter mir. Väter haben auch Rechte.«
So viele Monate lang hatte sie ihr Leben vor ihm geheim gehalten. Wie hatte er sie gefunden? Hatte er Samuel manipuliert, ihre Mutter? Die Behörden? Nein, die Antwort war klar, es war Charlotte gewesen, ihre gemeinsame Tochter. Ein Kind zu drängen, Lügen zu erzählen, war nicht in Ordnung, das war die Quittung. Nun würde es wieder losgehen. Ich hätte niemals zulassen dürfen, dass sie ihn trifft, dachte Lou.
Er schüttelte sie mit der einen Hand, mit der anderen riss er sie an ihrem Haar. »Du und ich, wir wissen beide, dass es nicht um Charlotte geht, ich benutze sie. Ich benutze unser Kind, weil du mich dazu zwingst. Du hast das gemacht, was jetzt passiert. Du warst es. Vergiss das nie.«
Als er erneut zudrückte, grub sie ihm mit aller Kraft die Fingernägel in seinen Handrücken. Er schrie auf. Dann ließ er sie los, sodass sie zu Boden taumelte. »Sieh dich vor, Lou! Ich bin nicht mehr allein. Und die anderen kennen nichts. Du legst dich mit Leuten an, die dich ausmerzen wie eine Kakerlake.«
4
»Du kommst gerade rechtzeitig«, flüsterte Werner Meier Zita zu. Dass sie ihm einen Espresso mitbrachte, versöhnte ihn mit ihrer Verspätung. Auch wenn sie vermutlich zwischen dem Supermarkt am Stadelhofen und dem Opernhausplatz – dieser alte Name gefiel ihm einfach immer noch besser – Mails beantwortet oder eine ganze Postdoc-Arbeit geschrieben hatte, nun war sie hier, die Kinder waren hier, und zusammen erlebten sie ein Spektakel.
»Gleich kommt der Höhepunkt«, erklärte Lily. »Da singe ich dann am Dienstag mit, Mama. Und Papa kommt zuschauen.«
Gerührt griff Meier nach dem Taschentuch, das er immer in seiner Lederjacke mit sich führte. Wieder Musik zu machen stand jedes Jahr an Silvester auf seiner persönlichen Liste. Nie hatte er es durchgezogen, zu viele Kinder, zu viel Arbeit, zu viel Leben. Zum Glück trat Lily in seine Fußstapfen.
»Habt ihr Hunger?« Zita verteilte Brötchen, Käse, Äpfel und Dinkelkekse.
Finn und Theo griffen zu.
»Ihr Kunstbanausen!«, sagte Meier. »Da vorne singt sich Macbeth die Seele aus dem Leib, und ihr mampft.«
Aber er meinte es nicht sonderlich ernst, das Brötchen nahm er auch gerne. Zita war mehr von der Pop-Front, Finn mochte Balladen, und Theo war ein richtiger kleiner Rocker. Ihr Mitkommen war vor allem als Unterstützung für Lily zu sehen.
Eine Frau mit zwei Kindern blieb bei ihnen stehen und begrüßte Zita.
»Wer ist das?«, fragte Meier leise, als die Frau begann, mit seinen Söhnen zu sprechen.
»Die Mutter von Ali aus Theos Klasse. Du kennst sie.«
»Ich rede kaum mit anderen Eltern, sie halten mich immer für den Opa.«
An der Lederjacke und seinen Turnschuhen konnte es nicht liegen.
Lily zupfte ihn am Ärmel. »Papa, du hast es versprochen«, signte sie.
Mit Schwung hob er sie auf die Schultern.
»Ihr könnt doch jetzt nicht mehr hinter die Bühne«, stellte Zita in Gebärdensprache fest. »Das ist das Finale.«
Aber Lily hielt ihre Fingerchen in die Luft, um ihre Absicht zu bekräftigen. »Ich darf das, Mama, ich bin im Ensemble.«
Dass Zita so schnell nachgab, verblüffte ihn. War etwas los? Sie hatte sich mehrfach umgeschaut, als ob sie jemanden suchte.
»Entspann dich, Schatz«, sagte er. »Wir probieren es einfach.«
Theo war auch aufgestanden und fragte Meier, ebenfalls gebärdend, wie lange sie noch hierbleiben müssten.
»Es gibt am Abend ein Spiel, Papa.«
»Wir sind rechtzeitig zu Hause«, beruhigte er seinen fußballverrückten Sohn.
Der Mutter von Ali stand die Neugier über die Art der Verständigung ins Gesicht geschrieben.
»Ist unser Familien-Dialekt«, erklärte er. War doch so. Sie sprachen ein Gemisch aus Schweizerdeutsch und Gebärdensprache, dazu kamen viele Wortkreationen, die nur die Schnyder & Meiers verstanden. Dass Lily ihn in die Wange kniff, hieß, er solle sich beeilen.
Als sie gleich darauf dem Pförtner Benno Stanek ihr Anliegen erklärten, nickte er. »Ihr könnt über die Seitenbühne auf die billigen Plätze.«
Die »billigen« Plätze lagen in der vordersten Reihe, die oft dem geöffneten Orchestergraben zum Opfer fiel. Man musste den Kopf in den Nacken legen, um auf die Bühne zu sehen.
»Du kennst den Weg, nicht wahr, Lily? Und seid leise, nicht dass ihr stört.«
Zielstrebig zog Lily Meier über den Flur, eine Treppe hoch bis zu einem Vorraum. »Hallo, Herr Hollunderbäumer.«
Der Inspizient trug Kopfhörer, starrte auf einen kleinen Bildschirm und kommentierte das Bühnengeschehen mit leiser Stimme in ein Mikrofon. Er war eine auffallende Persönlichkeit, mit seinem geblümten Hemd und der dicken Hornbrille.
Nun trat Lily zu einem Tisch, auf dem mehrere Messer sowie Schokoladeneier und Luftschlangen lagen.
»Das sind die Requisiten«, flüsterte sie. »Schau, dahinten sind noch mehr.«
Der halbrunde Raum, der sich an die Seitenbühne anfügte, sah aus, als würden hier gleich Umzugsleute kommen, um alles zu verpacken, so viele Gegenstände standen und lagen herum.
»Und das ist Manfred.«
Manfred Bolli, der Requisiteur, entpuppte sich als magerer Mann mit Glatze und nervösem Augenzwinkern. Auch er schien Lily zu mögen.
»Willst du?« Er hielt ihr eine Süßigkeit hin. »Sie brauchen nicht alle auf der Bühne.«
Lily winkte ab.
»Wir müssen uns beeilen, mein Papa und ich.«
Sie zog ihn in einen Seitengang, die Verbindung zum Zuschauerraum, und durch eine weitere Tür direkt in die erste Reihe.
»Jetzt kommt es, Papa.« Lily zeigte nach vorn. »Das große Finale!«
5
Während seine Faustschläge ihren Bauch trafen, gelang es ihr, sich zur Seite zu drehen. Dabei bemerkte sie die Wasserflasche. Mit neuer Energie trat sie ihm zwischen die Beine.
»Fuck!«
Sie nutzte den Moment, rappelte sich auf, griff dabei nach der Flasche und rannte zur Tür. Da wurde sie von hinten gepackt.
»Du bleibst.«
Sie versuchte, ihn abzuschütteln, aber er war stärker. Es kostete sie unendlich Mühe, sich nicht zu wehren. Kein Widerstand, lenk ihn ab. »Lass mich gehen«, flüsterte sie.
»Ich habe einen Auftrag.«
Ihre Mutter hatte sie immer gewarnt. Hätte ich nur auf sie gehört, dachte sie. Erneut begann er, sie zu würgen.
»Tut mir leid«, krächzte sie. »Dass es mit uns so gelaufen ist.«
Sie spürte, wie die Sicht vor ihren Augen verschwamm.
»Endlich, Lou. Endlich siehst du es ein. Dass du schuld bist. Ich habe es dir so und so oft erklärt. Du musst zuhören.«
Er ließ von ihrem Hals ab, um sie anzuheben, und sprach weiter, wie er das immer tat, in diesem unablässigen Strom von Worten, diesem Monolog, der sich nur um eines drehte – um ihn und um seinen Platz in der Welt. Sie verstärkte ihren Griff um die Flasche, spürte das kühle Metall und wartete auf den geeigneten Moment.
»Schließlich habe ich dir Mieke vorgestellt. Nur wegen mir bist du hier. Alles, was du bist, verdankst du mir. Darum musst du mir gehorchen. Mein Auftraggeber will, dass du aufhörst. Kein Rumfragen mehr, kein Wort zu niemandem. Sonst bist du dran.«
In einer einzigen heftigen Bewegung hieb sie die Flasche auf seinen Schädel. Ein dumpfes Geräusch. Endlich konnte sie wieder atmen. Er war auf dem Boden zusammengesunken, neben ihm breitete sich eine Blutlache aus.
Sie bückte sich und versuchte, seinen Puls zu spüren. Er bewegte sich nicht. War er tot? Oder bewusstlos? Sie packte die Wasserflasche, stand auf und trat in den Flur. Der Theaterarzt, dachte sie, sitzt meist in der ersten Reihe. Ich muss ihn holen.
»Lou?« Vor ihr stand Manfred Bolli, eine Schale mit Süßigkeiten in der Hand, die am Schluss auf der Bühne gebraucht wurden. »Du blutest.«
Sie folgte seinem Blick. Auf ihrem Mantel prangte ein dunkler, feuchter Fleck.
»Er hat mich angegriffen«, flüsterte sie.
»Wer?«
»Anselm. Jemand hat ihm gesagt, dass ich hier bin. Du? Aus Versehen? Hast du ihn reingelassen, Manfred?«
Bollis Blick flackerte. Dann drehte er sich um und ging weg.
Gleich darauf wurde sie erneut gepackt.
»Schlampe!«, zischte Anselms Stimme in ihr Ohr. »Wolltest du abhauen?«
Sie floh in Richtung Foyer. Weiter vorne war die blinde Loge, ganz seitlich, verborgen vor den Blicken und vorm Orchester. Manchmal saß die Regieassistentin dadrin, wenn sie sich die Vorstellung von ganz nah ansehen wollte. Die Tür war abschließbar, außerdem war die Loge von der ersten Reihe aus zu sehen. Da wäre sie bis zum Ende der Vorstellung sicher.
Es gelang ihr, den Knauf zu drehen. Sie öffnete die kleine Tür einen Spaltbreit und schlüpfte hinein. Sie spürte die Töne am ganzen Körper, als sie die Tür hinter sich zuzog. Da zwängte er seinen Fuß dazwischen, auch verletzt war er stärker als sie. Schon trat er ein und drängte sie beiseite, um sich mit dem Rücken zum Geländer zu stellen. Nein, dachte sie, als sie merkte, was er vorhatte. Die Balustrade war niedrig, das Geländer filigran. Sein Blick umfasste ihren. Blut rann ihm den Schädel entlang.
»Du dumme Ziege!«, flüsterte er. »Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt.«
Dann kippte er langsam nach hinten.
6
Chor und Orchester waren auf dem Höhepunkt angekommen, der Schluss dieses grandiosen Finales ging wie eine Sturmflut auf das Publikum nieder, als Lily Meier packte. Davor hatten ihre Hände auf der Brüstung gelegen, wer sie kannte, wusste, dass sie da über Schwingungen und Vibrationen die Töne wahrnahm und sie so verstehen konnte.
»Papa«, signte sie so schnell, dass Meier kaum nachkam. »Da vorne wurde jemand geschubst. Die Hexe hat es auch gesehen.«
Meier blickte zur Oberhexe. Erst nach einem Moment wurde er des kleinen Balkons gewahr, der über dem Orchestergraben schwebte.
»Geh nachschauen, Papa.«
Da Lily über eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe verfügte, gab Meier nach. »In Ordnung. Ich bin gleich wieder hier.«
Er öffnete die schmale Einlasstür. Am Ende des Flurs, da, wo er mit Lily eben abgebogen war, fand er eine weitere Tür, in der Farbe der Tapete gestrichen und nur sichtbar wegen des hölzernen Knaufs und weil sie einige Millimeter aufstand. »Blinde Loge«, stand in Sütterlinschrift am oberen Rand.
Meier betrat den Balkon, als der Applaus losging. Es war, als ob er von einem Bötchen auf einen Dampfer blickte.
Gerade verbeugte sich der Dirigent im Orchestergraben und rief seine Musiker auf, dasselbe zu tun. Einige Seile waren vom Schnürboden, der sich in bestimmt zwanzig Meter Höhe befand, bis ganz nach unten gespannt. Sie waren mit schwarzem Tuch abgehängt. Aus seiner Position konnte Meier dahintersehen. Zwischen den Seilwinden lag völlig verdreht ein Körper.
Er hielt den Atem an, seine Gedanken strudelten. Könnte er hinunterspringen? Aber es war zu hoch. Er musste den Weg außen herum suchen. Im Laufen holte er sein Handy heraus, um erst die Ambulanz und danach die Kollegen vom Bereitschaftsdienst zu informieren. Die Stimme des Inspizienten rief über die Hausanlage zu einem erneuten Vorhang auf. Meier krallte sich die erstbeste Person, es war Manfred Bolli, der Requisiteur.
»Jemand ist gestürzt, unterhalb der blinden Loge, er liegt im Orchestergraben. Gibt es hier einen Theaterarzt?« Er zückte den Ausweis von der Agentur für besondere Affären, wo er arbeitete, seit er den offiziellen Polizeidienst bei der Kapo Zürich verlassen hatte.
Bolli wurde kreidebleich, seine Augen weiteten sich. »Ich dachte, Sie sind der Vater von Lily?«
»Im Moment bin ich Polizist.«
Bolli holte sein Telefon heraus, den Worten entnahm Meier, dass er die Pforte informierte.
»Ich bin auch gleich da, richten Sie das aus.«
Zuerst ging Meier in den Zuschauerflur zurück, der sich mittlerweile mit Publikum füllte, obwohl im Theatersaal weiter applaudiert wurde. Das waren die Eiligen, die zuerst draußen sein wollten. Er hatte immer zu den anderen gehört, denjenigen, die verweilten, um den Genuss bis zum letzten Moment auszukosten. So wie Lily, die immer noch brav an ihrem Platz saß und leicht arhythmisch, aber unentwegt vor sich hin klatschte.
»Komm, Mäuschen«, sagte Meier.
»Und der Mann?«
Sollte er ihr die Wahrheit sagen?
»Das gehörte zum Stück, jemand von der Technik, ein Freund vom Herrn Stanek.« Dass sie ihm glaubte, löste ein schlechtes Gewissen aus. Niemand sollte seine Kinder belügen, aber manchmal musste man sie schützen. Er würde es ihr später in Ruhe erklären.
»Ich habe einen Auftrag gefasst, Lily. Ich bring dich schnell zu Mama.«
***
Zita sah ihn schockiert an. »Er ist in den Orchestergraben gefallen?«
Meier hielt den Zeigefinger an die Lippen, die Kinder sollten auf keinen Fall etwas hören. Er neigte sich zu ihrem Ohr.
»Ich muss zurück und warten, bis die Kollegen von der Kripo da sind. Hoffentlich dringt es nicht nach außen.« Noch war auf dem Platz alles friedlich, euphorisch geradezu, nach dem Schlussapplaus. Die Leinwand zeigte einen Wald, aus den Lautsprechern tönte jazzige Klaviermusik, die verschiedenen Werbebanner links und rechts der Leinwand standen straff, trotz des auffrischenden Windes. Eines wurde gerade abmontiert, während ein Techniker sich an einem Mischpult zu schaffen machte.
»Geh mit den Kids nach Hause, bitte«, sagte Meier.
Kurz drückte er Zita an sich. Ihr Haar, so lockig wie am ersten Tag, mit einzelnen Silberfäden, ihre prallvolle Umhängetasche, auch am Sonntag mit Laptop, die leichten Lederstiefel, die beiden Jungs, Lily bei Finn auf dem Arm. Sein Herz zog sich zusammen, und er ertappte sich bei einem heimlichen Gebet. Gib, dass ich nie in einen Orchestergraben falle, gib, dass ich hundert werde, zweihundert, alt genug, um sie alle sicher zu begleiten.
Nachdem sie losgezogen waren, bahnte sich Meier einen Weg zur Treppe. Dabei holte er sein Handy heraus. Fünf Nachrichten, eine davon von Roland Nussbaum, dem Chef der Abteilung Leib und Leben der Zürcher Kripo. Meiers ehemalige Assistentin Beanie Barras war unter Nussbaums Führung zu einer erfolgreichen Ermittlerin aufgestiegen. In verschiedenen Fällen hatte die Agentur für besondere Affären, die Meier mit seinem Freund Eli Apfelbaum führte, mit der Kripo zusammengearbeitet, wobei er mit Nussbaum auch mal aneinandergeraten war. Nun befand sich Barras in einer Auszeit, über ein Jahr schon war sie mit ihrem Verlobten, Sahel Huwyler, auf Weltreise.
Damals hatte Nussbaum ihm angeboten, ihren Job zu übernehmen. Meier hatte abgelehnt, da Zita zur selben Zeit ein Angebot als Gastdozentin in London akzeptiert hatte: eine pendelnde Mutter und ein Vollzeitpolizist, das war nicht möglich.
»Ich habe gerade deine Meldung bekommen«, sagte Nussbaums Stimme in der Sprachnachricht. »Ein Toter im Orchestergraben, Gewalt nicht ausgeschlossen. Es ist Sonntagabend, und du bist vor Ort, Meier. Außerdem bist du doch unser Kulturpolizist. Kannst du übernehmen, bis ich einen Brandtouroffizier organisiert habe?«
7
Mieke Jansen wartete auf ihre Gesangsschülerin, als die Nachricht von Lou Müller eintraf. Lou war eine langjährige Freundin, vom Alter her aber eher wie eine Tochter. Anselm war Lous Ex-Mann, ein schlimmer Mensch. Offenbar war etwas vorgefallen.
Unruhig ging Mieke nach dem kurzen Telefonat hin und her. Das Haus befand sich in einem Hinterhof, unten waren die Trainingsräume der Ballettschule, im ersten Stock fanden die Chorproben statt, den kleinen Nebenraum mit Piano benutzte Lou für die Proben mit dem Zauberchor und Mieke für ihre Coachings. Sie besuchte das Opernhaus regelmäßig alle paar Wochen.
Als Mieke Lou damals bei einem Spendenanlass kennengelernt hatte, hatte sie ihren Weg als Dirigentin unterstützt. Leider hatte sie nach der Geburt von Charlotte einen Job als Musiklehrerin an einem Gymnasium angenommen und war nie mehr da rausgekommen. Den Metrochor am Opernhaus dirigierte sie in der Freizeit, ohne Gehalt. Weil sie es so gerne tat, weil es viel mehr war als ein Hobby, nahm sie lange Proben, zerstückelte Wochenenden und besetzte Abende in Kauf. Mieke fand, Lou hätte mehr verdient, darum hatte sie sie für die frei werdende Stelle als Leiterin des Berufschors empfohlen. Das Auswahlverfahren war im Gang, Lous Chancen intakt. Noch.
Mieke trat zum Fenster und öffnete es. Die Lindenblüten des Baumes mitten im Hof waren in den letzten Tagen explodiert.
Am Brunnen vor dem Tore …, fiel Mieke die Melodie ein. Auch wenn sie praktisch rund um die Uhr anderen beim Singen half, sie selbst konnte es nicht mehr. Ein Problem mit den Stimmbändern. Das war der Grundstein für ihre Karriere als Pädagogin gewesen. Heute sagte sie mit Fug und Recht, dass die Stimmen der anderen ihr größtes Glück waren. Dass einige Kollegen behaupteten, jeder könne singen, hielt sie für gewagt. Manche hatten Gold in der Kehle, andere nicht. Das Leben war nicht gerecht, so einfach war das.
Die junge Schülerin namens Lia betrat das Zimmer. Ihr Gesicht war schmal, mit Mittelscheitel und geschminkten Augen, die Miene vollkommen ausdruckslos, kein Gefühl, noch nicht mal Missfallen, weil sie an einem Sonntagabend zu einer Stunde verdonnert worden war.
»Dann leg mal los«, sagte Mieke.
Die Töne waren lupenrein, aber kalt wie kleine Splitter. »Atme tief ein, bis hinunter in die Zehen.«
Das konnte Lia nicht, nur ihr Brustkorb flatterte.
Beim nächsten Versuch stützte Mieke Lia seitlich in die Taille. »Atme in meine Hand. Lass es fließen. Sei ganz weich wie ein Marshmallow.«
»Ein Marshmallow? Der Song geht um einen Baum.«
Miekes Handy zeigte eine Nachricht an.
»Weißt du was? Geh nach Hause.«
Lias Augen weiteten sich. Sie wollte verhandeln. Aber wenn bei Mieke Schluss war, war Schluss. Zornestränen liefen Lia über die Wangen. »Ich muss die Aufnahmeprüfung schaffen. Meine Mutter hat Sie dafür bezahlt, Sie Pflaume!«
Die Tür knallte. Lia war hinausgestürmt. Durch das geöffnete Fenster drang der Klang einer sich nähernden Sirene. Im Hof unten fuhr ein Wagen vor, ein Mercedes. Die Mutter stieg aus und nahm ihre aufgeregte Tochter in Empfang. Plötzlich bemerkte Mieke Lou, die hinter dem Container versteckt wartete, bis das Auto an ihr vorbeigefahren war. Sie trug ein Kopftuch und eine Sonnenbrille. Auf Miekes Winken reagierte sie nicht. Mieke packte ihre Sachen in den Rollkoffer, zog die Tür hinter sich ins Schloss und ging die Treppe hinunter, zu Fuß, so hielt sie sich fit. Mieke war achtzig.
Die Hitze des Asphalts drang durch die dünnen Sohlen ihrer Halbschuhe, als sie den Hof überquerte.
»Lou?«, sagte Mieke leise und trat zu ihr in den Durchgang. »Ich habe dich von oben gesehen. Die Vorstellung ist vorbei, nicht wahr?« Erst jetzt bemerkte Mieke, dass Lou vollkommen verschwitzt war. Ihre Nase schien geschwollen, ein Mundwinkel war verkrustet, und auf ihrem blauen Mantel prangte ein dunkler Fleck.
»Mieke, der See ist eiskalt.« Ihre Stimme klirrte. So als ob sie nie mehr einatmen würde.
Es war ein Code, den nur Mieke verstand.
»Sollen wir reingehen?«, fragte sie.
Lou schüttelte den Kopf. »Ich muss weg. Anselm will nicht nur mich vernichten, sondern auch die Kinder.« Sie blickte dauernd um sich, ihre Sprache klang abgehackt.
Mieke war konsterniert. »Und wie hat er dich gefunden?«
Lou war als Chorleiterin zwar eine öffentliche Person, aber sie hielt ihr Profil sehr flach, es bräuchte viel, um sie aufzuspüren. »Seit der Carmen-Premiere im November werde ich bedroht. Anselm hat es erwähnt, als er mich angegriffen hat.« Dann beschrieb sie seinen Sturz und wie sie die Trinkflasche im See entsorgt hatte. »Ich bin sicher, er ist tot. Du musst mir helfen.« Als sie anfügte, wie Anselm sie davor gewürgt und geschlagen hatte, sah Mieke eine Möglichkeit.
»Es war Notwehr. Du musst keine Angst haben.«
Lou deutete auf den Fleck. »Sein Blut ist an meinem Mantel. Wie soll ich das erklären? Du weißt, wie es ist. Die Opfer werden zu Tätern gemacht. Bestimmt suchen sie bereits nach mir.«
Mieke zog ihr Handy heraus und rief Violetta Roncalli an, die alte Sopranistin, die bei jedem ihrer Besuche einige Stunden bei ihr nahm. »Was ist denn los bei euch?«
»So ein Kerl ist in die Seilwinde gestürzt. Das gefährdet die Macbeth-Premiere am Dienstag. Stronzo!«
Mieke kannte die leicht ordinäre Seite Violettas, die im Gegensatz zu den Tönen stand, die sie hervorbrachte.
»Sie machen ein Riesentamtam, niemand darf das Haus verlassen, Han Ly spricht mit ihnen.«
»Mit ›ihnen‹ meinst du die Polizei?«
»Sag ich doch.«
»Ist er schwer verletzt?«
»Was denkst du denn? Tot, selbstverständlich.«
Wie Lou befürchtet hatte.
»Ich bin durch den Warenlift nach draußen geflohen. Jetzt sitze ich in der Brasserie und warte auf meine Schnecken. Du weißt, die brauche ich nach jeder Vorstellung.«
Eine Art Lachen, und Roncalli war weg. Keinen Gedanken verschwendete sie an den Toten in der Seilwinde. Nun, wer als Hexe auf der Bühne gerade mehrere Männer gemeuchelt hatte, konnte sich an einer solchen Kleinigkeit nicht aufhalten.
Lou trat einen Schritt näher und nahm Miekes Hände. »Ich kann nicht ins Gefängnis, auch nicht für einige Tage. Um der Kinder willen. Ich spreche mit Mutter. Es muss einen Zusammenhang geben. Und überrede mich nicht, zu bleiben.«
Mieke wusste, wann sie verloren hatte.
Sie umarmte Lou. Einen Moment standen sie da. Der Duft der Linde hüllte sie ein.
»Kauf dir als Erstes ein Prepaidhandy.«
Lou nickte. »Ich bin vorbereitet, Mieke.« Sie klopfte auf ihre Handtasche. »Da drin ist immer alles, was ich brauche. Mein Pass. Eine Zahnbürste.«
Mieke strich Lou übers Kopftuch. »Wenn du Hilfe brauchst, ruf an. Ich kenne Anwälte.« Sie griff zu ihrem Rollkoffer. Charlotte, Miekes Patenkind, hatte das Adressetikett beschrieben: »Mieke Jansen, auf der ganzen Welt zu Hause«.
Sie schob ihn zu Lou. »Nimm ihn mit. Ich kann mir alles neu kaufen. Und pass auf dich auf.«
8
Der Requisiteur Manfred Bolli stand vor seinem Spind und holte die Fleecejacke heraus, seine Arbeitsuniform, ob Sommer oder Winter. Dazu ein militärgrünes Leibchen und eine abgewetzte Cargohose. Im Spiegel sah er seine Falten und den kahlen Schädel. Schnell blickte er wieder weg, stellte sich auf die Zehen und nahm hinten vom Tablar den Flachmann herunter, der für Notfälle gedacht war. Nur einen Schluck oder zwei. Seine Hände zitterten. Seiferts Brutalität hatte sich tief in seine Netzhaut gegraben. Er hatte Lou Müller gepackt, als wäre sie ein Vogel. Manfred rieb sich über die Augen, um das Bild zu vertreiben.
Bald würden alle befragt, auch er würde an die Reihe kommen, da war er sicher. Manfred mochte die Polizei nicht. Eine Betreibung hatte zu einem Streit geführt, der im Chaos geendet hatte. Nicht seine Schuld. Was er damals nicht bedacht hatte, war, dass es nie mehr aufhören würde, dass ein Ding das nächste anzog. Er kannte den Wechsel im Gesichtsausdruck der Leute, wenn sie herausfanden, was es über ihn herauszufinden gab. Darum war er so froh gewesen über den Job hier. Sein Mentor hatte ihm geholfen. Allerdings hatte er nicht geahnt, dass es da einen Hintergedanken gab. Er war zu gutgläubig gewesen, und das rächte sich jetzt. Die Polizei würde schnell erfahren, dass er als Einziger mit dem Inspizienten hinter der Bühne gewesen war. Fritze Hollunderbäumer mit seinem schicken Halstuch, den Hosenträgern, den geblümten Hemden. Alle liebten ihn, alle taten, was er wollte. Niemand würde ihn verdächtigen, im Gegensatz zu Manfred.
Der Drang nach einem Schluck wurde unerträglich. Nur so konnte er die richtige Entscheidung treffen. Als er den Flachmann ansetzte, betrat jemand den Garderobenraum. Schnell schraubte er ihn zu und steckte ihn ein.
»Manfred?« Anita, die Regieassistentin. »Warum bist du hier? Was hast du da?«
Sie blickte auf den Schnitt am Zeigefinger, der sich entzündet hatte. Der Schorf war gelblich und weich. Feucht.
»Du musst es eincremen.«
»Ich muss gar nichts.«
Er ging hinaus. Herrgott, hatte die ihn durcheinandergebracht. Da fiel ihm etwas ein, und er drehte noch mal um. Sie war gerade am Telefon. Als sie seiner ansichtig wurde, hörte sie auf und wurde knallrot, als ob er sie beim Petzen erwischt hätte. Bestimmt war es so. Seit er aus Versehen bunte Requisitensuppe über ihre frisch polierten Stiefeletten geschüttet hatte, hatte sie ihn auf dem Kieker.
»Was vergessen?«
Stumm ging er durch den Raum und verschloss die blaue Tür des Spinds. Draußen holte er seine Schirmmütze raus, setzte sie auf und zog sie in die Stirn. Von der Treppe her hörte er Stimmen.
»Der Bolli ist oben beim Umziehen«, sagte Benno Stanek. Manfred rutschte das Herz in die Hose. Raus kam er nicht mehr. Es blieb nur die Kapelle. Seit der Lancierung einer internen App wurden die ausgedruckten Wochenpläne, die Manfred gewissenhaft einmal in der Woche an die Wand heftete, von niemandem mehr beachtet. Er hatte den Raum meist für sich, er war sein Refugium. Darum stach ihm der Blutfleck am Boden sofort ins Auge, er war frisch, es gab eine Tropfspur und eine weitere Lache. Er sah Lous Augen vor sich und ihren besudelten Mantel. Was für ein Feigling er doch war, dass er weggeschaut hatte.
Drei Wochen nachdem sie letzten Sommer frisch angefangen hatte, war sie mit einer blauen Wange zur Probe gekommen. Sie sei in eine Gerüststange gelaufen, unten auf der Probebühne. Die anderen hatten es geglaubt, aber Manfred hatte sich nicht davon täuschen lassen. Ihr Ex war ein Prügler. Aber würden die von der Polizei nicht trotzdem zum Schluss kommen, dass sie ihm etwas angetan hatte, nun, da er tot war? Sie würde drankommen, und Manfred war schuld.
»Lass den Seifert hinter die Bühne.« Wie harmlos die Aufgabe geklungen hatte. Er fuhr sich über den Schädel. Er brauchte auf der Stelle einen Drink, anders hielt er das schlechte Gewissen nicht aus. Und dabei hatte er keine Chance gehabt.
»Wenn du nicht gehorchst, geh ich zur Direktion und erzähl denen die Wahrheit über dich.«
Er griff in seine Hosentasche, holte den Lappen raus, mit dem er eben noch die Lampen poliert hatte, und begann, den Boden sauber zu wischen. Ein Riesengeschmier. Zum Glück gab es im Putzkasten ein Wundermittel, das sogar der Spuren an der Wand, die sich in den Gips hineingefressen hatten, Herr wurde. Nachdem er dazu eine halbe Flasche Brennsprit verbraucht hatte, war die Wand wie neu, nur noch wenige Schatten. Schließlich fuhr er einmal mit Desinfektionsmittel über alles drüber, kramte in seiner Werkzeugbox und zog Füßlinge an. Dann tränkte er den Lappen erneut und befestigte ihn am Besenstiel. Vorsichtig öffnete er die Tür. Er hörte Stimmen aus der Garderobe, die hohe, gellende von Anita und eine tiefere. Dann ein Lachen. In einem Affentempo wischte er über den Boden, links, rechts, links. Und wieder zurück. Noch eine Runde. Als sich die Stimmen näherten, schulterte er den Besen, als wär’s ein Requisit. Der Trupp Chorsänger, der an ihm vorbeikam, würdigte ihn keines Blicks, nur einer grüßte ihn.
»Manfred, kommst du auch in die Kantine? Wir müssen alle hierbleiben.«
Manfred nickte. »Später.«
Nachdem sie weg waren, huschte er den Flur entlang und über die Treppe hinunter zur Bühne. Sie war menschenleer. Auch auf der Seitenbühne war niemand. Er versteckte den Besen und die Lappen in der Requisitenkammer, da würden sie niemanden interessieren. Dann zog er die Füßlinge aus und steckte sie in die Ledertasche, die er umhängte. Der große Warenlift war vollgestellt mit den Stühlen von Macbeth. Die Rampe stand immer noch auf der Bühne, bereit für die Hauptprobe. Ob sie stattfinden konnte, stand in den Sternen.
Er quetschte sich zwischen die Stühle und blickte auf die mit Graffiti versprayte Seitenwand. Am liebsten mochte er das Bild des Künstlers.
Unten stieg er aus und ging über einen Gang bis zur Verbindung mit der Tiefgarage. Es war menschenleer, außerdem kannte er den Radius der Überwachungskameras und ließ sie aus. Durch die Tür kam er direkt in die Parkhalle. Er hatte diesen heimlichen Ausgang schon ab und zu benutzt, abends, wenn er für sich sein wollte. Schließlich wählte er auch hier wieder die Treppe statt den Lift. Oben kam man direkt auf den Platz. Als er hinaustrat, schlug es ihn fast wieder zurück. Diese Hitze und die vielen Menschen! Manche saßen am Boden, viele tranken, plauderten, waren guter Dinge. Auf der Seite wurden die Zelte abgebaut, wo sie Stühle verkauft hatten, die Programmhefte und T-Shirts. Es waren alles Mitarbeiter des Hauses, er würde sich hüten, da zu nah vorbeizugehen. Allmählich fühlte er sich etwas besser. Er, Manfred Bolli, hatte etwas Gutes getan. Lou Müller hatte es verdient. Als Einzige hatte sie ihm die Stange gehalten, als er die Kerzen für den Chor vergessen hatte. Sie hatte befunden, dass es auch mit den Handytaschenlampen gehen würde. Sie hatte ihm geholfen, nun half er ihr. Er drängte sich seitlich durch und überquerte die Straße zum See. Da waren so viele Menschen, dass er nicht auffiel. Er entsorgte die Füßlinge in einem Abfalleimer und reihte sich in den Strom der Leute. Bis ihm einfiel, dass er etwas Wichtiges vergessen hatte, einen Auftrag, den er nicht versieben durfte.
9
Nachdem Meier mit dem Pförtner Stanek organisiert hatte, dass niemand das Haus verließ, und sich kurz mit der Opernleiterin Han Ly ausgetauscht hatte, kehrte er zurück in den Orchestergraben. Hätte ich erwähnen sollen, dass ich der Vater einer kleinen Chorsängerin bin, dachte er, die möglicherweise eine Zeugin ist? Nein, das gehörte nicht hierher, außerdem wollte er Lily schützen. Auf absolut gar keinen Fall sollte sie verhört werden. Wer auch immer die Ermittlungen leiten würde, er würde das unter der Hand regeln. Er wandte sich nach links, stieg über die Seilwinden und kam am Unfallort an.
Die Notfallärztin und zwei Sanitäter knieten neben dem Mann am Boden. Er war mittelgroß, in einen zerknautschten und blutbefleckten Cordanzug gekleidet, die ganze Gestalt hatte die Aura einer gewissen Verwahrlosung. Dazu trug das eigenartige Lächeln bei, das auf seinen Zügen eingefroren war. Als ob er den Fall genossen und seinen Kopf so gedreht hätte, dass man sein Gesicht als Erstes sah. Meier stellte sich bei der Ärztin vor, der Austausch war knapp, sie kam sogleich zu ihrer Einschätzung.
»Tod möglicherweise durch Genickbruch. Gefallen, auffallend viel Blut. Es gibt Anzeichen für einen Kampf, die Kopfwunde ist vermutlich ante mortem entstanden. Ein Schlag mit einer Trinkflasche oder etwas Ähnlichem. Ein Verbrechen ist nicht auszuschließen.«
Meier hatte es befürchtet. »Ich bitte Sie, nichts mehr zu berühren, die Kollegen der Spurensicherung werden gleich da sein. Haben Sie einen Ausweis gefunden?«
Die Ärztin zeigte Meier einen Personal- und einen Bibliotheksausweis. »Anselm Seifert, 58 Jahre. Wohnhaft in Schwamendingen.«
Während sie sich mit den Sanitätern verständigte, ging Meier wieder nach oben und rief Nussbaum an, um die Identifizierung durchzugeben.
»Das Personal muss sich registrieren lassen. Die Pforte ist das Nadelöhr.«
Nussbaum kündigte an, dass eine Einheit der Stadtpolizei bereits vor Ort und dabei sei, die Umgebung abzusperren. Ohne es abzusprechen, gingen sie beide davon aus, dass sie die Situation einfrieren mussten, was bei der Menge an Beschäftigten nicht ganz einfach war. Dazu kam das Publikum im Saal, im Prinzip konnte jeder ein Zeuge oder eine Zeugin sein.
»Unsere Pressesprecherin ist auch auf dem Weg, wir brauchen jemanden vom Medienteam des Opernhauses, asap. Auf dem Sechseläutenplatz sind über zehntausend Leute und vermutlich ebenso viele Smartphones, es wird schnell die Runde machen. Wir müssen möglichst bald kommunizieren. Können Sie weiterhin die Koordination übernehmen, Meier?«
Das war keine Frage, natürlich. Im Erdgeschoss angekommen, ging Meier hinter die Bühne. Deutlich weniger Leute als eben bevölkerten den Warteraum auf der Seite, die meisten waren bereits in einer der vielen Garderoben verschwunden, um sich umzuziehen.
Der Inspizient stand an seinem Arbeitsplatz. Wenn er Meier von der Begegnung mit Lily eben erkannte, erwähnte er es nicht. Dafür hatte er eine Information. »Violetta Roncalli, die Oberhexe, lässt ausrichten, dass sie gesehen hat, wie jemand gefallen ist.«
»Das heißt, sie ist Zeugin.« Gut, dachte Meier, damit kann ich Lily getrost aus dem Spiel lassen. »Wo ist sie?«
»Bereits gegangen. Sie ist immer sehr schnell umgezogen, und sie schminkt sich zu Hause ab. – Aber unter uns gesagt: Sie hat eine wilde Phantasie, die Violetta. Mit den ganzen Scheinwerfern sieht man von der Bühne her kaum etwas.«
Meier notierte den Namen trotzdem. Dann teilte er Hollunderbäumer das weitere Vorgehen mit. »Können Sie per Durchsage alle informieren, dass sie bleiben müssen? Wir brauchen Personalien, Kontaktangaben und Erreichbarkeit von jeder einzelnen Person, Personal, Künstler, Besucherinnen. Gibt es hier interne Sicherheitsleute?«
Der erstaunlich gefasste Hollunderbäumer überlegte. »Das müssen Sie die Direktion fragen, meines Wissens braucht es das nicht.«
»Können Sie ein größeres Zimmer herrichten und jeden da vorbeischleusen?«
»Die Kantine.«
»Perfekt. Wie kommt man ins Haus? Per Badge?«
Hollunderbäumer nickte.
Meier fiel ein, wie leicht er ohne reingekommen war.
»Was ist mit Überwachungskameras? Haben Sie welche?«
»Nur im Eingangsbereich. Und ums Haus herum natürlich. Unsere nächsten Nachbarn sind eine Zeitung, mehrere Restaurants und Geschäfte. Man müsste nachschauen und fragen, ob die welche haben.«
Meiers Handy klingelte. Er erfuhr, dass Staatsanwalt Steve Moser sowie die Ermittler Serge Duchamps, Sonja Schmidt und Amadeo Lüthi unterwegs seien. Meier kannte sie alle, sie gehörten Beanie Barras’ Team an. »Wir brauchen die MEZ«, ordnete er an.
Damit war die mobile Einsatzzentrale gemeint. Die ersten Stunden in so einem Fall waren entscheidend, nur die MEZ bot ihnen die nötige Technik. Allerdings war sie teuer. Auch die Polizei war angehalten, zu sparen, wo es ging. »Wir treffen uns in einer halben Stunde.«
Er legte auf und trat noch mal zu Hollunderbäumer. »Wie kommt man in den Orchestergraben?«
»Sie meinen nebst dem Zugang von der Unterbühne? Über den Warenlift. Er ist auf der Rückseite des Hauses, in der Nähe der Kulissenwagen.«
Meier kannte die Situation. Aus Platznot standen manche Kulissen abgedeckt auf Transportwagen im Freien. Dieser gigantische Betrieb mit fast neunzig Millionen Franken Subventionen und über zweihundert Vorstellungen pro Jahr – Meier kannte die Zahlen, er hatte sich beim Warten auf die Rechtsmedizinerin schlaugemacht – lagerte einen Teil seiner Bühnenbilder draußen vor der Tür.
»Besten Dank. Sie waren sehr hilfreich, Herr Hollunderbäumer.«
Dass Meier seinen Namen bereits kannte, freute den Inspizienten, das sah er ihm an. Danke, Lily, sagte er im Geiste. Gleich darauf fiel ihm ein, dass die Premiere nun natürlich gefährdet war.
»Bereite unsere Tochter schon mal schonend vor, dass sie am Dienstag hier nicht singen wird«, schrieb er an Zita.
Dann eilte er nach oben. Draußen waren mehrere graue Dienstfahrzeuge vorgefahren. Eines davon mit Blaulicht. Allmählich realisierten Passanten, dass hier etwas abging. Meier besprach mit dem Stadtpolizeiteam das Vorgehen. »Niemand geht raus, niemand rein. Aber diskret, bitte.«
Wie das möglich wäre bei den vielen Leuten, überließ er den Kollegen.
»Herr Meier, auf ein Wort«, sagte Benno Stanek, der bereits von Hollunderbäumer informiert worden war. »Die Kantine fasst vielleicht zweihundert Leute, die Kantinenchefin weiß Bescheid, zusätzlich können wir auf die Studiobühne ausweichen, die ist zum Glück heute Abend frei. Sie schaffen bereits weitere Stühle heran.«
Meier fand die ganze Truppe bislang sehr professionell. Stanek bat ihn in seine Loge, wo Meier eine Reihe von kleinen Bildschirmen ins Auge fiel. Sie zeigten die Bühne, die Seitenbühne, den Eingang und den Platz. Während im Innern des Hauses die Magie der Vorstellung durch den Vorfall bereits verflogen war, saßen draußen immer noch viele Leute herum. Die Stimmung war ausgesprochen friedlich, obwohl die Stadtpolizei gerade einen Wagen so geparkt hatte, dass niemand ungesehen die Seitenstraße benutzen konnte.
»Können Sie schwenken?«, fragte er Stanek.
Vor den Eingängen des Opernhauses und des Bernhardtheaters waren ebenfalls je zwei Polizisten stationiert. Ein Familienvater erklärte seinen Kindern etwas, weitere Leute waren stehen geblieben. »Noch einmal zurück, bitte.«
Am Bildrahmen erblickte Meier ein Auto, das in die Tiefgarage fuhr. »Gibt es von da unten einen direkten Zugang zum Opernhaus? Blöde Frage, natürlich. Den müssen wir auch sperren.«
Stanek hatte bereits das Telefon in der Hand.
Meier warf einen letzten Blick auf einen der Bildschirme. »Wer ist das?« Er zeigte auf einen Mann, der zwischen Kulissenwagen und dem Lift aus einer Tür trat und eilends davonging.
»Das ist der Notausgang. Nur von innen zu öffnen.«
»Ich meine die Person.«
Stanek zögerte. »Ich weiß nicht, möglicherweise Manfred, der Requisiteur.«
Meier erinnerte sich an den mageren, kleinen Mann.
»Ist er während der ganzen Vorstellung vor Ort?«
»Natürlich.«
»Viel zu tun?«
»Das kommt auf die Produktion an. Bei den lustigen Weibern brauchte er drei Tische voller Zeug, bei Macbeth kaum einen halben.«
»Also hat er manchmal viel Zeit, manchmal wenig.«
»Exakt.«
»Und heute? Während Opera Air?«