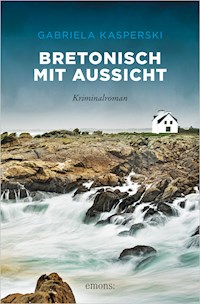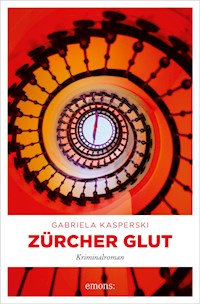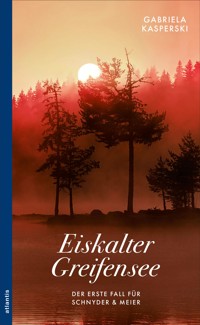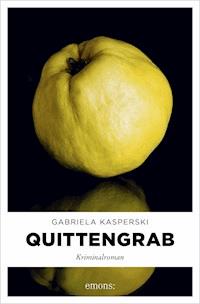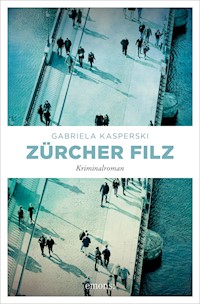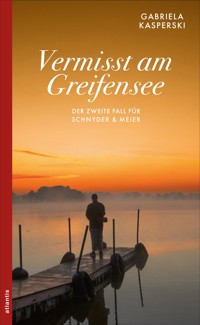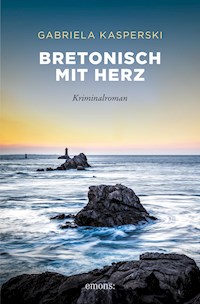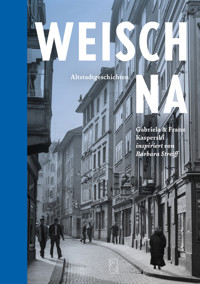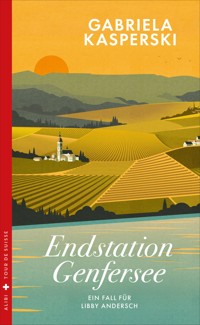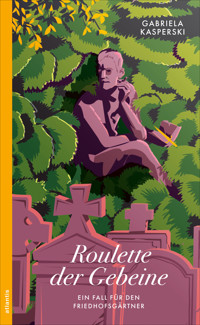
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Atlantis Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Friedhofsgärtner Paul Blom
- Sprache: Deutsch
Paul Blom, Anwalt für Wirtschafts- und Erbrecht und Friedhofsgärtner in Ausbildung, wird von einem jungen Mann aus Dublin aufgesucht: Stephan Dedalus ist getrieben von der Idee, dass die sterblichen Überreste von James Joyce nach Irland gehören. Der weltbekannte Literat wurde auf dem Zürcher Friedhof Fluntern beerdigt, die jahrelange Debatte über eine mögliche Exhumierung durch einen neu aufgetauchten Testament-Zusatz angestachelt: Joyce soll sich eine Beerdigung in Dublin gewünscht haben. Als sein neuer Mandant nicht zum vereinbarten Treffen auf dem Friedhof erscheint, ist Blom alarmiert. Hilfesuchend wendet er sich an Ruby Kosa. Die junge Archäologin und Historikerin heftet sich an die Fersen des Schweizer Performancekünstlers Sam Koonz, der Joyce auf dem Dubliner Glasnevin Cemetery auferstehen lassen will. Der Kampf um die Knochen ist entbrannt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Gabriela Kasperski
Roulette der Gebeine
Ein Fall für den Friedhofsgärtner
Kriminalroman
Atlantis
Für alle unsichtbaren Heldinnen …
… und für Shane Mac Thomáis. Unbekannterweise.
Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen.
Martin Luther, 1524
In the midst of death we are in life.
Leopold Bloom in Ulysses, 1922
Erstes Kapitel
Stephen Dedalus sitzt auf unserem Besuchersofa wie ein Sack Kartoffeln und rührt sich nicht. Bis auf das linke Knie. Das zuckt ununterbrochen. Was soll ich tun?
Es war kurz vor Feierabend, als Paul Blom die Nachricht seiner Kanzleipartnerin Jelena Nicolic las. Normalerweise störte ihn Jelena nicht, wenn er im Enzenbühl seiner Arbeit als Friedhofsgärtner-Lehrling nachging.
Schick ihn weg. Er soll mir eine Mail schreiben. Dann schau ich, ob ich ihn zwischenschieben kann. Morgen ist mein Kanzleitag.
Paul hoffte, dass die Angelegenheit damit erledigt war, aber Jelena antwortete postwendend.
Es gehe um Leben und Tod. Sagt er. Bitte komm umgehend, Paul!
Paul gab seinem Chef Matteo Lazzarone, mit Cornrows und halb so alt wie Paul, ein Zeichen, dass das Feierabendbier warten müsse. Eine Woche lang hatten sie die Kieswege von Giersch befreit, einem zähen Unkraut. Am Grad seines Muskelkaters konnte Paul ermessen, wie viele von den verwurzelten Pflanzen sie aus dem Boden gerissen hatten.
Draußen stellte er sich in den Schutz eines der hohen Bäume neben die Arbeitshütte, die sie alle nur den »Grünen Heinrich« nannten, und holte sein Handy heraus. Während er auf die Verbindung wartete, wurde ihm bewusst, wie kühl es geworden war. Pünktlich zu den Eisheiligen hatte es am Nachmittag zu regnen begonnen.
»Der Name«, sagte Paul, als Jelena ranging. »Stephen Dedalus … Der Mann erlaubt sich einen Scherz.«
»Der Ausweis sah echt aus.«
»Stephen Dedalus ist eine Figur aus den Geschichten von James Joyce. Und James liegt seit vierundachtzig Jahren auf dem Friedhof Fluntern beerdigt.«
»Genau das hat der Typ erwähnt.«
»Frag ihn …«
»Er will nur mit dir sprechen. Persönlich. Oder soll ich die Polizei holen?«
Pauls Blick verweilte auf dem Komposthaufen. »Wie sieht er aus?«
»Wie der Obdachlose, dem ich täglich am Bellevue begegne. Er riecht auch so. Und er hat gesagt, dass er James Joyce heimbringen will. Es gebe Beweise, dass er in Dublin beerdigt sein müsse und nicht hier.«
»Und wieso kommt der damit zu mir?«
»Du bist der einzige Anwalt Zürichs, der Halbire ist, mit Friedhöfen zu tun hat und James Joyce kennt – hallo?«
Paul gab sich geschlagen. James Joyces Gebeine nach Dublin bringen – das Anliegen entbehrte nicht einer gewissen Originalität. Mit dem kleinen Problem, dass Paul von dem irischen Nationalschriftsteller wenig Ahnung hatte. Vor dem Gespräch mit diesem Dedalus brauchte er Informationen, und wer könnte die besser liefern als Ruby Kosa? Seit Paul die junge Londoner Historikerin kennengelernt hatte, schrieben sie sich ab und zu, sie war fleißiger als er, er war ihr seit zwei Monaten eine Antwort schuldig. Ein paar locker dahingetextete Worte fielen ihm nicht ein, darum schilderte er einfach sein Anliegen. Gibt es vielleicht Textstellen, die belegen könnten, dass Joyce in Dublin beerdigt werden wollte? Wenn ja, schick sie mir, bitte.
Als Paul zum Parkplatz hinter der Kapelle abbiegen wollte, stieß er fast mit Frau Havel zusammen, über neunzig Jahre alt. Sie war ein Urgestein des Friedhofs, ging schwerfällig und hatte kaum mehr Haare. Aber ihre Augen blitzten so lebhaft wie immer.
»Herr Blom. Servus. Ich bin auf dem Weg zum Leo. Kommen Sie mit?«
Sie meinte das Grabmal eines Wiener Theaterregisseurs, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in Zürich gelandet war. Von allen Liebhabern, so sagte sie, sei er ihr liebster gewesen. Seit Paul auf seinem Grab die Begonien rausgerissen und eine Wildwiese gesät hatte, stand auch er bei Frau Havel hoch im Kurs.
»Keine Zeit, ich muss was rausfinden«, sagte Paul. »Über James Joyce.«
»Ach, der war auch ein Hallodri«, antwortete sie mit einem verschmitzten Lachen. »Ist im Fluntern begraben, oben am Zürichberg, bei den Reichen und Schönen.«
»Er stammte aus Dublin. Manche finden, er soll zurück in seine Heimat.«
Sie runzelte die Stirn. »Schon mal was von Grabesruhe gehört? Da, wo der Mensch beerdigt ist, da soll er bleiben, in Ewigkeit, amen. Nein, nein, er gehört hierher, der James.«
»Sie sprechen seinen Namen aus, als wäre er Teil Ihrer Familie.«
»Ich war elf, als er starb. Meine Mutter hat ihn gekannt. Oder seine Frau.«
Paul merkte auf. »Wissen Sie mehr?«
»Tut mir leid, mein Gedächtnis. Aber ich werde darüber nachdenken.«
Die Kanzlei war ein modernes Gebäude im Zürcher Seefeld, wo Paul gleichzeitig arbeitete und wohnte, nachdem er sein ehemaliges Haus unter Wert an eine junge Familie verkauft hatte. Nur Paul wusste, dass die Geste nicht so großzügig war, wie sie schien, war er doch unendlich froh gewesen, den Besitz loszuwerden, den er damals mit seiner Ex-Frau gekauft hatte. Es war ein Haus für eine Familie und nicht für einen Single jenseits der fünfzig, mit nicht mehr als ein paar Anzügen, Rollkragenpullis und einer alten Gitarre.
Als er geparkt hatte und die Hintertür öffnen wollte, fiel ein Schatten auf ihn, und ein Mann kam hinter der Birke hervorgeschossen.
»Auf ein Wort, Herr Blom.«
Es war sein Nachbar, ein unangenehmer Mensch, dem Paul normalerweise aus dem Weg ging.
»Tut mir leid, ich habe einen dringenden Termin.«
»Den haben Sie jedes Mal.« Der Mann lehnte eine Kettensäge an den Stamm und stellte sich Paul mit verschränkten Armen in den Weg. »Die Äste müssen weg. Sie haben noch einen Tag Zeit. Sonst …« Er richtete die Säge in Richtung Baum.
»Das ist widerrechtlich«, sagte Paul. »Die Birke steht auf meinem Grundstück.«
»Und sie macht mir Schatten.«
»Aber sie ist wunderschön.« Paul mochte Bäume, und seit er auf dem Friedhof arbeitete, noch mehr. Die Welt war besser mit Bäumen, fand er. Bislang hatte er die Drohungen des Nachbars negiert und gehofft, dass die Wogen sich von selbst glätten würden. Die Kettensäge war eine neue Dimension.
»Ich verstehe nicht, wieso Sie auf einmal ein Problem haben«, schob Paul nach.
»Ich sitze seit dreißig Jahren am selben Ort und blicke auf den See hinaus. Und seit einigen Wochen geht das nicht mehr. Weil die Äste Ihrer Birke zu lang sind.«
War Aussicht ein Menschenrecht? »Sie brauchen sich nur leicht zu drehen, dann sehen Sie den See doch.«
»Der Vorbesitzer hat sie immer zurückgeschnitten.«
»Machen Sie einen Termin beim Friedensrichter, ich werde da sein.«
An dem Nachbarn vorbei betrat Paul das Treppenhaus.
Sein Handy klingelte, es macht ihn ganz nervös. »Ich komme ja.«
Aber es war eine anstrengende Klientin, die er normalerweise Jelena überließ. Bevor Paul sie bremsen konnte, präsentierte sie ihm ihre neuste Idee.
»Ich setze meinen Hund als Erben ein.«
»Sie können eigentlich keinen Hund als Erben einsetzen.« Paul nahm zwei Stufen der eisernen Treppe aufs Mal.
»Aber Sam Koonz hat es auch so gemacht.«
Koonz war ein Performance-Regisseur, ein Liebling des Publikums, egal welcher Couleur. Höhepunkt seines bisherigen Schaffens war eine Operette gewesen, in der ein Hund als Herrscher über Menschen agierte. Das viel beachtete Spektakel hatte nun offenbar die Witwe inspiriert, ihren Hund als Erben einzusetzen.
»Sam Koonz macht Kunst.« Paul öffnete die schwere Eisentür, den eigentlichen Notausgang der Kanzlei, und blieb in dem schmalen Flur stehen. »Den können Sie nicht als Vorbild nehmen.«
»Aber Kunst ist das Leben.«
»Trotzdem ist ein Hund nicht Herr seiner Entscheidungen.«
»Doch, sagt Sam Koonz. Ich will Sie morgen sehen, Herr Blom, und alles abwickeln.«
Paul willigte ein, einfach um sie loszuwerden, und blickte durch die Glasscheiben, wo der Schriftzug Blom & Partner – Erben kann glücklich machen prangte. Die Kanzlei war ein loftartiger Raum mit fünf Arbeitsplätzen. Jelena, in einem dunklen Hosenanzug, das Haar kurz und mit Seitenscheitel, war eben dabei, die beiden jungen Praktikantinnen zu instruieren.
Unbemerkt betrat Paul den ehemaligen Aktenraum, den er als Wohnung benutzte. Riemenparkett, hohe Decke und ein Bett, das die ehemalige Klappliege ersetzt hatte. Er zog die Arbeitskleidung aus und schlüpfte in Anzug und Lederschuhe.
Sein Handy summte. Jelena.
»Deine Ex will dich sprechen …«
Seine ehemalige Schwiegermutter war verstorben und hatte ihn in ihrem Testament bedacht, von dem er aber nichts wissen wollte. Deshalb brauchte seine Ex eine unterschriebene Verzichtserklärung von ihm.
»Kann ich sie durchstellen?«
Pauls Blick blieb an der kleinen Schale hängen, wo ein abgegriffener Plastikbeutel mit der Asche seiner Tochter Milu lag. Einundzwanzig Wochen alt war sie gewesen, als seine Ex-Frau eine Fehlgeburt erlitten hatte. Früher hatte er den Beutel immer in seiner Anzugtasche mitgeführt, nun hatte sie hier eine vorübergehende Bleibe gefunden.
»Paul?«
»Ich rufe sie zurück.« Er wollte die Verbindungstür zu seinem Büro öffnen.
»Sie sagt, dass du das nie machst. Und Paul, wegen diesem Dedalus, ich habe ihn bei dir auf dem Besuchersofa platziert. Er ist eingeschlafen.«
Zweites Kapitel
Als Ruby Kosa die Nachricht von Paul Blom las, befandsie sich auf einer Ausgrabungsstätte in der Nähe des Bahnhofs Paddington.
James Joyce, schrieb sie zurück. Du meinst diesen Schriftsteller-Dude aus Dublin? Was fragst du mich? Bei euch in Zürich gibts eine Joyce-Stiftung. Der Leiter ist ein weltbekannter Experte. Der weiß besser Bescheid als ich.
Trotzdem las sie kurz einige Quellentexte zu James Joyce an und speicherte alles ab, bevor sie das Handy verstaute, eine Wasserflasche leer trank, eine Pille einschmiss, eine Leiter hinunterkletterte und sich im Licht ihrer Stirnlampe zurück in den Stollen begab. Auf einem aufgeklappten Tisch lagen ihre Werkzeuge bereit: Skalpell, Löffel und mehrere Pinsel. Sie griff zu einem kleinen Spaten und begann, den nächsten Abschnitt Erde zu lockern.
Im Rahmen der Erweiterung des Paddington-Bahnhofs war man bei den Aushubarbeiten hinter einer verschütteten Ziegelmauer auf einen bislang unbekannten Tunnelarm eines unterirdischen Postversandsystems der Royal Mail aus dem letzten Jahrhundert gestoßen. Die postalische Welt unter dem Boden war weitläufig, sie bestand nicht nur aus Schienen, Tunneln und Zügen, sondern auch aus Aufenthaltsräumen. Obwohl das System gut erforscht war, hatte niemand etwas von dem Tunnelarm gewusst. Entsprechend groß war die Aufregung unter Historikern und Archäologinnen, während sich Bauherren vor allem ärgerten. Der National Heritage Fund schrieb nämlich in einem solchen Fall vor, dass die Bautätigkeit gestoppt werden musste, bis das ganze Terrain nach historisch wertvollen Artefakten abgesucht worden war. Den Zuschlag für diesen Auftrag hatte Rubys Arbeitgeber, die Firma Public Past History, bekommen. Der Job bei PPH sicherte ihr ein regelmäßiges Einkommen, das Voraussetzung war, um an ein Hypothekendarlehen für junge Leute unter dreißig zu kommen. Und Ruby brauchte eines. Das Fünf-Quadratmeter-Zimmer ohne Fenster und Heizung in der Wohnung über der mütterlichen Wäscherei teilte sie mit einem Kater und einem Berg Bügelwäsche. Ruby musste da weg. Ihre Mam hatte die bucklige Verwandtschaft in Polen überlebt, sie würde auch den Auszug ihrer erwachsenen Tochter überleben. Die Arbeit war jedoch Routine, und Ruby fühlte sich oft gelangweilt. Ihren Licht- oder besser Ohrblick bildete die Musik der Arctic Monkeys, einer Indie-Rock-Band. Der Rhythmus war ideal beim Graben. Er riss Ruby so mit, dass sie fast eine Scherbe übersehen hätte. Sie war etwa einen Zentimeter lang, mit bröckliger Unterseite und einer glasierten Ecke. Ruby wollte sie gerade auf den Stapel der ausgemusterten Dinge legen, als ihr eine feine Kritzelei auf dem rotbraunen Grund auffiel. Sie rieb einige Male leicht darüber, bevor sie mit dem Skalpell die Linie freikratzte. Was sie sah, schien vielversprechend, also schaltete sie die Arctic Monkeys aus und buddelte weiter. Da war noch eine, und noch eine, zehn, zwanzig, ein ganzes Nest, und alle mit ähnlichen Bögen und Linien! Sie erinnerten Ruby an die Illustrationen von Beatrix Potter. Die Kinderbuchautorin hatte zu ihrer Zeit, sprich dem letzten Jahrhundert, im Schatten von wesentlich weniger begabten Männern gestanden, heute galt sie als nationales Heiligtum, ihre Bücher fanden sich in jedem Kinderzimmer. Und vor allem hatte Ruby vor einigen Tagen hier unten in einer alten Mappe ein Papierdokument aus den dreißiger Jahren gefunden, in dem, nebst einigen schwer lesbaren Initialen, der Name Potter erwähnt worden war. Sie hatte nichts damit anfangen können, aber zusammen mit der Zeichnung auf den frisch gefundenen Scherben ergab es plötzlich Sinn. Damit könnte Beatrix Potter gemeint sein.
Ruby fotografierte alles mit dem Handy und markierte die Fundstelle mit Stöcken und einer phosphoreszierenden Schnur, bevor sie drei der Scherben in einen Lappen einschlug und sich auf den Rückweg machte. Als sie über die Leiter durch den Grabungsschacht nach oben gelangte, betrat sie eine andere Welt. Das grelle Licht blendete sie, der staubige Kiesplatz war in der Mittagshitze erstarrt. Nur ihr Handy summte ununterbrochen, neunundvierzig Nachrichten von Mam.
Der Abfluss ist verstopft, Ruby, die ganze Soße ist rausgelaufen, du musst sofort heimkommen! Und bring Bargeld mit, die von der Rohrreinigung wollen es immer bar.
Mam ging nicht ans Telefon, darum schickte Ruby Pamir, dem Mieter aus dem zweiten Stock, eine Nachricht.
Alles wieder gut, Ruby, antwortete er sogleich. Der Laden ist blitzblank geputzt, die Kundschaft hat geholfen. Gerade essen alle Hackbraten. Kommst du auch?
Später, schrieb Ruby. Ich bin vegetarisch orientiert, falls Mam das vergessen haben sollte.
Sie nahm den gelben Schutzhelm ab und schüttelte ihr Haar, das sich anfühlte wie verdorrter Schnittlauch. Dann schlüpfte sie aus dem Oberteil des Overalls, band es um und ging zum Arbeitscontainer, wo die Fahne mit der Aufschrift PPH – Public Past History schlapp vom Mast hing.
Der Container war wie ein Büro eingerichtet, mit Gestellen an den Seiten, voller Holzkisten und Schubladen für die Fundstücke, und einem Arbeitstisch in der Mitte. Marten Jong, ihr Chef, war nicht da. Ruby versah die drei Scherben mit Klebeband und beschriftete sie: Fundort, Datum, Zeit, Gewicht. Danach zog sie die Bilder aus dem Stollen aufs Arbeitslaptop. Schließlich ging sie zum Planschrank in der Ecke und riss Schublade um Schublade heraus, bis sie eine historische Karte fand.
Was für andere Striche, Punkte und Schraffierungen waren, erwachte unter Rubys Augen zum Leben. Sie sah den Bahnhof Paddington vor sich, schon damals einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte Londons, mit den Zügen nach Westen und Wales und dem Endpunkt der Metropolitan Line, der ersten U-Bahn. Er war umgebaut worden, um mehr Platz für Fahrgäste und Züge zu schaffen, mit einem Art-déco-Gebäude, das bis heute erhalten war. In der direkten Umgebung fanden sich Hotels, Pubs, Geschäfte, Parks, Gärten sowie Wohn- und Geschäftshäuser. Für die Besucher und Bewohner aus allen sozialen Schichten gab es Theater, Kinos und Kirchen. Eine davon, die St.-Mary-Kirche, stand in dem kleinen Park Paddington Green und grenzte an die Baustelle. Die gestrichelten Linien des Untergeschosses deuteten auf einen der Kohlenkeller hin, die sich im Zweiten Weltkrieg als ideale Bunker erwiesen hatten. Churchill hatte die Geschicke von Britannien aus einem Bunker unterhalb der Great George Street geleitet. In Friedenszeiten waren sie für alles Mögliche genutzt worden, und genau das könnte mit den Scherben zu tun haben. Vor ihrem geistigen Auge sah Ruby, wie Beatrix Potter Tassen verzierte und eine Runde Frauen einlud, den Potter-Circle. Sie schoss hoch, ging hin und her, tippte dabei auf ihrem Handy herum, um eine Liste von Beatrix Potters Zeitgenossinnen zu erstellen, die mit ihr Tee getrunken haben könnten. Dafür griff sie auf die schwer leserlichen Initialen auf dem gefundenen Dokument zurück, die nun ebenfalls Sinn machten. An einer Initiale blieb sie besonders lange hängen. N.B. Das könnte für Nora Barnacle stehen, die Frau von James Joyce, nach dem sich Paul eben erkundigt hatte. What the fuck! Sie bat den ChatGPT um seine Meinung. Ist es möglich, dass sich Beatrix Potter und Nora Barnacle 1931 in London trafen?
Die Antwort war typisch künstliche Intelligenz. Es ist unwahrscheinlich, dass sich Nora und Beatrix persönlich kannten oder begegneten, aber ihre Wege könnten sich zufällig an einem der vielen öffentlichen Orte Londons gekreuzt haben.
Keine Phantasie, dieser ChatGPT, dachte Ruby. Es gab keine Zufälle, das hatte sie der Umgang mit Geschichte gelernt, alles war mit allem verknüpft, alte Geheimnisse wurden ans Tageslicht gespült, wenn die Zeit reif dafür war. Schon begann sie in ihr Tablet zu tippen.
»Hey, Ruby.« Marten stand im Türrahmen. Er trug wie immer ein kariertes Hemd sowie Stricksocken und rieb sich die Hände, weil er auch bei Hitze fror. »Machst du uns einen Kaffee?«
»Bin ich deine Sekretärin?«
Er grinste schief, legte eine Tüte Gebäck aus dem Supermarkt auf den Tisch und schnappte sich zwei Zimtbrötchen.
»Ich muss dir was zeigen.« Sie deutete auf ihr Laptop.
Marten schob sich eine Lesebrille auf die Nase, während eine Scherbe ganz groß sichtbar wurde.
»Ein Tier?« Marten tippte auf die Zeichnung, eine bröselige Spur hinterlassend.
»Ein Hase. Mit ganz besonderen Ohren. Die kennst du doch, oder?«
Dann – endlich! – kapierte er. Er blickte Ruby an, wieder zurück auf den Bildschirm, dann wieder zu Ruby.
»Wirklich?« Er hatte die Frage nur geflüstert.
Sie holte die Porzellanstücke und legte sie auf den Tisch, zwischen die Zimtrollen und den Plan.
»Viele an einem Haufen, als ob ein Tisch umgekippt wäre. Über dem Ohr von Peter Rabbit siehst du ein winziges Datum. Februar 1931.«
»Und der Name Beatrix Potter. Hat die getöpfert?«, sagte Marten.
»1886 in London geboren, englische Oberschicht, bis über dreißig bei den Eltern wohnhaft«, ratterte Ruby ihr eben erworbenes Wissen herunter. »Hat sich mit Grußkarten selbstständig gemacht, viele Bücher geschrieben, ist aufs Land gezogen, nach Sawrey im Lake District. Vom Gewinn hat sie ihre wissenschaftlichen Studien finanziert, gestorben ist sie 1943.«
»Wie kommen diese Scherben nach London?«
»Ihr Verleger hatte seinen Sitz in Covent Garden. 1931 veröffentlichte sie ihr bekanntestes Buch.«
»Es wäre eine absolute Sensation. Ein geheimer Potter-Keller.« Er umarmte Ruby, was sie als leicht übergriffig empfand.
Sie schob ihn weg. »Sag mal, kennst du Nora Barnacle?«
»Nö.«
»Die Frau von James Joyce.«
»Ach so, die? Natürlich. Seine Muse.«
Innerlich schüttelte Ruby den Kopf, aber sie hatte keine Lust mehr auf eine weitere Debatte. »Hast du sein Zeug gelesen?«
»Nur den Ulysses.«
»Du lügst.«
Er grinste schon wieder. »Es steht in meinem Bücherregal. Und ich war bei einer Lesung.«
»Wo?«
»Es gibt in London einen Joyce-Club. Die sind ziemlich rührig, mit der Leiterin hatte ich mal was am Laufen, nichts Ernstes. Was hat das mit der Potter zu tun?«
Keine Phantasie, dachte Ruby, wie der ChatGPT.
»Beide Frauen waren mit Büchern unterwegs, beide mit Verlagen, beide waren in den dreißiger Jahren in London.«
»… und dabei haben sie zusammen Tee getrunken?«, fragte er ungläubig.
»Spar dir deine Ironie.« Ruby langte über den Tisch und zog eine Kopie des Dokumentes aus einem Stapel heraus. »Diese Notiz habe ich gestern entdeckt. Es ist eine Art Anwesenheitsliste, ein Protokoll, vom 5. August 1931. Der Titel lautet ›Potter-Circle‹. Ansonsten stehen nur Initialen drauf. ›B. P.‹ könnte für Beatrix Potter stehen. Und das, sieh mal …«
Sie deutete auf die Buchstaben, um die sich ihre Gedanken drehten. »›N. B.‹, wie Nora Barnacle.«
Marten schnaubte. »Oder Noemi Brown oder Nele Abendland …«
Sie achtete nicht auf seinen Einwand. »Stell dir vor, Potter and Barnacle, die beiden treffen sich mit anderen unsichtbaren Heldinnen in einem geheimen Raum, aber das ganze Material wird durch eine Explosion im Zweiten Weltkrieg zerstört und nie mehr gefunden, bis …«
Er unterbrach sie. »… bis Ruby Kosa, die Heldinnen-Entdeckerin, zuschlägt. Entschuldige, aber das klingt zu abenteuerlich. Das kriegst nicht mal du glaubwürdig hin.«
Sie warf ihm eine seiner Zimtschnitten an den Kopf. »Wetten?«
Drittes Kapitel
Während Stephen Dedalus auf dem Sofa in seinemBüro schlief, telefonierte Paul mit einer Wissenschaftlerin der Zürcher Joyce-Stiftung. Man machte ihm freundlich und unmissverständlich klar, dass eine Rückführung der Gebeine von James Joyce komplett außer Frage stünde.
»Reines Wunschdenken. Es fehlt jegliche juristische Grundlage«, meinte die Frau. »Die Sachlage wurde bereits einmal ausführlich geprüft, ich kann Ihnen die Ergebnisse schicken.«
Als Paul nach dem Telefonat nach Präzedenzfällen suchte, landete er beim irischen Dichter Yeats, dessen Heimführung der Gebeine juristisch erstritten worden war. Die Aktion endete in einem Desaster, weil die sterblichen Überreste verwechselt worden waren.
Paul ging zurück in sein Büro. Sein Blick verweilte auf dem schlafenden Stephen Dedalus, auf den vollen Lippen, den schmalen Zügen, der hinters Ohr geklemmten Zigarette, dem buschigen Haar, dem Wintermantel und der verrutschten Sonnenbrille, dem Stock, der an der Wand lehnte, dem Rucksack mit einem Handgepäck-Badge. Er war vom Flughafen gekommen. Gerade als Paul das Wort Dublin vom Schild abgelesen hatte, summte sein Handy mit einer Nachricht von Ruby.
Ich habe was entdeckt, schrieb sie.
Wieder eine Grabstätte für Milu?, schrieb Paul zurück.
Ruby schickte Paul ab und zu Vorschläge, wo er ihrer Meinung nach die Asche seiner verstorbenen Tochter begraben könne.
Jepp, eine Grabstätte, aber für die Züge der alten Royal Mail. In deren Umgebung gibts jede Menge superaufregender Tonscherben. Sie könnten von einer klassischen Schattenfrau stammen.
Was ist eine Schattenfrau?
Eine von denen, die man unter den Tisch gekehrt hat. Die weniger Lohn bekam für dieselbe Leistung, dafür kein Lob und keine Erwähnung nirgends. Ihr Name war Beatrix Potter. Möglicherweise hatte sie einige Zeitgenossinnen um sich geschart, und eine davon könnte Nora Barnacle gewesen sein.
Der Name sagte Paul nichts, und das schrieb er ihr auch.
Die Frau von James Joyce. Das ist der Dude, von dem du Literaturzitate haben wolltest.
Du meinst Nora Joyce? Die liegt bei ihm im Zürcher Grab. Und von ihr hast du Scherben gefunden?
Nein.Von Beatrix Potter, hab ich doch geschrieben.Ihre Kinderbücher werden bis heute gelesen, im Gegensatz zum Werk von Joyce.
Was genau hat deine Scherbe mit der Frau von Joyce zu tun?
Ach, egal.
Dedalus war aufgewacht, und Paul steckte das Gerät weg.
»Paul Blom«, stellte er sich vor. »Sie wollten mich sprechen?«
Dedalus rieb sich die Augen, ganz offensichtlich musste er sich zuerst zurechtfinden.
»Tá brón orm«, sagte er. »Sorry für den Überfall. Ich habe einen irischen Anwalt in Zürich gesucht, Google hat mich an Sie verwiesen. Ihre Sekretärin hat mich eingelassen.«
»Nicht meine Sekretärin, meine Kanzleipartnerin.«
Er warf einen Blick durch die Scheibe und bemerkte, dass die beiden Praktikantinnen, von denen die eine Michelle hieß und ihm im Mandat um das Totengold weitergeholfen hatte, zu ihm ins Büro starrten und sich gegenseitig anstießen.
»Und Sie heißen Stephen Dedalus?«, fragte er, während er die Lamellen runterließ.
»Ich kann es nicht ändern. Meine Mutter war Joyce-Fan.«
Er meinte das offensichtlich ironisch, und Paul beschloss, nicht weiter nachzubohren.
»Und was wollen Sie hier in Zürich?«
Dedalus stand auf. »Jims Knochen nach Dublin zurückbringen.«
Er nannte ihn Jim wie einen Bruder oder einen Freund.
»Sie können ihn nicht einfach so ausgraben, das ist Ihnen schon klar.«
»Über achtzig Jahre Zürich sind genug.«
»Er liegt seit 1941 in dem Grab. Wieso das Ganze? Interessiert sich überhaupt jemand dafür? Außer Ihnen?«
Dedalus begann hin und her zu gehen. »Er ist ein Volksheld bei uns. Seine Charaktere, das sind wir, ihre Leiden sind unsere, ihre Schwächen sind unsere.« Er klopfte sich auf die Brust. »In Dublin begegnet man Jims Namen auf Plakaten, in Schaufenstern, in Pubs. Auf Wegweisern, auf Fotos. In jeder Stadtführung ist er Thema.« Er holte die Zigarette hinter dem Ohr hervor, dazu ein Feuerzeug aus der Hosentasche. »Er war verwirrend, verblüffend. Witzig, wortreich. Wild. Er war unglaublich. Und er gehört nach Dublin und nicht in diese …«, er zeigte zum bodentiefen Fenster hinaus, »… Stadt. Wo ihn kaum einer kennt. Ich habe gestern am Bahnhof ein paar Leute gefragt, die hatten keine Ahnung. James was?«
Paul war Dedalus’ Blick gefolgt, zu den parallel geparkten Autos, dem sauber gewischten Vorplatz, der zurechtgestutzten Hecke, die er längst durch eine seiner geliebten Wildblumenwiesen ersetzen wollte.
»Wieso ist die Überführung nicht direkt im Anschluss an seinen Tod passiert?«, fragte er.
Dedalus ließ das Feuerzeug schnappen, die Flamme brannte und spiegelte sich in seinen Augen. »Es war Krieg, und die Dubliner Behörden hielten Joyce für einen Nestbeschmutzer. Seine Romane waren teilweise sehr explizit, manche fanden sie gar pornografisch. Darum hat ihn damals keiner verlegt, weder die beleidigten Iren noch die prüden Amerikaner. Es brauchte Frauen, um die Bücher zum Leben zu erwecken.« Er ging zur Glastür und winkte den Praktikantinnen zu. Das Gekicher durchdrang die Scheibe, es waren Laute, die in der Kanzlei noch nie zu hören gewesen waren. »Und nun braucht es mich.« Er drehte sich wieder zu Paul. »Bevor ich hergekommen bin, habe ich bei den Zürcher Stadtbehörden einen Antrag zur Exhumierung gestellt. Ich werde damit durchkommen, ich kriege alles durch. Und dann bringen wir den Sarg nach Dublin, so wie Lady Diana nach London.«
Ein interessanter Vergleich, fand Paul. »Ich habe mal bei einer Exhumierung mitgearbeitet. Da wird nicht mehr viel von den Knochen übrig sein, und ansonsten nur Erde.«
»Aber es ist heilige Erde.« Dedalus sah aus, als ob er gleich den Spaten aus dem Rucksack ziehen würde. »Ich werde ihn im Glasnevin neben seinem Vater beerdigen. Der Glasnevin ist sozusagen unser irischer Heimatfriedhof, mit vielen Prominenten der irischen Geschichte. Da passt Jim hin, da soll er seine ewige Ruhe finden.«
Genau wie mein Vater, dachte Paul, fragte aber laut: »Wäre eine schöne Ehrentafel nicht auch in Ordnung? Auf dem Glasnevein, meine ich.«
Stephen raufte sich das buschige Haar. »Billiger Ersatz.«
»Das verstehe ich.« Paul stand ebenfalls auf. Gegen seinen Willen faszinierte ihn die Sache. »Haben Sie denn eine Grundlage?«
»Es gibt eindeutige Zitate!« Dedalus stellte sich hin, als ob er einen Vortrag halten würde. »Wenn ich sterbe, wird Dublin in meinem Herzen sein.«
»Aber er hat auch anderes geschrieben.« Paul holte sein Handy raus, um Rubys Text zu lesen. »Eine Historikerin meint sogar … Moment … dass der Dude Dublin gehasst hat.« Er räusperte sich. »So oder so, literarische Hinweise reichen nicht aus.«
»Weiß ich. Darum habe ich die Dubliner Denkmalschutzbehörde vor den Karren gespannt …« Dedalus nestelte an seinem Rucksack und holte ein Schreiben aus einer Mappe. »… und den Heimatschutz.« Immer mehr Schreiben förderte er zutage. »Sie alle unterstützen unser Vorhaben.« Er hielt Paul die Papiere hin.
»Unser Vorhaben?«
»Ich handle im Auftrag.«
»Von wem?«
»Die Person will aus Sicherheitsgründen anonym bleiben. Sehen Sie nur, alles seriöse Institutionen.«
Paul durchblättere den Stapel im Schnelllauf. »Das sind Empfehlungen und Wunschbekundungen. Aber keine Verfügung oder etwas Ähnliches.« Er gab die Papiere zurück.
»Sie übernehmen das Mandat nicht?«
Stille. Der Raum vibrierte von Dedalus’ Energie. Bis Paul den Kopf schüttelte.
»Es braucht einen schriftlichen Beweis, dass Joyce in Dublin beerdigt werden wollte. Eine letztwillige Verfügung oder ein allerletztes Vermächtnis. Ohne kann ich nichts tun.«
Dedalus schnallte den Rucksack an und ging zur Tür. »Eine Sache noch.« Er sprach, ohne Paul anzusehen. »Außer uns gibt es noch jemanden, der Jim zurückbringen will. Ein Event-Theatermann, der ein Spektakel auf dem Friedhof Glasnevin plant und dafür Joyces Gebeine mit großem Brimborium beerdigen will. Der Mann heißt Sam Koonz.«
»Sam Koonz?«
Über den hatte Paul eben mit der Hundefrau gesprochen. Koonz war jemand, der Themen aufgriff, die in der Luft lagen, wie erbende Hunde oder angeeignete Gebeine. Es könnte passen. Dedalus drehte sich um. »In wenigen Tagen wird groß herauskommen, dass Sam Koonz einen Zusatz zum Testament gefunden hat, der beweist, dass Jim zurückwollte.«
Das konnte Paul fast nicht glauben. »Juristisch haltbar?«
Dedalus zuckte die Schultern. »Ich habe ihn eben in einer Bar getroffen. Er ist ein aufgeblasener Wichtigtuer.« Das klang etwas verzweifelt.
»Ist er Ihr anonymer Auftraggeber?«
»Nichts an dem Mann ist anonym. Er ist laut und proletenhaft.«
»Aber er hat dieselbe Absicht wie Sie. Es müsste Ihnen doch gefallen.«
»Sind Sie bescheuert? Der Typ hat keinen Bezug zu Dublin, auch nicht zu Irland. Er will nur provozieren.«
»Ich kenne die Spektakel von Sam Koonz. Wobei ich ihm nicht unterstellen würde, dass er im Kern nicht eine hehre Absicht hegt.«
»Und ich sage Ihnen: Er hat mit Jim Joyce nichts am Hut. Ich habe ein Bier bestellt und aus Joyce zitiert. Drugs age you after mental excitement …«
Paul war es, als hörte er seinen Dad.
»… lethargy then«, sagte er. »Ulysses, Kapitel 5, Zeile 474.«
Dedalus’ Augen wurden ganz groß. »Wusste ich es doch, Sie sind mein Mann, im Gegensatz zu Koonz, der keine Ahnung hat. Passen Sie auf«, er verfiel in ein Flüstern und kam zu Paul zurück. »Koonz hat mir ganz im Vertrauen erzählt, dass er in Zürich jemanden aufgespürt hat, der damals bei der Beerdigung dabei war. Die Person muss sehr alt sein, und über die kriegt er diesen Beweis.« Dedalus packte Paul am Revers. »Nun muss ich einfach vor ihm bei ihr sein.«
»Haben Sie einen Namen? Eine Adresse?«
Dedalus schüttelte den Kopf. »Morgen. Aber ich will da nicht allein hin.« Er blickte Paul an. »Begleiten Sie mich? Wir treffen uns beim Grab von Joyce, nachmittags um vier.«
Viertes Kapitel
»Hey, Leute, herzlich willkommen zu Diesseits vomJenseits – dem Podcast mit Friedhofsvibes.« Ruby hörte sich den neu produzierten Jingle mit der Musik der Arctic Monkeys noch mal an, dann machte sie sich an die Aufnahme. Wie immer schaffte sie es erst kurz vor der Deadline. Früher hatte Ruby nach Lust und Laune veröffentlicht, aber seit die BBC einer wöchentlichen Sendung zugestimmt hatte, war sie zum Opfer ihres eigenen – schlecht bezahlten – Erfolgs geworden. Die Aufnahmen stressten sie mehr und mehr. Umso glücklicher war sie, dass ihr über ihren Tunnelfund ein Thema vor die Füße gefallen war.
»Die heutige Folge heißt ›Die unsichtbaren Heldinnen‹, und sie ist ein Vodcast. Das heißt, ihr könnt sie auch als Videobeitrag ansehen, weil ich eine richtig spannende Location gefunden habe.«
Ruby hatte in ihr Handy gesprochen, das sie an einem kleinen mobilen Kamerastativ befestigt hatte. Nun ging sie los und schwenkte es seitlich, damit das Publikum möglichst viel von der Welt rundherum mitbekam. Rubys Ziel war der Keller der St.-Mary-Kirche, dort hatte sie sich mit der Sigristin verabredet.
»Es ist Mittwoch, der 5. August 1931. Wir sind unterwegs mit der Autorin Beatrix Potter. Sie hat Peter Rabbit gemalt, Peter Hase, diesen niedlichen Hasen mit den langen Ohren und dem Potter-Schwung. Außerdem war sie Botanikerin, Mythologin und Schaffarmerin, Pilze waren ihr Spezialgebiet. Pilze, ich meine, da muss man auch erst mal drauf kommen. Eine richtig starke Frau.«
Ruby machte eine kühne 360-Grad-Bewegung und dann ging sie los, schnell und bestimmt, die Kamera gleichbleibend im schrägen Winkel haltend.
»Stellt euch nun mal vor, dass Beatrix Potter gerade das Haus ihres Verlegers in Bloomsbury verlassen hat. Der will zwar ihr neues Buch veröffentlichen, aber der Prozentsatz ist oberlausig und viel schlechter als bei männlichen Schriftstellern. Obwohl niemand in der Branche über Geld spricht, ist es ein offenes Geheimnis. Beatrix merkt, wie sie wütend wird. Darum macht sie sich auf die Suche nach einem neuen Verleger.«
Ruby zoomte auf das Schild neben einem Eingang, wo groß Publishing House draufstand.
»Am Russel Square, einem bekannten Verlegernest, klappert sie einen nach dem anderen ab, aber keiner ist bereit, ihr mehr Geld zu geben. Auch nicht der Herausgeber von James Joyce, auf den sie alle Hoffnung gesetzt hat. Der ist noch nicht mal da. Im Eingangsbereich begegnet sie dafür Nora Barnacle, der Partnerin von James Joyce. Sie kennt sie von Fotos und von Zeitungsartikeln. ›Hey, Nora, it’s me‹, sagt Beatrix. ›Sorry, dass ich Sie einfach so anspreche. Aber ich glaube, wir haben einiges gemeinsam.‹ Nora hat am Vortag James geheiratet, mit dem sie seit dreißig Jahren zusammen ist. Nach der Zeremonie ist er ins nächste Pub gezogen, zusammen mit seinem Verleger und dem Freund vom Verleger und der Freundin vom Verleger und der Frau vom Verleger. Nora war dafür in der Stadt unterwegs, sie mag London und würde gerne für immer hierbleiben. Für Jim ist London zu nah an Dublin, sagt er. Aber wenn er sie so liebt, wie er immer sagt, könnte er ja auch einmal was für sie tun, findet sie. Geheiratet hat er sie nämlich nur wegen der Kinder und wegen dem Erbe und wegen seiner Augenkrankheit. Normalerweise kann Nora damit leben. Aber heute, am Tag nach ihrer Hochzeit, als ihr Mann schnarchend im Bett liegt und seinen Rausch ausschläft und der Concierge ihr dieses abfällige Lächeln geschenkt und eine junge Nachwuchsautorin in der Lobby herumgesessen hat, weil sie einen Termin mit James Joyce habe … heute passt es ihr nicht.
Darum schüttelt sie Beatrix Potter die Hand. »Guten Tag, Beatrix, natürlich habe ich schon von Ihnen gehört.«
Die beiden Ladys machen einen Spaziergang am Bahnhof Paddington vorbei, der gerade umgebaut wird, und danach zu der wunderschönen Kirche.«
Ruby schwenkte die Kamera. Dass sie in der Realität nur wenige Meter zurückgelegt hatte, sollte keiner merken. »Einmal quer durch den Friedhof, und wir sind da.«
Die Kirche war ein gregorianischer Bau und gehörte zur Kirchgemeinde Little Venice. Selina, die Sigristin stand wie verabredet beim Seiteneingang.
»Hallo, Ruby Kosa, hallo, liebe Podcast-Fans, wie toll, dass ihr mich besucht und den alten Keller sehen wollt, in dem sich Weltgeschichte ereignet hat, ohne dass jemand es weiß.«