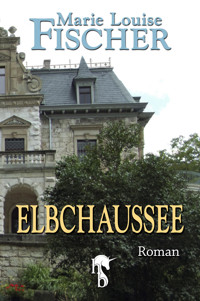
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: hockebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eigentlich hat Claudia allen Grund, zufrieden zu sein: Mit ihrem zweiten Mann, dem renommierten Professor Knut Kröger, und ihrer Tochter aus erster Ehe lebt sie ohne Sorgen in einer herrschaftlichen Villa in Hamburg. Sie genießt es, am gesellschaftlichen Leben der gehobenen Kreise teilzunehmen. Aber ist Claudia wirklich glücklich mit ihrem Leben, so wie es ist? Sie glaubt, ihren Mann zu lieben, und doch zieht es sie immer wieder zu dem Antiquitätenhändler Ralf Hayd, mit dem sie Stunden voller Leidenschaft verbringt. Ralf drängt sie immer mehr dazu, ihren wahren Gefühlen nachzugeben und ihren Mann zu verlassen. Doch erst ein Schicksalsschlag zwingt Claudia, ihr Leben neu zu ordnen. Für wen wird sie sich entscheiden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Marie Louise Fischer
Elbchaussee
Roman
»Wir sind verrückt!« Mit einem lächelnden Seufzer fügte sie hinzu: »Aber süß verrückt!« Sie legte ihm die Hand auf die Brust und spürte das heftige, gleichmäßige Schlagen seines Herzens.
Er zog sie noch enger an sich und hauchte, den Mund an ihrem Ohr: »Hexe!«
»Nun sag bloß …«
Er ließ sie nicht aussprechen: »Natürlich war es deine Schuld! Wenn du dich so aufreizend herrichtest!«
»Aufreizend? In den Klamotten, die ich den ganzen Vormittag im Büro getragen habe?«
»Auf mich wirkst du eben immer aufreizend.«
Sie lachte. »Soll das ein Kompliment oder eine Beleidigung sein?«
Sie lagen nackt, wie Gott sie erschaffen hatte, auf dem taubenblauen Teppichboden seines Wohnraums, ihre Kleidungsstücke wild um sich verstreut. Nach Wochen der Trennung war ihnen der Weg zum Bett oder auch nur zur Couch zu weit gewesen.
»Ich geh’ jetzt unter die Dusche«, verkündete sie, machte aber keine Anstalten aufzustehen.
»Gute Idee! Ich komme mit.«
»Lieber nicht.«
»Hast du es eilig?«
»Überhaupt nicht. Aber ich finde …« Sie zögerte. »… Glück, das man zu wiederholen versucht, nützt sich ab.«
»Dann müsste unseres längst schäbig geworden sein.«
»Eben nicht, weil die Gelegenheiten rar sind, es zu genießen.«
»Man könnte beinahe von homöopathischer Dosierung sprechen.«
»Beschwer dich nicht! Du weißt, ich widme mich dir in jeder freien Minute.« Sie küsste ihn auf die glatte braune Brust, richtete sich energisch auf und sprang hoch.
Er blieb träge liegen, beobachtete, wie sie mit raschen, zielbewussten Griffen Ordnung in das Chaos brachte. Ihr Körper, braungebrannt von Sommersonne und Seewind, wirkte noch immer mädchenhaft, die Beine lang, die Taille schmal und die hoch angesetzten Brüste sehr fest und nur schwach gerundet. Sie sammelte ihr Kleid, seine Hose, Strümpfe und Schuhe ein und trug sie ins Schlafzimmer hinüber. Dann bückte sie sich, um den Inhalt ihrer Handtasche einzusammeln, die sich beim Sturz geöffnet hatte.
Er setzte sich auf. »Lass mich das machen.«
Sie hielt in der Bewegung inne und sah ihn an. »Warum?«
»Nur so. Oder hast du etwa Geheimnisse vor mir?«
»Du bist der einzige Mensch auf der Welt, vor dem ich keine habe.«
»Beruhigend zu wissen.«
Als sie zehn Minuten später aus dem Bad zurückkam, fand sie ihn, schon wieder in Hemd und Hose, auf der Couch sitzend, ihre weiße Handtasche neben sich. Das Licht der Sommersonne, das durch die Jalousetten in den Raum fiel, zauberte einen goldenen Schimmer auf seine braunen Locken. Es wurde ihr einmal mehr bewusst, wie schön er war, und das war, so glaubte sie, das Einzige, was sie an ihm störte.
Er betrachtete ein Foto, das er in der Hand hielt.
Der Versuchung widerstehend, sich neben ihn zu setzen, nahm sie auf einem mit grauem Samt überzogenen Sessel ihm gegenüber Platz. Sie hatte ihr Gesicht noch nicht zurechtgemacht und trug seinen kurzen weißen Bademantel.
Er hatte kurz aufgesehen, als sie eingetreten war, mit jenem Aufleuchten in den ausdrucksvollen Augen mit der grünen Iris, das ihr durch und durch ging, und sich dann wieder dem Betrachten des Fotos gewidmet.
»Dein Mann und deine Tochter?«, fragte er.
Sie hielt es nicht für nötig, ihm die Antwort zu geben, die er ohnehin wissen musste.
»Der ehrenwerte, wohlbetuchte Professor Doktor Knut Kröger«, sagte er in einem Ton, der ironisch klingen sollte, in dem aber ein Hauch von Eifersucht schwang.
»Ach, lass doch, Ralf!«, bat sie.
»Sieht aus, als könnte er dein Großvater sein.«
»Sei nicht albern! Imogen ist neun und er ist zweiundvierzig.«
»Sie ist lieb.«
»Ja, das ist sie.«
»Ich würde sie zu gern kennenlernen.«
»Unmöglich. Ich denke nicht daran, ihr was vorzuspielen, und sie einzuweihen schon gar nicht.«
»Aber wenn es sich zufällig ergäbe …«
»Das möchte ich nicht erleben.«
»Du hast natürlich recht.« Er steckte das Foto in ihre Handtasche zurück und stand auf. »Ich habe uns einen Tee aufgebrüht.«
Sie lächelte zu ihm auf. »Wie immer.«
»Du musst es mir sagen, Claudia, wenn du etwas anderes willst.«
»Das würde ich schon, wenn es so wäre. Aber ich weiß noch nicht, was ich mehr liebe … dich oder deinen wunderbaren Tee.«
Er gab ihr im Vorbeigehen eine leichte Kopfnuss. »Biest.«
Sie lachte nur, langte über den Tisch nach ihrer Handtasche, nahm ein Zigarettenpäckchen und ihr schweres goldenes Feuerzeug – ein Geschenk ihres Mannes – heraus und stellte die Tasche dann neben den Sessel. Während er in seiner Kitchenette hantierte, hatte sie Muße, sich in dem sehr modern, großzügig und hell eingerichteten Raum umzusehen. Sie kannte ihn von vielen Besuchen her, war aber immer gewärtig, etwas Neues zu entdecken. Ralf Hayd und sein Vater, die im Erdgeschoss ihres alten Hamburger Hauses einen Handel mit Antiquitäten betrieben, hatten beide die Angewohnheit, ein vor Kurzem erworbenes Stück, wenn es ihnen gefiel, erst einmal hinauf in die eine oder andere Wohnung zu nehmen. Diesmal war es eine zierliche Kommode aus Rosenholz.
»Zauberhaft!«, rief sie, sprang auf und berührte mit den Fingern das glatte, schimmernde Holz, das trotz seines Alters noch lebendige Wärme auszustrahlen schien.
»Gefällt sie dir?«, fragte Ralf, der ein Tablett mit Teegeschirr zum Tisch hinbalancierte.
»Und ob! Rokoko?«
»Eher spätes Barock.« Er stellte Teekanne, Sahnekännchen und Zuckerdose aus kunstvoll verarbeitetem Silber – England, 18. Jahrhundert – auf den Tisch, verteilte Tassen, Untertassen und Silberlöffel.
»Woher hast du es?«
»Aus einer Versteigerung. Zu teuer erstanden. Aber ich konnte nicht widerstehen.«
»Kann ich dir nachfühlen.«
Sie setzten sich. Er goss frische Sahne in die Tassen, füllte sie mit dem sehr dunklen, fast schwarzen Tee auf, tat Kandiszucker dazu. »Wie war es auf Sylt?«
»Erholsam wie immer. Sonnenbaden, lange Strandspaziergänge, Abende im Pony. Du kennst das ja alles. Aber du hast mir gefehlt.«
»Das will ich hoffen.«
Sie warteten, bis der Zucker sich aufgelöst hatte, rührten behutsam um und nahmen dann den ersten Schluck.
»Ah, wie gut das tut!«, sagte sie. »Nirgendwo bekomme ich einen Tee wie bei dir.«
»Du könntest ihn dir selber kochen.«
»Ja, warum eigentlich nicht?« Sie glaubte, dass ihr Mann ihn sicher auf friesische Art zubereitet auch mögen würde, aber es wäre ihr wie ein Verrat an Ralf vorgekommen, wenn sie ihn auch mit ihrem Mann zusammen so getrunken hätte. Vielleicht später einmal, wenn alles vorbei war.
»Was hast du?«, fragte er.
»Nichts.« Sie zwang sich ein Lächeln ab.
»Du hast an etwas Ungutes gedacht.«
»Vielleicht. Kann sein. Aber wenn, dann habe ich es schon vergessen.« Sie zündete sich eine Zigarette an.
»Du kannst mir vertrauen«, sagte er.
»Das weiß ich ja. Aber vertrauen heißt doch nicht, den anderen mit jedem dummen Gedanken zu belasten, der einem durch den Kopf schießt.« Sie schob ihm das Zigarettenpäckchen zu. »Magst du? Nur zur Gesellschaft.«
Er machte sich nichts daraus zu rauchen, nahm sich aber dennoch eine Zigarette und zündete sie sich mit ihrem Feuerzeug an.
»Wie kommt es, dass du erst heute zurück bist? Ich hatte dich schon am Mittwoch erwartet.«
Sie streifte die Asche ihrer Zigarette ab. »Ich habe es versucht. Aber es ging nicht. Knut und Imogen fühlten sich so wohl auf der Insel, und allein lassen wollte ich sie auch nicht.«
»Aber du hattest Sehnsucht nach mir?«
»Ja«, gab sie zu, »aber gerade das war das Fatale.«
»Verstehe ich nicht.« Er sah sie aufmerksam an.
»Tatsächlich hätte ich guten Grund gehabt, früher abzureisen. Am Mittwoch war die große Artikelabgabe bei Cosmos.«
»Was ist das?«
»Ach, das habe ich dir bestimmt schon mal erzählt. Da stellen die Einkäufer ihre Waren für den nächsten Katalog vor. Das ist immer eine ziemlich aufregende Angelegenheit. Alle versammeln sich im Konferenzsaal.«
»Wer – alle?«
»Der Big Boss, die Chefs der Einkäufer und der Werbeabteilung und ihre Assistenten, die Texter, die Fotografen und die Grafiker.«
»Und da hättest du als Cheftexterin natürlich dabei sein sollen.«
»So ist es.« Claudia drückte ihre Zigarette aus. »Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.«
»Wieso hast du das deinem Mann nicht klarmachen können?«
»Der Termin fiel ja in meinen Urlaub. Man hat mich erst am Montag wieder im Büro erwartet.«
»Aber du warst schon heute da.«
Sie griff nach einer Zigarette. »Weil ich mich so schnell wie möglich orientieren und zu dir wollte. Ich kann dir nicht genau sagen, was mir wichtiger war.« Sie zuckte die Achseln.
Er ließ ihr goldenes Feuerzeug aufspringen. »Es wird wohl die Arbeit gewesen sein.«
Sie steckte sich die Zigarette in den Mund, hielt sie in die kleine Flamme und zog den Rauch ein. »Da bin ich mir nicht so sicher«, erklärte sie.
»Claudia!« Er wollte sie zu sich ziehen.
»Bitte nicht!« Sie wehrte ihn ab. »Ich muss noch in die Firma.«
»Warum? Könntest du nicht …«
»Nein!«, erklärte sie so entschieden, dass er sie freigab.
Sofort versuchte sie die Zurückweisung zu mildern. »Sei mir nicht böse, Liebling!«, bat sie zärtlich. »Wir können ja von Glück sagen, dass wir uns überhaupt heute schon treffen konnten.«
»Ja«, sagte er, »wieso eigentlich?«
»Weil heute ein Professor aus München zu uns kommt, ein Wissenschaftler, den Knut sehr verehrt. Professor Weber und seine Frau. Sie sind heute den letzten Tag in Hamburg und Knut wollte ihn auf keinen Fall verpassen.«
»Dann«, sagte er sehr nachdenklich, »hast du dich also nach seinen Wünschen gerichtet.«
»Sollte ich das nicht?«, fragte sie lächelnd. »Sie konnten mir doch nur recht sein.« Sie drückte die Zigarette aus, nahm ihre Handtasche und stand auf.
Stirnrunzelnd blickte er zu ihr hoch. »Irgendetwas an dir wird mir immer rätselhaft bleiben.«
Sie lächelte ihm zu. »Das ist auch gut so. Rätsel hören auf, spannend zu sein, wenn sie gelöst sind.« Mit raschen Schritten verschwand sie im Schlafzimmer.
Wenige Minuten später – er hatte gerade Zeit gefunden, den Tisch abzudecken und das Geschirr in die Küche zu tragen – kam sie zurück, schon angezogen, in einem schmalen maisgelben Kleid mit Leinenstruktur und dazu passender Jacke: Normalerweise legte sie sehr viel Wert auf ein sorgfältiges Make-up, aber augenblicklich hielt sie es, bei ihrer gleichmäßig sommerlich gebräunten Haut, nicht für nötig. Die vereinzelten, winzigen, sehr dunklen Sommersprossen auf dem Nasenrücken gefielen ihr; sie gaben ihr etwas Keckes, Jugendliches.
So hatte sie nur ihre ohnehin langen, dunklen Wimpern getuscht und das tiefe Blau ihrer Iris durch einen entsprechenden Lidstrich noch betont. Das braune, fast schwarze Haar machte ihr keine Arbeit. Sie trug es kurz geschnitten und brauchte es nur kräftig durchzubürsten, damit es sich locker um ihr klares Gesicht bauschte.
Er blickte ihr bewundernd, fast anbetend entgegen und sie reichte ihm ihren noch ungeschminkten Mund zu einem letzten Kuss. Sie wusste, dass er sie gerne gebeten hätte, sich auf ein Wiedersehen festzulegen. Aber er hatte gelernt, darauf zu verzichten und die Organisation ihrer Begegnungen ganz ihr zu überlassen.
»Ich liebe dich«, sagte er, als er sie wieder freigab.
»Ich dich auch«, erwiderte sie, holte Spiegel und Lippenstift aus ihrer Handtasche, klemmte sie unter den Arm und malte sich den großzügig geschwungenen Mund leuchtend rot.
Sie verließ seine Wohnung durch die Tür, die ins Treppenhaus führte – es gab noch eine zweite, die seine Privaträume mit dem Geschäft verband – legte zwei Finger an die Lippen und warf ihm, der sie begleitet hatte, eine Kusshand zu, dann klapperte sie auf ihren hohen Absätzen die Stiege hinunter.
Erst als sie außer Sichtweite auf der Straße stand, erlaubte sie sich einen Blick auf ihre Armbanduhr – sie tat dies, um ihn nicht zu verletzen, nie in seinem Beisein. Es war kurz nach drei Uhr nachmittags. Die Werbeabteilung von Cosmos hatte, wie üblich, freitags um ein Uhr geschlossen. Sie hatte also etwa zwei Stunden mit Ralf verbracht.
›Gutes Timing‹, dachte sie zufrieden und schritt energisch aus.
Es war ein schwüler Augusttag. In die schmalen Straßen nahe dem Fischmarkt drang zwar nur selten Sonnenschein, dennoch war die Hitze drückend. Claudia war froh über den Tee, den sie getrunken hatte. Er machte die Temperatur jetzt erträglicher. Ohne sich dessen bewusst zu sein, summte sie vor sich hin.
Das große alte Gebäude der Firma Cosmos stand nahe dem Nobistor, einem ehemaligen Kontorhaus. Häufige Renovierungen hatten ihm nichts von einer gewissen Düsternis, aber auch Würde nehmen können. Es gab keine Reklame an den Außenwänden oder dem hohen Giebel. Nur eine schwarze Inschrift auf einer Messingtafel neben der Tür verriet, dass es sich um das Versandhaus Cosmos handelte.
Ein alter Pförtner, der durch ein Fenster Aussicht auf die Straße hatte, ließ Claudia ein, ohne dass sie erst klingeln musste.
»Tag, Frau Wolff«, begrüßte er sie freundlich.
»Tag, Herr Stielicke.«
»Wieder einmal fleißig?«
»Muss ja wohl sein.«
Es war nicht ungewöhnlich, dass Claudia freitagnachmittags noch einmal in die Firma kam. Wenn auch die Katalogredaktion mittags Schluss zu machen pflegte, gab es andere Abteilungen, die weiter tätig blieben, die Packerei etwa und der Versand, der Einkauf und die Buchhaltung. Dennoch wirkte das Innere des Gebäudes spürbar verlassener als sonst.
Claudia ging, mit einer raschen Handbewegung grüßend, an der Pförtnerloge vorbei, um nicht vom alten Stielicke in ein zeitraubendes Gespräch über das Wetter oder ihren Urlaub verwickelt zu werden. Mit einem alten, quietschenden und ratternden Aufzug fuhr sie in den sechsten Stock hinauf, eilte den Gang entlang, der durch ein einziges Fenster an einem Ende nur unzureichend beleuchtet war. Alle Türen linker Hand zur Abteilung Einkauf, hinter der sich ein sehr großer verwinkelter Raum mit den Apparaten für Telex und Telefax verbarg, wie auch die nebeneinanderliegenden Büros von Personalabteilung, Chefsekretariat und Sekretariat, Buchhaltung und Direktion rechter Hand, waren geschlossen. Ganz hinten links die Tür führte in ihr Reich, die Textredaktion. Sie wirkte jetzt, da Claudia sie allein betrat, angenehm groß. Das Zimmer hatte eine hohe Decke und schmale Fenster, durch die das helle Licht des Sommertages, durch die verschmutzten Scheiben gefiltert, in Streifen einfiel.
An gewöhnlichen Tagen herrschte hier drangvolle Enge. Claudia teilte sich den Raum mit Mitarbeitern, beziehungsweise Mitarbeiterinnen, die ihr unterstellt waren. Ihr Schreibtisch stand auf einem kleinen Podest, so dass sie alles, was geschah, ständig übersehen und kontrollieren konnte. Claudia hätte liebend gern ein eigenes Büro gehabt, und die anderen wünschten sich wenigstens eine Unterteilung durch halbhohe Trennwände oder Blumenkübel. Aber die Herren von der Chefetage hatten es anders bestimmt. Sie bestanden darauf, dass nur in dieser Anordnung eine effiziente redaktionelle Arbeit möglich sei.
Tatsächlich wurden Claudia und ihr Stab in der Firma als »die glücklichen Sieben« bezeichnet, und sie war stolz darauf, dass dies nur ihrer freundlichen und bestimmten Art der Menschenführung zu verdanken war. Sie achtete darauf, dass jeder Mitarbeiter die Aufgaben bekam, die ihm am meisten lagen, verstand es, Intrigen im Keim zu ersticken, und war immer bereit auf einen Scherz einzugehen, wenn er nicht gerade das Arbeitsklima störte. So kam es, dass alle sich wohlfühlten und in dem nüchtern eingerichteten Raum oft genug Gelächter ausbrach.
Obwohl sie an alle nur möglichen Stellen der Wände bunte Poster geklebt hatten, wirkte das große Zimmer kahl und unfreundlich. Der Fußboden war mit dunklem, seit undenklichen Zeiten zerschrammtem Holz belegt und von der Decke löste sich der Verputz. In einem mächtigen Regal waren die Artikel für den neuen Katalog gelagert.
Insgesamt sieben graue Stahlschreibtische standen in dem Raum – Claudias war ein wenig imposanter als die anderen – und ein breiter, geschlossener Schrank, in dem Kataloge aufbewahrt wurden, die der eigenen Firma wie auch der Konkurrenz. Nur Claudia hatte einen Computer mit Drucker zur Verfügung, die beiden Herren im Team und Liselotte Klein arbeiteten an Computern ohne Zubehör, die anderen benutzten Schreibmaschinen. Es wurde zwar immer wieder von der Firmenleitung versprochen, die ganze Belegschaft der Redaktion mit Computern und Druckern auszustatten, aber dazu würde es wohl nie kommen, und Claudia war es ganz recht so. Sie wusste, dass die älteren Frauen vor der Einführung der neuen Technik zitterten und die eine oder andere, wenn es dazu käme, wohl gar das Handtuch werfen würde. Aber gerade sie waren gute und einfallsreiche Texterinnen, auf die Claudia nicht verzichten wollte, einmal ganz davon abgesehen, dass eine neue Stellung für sie wohl nur schwer zu finden sein würde.
Claudia durchquerte den Raum, stieß die Tür zur anschließenden Grafikabteilung auf, ging weiter und lugte in die Fotografie hinein; wie sie nicht anders erwartet hatte, lagen sie verlassen. Sowohl die Grafiker als die Fotografen hatten keine eigene Verbindung zum Gang, sondern mussten, wenn sie hinauswollten, die Textredaktion durchqueren. Das förderte zwar die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Abteilungen, brachte aber auch sehr viel Unruhe mit sich.
Erst nachdem sie sich vergewissert hatte, dass sie tatsächlich allein war, streifte sie die Pumps ab. Ihre Füße schmerzten. Es war wohl doch keine so gute Idee gewesen, beim raschen Ankleiden in Ralf Hayds Wohnung auf Strümpfe und Straps zu verzichten und sie stattdessen in die Handtasche zu stopfen. Zum Glück hatte sie keine Blasen bekommen, sondern nur rote Druckstellen.
Claudia legte ihre Handtasche in das dafür bestimmte Seitenfach ihres Schreibtisches. Obwohl das alte Gemäuer die größte Hitze abhielt, zog sie die Jacke aus und hängte sie über die Stuhllehne, was sie sich in der normalen Bürozeit nie erlaubt hätte. Das maisgelbe Kleid, das sie trug, gab ihre schönen braunen Arme frei, war leicht tailliert, lang genug, die Knie gut zu bedecken, sie aber bei Bewegungen durch einen kurzen Schlitz seitlich am Rock freizugeben. Claudia besaß einige dieser Kombinationen, Kleid mit gleichfarbiger Jacke, die zwar nicht gerade modisch, aber zeitlos bequem waren. Da sie keinen Büstenhalter trug, ihn nicht zu tragen brauchte, bestand auch nie die Gefahr, dass ein Träger sichtbar wurde oder gar über die Schulter hinabrutschen konnte.
Kurz massierte sie ihre schmalen, kräftigen Füße mit den rot lackierten Zehen. Barfuß trat sie an das riesige Regal, in dessen Fächern die neuen Artikel ausgestellt waren, so dass sich alle ihrer bedienen konnten. Jedem Artikel war ein Produktblatt beigefügt mit Code, Preis und den wichtigsten Angaben. Bei einigen steckten auch schon die sogenannten »Mäppchen«, braune Umschläge, in die Texte oder Fotos geschoben worden waren, Zeichen dafür, dass die Produktion des Katalogs begonnen hatte.
Claudia kümmerte sich nicht darum, sowenig wie um die abgegriffenen Mäppchen, die Fotos, Texte und Grafiken von alten Artikeln enthielten, die wieder in den Weihnachtskatalog hineingenommen werden sollten. Heute prüfte sie nur die Warenpalette – es gab fast nichts, was es nicht gab, angefangen von billigen Plastik-Weihnachtsbäumchen fürs Auto über Küchengeräte, Pantoffeln, Winterstiefel und Anoraks bis zu echten Pelzen – und studierte die beigefügten Formblätter, zuweilen sehr angetan, manchmal aber auch kopfschüttelnd. Sie musste sich zumindest einen allgemeinen Überblick verschaffen.
Danach wischte sie sich die Füße – sie schmerzten immer noch – mit einem Papiertaschentuch ab, schlüpfte in ihre Pumps und nahm ihre Handtasche. Dann zog sie ihre Jacke über und verließ den Raum.
Knatternd und quietschend kam der alte Aufzug zur Chefetage hinauf; er hielt mit dem üblichen harten Ruck im sechsten Stock. Claudia wartete darauf, dass die Türen sich öffnen würden, als sie von hinten angesprochen wurde.
»Hallo, schöne Frau!«, begrüßte sie Georg Hacker, der Chefeinkäufer von Cosmos.
Sie fuhr herum.
Lächelnd stand er vor ihr in einem eleganten, hellen Leinenanzug mit Krawatte – als einzigen Tribut an die Hitze hatte er den oberen Kragenknopf geöffnet – und lüftete seinen Panamahut.
Claudia, in Gedanken versunken, war weder auf diese noch eine andere Begegnung gefasst gewesen und starrte ihn erst einmal sprachlos an. Er war ein schwerer Mann Mitte vierzig mit ausgeprägten Gesichtszügen, vollen Lippen, fleischiger Nase und kleinen, sehr lebendig funkelnden schwarzen Augen; sein dunkles Haar begann schütter zu werden.
Claudia gewann ihre Fassung zurück und lächelte ihn an. »Einen schönen guten Tag, Herr Hacker!«
Er trat mit einer chevaleresken Bewegung zurück, um sie als Erste einsteigen zu lassen. »Es ist mir, wie immer, eine besondere Freude, Sie zu sehen, Frau Wolff-Kröger.«
»Das Vergnügen«, behauptete Claudia, »liegt ganz auf meiner Seite.«
Die Türen schlossen sich hinter ihnen und der Aufzug rumpelte in die Tiefe.
Die Kabine war geräumig, Claudia stellte sich so weit entfernt von Georg Hacker hin, wie es die Höflichkeit gerade noch erlaubte. Er drängte sich nicht an sie heran, dennoch fühlte sie sich durch seine Gegenwart beengt. Der scharfe Geruch, den er ausströmte, ein Gemisch aus warmem Schweiß und einem allzu reichlich benutzten Herrenparfum, setzte ihr zu.
»Ich brauche nicht zu fragen, wie es Ihnen geht, verehrte Frau Wolff-Kröger«, sagte er schmeichelnd, »man sieht es Ihnen an. Es könnte nicht besser sein.« Seine glitzernden Augen musterten sie – unverschämt, wie es ihr schien – und saugten sich an ihren nackten Beinen fest.
Claudia war froh, dass sie nicht dazu neigte, rot zu werden; sie setzte eine gelassene Miene auf und bemerkte so unpersönlich wie nur möglich: »Ich war in Urlaub.«
»Ich weiß, ich weiß. Man hat Sie im Haus vermisst.«
»Nett, das zu hören«, erwiderte Claudia lächelnd und dachte bei sich: ›Du alter Heuchler wärst mich doch am liebsten für immer los!‹
Sie hatte nichts gegen Georg Hacker persönlich, jedenfalls versuchte sie sich das einzureden. Er war ein mächtiger Mann in der Firma und niemand konnte wagen, es sich mit ihm zu verscherzen. Aber seit eh und je hatte es zwischen ihm und Claudia gewisse Spannungen gegeben. Sie wagte zwar nicht, offen Kritik an der Auswahl der Waren zu üben, die er für das Versandhaus erstand, aber sie war auch nicht falsch genug, Begeisterung zu heucheln, wenn sie ihr nicht gefielen. Besonders die billigen Importe aus dem Fernen Osten waren ihr ein Gräuel, die sie dann im Katalog hochpreisen musste, obwohl sie wusste, dass das meiste den Kunden schon nach dem ersten Gebrauch zwischen den Fingern zerfallen würde.
»Wann nehmen Sie Ihren Urlaub?«, fragte sie in der Hoffnung, damit seinen Blick umlenken zu können.
Aber es gelang ihr nicht.
»Irgendwann«, erklärte er beiläufig. »Sie wissen ja, wir Junggesellen müssen immer zurückstehen.«
Claudia fand es zwar lächerlich, dass er sich als Junggeselle bezeichnete – er war erst seit wenigen Jahren geschieden –, dennoch sagte sie teilnahmsvoll: »Sie Ärmster!«
Plötzlich hob er den Blick und sah ihr direkt in die Augen, und das war ihr zu ihrer eigenen Überraschung noch unangenehmer, als wenn er unverfroren auf ihre Beine starrte.
»Übrigens bin ich überrascht, Sie hier und jetzt zu sehen.«
»Das kann Ihnen öfter passieren. Ich arbeite freitagnachmittags gerne noch eine oder zwei Stunden.«
»Wie emsig«, erklärte er spöttisch.
Sie zuckte die Achseln. »Der Katalog muss ja fertig werden.«
Laut krachend landete der Aufzug im Keller und die Tür öffnete sich. Mit einer übertriebenen Geste der Höflichkeit überließ Georg Hacker ihr den Vortritt, war aber dann, auf dem Weg zur Tiefgarage, schon wieder an ihrer Seite.
»Wie weit sind Sie denn damit?«
»Noch ganz am Anfang.«
»Ich glaube, wir sollten uns bei einem Glas Bier darüber unterhalten. Wie wär’s?«
»Bei der Hitze trinke ich prinzipiell kein Bier.«
Er lachte, um zu beweisen, dass er sich nicht kränken ließ. »Dann also – bei einem Glas Tee mit Rum?«
Claudia blieb stehen. »Ein andermal gerne, Herr Hacker, aber heute habe ich es eilig. Ich muss meine Tochter abholen. Sie wartet schon auf mich.« Sie reichte ihm die Hand.
Er hielt sie länger fest, als es angebracht war. »Nächste Woche?«
»Ich fürchte, dann ergibt sich die gleiche Situation«, sagte sie und blickte ihm lächelnd in die Augen.
»Ich gebe die Hoffnung nicht auf.«
»Wer könnte Ihnen das verbieten?«
Jetzt endlich gab er ihre Hand frei. »Dann bis Montag, Frau Wolff-Kröger!« Er drückte sich seinen Panamahut auf den Kopf.
»Auf Wiedersehen, Herr Hacker!«
Sie trennten sich und jeder ging zu seinem Auto.
Claudia ärgerte sich über sich selber. Sie hatte wirklich keine Zeit gehabt, sich mit Georg Hacker zusammenzusetzen. Aber sie hätte sich liebenswürdiger aus der Affäre ziehen können. Aus ihrem Benehmen musste er den Schluss ziehen, dass sie ihm absichtlich auswich. Dabei wäre ein Gespräch mit ihm für sie mindestens so nützlich gewesen wie für ihn. Doch seine unverschämte Art ärgerte sie unsäglich. Claudia hielt sich viel zugute auf ihre Selbstbeherrschung. Aber mit ihm allein war sie oft nahe daran, die Fassung zu verlieren.
Schon dass er sie mit leicht süffisanter Betonung, wie ihr schien, Wolff-Kröger nannte, irritierte sie. Nach ihrer ersten, so kläglich gescheiterten Ehe hatte sie ihren Mädchennamen wieder angenommen und hatte ihn, als sie Knut Kröger heiratete, nicht noch einmal aufgeben wollen. Freunde hatten Bedenken gehabt, auch Knut war es nicht ganz recht gewesen, aber die angemeldeten Schwierigkeiten waren ausgeblieben, im Betrieb war sie Frau Wolff geblieben, im gesellschaftlichen Leben Frau Kröger geworden. Georg Hacker war der Einzige, der beharrlich ihren Doppelnamen anwandte.
Claudia wusste selber nicht, warum sie das so aufbrachte. Vielleicht meinte er es ja gar nicht spöttisch, vielleicht wollte er ja damit nur seiner Achtung ihr gegenüber Ausdruck geben. Wie dem auch war, sie nahm sich vor, in Zukunft freundlicher, zumindest aber gelassener zu sein. Zum Glück hatte er ja auch nur selten Gelegenheit, sie so zu überrumpeln wie heute.
Die Tiefgarage unter dem alten Kontorhaus war nicht sehr groß. Nur leitende Angestellte hatten hier Stellplätze. Alle anderen mussten mit der S-Bahn von und zum Nobistor fahren. Gerade deshalb hatte Claudia Freude an ihrem Privileg und nutzte es weidlich aus.
Sie war gerade dabei, ihr kleines gelbes Cabriolet aufzuschließen, als sie einen anderen Wagen hinter sich vorbeifahren hörte. Sie drehte sich um und erkannte Hackers silbergraue Limousine.
Er kurbelte das Seitenfenster herunter und rief ihr zu: »Schönes Wochenende, Frau Wolff-Kröger!« Glücklicherweise war er also nicht beleidigt.
Claudia winkte ihm zu. »Ihnen auch, Herr Hacker!«
Sie stieg ein, warf einen Blick auf die Uhr im Armaturenbrett und stellte fest, dass sie nicht mehr ganz in der Zeit war. Das passte ihr nicht, war aber kein Grund, nervös zu werden. Imogen war nach der Ballettschule bei Claudias Schwester, Sandra Hagedorn, in bester Obhut.
Imogen saß mit ihrer Cousine Kersten auf dem Küchenbalkon bei Hagedorns. Die beiden Mädchen spielten mit großem Eifer »Sechsundsechzig«. Imogen war dünn, hatte hellblaue Augen und langes blondes Haar. Die gleichaltrige Kersten wirkte neben ihr pummelig. Sie hatte ein rundes Gesicht, Grübchen in den vollen Wangen, braune Augen und einen braunen Wuschelkopf. Die Karten, die sie auf den wackligen Gartentisch klopften, waren reichlich abgedroschen.
Sandra Hagedorn, die in der offenen Küche hantierte, kümmerte sich nicht weiter um die Kinder. Sie war zufrieden, dass sie sich selbst beschäftigten.
»Ich melde vierzig!«, rief Imogen triumphierend und legte die offenen Karten auf den Stapel. »Buch zu! Gewonnen!«
»So ein Schiet!«, rief Kersten. Leise fügte sie hinzu: »Jetzt schulde ich dir schon acht Mark.« Sie begann die Karten erneut zu mischen.
»Mach dir nichts draus«, sagte Imogen tröstend, »ich werde sie dir stunden.«
»Nein, ich hol’s mir zurück! Revanche!«
»Tut mir leid. Ich muss jetzt aufhören.«
»Das könnte dir so passen!«
»Nimm Vernunft an, Kersten! Meine Mutter kann jeden Augenblick kommen.«
Kersten wurde einen Moment nachdenklich; sie wusste so gut wie Imogen, dass deren Mutter ihr Kartenspielen streng verboten hatte. Ihre eigene Mutter hielt es für eine harmlose Unterhaltung, ahnte allerdings nicht, dass die beiden Mädchen versuchten, sich gegenseitig das Taschengeld abzuluchsen.
»Wir können sofort aufhören, wenn sie erst da ist!«, schlug sie vor. Tatsächlich hatten die beiden Übung darin, die Karten blitzschnell verschwinden zu lassen.
Trotzdem widersprach Imogen. »Nein. Das ist mir zu riskant.«
»Du bist gemein!«, schrie Kersten.
Sandra Hagedorn erschien in der offenen Küchentür. »Was gibt’s denn, ihr beiden?«
»Immy will schon aufhören!«, beklagte sich Kersten.
»Claudia holt mich gleich ab«, sagte Imogen.
»Aber sie bleibt doch bestimmt ein Weilchen.«
»Heute nicht. Wir bekommen Besuch.«
Sandra Hagedorns Gesicht verdüsterte sich. »Besuch?«, wiederholte sie betroffen.
Imogen begriff, dass sie das nicht hätte sagen sollen. Tante Sandra kränkte es, weil sie und ihr Mann, Onkel Albert, nicht mit eingeladen waren. Rasch versuchte Imogen ihren Fehler wiedergutzumachen. »Nur Onkel Jens und Tante Sylvia und noch so ein langweiliges Ehepaar«, versicherte sie.
Sandra hatte sich wieder gefasst. »Dann ist es wohl besser, wenn ihr die Karten jetzt wegräumt«, sagte sie.
Kersten stiegen Tränen in die Augen. »Ach Mutti«, wollte sie anfangen zu betteln.
Da klingelte es auch schon an der Wohnungstür.
»Siehst du!«, rief Imogen. »Habe ich dir doch gesagt!«
»Noch ein ganz, ganz kleines Spielchen!«, drängte Kersten. »Die beiden quatschen bestimmt erst.«
Imogen ließ sich überreden. »Von mir aus. Aber äußerste Vorsicht, ja?«
»Caution!«, bestätigte Kersten, die von ihrem großen Bruder ein paar englische Ausdrücke aufgeschnappt hatte. »Versteht sich. Ich habe die Küche im Auge.« Sie mischte die Karten und verteilte erneut.
Die beiden verheirateten Schwestern begrüßten sich an der Wohnungstür. Das kleine Entree war fensterlos und Sandra hatte die Deckenleuchte angeknipst.
Jetzt zog sie Claudia unter das Licht, um sie besser betrachten zu können. »Du siehst mal wieder aus!«, rief sie mit neidvoller Bewunderung.
»Wie immer«, behauptete Claudia.
»Nein. Immer hast du nicht so ausgesehen.«
»Mach mir die Freude und erinnere mich nicht!«
»Du warst noch nie so schön! Dass man mit dreißig noch so aussehen kann!«
»Ich tu’ ja auch was für mich.«
»Nein, daran liegt es nicht. Du wirkst so glücklich, so strahlend!« Sie überlegte. »Strahlend glücklich, ja, das ist es.«
»Das Leben ist ja auch schön.«
»Ist das dein Ernst?«
»Ja. Du solltest öfter mal was unternehmen. Das würde dir guttun.«
»Du kennst doch Albert! Dem geht nichts über seine Bequemlichkeit.«
»Seine Pantoffeln, seine Briefmarken und sein Stammtisch, ich weiß. Aber warum ziehst du nicht einfach mal alleine los?«
»Das könnte ich nicht.«
»Quatsch. Du hast es noch nie versucht.«
»Ich möchte es gar nicht!«, erklärte Sandra mit Nachdruck. »Ich bin mit meinem Leben so zufrieden, wie es ist.«
Claudia lag eine spöttische Bemerkung schon auf der Zunge, besann sich dann aber und sagte: »Sandra, es tut mir leid. Ich habe heute wenig Zeit.«
»Ja, ich weiß. Du gibst heute wieder mal eines deiner kleinen Diners.«
»Zu denen du nicht eingeladen bist. Nicht wahr, das willst du mir jetzt doch vorhalten. Aber sei mir nicht böse, Sandra. Glaub mir, das wäre wirklich nichts für dich.« Sie umarmte die Schwester flüchtig. »Es wird bestimmt todlangweilig.«
»Und wie stehst du das durch?«
Claudia lachte. »Ich tue meine Pflicht als Gattin von Professor Doktor Kröger. Was sein muss, muss sein.«
»Ich bin sicher, du genießt es.«
»Ich habe nun mal das Talent, aus allem das Beste zu machen. Aber wenn du darauf bestehst, werde ich euch das nächste Mal zusammen mit Lydia und Sven einladen.«
»Nur nicht!«, rief Sandra mit gespieltem Entsetzen.
»Am Sonntag kommt ihr jedenfalls alle zu uns raus. Wenn das Wetter schön bleibt, machen wir ein Picknick.«
»Ich bringe einen Kuchen mit.«
»Genehmigt. Wo sind denn die Mädchen?«
»Auf dem Balkon.«
»He, Imogen!«, rief Claudia durch die offene Küchentür; sie und ihr Mann waren die Einzigen, die Imogen gelegentlich bei ihrem richtigen Namen nannten.
Mit geröteten Augen kam das Mädchen ins Vorzimmer gesaust. »Da bin ich schon, Claudia.«
»Hast du mich denn nicht gehört?«
Etwas gemächlicher erschien Kersten auf der Schwelle. »Doch, Tante Claudia, aber wir dachten, ihr wolltet noch …«, sie unterdrückte einen saloppen Ausdruck, »… plaudern.«
»Wie rücksichtsvoll von euch!«, bemerkte Claudia mit verhaltener Ironie.
Kersten blickte sie aus unschuldsvoll aufgerissenen Kulleraugen an. »Aber so sind wir doch immer.«
Imogen hatte sich inzwischen gebückt und die Leinentasche mit ihrem Ballettzeug gegriffen, die neben der Garderobe gestanden hatte. »Können wir, Claudia?«
»Hast du ein Kopftuch dabei?«
»Wollen wir offen fahren?«, fragte Imogen begeistert.
»Ja. Ich denke schon.«
»Toll!«, rief Kersten.
Imogen zerrte ein geblümtes Tuch aus ihrer Tasche und wies es vor.
»Fein«, sagte Claudia, »dann ist ja alles in Ordnung.« Sie wandte sich Sandra zu. »Bis übermorgen dann! Wir freuen uns schon.« Imogen an der Hand verließ sie die Wohnung.
Mit ihrer Mutter allein geblieben maulte Kersten: »Die Immy hat es gut.«
»Du etwa nicht?«
»Nicht so gut wie Immy. Die wohnt in einem geilen Haus …«
»Aber Kersten!«
»Wenn es doch wahr ist! Und sie darf mit ihrer Mutter im offenen Auto fahren …«
»Bestimmt nimmt Tante Claudia dich auch mal mit!«
Kersten ließ sich nicht unterbrechen. »… und sie nennt ihre Mutter beim Vornamen!«
»Wenn das alles ist, was dir Sorgen macht – sag ab heute Sandra zu mir!«
Kersten kaute nachdenklich auf ihrer vollen Unterlippe. »Nein, das möchte ich eigentlich gar nicht. Es käme mir komisch vor.«
»Mir auch«, stimmte die Mutter ihr zu.
»Warum tut Immy es dann?«
»Ich weiß es nicht. Vielleicht weil die beiden ein paar Jahre allein gelebt haben. Ohne Immys Vater. Da haben sie sich wohl wie Freundinnen gefühlt.«
»Aber da sind wir doch noch ganz klein gewesen.«
»Ich denke, dass ihre Mutter sie zur Freundin machen wollte. Wenn du mal richtig nachdenkst, Kersten, wirst du darauf kommen, dass du es viel besser hast als Immy. Wir haben zwar kein tolles Haus, aber wir sind eine intakte Familie.«
»Intakt – was ist das?«
»Eine heile Familie. Richtiger Vater, richtige Mutter und richtige Kinder. Und außerdem bin ich nicht berufstätig, sondern immer für euch da.«
»Immer«, sagte Kersten, »brauchst du eigentlich gar nicht für uns da zu sein.«
»Na, hör mal!«
»Ich meine nur, Krischan und ich sind jetzt doch schon ziemlich groß. Wir könnten auch mal allein für uns kochen.«
»Traust du dir das zu?«
»Ich könnte es ja versuchen.«
Sandra packte ihre kleine Tochter zärtlich am Nacken. »Weißt du was? Du solltest mir öfter in der Küche helfen. Jedenfalls am Wochenende. Damit du kochen lernst.«.
»Gehst du dann auch arbeiten? Wenn ich es kann, meine ich?«
»Willst du das wirklich?«
»Dann würde ich doch mehr Taschengeld kriegen, oder?«
Sandra schüttelte sie wie einen jungen Hund. »Was für Ideen! Fünf Mark in der Woche müssten für ein Mädchen in deinem Alter doch wohl genug sein.«
»Immy hat mehr.«
»Hör auf, dich mit Immy zu vergleichen. Das ist ganz dumm. Du und ich, wir kennen unzählige Kinder, denen es sehr viel schlechter geht als dir. Vergleiche dich lieber mit denen!«
»Ja, ich weiß, Mutti. Könnte ich aber nicht doch ein paar Mark mehr kriegen? Als Gehalt sozusagen. Wenn ich dir doch ab jetzt in der Küche helfe.« Sie blickte ihre Mutter flehend an.
Christian, ein schlaksiger Junge, war aus seinem Zimmer gekommen. »Wenn Kersten mehr kriegt, dann ich auch!«, rief er. »Ich lange hinten und vorne nicht! Ich überlege schon, ob ich Zeitungen austragen soll, um über die Runden zu kommen.«
Sandra seufzte. »Was für Egoisten ihr doch seid, alle beide! Da opfert man sich auf, Jahr für Jahr – und was ist der Dank? Dass ihr mehr Geld haben wollt!«
»Ist mir ja selber peinlich«, meinte Christian, »sonst hätte ich das Thema schon längst mal angeschnitten. Aber wenn diese kleine Kröte sich traut …«
»Bin keine Kröte und bin nicht frech!«, empörte sich Kersten und trat ihrem Bruder heftig gegen das Schienbein.
Da sie offene Sandalen trug, tat es nicht weiter weh. Trotzdem schrie Christian und begann auf einem Bein herumzuhüpfen.
Kersten lachte entzückt.
»Ich werde mit eurem Vater über die Angelegenheit sprechen!«, erklärte Sandra.
Die Kinder umarmten sich stürmisch.
Sandra wurde es warm ums Herz und es fiel ihr schwer, die erwartungsvolle Freude der beiden zu dämpfen. »Versprechen kann ich aber gar nichts«, sagte sie, »ihr wisst selber, dass alles immer teurer wird.«
Claudia und Imogen fuhren indessen im offenen Kabriolett die Elbchaussee entlang in Richtung Blankenese. Da der Wind ihnen die Worte vom Mund riss und Imogen zudem die Stereoanlage auf volle Lautstärke aufgedreht hatte, kam eine Unterhaltung nicht zustande. Aber beide genossen das seltene Vergnügen.
Der Krögersche Besitz lag hinter dem Uferstreifen und der Fahrbahn gleich an der Elbe, ein fast vier Hektar großes Grundstück, von einer hohen, weiß gekalkten Mauer umgeben und mit einem schönen alten Baumbestand, Ulmen zumeist und Buchen, die alle ein wenig windschief dastanden.
Als Claudia auf das schmiedeeiserne Gartentor zuhielt, öffneten sich die beiden Flügeltüren elektronisch, um sich gleich hinter dem Auto wieder zu schließen. Die Auffahrt war nur kurz. Vor der Garage angekommen, nahm Imogen ihren Beutel vom Rücksitz, riss sich das Kopftuch ab und sprang aus dem Auto. Claudia rangierte ihr Cabriolet neben die Limousine ihres Mannes in die Garage. Er war also schon da.
Wie immer erfreute sie der Anblick ihres Hauses, als sie darauf zuschritt: aus roten Klinkersteinen erbaut, mit weißer Tür und weißen Fensterläden, zwei Stockwerke, mit ausgebautem Dachboden, ganz oben ein halbrundes Fenster unter dem tiefgezogenen Dach. Sie empfand es als ihr Heim, obwohl es nicht für sie, sondern für Rosalind, die erste, verstorbene Frau ihres Mannes, gebaut worden war. Außen war nichts, innen nur wenig verändert worden. Claudia hatte es so akzeptiert, wie es war.
Weiter zurückgesetzt, bis auf den hohen Giebel von einer Baumgruppe verdeckt, lag das Haus der alten Krögers, ein riesiger, pompöser Kasten, der um die Jahrhundertwende entstanden war. Obwohl die alte Villa reichlich Platz bot, hatte Rosalind darin nicht leben wollen, und Claudia dankte ihr von Herzen dafür. Jetzt wurde es von Sven Kröger, dem älteren Bruder ihres Mannes, und seiner Frau Lydia samt ihrer beiden halbwüchsigen Söhne bewohnt. Später, so war es geplant, sollten Jens und Knut eigene Wohnungen darin ausgebaut bekommen. Dennoch würden im Souterrain immer noch Räume für Personal bleiben.
Claudia empfand es als angenehm, mit ihrem Mann und ihrer Tochter allein zu leben. Ihre Angestellten – Alfons Braake, der Gärtner und Chauffeur, der auch kleinere Reparaturen ausführte, und Frau Beer, die Haushälterin – wohnten in der Stadt und hatten gewöhnlich am Wochenende frei. Nur wenn Krögers eine Party besuchen wollten, bei der getrunken wurde, beanspruchten sie die Dienste des Chauffeurs, und wenn Claudia selber eine Einladung gab, brauchte sie Frau Beers Hilfe. Claudia hatte keinerlei hausfrauliche Ambitionen. Sie konnte einfache oder auch exotische Gerichte für wenige Personen kochen, und am Wochenende tat sie dies auch zuweilen und erlangte damit großes Lob oder nachsichtige Kritik von ihrem Mann und ihrer Tochter. Aber an einem Diner mit Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch hatte sie sich noch nie versucht. Sie war zwar überzeugt, dass sie auch dies schaffen könnte, wenn sie es sich nur ernstlich vornähme. Aber dazu bestand kein Anlass. Frau Beer, die schon in der ersten Ehe ihres Mannes über den Haushalt gewaltet hatte – Rosalind hatte jahrelang gekränkelt, unter Depressionen gelitten und sich nicht zu helfen gewusst –, war eine Meisterin ihres Faches. Manchmal wünschte Claudia sie zum Teufel, weil sie sich so gar nichts sagen ließ.
Von Anfang an hatte sie daher wohlweislich darauf verzichtet, ihr irgendwelche Anordnungen zu geben. Sie ahnte, wie viel der fast fünfzigjährigen Frau an ihrer Selbstständigkeit lag. Aber auch sehr bescheiden vorgetragene Wünsche wurden regelmäßig abgeschmettert. Zuweilen ärgerte sich Claudia so, dass sie nahe daran war, ihrem Mann vorzuschlagen, Frau Beer zu kündigen. Da sie jedoch wusste, dass er mit ihr durchaus zufrieden war, auch zugeben musste, dass der Haushalt nicht besser klappen könnte, hatte sie dieses Thema noch nie angeschnitten.
Als sie jetzt in die geräumige, lichtdurchflutete Diele trat – mit hellen skandinavischen Möbeln ausgestattet, die sich hübsch von dem roten Steinfußboden abhoben –, war von der Haushälterin nichts zu sehen. Am liebsten wäre Claudia gleich nach oben gegangen, aber sie hielt es doch für unhöflich, sich später an den gedeckten Tisch zu einem Diner zu setzen, an dessen Vorbereitungen sie überhaupt keinen Anteil gehabt hatte. Also schritt sie durchs Wohnzimmer – mehrere Gruppen niederer Ledersessel waren um Tische mit Stein- und Glasplatten gruppiert, bauchige Lampen auf hübschen Sockeln und überall Vasen mit Sommerblumen verteilt – und betrat das Esszimmer.
Hier stand ein langer, für sechs Personen ausgezogener Tisch mit hochlehnigen Stühlen aus dunklem Holz, in der Ecke neben dem Fenster eine große Kristallvase mit einem üppigen Strauß langstieliger gelber Rosen. Der Tisch war mit weißem Damast gedeckt, blau gemustertem Porzellan aus der Kopenhagener Manufaktur und schwerem Silberbesteck. Vor jedem Gedeck stand eine Reihe von Gläsern und in der Mitte ein hübsches Blumenarrangement, niedrig genug, damit es den Blick über den Tisch nicht behindern konnte.
Frau Beer kam, in einem leichten Baumwollkleid, eine bunte Schürze vorgebunden, aus der Küche. Sie hatte das braune Haar, wie immer, streng zurückgebürstet und im Nacken zu einem Knoten geschlungen, wodurch ihre sehr hohe Stirn noch betont wurde. Ihr blasses Gesicht zeigte weder eine Spur sommerlicher Bräune noch die mindeste Rötung von Eifer.
»Guten Abend, gnädige Frau«, sagte sie ohne ein Lächeln, »entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht empfangen habe …«
»Aber, ich bitte Sie, Frau Beer!«, entgegnete Claudia rasch. »Ich weiß doch, dass Sie heute alle Hände voll zu tun haben!« Ihr Blick überflog den festlich gedeckten Tisch.
»Ich habe mir erlaubt, die Kerzen heute wegzulassen. Bei dieser Hitze hatte ich Bedenken.«
»Sie hatten vollkommen recht. Es ist alles perfekt wie immer.«
»Gegessen wird um acht. Ich hoffe nur, dass alle pünktlich sind.«
»Werden sie schon, Frau Beer, nur keine Sorge!« Lächelnd fügte sie hinzu: »Und wenn nicht, setzen wir uns eben allein zu Tisch.«
Diese Bemerkung kam bei der Haushälterin nicht an. Sie presste die schmalen Lippen zusammen und ihre kleinen braunen Augen funkelten missbilligend.
»Das war doch nur ein Scherz!«, erklärte Claudia rasch. »Ich wollte Ihnen damit klarmachen, wie viel uns daran liegt, ihr bestimmt köstliches Roastbeef nicht verbrutzeln zu lassen.«
»Ich gebe das Fleisch natürlich erst in den Ofen, wenn die Gäste da sind.«
»Ach so. Ja. Natürlich!«, sagte Claudia und kam sich ein wenig töricht vor. »Ich gehe jetzt nach oben, um mich frisch zu machen.«
»Der Herr Professor ist in seinem Arbeitszimmer.«
»Danke, Frau Beer.«
Imogens Reich bestand aus einem gemütlichen Raum mit schrägen Wänden und einem halbrunden Fenster, durch das man den breiten grauen Fluss mit den Schiffen darauf beobachten konnte. Sie tat es oft, Stunde um Stunde, mit nie nachlassender Begeisterung. Die gemauerte Bank unter dem Fenster war mit bunten Kissen belegt. Ein weiteres Kissen ins Kreuz gestopft, die Beine angezogen, pflegte sie dort zu sitzen und vor sich hin zu träumen oder zu lesen. Aber heute war keine Zeit dazu. Frau Beer hatte ihr schon das frisch gewaschene und gebügelte weiße Batistkleid mit einer dazugehörigen breiten Schärpe aus glänzender rosa Taftseide aufs Bett gelegt.
Sie würde die Gäste begrüßen müssen. Imogen hasste diese Zeremonie, weil sie sich dabei immer wie etwas Exotisches vorkam. Sie wusste, dass es nicht an ihr lag. Erwachsene hatten einfach ihre eigene Art, mit Kindern umzugehen, dumme Bemerkungen zu machen oder alberne Fragen zu stellen.
Claudia war nicht so. Sie behandelte sie immer wie eine Gleichberechtigte und wie ein mit Vernunft begabtes Wesen. Das war sehr angenehm, aber auch anstrengend.
Imogen liebte ihre Mutter und sie bewunderte sie maßlos. Claudia war so schön, so klug und so selbstsicher, sie war ganz einfach wunderbar. Aber man konnte sich ihr nicht heulend in die Arme werfen, man durfte keinen Wutanfall bekommen oder nach einem schlechten Traum zu ihr ins Bett flüchten.
Nicht, dass Imogen zu Alpträumen neigte – wenn es doch einmal geschah, war sie erfahren genug, sich mit der Erkenntnis zu beruhigen, dass Träume nichts zu bedeuten hatten. Sie heulte auch nie, schrie nicht oder stampfte mit dem Fuß auf. Sie wollte das auch gar nicht und fand es schlimm, wenn andere sich schlecht betrugen. Aber es irritierte sie, dass es Claudia gegenüber oder auch nur in ihrer Gegenwart ganz unmöglich war.
Natürlich war das nur ein vages Gefühl, das sie nicht in Worten hätte ausdrücken können. Sonst hätte sie es der Mutter erklärt. Man konnte mit Claudia über alles sprechen, das war das Gute an ihr. Nie lachte sie Imogen aus oder fertigte sie mit einem »Das verstehst du noch nicht« ab.
Obwohl Imogen wusste, dass sie sich sputen musste, kniete sie sich doch – nur für einen Augenblick – auf die Fensterbank und starrte auf die Elbe hinaus, wo gerade ein riesiger Tankzug auf das offene Meer hinausfuhr. Ja, dachte sie, man kann mit Claudia über alles sprechen, nur über Vater nicht. Warum hatten Michael und sie sich scheiden lassen? Warum nur? Wie oft hatte sie sich das schon gefragt, wie oft versucht, das herauszubringen. Aber Claudia erklärte immer nur: »Wir haben uns nicht vertragen. Es gibt eben Menschen, die sich beim besten Willen nicht vertragen können.«
Und wenn Imogen dann bettelte: »Erzähl mir doch mal, wie es war!«, bekam sie immer nur zur Antwort: »Das ist schon so lange her. Ich habe es vergessen und ich will nicht mehr daran denken.«
Komisch war, dass auch der Vater nicht darüber reden wollte. »Wir waren noch zu jung«, pflegte er zu sagen, »ich war einfach noch unreif damals. Aber deine Mutter hatte bestimmt keine Schuld. Sie ist eine wunderbare Frau.«
Das war eine Erklärung, die die Tochter nicht überzeugen konnte.
Auf der Elbe tutete ein Ausflugsdampfer, der dem Tanker entgegenkam. Das Geräusch schreckte Imogen aus ihren Gedanken. Sie fuhr zusammen und kletterte von der Bank.
In ihrem Badezimmer, einem hübschen weiß-rosa gekachelten Raum, stopfte sie ihr verschwitztes Trikot in den Wäschepuff, zog T-Shirt, Jeans und Unterhose aus und tat sie dazu. Jetzt stand sie splitternackt da. Sie hätte sich gern einmal richtig betrachtet, aber es gab keinen großen Spiegel. Doch sie wusste ja von den Spiegelwänden im Ballettsaal her, wie sie aussah. Sie konnte sich nichts über ihre Figur vormachen. Sie war spindeldürr. Sie betastete ihre Brust. Nicht einmal ein Ansatz für eine mögliche spätere Rundung.
»Sei froh, dass du so schlank bist!«, pflegte Claudia zu sagen. »Schlanke Kinder werden auch später selten dick.« Die Mutter verstand nicht, dass sie ja nicht pummelig sein wollte wie Kersten, sondern weiblicher. Ihr Körper, fand sie, glich dem eines durchtrainierten Jungen, kein Gramm Fett, nur Muskeln – schöne Muskeln, wenn man Muskeln mochte. Aber sie mochte sie nun einmal nicht.
Ob sie ihre Ballettstunden aufgeben sollte? Aber wie sollte sie ihre Mutter davon überzeugen, dass sie keine Lust mehr hatte? Außerdem stimmte es ja gar nicht. Das Ballett machte ihr Spaß. Sie fühlte sich nie wohler, als wenn sie tanzen konnte. Selbst die simpelsten Übungen führte sie mit Konzentration und Freude aus, die simpelsten und auch die schwierigsten. Ein Lob der strengen Frau Kern bedeutete ihr mehr als jede Anerkennung in der Schule.
Außerdem konnte das Ballett nicht an ihrer flachen Linie schuld sein. Andere Mädchen, die sogar noch länger dabei waren und nur ganz wenig älter als sie selber, zeigten schon sehr hübsche Rundungen. Imogen seufzte schwer, steckte sich die langen Haare mit drei großen Rundkämmen hoch und ging unter die Dusche.
Claudia hatte sich die Haare gewaschen. Sie saß, nur mit einem Slip bekleidet, auf dem gepolsterten Hocker vor dem Frisiertisch und bearbeitete ihre dunkle, kurz gehaltene Mähne mit Föhn und Rundbürste, um sie in Form zu bringen.
Im Spiegel sah sie ihren Mann vom Ankleideraum her eintreten. Sie hatten sich schon vorher kurz begrüßt, als er noch im Arbeitszimmer hinter seinem Schreibtisch gesessen und sich, umgeben von Bücherstapeln, Notizen gemacht hatte. Als er jetzt ihr Schlafzimmer betrat, war er barfuß, trug aber schon seine Smoking-Hose und darüber sein weißes, gefälteltes Hemd, das er noch nicht eingesteckt hatte. Mit der linken Hand nestelte er an seiner rechten Manschette.
»Kann ich dir helfen, Knut?«, fragte sie lächelnd, ohne jedoch ihre Tätigkeit zu unterbrechen.
»Wenn ich dich darum bitten darf.«
»Wieder der dumme Manschettenknopf?«
»Du sagst es.« Er stand nun dicht hinter ihr, neigte sich und küsste sie auf die schön geschwungene, goldbraune Schulter. Sie war überrascht. Impulsive Zärtlichkeiten waren nicht seine Art. Als er sich aufrichtete, war sein Gesicht leicht gerötet und der Ausdruck seiner blauen Augen verriet Begierde.
Claudia schaltete den Föhn ab, ließ die Bürste fallen, wandte sich ihm zu, legte ihm die Arme um den Hals und bot ihm ihren Mund. Da sie die Leidenschaft seines Kusses erwiderte, hob er sie hoch und trug sie zum Bett.
Sie liebten sich mit der Innigkeit von Eheleuten, deren Körper sich vertraut waren und die die Bedürfnisse des anderen seit Jahren kannten.
»Ich habe mich wie ein Schuljunge benommen«, sagte Knut darauf beschämt.
Sie lachte. »Wie ein ziemlich großer, ausgewachsener Junge, möchte ich sagen.«
»Es tut mir leid, Claudia.«
»Mir überhaupt nicht. Ich liebe Spontaneität.«
»Es war, fürchte ich, nicht gentlemanlike.«
»Was du auch tust«, sagte sie zärtlich, »ein Gentleman bist du immer.« Sie wusste nur zu gut, dass das leichteste Zurückzucken ihrerseits, der geringste Hauch von Abwehr es nicht zu diesem Ausbruch der Leidenschaft hätte kommen lassen. »Wahrscheinlich bin ich schuld«, gestand sie.
»Du bist einfach zu schön!«
Sie gab ihm einen leichten Kuss auf die Schläfe. »Nicht halb so schön, wie ich sein möchte. Lass mich jetzt mein Haar richten und mich anziehen. Wenn ich fertig bin, komme ich zu dir und helf’ dir mit dem Manschettenknopf. Du musst ein frisches Hemd anziehen.« Sie schwang sich vom Bett. Der schwere, goldene, erst halb eingeknöpfte Manschettenknopf war auf den Teppichboden gefallen. Claudia entdeckte ihn und legte ihn auf ihre Frisiertoilette. »Hier ist er, der Schlingel! Ich behalte ihn bis gleich.«
Er war ebenfalls aufgestanden und hob die Hose auf, die er achtlos abgestreift hatte. »Mir scheint, die hat keinen Schaden genommen.«
Sie hatte wieder begonnen, sich mit ihrem immer noch feuchten Haar zu befassen. »Um so besser!«, rief sie ihm über das Summen des Föhns hinweg zu.
Er strich sich über sein zerknittertes Hemd. »Drei Hemden an einem Tag. Wenn wir das öfter machen, wird die Beer uns kündigen.«
Sie fand, dass er, wie er so dastand, mit dem weißen Smoking-Hemd, das gerade den Po bedeckte und seine strammen, braungebrannten Beine freigab, tatsächlich wie ein Schuljunge wirkte. Er blickte halb reuevoll und halb verschmitzt drein, wie ein Junge nach einem gelungenen Streich.
»Wegen der Beer«, rief sie, »musst du dir gewiss keine Gedanken machen. Die betet dich doch an.«
»Ach, meinst du?«, sagte er zerstreut. »Also, ich weiß nicht.« Die Smoking-Hose über dem Arm, ging er zur Tür. »Ich denke, wir sollten uns jetzt wohl beeilen.«
Als sie allein war, ließ Claudia Bürste und Fön sinken und betrachtete ihr Gesicht im Spiegel. Ihre Haut glühte und ihre tiefblauen Augen strahlten. Es fiel ihr schwer, sich streng zu mustern.
›Was bin ich nur für eine!‹, dachte sie. ›Zwei Männer an einem Nachmittag. Wenn ich ein Kind bekäme, wüsste ich nicht einmal, wer der Vater ist. Keine gute Organisation. Aber wie hätte ich mich Knut entziehen können? Ich liebe ihn doch auch, mehr noch sogar als den anderen. Mit Ralf, das ist ja nur eine Affäre, die enden wird, wie sie begonnen hat. Der Mann, zu dem ich gehöre, ist und bleibt Knut.‹
Imogen war schon in ihr weißes Batistkleid geschlüpft. Sie saß auf der Fensterbank und zerrte mit Kamm und Bürste an ihren langen blonden Haaren, die sich wieder einmal hoffnungslos verheddert hatten. Dabei wollte sie heute Abend für ihren kurzen Auftritt bei den Gästen besonders schön sein.
Als die Tür sich öffnete, ließ sie Kamm und Bürste sinken und atmete auf.
Claudia trat in einem weißen Seidenkleid ein, das ihre nackten, makellosen Schultern freigab.
»Endlich!«, stieß Imogen erleichtert aus.
Claudia lächelte sie versöhnlich an. »Tut mir leid, ich habe mich verspätet.« Ihr Gesicht war sehr sorgfältig zurechtgemacht; Lidschatten ließen ihre tiefblauen Augen noch ausdrucksvoller erscheinen.
»Das habe ich gemerkt!«, erwiderte Imogen.
»Steh schnell auf, damit ich dir die Schärpe umbinden kann.«
Imogen folgte, und während die Mutter ihr die Schärpe im Rücken zu einer großen Schleife knotete, die sie sorgfältig zurechtzupfte, schnupperte sie den herben Duft ihres Parfums.
»Hui!«, sagte Imogen. »Hast du dich aber fein riechlich gemacht.«
Claudia ging nicht auf diesen Scherz aus frühen Kindertagen ein. »Beim Frisieren kann ich dir leider nicht helfen. Professor Weber und seine Frau sind schon da.«
»Dann geh’ ich überhaupt nicht runter«, erklärte Imogen mit einem Anflug von Trotz.
Claudia richtete sich auf. »Wie du willst. Aber ich finde, du solltest dich nicht so anstellen. Im Allgemeinen kommst du doch ganz gut mit deinen Haaren zurecht. Du kannst dir Zeit lassen.« Und damit war sie schon wieder aus dem Zimmer.
Tränen der Enttäuschung waren in Imogens Augen gestiegen. Sie fühlte sich im Stich gelassen. Sie war nahe daran, sich quer über ihr Bett zu werfen und in die Kissen zu heulen.
Aber für so ein Benehmen war sie doch wirklich schon zu groß. Sie glaubte ja auch gar nicht, dass Claudia ihr absichtlich nicht geholfen hatte. Sie hatte sich ja auch nur ausnahmsweise verspätet. Das passierte ihr sonst nie.
Imogen fasste sich rasch wieder. Sie überlegte, was sie jetzt tun sollte. Natürlich brauchte sie nicht hinunterzugehen. Dann musste sie ihr schönes Kleid aber sorgfältig über einen Bügel und in den Schrank hängen. Wenn sie es grundlos zerknitterte, würde Frau Beer böse werden, und das mit Recht.
Imogen wollte sich schon für diese Lösung entscheiden. Die Möglichkeit, es sich in ihrem Zimmer gemütlich zu machen, war verlockend genug. Sie brauchte auch kein schlechtes Gewissen dabei zu haben. So wichtig, dass Claudia oder Onkel Knut enttäuscht sein oder die anderen sie vermissen würden, war sie nun auch wieder nicht.
Aber wenn sie oben blieb, bekam sie natürlich nichts von dem guten Essen. Eine Möglichkeit, sich ungesehen in die Küche zu schmuggeln, gab es nicht. Und sie hatte auch noch einen anderen guten Grund dafür, doch besser unten zu erscheinen. Sie wusste, dass Claudia es für praktischer und vernünftiger hielt, wenn sie sich das lange Haar abschneiden ließ. Sie lag ihr damit zwar nicht in den Ohren, weil es nicht ihre Art war, andere Menschen gegen ihren eigenen Willen beeinflussen zu wollen.
Imogen liebte ihr Haar, wenn sie sich auch einen etwas kräftigeren Farbton gewünscht hätte. Jedenfalls war es das Einzige, was ihr an ihr wirklich gefiel, und sie wollte es keinesfalls kürzer tragen. Es tat ihr schon weh, wenn Claudia hin und wieder auch nur die Spitzen abschnitt. Zu ihrer eigenen Überraschung stellte sie fest, dass sie schon wieder dabei war, ihre Haare mit Kamm und Bürste zu bearbeiten.
Als Imogen ins Wohnzimmer trat, saßen Claudia, Knut und ihre Gäste schon vor halb geleerten Gläsern beisammen und sprachen lebhaft durcheinander. Zunächst beachtete niemand das Mädchen. Sie blieb etwas schüchtern nahe der Tür stehen und nutzte die Gelegenheit, die Erwachsenen zu beobachten.
Onkel Knut und Onkel Sven trugen beide einen eleganten, leichten Tropensmoking. Sie sahen sich sehr ähnlich, nur war Sven schwerer und hatte nicht so freundliche Augen wie Knut. Tante Lydia war sehr schlank, fast hager – Imogen wusste, dass sie Diät hielt, was sie sehr dumm fand. Ein bisschen voller hätte sie sicher besser ausgesehen, und das rote Kleid, das sie trug, war zu jugendlich für eine Dame, genau wie ihr blondiertes Haar mit Dauerwelle. Sie konnte an Claudias Schönheit nicht einmal im Entferntesten heranreichen, gab sich aber wie eine Königin. Sie hielt sich viel darauf zugute, dass sie ihrem Mann zwei Söhne zur Welt gebracht hatte, zwei »Stammhalter«, wie sie es nannte. Claudia hatte Imogen einmal erklärt, was man darunter verstand, aber dem Mädchen schien der Ausdruck trotzdem albern.
Professor Weber war ein alter Herr mit weißem Haar und einer Brille mit Goldrand; er war hager und saß gebückt. Seine Frau war mollig und heiter, viel kleiner als er, und schien trotzdem gut zu ihm zu passen. Die beiden Webers waren im Gegensatz zu den anderen dunkel gekleidet, er im Smoking, sie in einem schwarzen, hochgeschlossenen Kleid, was nicht recht zu dem Rahmen und zu der sommerlichen Hitze passen wollte. Aber sie bemerkten das anscheinend gar nicht, gaben sich gelassen und würdevoll. Imogen konnte sich die beiden gut als Großeltern vorstellen.
Tante Lydia und Frau Weber trugen eine Menge kostbaren Schmuck. Imogen hatte den Eindruck, dass sie das nicht hübscher machte. Sie taten es wohl, weil sie zeigen wollten, wie viel sie wert waren. Der kleine Brillant an Claudias Hals dagegen funkelte auf ihrer glatten Haut, als würde sie selber ihn zum Leuchten bringen.
Obwohl die Fenster offen standen, stand die Luft im Raum. Alle außer den Webers rauchten, die Blumen und die Damen verbreiteten intensive Düfte.
Imogen musste niesen.
»Ach, da bist du ja!«, rief Claudia, stand auf, nahm sie bei der Hand und führte sie zu Professor Weber. »Herr Professor, darf ich Ihnen meine Tochter vorstellen?«
Imogen machte einen artigen Knicks.
»Du bist also die kleine Imogen Kröger!«, sagte Frau Weber herzlich.
Einen Augenblick, der ihr unendlich lang zu sein schien, stand Imogen wie versteinert. Sie wollte die alte Dame verbessern, hatte aber Angst, dass das als ungezogen aufgefasst werden könnte.
Claudia nahm sie noch fester bei der Hand. »Imogen von Geldern«, stellte sie richtig. »Imogen ist meine Tochter aus erster Ehe.«
Es wurde sehr still im Raum.
Dann wiederholte Frau Weber lächelnd: »Von Geldern? Dann ist dein Vater vielleicht Michael von Geldern? Der Cartoonist?«
»Sie kennen ihn?«, rief Imogen entzückt.
Die alte Dame hatte Imogen nur mit einem Scherz aus der Verlegenheit helfen wollen. Jetzt sagte sie überrascht: »Er ist es also tatsächlich?«
»Ja!«, sagte Imogen stolz. »Woher kennen Sie ihn?«
»Kennen ist übertrieben. Mein Sohn und mein Enkel lieben seine Zeichnungen. Sie haben mir erklärt, dass das verschlungene M. v. G. Michael von Geldern heißen soll.«
Claudia fand es an der Zeit, das ihr unliebsame Gespräch abzubrechen. »Du hast Tante Lydia und Onkel Sven noch nicht begrüßt«, erinnerte sie.
Imogen wandte sich Onkel und Tante zu und gab ihnen die Hand. »Guten Abend, Tante Lydia … guten Abend, Onkel Sven!«
»Du hast dich ja richtig fein gemacht, Irmy«, bemerkte Lydia.
Wenn Imogen es schon nicht mochte, Immy genannt zu werden, so hasste sie es geradezu, wenn ihr Name zu Irmy verballhornt wurde. »Imogen«, verbesserte sie nachdrücklich, obwohl sie aus Erfahrung wusste, dass es doch nichts nutzte. Lydia würde bei ihrem »Irmy« bleiben, sei es nun aus Bosheit, Trägheit oder Gedankenlosigkeit.
Jetzt lächelte sie auch nur süffisant.
»Komm einmal her zu mir, Imogen!«, bat Knut.
Sie lief zu ihm hin und schmiegte sich an ihn, als er ihr sanft den Arm um die Taille legte. »Ja, Onkel Knut?«
»Wie wäre es – hättest du nicht Lust, heute einmal mit uns zu essen?«





























