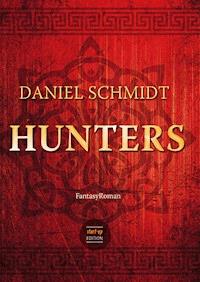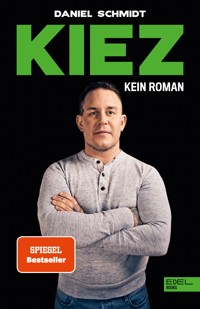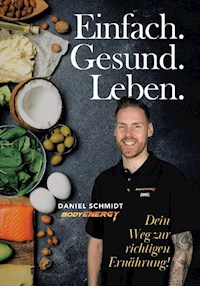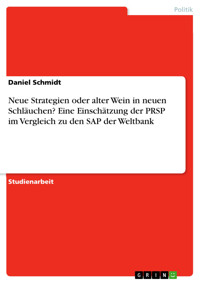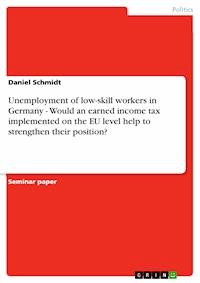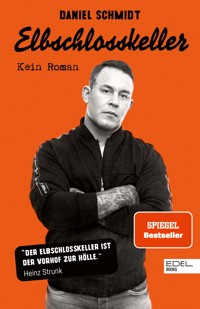
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Seit seinem 18. Lebensjahr steht Daniel Schmidt, 33, in Hamburg-St. Pauli als Wirt hinterm Tresen. Und zwar in zweiter Generation. Nichts anderes wollte er jemals werden. Der Elbschlosskeller, direkt gegenüber vom "Goldenen Handschuh", ist seit über 50 Jahren ununterbrochen geöffnet und gilt als härteste Kneipe Deutschlands. Hier gehen Obdachlose, Prostituierte, gestrandete Existenzen, aber auch Millionäre, Sozialpädagogen oder Anwälte ein und aus. Einzigartige Schicksale, Dramen und Tragödien spielen sich ab. Eine düstere, faszinierende Parallelwelt, in der sich nicht nur traurige, sondern auch viele schöne, weil zutiefst menschliche Momente abspielen. "Die Menschen kommen zu uns, damit sie sie selbst sein können", sagt Daniel Schmidt, der nahezu täglich Extremsituationen erlebt – oft, aber nicht immer wird er damit fertig. Von seinem unglaublichen Leben erzählt er brutal ehrlich, überraschend reflektiert und mit ganz viel Empathie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für meine Schwester
Jana-Joy
und meinen Patenonkel
Kai-Uwe
Vier Stufen
Im Elbschlosskeller landen die Gestrandeten, die Erledigten, die Einsamen. Wir lassen jeden rein. Das sieht man, das riecht man auch. Ich bin 34 Jahre alt, Wirt mit Leib und Seele und mit dem Elbschlosskeller groß geworden. Ich erzähle meine Geschichte und die des Elbschlosskellers, einer Institution für verlorene Seelen. Keiner ist davor gefeit, hier zu landen.
Oft genug habe ich gesehen, wie das Schicksal genau dort zugeschlagen hat, wo man es am wenigsten erwartet hätte. Tiefer runter als in den Elbschlosskeller geht es nicht, und doch geht es irgendwie weiter, manchmal auch aufwärts, nicht immer, aber es kommt vor. Bei uns kann jeder so sein, wie er ist. Wir sind eine Familie. Mal ist es leise, mal laut. Mal beängstigend, mal dreckig, mal wunderschön. Alle, die gesellschaftlich geächtet sind, gehen hier ein und aus: Obdachlose, Prostituierte, Süchtige, Kaputte. Und dann gibt es auch die anderen: Millionäre, Sozialpädagogen, Lehrer, Hausfrauen. Aber die sozialen Unterschiede lösen sich Im Elbschlosskeller auf. Hier sind alle Menschen gleich.
Vier Stufen führen runter in den Elbschlosskeller. Vier Stufen und du bist in einer anderen Welt. Jedes Mal, wenn ich da hinuntergehe, passiert etwas mit mir. Der Elbschlosskeller ist alles und nichts für mich. Heimat – ja, das trifft es. Mit jedem, der da unten hockt, fühle ich mich irgendwie verbunden. Damit meine ich unsere Stammgäste, nicht die Horden, die jedes Wochenende in St. Pauli einfallen und sich in die Seitenstraßen der Reeperbahn ergießen. Ich rede von denen, die auf dem Kiez leben und jeden Tag im Elbschlosskeller sitzen. Viele sind arbeitslos, sie kommen schon tagsüber. Andere trinken bei uns nach Feierabend ein Bier. Oder mehr. Sobald ich die Schwelle übertrete, überfallen mich die Leute. War ich ein paar Tage nicht da, heißt es: „Mensch, Daniel, du musst hier wieder mehr stehen“, und damit haben sie recht. Ich sehe mich manchmal als weißes Licht in all dem Dunkel. Das soll nicht arrogant klingen. Damit meine ich die Glut in meinem Herzen. Manchmal sitzen Leute vor mir im Elbschlosskeller, die sind kalt, deren Glut ist erloschen. Aber ich trage so viel davon in mir, dass ich denke, ich kann ihr Feuer mit meiner Glut wieder entfachen. Indem ich ihnen meine Energie und mein Mitgefühl gebe. Als ich mit 18 hinter der Theke anfing, hieß es immer noch: „Lothar, Lothar!“ Damit war mein Vater gemeint. Jahrzehntelang war er der Zampano im Elbschlosskeller. Er hat den Laden zu dem gemacht, was er heute ist.
Die Menschen im Elbschlosskeller, von denen ich erzählen werde, brauchen einen hinterm Tresen wie mich. Viele von ihnen haben nichts. Sie waren mal wer und sind jetzt nichts mehr. Oder wie es der schöne Klaus, ein legendärer Lude aus den Achtzigern, mal gesagt hat: „Früher war ich eine große Nummer, heute nur noch eine Nummer.“ Die, die abgestürzt sind, die Verlierer des Lebens, die hinauskatapultiert wurden, ins Abseits, auf die Verliererseite – sie kommen nicht nur in den Keller, um ihr Bier zu trinken. Klar gehört das dazu, aber was sie vor allem suchen, ist Geborgenheit. Sie wollen sagen können: „Ich trinke mein Bier zu Hause, bei einem, der meine Geschichte kennt. Einer, der selbst eine Geschichte hat.“ Ich biete ihnen dieses Zuhause, ich bin gerne ihre Familie. Es sind die Emotionen der Menschen, die mich diese vier Stufen nach unten ziehen.
Seit fast 70 Jahren gibt es den Elbschlosskeller schon. Hamburger Berg Nummer 38, schräg gegenüber vom Goldenen Handschuh. Das ist eine Menge Kiez-Geschichte. Wir sind eine der ältesten Kneipen Hamburgs. Und nicht nur das: Seit der Eröffnung im Jahr 1952 hat der Keller sieben Tage die Woche geöffnet, rund um die Uhr. Immer. Mit einer Ausnahme, das war 2016, als der Laden über mehrere Tage jeweils für einige Stunden geschlossen hatte. Grund war eine ernste Familienangelegenheit.
Im Grunde sah der Keller damals schon so aus wie heute. Anfangs gab es noch weiße Tischdeckchen und Teelichter, bis mein Vater kam und aus dem Laden eine Partyhölle machte. Ansonsten wurde kaum etwas verändert. Derselbe Tresen, dieselbe Holzvertäfelung.
Die Rückenspeckpatina an den Wänden, die gab’s damals noch nicht. Diese Wände erzählen viel. So viele Spritzer Flüssigkeit, so viel Lebensenergie, die hier abgeladen wurden. Du kommst rein und kommst nicht mehr weg, versackst. Manchmal sind hier Fremde von außerhalb, Leute mit ganz normalen Jobs, und die bleiben drei Tage lang, obwohl sie sich zunächst fragten, wo sie hier nur gelandet sind. Und dann kommen sie immer wieder. Es ist ein bisschen wie schwarze Magie. Der Hamburger Berg, unsere Straße und seine Kneipen, ist eine Art Bermudadreieck, in das es dich reinzieht wie in einen Strudel. Und der Elbschlosskeller ist das schwarze Loch, in dem man verschwindet. Eines Tages stand ein gutaussehender junger Mann an meiner Theke. Er hatte was im Kopf, stand mit beiden Beinen im Leben, hatte einen guten Job, eine eigene Wohnung, er war anders als die meisten unserer Stammkunden, das fiel mir gleich auf. Er kam wieder. Und wieder. Er sieht immer noch gut aus, aber inzwischen ist er obdachlos. Irgendwas ist schiefgelaufen. Ich fragte ihn, warum er zu uns komme, und er meinte, der Elbschlosskeller sei ein Ort, an dem er für voll genommen werde: „Ich habe mich in meinem Leben noch nie so frei gefühlt.“ Keine Pflichten mehr, in den Tag hinein leben, nicht an morgen denken müssen. Das sei zwar kein Zustand auf Dauer, irgendwann wolle er wieder einen Job, eine Wohnung, aber jetzt nicht, jetzt genieße er seine Situation und lasse sich einfach treiben.
Elbschlosskeller in den Siebziger Jahren
In meinem eigenen Leben war es oft genauso. Wenn mich etwas richtig zurückgeworfen hat, ist daraus etwas Neues entstanden. Die schönste Blume wächst im tiefsten Schlamm, sagt man. Wie Phoenix aus der Asche. Als meine kleine Schwester starb, verpasste mir die Trauer einen so krassen Energieschub, dass ich sechs Tage die Woche zum Thaiboxen gehen musste. Ich hatte damals die beste Fitness meines Lebens. Ich war vom Kopf her stark und klar wie nie zuvor, begann eine Lehre, direkt nach Janas Tod, schrieb Bestnoten in der Berufsschule, zog wieder zu meiner Mutter, unser Verhältnis besserte sich. Ich wohnte spartanisch, verzichtete auf vieles, was mir bis dahin wichtig erschienen war. Ich besaß zwei Paar Schuhe, zwei Hosen, zwei T-Shirts, ging jeden Abend zur gleichen Uhrzeit ins Bett und stand früh am Morgen auf, funktionierte wie ein Uhrwerk. Körper, Geist und Seele waren eine Einheit. Damals war ich 26. Und Ähnliches sehe ich im Elbschlosskeller, dieses Von-oben-nach-unten und Von-unten-nach-oben, Genie und Wahnsinn, Hass und Liebe, hell und dunkel – das eine bedingt das andere, so unterschiedlich und trotzdem gleich. All das erlebst du im Keller. Es ist der tiefste Abgrund, aber hier zeigen sich auch die schönsten Dinge. Liebe, Glück. Hier finden Menschen zusammen, manche haben bei uns sogar geheiratet. Die, die nichts besitzen, teilen ihr Weniges. Ich habe Menschen kennengelernt, die, obwohl sie keinen Schuh am Fuß, keinen Cent in der Tasche hatten – ihr letztes Hemd für einen anderen gaben. Du siehst ihnen an, dass sie tagelang nichts gegessen haben. Irgendwie kriegen sie schließlich das Geld für ein Dreieckssandwich von Penny zusammen, dann kommt jemand, der ähnlich fertig ist, und dem geben sie die Hälfte ab. Solche herzergreifenden Momente erlebe ich tagtäglich. Viele, die zu uns kommen, sind so tief unten. Alles wurde ihnen genommen, die Klamotten, die Wohnung, die Familie, die Würde, sie waren im Knast, wurden missachtet, misshandelt. Nicht wenige von denen waren aber auch mal ganz oben. Firmeninhaber mit Familien, wie sie im Bilderbuch stehen, eine einzige Idylle. Und dann stranden sie im Elbschlosskeller.
Es gibt diese Tage, an denen 30 Gestalten vor dir sitzen. Die schmutzig sind, die nicht gut riechen, gespenstisch aussehen, sich über Blödsinn unterhalten und rumstreiten. Und auf einmal ist da ein Moment von Nächstenliebe, ein Gefühl, das jemand ausstrahlt und das von den anderen empfunden wird. Plötzlich sitzen sie zusammen, teilen ihr Bier und sind glücklich wie am Weihnachtstisch. Sie eint ein Gefühl, das sie von früher kennen und nach dem sie sich zurücksehnen.
Die Geschichte des Elbschlosskellers ist untrennbar mit der Geschichte meiner Familie verbunden. Als ich ein Kind war, sagte meine Mutter: „Wenn dein Vater mal ein Buch über den Elbschlosskeller schreibt, das wird ein Bestseller.“ Ohne zu wissen, was ein Bestseller ist und was es bedeutet, ein Buch zu schreiben, sagte ich: „Mama, ich schreibe eins, wenn ich groß bin.“ Meine Mutter lächelte und meinte: „Ja, du schaffst das, aber nur, wenn du auch daran glaubst.“ So war sie immer. Ein optimistischer Mensch, sehr lebensbejahend. Bis sie krank wurde und ihre Psychosen einsetzten. Aber damals hatte sie ein besonderes Funkeln in ihren Augen und strahlte eine Energie aus, die mich glücklich machte.
Von klein auf war mir klar, dass es bei uns zu Hause anders zuging als in anderen Familien. Ganz deutlich spürte ich das, wenn ich Schulfreunde besuchte. Wir wohnten in einem schönen Hamburger Vorort, aber das Rotlichtviertel von St. Pauli, die Reeperbahn, wo meine Eltern ihr Geld verdienten, war nicht zu leugnen. Wir fielen auf. Allen voran mein Vater. Er war eine echte Erscheinung. Von seiner Optik, den Klamotten, der Frisur, von seinem ganzen Gehabe her. Ich war fünf Jahre alt, als er sich einen Opel Lotus zulegte. Schwarz mit gelben Highlights, Ledersitzen, einem kleinen Lenkrad, Highend-Ausstattung. „Das ist die schnellste Limousine der Welt“, sagte mein Papa, und das war sie auch. Wenn der Opel Lotus vor unserem Haus parkte, kamen die Leute von der anderen Straßenseite rüber und begafften ihn neugierig. Im Kindergarten prahlte ich damit: „Wir fahren die schnellste Limo der Welt!“ So hatte ich es ja aufgeschnappt, aber keiner wollte mir glauben. Die Kindergärtnerin sagte, ich solle mal aufhören, solche Märchen zu erzählen. Als meine Mutter mich abholte, bestürmte ich sie: „Mama, Mama, sag, dass ich nicht spinne.“ Und sie bestätigte: „Ja, unser Auto fährt wirklich so schnell.“ Mit stolzgeschwellter Brust stand ich da, hatte es allen gezeigt. Es war ein geiles Gefühl, zum ersten Mal im Leben hatte ich dicke Eier.
Meine ersten Versuche auf dem Fußballplatz
Noch so eine Sache ist mein Geruchstalent. Ich kann nämlich Betrunkene riechen. Und zwar nicht nur, wenn jemand eine Fahne hat, ich rieche Betrunkene auf 50 Meter Entfernung. Bis heute habe ich diesen Geruch in der Nase, wenn mein Vater nach seiner Kellerschicht nach Hause kam. Ich konnte ihn riechen, bevor ich ihn sah oder hörte. Den Schnaps, das Bier und die Zigaretten, den Elbschlosskeller, ein ganz spezieller Geruch, anders als in anderen Kneipen. Dieses Aroma haftete ihm an. Der Schweiß von 50 Leuten, 300 Zigaretten, Pfeifen, Zigarren, Unmengen von Schnaps. Du hast einen bestimmten Schweißfilm auf der Haut, wenn du aus dem Elbschlosskeller kommst. Alle Poren sind verklebt. Wenn du nach Hause kommst, vorm Duschen einpennst und dann nach drei Stunden aufwachst, tränen dir die Augen von dieser Kellerschmiere.
Nach der Nachtschicht heißt es deswegen für mich sofort: Klamotten aus und ab unter die Dusche. Du machst dich sauber, atmest durch, und dann machst du einen Schritt raus und riechst es vom Fußboden aufsteigen, da, wo du deine Klamotten hingeschmissen hast.
So viele Jahre mache ich das nun schon, so viele Schicksale sind mir im Keller begegnet. Ich bin ein bisschen Seelsorger, Gefühls-Katalysator, Samariter, und ja, ich fühle mich gut in dieser Rolle. Nicht wenig Eigennutz ist dabei. Glück und Liebe sind die einzigen Dinge, die nicht weniger, sondern mehr werden, wenn man sie teilt. Jeder, der Kinder hat, kennt das. Ich komme morgens geduscht und mit sauberen Klamotten in den Keller, ich treffe Typen, die hier seit Tagen sitzen und verdreckt sind, aber es stört mich nicht. Wenn ich da bin, drücke ich die Leute an mich. Mir ist egal, wie sie aussehen, wer sie sind und wo sie herkommen.
Letzte Station, letzter Halt
Hier auf dem Kiez fühle ich mich zu Hause, ich kenne jeden Winkel, jede Gasse, jedes Gebäude, alles weckt Erinnerungen. Wenn ich über den Hamburger Berg, eine Seitenstraße der Reeperbahn, gehe, treffe ich Menschen, die ich von klein auf kenne. Ständig schüttele ich Hände, Kollegen, die nebenan arbeiten, Kellnern, Türstehern, alten Kiezianern, Obdachlosen. Wenn ich um die Ecke gehe, links vorbei an einer weiteren Kaschemme, begegne ich manchmal Werner. Der hat hier zwanzig Jahre lang gearbeitet, bis er zu alt war und „ausgemustert“ wurde. Er läuft über den Kiez und weiß nicht, wohin mit sich. Ein paar Straßen weiter hat früher Susanna gewohnt. Susanna ist meine Partnerin, wir sind nicht verheiratet, aber ich nenne sie meine Frau. Damals, in unserer Anfangszeit, habe ich mich oft aus dem Elbschlosskeller davongestohlen und bin zu ihr in die Wohnung. Egal, ob der Laden voll oder leer war. Ich habe unseren Tischkellner hinter den Tresen gestellt und bin los. Meistens war ich selbst schon ziemlich betrunken. Susanna arbeitete auch auf dem Kiez. Oft sind wir erst noch tanzen gegangen, bevor wir in ihrer Bude landeten und wilden Sex hatten. Sofern ich das noch konnte, je nach Alkoholpegel. Wenn man frisch verknallt ist, dann ist der Sex ein bisschen wilder, alles kribbelt, alles ist wahnsinnig aufregend. Gelegentlich habe ich beim Sex mit ihr die Prostituierten nebenan in der Herbertstraße beobachtet. Das fand ich geil. Von Susannas Wohnung aus hatte man alles gut im Blick. Sie fand das nicht so witzig, als ich ihr das erzählte. Aber ich konnte es nicht verheimlichen, ich hau alles raus, muss alles loswerden. Nach dem Sex schlief ich bei ihr, bis sie mich frühmorgens weckte, damit ich gerade rechtzeitig vor der Ankunft meines Vaters wieder im Elbschlosskeller war. Der kam um acht, um die Abrechnung zu machen. Ich stand dann schon wieder hinter der Theke wie aus dem Ei gepellt, mit gewaschenen Haaren, sauberer Kleidung, gut riechend, und dachte: Papa kriegt nix mit, wie ich ihn austrickse. Da hatte ich mich allerdings getäuscht. Später hat er mir erzählt, dass er genau gewusst habe, was ich so trieb.
Nachts hat St.Pauli seinen ganz eigenen Charme, alles leuchtet und blinkt. Bei Tageslicht lassen sich die schmutzigen Ecken kaum kaschieren. Aber wenn die Sonne scheint, wirkt alles gleich ein bisschen freundlicher. Es sind diese krassen Gegensätze, die ich mag. Es gibt hier nicht nur die Spelunken, die Bettler, die Junkies und die Besoffenen, die von der letzten Nacht übrig sind, sondern auch Kindergärten und Schulen, Kinder gehen Hand in Hand, alt eingesessene Geschäfte, wie von Peppi, dem Friseur, oder Thomas, dem Kiezbäcker. An schönen Tagen sitzen die Menschen in den Straßencafés und trinken ihren Latte Macchiato. Gleich gegenüber an der Ecke das schwule Pornokino, wo sich zu jeder Tages- und Nachtzeit Typen mehr oder weniger verstohlen reinschleichen. Niemand stört sich dran. Jeder kann so sein, wie er will, und tun, was er will.
Was sehr schlimm, richtig massiv geworden ist auf dem Kiez, sind die Drogensüchtigen, die aus anderen Stadtteilen hierhin vertrieben worden sind. In den Hauseingängen stehen sie, kratzen die Reste aus Crackplastiktütchen zusammen. Viele stammen nicht aus Deutschland, sind hierher geflüchtet und auf dem Kiez gestrandet. Anfangs hatten sie noch ein Gesicht, waren gut genährt, sahen einigermaßen gesund aus, und jetzt ziehen sie, zwanzig Kilo weniger, mit eingefallenem Gesicht, wie Untote durch die Straßen, den Blick auf den Boden gerichtet, auf der Suche nach Drogenresten in den Ritzen des Kopfsteinpflasters. Das ist die Realität, und die ist manchmal ganz schön beklemmend.
Für Susanna und mich ist der Elbschlosskeller mehr als nur unser Job. Klar, er zahlt unsere Miete, sichert unserer kleinen Familie – wir haben einen siebenjährigen Sohn – den Lebensunterhalt. Aber uns geht es auch darum, dass die Leute, die zu uns kommen, einfach eine geile Zeit haben. Gerade die Stammgäste, die so wenig geile Zeiten im Leben hatten. Das ist uns wirklich wichtig. Der Elbschlosskeller hat früher auch viele abgeschreckt, das tut er heute immer noch. Er sei asozialer, schmutziger, gewalttätiger als andere Kneipen, das las man in der Presse. Gerade wenn es mal wieder eine Schlägerei oder eine Messerstecherei gegeben hat. Und ja, es geht hart zu, und manchmal hast du einen Typen an der Theke sitzen, der drei Tage oder länger durchgesoffen hat und dementsprechend ausdünstet. Der schreit auch mal seinen Frust raus, ist völlig aufgelöst. Und pullert manchmal daneben, auch dort, wo er gar nicht hinpullern soll. Tatsache ist, und das sage ich voller Überzeugung: Wir sind die sozialste Kneipe der Stadt. Denn wir lassen auch Leute rein, die von den anderen Kneipen abgewiesen werden. Obdachlose, denen du ansiehst, dass du mit ihnen kein Geld verdienst. Und wir lassen Leute bei uns schlafen, auch das lassen andere Kneipen nicht zu. Ist bei uns aber fast schon Tradition. Auch zu Zeiten meines Vaters gaben manche Stammgäste den Elbschlosskeller als postalische Adresse an.
Der Elbschlosskeller besteht aus sechs Räumen: Da ist die Kneipe selbst, mit der langen Theke, mit Tischen, Stühlen und in der Mitte eine Stange zum Tanzen. Vom Schankraum führt links neben der Küche ein schmaler Gang zuerst zum Herren-WC, anschließend zum Getränkelager, zu Damentoilette und Kickerraum, den man durchqueren muss, um ins Büro zu gelangen. Der Kickerraum war früher das Leergutlager. Susanna und ich haben den Raum erst benutzbar gemacht. Wir stellten einen Kicker und eine alte Ledercouch rein. An die Wände haben wir Fotos von verstorbenen Angestellten und von Stammgästen gehängt. Der hintere Raum wird gern genutzt. Tagsüber legen sich manche Gäste da aufs Ohr, wenn sie nicht mehr können. Für andere ist der Kickerraum nicht weniger als ihr Zuhause. Ist teilweise richtig rührend, was ich da erlebe.
BINE, DIE MUTTI
Sabine, Bine, kommt seit dreißig Jahren in den Elbschlosskeller. Noch bevor mein Vater den Laden übernahm, trank sie hier ihr Bier. Alle nennen sie „Mutti“, weil sie immer da ist, vor allem für die jungen Leute, die ihr das Herz ausschütten. Durch einen Hausbrand verlor sie letztes Jahr ihre Wohnung, stand plötzlich auf der Straße. Ich bot ihr an, bei uns zu schlafen, bis sie eine neue Bleibe fände. Bine ist das, was man eine starke Frau nennt. Sie lässt sich nicht gern helfen, will lieber alles alleine regeln. Aber dann nahm sie mein Angebot an, blieb vier Monate. Das Leben hat ihr übel mitgespielt. Sie ist jetzt sechzig Jahre, wuchs in St. Pauli auf. Als Kind galt sie als schwer erziehbar, ihre leibliche Mutter lernte sie nie kennen, sie kam ins Heim. Eine Scheißkindheit sei das gewesen, sagt sie heute. Nach der Schule begann sie eine Ausbildung zur kaufmännischen Angestellten, die sie abbrach, wegen einer persönlichen Krise, über die sie nicht weiter spricht. Sie fing an zu trinken, verlor den Halt. „Ich wurde geschlagen, gemobbt, aber das hat mich nur härter gemacht. Hat mir geholfen, mich später als Frau durchzukämpfen. Ich habe meine Probleme immer selbst gelöst, auch wenn ich auf die Nase gefallen bin.“ Denn das Leben auf dem Kiez sei brutal. Gerade als alleinstehende Frau. Heute habe sie das Saufen im Griff, sie sei nur noch Quartalstrinkerin, sagt sie. Wenn sie säuft, versackt sie für mehrere Tage bei uns. Bine ist ein robuster Typ, harte Gesichtszüge, graue Haare, aber wenn sie lacht, fällt alle Härte von ihr ab. Ein guter Mensch. Ihr Herz ist groß. Bine hat immer ein offenes Ohr, aber sie redet dir nie nach dem Mund. Sie sagt dir klipp und klar, was Sache ist, auch wenn es nicht das ist, was du hören willst. Als sie im Keller wohnte, kam eines Tages Maria (Name geändert) neu dazu. Eine sehr alte Frau, die auch kein Zuhause mehr hatte. Sabine teilte „ihre“ Couch mit Maria. Wenn sie sah, dass Maria müde war, half sie ihr, sich auf die Couch zu legen, deckte sie zu und machte das Licht aus, sorgte dafür, dass kein anderer Gast sie störte. Während sie selbst auf einer harten Holzbank schlief, nur damit die Ältere den besseren Platz hatte.
Da fällt mir eine ähnliche berührende Szene ein, als ich mal sah, wie unsere Angestellte Tina meiner Frau ihr Herz ausschüttete.
TINA, DIE PANZERFAHRERIN
Tina ist um die 50 und hat ihr Leben auf dem Kiez verbracht, eine kleine Person mit langen krausen Haaren. Und einem abgefahrenen Hobby: Panzerfahren. Sie war früher bei der Bundeswehr, keine Ahnung, was genau sie da machte, aber heute noch fährt sie einmal im Jahr irgendwohin zum Panzerfahren. Als Kind wurde sie von ihrem Vater missbraucht und bekam eine Tochter von ihrem eigenen Erzeuger. Später wurde sie von einem Freier vergewaltigt, und wieder schwanger. Und dann traf sie die große Liebe, einen Luden. Mit dem zusammen vergewaltigte sie eine andere Frau, dafür wurde sie verurteilt. Kam in den Knast. Als sie rauskam, war der Lude tot. Vor ein paar Jahren gaben wir Tina einen Job im Elbschlosskeller. Sie arbeitet an der Theke. Wenn sie betrunken ist, kommt alles hoch, was ihr widerfahren ist. Dann ist sie einfach nur fertig, lässt ihre Stimmungen raus. Und das Bild, das ich vor mir sehe, ist das, wie Tina auf Susannas Schoß eingeschlafen ist, nachdem sie ihr das Herz ausgeschüttet hat. Wie in der Obhut einer großen Schwester. Susanna holte eine Decke und legte sie Tina über die Schultern. Gab ihr für einen Moment das, was sie am wenigsten im Leben kennt: Geborgenheit.
Noch mal zurück zu Maria, der alten Dame. Sie hat mir ihre Geschichte nie verraten. Ich denke, sie will nicht darüber reden, weil ihr das Leben, das sie führt, peinlich ist, weil sie zu sehr in ihrem Stolz gekränkt ist. Ich weiß nur, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen konnte und rausgeschmissen wurde. Maria ist um die 80. Sie sieht gut aus, eine feine Dame, man würde sie jünger schätzen. Vor ein paar Jahren kam sie öfters in den Elbschlosskeller, dann jahrelang nicht mehr, bis sie vor Kurzem wieder da war. Und seit ein paar Monaten schläft sie im Kickerraum. Jeden Abend macht sie sich bettfertig, zieht einen Pyjama an und putzt sich auf der Damentoilette die Zähne. Morgens kleidet sie sich an, immer geschmackvoll. Man sieht, dass sie mal Geld hatte und keiner käme auf die Idee, dass sie heute obdachlos ist. Was sie tagsüber treibt, kann ich nicht sagen. Dann ist sie in der Stadt unterwegs, geht spazieren, träumt sich vielleicht in eine andere Zeit zurück – wer könnte es ihr verdenken?
Am längsten bei uns wohnt Angie. Ein Herzensmensch. Seit zwölf Jahren ist sie im Elbschlosskeller.
ANGIE, DER GEFALLENE ENGEL
Eigentlich ist ihr Vorname Rima. Aber sie nennt sich Angie. Angie kommt aus Litauen. Als sie ein junges Mädchen war, entdeckte man ihr musikalisches Talent. Sie wurde früh gefördert, man schickte sie auf eine Schule für musikbegabte Kinder, wo sie Akkordeon lernte. Was ich nicht wusste. Bis eines Tages ein Akkordeonspieler im Elbschlosskeller zu Gast war, der sein Instrument dabeihatte und ein paar Stücke vorspielte. In dem Moment begannen Angies Augen zu leuchten, sie griff sich das Akkordeon und legte los. Spielte wie eine Weltmeisterin, als hätte sie nie was anderes in ihrem Leben gemacht. Wir alle waren baff. Was ich von Angies Kindheit weiß, ist, dass der Vater ein Trinker war und ihre Mutter sie im Stich ließ, als sie noch ein Baby war. Sie ging einfach weg, verschwand mit einem anderen Mann. Angie wurde 1977 geboren und kam mit drei Monaten zu ihrer Großmutter, „Omschi“, wie sie sie liebevoll nennt. Der Vater kümmerte sich nicht um sie, er hatte andere Frauen und den Alkohol. Ihre Mutter sah sie erst viele Jahre später wieder, und auch nur einmal, da war Angie elf Jahre alt. Sie wollte ihre Tochter damals mitnehmen, aber Omschi ließ das nicht zu. Angies großer Traum war die Musik. Sie sei mit Musik geboren, schwärmt sie. Neben der Musikschule besuchte sie ab dem dreizehnten Lebensjahr eine Tanzschule, lernte dort den Seiltanz. Dafür durfte sie nicht mehr als 50 Kilo wiegen. Dünn ist sie bis heute. Dann verunglückte sie, stürzte vom Seil: Knochenbrüche, Koma. Ein halbes Jahr lang. Der Vater wollte die Geräte schon abschalten. Dann das Wunder – Angie wachte aus dem Koma auf. „Ich konnte gar nichts mehr, nicht mehr laufen, musste alles neu lernen“, sagt sie. Aber sie schaffte es. So viel Unglück in einem so jungen Leben, das sollte doch reichen, denkt jeder, der Angies Geschichte hört. Aber jetzt wurde es erst richtig schlimm. Mit 17 fielen drei Männer mit Messern über sie her und vergewaltigten sie. Auf ihrem Bauch hat sie bis heute eine lange Narbe. Die Täter wurden nie gefasst. Dann, Angie war 18, wurde sie vom eigenen Vater missbraucht. Darüber zu reden, fällt ihr immer noch schwer. „Ich war vom Tode auferstanden, nach dem Koma, und dann folgte der nächste Tod.“ Den Vater anzuzeigen, keine Chance. Aber zwei Onkel, denen sie sich anvertraute, schlugen den Vater zusammen, beinahe tot, erzählt sie. Angie ging nach Vilnius, Litauens Hauptstadt. Hier konnte sie endlich das tun, was sie glücklich machte. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt als Musikerin, spielte in Restaurants Akkordeon. Kontakt zu ihrem Vater hatte sie keinen mehr.
Dann der Sommer, als sie 25 wurde. Wunderschön sei alles gewesen, sie habe ihr Leben im Griff gehabt. Zu einer Familienfeier fuhr Angie in die alte Heimat, besuchte ihren Vater. Plötzlich standen zwei große Männer vor der Tür und wollten den Vater sprechen. „Hol ihn raus“, befahlen sie. Die beiden waren gekommen, um die Spielschulden des Vaters einzutreiben. Er hatte im Casino viel Geld verloren. „Weil er pleite war, verkaufte er mich“, sagt Angie. Die Männer entführten sie und gaben ihr eine Spritze. Als sie wieder wach wurde, war sie schon in Deutschland. Man hatte sie in einer Kiste über die Grenze geschmuggelt. In ein Bordell in der Nähe von Frankfurt am Main, wo auch andere Frauen aus Osteuropa zur Prostitution gezwungen wurden. Den Pass nahm man Angie ab. Sie wurde eingesperrt, bekam kein Essen, wurde jeden Tag mit einem Elektroschocker an Beinen und Bauch gequält. Weil sie sich weigerte, mit den Freiern ins Bett zu gehen. Tanzen würde sie, aber nicht nackt und erst recht nicht würde sie anschaffen gehen, sagte sie ihrem Zuhälter. Lieber sei sie tot. Angie ist zwar eine Kämpferin, aber irgendwann gab sie auf. Nach ein paar Monaten in dem Bordell konnte sie entkommen: Einer ihrer Freier kaufte sie frei, für 20.000 Euro. Sie heiratete den Mann, der 30 Jahre älter war. Lange ging diese Ehe nicht gut. Sie zog weiter. Angie landete in Lübeck, wo sie mit einem Musiker liiert war. Als auch das in die Brüche ging, packte sie ihren Kram und rief ein Taxi. „Ich habe genug Geld“, sagte sie, „fahr mich in die gefährlichste Ecke Hamburgs.“ Das Taxi hielt vor dem Elbschlosskeller. Das war am Tag vor Angies 30. Geburtstag. Im Elbschlosskeller habe man sie so warm aufgenommen, ihr sofort ein gutes Gefühl gegeben, sagt sie. Das ist jetzt zwölf Jahre her. Angie ist dürr, abgemagert, weil sie auch kaum etwas isst. Wenn du viele Jahre massiv Alkohol trinkst, bleibt nicht viel hängen, auch wenn du Nahrung zu dir nimmst. Ich habe mal zu ihr gesagt, wie sehr ich es liebe, sie tanzen zu sehen. Angie tanzt aus vollem Herzen. Wenn sie sich zur Musik bewegt, wirkt es, als sei der Tanz wie eine Therapie für sie. Voller Gefühl. Ihr Ausdruck ist der Wahnsinn. An Tagen, wenn der Laden fast leer ist, tanzt Angie fünf, sechs Stunden lang. Dreht und dreht sich. Ganz in sich versunken, mit einem Lächeln auf den Lippen. Und tanzt sich das ganze Leid weg, man sieht ihr das an, sie ist befreit, leichtfüßig, hat Spaß, strahlt tierisch was aus. Und in solchen Momenten ist sie schön. Und obwohl sie so viel gelitten und so viel durchgemacht hat, sieht man, dass die Hoffnung noch da ist, solange der Mensch immer noch voller Liebe ist, voller Leidenschaft und Zuversicht auf ein bisschen Glück. Angie hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter, die sie nicht sehen darf. Das ist – bei allem Unglück – die eigentliche Tragödie ihres Lebens. Nachdem sie schon fünf oder sechs Jahre bei uns wohnte, lernte sie einen Mann kennen, in den sie sich verliebte. Danach ließ sie sich kaum noch blicken. Sie war zwei Jahre fast komplett weg, kam alle paar Monate auf einen Kaffee oder auf eine Cola vorbei, um den alten Freunden Hallo zu sagen. Den Menschen, die sie begleitet hatten, getröstet, die für sie immer da waren. Angie führte fast so etwas wie ein bürgerliches Leben. Aber auch nur fast. In dieser Zeit kam ihre Tochter zur Welt, ihr Ein und Alles. Die Beziehung zu dem Vater der Tochter ging in die Brüche. Angie wollte weg von ihm. Das nahm er ihr übel und rächte sich, indem er ihr das Kind wegnahm. Angie spricht nur schlecht Deutsch, sie hatte keine Ahnung von der Gesetzeslage und einen Anwalt konnte sie sich nicht leisten. Vor Gericht war Angie chancenlos und verlor das Sorgerecht. Damit ging der alte Teufelskreis wieder los. Alles kam wieder hoch, was damals mit ihr geschehen war, der Missbrauch, die Ängste um die Tochter. Und all den Frust versuchte sie sich wegzusaufen. Aus dem einen Drink wurden schnell sehr viele, seitdem war sie wieder im Elbschlosskeller, und das konnte ihr Ex gegen sie anführen. Nach dem Motto: Guckt mal, die hat keine Arbeit, keinen Wohnsitz, die lungert in der Kneipe rum. Seitdem darf sie ihre Tochter gar nicht mehr sehen.
Angie ist mittlerweile so was wie eine Freundin geworden, die – weil sie weiterhin ohne Wohnsitz ist – ihre postalische Adresse bei uns hat. Hamburger Berg 38, 20359 Hamburg. Ihre Post wird zu uns geschickt, damit sie offizielle Briefe bekommen kann, für Gerichtstermine oder Behördenkram. Ich habe sie schon mehrfach auf Ämter begleitet. Susanna und ich helfen ihr, weil ich es oft genug erlebt habe, dass Leute wie Angie, die nicht gut Deutsch sprechen, bei den Behörden wie der letzte Dreck behandelt werden und automatisch als Sozialschmarotzer gelten. Nicht von allen, aber es kam oft genug vor. Alle paar Monate findet Angie einen Gönner, jemanden, der sie bei sich wohnen lässt, der nicht nur Sex will, sondern ihr wirklich etwas Gutes tun möchte. Dann sehen wir sie nur an manchen Tagen, dann kommt sie gut gekleidet und frisch geduscht zu uns. Aber lange hält sie dieses Leben in der Regel nicht aus. Nach ein paar Wochen macht sie einen Abgang. Vielleicht hat sich das aber jetzt geändert. Denn seit ein paar Monaten wohnt sie bei Thorsten, auch ein Stammkunde. Bei ihm hat sie eine Matratze, ein Bad, kann kommen und gehen, wann sie will. In ihrer Heimat Litauen war Angie nie wieder. Ihr Vater ist vor einem Jahr gestorben. Die Wut sei immer noch da, wenn sie an ihn denkt, verzeihen konnte sie ihm nie. Angies Traum? Ihre Tochter wiederzukriegen, vom Alkohol wegzukommen, einen Mann finden, jemand, der ihr unter die Arme greift. Sie braucht jemanden, der sie da rauszieht, damit dieser Teufelskreis endlich ein Ende findet.
Bine, der Mutti, ist das gelungen. Nach einigen Monaten konnten wir ihr eine Wohnung besorgen, gleich über der Meuterei, meinem anderen Laden auf St. Pauli, auch nur ein paar Seitenstraßen von der Reeperbahn entfernt. Den Vermieter, einen Dänen, hatte ich angequatscht: „Wenn was frei wird, musst du mir unbedingt Bescheid sagen. Ich habe Leute, die da oben einziehen wollen.“ Dann war es soweit. Eine Wohnung war frei geworden, weil eine Mieterin gestorben war. Auch eine Stammkundin aus dem Elbschlosskeller, auch eine Sabine, von ihr werde ich noch erzählen. Seitdem Bine in Sabines Wohnung lebt, sieht sie fitter aus und trinkt weniger Alkohol. Sie kann duschen, schlafen, sich selbst etwas zu essen machen, ihre Behördengänge erledigen – sie hat’s geschafft. Ihre neue Wohnung, das sind nur acht Quadratmeter, aber die sind Bines ganzer Stolz. „Das ist er“, sagt sie und zieht etwas aus der Hosentasche, „der Schlüssel zu meiner eigenen Wohnung!“ Und dann lacht sie. Einen Job hat sie jetzt auch. Sie arbeitet bei uns. Anfangs hat sie geputzt, als dann jemand ausfiel, sprang Bine als Tresenkraft ein. Das machte sie so gut, dass wir sie einstellten. Jetzt verdient sie wieder ihr eigenes Geld. Dabei ist es gar nicht so einfach, wieder ein geregeltes Leben zu führen, wenn du einmal auf der Straße warst und von Almosen gelebt hast. Du hast verlernt, dich unterzuordnen und zu integrieren. Und wenn du das nicht kannst, fliegst du aus jedem Job sofort wieder raus. Die einfachsten Dinge musst du neu lernen. Zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und morgens pünktlich aufzustehen. Sich was zu essen kaufen, mit Geld umzugehen, einschätzen, was du dir leisten kannst und was nicht. Vor allem lernen, das Geld nicht zu versaufen. Aber Bine hat den Absprung geschafft. Und sie ist bereit für ihr neues Leben.
Es ist fast schon eine Art Tradition, dass wir auch immer einen jungen Obdachlosen beherbergen. Wenn der nach ein paar Wochen wieder weg ist, kommt schon bald der nächste. Das ergibt sich einfach. Gerade ist es ein gut aussehender blonder Typ, der im Elbschlosskeller schläft. Er ist ein bisschen mein „Ohr“, er steckt mir immer, was im Laden läuft, wenn ich nicht da bin. Er hat früher Kickboxen gemacht, das verbindet uns, dadurch haben wir eine Basis und verstehen uns. Er hat was Unschuldiges, Braves an sich, aber so langsam sieht man auch ihm die Straße an. Den schwarzen Ansatz an den Zähnen, der entsteht, wenn du dir die Zähne nicht regelmäßig putzen kannst. Vor einiger Zeit hatten wir einen jungen Obdachlosen, der aus einer Kleinstadt kam. Sein Vater hatte ihn zu Hause rausgeschmissen, weil er schwul ist. Er wollte mit seinem Sohn nichts mehr zu tun haben. Die Schande der Familie. Der schwule bunte Hund in dem spießigen Kaff. Dann verlor der Junge auch noch seinen Job, sein Freund trennte sich von ihm. Plötzlich hatte er nichts mehr. Er kam nach Hamburg und landete im Elbschlosskeller, sein neues Zuhause für einige Wochen. Einmal sagte er zu mir, er habe länger nicht geduscht und kein Geld, um seine Sachen zu waschen. Er bat mich um frische Wäsche, damit er die mal wechseln könne. Die habe ich ihm natürlich besorgt, und er war richtig glücklich mit seinen sauberen Tennissocken. Wir haben uns um ihn gekümmert, ihn getröstet, wenn er geweint hat. Wenn es ihm auf der Seele brannte, dass er verstoßen worden war. Und irgendwann ging es bei ihm wieder aufwärts. Er fand einen Job, erst mal nur als Aushilfe, aber dadurch kann er sich eine kleine Wohnung leisten. Gelegentlich kommt er bei uns vorbei, umarmt mich herzlich, trinkt aber keinen Alkohol mehr, aus Angst, wenn er ein oder zwei Bier trinkt, versackt er wieder für mehrere Tage und alles geht von vorne los.
Mein Leben ist eine Acht
So extrem, wie es bei vielen meiner Gäste zugeht, ist es auch bei mir oft im Leben gewesen. Mein Leben ist wie eine Acht. Mal geht’s hoch und mal geht’s runter. Egal, was ich mache: Nichts ist normal. Mal lebe ich wie ein kleiner Mönch, lese ohne Ende spirituelle Bücher, bin im Einklang mit mir und stehe morgens pünktlich auf. Jeden, den ich treffe, den berühre ich, bekehre ich auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bete zu Gott, und abends geht’s um acht ins Bett. Alles, was ich anfasse, funktioniert, wenn ich so drauf bin.
Zumindest war das immer so. Und dann kommt die andere Phase. In der verliere ich mich, bin unausgeglichen und gemein, ernähre mich schlecht, distanziere mich von mir selbst, und weil mir das alles bewusst ist, werde ich noch unzufriedener mit mir. So sind wir alle in unserer Familie. Einfach sehr extrem.
Mit Kiez und Kneipen hatten wir ursprünglich gar nichts am Hut. Der Erste aus meiner Familie, der seinen Fuß in den Elbschlosskeller setzte, war mein Großvater Henning, der Vater meiner Mutter Katja. Er saß regelmäßig am Kellertresen und trank sein Bier. Von Beruf war er Bäckermeister, er hatte einen eigenen kleinen Betrieb, der ganz gut lief. Und trotzdem litt er zeitlebens, so erzählte man, unter seinen familiären Verhältnissen. Seine Geschwister hatten studiert und bekamen tolle Jobs, sie waren Akademiker, hohe Tiere, und Henning war eben „nur“ der Bäcker. Er galt als der Dümmling der Sippe und bekam von zu Hause immer nur Druck. Ob das der Grund dafür war, wer weiß es, jedenfalls griff er schon früh zur Flasche, trank sehr viel und tauchte immer häufiger im Elbschlosskeller auf.