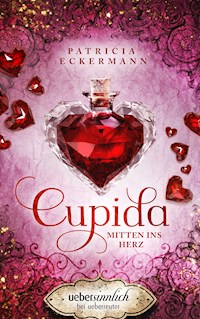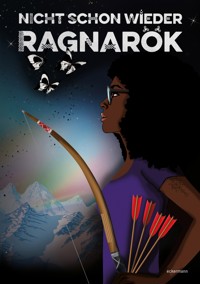3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
"Wer ist die denn?! Wo ist der Krause?" "Ich bin Krause", antwortete ich und registrierte, wie mein Herzschlag sich spontan verselbstständigte. Nazis und Rassisten, ob tot oder lebendig, erkenne ich sofort. Dafür hat unsereiner einen feinen Radar. Dieses Exemplar hier war nur ein ekliger Rassist, also nicht lebensgefährlich, wie zum Beispiel die Nazis, die in Bielefeld ihr Unwesen trieben. Psychisch aber war er ebenso verletzend und unangenehm. Ich ballte die Fäuste und zählte bis zehn. Ich war nicht in dieses Dorf gekommen, um Nobbys Kundschaft noch weiter zu dezimieren." Krause - Schwarz, Elektrikerin und Geisterjägerin a.D. - kommt in die rheinische Pampa. Ende der 80er Jahre, auf dem Dorf, begegnen ihr dort viele Weiße mit Vorurteilen. Entsprechend schnell will sie eigentlich wieder raus aus "Milchschnittenhausen". Doch sie muss im Betrieb ihres Vaters Nobby aushelfen, denn der ist seit einem Arbeitsunfall nicht mehr derselbe. Krause ahnt, dass der Grund dafür kein einfacher Stromschlag war. Bei der Suche nach der wahren Unfallursache macht Krause nicht bloß unerfreuliche Bekanntschaft mit toten und lebendigen Nazis. Sie stößt auf eine okkulte Verschwörung, die ganz Deutschland bedroht ... Eine unkonventionelle Geisterjägerstory, verbunden mit einem humorvoll analytischen Blick unter den verbeulten Familienteppich der alten BRD.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Biografie
Patricia Eckermann wurde in Bielefeld geboren. Nach einer Handwerkerlehre wurde sie Beamtin, sie kämpfte für die Gewerkschaft und studierte in Köln Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft, Pädagogik und Anglistik.
Heute arbeitet sie als Fernsehautorin, engagiert sich für mehr Diversität in den Medien und veranstaltet Workshops zum Thema.
Auf Twitter findet man sie unter @feireficia
Mehr Infos gibt’s auf www.antagonisten.de
Triggerwarnung
Manche Figuren in diesem Buch sind Rassisten. Auch das N-Wort kommt vor, ein Schimpfwort, das schon in den 1980er Jahren von Schwarzen Menschen in Deutschland konsequent abgelehnt wurde. Das N-Wort wird nicht ausgeschrieben, wer allerdings auch die Schreibweise N***r als verletzend empfindet, sollte nicht weiterlesen.
Für Anregungen und Feedback in Bezug auf triggernde Sprache oder Figurenzeichnung schreib mir eine Mail an: [email protected]
Patricia Eckermann
Elektro Krause
Erstausgabe
Inhaltsverzeichnis
Biografie
Triggerwarnung
Home again in Milchschnittenhausen
Tote und lebendige Nazis
Nobbys Geisterordner
Das geheime Waffenlager
Geisterkontakt
Recherche
Der Frequenzphaser
TR-808
Geschenkte Erinnerungen
Das Notfall-Kit
Teamarbeit
Showdown
Dankeschöns
Weiterführendes
Orientierungsmarken
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hauptteil
Warnung
Titelei
Epigraph
Danksagungen
Anhang
Mitwirkende
It is not our differences that divide us.
It is our inability to recognize, accept,
and celebrate those differences.
zugeschrieben: Audre Lorde – black, lesbian, mother, warrior, poet
Home again in Milchschnittenhausen
Wenn ich an 1989 denke, fällt mir nicht zuerst der Mauerfall ein. Auch nicht die erste Loveparade in Berlin. Oder die schwere Ölpest vor Alaska. Ich denke an Nazis. Zugegeben, als Schwarze Deutsche fallen mir immer erst Nazis ein, wenn es um mein Heimatland geht. Egal, um welches Jahr es sich handelt. Denn was auch immer sie uns in der Schule eingetrichtert haben: Die braune Brut war nie weg. Dafür war sie zu einflussreich. Man hat verzichtbaren hohen Tieren einen medienwirksamen Prozess gemacht, die eine oder andere Führungspersönlichkeit prestigeträchtig eingesperrt und den Rest verschont. Okay, ein paar feige Verpisser, darunter auch der Arsch, der uns das ganze Elend eingebrockt hat, haben sich vor Kriegsende selbst aus dem Leben gekugelt, aber der große Teil der Nazis ist einfach so durchgekommen. Schließlich ging es um das Wohl des Landes – und das fußt ja bekanntlich auf Wirtschaft und Wachstum. Was wiederum die ideale Spielwiese für das ganz große Geld ist. Und wenn es ums Geld geht, kennen die Nachfahren der Dichter und Denker nichts, das haben sie ja schon im Krieg bewiesen, als sie Nachbarn, Freunde und sogar Familienmitglieder verraten und an die Gestapo ausgeliefert haben. In der Folge zogen die braven, arischen Deutschen, angeblich nichtwissend, dass Juden, Sinti und Roma, Andersdenkende, Menschen mit Behinderungen, Schwarze und Queers auf grausamste Art ermordet wurden, in deren leerstehende Häuser ein, übernahmen deren florierende Geschäfte und rissen sich deren wertvolle Kunstgegenstände unter die Nägel. Hätte man nach Kriegsende alle Nazis zur Rechenschaft gezogen, wäre unser Land heute vielleicht so sozial, antifaschistisch und zukunftsorientiert, wie es sich die wahren, aber leider wenig einflussreichen Demokraten damals erträumt haben. Und 1989 wäre auch für mich einfach nur das Jahr des Mauerfalls. Stattdessen aber ist es das Jahr, in dem ich auf die Zyankali-Nazi-Verschwörung stieß.
Es war September 1989, nur wenige Monate vor dem legendären Versprecher eines überforderten weißen Mannes, der Deutschland und die DDR wieder zu einem Land verschweißen sollte. Drüben, hinter der Mauer, brodelte es, immer mehr mutige Menschen gingen friedlich auf die Straße, um für ihre Freiheit und Selbstbestimmung einzustehen. Hier, vor der Mauer, erstarkte der Glaube an die Wiedervereinigung und sogar diejenigen von uns, die keine Verwandten in der DDR hatten, hofften, dass bald endlich wieder zusammenwuchs, was zusammengehörte.
Ich allerdings hoffte etwas anderes. Nämlich, dass ich nicht allzu lange in der Pampa würde bleiben müssen. Genauer gesagt in Sieglar, einem kleinen Ort in Troisdorf bei Köln. Am Tag zuvor war ich aus Bielefeld in dieses Nest gezogen, um im Elektrikerbetrieb meines Vaters – Nobby – auszuhelfen.
Seit einem Arbeitsunfall war Nobby nicht mehr wiederzuerkennen. Er war die meiste Zeit apathisch und absolut unfähig, den Betrieb zu führen – fand Frauke, die bei ihm eine Lehre zur Bürokauffrau machte und jetzt um ihren Ausbildungsplatz bangte. In einem endlosen Telefongespräch hatte sie mir erzählt, dass es unzählige Kundenbeschwerden gab und kaum noch neue Aufträge eintrudelten. Da ich meinen Vater liebte und mich in meinem Job als Elektrikerin in Bielefeld sowieso unterfordert fühlte, kündigte ich kurzentschlossen und zog von heute auf morgen ins Rheinland. Meine Mutter Alice, eine stolze Schwarze Jamaikanerin, die für die Britische Armee arbeitete und jeden Tag drei Kreuze machte, dass sie seit vielen Jahren von Nobby geschieden war, setzte alles in Bewegung, um mich aufzuhalten. Sie hatte damals nach der Trennung dafür gesorgt, dass ich bei ihr in der ostwestfälischen Großstadt aufwuchs, umgeben von Schwarzen Identifikationsfiguren. Aber ich war schon immer ein Papa-Kind gewesen, und dass Nobby im Gegensatz zu mir so weiß wie ein Vampir war, änderte daran nichts. Es hatte uns im Gegenteil nur sensibler gemacht für die Dinge, die wir gemein hatten: unter anderem unsere Begeisterung für US-amerikanischen Hip-Hop, die Vorliebe für bayrisches Weißbier … und unsere Fähigkeit, Geister zu sehen. Doch während Nobby die Gabe angenommen hatte und unter dem Radar als Geisterjäger arbeitete, wollte ich damit nichts zu tun haben. Es reichte mir, dass ich durch meine Hautfarbe auffiel, ich hatte keine Lust, auch noch als verrückt abgestempelt zu werden. Sollten die Leute doch allein mit den Polter- und Klopfgeistern, den Dämonen, den Wesenheiten aus anderen Dimensionen und den vielen schuldbeladenen Seelen der Verstorbenen fertigwerden, die im Krieg an allem Unrecht vorbeigesehen hatten und denen das Karma jetzt den verdienten Arschtritt verpasste, indem es ihnen den Weg ins Jenseits verwehrte.
***
»Du hättest wirklich nicht kommen müssen, Kassy. Ich krieg den Laden schon allein gestemmt.« Nobby sah mir zum ersten Mal in die Augen, seitdem ich am Tag zuvor angekommen war. Er sah mitgenommen aus: Seine Haut war viel zu kalkig-weiß, sogar für seine Verhältnisse, und seine Augenringe erinnerten an die eines Dauerkiffers. Ich dachte an meine Koffer oben im Dachzimmer, das Nobby immer für mich freihielt, obwohl ich schon seit Jahren nur noch selten und meist viel zu kurz bei ihm aufschlug. Auch diesmal würde ich nicht länger als nötig in Troisdorf bleiben. Vielleicht musste ich nicht mal alles auspacken. Vielleicht war mein Vater in ein, zwei Wochen wieder der Alte. Dann konnte ich ohne Zwischenstopp in OWL direkt nach England fliegen und endlich das Workcamp machen, von dem ich seit meinem Realschulabschluss träumte. Mit meinem Vater Nobby hatte dieser Fluchtimpuls nichts zu tun. Ich liebte ihn und war gern bei ihm zu Besuch, aber dieses Dorf hier war einfach nichts für mich. Ich brauchte die Großstadt, das bunte Nachtleben mit DJs, die die neuste Musik auflegten – und vor allem die Vielfalt der Hautfarben, Nationalitäten und Religionen. Denn wenn man selbst nicht die Norm ist, fühlt man sich denen zugehörig, die es auch nicht sind, egal, wie sehr sie sich von einem unterscheiden. Zu meinem Freundeskreis in Bielefeld gehörten Leute aus dem damaligen Jugoslawien, aus Griechenland, der Türkei, Sri Lanka und Großbritannien, aus Spanien, Portugal und Polen, aus Jamaika, Eritrea, Tunesien und Marokko. In Gegensatz dazu gab es hier in der rheinischen Pampa ausschließlich durchschnittsdeutsche Milchschnittengesichter – wenn man von KaySer und Errol absah, die einzigen Menschen neben Nobby und seinem Freund Peter, mit denen ich in diesem Dorf etwas anfangen konnte. Als Schwarze Frau – meine Haut ist so dunkel, dass selbst meine Mutter neben mir hell wirkt – fühlte ich mich hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn ich vor die Tür trat, beobachteten mich Hunderte neugierige Augenpaare, ich konnte niemals einfach untergehen in der Masse, mich treiben lassen. Und da die Milchschnitten ständig miteinander tratschten – was soll man auch sonst tun, in einem Kaff, in dem Dreiviertel der Bevölkerung miteinander verwandt sind – wusste jeder über mich und meine Aktivitäten Bescheid. Wann immer ich meinen Vater zu Weihnachten, in den Sommerferien oder zum Geburtstag besuchte, war ich der Talk of the Town.
Nobby räusperte sich. Ich unterbrach meinen Gedankenkreisel. Von Frauke wusste ich, dass er nicht eben positiv darauf reagierte, wenn man ihn auf den Arbeitsunfall ansprach. Ich beschloss, das Thema behutsam anzugehen.
»Ich hatte keinen Bock mehr auf den Job in Bielefeld. Außerdem brauchst du jemanden, der dir aushilft. Oder hast du schon Ersatz für Arnulf gefunden?«
»Ich hab doch Peter.«
»Peter ist Frührentner«, wischte ich Nobbys Antwort beiseite. »Außerdem ist er kein Elektriker.«
Vorn, im Schaufensterbüro, hörte ich Peter schnauben.
»So ein paar Strippen zusammenzwirbeln kann ich ja wohl noch!«, empörte er sich. Anscheinend belauschten er und Frauke unser Gespräch. Kurz dachte ich darüber nach, die Tür zu schließen, doch hier im Lager, das gleichzeitig als Werkstatt diente und in dem zumindest früher noch der Spind mit Nobbys Geisterjägerwaffen gestanden hatte, gab es nur ein Kuppelfenster, das ins Flachdach eingelassen war und das weder für besonders viel Licht noch Luft sorgte. Sollten die beiden da draußen also ruhig zuhören. Ich wusste, dass sie meine Sorge um Nobby teilten, auch wenn wir alle anders damit umgingen.
Nobbys Augen wurden wieder glasig und wanderten ins Unendliche. Verdammt. Ich wollte ihn noch so viel fragen!
»Papa?«
Er schwieg.
»Komm schon. Sag mir wenigstens, warum Arnulf gekündigt hat. Er stand kurz vor der Gesellenprüfung. Da schmeißt man doch nicht von jetzt auf gleich das Handtuch.« Nobby sah mich an. Beziehungsweise durch mich durch. Frauke hatte recht. Mein Vater hatte sich wirklich verändert. Vom energiegeladenen Sprücheklopfer war nichts mehr übriggeblieben. Dieser Arbeitsunfall hatte ihn komplett auf links gezogen. »Papa! Lass mich nicht hängen. Ich bin hier, um dir zu helfen. Du kannst Peter ja wohl unmöglich allein zum Kunden schicken. Starkstrom ist nichts für Laien. Das musst du doch am besten wissen!«
Nobby zog die Brauen zusammen. Seine faltige Haut war in den letzten Jahren noch faltiger geworden, das konnte auch der struppige Bart nicht verbergen, den er seit neuestem trug. In Kombination mit seinem chronischen Untergewicht, der über die Schädelplatte kriechenden Glatze und den schwarzen, ungebügelten Klamotten, sah er aus wie ein depressiver Philosophielehrer. Ich legte meine Hand auf seinen Arm und versuchte einen weiteren Anlauf.
»Ich übernehme deine Aufträge, bis du wieder fit bist. Okay?«
Nobbys Augen erwachten.
»Auf keinen Fall! Das ist viel zu gefährlich!«, polterte er.
»Ich bin ausgebildete Elektrikerin«, blaffte ich zurück. »Ich weiß, wie man mit Starkstrom umgeht. Und das anscheinend besser als du!« Einen Moment lang war ich wütend, weil er mir das nicht zutraute. Schließlich arbeitete ich seit Jahren in dem Beruf. Oder ging es hier nicht um den Elektrikerjob? Der Verdacht war mir schon einmal gekommen, vor ein paar Tagen, als Frauke am Telefon von Nobbys Wesensveränderung erzählt hatte. Stromschläge hatte er im Lauf seines Lebens nämlich schon einige erhalten, aber bisher war er danach immer wieder sehr schnell der Alte gewesen. »Was ist passiert, Papa?«, flüsterte ich. Wenn sich mein Verdacht bestätigte, dann hatte kein Arbeitsunfall, sondern ein Geisterkontakt Nobby traumatisiert. Besser, Peter und Frauke bekamen das nicht mit. »Hast du wirklich nur einen gewischt bekommen?«
Eine gefühlte Ewigkeit später verließ ich das Lager ebenso schlau, wie ich es betreten hatte. Nobby war nicht wieder aus seiner Lethargie erwacht. Ich hatte mich allerdings auch nicht getraut, ihn deutlicher auf einen möglichen Geisterkontakt anzusprechen, denn ich wollte verhindern, dass Frauke und Peter mitbekamen, dass Nobby und ich Geister sehen konnten. Mein Leben lang hatte mein Vater mir nämlich eingeschärft, dieses »Talent« geheim zu halten.
Während Nobby im Lager weiter vor sich hinstarrte, enterte ich das Schaufensterbüro. Der Raum war nicht sehr groß, rechteckig und besaß eine Fensterfläche, die fast die komplette Frontseite bedeckte. Sogar die Tür in der Ecke war weitestgehend aus Glas. Auf der Schaufensterscheibe stand in bronzefarbenen Lettern: »Elektrikermeisterbetrieb Krause: Schnell, kompetent, preiswert«. Vor Nobbys Einzug hatten der Betrieb und der angrenzende Kiosk zusammengehört und einen Raum gebildet. Die Wand, die jetzt beide Einheiten voneinander trennte, war dünner als die Fensterscheiben und genauso zugig. Zum Betrieb gehörte außerdem das kleine Lager mit der Werkbank und ein winziges, fensterloses Klo mit Dachluke, das Frauke mit Postern von Madonna, Cindy Lauper und Grace Jones dekoriert hatte.
Ich lehnte mich an die Theke, hinter der Frauke in einem Ordner blätterte. Dass sie Madonna-Fan war, sah man ihr auf den ersten Blick an. Zurzeit kopierte sie Madonnas Bad-Boy-Look: Sie trug kurze, blondgefärbte Haare mit dunklem Ansatz, hatte sich die ohnehin prominenten Augenbrauen dunkel nachgezogen und ihre Marilyn-Monroe-blasse Haut mit knallroten Lippen und einem künstlichen Leberfleck verziert, der allerdings an warmen Tagen gern mal im Gesicht herumwanderte. Über ihrem üppigen Busen trug sie ein tief ausgeschnittenes, weißes T-Shirt, darüber eine einen Tick zu große Lederjacke. Dazu schwarze Jeans, Turnschuhe, einen albernen Hut und jede Menge klirrender Ketten und Armreifen.
Sie klappte den Ordner zu und lächelte mich mitfühlend an. Nobbys Freund Peter, ein kleiner, dicker Mann mit breitem Schnubbi, der neben mir an der Theke lehnte, drehte sich neugierig zu mir ein. Sogar in meinen flachen Sicherheitsschuhen war ich anderthalb Köpfe größer als er.
»Bei Nobby alles im Lot?« Er faltete die Hände vor seinem kugelrunden Bauch und musterte mich mit eisgrauen Augen. Ich kannte Peter, seit Nobby hierhergezogen war und ich ihn das erste Mal nach seiner Scheidung von Alice besucht hatte. In all den Jahren hatte ich Peter als einen gutmütigen, absolut zuverlässigen, meist maulfaulen Menschen kennengelernt. Ein waschechter Solinger aus dem Bergischen Land, der lieber anpackte, als große Reden zu schwingen.
»Ich hab keine Ahnung«, stöhnte ich. »Ich erkenn Papa nicht wieder. Der guckt einfach durch mich durch.«
»Das macht er mit uns allen«, mischte sich Frauke ein. »Nimm das bloß nicht persönlich.«
»Nobby war immer aus dem Häuschen, wenn er wusste, dass du zu Besuch kommst, Kassy. Das ist auch diesmal so. Er kann grad nur nicht zeigen, wie froh er ist, dass du hier bist«, versuchte Peter, mich aufzumuntern. Ich war mir da nicht so sicher. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Nobby mich lieber heute als morgen wieder loswerden wollte. Frauke lehnte sich zu uns über den Tresen.
»Peter hat Recht. Nobby freut sich total, dass du ihm aushilfst.« Sie reichte mir einen Zettel, auf den sie eine Adresse gekritzelt hatte. »Stromausfall in der Grundschule. Der Hausmeister war ziemlich angefressen. Nobby hat da erst letzte Woche eine neue Leitung gelegt. Kannst du dir das mal anschauen?«
»Und ihr wisst wirklich nichts Genaues über Nobbys Arbeitsunfall?«, fragte ich, schnappte mir den Zettel und vergrub ihn in der Hosentasche meines Blaumanns. Frauke warf Peter einen schwer zu deutenden Blick zu.
»Ich weiß nicht mal, wie Nobby an den Auftrag gekommen ist. Geschweige denn, wo er war. In meinen Unterlagen findet sich nichts.« Wieder so ein merkwürdiger Blick, den sie Peter zuwarf. Ich sah ihn an. Er hob abwehrend die Arme.
»Mit mir spricht er doch auch nicht.«
»Aber?«, hakte ich nach.
»Na ja …«, Peter suchte nach Worten, »ich glaub langsam nicht mehr an einen einfachen Stromschlag. Da muss noch irgendwas anderes passiert sein.«
»Vielleicht hatte er ja eine Nahtoderfahrung oder so«, flüsterte Frauke.
»Keine Ahnung.« Peter wackelte unbestimmt mit dem Kopf. »Irgendwas ist jedenfalls mit ihm.« Er sah auf seine Armbanduhr, zog einen Autoschlüssel aus der Hosentasche und warf ihn mir zu. »Sieh zu, dass du loskommst. Das Auto steht auf dem Parkplatz vorm Büdchen. Blauer Golf, weißte ja.«
***
Als ich den Wagen vor der Grundschule parkte, war gerade große Pause. Es herrschte das bekannte Bild: Ein Großteil der Jungs berserkte über den Schulhof und rempelte dabei bevorzugt schwächere Jungs und schüchterne Mädchen an. Gelangweilte Lehrer liefen Streife und sorgten halbherzig für Ordnung. Größere Mädchengruppen, zu denen wenige Jungs gehörten, spielten Gummitwist, sprangen seilchen, manche sogar im Double-Dutch. Die Kletterstangen und Klatschspiel-Gruppen schienen fest in Mädchenhand und an den im Schatten liegenden Schulhofwänden hockten anscheinend ausschließlich Jungs, die mit Murmeln spielten. Der Lärmpegel war unglaublich. Falls Nobby hier einen Fehler beim Verlegen neuer Leitungen gemacht hatte, konnte ich ihn gut verstehen. Wir beide waren empfindlich, was Geräusche, Gerüche und andere Informationen anging, die unaufhörlich auf uns einprasselten. Unsere Konzentration und Schlagfertigkeit litt, wenn das Informationsgewitter zu stark wurde. Heute nennt man das hypersensibel, es gibt Tonnen von Ratgebern und Studien zum Thema. Doch in den Achtzigern schoben wir es auf unsere Geistersehergabe und versuchten, irgendwie damit klarzukommen.
Ich öffnete den Kofferraum und sah auf das Durcheinander aus Kabeltrommeln, Bohrmaschinen, Stemmeisen, verschiedenen Hämmern und Gummimatten. Mit Arnulfs Kündigung war anscheinend auch die Ordnung aus dem Betrieb desertiert. Ich entdeckte den Werkzeugkasten, zog ihn mit einiger Anstrengung aus dem Chaos heraus und schmiss die Heckklappe zu. Das Schloss war defekt, das hatte mir Peter noch hinterhergerufen, als ich mich auf den Weg gemacht hatte, deshalb versuchte ich erst gar nicht, den Wagen abzuschließen. Auch die Fenster ließ ich heruntergekurbelt, es würde sowieso niemand auf die Idee kommen, die Karre zu klauen. Erstens, weil sie zerbeult war und sich rundherum in Rost auflöste und zweitens, weil sie selbst bei so durchschnittlichen Temperaturen wie heute unfassbar stank. Wer oder was auch immer darin verwest war, die olfaktorischen Überreste hatten sich unauslöschlich ins Innere des Wagens eingefressen, da halfen auch die vielen bunten Duftbäumchen nicht, mit denen Frauke den Geruch zu übertünchen versuchte.
Auf meinem Weg zum Schuleingang kam ich mir vor wie Moses, der das Wasser teilte. Nur dass es in meinem Fall kein Wasser war, das sich von mir zurückzog, sondern Kinder. Angst, Irritation, Abneigung – kein schönes Gefühl, wenn einem Kindergesichter sowas entgegenwerfen. Selbst die rotbäckigen, widerlichen Knirpse, die eben noch andere Kinder in den Staub gerempelt hatten und null Respekt vor ihren Lehrern zeigten, machten einen Bogen um mich. War ich etwa die erste Schwarze Person, die ihnen leibhaftig begegnete? Da blieb mein Blick an einem schmächtigen Jungen hängen, dessen Haut fast so dunkel wie meine war. Seinem Gesichtsausdruck nach war er gleichermaßen überrascht und froh, jemanden zu sehen, der hautfarbentechnisch in seine Richtung ging. Ich zwinkerte ihm freundlich zu, er winkte schüchtern zurück. Die Blicke der Jungen und Mädchen auf dem Schulhof, die neugierig zwischen uns hin- und hertitschten, ignorierten wir. Noch heute liebe ich diese Momente der Begegnung mit anderen Schwarzen, dieses kurze Bonding mit Fremden, auf der Straße, auf einer Party, in der Bahn. Momente, in denen wir uns wortlos grüßen, einander versichern, dass wir nicht allein sind. Dass wir wissen, was der andere durchmacht. Wie es ist, Schwarz unter Weißen zu sein, Rassismus zu erleben und ihn nicht klar benennen zu können – es sei denn, wir nehmen in Kauf, dafür von den Tätern belächelt, beschimpft oder sogar bestraft zu werden.
»Kann ich helfen?« Vor mir stand ein Lehrer, der stark nach Kunstunterricht aussah. Klamottenmäßig hing er noch in den Siebzigern fest. Trotz der angenehmen 20 Grad trug er eine dicke braune Cordhose, ein weißes Rüschenhemd, das Prince zu Beginn der Achtzigerjahre wieder hip gemacht hatte, und seine Füße steckten in gelben Holzklotschen. Sein helles, leicht gelbliches Gesicht war glattrasiert und ziemlich attraktiv, mit schmaler, ein wenig schiefer Nase, hellbraunen Fuchsaugen und straßenköterblonden, welligen Haaren, die ihm bis auf die Schulter fielen. »Ich bin Thomas. Kunst und Sport«, stellte er sich vor.
»Krause.« Ich ergriff seine ausgestreckte Hand. Sie war warm und sein Händedruck genau richtig, nicht zu schlaff und nicht zu fest. »Ich bin die Elektrikerin.«
»Ah, der Stromausfall«, nickte Thomas. »Kommen Sie. Ich bring Sie zum Hausmeister.«
Er legte mir seine Hand auf den Rücken und schob mich am Haupteingang vorbei zur Rückseite des Schulgebäudes. Dort führte eine kurze Treppe in den Keller, wo die Grundschüler in einer Art provisorischem Büdchen Milch, Kakao und Limonadenpäckchen für 80 Pfennige das Stück kaufen konnten. Kerzen auf einem zur Verkaufstheke umfunktionierten Biertisch deuteten darauf hin, dass ich hier genau richtig war.
»Hey, Jupp«, grüßte Kunstlehrer Thomas einen alten, grauhaarigen Mann mit grauen Augen im grauen Kittel. Sogar seine Gesundheitsschuhe waren grau. »Gleich wird’s wieder Licht.«
»Das wird aber auch Zeit«, brummte der Angesprochene. Dann fielen seine Augen auf mich. Er zog missbilligend die Stirn in Falten. »Wer ist die denn? Wo ist der Krause?«
»Ich bin Krause«, antwortete ich und registrierte, wie mein Herzschlag sich spontan verselbständigte. Nazis und Rassisten, ob tot oder lebendig, erkenne ich sofort. Dafür hat unsereiner einen feinen Radar. Dieses Exemplar hier war nur ein ekliger Rassist, also nicht lebensgefährlich, wie zum Beispiel die Nazis, die in Bielefeld ihr Unwesen trieben, psychisch aber war er ebenso verletzend und unangenehm. Ich ballte die Fäuste und zählte bis zehn. Ich war nicht in dieses Dorf gekommen, um Nobbys Kundschaft noch weiter zu dezimieren. Deshalb schluckte ich meine bissigen Kommentare und zwang mich zu einem neutralen bis semi-freundlichen Gesichtsausdruck. »Was gibt es denn für ein Problem?«
Hausmeister Jupp deutete verächtlich zur Wand in seinem Rücken.
»Da hat der richtige Krause am Freitag geschlitzt und eine neue Leitung verlegt. Die Lampe«, er zeigte nach oben, über seinen Kopf, ohne mich aus den Augen zu lassen, »hat er auch montiert. Hat heute Morgen den Geist aufgegeben.«
Ich stellte meinen Werkzeugkasten ab und betätigte den Lichtschalter.
»Mädchen, am Lichtschalter liegt das nicht. So schlau war ich auch schon«, brummte Jupp. Der Schulgong ertönte. Kunstlehrer Thomas wandte sich mir zu.
»Ich muss dann mal. Kunst mit der 4a.«
»Danke fürs Bringen.« Ich lächelte. »Dann mal viel Spaß mit den kleinen Monstern.«
Thomas zögerte, sah nachdenklich zum Hausmeister hinüber und zog ab. Zurück blieb ich, mit einem auch auf den zweiten Blick durchweg unangenehmen grauen Zeitgenossen.
Draußen verebbte das Kindergeschrei, und bald hörte ich nur noch Jupps asthmatisches Röcheln in meinem Rücken. Er sah mir über die Schulter und beobachtete jeden meiner Handgriffe. Der würzige Mix aus Käsefuß und Zigarre, der mich von hinten umwaberte, war schwer auszuhalten, mehr als das nervten mich allerdings seine Fragen.
»Woher kommst du? Aus Afrika?«
»Aus Ostwestfalen«, antwortete ich einsilbig und versuchte mich nicht auch noch darüber zu ärgern, dass er mich einfach duzte.
»Nein. Ich meine wirklich«, beharrte er. »Du bist keine Deutsche, das sieht man doch.«
»Ich bin in Bielefeld geboren. Im Schatten des Teutoburger Walds, direkt beim Hermann. Deutscher geht nicht.«
»Und deine Eltern? Sind die aus Afrika?«
»Nein.« Ich schwieg, denn ich hatte keine Lust, diesem Trottel meinen Stammbaum zu erklären. Jupp räusperte sich. Ich hörte, wie er in seiner Tasche wühlte, kurz darauf vernahm ich ein metallisches Klicken.
»Und du bist also Elektrikerin? So richtig mit Meisterbrief?«, setzte er das Verhör fort und zog etwas durch die Nase. Vermutlich Schnupftabak. Wieder dieses metallische Klicken. Am liebsten hätte ich ihm das Döschen durchs Nasenloch ins Hirn gestoßen.
»Noch bin ich Gesellin.«
»Eine N****in als Elektriker … Früher hätte es das nicht gegeben«, wunderte er sich. Ich wiederum wunderte mich, dass ich ihn für das N-Wort nicht unangespitzt in den Boden rammte. Aber er würde eh nicht begreifen, wie verletzend es war, deshalb schwieg ich, in der Hoffnung, dass Leute wie er über kurz oder lang aussterben würden. Heute weiß ich, wie falsch ich damals lag. Wenn heute jemand das N-Wort benutzt oder sich anderweitig rassistisch äußert, lasse ich das nicht mehr unkommentiert, egal wie einflussreich, sympathisch oder alt die Person ist. Das hat mich schon einige Jobs und Freundschaften gekostet – aber das ist eine andere Geschichte.
»Und warum heißt du Krause?«, bohrte Jupp weiter.
»Norbert Krause ist mein Vater.« Ich legte den Spannungsprüfer zur Seite. Die Leitung, die Nobby verlegt hatte, war in Ordnung, ebenso die neue Steckdose, zu der sie führte. Der Fehler lag entweder in der Lampe oder im alten Kabel, das zur Lampe führte. »Gibt’s hier eine Leiter?«
Jupp grunzte empört.
»Natürlich. Da hinten in der Ecke. Neben dem Sicherungskasten.«
Ich entfernte mich aus seinem Dunstkreis, schraubte die Sicherung für den Keller raus und schnappte mir die Leiter. Kurz überlegte ich, Jupp zu bitten, mich zu sichern, denn das Teil sah nicht sehr vertrauenswürdig aus. Doch ich entschied mich dagegen, noch weniger als dem morschen Holz vertraute ich diesem ätzenden grauen Mann, der mir jetzt schon eine Viertelstunde meiner kostbaren Lebenszeit mit seiner rassistischen Weltsicht versaut hatte.
Oben auf der Leiter gab ich alles, damit der alte Zausel meine Höhenangst nicht mitbekam. In größeren Höhen zu arbeiten, war ein fester Bestandteil meines Jobs, trotzdem drehte sich mir dabei regelmäßig der Magen um, besonders, wenn ich ohne Absicherung, mit beiden Händen über Kopf, auf einer wackligen, morschen Leiter stand. Endlich fand ich das Problem: Ein Kabelbruch in einer uralten Lüsterklemme im Deckenhalter, die das Lampenkabel mit der Zuleitung aus der Decke verband. Ich entfernte die alte Klemme und zog eine neue aus meiner Hosentasche.
»Warum bist du ausgerechnet Elektriker geworden? Das viele Lernen fällt euch doch sicher schwer?«
Ich starrte genervt auf Jupp herab. Er war schon wieder dabei, sich eine Line Schnupftabak zu ziehen.
»Wem soll es schwerfallen? Frauen? Oder Schwarzen?«, fragte ich heiser. Langsam verließ mich meine anerzogene Geduld. Bevor Jupp antworten konnte, enterte eine dralle Blondine den Raum.
»Herr Kahn, in der 3a ist das Waschbecken verstopft. Können Sie sich das bitte kurz ansehen?«
Jupp steckte das Döschen in die Tasche seines Kittels, schnäuzte sich in ein nicht mehr ganz weißes Taschentuch und musterte mich unschlüssig.
»Hat das noch Zeit?«, fragte er die Blondine. »Ich muss hier aufpassen …«
»Ich bin hier eh fertig«, unterbrach ich ihn. Das Ende des Lampenkabels steckte in der neuen Lüsterklemme, jetzt machte ich mich daran, das gebrochene Kabel etwas zu stutzen, abzuisolieren und ebenfalls in die Klemme zu stecken.
»Es ist wirklich dringend«, beharrte die Blondine. Jupp sah unschlüssig zu mir herauf. Ich zog die Lüsterklemme fest und schraubte den Deckenhalter zurück unter die Decke.
»Die Rechnung schicken wir wie immer per Post«, sagte ich und kletterte von der Leiter. Unten angekommen, klappte ich sie zusammen, schraubte die Sicherung wieder hinein und betätigte zur Kontrolle den Lichtschalter. Es wurde hell. Hausmeister Jupp brummte zufrieden. Ein Danke kam ihm natürlich nicht über die Lippen, aber das war mir herzlich egal. Ich konnte es kaum erwarten, aus diesem Kellerloch herauszukommen. Ob der alte Zausel den kleinen Jungen of Color auch so löcherte? Ihm das Gefühl gab, nicht dazuzugehören? Anders zu sein? Wenn ja, hoffte ich, dass der Knirps Eltern hatte, die ihn empowerten und die ihm beibrachten, sich gegen rassistische Sticheleien zu wehren. Microaggressions nannte Alice das. Man braucht ein dickes Fell, um davon nicht verletzt zu werden. Zum Glück hatte mich meine Mutter schon als Kleinkind darauf vorbereitet. Sie hatte lange Zeit in England gelebt, wo die Auseinandersetzung mit Rassismus sehr viel weiter fortgeschritten war als in Deutschland. Doch trotz ihrer Aufklärungsarbeit ließen mich solche Sticheleien damals nicht unbeeindruckt. Ehrlich gesagt treffen sie mich auch heute noch. Aber dank Alice wusste ich immer, dass ich okay bin und mich nicht vor weißen Menschen beweisen muss, nur weil ich eine andere Hautfarbe habe.
***
Als ich in den Betrieb zurückkehrte, war Peter schon wieder gegangen, denn für den Tag stand kein weiterer Einsatz an. Nobby hatte sich nach oben in seine Wohnung verzogen. Mir graute davor, den Rest des Tages Kabel und Schrauben im Lager zu sortieren, deshalb ließ ich mir von Frauke Nobbys erledigte Aufträge der letzten Wochen zeigen. Viele waren es allerdings nicht, schon am frühen Nachmittag hatte ich einen guten Überblick darüber, wo Nobby gearbeitet hatte und auf welche Probleme er gestoßen war. Anscheinend alles eher harmlose Jobs, meist ging es um brüchige Stromkabel oder Leitungen, die er verlegt hatte. Ich arbeitete mich in seine Orga ein – die im Grunde nur aus einem Ordner bestand, in dem er für seine Verhältnisse erstaunlich akribisch protokollierte, was er beim jeweiligen Kunden getan, wie lange er dafür gebraucht und welche Materialen er benutzt hatte. Frauke machte daraus dann eine Rechnung, die Nobby nur noch unterschreiben musste. Nobbys Aufzeichnungen der letzten Aufträge waren einwandfrei, es gab also nichts für mich zu tun, deshalb verzog ich mich dann doch ins Lager, inspizierte die Bestände und überlegte, wohin mein Vater den Spind mit den Geisterjägerwaffen geräumt hatte. Vermutlich hoch in seine Wohnung. Aber warum? Die Geräte jedes Mal die Treppe hinunter und hinauf zu wuchten erschien mir widersinnig. Irgendwann kurz vor Feierabend, ich kannte die Lagerbestände inzwischen auswendig, hielt ich die Langeweile nicht mehr aus. Ich schnappte mir den Autoschlüssel und fuhr zu KaySer. Frauke konnte den Laden ohne mich abschließen.
KaySer und ich kannten uns seit unserer Teenagerzeit. Ihren Eltern gehörte der Schrottplatz, auf dem Nobby regelmäßig nach Bauteilen für seine Geisterjägerwaffen suchte. Ursprünglich hatte KaySer Bildhauerin werden wollen, doch nach dem Tod ihres Vaters vor ein paar Jahren hatte sie ihr Studium abgebrochen und sich erstmal um ihre Mutter gekümmert. Als diese dann zurück in ihre Heimat Schottland zog, stand für KaySer fest, dass sie das Erbe ihres Vaters keinem Fremden überlassen wollte. Eine Künstlerin war sie trotzdem geworden: Sie schweißte faszinierende Gebilde aus Autowrackteilen zusammen und dekorierte damit den Schrottplatz.
Auf den ersten Blick wirkte KaySer maskulin, und das nicht nur, weil sie wie ein Mann rumlief, meist mit derben Schuhen, schlabbrigen Jeans und karierten Hemden. Sie war groß, kräftig gebaut, mit starken Armen, flacher Brust und muskulösen Beinen. Ihr Gesicht war markant, mit breiten Wangenknochen, einem eckigen Kinn und algengrünen Augen. Die lockigen roten Haare, die an den Seiten abrasiert waren und auf ihrem Kopf eine Handbreit in die Höhe standen, hatte sie von ihrer Mutter geerbt, die großen, quadratischen Hände und den sinnlichen Mund von ihrem Vater.
Ich schloss mein Fahrrad auf dem kleinen Parkplatz ab, der zum Schrottplatz gehörte. Direkt daneben, eingerahmt von KaySers neuesten Werken, zwei beeindruckenden Flugdrachen mit Flügeln aus verrosteten Autotüren, stand ein kleines Haus, in dem KaySer wohnte und in dem sich ihr chaotisches Büro befand. Ähnlich wie Nobby war KaySer eine Niete, wenn es um Ordnung und Struktur ging. Kein Wunder, dass sie fast ihre ganze Zeit auf dem Schrottplatz verbrachte.
Das Büro war leer, die Tür verschlossen, KaySer also vermutlich in ihrem Element. Und richtig, ich hörte sie in einiger Entfernung hämmern und schweißen. Eine etwa zwei Meter hohe Steinmauer, die mit bunten Graffitis besprayt war, schloss sich an das Haus an und schützte das Innere des Schrottplatzes vor neugierigen Blicken. Nur die Spitzen der Schrottberge, der uralte Kran und eine stahlblaue Schrottpresse, die in der Abendsonne funkelte, lugten darüber hinaus. Ich zog die weißlackierte Stahltür in der Mauer auf und ging auf den Geräuschherd zu.
KaySer schweißte zwei Metallplatten aneinander und produzierte dabei einen imposanten Funkenkranz, der wild um sie herum irrlichterte. Ich blieb mit zwei Metern Abstand neben ihr stehen. Sie trug ihre »Arbeitskleidung«: Sicherheitsschuhe, abgewetzte Jeans und ein kariertes, feuerfestes Hemd in den Farben des Clans ihrer Mutter, also grün, blau und rot. In Kombination mit dem Schweißhelm sah sie aus wie eine Gladiatorin im Karnevalskostüm. Als sie mich bemerkte, klappte sie ihren Helm nach oben und grinste breit.
»Krause! Ich dachte schon, du willst mich nicht sehen!«
»Ich bin erst gestern Abend angekommen«, grinste ich zurück. »Musste mich erstmal um Nobby kümmern.« KaySer legte Schweißgerät und Helm zur Seite, zog diezog die Arbeitshandschuhe aus und nahm mich in den Arm.
»Besser spät als nie. Wie geht’s dir, Kleine?« Sie war die Einzige, die mich so nennen konnte, denn trotz meiner einsvierundachtzig überragte sie mich um einen halben Kopf.
»Ich vermisse die Großstadt«, antwortete ich und dachte an die ängstlichen Kinderaugen. Und an die nervigen Fragen von Hausmeister Jupp.
»Du wirst ja nicht ewig bleiben müssen«, lachte KaySer und zog mich zu einem Wohnmobil, das zwar nicht mehr fahrtüchtig war, dafür aber umso liebevoller eingerichtet. Die meiste Zeit des Jahres hielt sich KaySer hier auf, ins Haus ging sie nur, um zu duschen, etwas zu kochen oder weil sie Bürokram erledigen musste. »Setz dich«, sagte sie und deutete auf die zwei Campingstühle vor dem Wagen unter einer verwitterten Markise. Dazwischen stand ein wurmstichiger Holztisch. »Ich hab uns extra Weißbier gekauft.« Sie verschwand im Inneren des Wagens. »Hast du Hunger?«
»Nee, danke.« Ich fläzte mich auf einen der beiden Stühle und schaute in den blutorangefarbenen Abendhimmel. Kurz darauf kam KaySer mit zwei Bierflaschen zurück und ließ sich in den anderen Stuhl fallen. Sie zog ein Feuerzeug aus der Hemdtasche, öffnete die Flaschen, und wir stießen scheppernd an.
»Slàinte Mhath«, prostete KaySer.