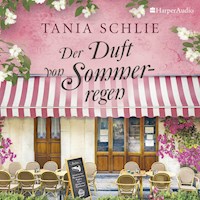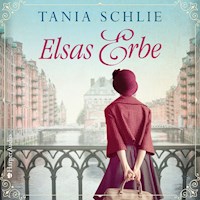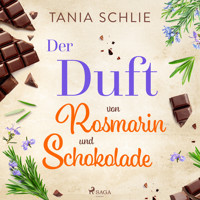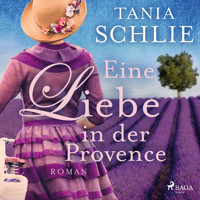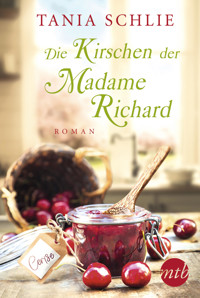Elsas Erbe, Und über uns das Blau des Himmels & Das Flüstern der Vergangenheit E-Book
Tania Schlie
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wenn die Hoffnung das einzige Licht in der Dunkelheit ist ELSAS ERBE: Ein Dorf nahe Hamburg, Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Tochter des reichen „Kiesbarons“ Georg Heller soll Elsa eines Tages die Nachfolge ihres Vaters antreten – doch plötzlich verlässt dieser die Familie für eine andere Frau. Ohne Vorwarnung ist Elsa nun auf sich allein gestellt. Doch selbst in ihrer dunkelsten Stunde, bleibt ihr eines erhalten: der feste Wille, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. UND ÜBER UNS DAS BLAU DES HIMMELS: Berlin, 1942. Die bodenständige Marlis hilft im Laden ihrer Familie aus, während die schöne Johanna am Theater tanzt. Doch eines Tages steht sie verzweifelt vor Marlis’ Tür: Ein SS-Offizier erpresst Johanna, damit sie seine Geliebte wird. Tags darauf ist sie verschwunden. Auf der Suche nach ihr muss Marlis gegen Zweifel und bitteren Verrat ankämpfen – und gibt doch alles, um ihre Freundin zu retten … DAS FLÜSTERN DER VERGANGENHEIT: München in den 60er Jahren. Elisabeth will als Modeschneiderin ein selbstbestimmtes Leben zu führen – doch dann wird sie ungewollt schwanger, von einem Mann, der sie nicht liebt. Muss sie ihren Wunsch für immer aufgeben? Lüneburg, 2018. Ein altes Familienfoto stellt das Leben der Grafikdesignerin Nell völlig auf den Kopf: Darauf ist sie als Baby zu sehen – im Arm einer Unbekannten. Hat sie ihre richtige Mutter womöglich nie kennengelernt? Ein bewegender Sammelband für alle Fans von Charlotte Roth und Tabea Bach
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1655
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
ELSAS ERBE: Ein Dorf nahe Hamburg, Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Tochter des reichen „Kiesbarons“ Georg Heller soll Elsa eines Tages die Nachfolge ihres Vaters antreten – doch plötzlich verlässt dieser die Familie für eine andere Frau. Ohne Vorwarnung ist Elsa nun auf sich allein gestellt. Doch selbst in ihrer dunkelsten Stunde, bleibt ihr eines erhalten: der feste Wille, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen.
UND ÜBER UNS DAS BLAU DES HIMMELS: Berlin, 1942. Die bodenständige Marlis hilft im Laden ihrer Familie aus, während die schöne Johanna am Theater tanzt. Doch eines Tages steht sie verzweifelt vor Marlis’ Tür: Ein SS-Offizier erpresst Johanna, damit sie seine Geliebte wird. Tags darauf ist sie verschwunden. Auf der Suche nach ihr muss Marlis gegen Zweifel und bitteren Verrat ankämpfen – und gibt doch alles, um ihre Freundin zu retten …
DAS FLÜSTERN DER VERGANGENHEIT: München in den 60er Jahren. Elisabeth will als Modeschneiderin ein selbstbestimmtes Leben zu führen – doch dann wird sie ungewollt schwanger, von einem Mann, der sie nicht liebt. Muss sie ihren Wunsch für immer aufgeben? Lüneburg, 2018. Ein altes Familienfoto stellt das Leben der Grafikdesignerin Nell völlig auf den Kopf: Darauf ist sie als Baby zu sehen – im Arm einer Unbekannten. Hat sie ihre richtige Mutter womöglich nie kennengelernt?
Eine Übersicht über die Autorinnen finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
Sammelband-Originalausgabe April 2025
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Eine Übersicht über die Copyrights der einzelnen Romane, die im Sammelband enthalten sind, finden Sie am Ende dieses eBooks.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: dotbooks GmbH, München
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (vh)
ISBN 978-3-98952-706-5
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Tania Schlie, Verena Rabe und Sabine Neuffer
Elsas Erbe, Und über uns das Blau des Himmels & Das Flüstern der Vergangenheit
Drei Familiengeheimnisromane in einem eBook
dotbooks.
Tania SchlieElsas Erbe
Wer alles zu haben scheint, vergisst leicht, was wirklich zählt. – Ein Dorf von den Toren Hamburgs zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Sie ist jung, schön und selbstbewusst: Als Tochter eines vermögenden Mannes wächst Elsa in besten Verhältnissen auf. Stets ist ihr bewusst, dass sie eines Tages die Nachfolge ihres Vaters antreten wird. Doch Georg Heller, der „Kiesbaron“, ist ein Patriarch alter Schule. Treu kann er nur sich selbst sein – und so verlässt er seine Familie wegen einer anderen Frau. Plötzlich fühlt Elsa sich wie im freien Fall. Sie muss nicht nur den gesellschaftlichen Abstieg verkraften, sondern ist zum ersten Mal in ihrem Leben auf sich allein gestellt. Aber einen Teil ihres Erbes kann Elsa niemand streitig machen: den festen Willen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen!
Prolog
Auf den ersten Blick war Georg Heller ein Mann voller Würde. Angetan mit einem pelzgesäumten Mantel der die untersetzte Gestalt noch breiter machte, schritt er die Stufen seines Hauses hinab. Die hochherrschaftliche Villa war das größte Haus in Roseburg. Man verfügte dort über den einzigen Fernsprechanschluß in der ganzen Gegend, was man schon daran sah, daß die Telefonnummer schlicht »1« lautete. Unter den drei mächtiger Kastanien, die, zwei rechts und eine links, am Fuß der Treppe standen und deren Asymmetrie er jeden Morgen aufs neue als Angriff auf seine Herrlichkeit empfand, zündete Heller sich die erste Zigarre des Tages an und paffte den Rauch in die Morgenluft. Nachdem er auf diese Weise seine Duftmarke gesetzt hatte, marschierte er auf die Kutsche zu. Er mußte nicht auf die Uhr sehen, um zu wissen, daß es genau fünf Uhr zweiundfünfzig war wenn er nach einem knappen »Moin« neben dem Kutscher Platz nahm, gerade rechtzeitig, damit er um sechs Uhr am Bahnhof eintraf, wo der Zug bereits wartete.
Elsas Rolle in dieser morgendlichen Zeremonie bestand darin, ihrem Vater von einem Fenster im oberer Stockwerk aus zuzusehen. Sie durfte sich nicht von ihm verabschieden, eigentlich durfte sie um diese frühe Stunde noch gar nicht aufsein. Aber die Angst trieb sie aus. dem Bett. Sie stand am Fenster, die kalten Füße gegeneinanderreibend, weil sie wußte, daß es ihren Vater beschützen und ihn abends sicher wieder nach Hause bringen würde, wenn sie ihn nicht aus den Augen ließ, bis die Kutsche hinter dem großen Mühlteich nach rechts abbog und aus dem Blickfeld verschwand.
Jahre später, als die kindliche Magie ihre Zauberkraft verloren hatte, verließ Georg Heller eines Tages das Haus, um ein neues Leben anzufangen, in dem für Elsa kein Platz war, und um mutwillig zu zerstören, was sein Vermächtnis sein sollte.
Kapitel 1
»Jetzt hör doch um Gottes willen auf, so herumzuzappeln.« Bevor sie entwischen konnte, griff Hulda nach Elsas Arm und zog sie zu sich heran. Am Fuß der Treppe, die sich über zwei Stockwerke nach oben wand, hörten sie Georg Heller ungeduldig mit dem Spazierstock auf das Eichenparkett pochen.
»Hulda, was treibt ihr da oben? Wann können wir denn nun endlich?« rief er ungeduldig.
»Wir sind gleich soweit!« rief die Kinderfrau zurück. »Jetzt bleib doch mal stehen«, fuhr sie Elsa an. »Sonst fährt er noch ohne dich.« Unsanft stellte sie das Mädchen vor sich hin und ging in die Knie, um ihm die seitlich angebrachten silbernen Knöpfe des knielangen Mantels zu schließen. Während Elsa mit vor Aufregung zusammengekniffenen Augen stillhielt, überprüfte ihre Kinderfrau den Sitz des weißen Matrosenkragens und zupfte mit raschem Griff eine Locke unter dem weiten, ebenfalls weißen Hut hervor. Nach einem letzten prüfenden Blick gab sie ihr einen Klaps auf den Po und schubste sie in Richtung Tür.
»Viel Spaß!«
Elsa drehte sich noch einmal um und warf ihr einen Luftkuß zu. Sie rannte aus dem Zimmer. An der Treppe schwang sie sich auf das auf Hochglanz polierte Geländer und rutschte hinunter, direkt in die Arme ihres Vaters, der sie unten auffing, während von oben Hulda mit dem Finger drohte. An normalen Tagen würde Elsa niemals das Geländer hinabrutschen, wenn sie dabei beobachtet wurde, aber heute war ein besonderer Tag. »So geht's schneller«, flüsterte sie ihrem Vater ins Ohr. Der schnippte mit einem gespielt bösen Blick die Asche seiner Zigarre von dem schwarzen doppelreihigen Mantel.
Hulda schimpfte oben an der Treppe. »Elsa, ich hab dir doch schon tausendmal gepredigt, daß das Geländer nicht zum Rutschen da ist! Aber wenn dein Vater auch nichts dazu sagt ... So benimmt sich doch kein Mädchen, Herr Heller ...!« Als die beiden unten grinsen mußten, wuchs ihr Zorn. Hulda war die einzige, die sich ihrem Herrn gegenüber einen respektlosen Ton herausnehmen durfte. Meistens quittierte er ihr Gezeter mit einem hilfesuchenden Blick zur Decke, was sie noch wütender machte. »Elsa, jetzt sieh doch nur mal dein Kleid. Gerade frisch angezogen und schon wieder kraus!« Sie wollte die Treppe hinuntereilen, um sich erneut an Elsas Garderobe zu schaffen zu machen, doch Georg ergriff die Hand seiner Tochter, und dann waren beide aus dem Haus, wo Franz Heinrich bereits in seiner Kutsche wartete.
Sie fuhren durch das Tor auf die Straße und dann rechts an der niedrigen Mauer aus großen Feldsteinen entlang, hinter der sich der parkähnliche Garten befand, der zur Villa gehörte. Der Garten war der ganze Stolz von Elsas Mutter. Karoline Heller richtete sich auf, um ihrem Mann und ihrer Tochter nachzusehen. Elsa rief ihr einen Gruß zu, als die Kutsche auf dem kurzen Weg zum Bahnhof vorüberfuhr. Karoline winkte kurz, dann beugte sie sich wieder über ihre Rosen.
***
Vor einer Woche war Elsa Heller neun Jahre alt geworden, und an diesem Sonnabend nahm ihr Vater sie zum erstenmal mit nach Hamburg. Sie bestiegen in Roseburg den Frühzug, nach wenigen Minuten stiegen sie in Büchen um in den Expreßzug, der sie innerhalb einer guten Stunde nach Hamburg bringen sollte. Während der Fahrt saß Elsa beinahe die ganze Zeit still. Stolz und Vorfreude auf den Ausflug ließen sie ihre Zappeligkeit vergessen.
»Moin, Herr Heller«, rief der Kontrolleur und legte die Hand an die Mütze. »Wat höbt Sei denn dor vön hübsches Fieken bi sick?«
»Dat ist miene Dochter, Elsa. Dei ist nu ok all so grot worn.«
Elsa nahm das Lob nur zerstreut wahr. Sie wartete gespannt darauf, ob ihr Vater die Billetts aus der Tasche ziehen würde oder ob es wieder einmal auf einen Eklat hinausliefe. Georg Heller machte sich nämlich einen Spaß daraus – und hielt es nebenbei auch noch für sein gutes Recht –, auf das Lösen der Fahrkarte zu verzichten. »Wer hat denn schließlich die Schienen von Güster nach Roseburg verlegen lassen, wenn nicht ich?« erregte er sich bei solchen Gelegenheiten. »Hätte ich damals nicht investiert, die Güsteraner müßten immer noch zu Fuß gehen oder sogar den Umweg über den Kanal nach Lübeck machen!«
Dem Schaffner, der durch das Kompliment für die Tochter gute Stimmung verbreiten wollte, war die Erleichterung anzusehen, als Georg Heller, nachdem er so getan hatte, als suche er in allen Taschen, mit einem verschmitzten Augenzwinkern die Fahrkarten hervorzog und sie mit einem lauten »Ach, da sind sie ja!« dem Kontrolleur unter die Nase hielt, der sie abknipste und mit einem »Schönen Dach ok!« das Abteil verließ.
»Eigentlich schade, daß Mama nicht dabei ist«, sagte Elsa etwas später, da fuhren sie schon durch Hammerbrook.
Ihr Vater blickte sie kurz über den Rand seiner Zeitung hinweg an, dann schüttelte er das Blatt wütend, um einen Knick herauszubringen. Elsa wußte, daß sie etwas Falsches gesagt hatte. Ihre Eltern waren nicht gerade wie gute Freunde, und es gab nicht viele Gelegenheiten, bei denen man sie gemeinsam sah. Trotzdem ließ sie nicht locker.
»Ich würde es schön finden, wenn wir mal alle zusammen irgendwohin fahren«, sagte sie in Richtung der Zeitung.
Georg faltete das Blatt mit einem Brummen zusammen und sah Elsa an. »In Ordnung, ich habe sie gefragt, ob sie mitkommen will, und sie hat abgelehnt. Irgendwas mit Nachbarinnen und Häkeln, du kennst das ja. Und wenn ich recht weiß, bist du ganz froh, daß du nicht dabeisein mußt.«
»Sticken, Papa, nicht häkeln«, murmelte sie und sah ihn mißtrauisch an, weil sie ihm nicht glaubte.
»Jetzt komm mal rüber zu mir. Gleich kannst du die Elbe und die großen Schiffe sehen.«
Sie setzte sich neben ihren Vater und ließ sich von ihm die Hafenanlagen erklären.
***
Kurze Zeit später lief der Zug im Hamburger Hauptbahnhof ein. Beim Aussteigen nahm Elsa die Hand ihres Vaters und ließ sie nicht mehr los. Der Lärm in der riesigen Bahnhofshalle, die vielen Menschen, die in unterschiedlichen Sprachen redeten und von denen einige Kleidung trugen, die sie noch nie gesehen hatte, machten ihr angst. Noch nie hatte sie so viele Menschen an einem Ort gesehen. Als direkt neben ihr ein Lautsprecher losdröhnte, schrie sie erschrocken auf und umklammerte Georgs Arm. Er drückte sie an sich, und gemeinsam bahnten sie sich ihren Weg durch die Menge.
»Ich verstehe nicht, warum man den Bahnhof nicht größer gebaut hat. Hier ist doch gar nicht genug Platz für alle.«
Ihr Vater lachte. »Doch, der reicht schon aus. Guck dir nur mal die Bahnsteige an: so lang wie drei Fußballfelder. In der Stadt haben die Leute nun mal nicht so viel Platz wie bei uns in Roseburg.«
Heller berührte die Geschäftigkeit um ihn herum nicht. Er fuhr oft in die Hansestadt, mindestens jede Woche einmal, der Geschäfte wegen. Seit die Stadt vor kurzem mit dem Bau der Hamburger Hochbahn begonnen hatte, für deren Tunnel, Brücken und Bahnhöfe die Hellerschen Werke den Kies lieferten, war er womöglich noch häufiger unterwegs.
***
Elsa mochte die Hand ihres Vaters auch nicht loslassen, während sie mit ihm die Mönckebergstraße entlangspazierte. Der imposante Straßendurchbruch zwischen Hauptbahnhof und Rathaus war durch den Abriß der anliegenden Gängeviertel entstanden. Seit über drei Jahren wurde hier schon gebaut.
»Hier haben früher die Hamburger Arbeiterfamilien gelebt, zig Familien mit unzähligen Kindern in einem Haus. Und für alle nur ein Klosett auf dem Hof!« Der Stolz in Georg Hellers Stimme war unüberhörbar. Schließlich hatte er in seiner Roseburger Villa die erste Toilette mit Wasserspülung einbauen lassen. »Aus dem Wasserhahn kam das dreckige Elbwasser, und daneben alle möglichen Tiere, sogar Aale. Stell dir mal vor, du willst dich waschen, und dann glibbert so ein Fisch in deine Hände.« Er kitzelte ihre Handinnenflächen mit den Fingerspitzen.
Elsa schüttelte sich.
Vater und Tochter hatten das Klöpperhaus passiert, als sich rechts vor ihnen das majestätische Gebäude des Warenhauses Karstadt erhob, das gerade eröffnet worden war, und auf der anderen Straßenseite, in einer Linie mit der Front der Bürogebäude, der Turm von St. Petri. Elsa legte den Kopf in den Nacken, um nach oben zu sehen, zu den imposanten Fassaden mit den riesigen Fensterfronten und umlaufenden Balkonen, die auf sie herabzustürzen drohten, wenn sie sie lange genug fixierte. Georg Heller hatte keinen Blick für die moderne Architektur. Er hielt die Augen auf das Trottoir gerichtet und inspizierte voller Stolz die Bepflasterung. »Gleichzeitig hart und elastisch, elegant und praktisch, wie das neue Jahrhundert«, schwärmte er. Er tänzelte ein wenig auf den Zehenspitzen umher und machte einen kleinen Hüpfer. Elsa bemerkte dieses für ihren Vater ziemlich ungewöhnliche Verhalten und lachte laut heraus.
Er machte eine letzte Drehung und sagte: »Lach du nur ruhig. Worüber du hier gerade läufst, ohne einen Blick daran zu verschwenden, ist bester Kies aus Güster. Mein Kies! Ich ...«, bei diesem Wort tippte er sich mit dem Daumen gegen die Brust, »ich habe ihn nach Hamburg geschafft, per Zug, versteht sich, und nicht über den ollen Kanal. Ich hatte eben den richtigen Riecher. Alles bester Kies, das merkt man sofort«, versicherte er wiederholt, »alles feinster Heller-Kies aus Güster, ha!«
Elsa sah auf den Boden und versuchte zu begreifen, wie sich die körnige Masse, die im Werk ihres Vaters in riesigen Mengen aus tieferen Erdschichten gebaggert wurde, in die hell und dunkel gemusterten Steine verwandelt haben konnte. Heller sah ihr an, daß sie zweifelte. Übermütig griff er nach ihrer Hand und wirbelte sie einmal um die eigene Achse. »Komm, wir gehen fliegen!« Jetzt verstand Elsa gar nichts mehr, aber er zog sie einfach hinter sich her, wobei er hin und wieder seine kleinen Hüpfer machte.
Sie betraten eines der neuerbauten Kontorhäuser und durchquerten die elegante, in weißem Marmor gehaltene Eingangshalle, bis sie vor einem Kasten standen, in dem sich holzgetäfelte Kabinen auf der linken Seite langsam nach oben, auf der rechten Seite ebenso langsam abwärts bewegten. Auf dem Schild links daneben stand ein Wort, unter dem Elsa sich absolut nichts vorstellen konnte: »Stetigförderer« und darunter »Hinweise zur Benutzung des Gefährts«.
Elsa blieb nichts übrig, als hinter ihrem Vater, der ihre Hand nicht losließ, in eine der Gondeln zu springen. Sie kreischte auf, als es plötzlich dunkel wurde und dicht vor ihr eine Wand nach unten wegrutschte. Sekunden später erreichten sie das nächste Stockwerk und sahen den hellen Fußboden eines langen Korridors aufblitzen, dann wurde es wieder dunkel. »Das ist ein Paternoster«, sagte Heller in das Schwarze hinein. »In der nächsten Etage steigen wir aus.« Als sich das Loch wieder auftat, warteten sie, bis der Kabinenboden auf der Höhe des Linoleums war, dann machten sie einen großen Schritt und standen wieder auf festem Boden.
»Noch mal!« bettelte Elsa, und sie stiegen wieder ein.
»Es kommt noch besser«, .sagte Georg Heller triumphierend. Sie fuhren zwei Stockwerke aufwärts, dann las Elsa im Vorbeifahren ein Schild »Ende der Fahrt«. Die Kabine fuhr weiter nach oben und bewegte sich mit einem lauten Rumpeln plötzlich zur Seite. Elsa schrie vor Aufregung, während ihr Vater lachte. Einen Augenblick später fuhren sie wieder abwärts. Im Erdgeschoß stiegen sie aus und wollten sich vor Lachen ausschütten.
»Noch mal«, sagte Elsa wieder. Sie fuhren noch dreimal rauf und runter, das letzte Mal fuhr Elsa sogar allein, während ihr Vater unten wartete.
»Wir müssen gehen«, sagte er, als sie stolz und glücklich über ihren Mut wieder vor ihm stand.
Sie verließen das Kontorhaus und sahen zwei Querstraßen weiter die glitzernde Oberfläche der Binnenalster, in deren Mitte sich die künstliche Kaiserinsel auf ihren siebenhundertfünfzig in den Grund gerammten Pfählen erhob. Elsa wäre gern mit einem der weißen Boote gefahren, die rechter Hand unter der Lombardsbrücke hervorkamen und die Binnenalster überquerten, um dann vor der Fassade des Warenhauses Tietz festzumachen, das ebenfalls gerade erst seine Pforten geöffnet hatte. Gegenüber von Tietz, an der Wasserseite, befand sich der von den Hamburgern wegen seiner Architektur »Kachelofen« genannte Alsterpavillon. Das Traditionscafé war Ziel vieler Einheimischer und Auswärtiger, die sich bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Sahnetorte von ihren Einkäufen ausruhten, Geschäfte machten oder eine der vierhundert ausliegenden Tageszeitungen lasen. Hierher lenkte auch Georg Heller seine Schritte. Auf dem breiten Trottoir mußten sie sich einen Weg durch die vielen Menschen bahnen, die ihnen entgegenkamen oder in Gruppen zusammenstanden. Ständig fuhren Kutschen und manchmal auch eins der ersten Autos vorbei oder hielten an, um Leute aussteigen zu lassen. Elsa mußte Sonnenschirmen, kleinen Kindern und Hunden an der Leine ausweichen. Sie überquerten die palmenbestandene Terrasse vor dem Haus, und Elsa bestaunte die Jugendstilfiguren in der großen Halle, während sie hinter ihrem Vater herging, der auf einen Tisch in einer der ruhigeren Veranden auf der Wasserseite zustrebte. Erleichtert, der übergroßen Hektik entkommen zu sein, ließen sie sich in die tiefen Korbstühle fallen. Eine Minute später stand ein Kellner vor ihnen. Er begrüßte ihren Vater mit Namen und fragte: »Einen Kaffee, wie immer? Nummer siebenhundertdreizehn, wenn ich nicht irre?«
»Sie irren nicht«, antwortete Heller gutgelaunt. »Und für meine Tochter eine Tasse Schokolade.«
»Was meinte er denn damit?« fragte Elsa, nachdem der Kellner gegangen war.
»Wichtige Stammkunden haben hier ihre eigene Tasse.« Georg machte ein bedeutsames Gesicht, als er Elsas große Augen sah, dann mußte er lachen. »Man sollte meinen, die haben diese Sitte, weil sie die Dinger nicht spülen.«
Elsa war unsicher, ob sie ihm Glauben schenken durfte, traute sich dann aber doch nicht, den Kellner danach zu fragen, der schwarzbefrackt vor ihnen stand und eine mit Kirschen bemalte Tasse, die tatsächlich in verschnörkelter Schrift die Nummer siebenhundertdreizehn trug, vor ihrem Vater abstellte. Sie löffelte die steife Sahne von ihrer heißen Schokolade und sah den Booten und den Schwänen zu. Trotzdem bemerkte sie, wie ihr Vater sich immer wieder suchend umblickte. Nachdem sie ihn zum dritten Mal auf einen der Ausflugsdampfer aufmerksam gemacht hatte, der gerade unten festmachte, und er abwesend genickt hatte, ohne auch nur hinzusehen, wurde sie ärgerlich.
»Wo guckst du denn immer hin?« fragte sie.
Zu ihrer Empörung reagierte Georg Heller auch diesmal nicht. Stattdessen erhob er sich, knöpfte eilig sein Jackett zu und eilte einer Frau entgegen, um ihr die Hand zu küssen und sie an seinen Tisch zu führen.
Elsa starrte die Fremde unverhohlen an. Sie war groß, vielleicht sogar ein paar Zentimeter größer als ihr Vater, und sehr schlank. Ihr weißes Kleid war keineswegs üppig mit Volants und Spitze versehen, sondern fiel schlicht an ihr herunter, was ihre Figur sehr betonte. Sehr gewagt, aber sehr schick, fand Elsa. Das Gesicht war ebenmäßig, die Haut fein. Unter der kecken Nase kräuselte sich jetzt ein Mund, der so rot geschminkt war, daß Elsa zweimal hinsehen mußte.
»Und du bist wohl Elsa?« fragte sie an Stelle einer Begrüßung. »Mein Name ist Anna Köster.« Dabei strich sie sich eine Locke ihres hellbraunen Haares aus der Stirn. Sie trug keinen Hut!
Elsa nickte nur mit offenem Mund. Die Frau verschlug ihr die Sprache. Sie wußte nicht genau, ob sie sie einschüchterte oder faszinierte. Noch nie hatte sie eine derart attraktive Frau vor sich gehabt, die den Kopf so hoch trug. Einen Moment fragte sie sich, ob sie wohl eines von diesen liederlichen Frauenzimmern sein könnte, von denen die Erwachsenen manchmal redeten, aber das war ja wohl unmöglich, schließlich schien ihr Vater sie gut zu kennen. Aber trotzdem: Ihre Mutter wäre niemals ohne Begleitung in ein Café gegangen. Und erst recht nicht ohne Hut!
Mit der größten Selbstverständlichkeit setzte sich die fremde Frau auf den Platz am Fenster, den vorher ihr Vater innegehabt hatte, und ließ sich von ihm den Stuhl an den Tisch rücken. Sie hielt ihm eine Einkaufstüte hin, in der hellgelbes Seidenpapier raschelte. Er nahm sie, hielt sie ein wenig ratlos an sich gedrückt und stellte sie dann neben seinen Stuhl.
Auch Frau Köster hatte hier ihre numerierte Tasse, und Elsa kam aus dem Staunen gar nicht wieder heraus. Man bestellte dreimal Schwarzwälder Kirsch, Kaffee und noch eine heiße Schokolade für Elsa.
***
Später gingen sie zu dritt die Großen Bleichen hinunter. Georg Heller hatte Frau Köster seinen rechten Arm geboten, und so blieb für Elsa nur die ungewohnte linke Hand. Am Ende der Straße betraten sie das Atelier eines Fotografen, von dessen Fenster aus man auf das Wasser des Fleets sehen konnte.
Georg nahm auf einem Lehnstuhl Platz, der unter seiner schweren Gestalt fast völlig verschwand. Er war immerhin schon ein Mann von einundvierzig Jahren, kein schöner Jüngling mehr, aber doch eine imposante Gestalt, ein Mann in der Blüte seiner Jahre, der durch Reichtum und Einfluß beeindruckte. Der Bowler war zu klein für seinen massigen Kopf, zwischen Krempe und Ohren blieben gut fünf Zentimeter Raum und gaben den Blick auf das dunkle Bürstenhaar frei. Der Hut wurde so lange auf seinem Kopf zurechtgerückt, bis Frau Köster zustimmend nickte. Heller legte die Füße übereinander, so daß die Knie leicht gespreizt waren. Die Linke hielt die Zigarre, die Rechte hatte er ursprünglich auf den edlen Spazierstock gestützt, sich dann aber anders besonnen und ihn beiseite gelegt. Die Hand ruhte nun in seinem Schoß, nachdem sie die schwere goldene Uhrkette ins Bild gerückt hatte. Seine Miene mit den fleischigen Wangen, die von dem ausladenden Zwirbelschnauzer geteilt wurden, war ernst, erst im letzten Augenblick ließ er ein kleines, selbstzufriedenes Lächeln sehen. Am auffälligsten in seinem Gesicht war die mächtige Grube, die senkrecht am Kinn verlief und jedesmal hervortrat, wenn er an seiner Zigarre zog.
An seiner Seite, ihm zugewandt, den Kopf auf der Höhe des seinen, stand Elsa, deren Gesicht einen träumerischen, beinahe verlorenen Ausdruck annahm. Ihre linke Körperhälfte verschwand hinter ihrem Vater, der rechte Arm hing kraftlos herunter, der Ärmel ihres weiten Mantels mit dem weißen Aufschlag ließ die Hand frei, die noch ein wenig Babyspeck zeigte. Der Matrosenkragen war von Anna Köster noch einmal gerichtet worden, sie hatte sogar die runden Silberknöpfe mit einem Spitzentaschentuch poliert – wobei sie vorher nicht in das Tuch gespuckt hatte, wie Elsa dankbar feststellte. Am auffälligsten an ihrer Mädchengestalt war der große weiße Hut, der mit seiner abstehenden Krempe wie der Kelch eines Schneeglöckchens aussah. Elsa hatte einen schön geformten Mund, doch auch in ihrem Gesicht zeichnete sich bereits das charakteristische Kinn ab, das die untere Gesichtshälfte beherrschte und ihrer späteren Schönheit einen kleinen Makel versetzen würde.
Elsa gab sich Mühe, dem Ernst der Ateliersituation gewachsen zu sein. Sie stand bewegungslos, so wie der Fotograf sie postiert hatte, und schaute angestrengt in die Kamera. Im letzten Moment jedoch, als der Fotograf den Auslöser drückte, wandte sie die Augen ganz leicht ab und sah auf einen Punkt schräg hinter ihm. Dort stand im Halbdunkel Anna Köster. Ihre Gegenwart und mehr noch ihre offensichtliche Vertrautheit mit dem Vater machten sie unruhig. Sie hatte sehr wohl bemerkt, wie ihr Vater kurz nach der Hand von Anna gegriffen und sie sie ihm, nachdem sie einen Blick von Elsa aufgefangen hatte, hastig entzogen hatte.
***
Am Abend saß Karoline Heller am Bett ihrer Tochter, um ihr gute Nacht zu sagen. Elsa berichtete noch einmal ausführlich über alles, was sie an diesem Tag in Hamburg erlebt hatte. Sie übertrieb den Mut, den es gekostet hatte, allein mit dem Paternoster zu fahren, und machte die Portion Eis, die sie gegessen hatte, noch größer, als sie ohnehin schon gewesen war. Karoline fragte, ob ihr der Tag gefallen habe, und Elsa dachte daran, ihr von Anna Köster zu berichten. Aber sie sagte nichts. Als das Licht gelöscht war und sie allein in ihrem Bett lag, spürte sie im Bauch die Faust ihres schlechten Gewissens.
Kapitel 2
Karoline Heller, geborene Jakobi, war eine einfache Frau. Ihre Herkunft aus einem Bauernhaushalt war an ihrer kräftigen und breithüftigen Gestalt abzulesen. Sie bewegte sich ohne Grazie und trat mit schweren Füßen auf, aber sie besaß ein edles Profil mit einer geraden Nase, die in der flachen, hohen Stirn endete. Ihr dunkelbraunes Haar war zeit ihres Lebens nicht geschnitten worden und reichte ihr bis zu den Fersen. Jeden Abend vor dem Schlafengehen wurde es sorgfältig gebürstet. Kurz vor ihrer Verlobung bedrängte ein Lübecker Haarwuchsmittelfabrikant sie, der mit ihrem Foto auf seinen Fläschchen werben wollte, doch sie lehnte ab.
Als sie im ersten Jahr des neuen Jahrhunderts neben Georg Heller unter den sieben mächtigen Bäumen, dem der Ort Siebeneichen im Volksmund seinen Namen verdankte, auf die aus groben Feldsteinen erbaute Kirche zuschritt, um dort ihr Jawort zu geben, war sie einundzwanzig Jahre alt, neun Jahre jünger als der Bräutigam. Sie betrat die Kirche und blickte um sich, während sie den seitlichen Gang zum Altar entlangging. Die Hochzeitsgemeinde saß in den leuchtendblauen Bänken zu ebener Erde und auf beiden Seiten der hölzernen Empore. Schräg links oben konnte sie in ihrer Loge hinter Glas die alte Gräfin vom Schloß Wotersen erkennen. Sie bildete sich ein, daß die Gräfin nicht wie gewöhnlich zum sonntäglichen Gottesdienst erschienen war, sondern um ihrer Trauung die Ehre zu geben. Schließlich arbeitete ihr Zukünftiger seit einigen Wochen neben seinem eigentlichen Beruf als Roseburger Müller als Forstverwalter auf dem Schloß und fing gerade an, den dortigen Holzhandel neu zu organisieren. Karoline grüßte verhalten nach hier und dort. Sie fühlte Dank und Stolz angesichts der vielen Anwesenden. Aber auch ohne daß es im Angesicht Gottes unschicklich gewesen wäre, Hochmut zu zeigen: In diesem Augenblick kannte sie keinerlei Ehrgeiz und hatte sich auf ein bescheidenes Leben an der Seite eines Müllers mit Neigungen zum Holzhandel eingerichtet.
***
Ihr Mann hatte Größeres im Sinn, das wurde rasch nach der Eheschließung deutlich. Er war das vierte von fünf Kindern, und als ältestem Sohn stand ihm die Weiterbewirtschaftung der Umtauschmühle zu. Doch selbst dieses Erbe, das ihm ein sicheres Einkommen ermöglichte, war ihm nicht genug, und wenn er sich ansah, was aus seinen Geschwistern wurde, dann packte ihn die kalte Verachtung. Seine Schwestern hatten Bauern genommen und sein jüngerer Bruder in Hamburg in ein Fischgeschäft eingeheiratet. Heller sah das Übel in den alten familiären Strukturen, die immer noch Handel und Produktion bestimmten. Für die überkommene Denkungsart der ansässigen Bauern und Kaufleute, die immer schön vorsichtig, in überschaubaren Größen und mit den immer gleichen Handelspartnern Geschäfte machten, so wie ihre Väter und Vorväter es gehalten hatten, konnte er nur Geringschätzung empfinden. Mit derartiger Korinthenkackerei wollte der zum Emporkommen Entschlossene sich nicht abgeben.
Heller hatte seine eigene Theorie, warum die Leute hier, ganz im Norden des Deutschen Reiches, nicht über ihren Horizont hinausdenken konnten. Für ihn lagen die Motive in der Landschaft Schleswig-Holsteins begründet: Das Land von drei Seiten begrenzt, im Osten und im Westen von zwei Meeren, im Norden von Dänemark, mit dem die Schleswig-Holsteiner eine wechselvolle, oft kriegerische Geschichte verband. Da blieb man lieber unter seinesgleichen. Dem südlich gelegenen kleinen Herzogtum Lauenburg, eingekreist von den reichen Hansestädten Hamburg, Lübeck und Lüneburg, fehlte die räumliche Größe, um es durch die Jahrhunderte zu Macht und Einfluß zu bringen. Die vielen schnurgeraden Alleen und ebenso geraden Knicks auf den Weiden und Feldern taten ein übriges. Da gab es keine Kurven, keine unerwarteten Ausbuchtungen, weder Häfen noch Förden, ja, nicht einmal größere Hügel, die das Denken von der Schmalspur hätten ablenken können. Hamburg und Lübeck lagen so nahe, und doch fuhr kaum jemand dorthin. Deshalb blieb in diesem Landstrich alles, wie es immer schon gewesen war.
So dachte Georg Heller seit einem zufälligen Zusammentreffen mit einem Mühlenbesitzer in Rathsforde, dessen Steckenpferd die Geologie war. Georg verbreitete seine neugewonnenen Ansichten lautstark im Dorfkrug und fühlte sich bestätigt, als niemand ihm zuhören wollte. Er beschloß, in größeren Kategorien zu denken und zog dem Analysieren von staubtrockenen Zahlenkolonnen und Absatzstatistiken künstlerische Visionen seines künftigen Imperiums vor. Hilfreich waren dabei sein unbedingter Ehrgeiz und die brennende Energie, die ihn Tag und Nacht umtrieb. Sein Vorbild waren die großen Wirtschaftsführer, deren Unternehmen staatswichtig waren und die sogar vom Kaiser empfangen wurden. Mit Alfred Ballin, dem Chef der Hamburg-Amerikanischen Paketfahrt-Actien-Gesellschaft, kurz HAPAG, fühlte er sich seelenverwandt – natürlich bis auf den einen Unterschied, daß Ballin Jude war.
***
1896 wurde mit dem Ausbau des Elbe-Trave-Kanals begonnen, um die nach über fünfhundert Jahren eingestellte Fahrt auf dem Flüßchen Stecknitz zu ersetzen, die bisher die Städte Lauenburg und Lübeck miteinander verbunden hatte. Besonders die alte Hansestadt Lübeck forcierte den Kanalbau, um sich in der Konkurrenz mit Hamburg zu behaupten.
Der Kanalbau führte zu tiefen Einschnitten im Leben der Roseburger. Während der vierjährigen Bauzeit bis zur feierlichen Eröffnung 1900 waren die Sitten wegen der durchziehenden Kanalarbeiter, die aus ganz Deutschland und sogar aus Polen und Österreich kamen und an Wochenenden die Kneipen und Erntefeste heimsuchten, durchaus lockerer geworden. Und dann wurden während der Bauarbeiten in Güster, das nur wenige Kilometer von Roseburg entfernt direkt am Kanal lag, umfangreiche Kiesvorhaben gefunden, die auf dem neuen Kanal billig und unkompliziert abtransportiert werden konnten.
Was sich jahrhundertelang als Nachteil für die Gegend erwiesen hatte, nämlich die sandigen, wenig fruchtbaren Böden, die das Gletscherschmelzwasser während der letzten Eiszeit, als die Grenze zwischen eisfreiem und eisbedecktem Land genau durch das Herzogtum lief, hier abgelagert hatte, wurde nun zum Vorteil. In bis zu zwanzig Meter mächtigen Sandern ruhte der Kies entlang der früheren Endmoränen, an deren Grenzen sich dann die Stecknitz ihren Weg suchte. Mit dem Kanalbau sank der Wasserspiegel um einen halben Meter. Aus sumpfigen Niederungen wurden fruchtbare Wiesen und Ackerland, unter denen das gekörnte Gold darauf wartete, geschürft zu werden. Auch die Geschichte schien manchmal so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit zu kennen.
Die Kiesfunde zogen Investoren aus Lübeck und Travemünde an, die ein Geschäft witterten. Plötzlich sah man in Roseburg gut gekleidete Geschäftsmänner mit Hut und Gehpelz, die sich von Hof zu Hof kutschieren ließen, um den Bauern ihr Land abzukaufen. Nicht wenige gaben alles her und schimpften hinterher auf die Kiesbarone, die sie über den Tisch gezogen hatten.
***
Georg Heller stand in der unüberschaubaren Zuschauermenge, als der Kaiser am 16. Juni 1900 in einer feierlichen Zeremonie in Lübeck den Kanal eröffnete. Mit seinen gut sechzig Kilometern Länge und den sieben Schleusen verkürzte der künstliche Wasserweg die Fahrt zwischen Lauenburg und Lübeck von mehr als sieben Tagen auf weniger als einen.
Gut möglich, daß Heller bereits damals, als er den Herrscher in seinem Prunk sah, seinen Plan fertig im Kopf hatte. Er mußte jedoch noch drei Jahre warten, bis er das notwendige Kapital beisammenhatte, um acht Hektar Land nördlich von Güster zu erwerben. So gehörte er gewiß nicht zu den ersten, die mit dem Kiesabbau Geld verdienen wollten, aber Hellers Geniestreich lag darin, daß er gleich nach dem Erwerb der Grube eine eingleisige Anschlußstrecke nach Roseburg bauen ließ, um eine Verbindung zur Bahnlinie Berlin–Hamburg zu schaffen. Die nur fünfzig Kilometer entfernte Hansestadt Hamburg wuchs in diesen Jahren sprunghaft, dazu kam die neue Errungenschaft des Betonbaus, für den man Kies benötigte. Den Kies wollte Heller liefern, und zwar über den Schienenweg und damit wesentlich schneller als über den trotz allem langsamen Kanal.
Der florierende Holzhandel, den er in den letzten Jahren aufgebaut hatte, hatte ihm ein anständiges Kapital beschafft. Um ein Unternehmen dieser Größe aufzuziehen, reichte es jedoch nicht aus. So nahm er Otto Lüders als Juniorteilhaber auf. Lüders war einer der reichsten Bauern Roseburgs. Nur besaß auch er nicht Hellers Geschäftssinn und die kühne Abenteuerlust. Er war damit einverstanden, sich am Kauf des Stücks Land für den Kiesabbau zu beteiligen, der Verlegung der Gleisstrecke widersetzte er sich anfangs. Lüders wollte nicht einsehen, warum sie nicht wie alle anderen ihren Kies über den Kanal nach Lübeck oder Lauenburg verschiffen sollten.
»Paß auf«, erklärte Heller ihm, wobei er ihm den Rauch seiner dicken Zigarre in die Augen blies: »Was geschieht mit dem Sand, wenn er aus der Erde kommt? Richtig, er wird auf Loren geladen und zum Kanal transportiert, wo er auf Lastkähne umgeladen wird. Das ist ein Arbeitsgang zuviel. Wenn der Kies schon auf den Schienen ist, warum läßt man ihn dann nicht dort und fährt ihn auf diesem Weg bis Hamburg? Zumal das auch noch mindestens einen Tag Transportweg spart?«
Lüders wußte nichts darauf zu antworten und rieb sich die brennenden Augen.
Der Erfolg der nächsten Jahre gab Heller recht, die aufschneiderische Art, mit der er alles besser machen wollte und auf seine Konkurrenten herabsah, ging Lüders nach wie vor gegen den Strich. Lüders konnte nicht wie die meisten Roseburger darüber lachen, daß sein Partner tagtäglich in Güster, das noch keinen Bahnhof hatte, die Notbremse zog und mit einer Behendigkeit, die man seiner schweren Gestalt nicht zutraute, aus dem Zug sprang, um dann schimpfend »Wer hat denn schließlich das verdammte Gleis verlegt? Die Reichsbahn oder ich?« die Strafe zu zahlen.
Obwohl die persönliche Verbindung zwischen Lüders und Heller von Anfang an unter keinem besonders guten Stern stand, lief das Unternehmen bestens. Hellers Idee war genial und richtig gewesen, innerhalb kürzester Zeit hatte er mit seinem Schienentransport eine Monopolstellung unter den Kiesbaronen erreicht. In den nächsten Jahren verdiente er mehr Geld, als er ausgeben konnte.
Als seine einzige Tochter Elsa im September 1907 ihren vierten Geburtstag feierte, war ihr Vater der reichste Mann der Gegend geworden.
***
Eines Tages im März des Jahres 1906 war Georg Heller nach Hause gekommen und hatte seiner Frau beim Abendessen verkündet, er werde den alten Jakobischen Hof, von dem Karoline stammte, verkaufen und mit dem Erlös ein neues Haus bauen, in Sichtweite der alten Mühle, auf der anderen Seite des Mühlendamms. Karoline war entsetzt gewesen.
»Sein Elternhaus ohne Not verkaufen bringt Unglück!« rief sie aus. »Wer seine Eltern verrät, den trifft Gottes Zorn!«
»Deine Eltern sind tot, die kannst du nicht mehr verraten«, erwiderte Georg, den die Gottesfurcht seiner Frau, die bisweilen in finsteren Aberglauben umschlug, zur Raserei trieb.
»Mama ist noch kein Jahr unter der Erde. Außerdem geht es um ihr Andenken. Was werden die Leute sagen!«
Ihr Mann drehte sich zu ihr herum und sah sie gereizt an: »Es ist mir egal, wenn die Leute sich das Maul zerreißen. Sie reden sowieso. Ich weiß nur, daß ich keine Lust habe, länger in diesem Loch zu wohnen. Ich habe bereits einen Käufer gefunden, der einen guten Preis zahlt, damit basta.« Er war im Begriff, den Raum zu verlassen, kam dann aber noch einmal zurück. Er stützte seine Hände schwer auf den Tisch und brachte sein Gesicht dicht vor das von Karoline. »Laß dir sagen, daß ich mich von meinem Entschluß nicht abbringen lasse. Nimm endlich zur Kenntnis, daß wir keine kleinen Leute mehr sind. Wenn du dich nicht da hineinfügen kannst oder willst, dann denke wenigstens an Elsa.«
Karoline schlug einen versöhnlichen Ton an. »Aber Georg, uns geht es doch gut, und ich bin stolz auf das, was du erreicht hast. Schließlich mußte dein Großvater sich noch als Tagelöhner verdingen, um seine Kinder durchzubringen.« Ihr Einwand machte Georg Heller nur noch wütender. Aus der Angst, ein Leben wie das seiner Vorfahren zu fristen, kam doch sein brennender Ehrgeiz, der ihn immer weiter vorantrieb!
Er hob beide Arme und machte eine wegwerfende Bewegung. Dabei riß er die große Vase mit den ersten Tulpen des Jahres vom Tisch. Mit lautem Krachen zerschellte sie auf dem gefliesten Boden. »Genug! Du weißt ja nicht, wovon du sprichst. Du kannst dir nicht vorstellen, was es bedeutet, morgens noch nicht zu wissen, ob es am Abend etwas zu beißen gibt!«
Karoline achtete nicht auf das Wasser, das vom Tisch auf den Boden rann. Mit einem leisen Anflug von Ironie, den ihr Mann zum erstenmal an ihr bemerkte, entgegnete sie: »Dein Vater war schon Müller, bevor du zur Welt kamst. Ihr habt nie gehungert. Vielleicht entscheidest du dich mal, was du mir eigentlich vorwirfst. Einmal bin ich dir nicht gut genug, weil ich eine Bauerntochter bin. Und dann machst du mir den Vorwurf, nicht dein angebliches Elend geteilt zu haben.«
Seine Augen waren kalt, als er, mehr zu sich, sagte: »Nein, wahrscheinlich liegt der Fehler bei mir. Ich habe eben die falsche Frau geheiratet.« Mit energischen Schritten verließ er das Zimmer. Karoline starrte ihm zornig hinterher, dann holte sie einen Lappen, um die Bescherung aufzuwischen.
***
Karoline fuhr ihr schwerstes Geschütz auf. Sie setzte Georgs älteste Schwester in Kenntnis. Zwei Tage später erschien Minna Heller, verheiratete Brinckmann, hoch aufgerichtet und schnellen Schrittes, wobei die Federn auf ihrem üppigen Hut auf und ab wippten, in Georgs Kontor in Güster. Schon als Kind hatte Georg ein besonderes Verhältnis zu ihr gehabt. Minna war beinahe zehn Jahre älter als er und hatte nach dem frühen Tod der Mutter, die starb, als Georg gerade drei war, die Erziehung der jüngeren Geschwister übernommen. Aus den Briefen, die er ihr 1892, als gut Zwanzigjähriger, während seiner Militärzeit als Matrose auf dem Kreuzer Leipzig aus Hongkong und Jokohama geschrieben hatte, sprachen Heimweh und eine Liebe, die eher an einen Sohn als einen Bruder denken ließ. Wenn Georg sich je einem Urteil beugte, dann dem ihren. Aber was das neue Haus betraf, ließ er sich nicht einmal von Minna etwas sagen. Unverrichteter Dinge marschierte sie wieder aus seinem Kontor.
***
Im Sommer des Jahres wurde mit dem Bau begonnen. Dazu wurde der See, der zur Mühle gehörte, stark vergrößert. Sechs – Karoline raufte sich die Haare. Sechs! –kleinere Teiche wurden entlang des Wasserlaufs ausgehoben und durch gewölbte, mit kleinen Geländern versehene Stege miteinander verbunden. Das ausgehobene Erdreich wurde zu einem flachen Hügel aufgeschüttet, auf dessen Kuppe die dreistöckige Villa entstand. Von den Fenstern der Wohn- und Schlafräume aus konnte man auf die Teichlandschaft sehen, die aus der Luft wie eine Schnur unregelmäßig großer Perlen wirken mußte, bedeckt mit Seerosen, Enten und Schwänen. Gespeist wurde alles durch das Wasser des Bachs, der auch die Mühle antrieb. Ein Wehr am jenseitigen Ende des Mühlenteichs verhinderte, daß die ausgesetzten Fische sich davonmachten.
Es war, als sollte Karoline mit ihrer bösen Vorahnung recht behalten. Über dem Bau des Hauses stand kein glücklicher Stern. Als man den Mühlenteich aushob, fand man im tiefen Schlick die skelettierte Leiche einer Frau. Die Polizei stellte Untersuchungen an, und bald erzählte man sich im Dorf, es handele sich um die ehemalige Mühlenmagd, die, wie lange war das jetzt her, zehn Jahre oder doch erst acht?, verschwunden war, nachdem man sie mit ihrem schwangeren Bauch in Schimpf und Schande davongejagt hatte. An einem Abend in der Wirtschaft war Ernst Jakobi, der Schwager von Georg Heller, so unvorsichtig, ihm das Gerücht zuzutragen, das im Dorf umging: Er, Heller, sei damals der Schuldige gewesen. Hellers Hals lief rot an, er schnaubte und schlug den Bruder seiner Frau mit einem einzigen krachenden Fausthieb zu Boden.
Kurze Zeit darauf fuhr der Blitz in eine der vier uralten Kastanien. Sie waren als einzige von dem einst imposanten Baumbestand auf der Straßenseite des Grundstücks verschont geblieben. Sie wuchsen am Fuß des aufgeschobenen Hügels, und der Bauherr plante, sie rechts und links unterhalb des säulenbestandenen Eingangs zu Repräsentationszwecken stehen zu lassen. Doch nun mußte der Baum gefällt werden, und die entstehende Lücke bildete eine so auffällige Asymmetrie, daß Georg Heller immer wieder danach gefragt wurde.
Als schließlich beim Richtfest der Zimmermann vom Dach stürzte, mitten in seiner Rede vom zukünftigen Glück der Hausbewohner und dem Segen, der über dem eigenen Heim liege, und seitdem verkrüppelt blieb, da fühlte Karoline Heller sich bestätigt.
»Wären wir drüben geblieben, wo wir hingehören, dann hätte das Glück uns nicht verlassen«, wiederholte sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit und erzürnte damit ihren Mann aufs äußerste.
Georg war ein viel zu bodenständiger Mann, als daß er für derartige Gedanken empfänglich gewesen wäre. Einmal schleuderte er ihr entgegen: »Ich habe mein Glück verloren, als ich dich geheiratet habe. Du mit deinem stumpfsinnigen Aberglauben und deinen bäuerlichen Manieren! In deiner Rückständigkeit erinnerst du mich an eine verdammte Katholikin.«
Das größte Unglück sollte aber erst noch geschehen. Es war die Totgeburt, die Karoline kurz vor ihrem Umzug in die Villa hatte, und die Nachricht des Arztes, daß sie keine weiteren Kinder bekommen würde. Bereits während der Geburt hatte die Hebamme mit dem Schlimmsten gerechnet, denn das Kind lag falsch herum im Bauch. Einen Tag und eine Nacht lang hatte Karoline in höchsten Qualen geschrien, dann fehlte ihr die Kraft dazu, und die plötzliche Stille machte allen noch mehr angst. Als der kleine Junge dann endlich heraus war, war sein Körper blau angelaufen. Das Kind mußte bereits längere Zeit tot gewesen sein. Die Hebamme wollte den kleinen Leichnam rasch aus dem Zimmer tragen, da sie glaubte, Karoline sei vor Erschöpfung bewußtlos, doch die bestand darauf, ihr totes Kind zu sehen und ihm zum Abschied die winzige feuchte Stirn zu küssen. Nachdem sie sich erholt hatte, besuchte sie mehrmals täglich das Grab auf dem Siebeneichener Friedhof, dann faßte sie sich, besonders als ihr bewußt wurde, daß ihr Mann ihr keinen Vorwurf machte, weil sie ihm keine Kinder mehr gebären würde.
Georg Heller hatte in der Tat genug an Elsa. Hin und wieder bekam er seinen »Rappel«, wie das im Haus genannt wurde. Dann verfügte er, seine Tochter müsse wie ein Junge aufgezogen werden. Ohne Rücksicht auf die Vorwürfe von Karoline und Hulda bestand er darauf, daß sie in Hosen ritt und im kalten Wasser des Mühlenteichs Schwimmen lernte. Bei Regen und Kälte nahm er sie mit ins Kieswerk, wo sie neben ihm stand, wenn er den Männern Anweisungen gab und den Kies prüfend durch seine Hände rieseln ließ. Ihr Vater ließ sie an allem teilhaben und machte sich einen Spaß daraus, sie abends naß und schlammverschmiert wieder zu Hause abzuliefern. Auch Elsa gefielen diese Ausbrüche aus der Mädchenerziehung sehr. Sie liebte das Gefühl für die eigene Stärke, das sie empfand, wenn sie mit ihrem Pferd über Zäune setzte und sich bis zur Erschöpfung körperlich forderte. Und natürlich war sie glücklich, an diesen Tagen ihren Vater ganz für sich zu haben. Leider waren sie zu selten. Es kam häufig vor, daß ihr Vater sie unwirsch fortschickte, wenn sie sich ihm näherte.
Daß es einen weiteren Grund dafür gab, daß er das Ausbleiben eines Sohnes in Roseburg verschmerzte, davon ahnte jahrelang niemand etwas.
***
Ein anderes Atelierfoto, aufgenommen im Studio Bernhard Prill in Lübeck, bezeugt den Tag des Umzugs in die rotgeklinkerte, dreistöckige Krüppelwalmdachvilla mit den Gauben und Wiederkehren. In der Mitte der Schwarzweißaufnahme steht Karoline Heller hinter einem Tisch, das üppige Haar in einem Kranz um den Kopf gelegt und den Rest darüber getürmt. Aus den weichen Wangen sticht die gerade Nase hervor. Den Kopf nach unten geneigt, wirkt sie kein bißchen triumphierend oder auch nur freudig an diesem Tag. Sie trägt eine weiße Lochstickerei-Bluse, deren mächtige Puffärmel bis knapp oberhalb des Ellenbogens reichen und in handbreiten Manschetten knapp über dem Handgelenk enden. Darüber ein Kleid mit Korsage und eine locker fallende Weste, deren Ränder eine weitere Spitzenbordüre verziert. Die überladene Garderobe, die schwere Kette, die ihr bis auf die Taille fällt, machen deutlich, daß sie noch nicht daran gewöhnt ist, ihren Reichtum beiläufig zu zeigen. Ihre Gedanken sind bei ihrem toten Sohn und bei den mißglückten Vorbereitungen zu dem Fest, dem ersten im neuen Haus, das sie morgen geben wird. Als Georg ihr gesagt hat, wen er alles zur Einweihung eingeladen hat, ist sie unsicher geworden. Sie ist es nicht gewohnt, Gastgeberin für so viele wichtige Leute zu sein. Sie weiß nicht, was sie anbieten soll, wie sie alles zu organisieren hat. Irgendwann hat ihr Mann die Geduld verloren und das beste Möllner Delikatessengeschäft mit der Lieferung von Champagner und Canapés beauftragt. Weder das eine noch das andere kannte Karoline bisher, doch als sie die Rechnung gesehen hat, ist ihr schwindlig geworden.
Links neben ihr sitzt Georg Heller auf einem geschnitzten, mit rotem Samt bezogenen Stuhl, von dessen Sitzpolster Troddeln herabhängen. Den linken Unterarm hat er auf den Tisch gelegt. Sein Haar ist voll und schwarz wie der mächtige Kaiser-Wilhelm-Bart. Über dem Vatermörderkragen trägt er ein offenes Jackett, darunter die Weste, auf der die Uhrkette blitzt, die er sich zur Feier des Ereignisses zugelegt hat. Rechts von Karoline, auf dem Tisch, auf den Georg seinen Unterarm gelegt hatte, sitzt Elsa, die Füße auf einen Gobelinhocker gestützt. Sie ist vier Jahre alt. Ihre Strümpfe sind nach unten gerutscht und stecken in schwarzen Knöchelstiefeln, die auf Hochglanz poliert sind. Sie trägt ein kariertes Kleid in den Farben weiß und dunkelrot, darüber den obligatorischen weißen Spitzenkragen, auf dem eine Korallenkette liegt. Ihr Haar ist noch halblang, auf der Seite gescheitelt und mit einer weißen Schleife zurückgehalten. Sie sieht aufmerksam-kritisch in die Kamera, denn es ist das erste Mal, daß sie fotografiert wird. Georg Heller hingegen blickt nach links aus dem Bild heraus, als gehöre er nicht zu den anderen, obwohl er doch so dicht bei ihnen sitzt. Dafür halten sich Mutter und Tochter an der Hand. Müssen sie sich gegenseitig Mut machen für die unbekannte Zukunft, die auf sie wartet?
***
Am folgenden Tag erschien tatsächlich ganz Roseburg, und die Dörfler, die dem Haus schon lange den respektvollen Namen »Mühlenvilla« gegeben hatten, traten staunend vor dem Wasserklosett von einem Fuß auf den anderen, während die Ehrengäste, der Bürgermeister und der Pfarrer sowie der Direktor der kleinen Schule, Geschäftsfreunde und allen voran die Gräfin, im Salon, der die ganze Länge des Hauses einnahm und zum großen Mühlteich in einer Veranda endete, Champagner tranken. Otto Lüders kam mit seiner Frau Hermine, die bewundernd auf die bodenlangen Stores sah und über die glänzenden Möbel strich. Von Karolines Familie war ihr jüngerer Bruder Ernst Jakobi gekommen, der Georg uneingeschränkt bewunderte, sogar dafür, daß er ihn niedergeschlagen hatte. Georgs Vater war drei Jahre zuvor gestorben, doch seine Geschwister waren fast vollzählig erschienen: Da war natürlich Minna, die die Bewirtschaftung der väterlichen Mühle übernommen hatte, seitdem Georg sich seinen anderen Geschäften widmete. Dann die zweitälteste Schwester Emilie, die einen Bauern aus Güster zum Mann genommen hatte. Aus Hamburg war sein jüngerer Bruder Wilhelm angereist. Emma-Louise, die mittlere, fehlte, sie lebte mit ihrem Mann in der Nähe von Flensburg und hatte den weiten Weg gescheut.
Im Laufe des Nachmittags begann Elsa sich zu langweilen. Sie kam auf die Idee, mit einem kleinen Spartopf, den ihr Vater ihr geschenkt hatte, zu ihren Onkeln und Tanten, später von Gast zu Gast zu gehen und Münzen einzufordern. Karoline versuchte sie daran zu hindern, doch Georg bestärkte sie unter dröhnendem Gelächter.
»Laß sie doch«, rief er quer durch den großen Raum. »Sie kommt eben ganz nach ihrem Vater. Wer Geld verdienen will, der muß was dafür tun, und wer Geld hat, der soll es zeigen. Nicht wahr, Herr Pfarrer?«
Er schlug dem Pfarrer, der zufällig neben ihm stand, seine große Rechte auf die Schulter, und der Pfarrer verschluckte sich heftig an seinem Champagner.
»Nun ja«, antwortete er mit so viel Würde, wie sein Hustenanfall zuließ, »ein wenig Mildtätigkeit gehörte wohl auch schon immer zu den besonderen Pflichten der Besitzenden. Und Bescheidenheit ist bekanntlich eine Zier.« Damit wollte er sich abwenden.
Doch Georg brach erneut in wieherndes Gelächter aus und hielt ihn am Arm fest. »Im Grunde tut die Kleine doch nichts anderes als Sie auch: Immer mit der offenen Hand herumlaufen, ob nicht irgendwo eine Spende einzuheimsen ist!«
Minna eilte herbei, um den armen Mann aus Georgs Umklammerung zu befreien. Sie warf ihrem Bruder einen sehr mißbilligenden Blick zu. Georg übersah ihn.
***
Elsa liebte die Villa vom ersten Tag an, und durch die Nähe zu ihrem früheren Zuhause fühlte sie sich keinen Augenblick fremd. Sie bekam ein eigenes Zimmer, einen sonnendurchfluteten Raum mit Balkon im ersten Stock über der Veranda, mit hellen Buchenmöbeln, die aus den Wäldern ihres Vaters stammten, und bunten, gewebten Teppichen und Kissen, während der Rest des Hauses mit den wuchtigen dunkelholzigen Repräsentationsmöbeln der Zeit eingerichtet wurde. Vor ihrem Fenster dehnten sich die Teiche und dahinter die große Obstwiese. Wenn sie sich weit über das hölzerne Geländer beugte und nach links schaute, konnte sie den jenseits des großen Sees liegenden Mühlenhof sehen, auf dem sie ihre ersten Jahre verbracht hatte.
Der große Teich war aber nicht ihr Lieblingsteich. Zu dem erkor sie den Modderteich ganz am Ende des Zuflusses, bevor die Obstwiese begann. Er wurde so genannt, weil er im Sommer als erster austrocknete und sich in ein feuchtes, muffig riechendes Schlammloch verwandelte, in dem sich Frösche und Kröten mit Vorliebe aufhielten. Nur in sehr wasserarmen Zeiten mußten die Tiere ihn verlassen, dann roch er intensiv nach Verwesung. Zum Seerosenteich ging sie ungern, seitdem sie sich dort in den Wurzeln der Pflanzen verfangen hatte. Dann schon lieber zum Blauen Teich. Er hatte seinen Namen von den blaugestrichenen Gartenmöbeln, die dort zwischen Buchsbaumhecken standen.
Über diesen Blauen Teich schwang die riesige Schaukel, die Georg im Geäst der Eiche rechts vor der Veranda anbringen ließ. Die Seile hingen gute zehn Meter herab, durch das an dieser Seite zum See hin abschüssige Gelände konnte man sehr gut Schwung holen und dann durch die Luft fliegen, beinahe wie ein Vogel. Bisher hatte sich niemand getraut, am höchsten Punkt, direkt über dem See, abzuspringen, aber Elsa hatte sich fest vorgenommen, es eines Tages auszuprobieren.
Das Haus hatte Abecken, tote Winkel zwischen den Zimmerwänden und der Dachschrägung, in die man durch halbhohe Türen hinter Betten und Schränken gelangte und die zur Aufbewahrung all dessen dienten, was man nur zu besonderen Gelegenheiten benötigte oder dort in Vergessenheit geraten lassen wollte: der eiserne Fuß für den Weihnachtsbaum, ein paar alte Stühle und andere Kleinmöbel, die noch aus der Mühle stammten und die Georg aus dem neuen Haus verbannt hatte, Schlittschuhe, die niemandem mehr paßten. Und leider auch Hunderte von hölzernen Schusterleisten, die Georg im Jahr zuvor aus Hamburg mitgebracht hatte. Er wollte weder sagen, wie er an die Leisten gekommen war – im Spiel gewonnen, vermutete Karoline –, noch was er mit ihnen vorhatte. Sie kamen in eine der Abecken, aus der sie in Zukunft hervorquollen, sobald jemand die Tür öffnete, als hätten sie sich in der Abgeschiedenheit noch weiter vermehrt. Diese Abecken liefen hinter allen Zimmern der oberen Stockwerke entlang, und in den dämmrigen Räumen, die nur durch kleine Dachluken spärlich erhellt waren, saß Elsa oft und lauschte auf die Geräusche im Haus.
***
Eines Tages, Elsa mochte sieben Jahre alt gewesen sein, kam Otto Lüders, um etwas mit ihrem Vater zu besprechen. Sein Sohn Paul, der einige Jahre älter war als Elsa, begleitete ihn. Paul verdrehte den Kopf, um der breiten, gewundenen Wendeltreppe mit dem blankpolierten Handlauf von der großen Diele bis hinauf unters Dach mit den Blicken zu folgen. Sobald die Väter im Arbeitszimmer verschwunden waren, rannte er die Stufen hinauf, setzte sich rittlings auf das Geländer und rutschte hinunter. Auf den Gedanken war Elsa vorher noch nie gekommen! Paul landete mit einem kleinen Sprung vor ihr, grinste sie an und lief die Treppe wieder hinauf. Er machte ihr ein Zeichen, es ihm nachzutun. Es ging wie von selbst, nur in der Mitte eines Stockwerks, wo die Treppe eine Kehre machte, wurde die Fahrt verlangsamt. Die beiden Kinder verbrachten die nächste halbe Stunde damit, das Geländer hinabzurutschen und die Treppe wieder hochzustürmen, um möglichst als erster wieder oben zu sein. Dann erschien Hulda und jagte sie davon. Paul nahm Elsa an die Hand, und lachend rannten sie aus dem Haus, um Huldas Schimpfen zu entkommen.
Als Otto Lüders seinen Sohn rief, weil er gehen wollte, war Elsa unsterblich in Paul verliebt.
Die Treppe wurde zu ihrem Lieblingsort im Haus. Wenn sie von dort vertrieben wurde, ging sie in die große Küche, die sich zur Straßenseite hin befand. Hier machte sich immer jemand zu schaffen – Hulda oder die Köchin oder auch die Waschfrau, die einmal die Woche kam, oder Franz Heinrich, der auf ihren Vater wartete. Im Winter brannte den ganzen Tag über ein wärmendes Feuer im Herd, und es gab immer etwas zu naschen.
Sobald Elsa den Finger in einen der Töpfe steckte, nahm Hulda sie auf den Schoß, den Geruch von warmem Kuchen verströmend. »Lütten Finger, Golden Ringer, Lange Mann, Pöttenlicker, Luschenknicker!« reimte sie, während sie Elsas Finger abzählte, erst die rechte Hand, dann die linke und dann wieder von vorn. Zur Obsternte folgte unweigerlich der Vers vom Daumen, der die Pflaumen schüttelte, und der beim kleinen Finger endete, der sie alle aufaß, wobei sie Elsas Finger in den Mund nahm und so tat, als würde sie ihn nicht wieder freigeben. Hulda hatte für jede Gelegenheit den passenden Spruch, die meisten auf Platt, denn auf Hochdeutsch ließen sie sich nicht sagen. Für Elsa gehörten sie zu ihrem Leben wie das Plätschern des Mühlrads.
***
Auch Karoline Heller schien sich am Ende mit dem Umzug abgefunden zu haben. Sie war erleichtert, die Mühle verlassen zu können, auf der die Erinnerung an ihr totes Kind lastete. Das neue Haus bot Annehmlichkeiten. Die alten Öllampen wurden fortgeworfen, weil die Villa »elektrifiziert« war, wie Georg sich großspurig ausdrückte. Trotzdem stand an ihrem Bett noch eine Petroleumlampe für Notfälle.
Die Teiche und der Garten wurden Karolines ganzer Stolz. Sie ließ Spazierwege aus allerfeinstem Sand anlegen. Auf der großen Brücke über den Bach entstand ein Pavillon, wie sie ihn in einer englischen Zeitschrift gesehen hatte. Er war sechseckig, nach Süden und Westen offen, zu den anderen Seiten verglast. Sie ließ eine Sitzgruppe und vor allem eine komfortable Chaiselongue hineinstellen, die nur sie allein benutzen durfte. An jedem Sonnabend wurden sämtliche Wege zwischen den Teichen geharkt, vor Festtagen mußten sogar Linien und Muster eingearbeitet werden, und wenn das Wetter hielt, so ließ sie an den Wochenenden Kissen und Tischdecken im Pavillon auflegen, um dort den Kaffee zu nehmen. Ein Ruderboot wurde für den Sommer angeschafft, und im Winter lief ganz Roseburg auf dem großen Mühlenteich Schlittschuh, sogar Georg Heller, bei dem man immer befürchten mußte, er würde aufgrund seines Gewichts einbrechen.
Das parkähnliche Gelände rund um das Haus eignete sich wunderbar zum Herumtollen, zum Versteckspielen. Nachdem ihr Vater Elsa zu ihrem sechsten Geburtstag ein eigenes Ponygespann geschenkt hatte, unternahmen sie dort sogar kleine Kutschfahrten.
Georg Heller vergötterte und verwöhnte seine Tochter über alle Maßen. Seit er in einer unruhigen Nacht davon geträumt hatte, sein Vermögen sei verloren und Elsa mittellos, gab es für ihnen keinen Grund mehr, seinen Launen nicht nachzugeben. Er schenkte ihr in diesen Jahren, was immer ihm einfiel. Zum Karneval bekam sie die schönsten Kostüme geschneidert, die regelmäßig auf dem Maskenball in Mölln den ersten Preis einheimsten. Er ließ für sie eine Puppenstube anfertigen, in der das winzige Porzellan aus Meißen stammte und die Bilder Originale eines Möllner Landschaftsmalers waren.
Wenn Elsa krank im Bett lag, brachte er ihr zur Aufmunterung mit Vorliebe lebende Tiere, die Anlaß für die größte Verwirrung im Haus boten. Einmal war es ein Esel, der offensichtlich schwer verliebt war oder an unheilbarem Bauchweh litt. Auf jeden Fall hielt sein nächtliches Geschrei ganz Roseburg wach, bis er nach drei Tagen dem Verkäufer zurückgebracht wurde. Ein andermal verfiel Heller auf die Idee, seiner Tochter, die mit Mumps im Bett lag, einen jungen Ziegenbock ins Schlafzimmer zu bringen. Hulda war noch dabei, schimpfend die Hinterlassenschaften des Viechs von der großen Treppe zu fegen, als ein lautes Klirren und dann folgendes irres Meckern sie nach oben stürzen ließ: Der Ziegenbock war wütend auf den Rivalen losgegangen, den er im Spiegel entdeckt hatte. Karoline war vor Angst wie gelähmt, als sie an die sieben Jahre Pech dachte, die ein zerbrochener Spiegel brachte.
Es hatte sich eingebürgert, daß Heller mindestens einmal im Monat seine Tochter mit nach Hamburg nahm. Sie fuhren Paternoster, machten Einkäufe, tranken Kaffee und aßen Eis, gingen in Hagenbecks Tierpark oder sahen sich die Ozeanriesen im Hafen an. Und immer wieder schloß sich ihnen Anna Köster an.
Für Elsa Heller hätte das Leben nicht schöner sein können.
***
Leider blieb nicht alles so unbeschwert. Elsa wurde älter, und die gemeinsamen Unternehmungen mit ihrem Vater wurden seltener. Sie spürte, daß er sich zurückzog. Wenn sie insistierte, verlor er die Geduld.
An ihrem zwölften Geburtstag bekam Elsa von ihrer Mutter einen wunderschönen Haarkamm in Gestalt eines Schmetterlings. Sie hatte das Geschenk gerade ausgewickelt und ins Haar gesteckt und drehte sich damit vor dem Spiegel, als ihr Vater zur Tür hereinkam. Mit einer einzigen Bewegung entriß er ihr den Schmuck und zerdrückte ihn.
»Meine Tochter ist kein Püppchen!« brüllte er.
Karoline antwortete ihm mit schneidender Stimme: »Warum beleidigst du sie, wenn du eigentlich mich meinst?«
Georg gab keine Antwort. Er schleuderte die Reste des Kamms zu Boden und ging.
Elsa blieb starr vor Schreck zurück. Sie wußte, daß ihr Vater doch sie gemeint hatte. Er war in der letzten Zeit oft grundlos gemein zu ihr, und sie fragte sich immer wieder, was sie falsch machte. Sie hatte ihre Mutter um Rat gefragt, doch Karoline hatte nur ausweichend geantwortet.
»Dein Vater ist nun mal ein sehr launischer Mensch. Er hat große Gefühle, die er leider nicht immer beherrscht. Und jetzt macht ihm der Krieg große Sorgen ...«
Elsa sah ihr an, daß sie nicht die ganze Wahrheit sagte. Sie wurde unsicher.
Ihre Welt schrumpfte. Die Eindeutigkeit der Zeichen und Worte, auf die bisher Verlaß gewesen war, galt nicht mehr. Nie wußte sie, in welcher Stimmung sie ihren Vater antreffen würde. Mal war er jovial, herzlich und großzügig, dann wieder verschlossen und voller unverständlicher Ablehnung. Sie bemühte sich, wie eine Erwachsene zu sein, wenn sie mit ihm zusammen war, aber sie wußte nicht genau, was darunter eigentlich zu verstehen war. Sie glaubte, es bedeutete das Verstecken von Gefühlen, besonders von positiven Gefühlen, eine leichte Arroganz im Umgang mit anderen, ein vornehmer Rückzug in innere Welten. Ein Stück Unbeschwertheit ihrer Kindheit ging zu Ende.
***