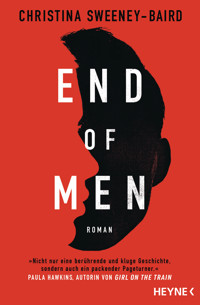
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wir schreiben das Jahr 2025. In einem Glasgower Krankenhaus behandelt Dr. Amanda Maclean einen jungen Mann mit leichtem Fieber. Harmlos. Denkt sie. Drei Stunden später ist ihr Patient tot. Doch Amanda hat keine Zeit, genauer darüber nachzudenken, denn innerhalb kürzester Zeit sterben drei weitere Männer an derselben mysteriösen Krankheit. Amanda schlägt Alarm, doch das Virus erreicht mit rasender Geschwindigkeit bald jeden Winkel der Erde – und tötet ausschließlich Männer ...
»End of Men« ist 2021 bereits unter dem Titel »Die andere Hälfte der Welt« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DASBUCH
Schottland im Jahr 2025: Als während ihrer Schicht ein junger Mann mit leichtem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert wird, macht sich Notärtzin Amanda Maclean keine großen Gedanken. Routine. Nicht der Rede wert. Wenige Stunden später ist ihr Patient tot, und Amanda in höchster Alarmbereitschaft. Denn inzwischen wurden noch drei weitere Fälle mit denselben Symptomen in die Klinik gebracht. Auch sie sind innerhalb kürzester Zeit verstorben. Amanda befürchtet den Ausbruch einer bisher unbekannten Seuche und informiert die Behörden, doch niemand glaubt ihr – zumal die mysteriöse Krankheit nur Männer befällt. Dann verbreitet sich die Seuche wie ein Lauffeuer über die Grenzen Schottlands hinaus über den ganzen Globus. Und plötzlich ist unsere Welt eine vollkommen andere. Eine Welt ohne Männer …
DIEAUTORIN
Christina Sweeney-Baird, geboren 1993, wuchs zwischen London und Glasgow auf. Ihr Studium der Rechtswissenschaften an der University of Cambridge schloss sie 2015 mit Prädikatsexamen ab. Anschließend schrieb sie für The Independent und Huffington Post. Inzwischen arbeitet sie als Prozessanwältin für Unternehmen. Ihr Debütroman End of Men erregte international große Aufmerksamkeit. Die Autorin lebt in Bloomsbury und schreibt an ihrem zweiten Roman.
CHRISTINA SWEENEY-BAIRD
END OF MEN
ROMAN
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Carola Fischer
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe: THE END OF MEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe 07/2023
Copyright © 2021 by Christina Sweeney-Baird
Copyright © 2023 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Das Illustrat GbR, München
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-30514-7V001
www.diezukunft.de
Für meine Mutter, Margarita.Ich bin sehr glücklich, dass ich deine Tochter bin.
VORHER
Catherine
London, Vereinigtes Königreich
Fünf Tage zuvor
Müssen Eltern sich an Halloween verkleiden? Das war noch nie ein Thema. Theodore ist vor einigen Monaten drei geworden, daher habe ich mir bis jetzt immer eine niedliche Kostümierung einfallen lassen (erst eine Karotte, dann ein Löwe und schließlich ein entzückender Feuerwehrmann mit Plüschhelm) und zu Hause Fotos von ihm gemacht. Ich will keine langweilige Mutter sein, die alle für arrogant halten, weil sie sich zu schade ist, den Spaß des Verkleidens mitzumachen. Ich will aber auch nicht peinlich übereifrig erscheinen. Die anderen Eltern, verkleiden die sich alle? Kostümiert sich irgendeiner von denen? Warum erklärt einem das keiner im Vorhinein?
Beatrice, meine einzige Freundin in Theodores Kita, hat gesagt, dass sie lieber sterben würde, als sich ein leicht entzündliches Kostüm anzuziehen, aber sie arbeitet im Investmentbanking und kauft sich zweitausend Pfund teure Handtaschen, »wenn sie einen schlechten Tag hatte«, deshalb ist ihr Verhalten nicht unbedingt der Maßstab für das der anderen Mütter in diesem ruhigen Teil von South London.
Mit einem mulmigen Gefühl betrachte ich die Kostüme. »Sexy Hexe«. Nein. »Sexy Magd aus Report der Magd«. Dann droht mir lebenslanger Ausschluss aus der Eltern-Lehrer-Vertretung von St. Joseph’s. »Sexy Kürbis«. Unsinn. Was würde Phoebe tun? Sie ist die vernünftigste und pragmatischste von meinen Freundinnen und besitzt die unglaubliche Fähigkeit, eine einfache Lösung für ein Problem hervorzuzaubern, als wäre diese schon die ganze Zeit über greifbar gewesen. Phoebe würde mir raten, schwarze Sachen anzuziehen und einen Hexenhut aufzusetzen, also beschließe ich, genau das zu tun. Ich vermute, dass Phoebes Tochter beim Süßes-oder-Saures-Umzug heute Abend hochwertigere Dinge einheimsen wird als die Süßigkeiten, die wir einsammeln werden. Sie wohnt in einer beängstigend teuren Gegend von Battersea, dank einer immensen Erbschaft von ihrem Vater im letzten Jahr. Er hat ihr sein Haus mit fünf Schlafzimmern und einem riesigen Garten hinterlassen, aber, wie Phoebe gern im Scherz sagt, ihre römische Nase war ein stolzer Preis dafür.
Ein Blick auf meine Armbanduhr, und mir wird klar, dass ich schon wieder spät dran bin mit Abholen. Ich kaufe den Hut und laufe eilig zur Kita. Für jede angebrochenen fünf Minuten, die ich zu spät komme, muss ich zwanzig Pfund bezahlen, ein horrender Satz, der mich in Versuchung bringt, meine eigene Kita zu eröffnen, denn es muss der höchste legale Zinssatz im ganzen Land sein.
Ein paar gehetzte Worte mit den anderen Müttern – Hallo, hallo, Tag auch, ja, ich weiß, wieder zu spät, obwohl ich so viel von zu Hause arbeite! Ha! Ja, ich bin schlecht organisiert, lustig, urkomisch, zum Totlachen –, als ich durch die Tür stürze, um einen unglücklichen Theodore abzuholen.
»Mummy war wieder zu spät«, sagt er seufzend.
»Tut mir leid, Liebling. Ich habe noch einen Hexenhut für morgen besorgt.«
Sein Gesicht hellt sich auf. Die Macht der Zerstreuung. Plötzlich ist Halloween, etwas, von dem er letztes Jahr nur eine vage Vorstellung besaß, zum denkbar aufregendsten Ereignis (bis Weihnachten) geworden. So habe ich mir das Elternsein immer vorgestellt. Meine Eltern starben, als ich zehn war, und ich habe keine Geschwister, daher waren Theodores Babyjahre eine Serie unangenehmer Überraschungen. Wie müde bin ich? Wie oft wird er krank? Ich fühle mich dermaßen einsam? Halloween, Weihnachten und Geburtstage sind sichere Häfen, wo meinem Wunschbild einer perfekten, Pinterest-adäquaten Mutter für kurze Zeit nachgegeben wird.
Nach der Kälte draußen drängen wir durch die Tür ins Warme, und ich beginne augenblicklich mit dem Kochen. Ich versuche, Theodore Abendessen zu machen, bevor Anthony nach Hause kommt, denn in der Aufregung des Wiedersehens mit seinem Vater geraten Gemüsehäppchen und die Ermahnung zu essen schnell in Vergessenheit, und zurück bleibt ein traurig aussehender Teller. Die Verhandlungen, die erforderlich sind, damit ein Dreijähriger sich ausgewogen ernährt, kennen keine Grenzen, und heute sind sie besonders quälend. Noch eine Erbse, dann kannst du zwei Nudeln essen. Fünf Erbsen, und du darfst am Samstag einen Film schauen.
Anthony kommt nach Hause, als Theodore sich gerade die Treppe hinaufgeschleppt hat, wieder einmal überdrüssig des obligatorischen Badens vor dem Zubettgehen. Anthony ist noch dabei, ein berufliches Gespräch zu Ende zu führen, als er zur Tür hereintritt. Er sieht müde und abgespannt aus. Wir brauchen Urlaub. Jetzt, wo wir Mitte dreißig sind, scheine ich das alle zwei Wochen zu sagen, selbst wenn wir gerade im Urlaub waren.
Schließlich hat Anthony das Telefonat beendet. Irgendetwas mit Blockchains und anderen komplizierten Wörtern, die keine Bedeutung für mich haben. Nach einem Jahrzehnt Ehe habe ich meine Einstellung glücklicherweise geändert: von Schuldgefühlen über mein mangelndes Verständnis der Arbeit meines Mannes hin zu seliger Ignoranz. Wenn ein tiefes Verständnis des Berufs des Ehepartners eine Voraussetzung für eine beständige und glückliche Ehe wäre, würde niemand lange verheiratet bleiben. Außerdem könnte Anthony genauso wenig einen einzigen meiner letzten wissenschaftlichen Artikel nennen, wie ich ein Programm in Java schreiben könnte, ein Wort, bei dem ich unweigerlich an Körperlotion denke, bevor mein Verstand zu Programmieren weitergeleitet wird.
Ich bekomme ein Hallo, einen Kuss auf die Wange und eine rasche Umarmung, bevor Anthony nach oben geht. Baden und ins Bett bringen sind seine Aufgaben. Von der Kita abholen und Abendessen meine. Selten verbringen wir einen Abend zusammen, aber wenn, ist es wunderbar. Während ich mir ein Glas Rotwein einschenke – den Geschirrspüler einzuräumen kann warten, E-Mails zu beantworten hingegen nicht –, blitzt der Gedanke in meinem Kopf auf, dass ich diese Muße nicht hätte, wenn wir noch ein Baby versorgen müssten. Keine ruhige, annähernd ordentliche Küche mit einem Glas Wein in der Hand. Keine Aussicht auf einen Abend mit Gesprächen mit meinem Ehemann, ungestörtes Fernsehen und eine lange Nacht mit gehirnstärkendem, die Beziehung erhaltendem Schlaf.
»Wie war dein Tag?« Anthony ist wieder nach unten gekommen. Kein Wein für ihn heute Abend, fällt mir auf, während er die Nudeln, die ich für ihn übrig gelassen habe, in eine Schüssel gibt.
»Redigieren, redigieren, redigieren. Meine Lieblingsaufgabe, wenn ich einen Aufsatz schreibe«, sage ich mit beißendem Sarkasmus. Eine meiner Tutorinnen in Oxford hat einmal zu mir gesagt, dass ich, um Wissenschaftlerin zu werden, lebenslang Hausaufgaben erledigen müsse, und damals habe ich ihr nicht geglaubt, aber, Herrgott noch mal, sie hatte recht. Drei Testleser haben meinen neuesten Aufsatz über die Unterschiede zwischen Erziehungsstilen in Dänemark und dem Vereinigten Königreich und deren Auswirkungen auf das Bildungsniveau gelesen, und aus irgendeinem Grund wollen sie alle, dass ich Änderungen vornehme, aber in verschiedene, gegensätzliche Richtungen. Nachdem ich einen achtstündigen Arbeitstag mit dem Entziffern der Kommentare verbracht hatte, war ich so erschöpft, dass ich meinen Laptop am liebsten aus dem Fenster geschmissen hätte. Voller Hoffnung deutete ich meiner wunderbaren Chefin Margaret gegenüber an, dass ich bei so viel Widersprüchlichkeit die Kommentare ignorieren könne, aber sie schüttelte nur missbilligend den Kopf und sagte: »Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.«
Ich erkläre Anthony das Hexenkostüm, und er sieht mich aufmerksam an. »Das ist ein guter Plan«, sagt er. »Plan A: Hexe. Plan B: Normale schwarz gekleidete Frau.« Die Ernsthaftigkeit, mir der er an diese Themen in der Diskussion herangeht, ist eine der vielen Eigenschaften, die ich an ihm liebe. Er würde nie sagen: »Das ist albernes Zeug, warum reden wir darüber?« Einmal sagte der Ex-Freund meiner Freundin Libby zu ihr, sie sei lächerlich, als sie irgendetwas – ich weiß nicht mehr was – zur Sprache brachte, während wir zu viert in einem Sushi-Restaurant in Soho saßen. Anthony sagte, ohne eine Spur von Humor in der Stimme: »Wenn sie es anspricht, ist es nicht lächerlich. Sie ist nicht lächerlich.«
Libby behauptet, dass Anthony einer der Gründe ist, warum sie Single ist; an ihm kann sie sehen, wie Liebe sein sollte. Ich versuche sie daran zu erinnern, wie wir zu Uni-Zeiten waren. Wir sind jetzt unser halbes Leben lang zusammen. Man wird nicht über Nacht zwei Hälften eines Ganzen. Ich glaube, ich habe in Zusammenhang mit Beziehungen Libby gegenüber einmal das Wort »Reise« fallen gelassen, und daraufhin sprach sie kein Wort mehr mit mir, bis ich ihr einen doppelten Gin Tonic spendierte.
Nachdem Anthony die Teller abgeräumt hat, was ich quasi, mehr oder weniger, definitiv ihm überlassen habe, weil er ordentlicher ist als ich, lehne ich mich mit einem zufriedenen Seufzen im Stuhl zurück. Er sieht mich eindringlich an. Entweder will er Sex, oder er will die große F-Unterhaltung führen. Künstliche Befruchtung – ja oder nein? Erst seit vierzig Jahren genießen Paare den Luxus, über diese Frage nachzudenken. In Anthonys Arbeitskalender habe ich vor einigen Monaten ein großes F in der Ecke eines Freitags entdeckt. Sofort nahm ich an, dass er eine Affäre hatte, obwohl es gar keinen Beweis gab. Freya? Flora? Felicity? Wer ist sie? Ein paar Wochen lang ließ ich ständig Frauenvornamen mit F fallen und befürchtete, er würde erröten oder schuldig aussehen, aber er hielt das nur für einen subtilen Versuch von mir, Babynamen vorzuschlagen. In den folgenden Wochen überprüfte ich immer wieder seinen Kalender, und jedes Mal fand ich das F. Ich weiß nicht, warum ich ihn nicht direkt fragte, wofür das F stand. Er belügt mich nicht, wahrscheinlich war es irgendein langweiliges Jobthema, aber aus irgendeinem Grund bekam ich es nicht aus dem Kopf. Ich wollte es selbst herausfinden. Und dann, vor zwei Wochen, ging mir ein Licht auf. Das F war an allen Tagen vermerkt, an denen wir uns über Fruchtbarkeit, oder meinen Mangel daran, unterhielten. Ich ging meine Tagebücher durch, und es machte klick. Wenn Anthony ein F in seinem Kalender vermerkte, landeten wir letzten Endes immer bei dieser sich wiederholenden Unterhaltung. Anthony plant sein Leben, er kann den Dingen nicht einfach ihren Lauf lassen. Im Urlaub ist das wunderbar, ich muss gar nichts tun, und bevor ich mich’s versehe, bin ich in einem schönen Hotel in Lissabon, das er acht Monate zuvor zu einem günstigen Tarif gebucht hat. Für Abende ohne Kind und Schulanmeldungen ist es noch besser. Doch für die grundsätzlichen Gespräche, die einen Mittwochabend ruinieren können, an dem man hoffte, von seinem Ehemann verführt zu werden, ist es ein ziemlicher Dämpfer.
In gewisser Weise beneide ich die Frauen, die sich vor dem Aufkommen des qualvollen Wunders der Fruchtbarkeitsbehandlung in meiner Position befanden. Viele Frauen hatten ein Kind oder keines, und das war’s dann. Es folgten Tränen und Gebete, vielleicht auch ein selbstmitleidiges, erstauntes »Warum ich?«. Aber es gäbe in dieser Angelegenheit keine Wahl. Es läge nicht mehr in meiner Hand. Ich träume von einem derartigen Kontrollverlust.
Wir führen diese Gespräche nun schon seit fast einem Jahr. Davor haben wir es ein Jahr lang versucht, in der Annahme, dass ich irgendwann schwanger würde. Doch dann, nichts. Funkstille von meinen Eierstöcken. Mit einem Medikament namens Clomid versuchte ich, sie »aufzuwecken«, aber sie drückten die Schlummertaste und ignorierten beharrlich mein dringendes Bitten um Kooperation.
»Ich habe heute in der Arbeit mit meiner Chefin gesprochen.« Bei diesen Worten zucke ich zusammen, nicht schon wieder sie. Ständig versucht sie, ihn davon zu überzeugen, dass er mich davon überzeugt, mit der künstlichen Befruchtung zu beginnen. Ich habe sie noch nie getroffen, aber ich kann sie nicht ausstehen. Es geht sie nichts an. Doch in unserem Ehegelübde habe ich versprochen, immer zuzuhören und niemals zu urteilen. Ich war vierundzwanzig! Damals wusste ich nicht, wie nervig es sein kann, zuhören zu müssen, wenn man nur in Ruhe ein Glas Wein trinken will. Doch ich habe mein Versprechen gegeben, daher lächle ich und frage: »Worüber?«
»Sie hat erzählt, dass Alfie sich sehr verändert hat, seit er eine Schwester bekommen hat. Er ist viel geselliger. Spricht auch viel mehr. Sie glaubt, dass er empathischer geworden ist.«
Ich ärgere mich über die indirekte Kritik an meiner Familie von dieser schrecklichen Frau. Als ob ich einen abnormal schweigsamen zukünftigen Psychopathen heranziehe, nur weil ich nicht mehrere Kinder in die Welt gesetzt habe. Ich gebe ein unverbindliches Geräusch von mir und leere mein Weinglas; ein Akt des Widerstands angesichts der fruchtbarkeitsschädigenden Eigenschaften von Alkohol.
»Wir sollten es machen«, sagt er und sprüht vor Tatendrang. Das habe ich schon öfter gehört. »Ich habe gründlich darüber nachgedacht. Wir müssen aufhören, ständig hin und her zu überlegen. Wir werden nicht jünger. Du wirst in zwei Monaten vierunddreißig, und die Erfolgschancen der künstlichen Befruchtung werden schlechter, je älter man ist.« Er sieht mich an, als wäre die Antwort einfach. Ich muss nur mitspielen, und alles wird gut!
»Wir haben schon darüber gesprochen. Wir kennen die Statistiken, aber …« Ich habe nichts zu sagen, das ich nicht schon gefühlt tausendmal vorher gesagt habe. Wenn ich garantieren könnte, dass ein Zyklus der In-vitro-Fertilisation mir ein Baby schenken würde, dieses neue Familienmitglied, auf das wir schon so lange warten, ich würde nicht eine Sekunde lang zögern. Aber das kann mir niemand versprechen. Ich kenne die Erfolgschancen. Sie sind nicht gut, und Glücksspiele mochte ich noch nie. Es fühlt sich grauenhaft leichtsinnig an, mit der künstlichen Befruchtung zu beginnen, wo wir doch Theodore haben und ich ihm all meine Zeit widmen kann. Außerdem habe ich gelernt, unsere Familie so zu akzeptieren, wie sie ist. Was, wenn ich mich nicht um ihn kümmern kann, weil die vielen Hormone mich krank machen oder die Enttäuschung mich emotional auslaugt? Was, wenn ich bei dem Versuch, ein weiteres Kind zu bekommen, dem Kind, das ich schon habe, keine gute Mutter mehr bin? Dennoch versetzt mir der Wunsch nach einem weiteren Theodore und danach, ihn mit einem Geschwisterchen spielen zu sehen, manchmal einen Schlag in die Magengrube, und einen Tag lang teile ich dann Anthonys unerschütterliche Überzeugung, dass wir noch ein Kind brauchen.
Ich durchlebe verschiedene Phasen. Manchmal bin ich entschlossen und bereit. Ich kann das machen. Schickt mir die Spritzen, pumpt mich voll, schnallt mich fest. Ich würde alles für ein Kind tun. In anderen Wochen ruft die Vorstellung all dieser Menschen, Instrumente und Kabel in meinem Körper den Wunsch in mir hervor, mich schützend zusammenzurollen. Nein, sagt mein Körper. Das ist nicht richtig. Andere Babys wecken Anthonys Kinderwunsch mehr als meinen. Ein wimmerndes Neugeborenes oder ein kleines Bravourstück seines Patenkindes führt unweigerlich zu der ernst gemeinten Erklärung, dass wir es tun sollten, lass es uns machen, was haben wir zu verlieren? So wie heute Abend.
Was haben wir zu verlieren? Alles, Anthony, möchte ich jedes Mal schreien. Hin und wieder überzeuge ich mich selbst davon, dass ich eine künstliche Befruchtung machen lassen kann, aber leichtfertig kann ich das nicht. Für einen Mann, der so begeistert plant, kann Anthony bemerkenswert risikofreudig hinsichtlich der Auswirkungen von IVF und Babys, oder schlimmer noch IVF und keine Babys, auf unser Leben sein. Für mich ist wichtig, dass er sich das Worst-Case-Szenario vor Augen führt. Für mich ist wichtig, dass er versteht, wie schwer das für mich wird. Denn wie immer, wenn es um die Geburt eines Menschenkindes geht, muss auch bei dieser Gleichung die Frau die negativen Seiten aushalten. Und das in der Annahme, dass es funktioniert. Was, wenn alles umsonst war?
»Ich brauche noch etwas Zeit, um darüber nachzudenken und die Vor- und Nachteile abzuwägen.«
»Warum gehst du immer davon aus, dass es schiefgehen wird?«
»Das tue ich nicht.«
»Doch, das tust du.« Die Enttäuschung dringt an vorderste Stelle seiner Stimme und rührt sich nicht mehr vom Fleck. »Du sprichst über die finanzielle Belastung, die emotionale Belastung und die körperliche Belastung, als wäre es schon ausgemacht, dass die Behandlung die nächsten drei Jahre dauert. Was, wenn die In-vitro-Fertilisation schon beim ersten Mal klappt? Wenn es ein Erfolg wird? Wenn ein Kind zu bekommen für uns zum Greifen nah ist, wir aber die Chance nicht nutzen?«
»Du hast leicht reden«, murmele ich.
»Was war das?«, fragt er, obwohl er mich verstanden hat. Natürlich hat er mich verstanden.
»Ich sagte, du hast leicht reden. Du musst das nicht durchmachen.«
»Wir stecken da gemeinsam drin, Cat. Bitte, ich kann das nicht an deiner Stelle machen. Ich weiß, dass das unfair ist, aber es geht nicht. Bitte. Denk nur mal drüber nach.«
Wir lassen uns nebeneinander auf dem Sofa nieder, um eine Serie zu gucken, die, wie Anthony gehört hat, spannend sein soll, und mir fällt auf, dass mein Puls nicht in die Höhe geschnellt ist. Ich bin ruhig. Früher war ich nach diesen Gesprächen tränenüberströmt, und mir war weinerlich zumute, aber jetzt ist der Schmerz verschwunden. Was bedeutet das? Habe ich akzeptiert, dass wir nur ein Kind haben werden? Bedeutet es, dass ich damit glücklich bin? Kann ich diese Entscheidung für uns beide treffen, wenn die Kinderfrage ihn ebenso angeht wie mich?
Die Sache ist, dass Anthony mich bittet, etwas zu tun, was ich nicht tun kann. Ich kann darüber keine Entscheidung treffen. Ein wesentlicher Teil von mir hofft insgeheim, dass es einfach passieren wird. Wenn wir weiter warten und die Entscheidung über IVF einen weiteren Monat aufschieben, dann noch einen und noch einen, vielleicht wird es dann in jenem Monat geschehen. Mit Theodore wurde ich nach sechs Monaten durchweg angenehmer Versuche, ein Kind zu bekommen, schwanger. Genau in dem Moment, als ich anfing, Panik zu bekommen, war es schon passiert. Morgendliche Übelkeit, die auch den stärksten Mann umgehauen hätte. Ich weiß, dass wir es seit zweieinhalb Jahren vergeblich versuchen. Ich weiß, dass mein Vorrat an Eizellen eher knapp und mein Uterus aufgrund seiner seltsamen Form für einen Embryo »weniger gastlich« ist (ein grausames Wort in Verbindung mit Fruchtbarkeit, ich hätte den arroganten Frauenarzt für diese Beleidigung meiner Anatomie am liebsten mit seiner Krawatte erdrosselt). Ich weiß all diese Dinge, und ich wünschte, ich wüsste sie nicht. Ich wünschte, wir wären unwissend und voller Hoffnung, weil es passieren könnte. Bis jetzt wissen wir es einfach noch nicht.
Als ich an diesem Abend auf dem Weg nach oben an den Fotos von uns vorübergehe, staune ich (wie so oft nach unseren Fruchtbarkeitsgesprächen) über das, was wir geschaffen haben. Eine Familie von Grund auf. Von dem Foto aus unserem ersten gemeinsamen Jahr, in lockerer Umarmung schauen wir uns in der College-Bar in die Augen, bis zu der Aufnahme, die Phoebe von uns dreien vor ein paar Monaten im Battersea Park gemacht hat. Meine dunklen Locken wehen im Wind, ein absoluter Gegensatz zu Theodores kastanienbraunem Wuschelkopf, den er von Anthony geerbt hat.
Später liege ich im Bett und lese. Anthony klettert nach mir hinein, und ich beginne mit unserer eingespielten Routine. Mein Buch zur einen Seite legend, reiche ich ihm seine Schlafmaske, Licht aus, mein Kopf auf seiner Schulter, mein Arm auf seiner Brust, seine Hand an meinem Ellbogen, Sicherheit.
»Anthony«, flüstere ich.
»Ja«, erwidert er. Das liebe ich an ihm. Er fragt nicht »was« oder macht nur »hm«. Er sagt immer Ja, egal, was ich sagen möchte.
»Ich möchte keine Entscheidung treffen. Ich kann nicht.« Ich habe einen Kloß im Hals. Ich weine nur noch selten über unsere unfruchtbaren Jahre. Ich versuche es hinunterzuschlucken, denn man kann nicht zwei Jahre seines Lebens jeden Abend weinen. Das ist so deprimierend, dass mir die Worte dafür fehlen. »Was ist, wenn es auf natürliche Weise passiert? Ich möchte, dass …«
»Ach, Cat«, sagt Anthony sanft, und seine Stimme macht meinen Wunsch zunichte. Als ich es ausgesprochen habe, hat mein Geheimnis seine Kraft verloren. Es ist eine traurige, armselige, dumme Hoffnung. Und dennoch, wer weiß?
»Ich verstehe dich«, sagt er. »Wir lassen uns noch einen Monat Zeit.«
Nie habe ich meinen Ehemann mehr geliebt als in diesem Moment.
AUSBRUCH
Amanda
Glasgow, Vereinigtes Königreich
Tag 1
Im November ist immer viel los, aber das jetzt ist aberwitzig. Die Spaltung der Gegend um Gartnavel ist nie offensichtlicher gewesen. Glasgows kultivierte Mittelschicht aus dem West End taucht nach Stürzen auf eisigem Grund und mit starkem Husten in der Notaufnahme auf – ein Gewirr von teuren Strähnchen, Wissen um verschiedene Sorten von Antibiotika und Stakkato-Sprechweise – und macht klar, dass ihre Eltern oder Großeltern sofort untersucht werden sollen. Die andere Seite dieser Geschichte aus zwei Städten ist Leberzirrhose, chronische Armut und die unglamourösen Nebeneffekte von lebenslangem Rauchen.
»Noch einer mit SLS«, sagt Kirsty, eine hervorragende junge Krankenschwester, fröhlich und drückt mir im Vorbeigehen unsanft eine Patientenakte in die Hand. Scheiß-Leben-Syndrom. Arztsprech für: »Tatsächlich ist alles in Ordnung mit Ihnen. Sie sind nur traurig, weil Ihr Leben wirklich sehr, sehr hart ist, aber dagegen kann ich nichts tun.« Früher habe ich versucht zu helfen, kleines naives Dummerchen, das ich war. Was, wenn diese Menschen sonst niemanden haben?, dachte ich verzweifelt bei mir, während ich siebenmal in einer Nacht das Sozialamt anrief, bis sie nicht mehr ans Telefon gingen. Als Oberärztin habe ich inzwischen eine andere Herangehensweise.
»Warum soll ich mich dann mit ihnen befassen?«, frage ich. Ich verschwende nur meine Zeit, das ist eine klassische Anfängeraufgabe, wie sie im Buche steht.
»Sie haben ausdrücklich nach einem Oberarzt verlangt und weigern sich, mit jemand anderem zu sprechen.« Aha. So unfair das auch ist, wenn man laut, hartnäckig und eine Nervensäge ist, bekommt man im Krankenhaus oft die bessere Behandlung. Nicht weil wir derlei Sperenzchen wirklich gutheißen. Wir wollen die Leute nur so schnell wie möglich loswerden.
Ich betrete die Kabine, der Vorhang vermittelt einen schwachen Anschein von Ungestörtheit. »Was kann ich für Sie tun?«, frage ich in meiner speziell vergnügten, aber barschen Stimme, die ich für die Gesunden in meiner überfüllten, unterfinanzierten Notaufnahmeabteilung reserviert habe.
»Ihm geht’s nicht gut«, brummt die bleiche Frau zu meiner Linken und zeigt auf ein Kind, das, wenn auch gelangweilt, kerngesund aussieht.
»Was scheint denn das Problem zu sein?«, frage ich, als ich ihm gegenübersitze. In den Aufzeichnungen sehe ich, dass seine Vitalzeichen alle normal sind. Er hat nicht einmal erhöhte Temperatur. Er ist gesund.
»Er schläft immer sehr lange, und er hustet.« Das Kind hat buchstäblich noch keinen Ton von sich gegeben.
Ein paar harmlose Fragen, dann ist das Rätsel gelöst. Er hat einen Wachstumsschub, außerdem hat der Frechdachs auf dem Rückweg von der Schule mit einem ebenso missratenen Freund eine Zigarette geraucht. Man sollte Sherlock Bescheid sagen, ich habe Talent.
Während ich den kleinlauten Jungen und seine Mutter verabschiede, höre ich das Unfalltelefon klingeln. Ich nehme den Anruf entgegen. Ein zwei Monate altes Kind, Verdacht auf Blutvergiftung. Auf dem Weg zu uns.
Selbst nach zwanzig Jahren als Ärztin bin ich nicht immun gegen einen Adrenalinkick, wenn das Telefon klingelt und Unfallverletzte eingeliefert werden. Nach fünfundvierzig Minuten atemloser Arbeit, in denen wir das Baby stabilisieren, wird es eilig nach oben auf die Intensivstation gebracht. Ich habe kaum einen Moment, um mich umzudrehen und einen klaren Gedanken zu fassen, bevor ein neuer Verletzter eingeliefert wird. Dieses Mal ist es mehr Routine. Ein Zusammenstoß im Straßenverkehr hat einige hässliche Schnittwunden zur Folge, und es besteht Verdacht auf innere Blutungen. Dieser Patient wird binnen zwanzig Minuten für eine CT-Untersuchung nach oben geschickt. Während ich meine Hände wasche, versuche ich mich daran zu erinnern, um wie viel Uhr der Elternabend meines Sohnes beginnt, als die Assistenzärztin im ersten Jahr mich am Arm packt.
Sie stammelt etwas von einem Patienten, der zusammengebrochen ist, obwohl es ihm zuvor gut ging, aber jetzt mache er einen sehr schlechten Eindruck, sie brauche Hilfe. Sie ist vollkommen aufgelöst. Ich habe das schon unzählige Male gesehen. Sie arbeitet erst seit zehn Wochen auf unserer Station, sie hat einen Patienten, dessen Zustand sich verschlechtert, und bricht in Panik aus. Ich weiß, ich sollte respektvoll reagieren und mir vor Augen halten, dass sie Assistenzärztin ist, dass wir alle lernen müssen, aber mal ehrlich, es ist einfach nervig. Ich kann verstehen, dass es einer angehenden Ärztin an Fachwissen mangelt, und ich kann Fehler tolerieren, die aufgrund von Überarbeitung passieren. Doch reine Panik in einer Notaufnahme ist so nützlich wie ein Pappmaché-Schiffchen mit einer Falltür. Der bloße Gedanke klingt schon unfreundlich, doch mir schießt durch den Kopf, dass die Notaufnahme nicht der richtige Platz für sie ist. Wenn man seine fünf Sinne nicht beisammenhalten kann, sobald ein Patient zusammenbricht, dann ist das medizinische Gebiet, das sich Unfällen widmet, nicht das Richtige für einen.
Ich laufe neben ihr zur Kabine. Die Ehefrau des Patienten steht weinend neben seinem Bett. Ich fauche Fiona an, dass sie ihn in den Schockraum bringen lassen soll, und frage so leise und zornig wie möglich, warum er da nicht schon längst liegt. Selbst ein flüchtiger Blick auf diesen Mann und seine Vitalzeichen zeigt, dass es ihm ernsthaft schlecht geht. Meine Güte, dafür muss man ihn noch nicht einmal anschauen. Jedes Gerät im Raum piept laut in anhaltender Besorgnis.
Fiona sagt, dass er die Grippe hatte, aber okay war, als er im Krankenhaus ankam, total okay! Sie hat ihm Flüssigkeit und Paracetamol verabreicht und zweifellos gehofft, dass er nach einer Weile nach Hause gehen würde, denn sie war überzeugt, dass es nur die Grippe war, nichts anderes.
In diesem Augenblick liegt der Patient im Sterben. Seine Atmung ist schwerfällig, das flache Keuchen eines Körpers, der die Grundanforderung, Sauerstoff aufzunehmen, nicht erfüllen kann. Seine Haut hat die gräuliche Farbe eines Menschen, dessen Körpersysteme versagen, und seine Temperatur steigt unaufhörlich. Jetzt stehen sieben Mitglieder der Belegschaft um ihn herum. Die Oberschwester misst alle zwei Minuten seine Temperatur und teilt mit kaum unterdrückter Fassungslosigkeit mit, dass sie sehr schnell steigt. Wir ziehen ihn aus, legen Eis und kalte Handtücher um ihn herum. Ich suche seinen gesamten Körper nach einer Wunde ab, einem Insektenbiss, einem Rasierklingenschnitt, einem Kratzer. Irgendetwas, was diese Sepsis verursacht hat. Nichts. Kein Ausschlag, also ist Meningitis unwahrscheinlich. In dem Moment taucht in mir der Gedanke auf, dass es für ihn kein Zurück mehr gibt. Wenn die Organe einmal angefangen haben zu versagen, kann man nicht mehr viel tun. Wir legen ihm einen Katheter, verabreichen ihm Infusionen und Sauerstoff. Wir pumpen ihn mit Antibiotika und Virostatika voll, um den Kampf gegen das heftige Fieber aufzunehmen, wir geben ihm Steroide für seine Atmung, wir tun alles, was wir können. Wir nehmen Blut ab, um es auf Infektionen untersuchen zu lassen, und wenn er zumindest so lange am Leben bleibt, bis wir die Ergebnisse bekommen, können wir die Antibiotika oder Virostatika auf ihn abstimmen, aber jetzt versagen seine Nieren. Null Urinausscheidung – der Katheterbeutel unter dem Bett flattert in der Luft, deprimierend leer. Wenn meine Freunde mich halb im Scherz fragen, ob sie sterben, sage ich oft zu ihnen: Wenn du noch pinkeln musst, geht’s dir gut. Als ich einen Schritt zurücktrete und beobachte, was sich vor meinen Augen abspielt, setze ich einen Ausdruck feierlicher Ruhe auf. Er ist ein hübscher Kerl. Dunkles Haar, Dreitagebart, er sieht freundlich aus. Seine Frau steht immer wieder im Weg, weint in einem fort, untröstlich. Sie weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wir alle wissen das. Ab und zu schreit sie uns an, dass wir mehr tun sollen, aber wir können nichts tun, außer abzuwarten und zu hoffen, dass sein Körper auf wundersame Weise eine Kehrtwendung vollzieht. Drei Stunden nachdem der Mann in der Notaufnahme ankam, gibt das Gerät den langen schrillen Ton von sich, auf den wir alle gewartet haben. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Auf seltsame Weise ist das eine Erleichterung. Die Anspannung im Raum ist verschwunden. Endlich können wir alle etwas tun. Die Oberschwester beginnt mit der Herzdruckmassage. Ich ordne die Gabe von Adrenalin an. Der Defibrillator ist dran, wir geben dem Patienten Elektroschocks, einmal, zweimal, dreimal. Eine Krankenschwester sorgt in einer Ecke dafür, dass seine Frau – ihr Schock ist so groß, dass sie jetzt vollkommen stumm ist – nicht zusammenbricht und dem Bett fernbleibt. Ein Elektroschock ist äußerst heftig, nichts, was Angehörige mitbekommen sollten, wenn es vermieden werden kann. In dem Bemühen, einen Menschen vom Tod zurückzuholen, zerdrücken wir ihn, verabreichen Stromstöße, versuchen, sein Herz in einen widerwilligen Rhythmus zurückzukämpfen.
Es funktioniert nicht, aber das haben wir alle vorher gewusst. Der Körper dieses Mannes wurde von etwas zerstört, was wir noch nicht kennen. Unsere Arme ermüden. Die Oberschwester mit den Paddles des Defibrillators in den Händen sieht mich fragend an. Ich schüttele den Kopf. Wir haben alles getan, was möglich und nötig ist. Jetzt weiterzumachen würde bedeuten, den Körper eines toten Mannes unnötig zu quälen. Nach zweiundfünfzig Minuten gebe ich die Anweisung. »Alle aufhören. Es reicht.«
»Todeszeit: 11 Uhr 37, 3. November 2025.« Ich überlasse einem meiner erfahrenen Assistenzärzte den Papierkram, den der Tod mit sich bringt, und tröste die trauernde Witwe des Verstorbenen. Vor wenigen Minuten noch war sie eine Ehefrau.
Fiona, meine in Panik geratene Anfängerin, ist verstört. Das ist der erste junge Patient, den sie in dieser Abteilung verloren hat. Es ist nie leicht, einen Patienten zu verlieren, aber wenn jemand mit fünfundachtzig einen Schlaganfall oder einen schweren Herzinfarkt erleidet, dann ist das ein Teil des Lebens, und dieses Gefühl überwiegt die Trauer. Der Tod kommt zu uns allen, und dieser Mensch hatte eine lange, erfüllte Lebenszeit. Gute Reise und wir sehen uns dann auf der anderen Seite.
Doch wenn ein junger Mensch stirbt, hat es ernsthafte Komplikationen gegeben, und wir sind nicht in der Lage gewesen, sie zu beheben. Der Patient hieß Euan Fraser. Seine Frau wiederholt unter Schluchzen, dass er nur eine Grippe hatte.
Ich nehme Frasers Patientenakte und gehe mit Fiona in den Belegschaftsraum. Ich lasse sie sich hinsetzen, damit sie sich von dem Stress erholen kann, dann gehen wir die Ereignisse noch einmal durch und suchen nach den Gründen. Diese Methode habe ich von einem Oberarzt während meiner Ausbildung in Edinburgh gelernt. Wenn man einen Patienten verloren hat, geht man die Patientenakte sofort von Anfang bis Ende durch, Schritt für Schritt. Welche Behandlung hat man angeordnet, wann, warum, wie wurde sie durchgeführt? Normalerweise begreifen die jungen Assistenzärzte dann, dass sie alles richtig gemacht haben und das Geschehen außerhalb ihrer Kontrolle lag. Und wenn sie einen Fehler gemacht haben, können sie etwas daraus lernen. Es ist eine Win-win-Situation.
Wir durchkämmen die Patientenakte bis ins kleinste Detail. Fraser kam um 8 Uhr 39 in der Notaufnahme an, so weit, so normal. Um 9 Uhr 02 wurde er einer Triage-Schwester vorgestellt, die ihm eine niedrige Behandlungsdringlichkeit attestierte, da er anscheinend eine Grippe hatte. Er hatte nur leicht erhöhte Temperatur und atmete normal. Er klagte über Lethargie und Kopfschmerzen. Um 10 Uhr 15 wurde er von Fiona untersucht, die ihm Flüssigkeit und Paracetamol verabreichte. Sie bot ihm eine Blutuntersuchung an, um eine bakterielle Infektion oder ein Virus festzustellen und ihn entsprechend zu behandeln. Er wurde auf eine Liste für die Blutabnahme durch eine Krankenschwester gesetzt. Um 10 Uhr 15 betrug seine Temperatur 38,8 Grad Celsius. Das ist kaum erhöht. Selbst frischgebackene Eltern eines sechs Wochen alten Babys würden sich deswegen keine Sorgen machen.
Dreißig Minuten später, um 10 Uhr 45, eine Dreiviertelstunde, bevor sein Herz aufhörte zu schlagen, betrug seine Körpertemperatur 42 Grad. Zu diesem Zeitpunkt ist man praktisch tot. In dem Moment kam Fiona zu mir. Das Blut gefriert mir in den Adern. Vom Normalzustand bis zum nahenden Tod war weniger als eine Stunde vergangen.
Ich kann sehen, wie Fiona sich entspannt, während wir die Aufzeichnungen durchsehen. Ich habe keinen Fehler ihrerseits erwähnt, und ich bin definitiv verunsichert. Das ist nicht der einfache Fall eines Fehlers von einer Assistenzärztin. Das ist schockierend. Das war keine Grippe und anscheinend auch keine Sepsis. Er war ein gesunder junger Mann. Manchmal sterben Menschen plötzlich, auch junge gesunde Menschen. Doch normalerweise erkennt man dann die Todesursache.
Dann lese ich etwas, das eine Welle der Übelkeit in mir aufsteigen lässt. Er war vor zwei Tagen im Krankenhaus. Sofort denke ich, dass wir etwas übersehen haben müssen. Ein Mitarbeiter meines Teams, ein Arzt oder Pfleger, muss etwas übersehen haben, das diesen Mann sein Leben gekostet hat. Ich lese die Notizen – er war wegen eines verstauchten Knöchels nach einem Rugbyspiel hier.
Der Tod ist keine Nebenwirkung von Röntgen und Kühlen einer Gelenkverstauchung.
Dann pingt der Gedanke von MRSA in meinem Gehirn an. Multiresistente Erreger gehören zu den größten Ängsten eines jeden Arztes. Aber das hier … Ich weiß nicht. Ich habe noch keinen Fall von MRSA gesehen, glücklicherweise. Aber das hier passt nicht.
Ich brüte über der Patientenakte, versuche etwas zu finden, irgendetwas, das diesen Tod erklärt. Ein Bruchstück einer Erinnerung blitzt auf. Etwas lässt mich nicht los, aber ich kann es mir nicht ins Bewusstsein holen. Was ist es? Es ist nicht von gestern. Vielleicht von vorgestern? Es dämmert mir. Ein Patient, den ich vor zwei Tagen behandelt habe. Ein älterer Mann, zweiundsechzig, der im Rettungshubschrauber von der Isle of Bute hergeflogen wurde. Er war schwerkrank, als er ankam. Auf dem Flug wurde er intubiert. Die Nieren hatten versagt. Mir war nicht klar, warum sie den Mann ins Krankenhaus gebracht hatten, aber der Rettungssanitäter sagte aufgeregt zu mir: »Sein Zustand war nicht so schlecht, als wir ihn abgeholt haben. Seine Temperatur ist in die Höhe geklettert.« In dem Moment machte ich mir deswegen keine Gedanken. Die Körpertemperatur kranker Menschen steigt. Das ist keine große Überraschung.
Der Patient starb ungefähr eine Viertelstunde nach seiner Ankunft im Krankenhaus. Wir hatten bei ihm die gleichen Schritte vorgenommen wie bei Euan Fraser – wir nahmen Blut ab, um das Bakterium oder Virus, das den Patienten angriff, identifizieren zu können. Allerdings haben wir die Untersuchungsergebnisse nicht weiterverfolgt, denn der Mann verstarb. In dem Fall war es Aufgabe der Leichenhalle, sich das anzusehen. Ich überprüfe die Bettennummern. Die beiden Männer lagen nicht nah beieinander. Patienten mit einem verstauchten Knöchel kommen nicht in den Schockraum. Dann überprüfe ich, wer vom Personal den Mann von der Isle of Bute behandelt hat. Ich war die behandelnde Oberärztin, zusammen mit einem Assistenzarzt, Ross. Doch eine der Krankenschwestern war beide Male dabei. Kirsty hat sich um den Mann von der Isle of Bute und Euan Fraser gekümmert.
Bitte, lieber Gott, lass Kirsty eine Mörderin sein, denn das wäre viel weniger anstrengend als eine ansteckende Infektion oder ein Hygieneproblem. Nein, was denke ich nur? Morde bedeuten eine Menge Papierkram.
Ich kann spüren, wie die Angst in mir aufsteigt. Es sind nicht die Todesfälle – daran bin ich gewöhnt. Es ist die Ungewissheit. Was ich an der Medizin so schätze, ist die Gewissheit. Es gibt Pläne und Systeme, Listen und Protokolle. Es gibt Autopsien und gerichtliche Untersuchungen der Todesursache. Keine Frage bleibt unbeantwortet. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie schlecht es mir in meinem dritten Studienjahr an der Universität ging, nachdem Mum gestorben war. Das ist wie eine Konfrontationstherapie in meiner Vorstellung. Diese Zeit habe ich überlebt, also werde ich das hier auch überleben. Ich habe Panikattacken bewältigt, sollte ich also jetzt eine haben, schaffe ich das. Damals habe ich gedacht, ich würde sterben, aber ich bin nicht gestorben. Nur weil ich jetzt denke, ich könnte sterben, heißt das nicht, dass das auch eintreten wird. Ich wusste nicht, dass ich Ärztin sein könnte, und jetzt bin ich Ärztin. Nimm dich in Acht vor dieser kleinen Stimme, die versucht, einen beängstigenden Moment in eine Spirale der Verzweiflung zu drehen.
Keine Panik, Amanda. Das ist nur meine Angst, die da zu mir spricht. Zwei Patienten sind noch kein Ausbruch einer antibiotikaresistenten Infektion. Zwei Patienten sind keine Pandemie. Zwei Patienten bilden noch nicht einmal ein Muster.
Fiona sagt, dass sie gehen muss. Ich sehe sie verständnislos an, unsicher, wie lange wir hier schon gesessen haben. Das ist in Ordnung, nimm dir ein paar Minuten, beruhige ich sie. Wenn man einen Patienten verliert, muss man sich mit vielen Gefühlen und Zweifeln auseinandersetzen. Sie sagt, dass sie das nicht kann, weil sich jemand krankgemeldet hat. »Ross fühlt sich nicht gut, deshalb sind wir ein Arzt weniger.«
Im Bruchteil einer Sekunde tue ich etwas total Verrücktes. Wenn mein Ehemann da wäre, würde er mir eine Sitzung bei meiner Psychotherapeutin empfehlen, weil meine Angst völlig außer Kontrolle geraten sei. Aber er ist nicht hier, und ich rufe meine Therapeutin nicht an, denn was wäre, wenn … Meine Mutter hat mir immer geraten, meinem Bauchgefühl zu vertrauen, und mein Bauchgefühl sagt mir, dass das hier eine echte Katastrophe ist. Das Gewicht dieser Erkenntnis drückt auf meine Brust. Ich muss Leute benachrichtigen. Ich muss etwas unternehmen, mich nicht nur still sorgen.
Ich gehe wieder auf die Station hinaus. Ich bitte die Oberschwester, alle Patienten in unserer Abteilung zu fragen, ob sie vor zwei Tagen bereits einmal in der Notaufnahme waren. Sie sieht mich missbilligend an, aber ich habe keine Zeit, mit ihr zu diskutieren, deshalb gehe ich weiter zum Warteraum. Ich frage, wer von den Anwesenden schon vor zwei Tagen hier war, und zwei Männer stehen auf. Einer hebt nur den Arm. Er ist blasser als die anderen beiden. Er soll sich auf eine Trage legen. Mein Herz zieht sich krampfhaft zusammen, wie immer, wenn ich eine Panikattacke bekomme, aber diesmal gibt es tatsächlich einen Grund zur Panik. Das hier ist noch nie zuvor geschehen. Bei früheren Attacken bin ich wegen nichts in Panik geraten, das sollte niemals berechtigte Panik sein. Ich möchte weinen, im Belegschaftsraum auf einen Stuhl sinken; jemand anderes soll mit diesem Problem – was es auch immer sein mag – fertigwerden.
Alle haben grippeähnliche Symptome. Entweder machen sie selbst oder ihre Ehefrauen sich Sorgen, dass es etwas Lebensbedrohliches wie eine Sepsis sein könnte. Im Oktober hatte die Regierung eine Kampagne gegen Sepsis gefahren, dadurch konnten allein in diesem Krankenhaus zwanzig Leben gerettet werden, und auch die Wartezeit ist automatisch gestiegen. Hinz und Kunz ist davon überzeugt, eine Blutvergiftung zu haben.
Ich möchte diesen Männern sagen, dass das, was ihnen fehlt, meiner Meinung nach sehr viel schlimmer ist als eine Blutvergiftung, zehnmal erschreckender als eine der tödlichsten Erkrankungen der Nation, aber ich schweige. Ich bleibe entschlossen und nach außen hin ruhig. Niemand wagt es, mein Tun infrage zu stellen, bis ich alle aus dem Raum der ambulanten Notfallversorgung hinauswerfe und die drei vermutlich infizierten Patienten dort unterbringe. Eine der Krankenschwestern wendet sich entrüstet an mich, aber ich schicke sie direkt in den Schockraum. Ich kann die Lage jetzt nicht erklären, wir haben keine Zeit. Die Oberschwester hat getan, worum ich sie gebeten hatte, und sie hat zwei Patienten gefunden, die bereits vor zwei Tagen in der Notaufnahme waren. Ich habe drei aus dem Warteraum. Das macht fünf. Mit Euan Fraser sechs. Mit dem Mann von der Isle of Bute sieben. Das ist kein Zufall.
Fiona stürmt zur Tür herein. »Ross ist gerade von einem Rettungswagen hergebracht worden.«
Acht.
Das ist nicht meine Angst, das weiß ich jetzt. Mit eiskalten Fingern rufe ich meinen Mann an.
»Es gibt eine Infektion. Es sieht wirklich böse aus.«
»Warte, was war das? Welche Art von Infektion? MRSA?«
»Nein, ich habe das noch nie zuvor gesehen. Sie breitet sich rasend schnell aus. Du musst nach Hause. Jetzt sofort.«
»Bist du sicher, dass das nicht deine Angst ist, die da zu dir …«
»Hör. Auf. Damit. Ich habe acht Patienten, die einer nach dem anderen sterben, nebeneinander aufgereiht, als ob wir im Zweiten Weltkrieg wären. Es sind alles Männer, ich weiß noch nicht, ob das irgendetwas bedeutet, aber es ist kein gutes Zeichen. Geh nach Hause. Ich schwöre bei Gott, wenn du nicht behauptest, du hättest dich gerade übergeben, und nach Hause fährst, lasse ich mich scheiden.« Ich bin hysterisch. Ich habe noch nie gedroht, meinen wunderbaren Onkologen-Ehemann, der mich immer unterstützt, zu verlassen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass irgendetwas mich dazu bringen würde, solche Drohungen auszustoßen. Aber ich hätte mir das hier auch nie vorstellen können.
»Fahr nach Hause. Fass niemanden an, sprich mit niemandem, geh einfach. Hol die Jungs auf dem Heimweg ab. Sie sollen zu dir nach draußen kommen. Geh nicht ins Schulgebäude rein. Bitte hol sie jetzt.« Ich flehe ihn an. Will willigt ein. Ich weiß nicht, ob er Angst vor mir oder um mich hat. Es ist mir egal. Er soll nur mit unseren Söhnen zu Hause in Sicherheit sein. Ich schicke eine Nachricht an meine Söhne, dass ihr Vater sie abholen kommt und dass sie vor der Schule auf ihn warten sollen. Ich werde ihnen jede Entschuldigung schreiben, die sie brauchen. Ich werde den Lehrern irgendetwas erzählen.
Von früher kenne ich eine Frau, die bei Health Protection Scotland arbeitet, der Organisation für Gesundheitsschutz in unserem Land. Wir waren zusammen an der Universität, und jetzt ist sie dort stellvertretende Direktorin. Sie war immer etwas schnippisch, aber das ist mir gleichgültig. Sie muss mir zuhören. Ich rufe sie an und versuche, ruhig zu klingen, während ich mit der Telefonzentrale spreche. Als ich meiner früheren Kommilitonin alles in Eile erzähle, macht sie ständig kurze Geräusche, als ob sie das Gespräch schnell beenden möchte. Sie klingt nicht besorgt, anscheinend meint sie, das alles schon gesehen zu haben. Sie ist seit zehn Jahren keine praktizierende Ärztin mehr, aber ich habe den Eindruck, dass sie mir nicht traut. Vielleicht machen meine Erklärungen nicht deutlich, wie dringend die Lage ist. Mir ist das vollkommen klar, aber es klingt so unbedeutend – acht Menschen sind krank, okay, wir werden sehen, was passiert, und wir werden das prüfen. Ich halte meine Beobachtungen auch in einer E-Mail fest und schließe damit, dass der Gesundheitsschutz die Fälle in unserem Krankenhaus untersuchen sollte, nur für den Fall. Dann setze ich mich zu einem der Patienten und messe seinen Puls. Fünfundvierzig Schläge pro Minute. Er wird bald sterben. Alle hier werden sterben. Atme, Amanda. Die Kavallerie wird gleich herbeistürmen. Ich werde nicht mehr allein mit dieser Situation fertigwerden müssen. Es wird jemand da sein, dem ich das Ruder übergeben kann. Jemand Qualifiziertes, der beruflich einen Schutzanzug trägt, wird kommen und alles besser machen; und ich darf dann nach Hause gehen und vergessen, dass das hier je geschehen ist.
Die Türen der ambulanten Notfallversorgung schwingen auf. Es ist die Oberschwester.
»Vier weitere Erkrankte sind gerade in Rettungswagen eingetroffen. Zwei von ihnen waren vor zwei Tagen hier, die anderen beiden gestern. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Mein schlimmster Albtraum wird wahr.
E-Mail von Amanda Maclean ([email protected]) an Leah Spicer ([email protected]), 18 Uhr 42, 3. November 2025
Leah,
deine E-Mail-Adresse habe ich online gefunden. Du hattest vergessen, sie mir am Telefon zu geben, nachdem du gemeint hattest, ich solle dir schreiben. Ich bin gerade von meiner Schicht nach Hause gekommen. Als ich das Krankenhaus verließ, waren neunzehn lebende Patienten in der Notaufnahme, die alle Symptome zeigten von etwas, was ich für ein Virus halte. (Antibiotika machten keinen Unterschied, allerdings muss die Pathologie die Vorgänge noch bestätigen. Ist es einfacher, wenn euer Labor bei HPS das übernimmt, oder geht es schneller, wenn wir hier in Gartnavel weitermachen?). Von den sechsundzwanzig, die ich bis jetzt gesehen habe, waren fünf tot, bevor ich das Krankenhaus verließ. Der Erste, den ich untersucht hatte, ein Mann von der Isle of Bute, verschied vor zwei Tagen. Euan Fraser heute Nachmittag. Drei weitere Patienten starben bald, nachdem sie bei uns eingeliefert wurden, darunter einer meiner Assistenzärzte, Ross.
Es sind alles Männer. Natürlich sind die Fallzahlen noch zu klein, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Vielleicht sind Männer anfälliger für dieses Virus? Können wir das alles bitte in einem Telefonat besprechen und vielleicht auch deine Vorgesetzten informieren? Das hier ist sehr schlimm, Leah. Du musst verstehen, dass die Krankheit sich rasend schnell ausbreitet. Patienten, die normale Grippesymptome haben und sich unwohl fühlen, haben innerhalb von Stunden 43 Grad Fieber und sterben.
Bitte antworte mir, so schnell du kannst.
Amanda
E-Mail von Amanda Maclean ([email protected]) an Leah Spicer ([email protected]), 18 Uhr 48, 3. November 2025
Leah, da war auch noch ein Baby, ist mir gerade aufgefallen. Wir dachten, es wäre Sepsis. Der Kleine war vor Euan Fraser bei uns in der Notaufnahme. Er war erst zwei Monate alt. Ich hielt ihn für stabil, als wir ihn nach oben auf die Kinderintensivstation schickten, aber gerade haben sie mir am Telefon gesagt, dass er wenige Minuten nach seiner Ankunft im ersten Stock starb. Der Kleine war schon einige Tage zuvor in der Notaufnahme behandelt worden.
Insgesamt habe ich also heute siebenundzwanzig Patienten mit ähnlichen Symptomen gesehen. Sechs Todesfälle. Der Älteste unter ihnen zweiundsechzig Jahre, der Jüngste zwei Monate alt.
Amanda
Weitergeleitet: E-Mail von Amanda Maclean ([email protected]) an Leah Spicer ([email protected]), 18 Uhr 48, 3. November 2025. Weitergeleitet an Raymond McNab ([email protected]), 10 Uhr 30, 4. November 2025
Ray,
anbei zwei E-Mails von einer Frau, mit der ich zur Uni gegangen bin. Sie ist Oberärztin in Gartnavel. Ich denke, sie verwechselt eine schwere Grippe (immerhin haben wir November …) mit anschließender Sepsis/hoher Todeswahrscheinlichkeit aufgrund anderer Komplikationen mit etwas sehr viel Ernsterem. Wir haben keine weitere Meldung eines Erregers von der Kategorie-1-Liste, daher denke ich, dass wir an der SARS/MRSA/Ebola-Front sicher sind.
Unter uns, diese Ärztin hatte zu Unizeiten einen Nervenzusammenbruch. Ist damals total durchgedreht und musste ein Jahr pausieren. Ich meine mich zu erinnern, dass damals ein Elternteil von ihr gestorben ist. Jedenfalls ist sie ziemlich labil. Ich habe vor, ihr eine ausweichende Antwort zu schicken, in der ich gut durchgeführte Infektionskontrolle empfehle und ihr anbiete, sich bei Bedarf wieder an mich zu wenden. Melde dich, wenn du anderer Meinung bist.
Danke,
Leah
E-Mail von Raymond McNab ([email protected]) an Leah Spicer ([email protected]), 10 Uhr 42, 4. November 2025
Danke, Leah.
Hört sich an, als wäre diese Ärztin eine komplett geistesgestörte Irre, die versucht, die begrenzten Ressourcen und die knappe Zeit unserer Institution zu vergeuden. Ganz zu schweigen von meiner Geduld. Bitte ignorieren.
Ray
Catherine
London, Vereinigtes Königreich
Tag 5
Situationen wie das Abholen von der Kita konnte ich noch nie gut meistern. Ich spreche nicht gern mit Menschengruppen, die ich nur vage kenne. Mit Fremden ist das in Ordnung, und natürlich ebenso mit Freunden. Aber ich kann einfach keine Clique um mich versammeln, die mich in solchen Momenten rettet. Am Tor der Kita gibt es unzählige Fettnäpfchen, in die ich treten kann, oder ich interpretiere ein freundliches Hallo fälschlicherweise als einen »Komm rüber und rede mit uns!«-Wink, wo es doch in Wahrheit ein »Ich unterhalte mich gerade mit jemand anderem, nett, dich aus der Ferne zu sehen!«-Wink ist. Ich habe einen Doktortitel in Sozialanthropologie, doch der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen Wink entgeht mir gern einmal. Die Ironie hingegen ganz sicher nicht.
In den letzten Tagen war das Abholen auf andere Weise anstrengend. Alle wollen reden, aber nicht, weil sie mich für eine brillante Gesprächspartnerin halten (obwohl ich die Hoffnung nicht aufgebe). Nein, anscheinend suchen sie einen Resonanzboden für ihre wachsenden Ängste. Alle sprechen nur von der Seuche, obwohl wir einander versichern, dass sie noch weit weg ist, wie weit ist es bis Glasgow? Sechshundert, siebenhundert Kilometer? Absolut sicher. Die Behörden werden das bald unter Kontrolle haben. Eine Mutter, sie ist Anwältin, erzählt mir seit drei Tagen in dem resoluten, unangreifbaren Tonfall, den sie sicherlich vor Gericht gebraucht, dass es absolut gar nichts gibt, worüber man sich Sorgen machen müsste. Absolut. Gar. Nichts. Wenn sie sich damit selbst überzeugen will, dann hat sie hoffentlich mehr Erfolg als bei mir, denn sie hat meine Angst geschürt, die ich auf Sparflamme gehalten hatte.
Es fühlt sich wie gestern an, dass wir die Guy-Fawkes-Night beim St.-Joseph’s-Feuerwerk gefeiert haben. Ein Abend mit Hotdogs, Handschuhen und entzückenden Bildern von Anthony, einen aufgeregten Theodore mit roten Bäckchen auf dem Arm. Soweit ich mich erinnere, habe ich mich da zum letzten Mal wirklich entspannt und glücklich in einer Menschenmenge gefühlt – und es ist erst fünf Tage her. In den Nachrichten verwenden sie immer noch den gedämpften Tonfall von Journalisten, die mit Fakten umgehen, nicht mit Meinungen. Doch die Fakten werden ganz von allein immer widerwärtiger. Ein Virus, das nur Männer angreift. »So weit die Beobachtungen bei den Ausbrüchen in Glasgow, Edinburgh und entlang der schottischen Westküste, die bis jetzt nicht von offizieller Seite bestätigt wurden«, heißt es in den Nachrichten.
Ich habe mir den Kopf zerbrochen, und mir ist keine einzige Infektionskrankheit eingefallen, die nur Männer befällt. Natürlich ist mein Wissen über Infektionskrankheiten nicht besonders groß, aber dennoch. Ist das nicht seltsam? Warum geben die Regierung und die Krankenhäuser nicht zu, wie merkwürdig das ist? Auf gewisse Weise würde ich mich besser fühlen, wenn eine offizielle Stelle offen verkünden würde: »Wir haben noch nie von dieser Krankheit gehört. Wir wissen nicht, was los ist.«
Beatrice, normalerweise meine soziale Retterin – meine »Kita«-Freundin –, packt meine Hand, sodass ich mich erschrecke.
»Beatrice!« In den letzten Tagen hatte sie ihr Kindermädchen zum Abholen geschickt. Ich bin erleichtert, ein freundliches Gesicht zu sehen, aber die Freude ist schnell vorüber. Sie sieht sehr mitgenommen aus.
»Ich ziehe nach Norfolk. Morgen.«
»Was? Was tust du?«, stoße ich hervor. Beatrice hat ein Landhaus in Norfolk, wo sie bestenfalls vier Wochenenden im Jahr verbringt. Den Rest der Zeit vermietet sie es über Airbnb.
»Das Virus. Das hört sich nicht gut an, Catherine. Es hat einen Ausbruch in Streatham gegeben. Ich verlasse die Stadt, bevor es zu spät ist.«
»Bevor es für was zu spät ist?«
»Wenn das Schlimmste erst eingetreten ist, hat es keinen Sinn mehr wegzugehen.«
Beatrice macht mir Angst. Sie ist der ruhigste Mensch, den ich kenne, und jetzt klingt sie verstört.
»Ich habe drei Söhne, Catherine. Zwei Brüder. Meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, nur mein Vater lebt noch. Wir werden nicht in London bleiben, um herauszufinden, wie schlimm diese Sache mit dem Virus noch wird.«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Argumente vorzubringen gegen das, was sie sagt, ich könnte die Plattitüden der anderen Mütter wiederholen, und bei dem Gedanken an meine eigene Statistik steigt Übelkeit in mir auf. Ein Sohn. Ein Ehemann. Keine Mutter. Keine Tochter. Diese Sache wird nicht gut für mich ausgehen.
»Wie wollt ihr euch das leisten?« Endlich finde ich die Worte, um eine vernünftige Frage zu stellen.
Beatrice sieht mich mit einem Gesichtsausdruck an, der schnell in Mitleid umschlägt. »Warum, glaubst du, haben Jeremy und ich immer so hart gearbeitet, meine Liebe? Warum, meinst du, wohnen wir hier? Unter uns gesagt, wir brauchen einige Jahre lang nicht zu arbeiten.«
Sie stürzt davon, die Handtasche von Dior über einer Schulter, um ihren Sohn Dylon aus dem Spielzimmer dieser ruhigen, freundlichen Montessori-Kita im Süden von London zu holen, einer Gegend, die, wie ich gerade erkannt habe, Beatrice als vollkommen unter ihrer Würde betrachtet. Im Gegensatz zu ihr habe ich keinen Ort, wohin ich gehen könnte. Ich muss hierbleiben und abwarten.
Amanda
Glasgow, Vereinigtes Königreich
Tag 9
Ist der Beginn einer Seuche ein guter Zeitpunkt, um sich scheiden zu lassen? Oder sollte ich ihn einfach umbringen, um die Formalitäten zu vermeiden? Will, dieser verdammte Idiot, ist zur Arbeit gegangen. Er wusste, dass er das nicht tun sollte. Ich bin so vorsichtig gewesen.
Als ich das Krankenhaus am 3. November nach Ende meiner Schicht verließ, zog ich meine OP-Klamotten aus und ging in Unterwäsche zum Notausgang im Umkleideraum, wo ich frische OP-Sachen aus der Plastikverpackung nahm und überstreifte. Dann verließ ich den Raum durch die Tür, auf der die Aufschrift »NURNOTAUSGANG« prangt. Ich habe mich nicht ansatzweise um Notausgänge geschert.
Nachdem ich bei mir zu Hause aus dem Auto gestiegen war, ging ich nicht zur Eingangstür, sondern zog mich in der Garage aus und verbrannte die Klamotten. Dann lief ich nackt durchs Haus und duschte mich. Das Wasser stellte ich so heiß ein, wie ich es aushalten konnte, und wusch mich mit einer ganzen Flasche Desinfektionswaschmittel, die ich aus dem Lagerraum des Krankenhauses mitgenommen hatte. Ich näherte mich nicht den Jungen und schrie sie an, als sie anfingen, aus Spaß in kleinen Schritten auf mich zuzukommen. In der ersten Nacht war Will skeptisch, als ich auf einem Feldbett in der Garage schlief. Am nächsten Tag ging er zur Arbeit, obwohl ich ihm unter Todesstrafe befahl, es zu unterlassen – er ging, bevor ich aufwachte –, und als er nach Hause kam, war er bleich im Gesicht vor Erschütterung.
»Ich glaube dir«, sagte er. Das wird uns jetzt herzlich wenig nützen, wollte ich ihn anschreien. Er war dem Erreger unnötigerweise ausgesetzt gewesen. Er war wieder ins Krankenhaus gegangen. Dem Ort im Land mit der höchsten Anzahl infizierter Menschen.
Danach war er nicht mehr zur Arbeit gegangen. Bis gestern. Acht Tage waren vergangen seit dem Tag in der Notaufnahme, als diese böse Krankheit ihren Anfang genommen hatte, und es ging ihm immer noch gut. Die Inkubationszeit kann nicht mehr als ein paar Tage betragen, wenn man bedenkt, nach welch kurzer Zeitspanne die infizierten Patienten in die Notaufnahme zurückkamen. Wir waren sicher, außerhalb der Gefahrenzone, so sicher, dass ich mit Will und den Jungen im selben Zimmer saß, mit ihnen über eine Netflix-Serie lachte und keinen Herzinfarkt bekam, sobald einer von ihnen nieste. Dieser Trottel von meinem Ehemann, der am 4. November zur Arbeit ins Krankenhaus gegangen und dem Tod auf irgendeine Weise entkommen war, muss nicht einmal eine Woche später entschieden haben, dass das Leben hier in diesem ruhigen Vorort im nördlichen Glasgow schlichtweg nicht aufregend genug für ihn ist.
»Es geht um ein Baby«, brüllt er mich an, als mir nach seiner Rückkehr nach Hause schließlich die Puste ausgeht. Er war nur einige Stunden fort. »Die Kleine wird sterben, wenn ich ihr nicht helfe. Im Moment bin ich der einzige Kinderonkologe im Krankenhaus.« Er sagt nicht, warum er der einzige ist, denn er weiß, dass das alle meine Fragen beantwortet und seine Argumente absurd aussehen lässt. Er ist im Moment der einzige Kinderonkologe im Krankenhaus, weil die anderen beiden gestorben sind.
»Du hast zwei Kinder hier in diesem Haus«, fahre ich ihn wütend an. »Vielleicht bist du der bessere Arzt von uns beiden, aber ich bin der bessere Elternteil. Mir liegt mehr an Charlie und Josh als an irgendeinem Kleinkind.«
Jetzt weint Will. Ich habe ihn noch nie zum Weinen gebracht. Die Worte, die ich herausschreien will, ersterben in meiner Kehle. »Ihre Mutter hat mich auf dem Handy angerufen. Sie hat mich angefleht zu kommen, weil ihre Tochter sonst sterben würde. Seit mehr als achtundvierzig Stunden hat ihr niemand mehr die Chemo verabreicht. Sie ist, sie ist, ich … Ich will nur …« Er bricht in Schluchzen aus. Selbst in meinem größten Zorn möchte ich ihn unbedingt beruhigen; ich will ihn in meinen Armen wiegen, ihm sagen, dass man jeden Fehler wiedergutmachen kann und ich ihm verzeihe.
Doch dieser Fehler kann nicht wiedergutgemacht werden. Ich kann meinen Ehemann nicht berühren, denn wenn er das Virus in sich trägt, könnte ich mich anstecken, und das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Söhne krank werden. Ich kann ihm nicht verzeihen, wenn unsere Söhne deswegen sterben. Ein namenloses, gesichtsloses Kind auf einer sechs Kilometer entfernten Krankenhausstation ist nicht meine Angelegenheit. Meine Jungen – Charlie und Josh, mit den ersten sprießenden Bartstoppeln im Gesicht, den braunen Augen und Sommersprossen und den Stirnfalten, wenn sie sich auf ihre Hausaufgaben konzentrieren – sind meine Angelegenheit. Ich kann Will nicht verzeihen, dass er sie nicht an erste Stelle gesetzt hat. Sie sind die Einzigen, auf die es ankommt.
»Schlaf in der Garage. Fass nichts an. Verhalte dich ruhig. Geh nicht zu den Jungen. Wenn sie versuchen, zu dir in die Garage zu kommen, brüll sie an, als würden sie gleich auf eine heiße Herdplatte fassen.«
Will schluchzt nur und nickt einwilligend.
»Ich liebe dich«, sage ich. Ich erinnere mich an eine Frau vor einigen Jahren in der Notaufnahme. Sie hatte ihren Mann nach einem heftigen Streit tot im Schlafzimmer gefunden, er hatte sich an einer Gardinenstange erhängt. Sie war zu ihm gegangen, um sich zu entschuldigen und sich mit ihm auszusöhnen. Ich habe Will nie davon erzählt, aber seit damals sage ich ihm immer, dass ich ihn liebe, bevor ich aus dem Raum gehe, ganz gleich, wie heftig die Auseinandersetzung war. Die Seuche macht schnellen Prozess mit Männern. Wir müssen nicht ihren Job machen.
»Ich liebe dich auch. Es tut mir leid.«
Ich weiß, Liebling. Aber ich werde dir nie verzeihen.
Lisa
Toronto, Kanada
Tag 13
Schatz, hast du das gesehen?«
Meine Frau wedelt mit einem Artikel aus dem Wissenschaftsteil der New York Times vor meiner Nase. Ihre inständigen Bitten, etwas zu lesen, bin ich gewöhnt, aber es muss das erste Mal in fünfzehn Jahren sein, dass sie mich auf etwas Wissenschaftliches hinweist.
»Der Ausbruch eines aggressiven Influenzastamms hat zu Zehntausenden Erkrankungen in Schottland geführt, nachdem der Erreger erstmals Anfang November in Glasgow aufgetreten war. Weiterhin wurden Ausbrüche in London, Manchester, Leeds, Liverpool, Birmingham und Bristol gemeldet. Einzelberichten zufolge infiziert dieser Influenzastamm nur Männer. Bis dato wurde von keinem Fall berichtet, in dem eine Frau erkrankt war. Die Sterblichkeitsrate liegt mit über fünftausend gemeldeten Todesfällen sehr viel höher als bei der herkömmlichen Grippe.«
Über fünftausend Tote? Das ist viel für die Grippe. Und das in wenigen Wochen.
»Warte«, sage ich und beginne, in meinem Gedächtnis zu kramen. »Hast du gesagt, dass sich nur Männer infizieren?«
Margot nickt entschieden. »Ja.«
Ich setze mich neben sie, mein Gehirn läuft auf Hochtouren. »Nur Männer? Eine Grippe? Wie seltsam. Ich habe noch nie von so etwas gehört.«
»Ich auch nicht«, stimmt Margot mir zu, mit dem Unterschied, dass sie Professorin für Geschichte der Renaissance ist und nebenbei Liebesromane schreibt, beides keine Berufsfelder, wo Influenzastämme im Detail diskutiert werden, es sei denn, es geht darum, den Helden beinahe, aber letztlich doch nicht niederzustrecken. Auf meinem Arbeitsgebiet hingegen ist die Grippe von allergrößter Bedeutung. Wenn ich noch nie von einer Grippeerkrankung, oder genau genommen irgendeiner Infektionskrankheit, gehört habe, die nur Männer befällt, dann existiert sie wahrscheinlich nicht, oder zumindest wurde sie noch nicht untersucht. Das hier könnte interessant sein. Ich schreibe eine E-Mail an meine Assistentin Ashley mit einer Anweisung für morgen früh.
Ashley,
im Wissenschaftsteil der NYT kam ein Bericht über eine Grippe in Schottland, an der nur Männer erkranken. Könnten Sie bitte alle Veröffentlichungen dazu heraussuchen und mir bis elf Uhr in mein Büro bringen?
Danke
Lisa
Dr. Lisa Michael
Professorin für Virologie, Leiterin des Instituts für Virologie, Universität von Toronto
›Nolite Te Bastardes Carborundorum‹
Amanda
Glasgow, Vereinigtes Königreich
Tag 16
Niemand hört auf mich. Allmählich denke ich, dass ich verrückt werde. Ich schicke eine E-Mail, und da ich keine Antwort erhalte, frage ich mich anschließend, ob ich sie wirklich abgeschickt habe. Das gesamte medizinische Establishment Schottlands will mich in den Wahnsinn treiben. Gartnavel hat mich heute gefeuert, was einleuchtet. Ich war seit fünfzehn Tagen nicht mehr bei der Arbeit. Auf gar keinen Fall werde ich dem Gesundheitsdienst Priorität vor meinen Kindern einräumen. Die Frau am Telefon, eine Idiotin namens Karen (natürlich hieß sie Karen), sagte zu mir: »Sie sollten sich schämen, Ihre Patienten im Stich zu lassen, wenn sie Sie am dringendsten brauchen.« Ich fragte Karen, womit sie ihren Lebensunterhalt verdiente: Sie ist Verwaltungsangestellte. »Was wissen Sie schon, was meine Patienten brauchen?«, fauchte ich und spürte die neugierigen Blicke meiner Söhne in meinem Rücken, während ich ins Nebenzimmer ging und die Tür hinter mir schloss. »Das Virus kann nicht behandelt werden, Virostatika sind unwirksam. Nichts macht einen Unterschied. Ich könnte die Heilige Maria sein und wäre nicht in der Lage, irgendeinen Menschen zu retten.« Da legte sie auf.





























