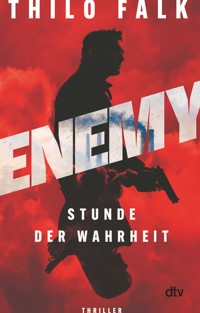
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen Im Naturschutzgebiet ›Schwarzes Moor‹ soll ein Kohlevorkommen abgebaut werden. Umweltschutzgruppen stellen sich vehement dagegen – allen voran Anouk Grunwaldt, die Frontfrau der Klimaschutzbewegung. Ganz andere Ziele verfolgt Utz Mildenberger, Vorsitzender des größten deutschen Stromkonzerns. Inmitten der Proteste um den bevorstehenden Abbau plant ein hochprofessioneller Auftragskiller ein grausames Attentat auf einen der Hauptakteure. Ermittlerin Karla Beneventi vom BKA muss dahinterkommen, wer im Fadenkreuz des Killers steht: Ist es die junge Klimaaktivistin oder der erfolgreiche Energiemanager? Und vor allem: Wie kann das Attentat noch vereitelt werden? Denn die Stunde der Wahrheit hat bald geschlagen. Für Leserinnen und Leser von Arne Dahl und Marc Raabe »›Warum ich? Warum jetzt? Warum so?‹ Diese Fragen hatte Isak Jensen oft genug in den Augen seiner Opfer gelesen. Doch Jensen hätte ihnen nur selten die Antworten geben können. Menschen hassten einander. Sie wünschten einander den Tod. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Geld. Macht. Liebe. Rache. Er ging davon aus, dass irgendwer jedem von uns den Tod wünschte. Allerdings waren die meisten Menschen zu feige, zu träge oder nicht reich genug, einen Mord in Auftrag zu geben. Erstaunlich war nicht, dass auf manche Menschen ein Auftragsmörder angesetzt wurde. Sondern wie viele weiterleben durften. Zumindest heute.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Im Naturschutzgebiet ›Schwarzes Moor‹ soll ein Kohlevorkommen abgebaut werden. Umweltschutzgruppen stellen sich vehement dagegen – allen voran Anouk Grunwaldt, die Frontfrau der Klimaschutzbewegung. Ganz andere Ziele verfolgt Utz Mildenberger, Vorsitzender des größten deutschen Stromkonzerns. Inmitten der Proteste um den bevor stehenden Abbau plant ein hochprofessioneller Auftragskiller ein grausames Attentat auf einen der Hauptakteure. Ermittlerin Karla Beneventi vom BKA muss dahinterkommen, wer im Fadenkreuz des Killers steht: Ist es die junge Klimaaktivistin oder der erfolgreiche Energiemanager? Und vor allem: Wie kann das Attentat noch vereitelt werden? Denn die Stunde der Wahrheit hat bald geschlagen.
Von Thilo Falk sind bei dtv außerdem erschienen:
Dark Clouds
White Zero
Thilo Falk
ENEMY
Stunde der Wahrheit
Thriller
Ohne den Tod, wie entflöhe man dir, o Leben?
Da tausend Übel du hegst: Nicht zu fliehn, noch zu ertragen ist leicht.
Lieblich zwar ist und schön, was Natur schafft: Erd und Gewässer,
Und die Gestirne, des Monds, Helios strahlender Kreis,
Alles das andere jedoch ist Trübsal und Furcht, und wenn einer Gutes erfährt, zum Lohn trifft ihn die Nemesis leicht.
(Aesop)
4. Mai
Brüssel, 9:56 Uhr
Warum ich?
Warum jetzt?
Warum so?
Diese Fragen hatte Isak Jensen oft genug in den Augen seiner Opfer gelesen.
Doch Jensen hätte ihnen nur selten die Antworten geben können.
Menschen hassten einander. Sie wünschten einander den Tod. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Geld. Macht. Liebe. Rache.
Er ging davon aus, dass irgendwer jedem von uns den Tod wünschte. Allerdings waren die meisten Menschen zu feige, zu träge oder nicht reich genug, einen Mord in Auftrag zu geben.
Jensen war kein Sadist. Er hatte keine Freude daran, Menschen zu töten. Er erledigte seinen Job ordentlich. Nicht mehr, nicht weniger. Hätte ihn jemand gefragt, so hätte er gesagt: Hoffentlich besser, als wenn es ein anderer täte.
Er bemühte sich, seinen Opfern keine Angst zu machen und keinen unnötigen Schmerz zuzufügen. Er musste abwägen. Messer, Gift, Handfeuerwaffe, Scharfschützengewehr, Garotte, ein Autounfall, Sprengstoff, ein Sturz aus dem Fenster oder in einen Abgrund, ein Kissen im Gesicht. Es gab keine richtige und falsche Entscheidung. Das passende Gift oder ein weiches Kissen in der Nacht waren die sanftesten Optionen, aber oft schwierig umzusetzen. Ein Autounfall war leicht zu arrangieren, aber schwer zu kontrollieren. Letztlich bevorzugte er daher sein Scharfschützengewehr G22A2 aus den Beständen der Bundeswehr. Nachtkampffähig und mit Signaturdämpfer ausgestattet wog es knapp zehn Kilo. Um es einzusetzen, musste er Informationen einholen und Locations auskundschaften. Er hatte die Mühe noch nie bereut.
Doch diesmal sollte es schnell gehen. Für einen erfreulichen Aufpreis hatte er sich gestern bereit erklärt, die Zielperson vor heute Mittag auszuschalten.
Den größten Teil der Zeit hatte die Anreise benötigt. Vor Ort war er daher auf seine Intuition und seine Erfahrung angewiesen. Auf die Verlockung großer Summen Bargeld.
Fünfundzwanzig Kilo Ammonium Nitrat Fuel Oil (ANFO) in einer Sporttasche morgens um fünf, ein Prepaidhandy und ein paar Drähte, ein Flughafenmitarbeiter mit zu vielen Kindern, mehr brauchte es nicht.
Warum?
Geld, Macht, Liebe, Rache.
Genauer kannte Jensen die Antwort nicht, und sie interessierte ihn auch nicht.
Erstaunlich war nicht, dass auf manche Menschen ein Auftragsmörder angesetzt wurde. Sondern wie viele weiterleben durften. Zumindest heute.
»Gleich geht es los«, sagte Jensen und kraulte seinen Dackel Maurizio im Nacken. Maurizio lag neben ihm auf einer Bank auf dem Brüsseler Friedhof und hechelte leise. Dem Hund war bereits zu warm. Jensen mochte die Frühsommertemperaturen. Die letzten Tage waren kühler als üblich gewesen, der April verregnet.
Er sah auf die Uhr, überprüfte die Anzeige der Abflüge auf dem Handy.
Wie erwartet hörte er eine Bombardier Global, die nicht im offiziellen Plan verzeichnet war. »Gleich«, wiederholte er leise und schaute himmelwärts.
Der Privatjet mit sechzehn Plätzen und bis zu zwölftausend Kilometern Reichweite stieg über dem Stadtteil Drei Linden auf, flog in Richtung Schaarbeek. Aus den Fenstern rechts würde gleich das Atomium zu sehen sein.
Jensen blickte sich um. In einiger Entfernung zupfte ein alter Mann Unkraut auf einem Grab. Ein Pärchen ging spazieren. Niemand achtete auf ihn.
Er zog einen kleinen Feldstecher hervor, überprüfte das Luftfahrzeugkennzeichen.
»Sehr gut.« Jensen steckte das Fernglas ein, zog ein zweites Handy aus der Tasche. Er drückte eine Kurzwahltaste.
Wenige Sekunden später ertönte ein Knall. Ein weißer Blitz schoss aus dem Bauch des Flugzeugs, gefolgt von einer rötlich-grauen Wolke. Das Metall zerriss, die Maschine brach in zwei Teile.
Sie zogen silbrig-weiße Bögen in Richtung der Stadt. Zuerst schlug die Nase auf, dann der hintere Teil samt Tragflächen und Tank. Das Donnern der massiven Explosion rollte bis zu Jensen herüber.
Maurizio hob den Kopf und quiekte besorgt.
»Alles okay, mein Junge«, murmelte Jensen und tätschelte dem Dackel den Kopf. »Alles okay. Wir sind weit genug weg.«
Nach einem kurzen Moment der Stille begannen die ersten Sirenen zu jaulen.
Der alte Mann schaute in Richtung Stadt. Die Spaziergänger waren nicht mehr zu sehen.
Jensen steckte das Handy weg, nahm sein eigenes wieder zur Hand. Am oberen Rand wurde eine eingehende Nachricht angezeigt. Jensen öffnete sie. »Planänderung. Muss mit an Bord. Abbruch!«
»Hm«, machte Jensen.
Das ließ sich jetzt nicht mehr ändern.
Nachdenklich streichelte er Maurizio. Kopfschüttelnd schaute er in Richtung der Rauchsäule, die über der Stadt aufstieg. Auf seine zweite Rate würde er wohl verzichten müssen.
Jensen erhob sich, ließ Maurizio in die Tragetasche steigen und hängte sie sich um.
Beim Verlassen des Friedhofsparks hielt er einer alten Dame mit einem Fahrrad das Tor auf. Sie transportierte zahlreiche Geranien in einem Korb am Lenker.
»Vielen Dank, junger Mann«, sagte sie mit einem Lächeln. Dann blieb sie stehen. »Habe Sie auch jemanden verloren?«, fragte sie und legte Jensen die Hand auf den Arm.
Er schüttelte den Kopf. »Nein, nicht jemanden. Nur etwas.«
Die alte Dame lächelte. »Verlieren Sie nicht den Mut«, sagte sie sanft. »Verlieren Sie nie den Mut und die Lebensfreude.«
»Danke. Ich werde es versuchen«, entgegnete Jensen freundlich.
Das Handy, mit dem er die Bombe gezündet hatte, warf er in einen der Hightech-Müllschlucker am Straßenrand. Die Presse am unteren Ende des Schachts würde es in Stücke platzen lassen, sodass keine Spur zu ihm zurückführte.
Zügig ging er dann mit Maurizio in Richtung Bahnhof. Der Eurostar brachte ihn in gut zwei Stunden zurück nach London.
Berlin, 11:47 Uhr
»Nein, nicht da!« Anouk kicherte und kniff vergnügt die Augen zu.
Utz küsste sie erneut auf die zarte Haut unterhalb ihrer Brüste. Er fuhr mit der Hand sanft über ihren nackten Bauch.
Anouk vergrub ihre Finger in seinem Haar, zog ihn an sich, ließ ihren Kopf genüsslich in das Kissen sinken.
Sie liebte Hotelbetten.
Utz’ Lippen wanderten höher. Er küsste ihre Brüste, ihre Nippel, ihren Hals. Ihren Mund.
Es war wundervoll.
Zwanzig Minuten später ertönte der Weckton ihres Handys auf dem Nachttisch.
Inzwischen lag sie oben. Mit einem Seufzen hob sie den Kopf von Utz’ Schulter, gab ihm einen letzten Kuss.
»Ich kann dich mitnehmen«, bot er an.
Anouk verdrehte die Augen. »Das hatten wir doch schon«, sagte sie. »Viel zu riskant.« Sie schob ihre langen braunen Haare über die Schulter und stand auf.
»Das merkt kein Mensch«, sagte Utz. »Und wenn doch, sagen wir, es war ein Meeting.«
Anouk schüttelte den Kopf. »Auf keinen Fall.«
Sie zog ihre Unterhose an, BH, T-Shirt, die bunten Socken, Jeans, Sneakers. Ging ins Bad.
Utz machte nackt neben dem Bett zwanzig Liegestützen, dann folgte er ihr. Anouk begann, ihre Haare zu bürsten. Er schmiegte sich von hinten an sie, schlang die Arme um ihren Oberkörper.
Mit der linken Hand schob sie ihn weg, aber sie lächelte. Sie war gleichermaßen fasziniert und erstaunt über die Gefühle, die sie in so kurzer Zeit für diesen älteren Mann entwickelt hatte. Nie hätte sie sich vorstellen können, mit jemandem über fünfzig ins Bett zu gehen. Und schon gar nicht mit einem Mann, der ganz andere politische Ansichten vertrat als sie.
Und nun genoss sie seine Aufmerksamkeit und bewunderte ihn dafür, wie diszipliniert er auf sich und seinen Körper achtete. Hatte diese Affäre eine Zukunft? Sie wusste es nicht, wusste nicht einmal, ob sie es sich wünschte. Vielleicht wäre kurz und heiß besser als lang und lauwarm.
Utz ging zurück ins Zimmer, zog sich ebenfalls an. Kam zurück ins Bad, um seine Krawatte zu binden. Im Alltag trug er Jeans und Langarmshirt, aber zu öffentlichen Terminen musste es dann doch ein Anzug sein.
Anouk rückte den Schlipsknoten zurecht, strich Utz eine widerspenstige Haarsträhne glatt.
Er sah auf seine Uhr. »Mein Fahrer ist da.«
Anouk küsste ihn.
»Das Zimmer ist bezahlt«, sagte er. »Bar.«
»Okay. Ich warte noch zehn Minuten.«
Er küsste sie. »Ich …«, begann er.
Anouk hob die Hand, fuhr zärtlich die Kontur seiner Lippen nach.
Sie sahen einander in die Augen.
Utz riss sich los, trat einen Schritt zurück. Anouk strich den Aufschlag seines Anzugs glatt.
Er verließ das Bad, Sekunden später hörte sie die Zimmertür ins Schloss fallen.
»Stelle einen Timer auf zehn Minuten«, wies sie ihr Handy an.
»Okay«, antwortete die künstliche Stimme. »Timer ist an.«
Anouk kehrte zurück in das Hotelzimmer, zog die Vorhänge auf und presste die Stirn gegen das Glas.
Was, wenn jemand von der Beziehung zwischen ihr und Utz erfuhr? Durch ihr privates Verhalten verriet sie alles, woran sie glaubte und wofür sie so leidenschaftlich kämpfte.
Meckenheim, 14:18 Uhr
Karla Beneventi zog den Kopf ein und ließ das Donnerwetter über sich ergehen.
»Ich sage Ihnen eines, Frau Beneventi, Sie sind nur eine Haaresbreite von der Einleitung eines Disziplinarverfahrens entfernt!«, schaukelte sich Löchner hoch, ihr Chef-Chef. »Haben wir uns verstanden? Keine Solokunststücke mehr und keine ›Auslegung‹ der Vorschriften, ist das klar?«
Sie starrte auf ihre Hände. Anders schaffte sie es nicht, den Mund zu halten.
»Ich habe gefragt, ob das klar ist?« Der Abteilungsleiter schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.
Beneventi zuckte zusammen. Löchner hatte die Führungsqualität eines französischen Königs aus dem siebzehnten Jahrhundert. Gehorsam oder Kopf ab. Aber so lief das heutzutage nicht mehr.
Ihr war klar, dass ihn das wurmte. Löchner würde den Rest seines Berufslebens auf diesem Posten verbringen. Er war zwar unkündbar, aber aufsteigen beim Zentralen Informations- und Fahndungsdienst des BKA würde er nicht mehr.
»Jaja, ist klar«, murmelte sie daher und stemmte sich hoch. »Wird nicht wieder vorkommen.«
Sie wusste: Hätte sie Erfolg gehabt mit ihrem Vorgehen, statt Kokain im Wert von fünf Millionen Euro aus den Augen zu verlieren, dann hätte ihr direkter Boss, Dr. Buse, sie für eine Beförderung vorgeschlagen. So würde die wohl nun an Marko Stüer gehen, und Buse hatte sie seinem Chef Löchner zum Fraß vorgeworfen. Blieb sie eben noch fünf Jahre Kriminaloberkommissarin.
Löchner trötete weiter vor sich hin, dass der Speichel über seine Schreibtischunterlage regnete.
»… allerdings!«, endete er und tippte mit dem Zeigefinger auf die Lederfläche.
»Okay«, nutzte sie die Pause und ging, als wäre völlig klar, dass Löchner am Ende seiner Standpauke angelangt war.
Sie holte ihre Jacke aus dem Büro. »Ich bummle ab«, sagte sie zu Danny Steverding, dem neuen Kollegen, mit dem sie seit ein paar Wochen das Büro teilte.
»Klaro«, murmelte Steverding, ohne vom Computer aufzusehen. Er füllte irgendeinen Bericht aus. Wie immer. Er liebte Berichte, Formulare, Memos. Der kleine Ordnungsfreak.
Beneventi verdrehte die Augen und ging.
Er zog sich auch an wie ein Streber, am ersten Tag hatte er ein Sakko mit Ellenbogenflicken getragen. Kurze Haare, akkurat gestylt. Sie war finster entschlossen gewesen, ihn nicht zu mögen, aber eigentlich war er ganz nett.
Draußen hätte sie am liebsten sofort einen Wodka gekippt, um den Stress abzubauen. Sie sah sich nach einem Stein um, den sie quer über die gepflegte Rasenfläche kicken könnte. Aber so was gab es hier im braven Meckenheim natürlich nicht.
Also fuhr sie nach Hause und setzte sich mit einer Dose Bier auf den Balkon in die Sonne. Wie normale Menschen, die auch nicht wussten, was das Leben bereithielt, und irgendwie klarkamen.
Schwarzes Moor (Hessen), 15:27 Uhr
Utz Mildenberger sah auf die Uhr. Der Helikopter aus Berlin hatte vier Minuten länger benötigt als berechnet. Nun blieben ihm nur noch drei Minuten bis zum Pressetermin.
Seine Familie – minus Friedrich, dieser kleine Idiot – und die Pressetante waren mit dem Fahrdienst aus Düsseldorf gekommen. Man musste es ja nicht übertreiben. Genauso würden sie nachher gemeinsam zurückfahren. Morgen früh hatte er Termine in der Zentrale.
Der Pilot gab über Funk einige Anweisungen. Zwei Minuten später landete er auf dem Parkplatz des Naturschutzgebiets Schwarzes Moor in der Bayerischen Rhön im Dreiländereck Hessen/Thüringen/Bayern.
Kaum ließ die Tür sich öffnen, sprang Mildenberger hinaus und lief im Rotorwind in Richtung des Gasthofs. Er war sich der Tatsache bewusst, dass so gute Nachrichtenbilder entstanden: der dynamische Vorstandsvorsitzende bei der Arbeit!
Er küsste seine Frau Eva, umarmte Sarina, Claas und Nesthäkchen Max. Gott sei Dank hatte Claas seine neue Freundin Marissa nicht mitgebracht. Hätte ein nettes Mädchen sein können, war aber viel zu idealistisch. Utz hätte sich am letzten Wochenende beim Frühstück beinahe mit ihr gestritten. »Wer mit zwanzig kein Sozialist ist, hat kein Herz«, hatte sein Doktorvater gern gesagt, »und wer es mit fünfzig noch ist, hat keinen Verstand.« Marissa hatte für seinen Geschmack zu viel Herz.
»Was macht denn deine Mutter hier?«, flüsterte Utz seiner Frau zu, als er Erika entdeckte. Die alte Dame las die Speisekarte des Lokals, die in einem Kasten vor dem Eingang hing.
»Sie wollte unbedingt mit. Ein Familienausflug, und wir würden sie zu Hause lassen – das ging nicht.«
Familienausflug. Nun gut.
Evas Mutter setzte sowieso immer ihren Willen durch, daran hatte Utz sich längst gewöhnt. An manchen Tagen dankte er Gott dafür, dass die Vorbesitzer ihrer Villa in Düsseldorf-Oberkassel die obligatorische Verbindungstür zwischen der Einliegerwohnung und dem Haupthaus einfach nicht vorgesehen hatten.
»Schön, dass Sie kommen konnten!«, begrüßte Mildenberger die Vertreter der Presse. Acht Journalistinnen und Journalisten standen vor ihm, zwei mit Videokameras, drei mit Radiomikrofonen. Fünf Frauen, drei Männer. Kein Logo überregionaler Sender.
Sehr gut, genauso hatten Jörn Opaterny und er es geplant. Als Grassroots-Kampagne, die den Nutzen des Abbaus für die Region in den Vordergrund stellte. Mildenberger wusste seinen Pressesprecher zu schätzen. Der Mann war ein erfahrener Profi und kurz vor der Rente alterszynisch. Dem war einfach alles egal außer seinem eigenen Haus und Garten. Das machte die Arbeit leichter.
»Meine Familie und ich lieben die Natur«, begann Mildenberger seine Rede. Langsam und medienwirksam ließ er den Blick über seine Kinder und seine Frau gleiten, die sich neben ihm aufgereiht hatten.
An den Schläfen wurde sein Haar langsam grau, aber das erhöhte die Souveränität seines Looks nur. Mildenberger war schlank und durchtrainiert – ein Läufer. Er trug das Haar kurz und praktisch geschnitten. Beim Lächeln zeigte er strahlend weiße Zähne, die er alljährlich aufhellen ließ. Ob Anzug oder Trainingskluft, er machte immer eine gute Figur und wusste das auch.
Seine Augen waren etwas schmal, die modische Brille half, sie auf Fotos größer wirken zu lassen.
Er war gut eins achtzig groß, und seine Stimme klang für einen Mann seiner Statur eher dünn. Früher hatte er nicht gern in der Öffentlichkeit gesprochen. In zahlreichen Kur-sen hatte er gelernt, wie er möglichst gut rüberkam. Stimme senken, langsam sprechen. Blickkontakt halten. Oberkörper locker, mit Gesten wichtige talking points betonen.
»Uns ist der Wert einer intakten Umwelt zutiefst bewusst«, fuhr er nun fort.
Wenigstens fiel es ihm leicht, sich Text einzuprägen. Schon in der Theatergruppe am Gymnasium hatte er trotz seines dünnen Stimmchens immer die Hauptrolle bekommen. Weil die Lehrerin dann sicher sein konnte, dass es klappte.
Überzeugungen waren wichtig. Man musste glauben, was man vertrat. Und er war sicher: Der wettbewerbsorientierte Kapitalismus war ein Segen, der Innovation und Wohlstand erst ermöglichte. Und was brauchte die Industrie? Strom!
Insofern war für Dr. Utz Mildenberger völlig klar, dass er mit diesem Projekt auf der richtigen Seite der Geschichte stand.
»Wie Sie sicher auch, lieben wir unser Land. Wir geben unser Bestes für die Zukunft Deutschlands. Dazu gehört auch das Engagement für die wirtschaftliche Sicherung des Industriestandorts und damit einhergehend für international konkurrenzfähige Energiepreise. Deshalb sind wir froh und stolz, dass unsere Inhouse-Wissenschaftler*innen« – lange hatte er mit dem Kommunikationschef der DSV die Pause beim Gendern geübt, bis sie modern und selbstverständlich klang – »Deutschlands größtes Kohlevorkommen entdeckt haben. Der Abbau des Flözes, der sich teilweise bis unter das Schwarze Moor erstreckt, wird selbstverständlich so schonend und naturerhaltend wie möglich erfolgen.«
Aus dem Augenwinkel sah Mildenberger, dass Max bereits gelangweilt zu zappeln begann. Seine ältere Schwester Sarina stieß ihn mahnend in die Seite.
Da Journalisten keine größere Aufmerksamkeitsspanne als Grundschüler hatten, kam er zum Ende.
»Die Finanzierung des größten deutschen Energieprojektes aller Zeiten ist gesichert. Die Pläne liegen der Bundesregierung vor, und wir sind überzeugt, dass die Volksvertreter Anfang kommender Woche das Richtige tun werden. Ich danke Ihnen.«
Er nickte mit einem zufriedenen, stolzen Lächeln.
»Was sagen Sie zu den Vorwürfen, der Abbau würde das Naturschutzgebiet unwiderruflich schädigen?«, rief ein Mann im Karohemd und streckte ihm ein Mikrofon entgegen.
Noch bevor Mildenberger reagieren konnte, fragte eine andere Journalistin dazwischen: »Umweltschutzorganisationen sagen, wenn die Kohle unter dem Schwarzen Moor verfeuert würde, entstünden dabei so viele Treibhausgase, dass die Klimaziele von Paris auf keinen Fall mehr erreichbar seien. Ist das richtig?«
Mildenberger zwang sich, weiter zu lächeln. Mit einer weiten Geste deutete er in Richtung seiner Frau und seiner Kinder. »Ich liebe meine Familie. Glauben Sie mir, ich würde nie etwas tun, was ihre Sicherheit und die Zukunft meiner – unserer – Kinder gefährdet.« Schnell schob er hinterher: »Alle weiteren Fragen richten Sie bitte an unsere Pressestelle. Wir werden Sie zügig mit entsprechenden Experten in Kontakt bringen. Expert*innen, meinte ich natürlich.« Er schnaufte kurz, lächelte noch breiter. »Vielen Dank noch einmal. Wenn Sie uns dann entschuldigen, ich werde nun mit meiner Familie einen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet unternehmen und anschließend zu Abend essen. Privat.«
»Werden Sie auch mit Dr. Sylvia Hubrich sprechen?«, fragte eine Journalistin.
Hubrich war die Autorin einer wissenschaftlichen Studie über Moore und hatte vor einer Woche in einem Zelt mitten im Schwarzen Moor einen Hungerstreik begonnen.
Mildenberger schüttelte den Kopf. »In dieser Hinsicht halte ich es mit Helmut Schmidt. Wir dürfen uns nicht erpressen lassen. Danke. Bitte richten Sie, wie gesagt, Ihre weiteren Fragen an die Pressestelle. Danke für Ihr Verständnis.«
Kaum hatten sie auf dem schmalen Holzweg, der durch das Moor führte, den Parkplatz und das Gasthaus hinter sich gelassen, stöhnte Erika: »Niemand hat mir gesagt, dass ich Wanderschuhe einpacken soll!«
Sarina fächelte sich Luft zu und schaute leidend, sagte aber kein Wort. Utz wusste schon seit längerem nicht mehr, wie er seiner Tochter begegnen sollte. Sie war dünn geworden, die Lippen schmal wie ein Strich. Trug nur noch Schwarz, das in Fetzen an ihr hing. Früher hatte er zu ihr ein gutes, enges Verhältnis gehabt. Doch momentan wurde er nicht schlau aus ihrem Benehmen.
Max rannte vorneweg, er hatte ein paar Vögel entdeckt und scheuchte sie immer wieder auf. Er war acht, und Eva hielt ihn für hochbegabt, Utz vermutete eher eine Aufmerksamkeitsstörung. Aber er würde sich hüten, das zu sagen.
Claas ging vollkommen desinteressiert den Weg entlang. Er hätte genauso gut auf der Kö oder in der Sahara unterwegs sein können. Er strahlte eine herablassende Gleichgültigkeit aus, die Mildenberger als Vater nervte. Zugleich wusste er jedoch, dass genau diese Haltung Claas später im Beruf weit bringen würde. Blonde Haare, kleiner Schnäuzer, zerknittertes Leinen, ab und zu die Andeutung eines Lächelns. Der Junge wäre perfekt auf jeder Position.
Eva nahm seine Hand. Ihr blondes Haar war wie immer zu einem steifen Helm gesprayt. Sie trug ein Kostüm, Ohrringe, eine Kette. Toll für den Termin, unpraktisch für den Spaziergang. Aber alles konnte man eben nicht haben. Seine Frau hatte ein exzellentes Gespür dafür, was von ihr erwartet wurde und wann sie sich besser im Hintergrund hielt. Er hätte sich niemand Besseren an seiner Seite wünschen können.
»Ich verstehe, dass du im Moment ganz besonders viel um die Ohren hast«, sagte Eva. »Gerade deshalb finde ich es schön, dass wir diese Zeit hier als Familie genießen können.«
Manchmal fragte er sich, wer der größere Bullshitkünstler war, Opaterny oder Eva.
Wortlos trotteten sie Max hinterher. Die Reporter waren tatsächlich zurückgeblieben. Das hätten die Hauptstadtschreiberlinge, denen Mildenberger normalerweise ausgesetzt war, nie getan. Die wären an ihnen drangeblieben wie die Schmeißfliegen und hätten auf ein falsches Wort gelauert, das sie aus dem Kontext reißen und zum Skandal aufblasen konnten. Die Landeier hatten wenigstens noch Respekt.
In einiger Entfernung sah er ein Zelt, davor eine grüne Fahne mit einem orangenen Kreuz. Das Logo der Klimahüter. Das Grün stand für Umwelt, Klima und Natur, Orange wurde als Warnfarbe eingesetzt. In dem Zelt hielt sich bestimmt die hungerstreikende Wissenschaftlerin auf. Eine Unverschämtheit, dachte Mildenberger. Von meinen Steuergeldern finanzieren wir solche Leute. Die Wissenschaft hatte sich seiner Ansicht nach neutral zu verhalten.
»Ich will ein Eis! Krieg ich ein Eis, Papa?« Max zerrte an Utz’ Ärmel.
»Sicher, mein Junge«, sagte der und wuschelte Max durchs Haar.
Zufrieden rannte der Junge wieder los.
Der kleine Rundweg war etwas über zwei Kilometer lang, nach einer knappen halben Stunde erreichten Sie ihren Ausgangspunkt, den Gasthof am Parkplatz.
»Ein Eis, ein Eis!«, jubelte Max und lief in den Biergarten.
Utz sah auf die Uhr. »Eine Dreiviertelstunde für das Abendessen haben wir noch.«
»Mir wird immer übel, wenn ich vor dem Autofahren esse«, murmelte Sarina, setzte sich aber.
»Du könntest dir ruhig etwas mehr Zeit für deine wundervolle Familie nehmen, Utz«, ätzte Erika, während sie sich einen Stuhl aussuchte. »Eine Dreiviertelstunde, wie gnädig.«
»Mama!«, sagte Eva. »Utz hat viel zu tun.«
Er rückte seiner Frau den Stuhl zurecht. »Bald wird es wieder besser, wenn die Entscheidung in Berlin gefallen ist und wir mit dem Abbau beginnen können«, sagte er.
Der Wirt kam und teilte die Karten aus. Er war in den Fünfzigern, deutlich aus dem Leim gegangen. Turnschuhe, Cargohose, Karohemd. Immerhin ordentlich rasiert. Die Haare etwas zu lang.
Eva sah auf, als sie ihre Karte entgegennahm – und zuckte zusammen. Scharf zog sie die Luft ein.
Utz sah sie überrascht an. »Ist etwas?«, fragte er.
»Ich … nein«, sagte sie.
Eva war blass geworden.
»Ich … ich bin gleich wieder da«, sagte sie, sprang auf und verschwand im Gastraum.
Einige Minuten später kehrte sie zurück, immer noch blass. »Weißt du, ich bin gar nicht so hungrig«, sagte sie. »Aber esst ruhig.«
Auf der Speisekarte klebten weiß-blaue Sticker mit der Aufschrift: »Tradition und Heimat schützen! Kein Kohletagbau im Schwarzen Moor!« Ob es die Farben der AfD oder der CSU waren, blieb offen.
Der Speisekarte beigelegt war die Kopie eines Interviews:
Schrot & Korn
Im aktuellen ›Mooratlas‹ fordern Heinrich-Böll-Stiftung, Michael Succow Stiftung sowie der BUND einen schnellen und umfassenden Strukturwandel. Wir sprachen mit Moorexpertin Dr. Sylvia Hubrich.
Warum sind trocken gelegte Moore ein Problem?
In vielen Regionen haben wir meterdicke Torfschichten. Werden diese entwässert, zersetzt sich der Torf und CO2 entweicht in die Atmosphäre – jahrzehnte- oder vielleicht sogar jahrhundertelang.
Wie hoch sind diese Emissionen?
Gut fünfzig Mio. Tonnen pro Jahr, das ist mehr als der gesamtdeutsche Flugverkehr verursacht. Ohne einen umfassenden Schutz der Moore erreichen wir die Klimaschutzziele keinesfalls.
Was muss geschehen?
Die trocken gelegten Flächen, auf denen meist Landwirtschaft betrieben wird, sollten wieder vernässt werden. Die Landwirte müssen dafür finanziell entschädigt werden. Wir fordern insofern nicht weniger als einen umfassenden Kultur- und Strukturwandel. Für die große Moortransformation brauchen wir dringend die richtigen politischen Bedingungen und Anreize.
Max bekam sein Eis, Claas wählte das Schnitzel, Erika nahm Grüne Soße, Utz einen Salat mit Putenbruststreifen. Sarina trank nur ein Glas Wasser, Eva nicht einmal das.
Als der Wirt die Gerichte servierte, packte sie auf einmal die Hand ihres Mannes und schob ihre Finger zwischen seine.
»Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?«, fragte Utz noch einmal.
Mit dem Rücken der freien Hand wischte sich Eva über die Wangen, dann sagte sie entschlossen: »Ja. Alles in Ordnung. Ich fühle mich nur etwas eigenartig. Das kann ja mal vorkommen. Mach dir keine Sorgen.«
London, 19:09 Uhr
Maurizio bellte und zog an der Leine. Sie erreichten das Tor des Battersea Park am Ufer der Themse.
»Nein, mein Junge, ich kann dich nicht von der Leine lassen«, sagte Jensen mit sanfter Stimme. In vielen Wochen war sein Hund der Einzige, mit dem Jensen sprach. Sein Beruf erforderte nicht gerade viel menschlichen Kontakt. Die meisten Aufträge wurden über anonyme Chatprogramme erteilt, in Sekundenschnelle bezahlt, und mit den Zielpersonen suchte Jensen das Gespräch nur dann, wenn dies unerlässlich zur Ausführung des Auftrags war. Supermarktkassierer, Fahrkartenkontrolleurinnen, Flugbegleiter oder die Mitarbeiterinnen von Autovermietungen waren im Grunde die Einzigen, mit denen er je ein Wort wechselte. Und auch das vermied er, wenn möglich, denn es verringerte sein Risiko maßgeblich, wenn sich niemand an den unscheinbaren schlanken Mann mit dem feinen hellblonden Haar und den leuchtend blauen Augen erinnerte.
Jensen war gründlich, ordentlich, fast schon pedantisch. Er liebte moderne Technik, die es ihm ermöglichte, Transaktionen noch unauffälliger und sicherer abzuwickeln. Er war in Berlin aufgewachsen. Wegen schlechter Noten hatten die Eltern ihn auf ein Internat geschickt. Dort hatte der Sportlehrer ihn als blass und kraftlos verspottet. Wenig später war der Mann spurlos verschwunden, und Jensen hatte seine Berufung gefunden. Wenn es sein musste, konnte er eiskalt und brutal sein.
Nun zog er eine kleine Tüte mit Leckerlis aus der Tasche. Maurizio kam sofort zu ihm gelaufen. Jensen fütterte den Hund, der ihm zufrieden seine feuchte Schnauze in die Handfläche bohrte. Dann gingen sie weiter.
Sein Handy vibrierte, eine der Apps forderte ihn auf, ein Captcha zu lösen, um unter Beweis zu stellen, dass er am Leben war.
Wo er es schon in der Hand hatte, überflog er die News.
Die BBC meldete: »Am späten Vormittag fiel der belgische Premierminister einem Terroranschlag zum Opfer. Nach vorläufigen Informationen wurde an Bord des Regierungsflugzeugs kurz nach dem Start vom Brüsseler Flughafen eine Bombe gezündet. Mit dem Premier kamen vier seiner engsten Mitarbeiter sowie die gesamte Besatzung ums Leben. Der oder die bislang unbekannten Täter befinden sich auf der Flucht. Eine EU-weite Fahndung wurde ausgeschrieben. Der belgische Premierminister stand zuletzt wegen seiner politischen Positionen immer wieder in der Kritik. Spitzenpolitiker aller Parteien haben ihr Beileid ausgesprochen. Der Absturz des Flugzeugs erfolgte kurz vor der Autobahn N1 auf mehrere Bahngleise. Mindestens drei Züge wurden massiv beschädigt und zahlreiche Passagiere kamen zu Tode, weitere schwer verletzt. Nach Polizeiangaben ist derzeit mit mindestens achtunddreißig Todesfällen zu rechnen.«
Kollateralschäden.
London war eine gute Basis für Jensen, da die Ermittlungsbehörden nicht mehr umfassend mit der EU vernetzt waren. Mittlerweile verbrachte er den größten Teil des Jahres hier und die Wintermonate in Asien, wo er ebenfalls gut gebucht war.
Was ihm wichtig war, passte in einen Rollkoffer. Sein Apartment in London war das heimliche Liebesnest einer ehemaligen Zielperson gewesen. Niemand wusste davon, niemand fragte danach. Jensen hatte die Einrichtung unverändert gelassen.
Maurizio und er gingen durch den Rosengarten um den Boating Lake herum und wieder zurück zum Ausgang des Parks.
Berlin, 20:07 Uhr
»Ich stehe auf der Liste«, sagte Anouk und nannte ihren Namen.
Der Security-Aufseher nickte und öffnete ihr die Tür.
Der Club war etwa zur Hälfte gefüllt. Nicht schlecht für den ersten Auftritt einer neuen Comedienne. Anouk hatte die Instagram-Posts ihrer Freundin und Mitbewohnerin Leisha geteilt. Das hatte offenbar etwas gebracht.
»Hey!« Die beiden jungen Frauen umarmten sich.
»Nervös?«, fragte Anouk.
Leisha klopfte sich dreimal gegen den Kopf und grinste. Dann wurde sie ernst. »Heute sind es sechs Monate«, sagte sie.
Anouk runzelte für einen Moment die Stirn. Dann verstand sie, worauf Leisha sich bezog. Timm, Anouks Bruder und Leishas bester Freund, war heute vor sechs Monaten an Krebs gestorben.
Wochenlang hatte Leisha mit niemandem geredet, kaum das Bett verlassen. Dann hatte sie sich in die Arbeit gestürzt. »Timm hat immer gesagt: Du kannst das. Du bist witzig. Du hast was zu sagen«, hatte sie Anouk berichtet. »In der Schule hat er mir mit den Hausaufgaben geholfen. Und wenn jemand mir dumm kam, war Timm da. Er wusste, dass ich lesbisch bin, noch bevor ich es mir selbst eingestanden habe. Er hat immer an mich geglaubt. Ich darf ihn jetzt nicht hängen lassen. Diese Show ist verdammt noch mal für ihn!«
Leishas Eltern stammten aus dem Libanon, sie war bereits in Deutschland geboren worden. Mit sechzehn ging sie in die Hauptstadt, jobbte, schlug sich durch. Anouks Bruder Timm hatte ihr geholfen, Stabilität zu finden. Und sich selbst besser kennenzulernen: queer, modelschön mit seidig-schwarzem Haar, tiefbraunen Augen, dunklem Teint und vollen roten Lippen, schlagfertig, witzig, politisch. Als Freundin zutiefst loyal, als Weltbürgerin zerrissen zwischen zwei Heimaten.
Nach Timms Tod hatte sie sich in ihrem Zimmer verschanzt und war nur dann und wann zu Anouk in die WG-Küche gekommen, um einen Witz zu testen. Manche waren schlecht, andere besser. Das komplette Programm kannte Anouk immer noch nicht.
Für Timms ehemaliges Zimmer hatten sie bislang keinen Nachmieter.
Anouk bestellte einen Moscow Mule, hob ihr Glas. »Auf Timm.«
»Ich muss«, sagte Leisha.
»Das wird super«, sagte Anouk. Sie stellte ihre Sneakers auf einen Barhocker und zog die Jeans ein Stück hoch. »Ich habe extra meine LOL-Socken für dich angezogen!« Auf ihren Strümpfen waren das Tränenlach-Emoji und der Schriftzug »LOL« eingestrickt.
»Danke.« Leisha umarmte Anouk noch einmal, dann verschwand sie durch eine kleine Tür neben der Bühne.
Anouk Grunwaldt war das deutsche Gesicht der aktuell wohl einflussreichsten Umweltaktivisten-Bewegung. Sie selbst hätte auf diesen Status gut verzichten können. Mit einsfünfundsechzig, leicht gewelltem, schulterlangem Haar, mausbraun, und der eher blassen Haut der Norddeutschen, war sie ihr Leben lang kaum jemandem aufgefallen – bis sie zu den Klimahütern stieß. Weil sie ständig im Fernsehen saß und einfach auch so verdammt viel zu tun war, vergaß sie manchmal, zu essen, aber manchmal versuchte sie auch, ein paar Kilos loszuwerden. Zugleich verachtete sie sich für diese peinliche Oberflächlichkeit.
Wichtig war letztlich nur eines: Gerade weil sie im Leben schon Schlimmes erlebt hatte, war Anouk überzeugt, dass auch Gutes möglich war. Daher war sie voller Wut und Hoffnung.
Nun suchte sie sich einen Platz im vorderen Drittel des Saals. Kurz hatte sie überlegt, den Besuch ausfallen zu lassen. Aktuell wurde ihr alles ein bisschen zu viel, das Studium, die Protestaktionen, die Sache mit Utz. Davon hatte sie noch nicht einmal Leisha erzählt. Bislang hatte die auch nichts bemerkt, aber das lag bestimmt auch an dem bevorstehenden Auftritt.
Nach einer TV-Diskussion in Mainz hatten der CEO und sie einfach an der Hotelbar weitergeredet … und waren dann auf sein Zimmer gegangen.
Natürlich wusste Anouk, dass man zwischen den Personen und ihren Handlungen unterscheiden sollte. Trotzdem verwirrte es sie, dass sie sich Hals über Kopf in den Vertreter all dessen verknallt hatte, wogegen sie auf die Straße ging: Industrialisierung, Raubtierkapitalismus, fossile Energien.
Das Saallicht erlosch, das Bühnenlicht ging an. Beifall brandete auf, Leisha betrat die Bühne.
»Hey, Partypeople, was geht ab bei euch?«, rief sie. »Hallöchen Popöchen, oder wie die FDP-Wähler_innen unter uns sagen: Guten Tacho!«
Von da an ging es mal bergauf, mal bergab. Anouks Vater sagte in solchen Situationen gern, es sei »noch Luft nach oben«. Seit Timms Tod sagte ihr Vater allerdings nur noch wenig.
Auch aktuelle Bezüge kamen vor. »Die Bertelsmann-Stiftung hat in einer Studie ermittelt, dass junge Leute vor lauter Zukunftsangst keine Nachrichten mehr schauen. Stimmt das wirklich? Ich habe das neulich meinen Neffen gefragt, der ist sechzehn und kommt aus Neukölln.« Anouk wusste, dass Leisha weder Neffen noch Nichten hatte, aber: künstlerische Freiheit. »Ich frage ihn also: ›Hey, schaust du eigentlich Nachrichten, um auf dem Laufenden zu bleiben?‹ Und er guckt mich an, als hätte ich ihn gefragt, ob er noch Kassetten hört. Er meinte: ›Ich habe schon genug Angst vor meiner Mathe-Klausur nächste Woche, warum sollte ich mir auch noch Sorgen über den Weltuntergang machen? Wenn 2030 die Welt untergeht, fällt wenigstens die Mietpreiserhöhung in Berlin weg, oder?‹ Und ich denke mir: ›Junge, das ist genau die Art von Optimismus, die wir brauchen!‹ Also: Ja, die Jugend von heute – Umweltbewusstsein Level hundert, aber Nachrichten? Nur, wenn sie auf TikTok getanzt werden!«
Das Publikum erkannte sich wieder und jubelte.
Dann wurde Leisha ernst. »Ich widme diese Show meinem besten Freund Timm. Er konnte heute leider nicht kommen.« Ihr Blick huschte zur Decke, was außer Anouk vermutlich niemand bemerkte.
Der schossen die Tränen in die Augen. Scheiße! Ihr Bruder war promovierter Biologe gewesen. Timm hatte sogar eine seltene Vogelart entdeckt, die nach ihm benannt worden war. Der lateinische Name der Grünen Bartmeise lautete: Panurus biarmicus grunwaldis. Im Krankenhaus hatte er Anouk gebeten, alles dafür zu tun, dass die Art nicht ausstarb.
Und die blöden Biester lebten natürlich ausgerechnet im Schwarzen Moor in Hessen. Noch ein Grund, warum all ihre Gefühle für Mildenberger falsch waren.
Wenn er jetzt wirklich von oben zusah, was Anouk nicht glaubte, dann wäre er sicher riesig stolz auf Leisha, weil die ihren Traum lebte. Und er würde seine kleine Schwester zutiefst verachten, weil die ihren – seinen – Traum verriet.
»Ist es unsere Fähigkeit zu lieben, die uns menschlich macht?«, fragte Leisha auf der Bühne. »Nein.« Sie machte eine dramatische Pause. »Es ist unsere Fähigkeit, alle Bilder anzuklicken, auf denen ein Bus zu sehen ist!«
Die Besucher lachten, aber Anouk konnte sich nicht mehr richtig auf die Show konzentrieren. Die ganze Zeit dachte sie an Timm und dass sie irgendwie das DSV-Projekt im Schwarzen Moor aufhalten musste. Daran arbeiteten sie zwar schon seit Monaten. Aber politisch stand die Sache noch immer auf der Kippe.
»Bauern pflügen über die Autobahn und kriegen nicht nur, was sie wollen. Die Menschen haben auch noch Verständnis und Mitleid für sie. Sind die besser organisiert als wir, machen die bessere Medienarbeit? Oder ist unsere Gesellschaft wirklich schon so hinüber, dass es mehr Verständnis für Egoismus gibt als für ein freiwilliges Zurückstecken zugunsten der Gemeinschaft?
Es ist doch verrückt: Leute, die sich für eine bessere Gesellschaft einsetzen, landen im Knast, während die Männer, die unsere Welt verbrennen, dafür Millionen kassieren. Da draußen laufen Typen rum, die unsere Erde schneller erhitzen als meine letzte Beziehung, und was passiert? Die bekommen eine Gehaltserhöhung. Aber wehe, du klebst dich aus Protest auf eine Straße – dann zeigt dir der Staat, was echte Haftwärme ist.«
Gelächter, Beifall. Anouk wusste das alles schon, ihr kamen Leishas Bemühungen oberflächlich vor. Dabei hatte ihre Freundin natürlich recht. Es musste endlich gelingen, die große, große Mehrheit zu erreichen. Die Menschen mussten begreifen, dass die Sache gar nicht so kompliziert war, wie Industrie und Politik taten. Sondern dass ganz einfach alles, absolut alles getan werden musste, um den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken, und zwar so schnell wie nur irgend möglich.
So einfach war das. Und so verdammt schwierig.
»Okay, Leute, es war toll, hier zu sein!«, rief Leisha zum Abschied. »Und wenn wir jetzt alle nach Hause radeln, denkt daran: Es fühlt sich vielleicht manchmal an, als würden wir gegen Windmühlen kämpfen. Aber die sind eine ziemlich nachhaltige Energiequelle. Lasst uns also aufhören, Windmühlen zu bekämpfen, und anfangen, sie zu bauen!
Macht’s gut, passt auf euch auf. Gute Nacht, Berlin!«
Das Spotlicht erlosch, alle klatschten. Anouk ging, solange es noch dunkel war. Zu Hause in der WG legte sie einen Zettel auf den Esstisch: Es war toll und superlustig! Bin wahnsinnig müde. Bis morgen, ♡ Anni.
5. Mai
Düsseldorf, 6:12 Uhr
Eva von Schmuck lag wach. Sie wusste, dass Utz’ Wecker um 6:30 Uhr klingeln würde. Seit einer gefühlten Ewigkeit starrte sie den immer heller werdenden Umriss des Schlafzimmerfensters an. Es regnete.
Utz war jede Woche zwei, drei Tage unterwegs. Und die Arbeitstage in der Zentrale waren auch lang.
Sie wusste, dass er seinen Schlaf brauchte.
Aber …
Sie holte Luft und nahm all ihren Mut zusammen.
Eva robbte näher heran an ihren Mann, schmiegte sich an seine Schulter. Sie schob ihre Hand unter sein Pyjama-Oberteil, streichelte seine Brust.
Obwohl Utz so viel arbeitete, ließ er sich nicht gehen. Er achtete auf sein Aussehen, seine Gesundheit, seinen Körper. Das liebte sie an ihm.
Sie küsste seine Wange, sein Ohr, seine Stirn. Umkreiste mit den Fingernägeln seine Brustwarze. Suchte mit ihrem Mund nach seinen Lippen.
»Hm«, machte er. Dann: »Hmm.« Langsam erwachte er.
Früher hatten sie oft morgens Sex gehabt. Bevor sie Kinder hatten. Vor der vielen Arbeit. Jetzt wusste sie nicht einmal mehr, wie lange das letzte Mal her war.
Viel zu lange. Der Alltag, ganz normal. So ging es allen Paaren.
Sie küsste ihn, und diesmal erwiderte er ihren Kuss.
Er löste sich von ihr, schaute kurz auf den Wecker auf seinem Nachttisch. Drehte sich dann auf die andere Seite, ihr zugewandt. Sie küssten sich noch einmal. Evas Hand verschwand unter dem Gummibund seiner Pyjamahose. Fuhr über seinen Po, seinen Oberschenkel, umfasste seinen …
Sie erstarrte für einen Moment. Es war, als würde sie unter Wasser gedrückt. Sie bekam keine Luft mehr, musste ersticken.
Eva zwang sich zurück in die Gegenwart. Sie schloss ihre Finger um Utz’ Penis. Ihr Mann hatte nichts gemerkt. Sie küsste seinen Hals, er legte den Kopf in den Nacken und genoss es.
Sie bewegte ihre Hand auf und ab.
Sein Atem ging schneller.
Er griff nach ihr, schob ihr Nachthemd hoch, presste sich an sie, schob ihre Beine auseinander, wollte gerade …
Eva begann zu weinen. Tränen quollen ihr aus den Augen, liefen ihr über die Wangen, von einem Moment zum anderen schluchzte sie haltlos.
Utz ließ sich neben sie sinken. Sanft streichelte er ihr Haar. »Was ist denn?«, fragte er mit rauer Stimme. »Habe ich dir wehgetan?«
»Nein, du nicht.« Eva wischte die verdammten Tränen mit dem Handrücken weg. »Hast du nicht. Ich habe … ich wollte …« Doch sie konnte nicht sprechen, so riesig war die Trauer, die sie auf einmal erfüllte, die Wut, der Hass, die Verachtung, der Schmerz.
Im Alltag war sie stolz darauf, der ruhende Pol der Familie zu sein, emotional ausgeglichen. Und jetzt das.
»Was ist es dann?«, fragte Utz.
Doch Eva konnte es ihm nicht sagen. Sie weinte nur, sie weinte und weinte.
Utz’ Wecker klingelte. Er löste sich von ihr, um ihn auszuschalten.
»Geh nur«, schniefte Eva. »Es ist okay.«
Er zögerte einen Moment, dann wandte er sich ihr zu. »Ich kann mich krankmelden.«
»Nein. Du musst los. Geh. Ich bin nur …« Ein weiterer Weinkrampf machte es ihr unmöglich, zu sprechen.
»Ich sage Zoey, dass ich später komme«, sagte Utz und nahm sein Handy vom Nachttisch. »Ein familiärer Notfall.« Er begann zu tippen.
Eva richtete sich auf. »Nein«, sagte sie. »Das muss nicht sein. Ich … Es …« Sie riss sich zusammen, schniefte noch einmal, wischte sich mit dem Handrücken über die Wangen.
Er legte das Handy auf den Nachttisch, sah sie an.
»Ich habe furchtbar schlecht geschlafen«, sagte sie. »Wir sind gestern … Du hast mich doch auf der Rückfahrt gefragt, was los ist. Und ich habe gesagt, nichts. Das war gelogen. Der Mann … der Wirt gestern. Im Schwarzen Moor. Der Restaurantbesitzer. Das war ein … ein Kommilitone von mir. Er hat … er hat mich … er hat damals …«
Wieder begann sie zu weinen.
»Deshalb konnte ich eben nicht … Deshalb wollte ich … Ich habe die halbe Nacht an ihn gedacht. Und ich wollte diesen Gedanken loswerden, verstehst du? Ich wollte ihn weghaben. Aber dann … als du dann … Ich habe ewig nicht daran gedacht, hatte es verdrängt, bis gestern…«
Utz zog sie an sich, hielt sie fest. »Ist ja gut«, sagte er. »Ist ja gut.«
Sie lehnte ihren Kopf an seine Brust, ließ die Tränen laufen.
»Ist ja gut, wir kriegen das wieder hin«, sagte er leise, und die Vibration seiner Stimme in seiner Brust beruhigte sie tatsächlich ein wenig.
Berlin, 8:30 Uhr
Für das heutige Treffen nutzten sie einen Seminarraum an der Uni. An anderen Tagen fanden die Begegnungen in WG-Küchen statt, in Klassenzimmern, ungenutzten Büros, Veranstaltungszentren.
Der harte Kern der Klimahüter waren die fünf Vorstandsmitglieder. Anouk, Fynn, Jannik, Ole, Leisha. Sie koordinierten die Aktionen in Berlin, stimmten sich mit anderen Ortsgruppen ab und unterstützten natürlich auch andere Klimaschutzgruppen. Einmal im Monat gab es größere Treffen, doch wenn Entscheidungen anstanden, blieben sie meist unter sich. Sonst kam nie etwas dabei heraus.
Anouk hatte extra ihre knallgrünen Baumretter-Socken aus Bambusfaser angezogen. Sie war nervös. In genau einer Woche musste die Bundesregierung Farbe bekennen, ob sie weiterhin einen kleinen Beitrag zur Rettung des Weltklimas leisten oder doch lieber die Kohle unter dem Schwarzen Moor abbauen wollte. Seit Wochen stritten sie darüber, wie sie das verhindern konnten.
Fynn »Fofi« Zavelberg war ein nerviger Unruhestifter. Wenn es nach Anouk ginge, hätten sie ihn längst rausgeworfen. Aber das war in einer basisdemokratischen Bewegung natürlich nicht möglich. Egal bei welcher Temperatur, er trug immer Jeans, Sweatshirt, Doc Martens und eine Wollmütze. Mit deutlich über dreißig war er der älteste von ihnen und hatte zu allem etwas zu sagen.
Sein Spitzname »Fofi« war die Abkürzung für »Four Finger Fynn«, weil er seit einem Sägeunfall an der linken Hand nur noch vier Finger hatte. Der Daumen fehlte.
Jannik Lamm war der offizielle Sprecher der Gruppe. Er war durchtrainiert und eloquent, sympathisch, vernünftig. Dreitagebart, weißes T-Shirt, grüne Augen. Sogar seine Handschrift war top.
Ole Falenski war der Friedfertigste von ihnen, suchte immer nach der gewaltfreien Lösung. Nur mit Fynn kam er nicht klar. Zavelberg und er gingen sich fast bei jedem Treffen an die Gurgel. Ole trug einen Man-Bun und jobbte bei einer internationalen Coffeeshopkette. Er trug immer komplett Schwarz, gern Merch von irgendwelchen Metalbands, und war mindestens zehn Kilo übergewichtig.
Leisha hatte die Stimmung früher meist aufgelockert. Seit ein paar Monaten wurde sie jedoch immer unbeweglicher und aggressiver.
Anouk zog ihre Wasserflasche aus dem Rucksack und stellte sie auf den Tisch. Sie saß kaum, da legte Fynn auch schon los: »Schön, dass du es auch noch einrichten konntest, Anouk.« Er sah vorwurfsvoll auf die Uhr. »Musstest du dich nach einem Auftritt im Frühstücksfernsehen noch abschminken? Aber ist ja nicht so schlimm, der Weltuntergang kann sicher auf dich warten.«
Anouk schüttelte den Kopf. »Lass es einfach, du Hohltaube«, sagte sie nur. Sie bedachte andere gern mit beleidigenden Vogelnamen.
Ihr Vater war Biologielehrer und schon seit einer Ewigkeit beim BUND aktiv. Die Mutter liebte ihren Garten. Als die Kinder klein waren, wurde im Urlaub viel gewandert. Zu Anouks ersten Schätzen gehörte ein Buch, in dem sie die verschiedenen »Vögel unserer Heimat« abhaken konnte, wenn sie sie sah.
Fofi redete einfach weiter: »Der Polizeistaat wird sich auch diesmal auf die Seite der Kapitalisten schlagen und der Industrie die Natur zum Fraß vorwerfen. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen eine Aktion planen. Je spektakulärer, desto besser! Die Demo am Freitag reicht einfach nicht.«
Im Hauptberuf war Zavelberg Berufsschullehrer. Und das merkte man. Von oben herab predigen konnte er gut. Zudem beneidete er Anouk so offenkundig um das Rampenlicht, dass es wehtat.
»Hast du mitbekommen, oder?«, flüsterte Jannik Anouk zu. Er hielt ihr sein Smartphone hin. Auf einem Foto schüttelte der bayerische Ministerpräsident dem Vorstandsvorsitzenden des größten deutschen Stromerzeugers die Hand. Zuverlässige Partner lautete die Bildunterschrift.
Anouk überflog den Text. Utz hatte gestern einer Regionalzeitung ein Interview gegeben, in dem er die Wichtigkeit des Abbaus fossiler Energien für die verlässliche Stromversorgung Deutschlands betonte. Der Reporter hatte dazu noch einen O-Ton des Ministerpräsidenten eingeholt, der sagte: »Ohne der Bundesregierung vorgreifen zu wollen: Wie diese Entscheidung ausfallen muss, ist klar. Scheitern ist keine Option!« Das Foto war ein Archivbild.
Wütend presste sie die Lippen aufeinander.
»Es gibt eine neue Umfrage vom ›Tagesspiegel‹, auf was die Menschen verzichten würden, um die Klimakatastrophe zu verhindern«, erklärte nun Leisha. Sie hob ihr Tablet und zeigte auf den Bildschirm. »Und das Ergebnis ist fast schon witzig: auf nichts nämlich.«
»Vielleicht lag es an der Fragestellung?«, wandte Ole ein. Typisch. Immer das Beste von allen denken. »Oder die Befragten waren nicht repräsentativ?«
Fynn schüttelte den Kopf. »Ich fass es nicht! Du bist so ein Schlafschaf!«, pöbelte er. »Nein, wir müssen endlich echten Widerstand leisten! So kann es doch nicht weitergehen. Irgendwer muss doch was tun!«
Ole widersprach. »Mich überzeugt dein Ansatz nicht, strukturelle Gewalt mit strategischer Gewalt zu bekämpfen. Es wäre besser, die Menschen im Umland zu mobilisieren und auf deren natürliches Engagement zu setzen.«
»Du spinnst doch!«, schnauzte Fynn und schnaufte zornig. »Wie kannst du …«
Jannik ging mit Nachdruck dazwischen. »Fofi!«, rief er. »Wir haben darüber gesprochen. Auch mit der Supervisorin! Worte können genauso eine Ausübung von Gewalt sein wie Schläge! Wir müssen solidarisch miteinander umgehen und dürfen einander nicht in den Rücken fallen. Außerdem ist der kritische Diskurs ausdrücklich erwünscht. Sonst wären wir nicht anders als die, die wir aufzuhalten versuchen!«
Zavelberg schnaubte verärgert und ballte die rechte Hand zur Faust, machte aber den Mund zu. Nach einer kurzen Pause hatte er sich wieder unter Kontrolle. »Entschuldige, Ole«, sagte er und zog dabei seine Wollmütze tiefer in die Stirn. »Ich bin nicht deiner Meinung, aber das ist kein Grund, dich persönlich anzugreifen.«
Es klang nachgeplappert und wenig überzeugend, aber besser als nichts.
In jeder Gruppe gab es einen wie Zavelberg, der immer Vollgas geben wollte. Es gab einen wie Jannik, die Stimme der Vernunft. Es gab eine Leisha, die so lange diskutieren wollte, bis alle sich liebhatten. Es gab einen Ole, der glaubte, ohne Regeln liefe alles von alleine und viel besser.
Und dann war da Anouk, die sich einfach nur für eine gute Sache hatte engagieren wollen und plötzlich zum deutschlandweiten Gesicht der Umweltschutzbewegung aufgestiegen war und ständig in Talk-Shows eingeladen wurde. Hätte sie diese riesige Chance, Menschen zu überzeugen, das Richtige zu tun, einfach ablehnen sollen?
Aber würden die Menschen ihr auch noch glauben, wenn sie wüssten, dass sie eine Affäre mit dem verheirateten Vorstandsvorsitzenden des größten Stromkonzerns des Landes und damit ihrem direkten politischen Gegner hatte?
Würden ihre Mitstreiter – Fofi, Leisha, Jannik, Ole –diesen Verrat jemals verzeihen?
Die DSV hatte unter dem Naturschutzgebiet Schwarzes Moor das größte deutsche Braunkohlevorkommen aller Zeiten entdeckt. Würde der Abbau genehmigt, wäre das natürlich ein gefundenes Fressen für die gesamte deutsche Industrie: billiger Strom bei höchster Versorgungssicherheit.
»Der Ausstieg aus der Kohle soll von 2030 auf 2045 verschoben werden«, sagte Ole.
»Und wenn es erst mal losgeht, dann läuft es wie beim Öl«, beschwerte sich Fynn. »Die Saudis verkaufen auch, so viel es geht, solange es noch Verbrenner gibt. Und wenn unsere industriehörige Regierung sich durchsetzt, wird auch bei uns noch fünfzehn Jahre länger so viel Kohle wie möglich verstromt, solange sich damit noch Geld verdienen lässt.«
»Die haben sogar schon erklärt, wenn die Kohle nicht in Deutschland verfeuert werden darf, könnte man sie auch nach China oder Afrika exportieren«, bestätigte Jannik.
Anouk schüttelte frustriert den Kopf. »Ich weiß das alles selbst. Wenn der Abbau genehmigt ist, sind die globalen Klimaziele erledigt. Sogar zwei Grad sind dann eine Illusion, vermutlich sogar drei. Ich weiß das, ich verstehe es. Die Medien berichten dauernd darüber. Aber die Menschen werden nicht aktiv. Die Politik nimmt das Problem nicht ernst.«
»Oder die Schmiergelder der Industrie sind einfach zu hoch«, warf Fynn ein.
»Ja, vielleicht auch das«, stimmte Anouk zu. »Aber wir haben die Demo in Berlin, die Petition, den Infofilm über das Schwarze Moor. Läuft alles. Ich weiß nicht, was wir noch tun könnten, um diese Katastrophe aufzuhalten.«
Nach vierzig Minuten brachen sie ab, wieder einmal ohne Ergebnis. Anouk ging auf die Toilette, zog ihren Vape-Pen aus der Tasche und nahm einen tiefen Zug. Langsam beruhigte sie sich wieder.
Es würde alles gut gehen.
Utz und sie würden eine Möglichkeit finden.
Die Welt würde nicht untergehen. Sie musste ihren Optimismus wahren.
»Schön, dass ihr da wart, und gebt die Hoffnung nicht auf – denn wer am Ende ist, kann wenigstens noch mal von vorn anfangen«, hatte Leisha gestern ihre Show beendet.
Schön wär’s. Anouk schaltete den Pen aus und schob ihn wieder tief in ihre Tasche.
Berlin, 9:57 Uhr
Jannik Lamm wählte sich in den Call ein. Das Meeting ist für 10:00 Uhr geplant. Das Gastgeber wird das Meeting in wenigen Minuten eröffnen.
Er stand auf, tigerte eine Runde im Kreis, setzte sich wieder vor den Laptop, fuhr sich durch die Haare. Jannik war nervös. Er konnte die Angst spüren. Die Angst um die Welt. Seine Therapeutin sagte, er solle dann tief atmen und sich kneifen. Auf diese Weise würde er wieder in den Moment zurückkehren.
Aber die hatte doch keine Ahnung! Er war ja in der Wirklichkeit. Er hatte Angst, weil die Lage so war, wie sie war.
In der Außenwelt gelang es ihm meist, die Fassade zu wahren. Anouk sagte ihm oft, wie sehr sie ihn für seine Ruhe und Gelassenheit bewunderte. Aber die kannte ihn eben nicht wirklich.
Wenn niemand etwas unternahm, etwas Großes, dann würde die Welt untergehen. Einfach so. Millionen Menschen würden verdursten, verhungern, ertrinken, erfrieren, den Hitzetod sterben. Kriege würden ausbrechen. Tiere würden aussterben, Pflanzen ebenfalls. Für Tausende von Jahren würde die bevorstehende Warmzeit den Planeten quälen.
Vielleicht, vielleicht gäbe es danach die Chance auf einen Neuanfang. Möglicherweise überlebten einige Menschen, oder es entwickelte sich erneut eine intelligente Art. Wenn sie dann Informationen über das frühere Fehlverhalten der Menschen fänden, konnten sie es besser machen …
Aber Jannik wollte nicht sterben!
Er wusste, dass dieser Zustand »Climate Anxiety« genannt wurde, »Klimapanik«. Er wusste, dass er Hilfe brauchte.
Endlich begann das Meeting. Erleichtert stieß er den Atem aus. Erst jetzt spürte er die Anspannung in seinem Körper. Vorher hatte er sie erfolgreich verdrängt.
Fast jeden Tag nahm er Teil an einem der zahlreichen internationalen Collapse Acceptance Calls. Dort trafen sich Menschen aus aller Welt, denen es ähnlich ging wie ihm. Sie hatten begriffen, wie schlimm die Lage war – und wussten nicht, wohin mit ihrer Wut, ihrem Zorn, ihrer Verzweiflung.
Jannik war aus Überzeugung Polizist geworden. Er wusste, dass es bei der Polizei Problemfälle gab. Neonazis. Schlägertypen. Gerade deshalb hatte er sich beworben. Um die Truppe besser zu machen.





























