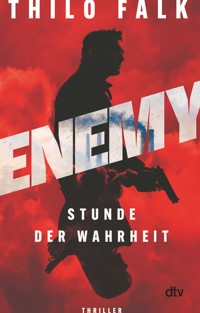9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Winter, der nie endet Für alle Leser*innen faktensatter und temporeicher Klimathriller. Perfekt für Fans von Wolf Harlander und Uwe Laub! Mitteleuropa wird von einer neuen Eiszeit heimgesucht. Die erbarmungslose Kälte bedroht das Leben aller – die Versorgung der Bevölkerung ist durch eine zerstörte Infrastruktur nicht mehr gewährleistet, Energiepreise sind unbezahlbar. Die Forschung nach den Ursachen läuft auf Hochtouren. Doch dann machen Geophysikerin Dr. Jana Hollmer, deren Partner Clemens Bach sowie der Reederei-Chef Titus van Dijk eine unglaubliche Entdeckung … - Dieses eisige Schreckensszenario lässt den Atem gefrieren – Spannung pur! - Als Journalist legt Thilo Falk großen Wert auf Fakten und liefert uns einen Klimathriller der Extraklasse - Brillante Verknüpfung der direkten Folgen des Klimawandels mit dem unmittelbaren menschlichen Eingreife Bei dtv ist von Thilo Falk außerdem das Buch ›Dark Clouds‹ erschienen. Ein herausragender, mitreißender und faktenreicher Klimathriller am Puls unserer Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über das Buch
Mitteleuropa wird von einer neuen Eiszeit heimgesucht. Die erbarmungslose Kälte bedroht das Leben aller – die Versorgung der Bevölkerung ist durch eine zerstörte Infrastruktur nicht mehr gewährleistet, Energiepreise sind unbezahlbar. Die Forschung nach den Ursachen läuft auf Hochtouren. Doch dann machen Geophysikerin Dr. Jana Hollmer, deren Partner Clemens Bach sowie der Reederei-Chef Titus van Dijk eine unglaubliche Entdeckung …
Thilo Falk
White Zero
Die Kälte ist dein Tod
Thriller
Ich sehe seit einer Zeit,
wie alles sich verwandelt.
Etwas steht auf und handelt
und tötet und tut Leid.
(Rainer Maria Rilke, ›Ende des Herbstes‹)
FÜNF JAHRE SPÄTER
»Mama, erzähl noch mal die Geschichte, wie du mit Papa in einer Woche die Welt gerettet hast!«
Emily kuschelte sich dichter an ihre Mutter. Im Kamin knisterte das Feuer.
»Ach, die Welt gerettet haben wir nicht«, sagte Jana. »Deutschland vielleicht. Möglicherweise Europa. Aber nicht die ganze Welt.«
»Du sollst die Geschichte erzählen!«, drängte Emily.
Jana seufzte lächelnd. Sie zog eine Decke über ihre und Emilys Beine. »Na gut. Wenn du unbedingt willst …«
Die Wissenschaft ist der Verstand der Welt, die Kunst ihre Seele. – Maxim Gorki
Mittwoch, 02. März
Leipzig, 09:47 Uhr, -28,2 Grad
»Ja, ja, wenn ich fertig bin, hole ich dich gleich ab!«, sagte Jana und kraulte Alexandra hinter den Schlappohren. Nach einem Knalltrauma war die ehemalige Polizeihündin taub, doch Jana sprach trotzdem mit ihr. Sie ließ dabei ihre Hände auf dem Rücken des Beagles liegen, sodass die Hündin die Schwingungen ihrer Stimme spüren konnte. Alexandra stupste mit ihrer Nase gegen Janas Bein.
»Genau, dann machen wir es uns im Zug gemütlich, und heute Abend sehen wir Clemens wieder«, fuhr Jana fort. »Aber jetzt muss ich hoch. Du weißt ja, gleich halte ich den Vortrag.«
Sie gab Alexandra das Handzeichen für »Platz«: die ausgestreckte flache Hand, Handfläche nach unten. Alexandra legte sich platt auf den Bauch. Jana richtete sich auf und nahm zum Abschied einige Leckerlis aus der Tüte in ihrem Rucksack. Die Hündin kannte das Ritual. Sie schnappte Jana die Snacks aus der Hand, dann trottete sie seelenruhig in den Zwinger.
Nach dem Kälteeinbruch Anfang Oktober waren der Polizei drei Tiere ihrer Hundestaffel erfroren, weil die Räume nicht ausreichend isoliert waren. Die Bundeswehr hatte kurzfristig Hilfe angeboten. Damals dachten noch alle, das Wetter würde sich bald wieder normalisieren. Seitdem hausten 20 Polizeihunde im Keller der Kaserne. Dreimal täglich wurden sie in Gruppen ins Freie geführt.
Der Leiter der Hundestaffel hatte sich bereit erklärt, Alexandra in Ausnahmesituationen hundezusitten. Er war knurrig und wortkarg, aber Jana wusste, dass er sich in Wahrheit freute, die Hündin wiederzusehen.
Ihren kleinen Overnight-Rollkoffer hatte sie bereits beim Pförtner am Eingang zur späteren Abholung deponiert. Durch einen von wenigen Neonröhren nur mäßig erhellten Flur ging sie zum Fahrstuhl. Im dritten Stock stieg sie aus. Am anderen Ende des langen Gebäudes befanden sich die Räume des Bundeswehr-Forschungszentrums für Geophysik. Dr. Jana Hollmer war seit der Gründung vor 18 Monaten die stellvertretende Leiterin. Ursprünglich hatten Jana und ihr kleines Team einen reinen Forschungsauftrag erhalten: Ermittlung und Bewertung militärisch relevanter geophysikalischer Faktoren. Bodenschätze, die Drittstaaten möglicherweise erobern wollen würden. Geologische Formationen, die bestimmte Manöver erleichterten oder erschwerten, beispielsweise Bergketten oder Wasserstraßen. Sie hatten geopolitische Zukunftsforschung betreiben sollen: Welche Macht könnte aus welchen Gründen mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Begehrlichkeiten entwickeln?
Doch seit Oktober gab es nur noch ein Thema im Institut: die Eiszeit, die Deutschland unerwartet heimgesucht hatte.
Die Temperaturen lagen um fast neun Grad unter den Temperaturen des vorindustriellen Zeitalters, mehr als zwölf Grad unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Heizkosten waren ins Unvorstellbare gestiegen. Nur Rhein und die Elbe wurden von Eisbrechern notdürftig freigehalten. Die übrigen Flüsse waren schon seit Monaten nicht mehr befahrbar. Harz, Schwarzwald und Erzgebirge waren tief verschneit. Viele Unternehmen hatten die Produktion einstellen müssen, weil die Maschinen dem Temperatursturz nicht gewachsen waren. Die Bundeswehr hatte aus Sicherheitsgründen das gemeinsame Wintermanöver mit Polen und Österreich abgesagt. Gerüchteweise hieß es, ein Panzerfahrer sei erfroren, weil seine Kabine nicht ausreichend beheizt werden konnte.
Sie betrat ihr Büro, startete den Rechner. Gestern hatte der Frühling kalendarisch angefangen, aber davon war noch nichts zu spüren. In zwei Wochen würde auch meteorologisch das Frühjahr beginnen, und darauf hofften alle.
Heute würde Jana zahlreichen Militärexpertinnen und -experten die Forschungsergebnisse ihres Teams vorstellen. Eigentlich hielt sie gern Vorträge. Sogar die Verteidigung ihrer Dissertation hatte sie gern absolviert. Doch diesmal graute ihr vor dem Termin. Denn sie hatte nichts von Wert zu berichten.
Handelte es sich bei dem brutalen Kälteeinbruch um den unerwarteten Beginn einer kleinen Eiszeit oder um einen zufälligen Ausreißer, dem zum Ausgleich ein heißer Sommer folgen würde? Darüber ließ sich aktuell schlicht keine Aussage treffen – sie würden es erst in einigen Jahren wissen.
Wieso war es so kalt geworden in Deutschland und Mitteleuropa, hatte überhaupt etwas Bestimmtes den Temperatursturz ausgelöst? Auf diese Fragen gab es keine Antworten.
Doch »wir wissen es nicht« sagte man nicht bei der Bundeswehr. Auf der Basis von Unkenntnis konnte niemand zu belastbaren Entscheidungen gelangen. Von Hollmer wurde zumindest erwartet, dass sie mit Wahrscheinlichkeiten um sich warf und Prognosen über die nächsten 18 Monate anstellte.
Wissenschaftlich vollkommen unseriös, aber taktisch notwendig.
Sie überflog die Papiere im Eingangskorb in der heimlichen Hoffnung auf ein revolutionäres Forschungsergebnis, das ihr nachher den Hintern retten würde.
Nichts.
Sie schaltete den Rechner ein, mied bewusst das Mailprogramm, klickte noch einmal durch ihre Präsentation. Daten, Statistiken, Durchschnittswerte. Sah gut aus, und doch wurde ihr flau im Magen, weil sie wusste, dass sie in Wahrheit nichts zu sagen hatte. Und heute bestand ihr Publikum nicht aus wohlwollenden Akademikern, sondern aus frustrierten Militärs.
Jana ließ den Atem langsam ausströmen. Sie war im Leben noch nie ohnmächtig geworden, aber vor jedem wichtigen Termin fürchtete sie, auf dem Podium könnte ihr schwarz vor Augen werden.
Zehn Minuten vor elf betrat sie den Konferenzraum am Ende des Ganges. Sie nickte den Besuchern zu, die kaum von ihren Handys aufschauten. Jana rief die Präsentation vom internen Server auf, schaltete Beamer und Smartboard ein. Eine Minute vor elf stürmte ihr Boss und ehemaliger Doktorvater in den Raum, Prof. Günther. Er blieb vor den zu einem U angeordneten Tischen stehen. »Schön, dass Sie da sind. Begrüßen Sie mit mir Dr. Hollmer«, sagte er, warf seinen Block und einige Stifte auf einen freien Platz und setzte sich. »Sie wird uns auf den aktuellen Stand bringen.«
Die Blicke wandten sich ihr zu. Manche der Besucher kannte sie – Müller von der Infanterie, Faber-Gosling von der Logistik, Sandra Wagner von der Aufklärung. Schmitt-Lang von der Marine, Pohl von der Luftwaffe. Die meisten waren angereist: aus Berlin, Hamburg, München, Karlsruhe, Köln. In diesem Raum waren momentan die wichtigsten Strategen der Truppe versammelt.
Jana hatte sich entschlossen, mit der Tür ins Haus zu fallen. »Ich werde Sie heute enttäuschen«, begann sie den Vortrag. »Sie erwarten von mir Fakten, Thesen, Vorhersagen. Ich habe nur Vermutungen, Möglichkeiten, Spekulationen.«
Sie hatte die Sätze vor dem Spiegel geübt, hatte sie Clemens am Telefon vorgetragen und heute Morgen noch Alexandra in die Augen gesehen und sie aufgesagt, wohl wissend, dass die Hündin sie nicht hören konnte.
»Die wissen nicht, was du nicht weißt«, hatte Clemens gesagt. »Du bist die Expertin. Sie werden dir aus der Hand fressen. Weil sie dich brauchen. Wissenschaftlichsind eure Erkenntnisse vielleicht mangelhaft. Aber etwas Besseres kriegen sie nirgends, und das wissen sie.«
Er hatte recht, und trotzdem hörte sie sich in ihren Ohren an wie ein kleines Mädchen, das die Hausaufgaben nicht gemacht hatte.
Jana räusperte sich. Im Saal herrschte erwartungsvolle Stille. Wahrscheinlich konnten sie sich nicht zwischen Lachen und Buhen entscheiden.
»Im Herbst des vergangenen Jahres begann in Deutschland eine massive Kältewelle«, fasste sie die Ereignisse der letzten Monate zusammen. »Erst waren die Menschen nach einem Hitzesommer erleichtert, doch schnell schlug die Stimmung um. Das Land, die Infrastruktur – nichts ist für derart lang anhaltende niedrige Temperaturen gemacht.«
Sie begleitete die Einleitung mit einigen Bildern, die alle ohnehin aus den Nachrichten kannten. Dass ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland von einem Temperatursturz derart überrascht worden war und wie umfassend die Schäden ausfielen, erschien ihr immer noch kaum vorstellbar.
»Wir wollten wissen – Sie wollen wissen –, welche geopolitischen Veränderungen die Großwetterlage mit sich bringt und welche militärstrategischen Konsequenzen das hat.« Jana atmete tief durch. »Was hat die Kältewelle ausgelöst? Ist sie Teil der Klimakrise – und wenn ja, in welchem Zusammenhang steht sie zum übermäßigen Ausstoß der Treibhausgase? Wann wird es endlich wieder wärmer – und kann sich eine solche Katastrophe im kommenden Winter wiederholen?«
Sie sah von einem zum anderen, wie sie es geübt hatte. Den Anwesenden in die Augen zu schauen vermittelte ihre Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit.
»Auf diese Fragen benötigen Sie Antworten. Sie erwarten diese von uns, von mir, von meinem Institut. Doch wir müssen Ihnen diese Antworten schuldig bleiben.«
Unruhe und ein leises Murmeln flossen wie eine Welle durch den Raum.
»Was ich Ihnen hingegen sagen kann, ist Folgendes.«
Es wurde wieder ruhig.
Gerade als sie fortfahren wollte, öffnete sich die hintere Tür. Generalleutnant Krause, dessen unermüdlichem Einsatz Günther und Hollmer ihre Positionen verdankten, kam herein. Er hatte auf der Gründung des Bundeswehr-Forschungszentrums für geopolitische und geophysikalische Entwicklungen und der Unterbringung in der Leipziger Bundeswehrkaserne bestanden. Krause würde in zwei Jahren pensioniert – dass er keine ruhige Kugel schob, sondern sich aktiv für eine sichere Zukunft engagierte, war bemerkenswert.
Er war es auch gewesen, der Jana und Alexandra miteinander bekannt gemacht hatte. Ohne ihn würde Jana noch immer allein wohnen, und Alexandra wäre vermutlich eingeschläfert worden.
Krause nickte ihr mit einem Lächeln zu und bedeutete mit einer Handbewegung, sie möge weitersprechen. Er ging an der Querseite des Raumes an der Wand entlang zur Fensterfront. Der Generalleutnant trug über der Uniform einen dicken Wintermantel und lehnte sich an die Mauer zwischen zwei Fenstern.
»Solange die Regierung die Bevölkerungssicherheit aufrechterhalten kann, und davon ist aktuell auszugehen«, fuhr sie fort, »ist nicht mit Unruhen zu rechnen. Weder im Land noch über Landesgrenzen hinweg. Es sind derzeit nur sehr geringe Reisetätigkeiten auszumachen. Zu Hause, scheinen sich die Menschen zu denken, ist es vielleicht nicht am schönsten, aber zumindest am wärmsten.«
Einige Anwesende lachten leise.
»Aktuell gehen wir, und darin sind wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen des DWD, des PiK und des DKK einig, davon aus, dass es sich um eine zeitlich begrenzte Extremwetterlage handelt. Wie Sie wissen, führt die Verlangsamung des Jetstreams zu einem längeren Andauern sämtlicher Wetterlagen – egal ob gut oder schlecht, Hochdruck oder Tiefdruck. Wir vermuten derzeit, dass mit Einsetzen des Frühjahrs auch wieder wortwörtlich Bewegung in die Sache kommt und es zügig taut. Ein weiterer ›Jahrhundert-Hitzesommer‹ ist insofern nicht auszuschließen, obwohl wir es uns aktuell kaum vorstellen können.«
Die Zuschauer nickten.
»Somit gehen wir davon aus, dass keine militärischen oder paramilitärischen Konsequenzen in den verbleibenden Tagen der Kältewelle zu erwarten sind. Unsere Nachbarn werden, genau wie wir, die Sache aussitzen und hoffen, dass es eine einmalige Problematik war.
»Aber« – Jana machte eine dramatische Pause – »Sie bekommen dennoch Hausaufgaben von uns.« Sie ging einige Schritte nach rechts, bis sie vor der Außenwand stand. »Als wissenschaftlich gesichert kann gelten, dass unser Wetter in den kommenden Jahren erheblich mehr Extreme zeigen wird. Selbst wenn es sich also nicht um den Beginn einer neuen Kleinen Eiszeit handelt« – sie klopfte mit den Knöcheln ihrer rechten Hand dreimal gegen den Fensterrahmen –, »so ist dennoch damit zu rechnen, dass es heißer, feuchter, aber zumindest an einzelnen Tagen auch trockener oder eben deutlich kälter als im Durchschnitt werden kann. Sie müssen daher unbedingt ihr gesamtes Material und alle Bauten überprü…«
Jana schlug mit der flachen Hand gegen die Innenseite der Außenwand.
Sie hatte sagen wollen: »… überprüfen auf ihre dauerhafte Wetterbeständigkeit.«
Doch ihre Worte gingen in einem lauten Knirschen unter, das in ein tiefes Knarren und krachendes Grummeln überging. Und mit einem Mal traf ein kalter Luftschwall sie wie ein Schlag. Die Wand neben ihr hatte sich gelöst, war nach außen gebrochen und drei Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Schlimmer noch: Erst folgte ein Fenster, dann ein weiteres Stück Mauer, und innerhalb von Sekunden brachen große Teile der Außenwand des dritten Stocks der Kaserne in sich zusammen.
Manche der Besucher im Konferenzraum starrten entsetzt auf das Geschehen, andere reagierten spontan, sprangen auf, packten ihre Nachbarinnen oder Nachbarn, zerrten sie weg von der Unglücksstelle in Richtung der Gebäudemitte.
Jana warf sich reflexhaft auf den Boden. Sie riss die Augen auf und sah, wie die Mauer hinter Generalleutnant Krause nachgab, nach außen wegkippte, und er hinterher. Im einen Moment war er noch da, im nächsten verschwunden. Sie schrie entsetzt auf.
Das Krachen und Rumpeln des zerberstenden Mauerwerks wurde auf einmal übertönt durch die Warnsirene. WIU-WIU-WIU-WIU schrillte es in maximaler Lautstärke. »Dies ist keine Übung! Dies ist keine Übung!« WIU-WIU-WIU-WIU. »Dies ist keine Übung!«
Panisch rannten die Anwesenden zur Tür, drängten in den Flur. Jana folgte ihnen auf allen vieren. Auf halber Strecke wandte sie sich um. Hatte sie gerade wirklich mit einem Schlag ihrer flachen Hand die Frontseite der Kaserne zerstört? Andererseits war nur eingetreten, was sie hatte demonstrieren wollen: Das noch zu DDR-Zeiten errichtete Bauwerk war der dauerhaften Kälte nicht gewachsen.
WIU-WIU-WIU-WIU kreischte die Sirene. Jana krabbelte weiter. Vor ihrem geistigen Auge sah sie die Mauer nach außen kippen, sah … Krause an der Wand lehnen, zwei Jahre vor der Pensionierung, ihren größten Förderer, sah die Wand hinter ihm verschwinden, sah ihn das Gleichgewicht verlieren und rücklings ins Nichts stürzen.
Wie wahrscheinlich war es, dass jemand einen Fall aus dem dritten Stock überstand?
Sie erreichte den Flur, links führte die Nottreppe nach unten. WIU-WIU-WIU. »Bitte verlassen Sie das Gebäude. Dies ist keine Übung. Bitte verlassen Sie das Gebäude.« WIU-WIU-WIU.
Jana zog sich an der Wand hoch, hörte hinter sich weitere Mauerteile brechen, in die Tiefe stürzen. Ein Beben durchfuhr den gesamten Boden. Hastig schloss sie sich dem Menschenstrom an, der aus den Büroräumen in den Flur und die Treppe hinunter zum Ausgang flutete.
Jana stolperte, fing sich, schrammte mit den Fingerknöcheln über den rauen Putz. Wurde mitgerissen von den anderen, kam einmal beinahe aus dem Gleichgewicht, stürzte fast, jemand packte sie am Oberarm, zog sie, hielt sie, ihr wurde schwindelig. Dann die Eiseskälte wie eine Ohrfeige, leichter Schneegries in der Luft, sie trug keine Jacke, begann zu zittern.
WIU-WIU-WIU, heulte die Sirene. Jana sah sich um, taumelte ein paar Schritte in Richtung Straße. Blieb wie angewurzelt stehen. Fast die gesamte obere Hälfte der Vorderfront der Kaserne war verschwunden. Eine riesige Wunde klaffte im Gebäude, es sah aus wie nach einer Explosion, einem terroristischen Angriff. Immer wieder lösten sich knirschend, krachend weitere Brocken aus der Mauer und stürzten in die Tiefe. Schreie und Rufe der Menschen hallten durch die Luft.
Und auf einmal kam ein Bellen dazu, Kläffen, die Hunde, die Hunde, Jana sah ein, zwei, drei schwarze Bündel über den Rasen fliegen, sie bellten, sie knurrten, sie fielen in ihrer Panik Menschen an, die frierend zwischen den Trümmern standen. Panische Schreie brandeten auf, ein schrilles Wimmern war zu hören, dann ein Knall.
Die Hunde kläfften immer wilder, ballten sich zu einem Knäuel. Der Hundeführer musste versucht haben, sie aus der Gefahrenzone zu bringen, oder vielleicht war auch der Zwinger beschädigt worden. Doch die Tiere waren abgerichtet auf den kontrollierten Einsatz unter direkter Aufsicht – kein Wunder, dass sie auf das Bersten der Mauern, das Schrillen der Sirenen und die hektisch rennenden Menschen ihrerseits mit Panik und Aggression reagierten.
Jana tastete nach dem Sender in ihrer Tasche. Vor wenigen Wochen hatte sie auf Anraten der Trainerin für Alexandra ein Vibrationshalsband gekauft, das der Hündin mithilfe unterschiedlicher Signalmuster Befehle übermitteln konnte.
Ein weiterer Knall hallte durch die eisige Luft, und auf einmal wechselte Janas Wahrnehmung von Zeitlupe in Zeitraffer. Sie begriff, was das Geräusch bedeutete: Jemand schoss. Die Hunde kläfften, Menschen schrien und rannten, die Tiere bissen, ihr Jagdinstinkt setzte ein, immer noch brachen Teilstücke der Kasernenfront heraus, und über allem schrillte nach wie vor die Alarmsirene. Alles schien gleichzeitig zu geschehen, bis plötzlich ein hektisches Tak-tak-tak-tak-tak alle anderen Geräusche auslöschte. Jana sah ein zerbissenes Bein, einen zum Schrei geöffneten Mund. Die Hunde stoben auseinander, Fellleiber stürzten zu Boden.
Sie rief laut: »Alexandra! Alexandra!«, und begann ihrerseits zu laufen, nicht weg von den Hunden und dem Maschinengewehrfeuer, sondern darauf zu, sie hatte die Hündin einmal durch die Adoption gerettet, sie würde sie wieder retten. »Alexandra, Alex!«, rief sie, ohne auf die irritierten Blicke derjenigen zu achten, die ihr entgegenkamen, und obwohl sie doch eigentlich wusste, dass die Hündin sie nicht hören konnte.
Jana entdeckte den jungen Mann, der seine Maschinenpistole weiter schussbereit hielt. »Feuer einstellen!«, blaffte sie ihn an. »Feuer einstellen!« Oft genug hatte sie gehört, wie die ranghöheren Soldaten ihre Befehle schnauzten und Gehorsam verlangten. Der junge Soldat sah sie an, schaute danach auf seine Waffe, als sähe er sie zum ersten Mal, und dann wirbelte er um die eigene Achse, ein dunkler Schatten flog auf ihn zu, er riss die Waffe hoch, und eine weitere Salve durchschnitt die Luft. Blut spritzte, und mitten aus dem Sprung stürzte ein Schäferhund zu Boden.
Jana sah sich panisch um. »Alex, Alexandra!«, rief sie erneut, dann zog sie den Sender aus der Tasche, drückte auf einen der Knöpfe. Mitten im Durcheinander der umherrennenden Menschen und Tiere entdeckte sie eine kleine Hündin, die abrupt stehen blieb und sich suchend umsah. »Hier! Alexandra! Hier bin ich!«, rief Jana und winkte. Der Beagle kam zu ihr gelaufen, presste sich an Janas Hosenbein. »Ja, da bist du ja, brave Alexandra«, murmelte Jana. »Brave Alex. Guter Hund.«
Sie hatte gerade – wenn auch unbeabsichtigt – mindestens einen Menschen in den fast sicheren Tod stürzen lassen und die Bundeswehrkaserne Leipzig vollkommen zerstört. Hätte sie darüber nachgedacht, wäre ihr bewusst geworden, wie unangemessen ihre Freude über das Wiedersehen mit der unversehrten Hündin war. So aber ging sie einfach nur in die Knie und vergrub ihr Gesicht im Fell der Hündin. Jana weinte los.
Hinter ihr jaulte die Sirene weiter, nun gesellten sich die Polizei, die Feuerwehr und die Rettungswagen hinzu. Die roten und blauen Lichter zuckten über den Schnee und das Eis, die den Boden bedeckten. Auf einmal fuhr Jana vor Kälte zusammen. »Komm«, sagte sie und erhob sich. »Komm, wir müssen hier weg.« Sie klopfte gegen ihren Oberschenkel.
Mehrere Polizei-, Feuerwehr- und Krankenwagen waren bereits eingetroffen. Immer noch rannten Menschen aus dem in sich zusammenstürzenden Gebäude, und immer noch fielen Mauerstücke auf den verschneiten Rasen.
Es war der nackte Horror.
Berlin, 10:35 Uhr, -19,7 Grad
Traumhaft langsam segelten die Flocken zu Boden. Über der Hauptstadt spannte sich heute ein zartgrauer Wolkenteppich, aus dem es sanft schneite.
Clemens ließ einige weiße Tupfer auf seinem Fäustling landen. Sie glitzerten und streckten ihre Kristallästchen in alle Richtungen.
Er zog die Tür hinter sich zu und schloss ab. Stieg auf die Langlaufskier, griff nach den Stöcken. Die Hauptstraßen wurden täglich geräumt, aber Nebenstraßen und Parks lagen seit Monaten unter Schnee und Eis. Clemens war froh, dass er die Skier noch auf dem Dachboden gehabt hatte. Er stieß sich ab und glitt auf den Bürgersteig, die Straße hinunter. Es waren nur wenige Menschen unterwegs. Wer konnte, blieb zu Hause, wer musste, war bereits bei der Arbeit. Eine Nanny mit einem altmodischen Kinderwagen mühte sich den Gehweg entlang. Die schmalen Räder blieben ständig stecken. Wie reich und eitel musste man sein, das Kindermädchen im härtesten Winter seit Menschengedenken mit einem solchen Wagen auf die Straße zu schicken?
»Stalingrad-Winter« nannten die Berliner das gnadenlose Wetter. Selbst Clemens, der eigentlich gern im Freien war, hatte langsam die Nase voll.
Zahlreiche bunte Punkte tanzten über das Eis der Spree – Schlittschuhläufer. Clemens blieb am Geländer stehen, genoss einen Moment den Ausblick. Einige Jugendliche hatten mit Schneehäufchen ein Feld markiert und spielten Hockey. Eine ältere Dame zog eine ruhige Bahn am Rand des Flusses Richtung Osten. Zwei Mädchen übten Pirouetten. Drei Jungs standen mit überkreuzten Armen daneben und schauten zu.
Es tat Clemens gut, zu sehen, dass es mehr gab als nur Kälte und Dunkelheit. Die letzten Tage hatte er das Haus nicht verlassen, und seine Stimmung war gesunken. Er freute sich auf das Treffen mit Bakir.
Auf einmal bemerkte Clemens, wie kalt ihm geworden war. Er schüttelte sich, strich die Schneeflocken von seinem Ärmel. Er stampfte einige Male auf, dann wollte er sich abstoßen, doch seine Skier schienen am Boden festgefroren zu sein. Er knickte um und fiel. Mit den Händen konnte er den Sturz abfangen, dennoch landete er mit dem Hintern im Schnee. Er versuchte, sich zurück in den Stand zu stemmen, aber nun rutschten seine Skier weg.
»Verdammt, ich bin zu alt für solches Wetter«, murmelte er lachend und stemmte die Kanten der Skier in den Schnee. Diesmal gelang es ihm, sich hochzudrücken. Er klopfte seine Hose ab, spürte jedoch bereits die feuchte Kälte am Po. Seine Jacke war wasserdicht, die Jeans nicht. Er trug zumindest eine lange Unterhose. Die wasserfeste Schneehose hatte er für den kurzen Weg nicht für nötig gehalten.
Sollte er Bakir absagen und nach Hause zurückkehren? Dort war es warm und gemütlich. Aber er wusste, es würde ihm guttun, jemanden zu sehen. Unter Normalbedingungen hatte er im Büro genug Sozialkontakte, nur aktuell eben nicht.
Er glitt in den Großen Tiergarten hinein, folgte dem Weg Richtung Siegessäule, umrundete den Großen Stern. Vorbei am Neuen See, am Zoo. An der Budapester Straße schnallte er die Skier ab und nahm sie auf die Schulter. Der Rest des Weges war geräumt und – schlimmer noch – gestreut. Hier würde er die Beläge der Skier komplett ruinieren.
Wie ein riesiger toter Wal lag das Gebäude des Europa-Centers da. Die Geschäfte hatten darin schon vor Monaten geschlossen – es gab kaum Waren und kaum Kunden. Zudem hatten Obdachlose und all diejenigen, die ihre Strom- oder Gasrechnung nicht mehr bezahlen konnten, das Einkaufszentrum genutzt, um sich vor der Kälte zu schützen. Am Ende musste es in einem der größten und umstrittensten Einsätze der Berliner Polizei gewaltsam geräumt werden. Seitdem waren die Türen mit Ketten und Brettern gesichert.
Der Platz vor der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war nahezu menschenleer, der Goldene Riss, der an die Opfer des Attentats auf dem Weihnachtsmarkt erinnerte, von einer weißen Kruste verdeckt. Touristen kamen seit Monaten nicht mehr in die Stadt. Viele deutsche Flughäfen hatten den Betrieb gänzlich eingestellt, der BER als einer der ersten schon bei minus 3 Grad. Ein spezielles Schmiermittel in der Lüftungsanlage hatte den Temperaturen nicht standgehalten und sich verhärtet. Der auftraggebende Architekt war verstorben, ob gegen die Erben ein Schadenersatzverfahren eingeleitet werden sollte, würde der Senat diskutieren, sobald die Tagesordnung nicht mehr vollständig durch Notstandsentscheidungen blockiert wurde.
Das Kranzler war eines der wenigen Cafés, die geöffnet hatten. Kleinere Anbieter konnten die Anhebung der Energiepreise nicht bewältigen. Vor allem aber bekamen sie keine Backwaren mehr, keinen Kaffee, keine Milchprodukte, und sowohl Mitarbeitende wie Gäste blieben ohnehin lieber zu Hause.
Clemens steckte seine Skier zu den vielen anderen in den Schneehaufen neben der Tür. Seit die BVG den Busbetrieb komplett ausgesetzt hatte und die Bahnen nur noch tagsüber alle 30 Minuten fuhren, waren viele Berliner dazu übergegangen, nicht mehr ohne Skier oder Schneeschuhe vor die Tür zu gehen.
Er nahm die Mütze ab, zog die Handschuhe aus, zupfte sich vor der Glasscheibe ein paar braune Haarsträhnen zurück in die Stirn. Die meisten Menschen, denen er begegnete, schätzten ihn auf Anfang dreißig, er wirkte freundlich und offen.
Bakir wartete bereits im Foyer. »Hey, Mann, schön, dich zu sehen«, sagte er und umarmte seinen Freund. Sie hielten einander länger, als man es früher getan hatte.
Aufgrund des Konkurrenzsterbens musste man im Kranzler jetzt Wochen vorher einen Tisch buchen, und den gab es für maximal eine Stunde. »Kapitalismus«, murmelte Bakir, nachdem er einen Blick in die Karte geworfen hatte. »Irgendwer profitiert immer.«
»Wie kommst du klar?«, fragte Clemens seinen besten Freund aus Schulzeiten. Bakir war Makler.
Der zuckte mit den Achseln. »Wir halten durch. Wie so viele. Aber wenn es nicht bald wärmer wird, kriegen wir ein Problem. Die Leute drehen einfach langsam durch.«
Clemens nickte. »Ja. Das Ausgangsverbot im Januar war für euch bestimmt hart. Wir konnten uns trotzdem sehen, weil Jana im Fachbeirat der Regierung ist und eine Sondererlaubnis hatte.«
»Ja, bei uns lief es nicht so gut …« Er wackelte mit der Hand.
»Ist Denise immer noch nicht zurück?« Bakirs Lebensgefährtin war im November zu ihren Eltern auf ein Dorf in der Nähe von Paderborn gezogen. Ihre Eltern kamen mit der extremen Kälte und den außerordentlichen Umständen allein nicht klar.
Der schüttelte den Kopf. »Und sie sagt …« Er unterbrach sich. Schwieg einen Moment, betrachtete seine Hände, griff nach seiner Kaffeetasse, ließ sie wieder los. »Sie sagt, sie würde mich gar nicht so vermissen, wie sie dachte. Sie ist sich nicht sicher, ob sie …« Er schluckte, wischte sich mit dem Handrücken über das rechte Auge. Zog die Nase hoch. »Frauen!«
»Wird schon«, sagte Clemens. »Ihr habt euch doch immer … wie lange seid ihr jetzt zusammen?«
»Ja, eben. Vielleicht ist einfach die Luft raus. Für sie. Und ich weiß nicht …« Bakir zog ein Taschentuch hervor und putzte sich die Nase. »Na ja. Momentan kann ich sowieso nichts machen. Ich wüsste nicht, wie ich auf dieses Kuhkaff komme, in dem sie wohnt, und sie kann ihre Eltern nicht allein lassen. Das verstehe ich ja sogar.« Er presste die Lippen aufeinander.
Clemens’ Handy vibrierte. Er zögerte kurz, dann zog er es aus der Tasche und las die Nachricht. Er runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf. »Amelie«, sagte er nur.
»Dein One-Night-Stand?«
»Ja, und von vor zwei Jahren. Verrückt, wenn man so zurückdenkt. Wie sich das Leben verändert hat. Das mit Amelie war im Sommer, es lief Fußball auf großen Leinwänden, die Stimmung war top, ich hatte gerade drei neue Leute eingestellt im Verlag. Es herrschte Frieden in Europa und damals dachten wir sogar, die Regierung würde was gegen die Klimakatastrophe tun. Das Leben war gut.«
»Was will sie denn?«
»Sie schickt mir einfach ab und zu so Nachrichten. Mal ein Bild, mal ein paar Sätze. Ich antworte fast nie drauf, aber …«
»Du antwortest ihr?«
»Ich antworte ihr fast nie, habe ich gesagt.«
»Aber du antwortest ihr überhaupt? Clemens, du musst die blockieren, sonst macht sie sich ewig Hoffnung.«
Clemens sah sein Handy an. »Du hast wahrscheinlich recht, aber …«
»Gib mal.« Bakir streckte die Hand aus.
»Nee. Ich bin schon groß«, sagte Clemens und steckte das Handy ein.
»Du Player«, sagte Bakir. »Und ich dachte, es wäre was Ernstes mit Jana.«
Clemens nickte, zuckte mit den Achseln. »Sie will Karriere machen, so richtig. In der Forschung. Das kostet natürlich Zeit. Neulich habe ich vorgeschlagen, wir könnten mal gemeinsam in Urlaub fahren, wenn das wieder geht.« Er deutete in Richtung der Fensterscheiben.
Bakir klopfte dreimal auf den Tisch.
»Aber sie sagt, sie weiß nicht, ob sie dann dafür Zeit hat. Forschungsprojekte. Sag mal, hast du was von Stefan gehört?«
Stefan war mit ihnen zur Schule gegangen. Später hatte er sich als Surflehrer durchgejobbt. Im November, als es noch ging, war er kurz entschlossen nach Bali ausgewandert.
Bakir nickte. »Er hat eine Freundin. Das ist gut. Aber keine Arbeit. Das ist schlecht. Keine Touristen heißt: keine Surfstunden. Immerhin hat er keine Heizkosten und muss trotzdem nicht frieren.« Er rief ein Bild auf dem Handy auf. »Hier.«
Stefan und eine junge Frau mit einem netten Lächeln schauten in die Kamera. Er trug nur eine kurze Hose, sie T-Shirt und Shorts. Hinter ihnen standen Palmen.
»Puh, da bin ich schon ein bisschen neidisch«, sagte Clemens.
Der Kellner kam, um zu kassieren. Ihre Stunde war um, die nächsten Kunden warteten.
Clemens kaufte am Tresen noch eine Tüte Aufbackbrötchen.
Sie umarmten einander zum Abschied, dann schnallte Clemens die Skier an und machte sich auf den Rückweg. Es war erst früher Nachmittag, aber schon deutlich dunkler als zuvor. Aus Energiespargründen brannte nur jede zweite Laterne. Es hatte gutgetan, Bakir wiederzusehen, aber nun war er froh, zurück nach Hause zu kommen.
Jana musste jetzt auch fertig sein mit ihrem Vortrag. »Alles gut gegangen?«, schrieb er.
Minuten später die Antwort: »Hätte besser laufen können. Erzähl ich dir heute Abend.«
Kiel, 14:10 Uhr, -17,9 Grad
Lulu – eigentlich »Luisa«, aber niemand nannte sie so – warf ihren Rucksack auf den Boden, schälte sich aus der dicken Winterjacke, der dünneren Winterjacke und dem Sweatshirt, das sie über dem Langarmshirt und dem Langarm-Unterhemd trug. »Hallo? Hal-lo?! Ist da jemand?«, rief sie.
Sie streifte die klobigen Winterschuhe ab, in deren Profil noch jede Menge dreckiger Schnee klebte. Kurz meinte sie, ihre Väter im Chor zu hören: »Bitte abtreten, das Holz verträgt die Nässe nicht.« Lulu, 15, hatte nicht das geringste Problem damit, die Stimmen zu ignorieren.
»Hallo! Wo seid ihr denn?«, rief sie. Die Schneehose landete ebenfalls auf dem Klamottenhaufen.
Einen kurzen Augenblick blieb Lulu jetzt im Flur stehen und genoss die Wärme. Sie wusste, wie gut es ihr und ihrer Familie ging. Sie gehörten zu den wenigen Leuten, die sie kannte, die es sich noch leisteten, das gesamte Haus zu heizen. Andererseits gingen in der alten Villa die meisten Räume offen ineinander über, es ließ sich also kaum vermeiden.
Sie ging in die Küche, nahm sich eine Scheibe Käse aus dem Kühlschrank, rollte sie auf und aß sie im Gehen. Wohnzimmer, Arbeitszimmer, niemand da, kein Geräusch. Sie trat an die Terrassentür. Ah! Im Gewächshaus bewegte sich etwas.
Lulu winkte, erhielt aber keine Reaktion. Sie zog ihr Handy heraus, startete einen Gruppen-Voice-Chat. Eric nahm ihren Anruf auf seiner Smartwatch an, das Klingeln von Antons Handy war im Hintergrund zu hören. »Ja?«
»Wo seid ihr?«
»Im Gewächshaus.« Etwas rumpelte. Dann: »Ich kann dich sehen.«
»Ja, ich euch auch. Wie lange braucht ihr noch?«
»Eine Weile. Ist es wichtig? Du kannst uns helfen.«
»Aber es ist so kalt draußen.«
»Auf dem Weg? Die paar Schritte hier rüber?«
»Ich bin gerade erst reingekommen.«
»Pff. Also wirklich. Als wir so alt waren wie du …«
Lulu konnte das Grinsen in seiner Stimme hören. »Ich komm ja schon, ich komm ja schon«, rief sie. »Bloß keine Geschichten aus deiner Jugend, bitte!«
Sie legte auf, steckte das Handy ein und schlüpfte in ihre Chucks, die neben der Terrassentür standen. Sie wusste, was ihr bevorstand, wenn sie die Tür öffnete, und dennoch war die Kälte ohne die dicke Bekleidung ein Schock. Gern wäre sie gerannt, aber seitdem sie sich vor ein paar Wochen auf dem vereisten Weg gemein hingepackt hatte, tippselte sie die zwanzig Meter in kleinen Schrittchen.
Anton hielt ihr bereits die Tür auf. Im Gewächshaus war es kühler als im Haus, aber immerhin deutlich wärmer als im Freien. Vor einigen Wochen hatten sie die Tagestemperatur im Gewächshaus auf zehn und die Nachttemperatur sogar auf sechs Grad abgesenkt. Als »Bromelien-Triage« hatten sie die Diskussion bezeichnet: Welche ihrer kleinen Schätze waren so wertvoll oder so schwer wiederzubeschaffen, dass sie unbedingt überleben mussten? Und welche waren ersetzbar, irgendwann, wenn das Leben wieder auftaute?
Lulu spürte einen kalten Hauch.
»Eine weitere Scheibe ist gesprungen«, sagte Anton. »Wir versetzen gerade die Bienenstöcke, um eine Plane anbringen zu können.«
Seit Wochen gab es keine Ersatzteile mehr für das Gewächshaus, weder vor Ort noch online. Die nahe gelegenen Gärtnereien hatten den Betrieb eingestellt, die Baumärkte waren nahezu leer gekauft und bekamen keine neuen Lieferungen.
Es war bereits die dritte Scheibe, die in der anhaltenden Kälte brach. Die ersten beiden hatten sie mit einer doppelten Lage Folie und reichlich Klebeband einigermaßen gut ersetzen können.
»Halt mal.« Eric drückte ihr einen Topf mit einer rot-grünen Billbergia amoena in die Hand.
Anton kehrte zurück zu den Bienenständen und zog die Schutzplane zurecht.
Lulu stellte die Bromelie auf einen Tisch und trat neben Eric. Sie hielt die Folie, er klebte sie fest. Darüber befestigte er eine zweite Lage.
Der kalte Luftstrom, der das Gewächshaus durchzogen hatte, nahm ab.
»Es kann so nicht weitergehen«, sagte Lulu, als sie fertig waren. »Heute sind Tim und Anna nicht gekommen. Ihr Weg ist zu weit. Die Busse fahren nicht, die Wege sind zu glatt, um mit dem Rad zu kommen. Die Eltern haben keine Autos mehr. Und zu Fuß … da können sie auch gleich nachts das Fenster auflassen und dem Elend ein Ende bereiten! Wir müssen etwas tun!«
»Wir?«, fragte Eric. »Wer ist wir?«
»Na, wir!« Lulu hob den Zeigefinger und fuhr damit einmal im Kreis durch die Luft. »Du, Anton und ich.«
»Und wieso wir? Wieso nicht die Schulbehörde?«
»Weil die nix machen. Denen ist alles egal. Hast du selbst tausend Mal gesagt. Vielleicht finden sie es sogar besser, wenn immer weniger Schüler_innen« – Lulu genderte beim Sprechen mit einer kurzen Pause vor der zweiten Wortendung – »kommen. Dann können sie Klassen zusammenlegen, das spart Heizkosten und Lehrkräfte.«
»Ich hab schon gesagt, denen ist alles egal, als du noch in der Grundschule warst und wir in irgendein Formular ›Mutter‹ und ›Vater‹ eintragen sollten!«
»Na ja, und auch, als die Klassenlehrerin beim ersten Elternabend in der Fünften angeboten hat, dass Lulu sich jederzeit bei ›Mädchenfragen‹ an sie wenden kann«, sagte Anton.
Lulu grunzte lachend, als sie daran zurückdachte, wie empört Eric von der Begegnung berichtet hatte. »Und was war mit den drei Klassenarbeiten in einer Woche in der Siebten?«, fragte sie dann.
»Okay. Gut. Ich bin kein Fan der Schulbehörde. Aber ganz ehrlich, wir können doch gar nichts machen. Wie stellst du dir das vor? Wir sind schließlich kein Busunternehmen. Und der öffentliche Nahverkehr ruht aus gutem Grund – da kämen wir mit unserem Kombi nicht besser durch«, hielt Anton dagegen.
»Vielleicht könnten sie bei uns wohnen?«, überlegte Lulu. »Von hier ist es ja nicht so weit.«
»Klar. Du kannst gern dein Zimmer mit vier Mitschülern teilen«, sagte Eric und schüttelte den Kopf.
Lulu presste die Lippen aufeinander. »Und die Klassenreise nach Ostern wurde auch abgesagt«, wechselte sie das Thema.
»Wohin sollte die noch mal gehen?«, fragte Anton.
»Berlin.«
»Da verpasst du nix.«
Lulu schnaufte. »Es geht doch nicht um die Stadt. Sondern um das Erlebnis. Wir werden um unsere Jugend betrogen. Um all die tollen Erlebnisse, die sie euch in den Hintern geschoben haben.«
»Nee, mit 15 noch nicht«, entgegnete Eric trocken. »Aber ich weiß schon, was du meinst. Nicht nur lernen, sondern gemeinsam etwas erleben. Regeln brechen, auf die Jungszimmer schleichen, heimlich Bier trinken. Wir haben schon Kondome gekauft, die wir dir heimlich ins Gepäck stecken wollten.«
»Argh!« Lulu stöhnte und presste sich die Hände auf die Ohren. »Du bist doof! Ihr seid beide doof!«
Eric legte seiner Tochter die Hand auf die Schulter. »War nur ein Spaß«, sagte er.
»Ach, lass mich in Ruhe!« Sie stieß die Tür des Gewächshauses auf und lief zurück ins Haus.
Eric und Anton sahen ihr nach. »Von mir hat sie diese Empfindlichkeit nicht«, sagte Eric irgendwo zwischen amüsiert und genervt.
»Wir werden es nie erfahren. Das war ja der Sinn der Sache«, sagte Anton.
Die Männer hatten, um Lulu zu zeugen, ihre Samenproben mischen lassen, damit offenblieb, wer der biologische Vater war – und wer nicht.
»Wollen wir die Bienen zurückstellen?«, fragte Eric.
Anton zuckte mit den Achseln. »Geht doch so auch«, sagte er. »Und ist vielleicht sogar einen Hauch wärmer vor einer echten Glasscheibe.«
»Okay.« Eric begann, die Töpfe und Ständer, die sie beiseitegeschoben hatten, wieder zurechtzurücken. Bromelien mussten nicht unbedingt in Erde wachsen – viele von ihnen fühlten sich deutlich wohler auf Aststücken oder in kleinen Moosbetten.
»Ich freu mich ja, dass sie gern zur Schule geht«, nahm Anton den Faden auf. »Anders als ich damals. Ich hätte gar nicht schnell genug ›Glatteis‹ rufen können bei so einem Wetter wie jetzt. Es macht mir Sorgen, dass sie so gestresst ist. Sie fühlt sich verantwortlich. Für die anderen, aber auch für ihre eigenen Erlebnisse. Dabei wäre das die Aufgabe der Lehrer – oder eben unsere. Ich wünschte, sie wäre unbeschwerter.« Er begann dabei zu helfen, die Vrieseae wieder in den notwendigen Abständen zu positionieren. »Meinst du, wir müssten etwas tun? Mit Lulu reden, oder mit der Klassenlehrerin?«
Eric arbeitete eine Weile wortlos weiter. Es fiel Anton schwer, abzuwarten und das Schweigen auszuhalten. Aber er hatte mit den Jahren gelernt, dass sein Mann oft etwas Zeit brauchte, um seine Position zu finden. Drängte Anton ihn, führte das höchstens zu einem Streit.
Eric rückte das letzte der vielfältigen Ananasgewächse an seinen Platz. Dann klopfte er sich zufrieden einige Erdkrümel von den Händen. »Vielleicht wird es bald besser«, sagte er. »Ewig kann diese Kälte ja nicht mehr anhalten. Wir haben schon Anfang März. Gut möglich, dass wir in einem Monat ohne Jacke draußen rumlaufen. Dann klärt sich das mit dem Schulweg von selbst. Und die Klassenreise lässt sich ja nachholen. Selbst wenn sie jetzt stornieren, in Berlin gibt es genug Hostels, da kriegen die kurzfristig was. Und so lieb ich sie habe – es ist nicht gut für Lulu, wenn wir immer alle ihre Probleme für sie lösen. Das haben wir doch auch so besprochen.«
Anton strich über die quergestreiften Blätter einer Neoregalie. »Ich weiß. Deswegen frage ich dich ja. Und hab nicht gleich was gesagt.«
Eric nickte. »Gut.«
»In Ordnung. Wir warten erst mal ab. Und sonst … Wir könnten ja mit ihr und ein paar Freundinnen oder Freunden für ein langes Wochenende nach Berlin fahren, wenn es mit der Klassenreise gar nicht klappt«, schlug er vor.
Eric lachte. »Genau. Weil mit deinen Vätern und zwei anderen Kindern in ein Ferienhaus am Stadtrand zu fahren, ja so ungefähr dasselbe ist wie eine Woche in der Jugendherberge mit 30 Kindern und zwei Lehrern, die im Idealfall die ganze Zeit weggucken.« Er bemerkte Antons Blick, trat einen Schritt auf ihn zu und nahm seine Hand. »Es ist ein netter Gedanke! Lass uns abwarten. Wir können ja immer noch darauf zurückkommen.«
Er lächelte und küsste Anton. Der entspannte sich mit einem Seufzen. »Es heißt immer, mit der Zeit würde das Elternsein einfacher, aber ich merke davon bisher nichts«, murmelte er.
»Weil du es von Anfang an so gut machst, dass da nichts mehr besser oder einfacher werden kann«, sagte Eric.
Anton löste sich aus der Umarmung, boxte seinem Mann spielerisch gegen die Schulter und sagte mit einem Lächeln: »Danke schön! Du aber auch.«
Hand in Hand gingen sie zum Haus zurück.
Lulu war ins Bett gekrochen, um ein wenig am Handy zu sein. Wenn sie sich unter die Decke legte, konnte sie die Heizung deutlich runterdrehen – gut für die Umwelt, gut für die Stromrechnung.
Sie öffnete TikTok. Das war immer eine gute Ablenkung. Auf diese Weise bekam sie mit, was in der Welt los war – aber in leicht verdaulichen Bruchstücken. Hitzewelle in Zentralafrika. Katzenvideo aus der Mongolei. Ein Muskelaufbau-Challenge aus den USA, ein Mädchen aus Chile sang »Let it go«, das Tierheim Kiel suchte Ehrenamtliche. In Leipzig hatte es eine Explosion gegeben. Der Kälterekord der letzten 24 Stunden war -37,8 Grad nachts um zwei auf dem Brocken. Ein Mädchen aus den USA berichtete von ihrem Autounfall und bat um Spenden. Lulu scrollte weiter und weiter, um die frustrierenden Gedanken zu vertreiben. Bloß klappte das nicht so recht.
Wie sollte es weitergehen – mit ihr, mit der Welt? Wie hatten Anton und Eric es überhaupt rechtfertigen können, ein Kind in diese Welt zu setzen? Lulu hatte keine Suizidgedanken, aber wie würde ihre Zukunft denn bitte aussehen? Entweder verglühte und verdorrte die Erde. Oder irgendwer fing Krieg an. Große Teile der Welt würden unbewohnbar werden und die Menschen von dort mussten auch irgendwohin. Bildung ist der Schlüssel zum Glück, hieß es immer, nur wer brauchte schon Mechatroniker_innen oder Ernäherungswissenschaftler_innen, wenn sowieso alles vor die Hunde ging?
Ihre Geo-Lehrerin hatte ein aktuelles Thema eingeschoben in der Hoffnung, dass die Schüler_innen dann besser aufpassten. Aber Lulu hatte es komplett gefreakt. Möglich, dass der aktuelle Megawinter kein Ausreißer war, sondern der Beginn einer echten Eiszeit. Gletscher-Forschungen zeigten, dass so was in der Vergangenheit schon mal innerhalb von nur zehn Jahren passiert war. Also nicht auszuschließen, dass es dank der Klimakatastrophe schneller ging.
Erfrieren, verbrennen, verdursten, verhungern … so, wie sie es sah, war der Tod nur eine Frage des Wie, nicht des Ob. Und jetzt, wo sie hier war, hatte sie darauf gar keinen Bock. Aber was sollte sie tun? Was brachte ein verdammtes Gewächshaus im Garten, in dem sie hundert Bromelien und drei Bienenvölker vor Kältestress schützten, wenn die ganze Welt unterging?
Eine Nachricht poppte auf. »Hey, was machst du?«
Noah.
Lulu lächelte und begann zu überlegen, was sie antworten sollte.
Berlin, 15:32 Uhr, -16,3 Grad
Janas Zug brauchte nur gut eine Stunde länger als früher, das war nicht immer so. Kurz vor der Einfahrt in den Hauptbahnhof schickte sie Clemens eine SMS: »Bin gleich da.« Ein Fahrer wartete auf dem Parkplatz, weil sie im Auftrag der Bundesregierung reiste.
Zu Clemens’ Haus, der ehemaligen Feuerwache Moabit, war es nicht weit. Es war dicht bewölkt und wurde bereits dunkel. Als Jana vor drei Jahren nach Leipzig gezogen war, verließ sie eine lebendige, internationale Stadt. Heute wirkte Berlin genauso provinziell und mutlos wie alle anderen Orte in Deutschland.
Ihr Handy klingelte. »Ja. Ja, das ist richtig. Ich verstehe. Natürlich müssen Sie das.«
Ihr Vorgesetzter Günther hatte ihre Nummer an die Polizei weitergegeben. Es würde eine offizielle Untersuchung geben, was zum Einsturz der Kaserne geführt hatte. Das war gut, denn nur so ließ sich eindeutig klären, dass sie nicht hatte wissen können, was passieren würde, und dass es weder Absicht noch ein Anschlag gewesen war. Und auch kein besonders genialer multimedialer Präsentationseffekt: Genau in dem Moment, in dem sie vor Materialermüdung durch Kälte warnte, führte diese zu einem Großschaden mit zahlreichen Verletzten.
Müde ließ sie den Kopf sinken. Alexandra lag quer über ihren Schuhen. Jana beugte sich vor und kraulte die Hündin.
»Sind wa da, oda wat?«, raunzte der Fahrer.
»Ja, natürlich, danke.« Sie stieg aus.
Ein paar Meter entfernt öffnete Clemens bereits die Haustür. Jana kam sich ein bisschen vor wie ein einem Weihnachtswerbespot, als sie über das brockige Eis auf das warme Licht zustakste.
»Komm rein«, sagte er. »Schön, dass du da bist. Ich hab was für dich.« Er nahm sie bei der Hand.
Alexandra schnupperte an dem Hundekörbchen im Flur, dann trottete sie hinter ihnen her.
Clemens war barfuß und trug eine Stretch-Cargohose und ein Kurzarmhemd. Im Sommer lief er meist drinnen wie draußen ohne Schuhe herum, für Regentage hatte er hässliche Barfußschuhe. Jana mochte Clemens’ bodenständige Art, aber manchmal war er ihr ein wenig zu naturburschig.
»Wieso frierst du eigentlich nie? Kann ich meine Schuhe noch kurz …«, begann Jana. Ihr war, wie immer, auf dem Weg aus dem Zug zum Auto und dann auf der Fahrt unangenehm kalt geworden.
»Nee, zieh die ruhig mal aus«, sagte Clemens lächelnd und deutete auf einen Küchenstuhl, vor dem eine Plastikwanne stand, aus der Dampf aufstieg.
»Für mich?«, fragte Jana.
»Klar. Du hast mir geschrieben, dass du gleich da bist.«
»Wow«, entgegnete sie mit einem Lächeln.
Clemens nahm Jana ihren Mantel ab. Sie zog Schuhe und Strümpfe aus, krempelte ihre Hose hoch und setzte sich auf den Stuhl. Einen Moment lang hielt sie ihre Füße einfach in den warmen Wasserdampf, dann ließ sie sie langsam in die kleine Wanne gleiten. »Ah! Du bist der Beste!«
Vielleicht war seine lebenspraktisch-rustikale Weltsicht doch nicht so verkehrt.
In dem Kachelofen, den Clemens in die geräumige Wohnküche hatte einbauen lassen, knisterte ein Holzscheit. Erst als sie tief ausatmete und die Arme hängen ließ, bemerkte Jana, wie angespannt sie war. Aufstehen, packen, der Vortrag und dann …
Tränen schossen ihr in die Augen. Ihr, der nüchternen Naturwissenschaftlerin!
»Ist das Wasser zu heiß?«, fragte Clemens. Dieser gute Geist, dieser Idealist, für den immer alles ganz einfach erschien.
Jana lächelte und wischte sich über die Wangen. »Nein, es ist wunderbar. Es ist nur … es war …« Sie setzte neu an, verschluckte sich beinahe, begann zu husten. Clemens trat neben sie und klopfte ihr leicht auf den Rücken. »Ganz ruhig, ist gleich vorbei«, sagte er.
»Es war so schlimm«, sagte Jana dann.
»Der Vortrag? Das kann ich mir nicht …«
»Nein. Es gab ein Unglück. Die Kaserne ist … sag mal, guckst du keine Nachrichten?«
Er schüttelte den Kopf. »Nicht, wenn ich es vermeiden kann. Zieht einen zu sehr runter, und mein Job ist es, das Licht der Hoffnung am Leben zu halten.«
Jana lachte auf. »Schön gesagt. Nein, ich habe meinen Vortrag begonnen, und dann habe ich mit der flachen Hand gegen die Außenwand des Kasernengebäudes geschlagen, so ›patsch‹, als ich sagen wollte, es besteht eine große Gefahr der Materialermüdung. Und dann ist die ganze Wand einfach … ich meine, da ist erst ein Stück rausgebrochen, und dann noch eins, und dann die ganze Wand des Konferenzraums. Mit Generalleutnant Krause, der ist einfach rausgestürzt.« Sie hob beide Hände vor den Mund, schluchzte einmal, fuhr sich dann über die Haare, zupfte nervös an ihrem kranzförmig geflochtenen Zopf. »Er hat mich damals eingestellt, hat das ganze Institut überhaupt erst ins Leben gerufen.«
Clemens war dazu übergegangen, sanft ihre Schultern zu massieren. Er fragte nicht, hörte zu, ließ ihr Raum.
»Dann gingen die Sirenen an, das Gebäude wurde evakuiert, immer mehr Mauerstücke brachen heraus, und aus irgendeinem Grund waren plötzlich die Hunde los, und sie hatten solche Angst, sie bellten und bissen, und dann hat jemand die meisten von ihnen einfach erschossen. Abgeknallt, einfach so. Mit einer Maschinenpistole.« Sie schüttelte den Kopf. »Völlig unnötig. Es wäre doch … es war alles schon schlimm genug, aber dann auch noch das, und man hätte doch … irgendwo hätte man jemand von der Hundestaffel finden können.«
Sie sah hinunter zu Alexandra. Die Hündin hatte es sich neben ihrem Stuhl gemütlich gemacht. Gerade hob sie den Kopf und trank ein wenig Fußbadwasser.
»Ihh!«, machte Jana, dann griff sie in die Tasche nach dem Sender für das Halsband und drückte die Taste für unerwünschtes Verhalten. Alexandra hielt inne, schaute zu Jana auf, zog fast schuldbewusst den Kopf zurück und legte ihn auf den Vorderpfoten ab. Jana streckte die Hand aus und kraulte die Hündin. »Kannst du ja nicht wissen«, sagte sie. »Aber Fußbadessenz ist bestimmt nicht gut für kleine Beagles.«
»Alles biologisch abbaubar«, sagte Clemens.
»Na dann.«
»Das ist ja wirklich … es tut mir leid. Was für eine Geschichte. Vor ein paar Monaten hätte dir das noch kein Mensch geglaubt.«
»Ich habe die halbe Bahnfahrt darüber nachgedacht. Vielleicht hängt es auch mit dem Material zusammen. Die Kaserne in Leipzig ist der letzte große soldatische Funktionsbau aus der DDR-Zeit. Keine Ahnung, möglicherweise der Mörtel, die Ziegel … an irgendwas muss es ja gelegen haben. Ich kann nur …« Sie schloss wieder die Augen.
Clemens küsste sie auf den Scheitel.
»Ich sehe immer wieder vor mir, wie Krause ins Nichts stürzt, und der nächste Wandbrocken gleich hinterher. Er hat mir den Weg geebnet, und ich … Hoffentlich ist er okay.«
Freiburg, 17:30 Uhr, -17,4 Grad
»Ach, was würde ich nur ohne dich machen!« Die alte Dame tätschelte Amelies Hand. »Ich freue mich immer, wenn du kommst.« Sie senkte die Stimme. »Du bist die Netteste von allen. So geduldig. Hast immer Zeit. Und du schneidest das Fleisch in kleinere Stückchen, das kann ich leichter essen.« Sie lächelte zahnlos.
»Das mache ich wirklich gerne«, sagte Amelie und strich sich die langen braunen Haare hinter die Ohren. Die Bezahlung in der Pflege war mies, aber an manchen Tagen machten die Komplimente es wett. An anderen nicht.
Sie zog ihr Handy heraus. Clemens hatte noch nicht geantwortet. Er ließ sich manchmal Monate Zeit, aber irgendwann schrieb er ihr dann doch zurück.
»Meine Tochter hat auch solche Tätowierungen«, sagte Frau Zimmermann und betrachtete Amelies Unterarme. »Aber ich finde das nicht schlimm. Wir hätten uns so etwas natürlich nie getraut. Wie gut, dass die Zeiten sich geändert haben. Manchmal erinnerst du mich an sie.« Ihre Stimme verdunkelte sich. »Leider besucht sie mich so selten.«
Amelie wusste, warum das so war. Frau Zimmermanns Tochter war vor Jahrzehnten nach Australien ausgewandert. Sie meldete sich regelmäßig per Videochat auf der Station und holte Schwiegersohn und zwei Enkel vor die Kamera. Die alte Dame plauderte freundlich mit allen und fragte hinterher Amelie: »Die junge Frau, die mich angerufen hat, war sehr nett – wer ist denn das?«
Amelie kannte Frau Zimmermanns Geschichte ebenso wie die aller anderen Bewohner des Pflegeheims. Ebenso kannte sie die Geschichten ihrer Kolleginnen und Kollegen: Sprücheklopfer Lars, den sein Vater bei schlechten Noten hart geohrfeigt hatte, obwohl das damals schon verboten gewesen war. Die hektische, aber ausgesprochen liebenswerte Stationsleiterin, die bei jedem Dienstplan dieselben Flüchtigkeitsfehler machte. Die muffelige Stellvertreterin mit dem Herz aus Gold. Die geschwätzige und faule Hannah, mit der niemand arbeiten wollte – auch so eine gab es in jedem Team. Brigitte, eine fleißige, leise und zarte Elsässerin, die aus Straßburg pendelte. Sie brachte zwei Kinder allein durch, weil der Mann – immerhin Zahnarzt – keinen Unterhalt zahlte.
Das Geld stimmte hinten und vorne nicht, davon abgesehen war es für Amelie ein Traumjob. Sie wusste, was zu tun war, und sie wusste, warum sie es tat. Sie mochte ihr Team, die meisten jedenfalls, und sie mochte die alten Menschen, um die sie sich kümmerten. Es gab keine Aufgabe, für die sie sich zu fein war, und nach zehn Berufsjahren nichts mehr, was ihr Angst machte oder wovor sie sich ekelte. Das führte dazu, dass Amelie eine große Ruhe und Zuversicht ausstrahlte.
Zudem brauchte sie den Job als Ausgleich, denn ihr Privatleben war völlig auf der Strecke geblieben. Ihren letzten festen Freund hatte sie mit 23 gehabt, den letzten One-Night-Stand vor über zwei Jahren. Bei der Arbeit nahm sie Feiertagsschichten und Überstunden nicht nur aus finanziellen Gründen mit, sondern auch, weil es ihr guttat, beschäftigt zu sein.
Die übrige Zeit kümmerte sie sich um ihre Mutter Ulrike, und wenn sie abends nicht sofort einschlief, fantasierte sie von Clemens.
Amelie zog gerade die Wohnungstür hinter sich ins Schloss und wollte ihre Schuhe abstreifen, da klingelte ihr Handy.
»Wo warst du denn so lange?«, fragte ihre Mutter ohne Vorrede.
Amelie verdrehte die Augen. Sie hängte ihren Rucksack an die Garderobe, die Jacke dazu.
»Ich kann gleich zu dir hochkommen.«
»Das wäre schön.« Aufgelegt.
Amelie ließ den Atem langsam und tief ausströmen, so, wie die Lehrerin im Entspannungskurs es ihr beigebracht hatte.
Sie öffnete die Tür zum Treppenhaus, das ihre Einliegerwohnung mit dem Wohnbereich ihrer Eltern verband. Das Haus war nach dem Tod ihres Vaters viel zu groß für die Mutter, doch Ulrike wollte auf keinen Fall umziehen. Und Amelie hatte auf diese Weise eine kostengünstige – kostenlose – Unterkunft.
Ihre Mutter lag auf dem Sofa. Der Fernseher lief, eine Shopping-Show. Auf dem Couchtisch eine Flasche Wodka. Daneben ein leeres Glas.
»Guck nicht so missbilligend«, mahnte Ulrike streng. »Warte mal ab, bis es dir so geht wie mir. Was du dann sagst.«
Ihre Aussprache war etwas verwaschen. Amelie konnte nicht sagen, ob es am Alkohol lag oder an der Krankheit. Ihre Mutter litt an Arthrose und an starkem Rheuma. Manchmal hatte sie schlimme Schmerzen. An anderen Tagen konnte sie einzelne Gelenke kaum bewegen, mal die Knie, mal die Ellenbogen oder die Finger. Auch die Muskeln, die für ihre früher stets messerscharfe Aussprache zuständig waren, hatte sie nicht mehr ganz unter Kontrolle.
Hundert Mal hatte Amelie vorgeschlagen, ihr einen Platz in einer betreuten Wohnanlage zu besorgen: »Du musst unter Menschen, musst interagieren, brauchst die Anregung.«
Doch ihre Mutter lehnte kategorisch ab. »Niemand möchte mich so sehen. Ich bin ein Wrack!«
Dabei ließ sie sich keineswegs gehen. Jeden Tag kleidete sie sich sorgfältig an, schminkte und frisierte sich. Bei Arztbesuchen trug sie stets eines ihrer alten Kostüme. Wer sie dort sah, konnte sie für eine Steuerberaterin in der Blüte ihres Lebens halten. Höchstens an den leicht verkrümmten Fingern – und an dem bitteren Blick – sah man ihr Leid.
»Was brauchst du denn?«, fragte Amelie.
»Findest du es hier auch so kalt?«
Ulrike lag unter einer dünnen Decke auf dem Sofa, vermutlich schon seit Stunden. Im Raum war es kühl, aber nicht kalt.
Amelie setzte sich auf die Kante des Couchtisches und griff nach der Hand ihrer Mutter, um diese etwas zu massieren.
»Man sitzt nicht auf Tischen!«, sagte die jedoch und reckte den Hals, um an ihrer Tochter vorbei den Bildschirm zu sehen.
Amelie seufzte. »Soll ich die Heizung höher drehen?«
»Bin ich etwa ein Goldesel?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Dann bleibt es, wie es ist.«
»Ich werd’s überleben«, entgegnete die Mutter. »Obwohl ich manchmal hoffe, lieber nicht. Wann gibt es Essen?«
Amelie schloss die Augen. Zu Hause war es genau wie bei der Arbeit, nur wurde sie hier nicht bezahlt und nicht gelobt.
Sie kann nichts dafür, dass es ihr so geht, sagte Amelie sich. Die Schmerzen machen sie so schlecht gelaunt. Sie hat es sich nicht ausgesucht. Sie meint es nicht böse.
Peking, 0:41 Uhr Ortszeit (Zeitzone Berlin: 17:41 Uhr), +2 Grad
Min Zhu Huang ließ sich in das Polster sinken. Er liebte den Geruch frischen Leders, weshalb er den Wagen alle sechs Monate durch einen neuen ersetzte.
»Ist es bequem für dich?«, fragte er Shiyan, seine Nichte, über die Schulter.
»Ja, Onkel«, antwortete diese mit einem Lächeln.
Es war spät. Da sie beide an unerträglicher Schlaflosigkeit litten, hatten sie sich den Abend absichtlich mit anregenden Gesprächen beim Essen vertrieben.
»Das Gong Bao Ji Ding war delikat, nicht wahr?«, fragte er, während sich die Limousine in Bewegung setzte. Hühnchen Kung Pao, wie das Gericht von Touristen genannt wurde, war in der authentischen Zubereitungsart sein Lieblingsgericht.
»Ja, Onkel, ganz ausgezeichnet«, entgegnete Shiyan.
Huang wusste die Essen mit seiner Nichte zu schätzen. Der Austausch mit ihr war stets ein Vergnügen. Ihre Themen waren weit gefächert: klassische Musik, moderne Literatur, wissenschaftliche Fortschritte. Den Bereich der Politik mieden sie, wie alle klugen Chinesen, bei Gesprächen in der Öffentlichkeit.
Die Treffen waren ein Ausgleich für ihn, den er dringend brauchte. Sein Hausarzt mahnte bereits, er müsse auf seinen Blutdruck achten, auf das Cholesterin und das Gewicht. Quacksalber!
Huang musterte sich im Spiegel der Sonnenblende. Ein markantes Kinn, um den Mund ein entschlossener Zug, noch wenig Falten um die Augen und schwarzes, volles Haar.
In der chinesischen Presse galt er als »der begehrteste Junggeselle des Landes«, und das war sicher richtig. Wobei Huang kein Interesse daran hatte, eine feste Beziehung einzugehen. Er hatte es einmal versucht – hatte haben wollen, was seine Eltern gehabt hatten, und was hatte es ihm gebracht? Nichts als Schmerz und Unglück! Nein, da war es besser, dann und wann für Entlastung zu sorgen, sich aber sonst von der Liebe fernzuhalten!
Seine Bindung zu Shiyan, die Wärme, die er für sie empfand, waren mehr als ausreichend für ihn.
Er dachte an seine Herkunft und dass er es bis ganz nach oben geschafft hatte. »Der reichste Mann Chinas« hatte ein internationales Wirtschaftsmagazin ihn genannt, und er hatte sich nicht die Mühe gemacht, zu dementieren. »Der mächtigste Mann im Reich der Mitte« hatte ein anderes geschrieben: Dem hatte er öffentlich und offiziell widersprechen müssen, denn so etwas lasen die Parteiobersten gar nicht gerne.
»Onkel, glaubst du wirklich, bald werden Menschen auf dem Mars leben?«, nahm Shiyan ihr Gespräch aus dem Restaurant noch einmal auf.
Huang nickte. »Sicher. Die Menschen werden alles tun, was technisch möglich ist. Sie werden den Mond besiedeln, den Mars. Sie werden Unterwasserstädte bauen und Luftreinigungskuppeln über Peking, Mumbai und São Paulo errichten. Jedenfalls über den gut situierten Vierteln. Es wird immer jemanden geben, der den Willen und die Mittel mitbringt, die bisherigen Grenzen nicht anzuerkennen. Das ist die menschliche Natur: Wir wollen mehr, immer mehr! Egal, ob du es Kommunismus nennst, Kapitalismus oder wie auch immer.« Er warf einen Blick hinüber zu seinem Chauffeur. Der hielt den Blick auf die Straße gerichtet und verzog keine Miene. Mit einer Aussage wie dieser konnte selbst jemand wie Huang sich heutzutage schon der Partei gegenüber in Misskredit bringen. »Die Menschen sind gierig. Das hat die Natur so angelegt. Diejenigen, die einst am meisten Beeren sammelten, am meisten Tiere erlegten, hatten die besten Überlebenschancen. Es ist in unserem Blut. In dieser Hinsicht sind alle Menschen gleich, glaub mir. Ich arbeite mit Menschen aus allen Kontinenten, aus allen Ländern. Sie alle wollen nur eines: mehr! Also, wenn du mich fragst, meine Kleine: Ja, der Mensch wird den Mars besiedeln, und zwar bald schon. Und er wird viele weitere technische Wunder vollbringen, davon bin ich überzeugt.«
Er schaute über die Schulter nach hinten zu Shiyan, lächelte sie an.
Dann sah er zum Fenster hinaus. Der Business District zog vorbei: das China World Hotel, der CCTV New Office Tower und die Chang’An Avenue, auf der es auch jetzt noch, nach Mitternacht, sehr betriebsam zuging.
Huang hatte längst mehr verdient, als ein Mensch je ausgeben konnte. Warum setzte er sich nicht zur Ruhe? Warum ordnete er nicht mit 62 seine Angelegenheiten und genoss das Leben? Warum flog er um die Welt, setzte sich Zeitverschiebungen und unterschiedlichsten klimatischen Bedingungen aus? Warum überließ er nicht zumindest die Führung seiner Unternehmen den Männern vor Ort, die er handverlesen mit den entsprechenden Aufgaben betraut und auf die er sich unter allen Umständen verlassen konnte?
Die Antwort war genau das, was er eben schon Shiyan gesagt hatte: Gier! Mehr zu haben als zuvor, mehr als andere, mehr als alle, mehr als jeder vor ihm – das war sein Ziel. Warum? Weil er die Möglichkeiten dazu hatte!
Für ihn waren Geld und Besitz kein Selbstzweck. Sie bedeuteten Macht. Sie brachten Möglichkeiten mit sich, die ihm sonst nicht zur Verfügung standen. Je reicher und mächtiger er wurde, desto mehr Menschen waren ihm zu Willen. Desto mehr Menschen taten, was er wollte. Wofür er sie bezahlte.
Je reicher er war, desto weniger Regeln galten für ihn. Und bald wäre es so weit. Wenn der Plan im Tschad aufging und die Mine dort sich als so ergiebig erwies, wie Huang und Gabriel Mamoun, sein Mann vor Ort, es vermuteten – dann käme niemand mehr an ihm vorbei! Alle brauchten, was er hatte. Sie würden ihm alle aus der Hand fressen. Sie würden endlich aufhören, seine »zweifelhaften Methoden« zu kritisieren, sondern einfach zahlen, was er forderte, weil ihnen nichts anderes übrig blieb. Cer, Lanthan, Neodym und Praseodym wurden immer dringender gebraucht für Computerchips und Akkus, und für diesen rasant steigenden Bedarf war es egal, ob man links stand oder rechts, ob man konservativ war oder sozial, grün oder nicht. Alle brauchten seine Rohstoffe, weil sonst ihr lächerliches Leben vor dem Untergang stand. Ohne Seltene Erden keine ausreichenden Stromspeicher für Wind- und Solarenergie, keine Smartphones, keine E-Autos. Dann drohte, was sie alle so sehr fürchteten und was niemand offen aussprach: der Absturz ins Elend, der Kampf aller gegen alle. Eine hochtechnisierte Welt konnte acht, neun, zehn Milliarden Menschen ernähren. Eine Welt ohne Huangs Rohstoffe nicht.
Sie würden ihn nicht lieben, aber sie würden so tun, als ob. Das war eigentlich sogar besser, weil echte Liebe versiegen konnte, gekaufte Liebe nie.
Sie erreichten die Tiantan Residence