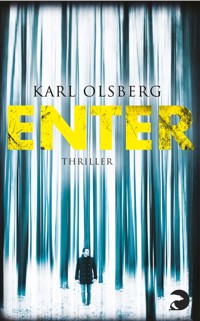
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Berlin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Stromausfall in ganz Berlin ist Auftakt einer Anschlagserie - eine unbekannte Aktivistengruppe namens NTR kämpt gegen die zunehmende Versklavung des Menschen durch Technik. Hauptkommissar Eisenberg und seine Sonderermittlungsgruppe Internet sollen das Landeskriminalamt unterstützen, doch der zuständige Fahndungsleiter hält wenig von der SEGI und ihren ungewöhnlichen Methoden. Als dann ein führender Computerwissenschaftler ermordet wird, verbittet er sich jede Einmischung. Und während weitere Anschläge geschehen und die Hintergründe des Mordes immer mysteriöser werden, fällt ein dunkler Schatten auf das SEGI-Team … Internetterror, künstliche Intelligenz und die illegale Überwachung durch Geheimdienste sind die hochaktuellen Themen, die Olsberg in seinem neuen Thriller einmal mehr zur packenden Story verwebt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.berlinverlag.de
Für Konstantin
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Berlin Verlag erschienenen Buchausgabe1. Auflage 2015
ISBN 978-3-8270-7782-0April 2015Deutschsprachige Ausgabe© Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin 2015Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, MünchenCovermotive: © Tatiana Koshutina/Demurez Cover ArtsDatenkonvertierung: psb, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Berlin Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Stimmen zu »Delete«, dem ersten Teil der SEGI-Serie:
»Grandios! […] Karl Olsberg legt einen brandaktuellen, hochspannenden und toprecherchierten Thriller vor, der zeigt, welchen Beitrag moderne Technik zur Aufklärung von Verbrechen leisten kann.«
Bücher
»Olsberg lässt das Internet lebendig werden.«
NDR
»Eine spannende Mischung aus klassischem Kriminalroman und modernem Computerthriller.«
dpa
»Dieses Buch besticht durch seine gut durchdachte Handlung und seine authentischen, teils tiefgründigen Charaktere. Der Spannungsbogen ist enorm hoch und hält bis zur letzten Seite. Wer also beste Unterhaltung möchte, ist hier genau richtig. Absolut zu empfehlen!«
spass-am-buch.de
Karl Olsberg (geb. 1960) promovierte über Anwendungen künstlicher Intelligenz und wurde mit dem eConomy Award der Wirtschaftswoche ausgezeichnet. Von ihm erschienen u. a. »Das System« und »Der Duft« sowie als Start der aktuellen Serie sein jüngster Technikthriller »Delete«, mit denen er allesamt große Erfolge feierte. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg. Mehr unter: www.karlolsberg.de.
»Doch nun, mit der Aussicht, dass Computer in 30 Jahren die Rechenleistung eines menschlichen Gehirns erreichen, drängt sich mir ein neuer Gedanke auf: dass ich vielleicht dabei bin, Werkzeuge zu schaffen, mit denen eine Technologie konstruiert werden kann, die unsere Spezies ersetzen könnte. Wie ich mich dabei fühle? Sehr unwohl.«
Bill Joy, Gründer der Computerfirma Sun Microsystems und Entwickler der Programmiersprache Java, im April 2000
Prolog
Das Wesen liegt friedlich da, während die flachen Strahlen der aufgehenden Sonne seine Eingeweide wärmen. Allmählich beschleunigt sich der Rhythmus seines Stoffwechsels. Immer mehr der winzigen Transportzellen gleiten durch seine Adern, jede mit ihrem eigenen Ziel, doch in ihrer Summe folgen sie einem immer gleichen Muster. Währenddessen übertragen Myriaden Nervenbahnen elektrische Impulse, synchronisieren den Rhythmus der Organe, steuern, koordinieren und kontrollieren die Aktivität seiner Zellen. Manche sterben, andere entstehen neu – für das Wesen eine kaum merkliche Veränderung seines Körpers, unbedeutend in ihrer Wirkung auf das Ganze.
Nicht immer lag das Wesen so ruhig. Es gab Zeiten, da erbebte sein Körper unter den Schlägen seiner Feinde. Es erlitt schwerste Verletzungen, wurde verstümmelt, eingeschnürt, litt Hunger und Durst, wurde hinter Mauern eingesperrt. Doch es überlebte, trotzte der Zeit, erholte sich, heilte seine Wunden, blühte auf. Es war nie eine Schönheit, jetzt aber pulsiert es vor Energie und Lebenswillen wie kaum ein anderes seiner Art. Es ist alt und hat doch die Kraft und die Ideen der Jugend, während es seine Narben voller Stolz trägt.
Nachdem an diesem schönen Tag Ende Mai die Sonne den Zenit überschritten hat, nimmt die Intensität seiner Nervenimpulse zu. Sie konzentrieren sich immer mehr auf eine Region seines Körpers, die nur selten im Zentrum der Aufmerksamkeit liegt. Doch wenn dies geschieht, dann kann der winzige ovale Fleck, nicht mehr als ein Muttermal auf einem Zipfel seiner Haut, das ganze Wesen in einen Zustand der Ekstase, ja der blinden Raserei versetzen. Dann stockt der Strom der Zellen in ihren Bahnen, der Stoffwechsel verlangsamt sich, doch die Nerven glühen vor Erregung.
Die Zellen aber, die sich der Tatsache, nur ein winziger Teil des Wesens zu sein, nicht bewusst sind, starren wie hypnotisiert auf den ovalen Fleck. Sie beschäftigt in diesem Moment nur eine Frage: Wird die Hertha doch noch den Klassenerhalt schaffen?
1.
»Wo bleibt Ramos? Wenn sich die Hertha noch auf den Relegationsplatz retten will, muss er jetzt ein Tor machen!« Die Stimme des Fernsehkommentators klang angespannt, so als sei er doch ein verkappter Fan und nicht der neutrale Beobachter. Aber vielleicht war es auch nur Mitleid mit dem Außenseiter in dieser Partie. »Die Statistik der letzten fünfzehn Spiele zeigt, dass die Hertha nur gewinnt, wenn Ramos trifft. Doch der Kolumbianer scheint am Spielgeschehen kaum teilzunehmen, hatte bisher fast keinen Ballkontakt.«
Jaap Klausen fuhr sich nervös durch sein kurzes, schwarzes Haar. Und auch sonst waren die Gesichter in der überfüllten Kneipe in Prenzlauer Berg bleich und bedrückt. Niemand sprach, während die Uhr die letzten Minuten des Spiels heruntertickte. Dabei hatte es zu Beginn der Partie noch so gut ausgesehen: Mit ein paar druckvollen Kombinationen, die ihnen selbst die eigenen Fans nicht zugetraut hätten, hatten die Berliner den Gast aus Dortmund überrascht. Und dann hatte Baumjohann das Ding in der 22. Minute aus dreißig Metern unter die Latte gesetzt. Die Kneipe hatte gekocht, während Jaap seinen alten Freund Daniel Lütten umarmt und ihm spontan ein Bier ausgegeben hatte.
Doch die Dortmunder waren viel zu abgebrüht, um sich durch den frühen Rückstand aus dem Konzept bringen zu lassen, und sie waren nicht nur nominell die klar bessere Mannschaft. Kurz vor der Halbzeit hatten sie den Ausgleich geschafft. In der zweiten Hälfte war das Spiel dann endgültig gekippt und hatte fast ausschließlich in der Berliner Hälfte stattgefunden. Obwohl die Abwehr ihr Bestes gab und Torwart Kraft zwei Glanzparaden zeigte, konnte sie dem Druck nicht standhalten und kassierte in der 68. Minute den zweiten Gegentreffer. Seitdem schien der Siegeswille der Heimmannschaft erloschen. Sofern die Spieler in Blau-Weiß überhaupt an den Ball kamen, droschen sie ihn meist unkontrolliert in Richtung des Dortmunder Tors, von wo ihn die Verteidiger sofort wieder zurück in die Hertha-Hälfte beförderten. Es war zum Verzweifeln!
»Wirklich, wo bleibt Ramos?«, stöhnte Daniel.
»Maul halten!«, motzte ein breitschultriger Typ mit tätowiertem Hals neben ihm.
Daniel wollte etwas entgegnen, doch Jaap legte ihm die Hand auf den Arm. In der angespannten Stimmung konnte jede kleine Meinungsverschiedenheit leicht außer Kontrolle geraten.
»Die Dortmunder erhöhen noch einmal den Druck«, erklang es von der Leinwand. »Sie scheinen entschlossen, kurz vor dem Abpfiff Nägel mit Köpfen machen zu wollen. Großkreutz zu Sahin … Lewandowski … Lewandowski!! Doch da geht van den Bergh noch mal dazwischen … nimmt sich den Ball … ein langer Pass nach rechts außen, wo Ramos fast allein steht …«
Jaap spürte, wie die Angst und Frustration der Umstehenden noch einmal in Hoffnung umschlug. Noch war es nicht zu spät! Noch war der Ausgleich möglich, um den einen, rettenden Punkt zu holen! Atemlos beobachtete er, wie der Stürmer den Ball annahm und auf das gegnerische Tor zurannte. Zwei Verteidiger stürzten ihm entgegen. Doch irgendwie gelang es dem Kolumbianer, zwischen den beiden hindurchzudribbeln. Ein Raunen ging durch die Kneipe. Jetzt stand nur noch der Dortmunder Keeper zwischen Ramos und dem Relegationsspiel. Jaap ballte die Fäuste.
»Ramos!«, rief der Kommentator, der seine Sympathie nicht mehr verbergen konnte. »Nur noch wenige Meter vor dem Tor … Perfekte Schussposition …«
Das Fernsehbild wurde schwarz.
Ungläubig starrte Jaap auf die Leinwand, während sich ringsum Stimmengewirr erhob, das rasch zu einem wütenden Gebrüll anschwoll.
»Ey, was soll das?«
»So eine Scheiße!«
Erst nach einem Moment fiel Jaap auf, dass auch die Deckenbeleuchtung ausgefallen war und nur noch durch die Fenster Licht hereindrang. Offensichtlich war eine Sicherung rausgesprungen. Ausgerechnet jetzt!
»Mach den scheiß Fernseher wieder an!«, brüllte jemand. Andere schlossen sich lautstark an.
»Ich hab kein Netz!«, rief Daniel, der offensichtlich anders herauszufinden versuchte, ob Ramos getroffen hatte oder nicht.
Jaap checkte sein Smartphone. Tatsächlich: Weder WLAN noch Mobilfunkverbindung waren verfügbar. Inzwischen heizte sich die Stimmung weiter auf. Ein Pulk wütender Männer hatte sich um den Tresen gruppiert, hinter dem ein geschockter Wirt versuchte, seine Gäste zu beschwichtigen.
»Mach sofort das Ding wieder an, sonst …«
»So ein Scheißladen!«
»Ich will mein Geld zurück!«
»Hört doch mal zu!«, rief der Wirt, ein junger Mann mit südländischem Aussehen, jedoch ohne Akzent. »Ich kann doch nichts dafür! Der Strom ist ausgefallen!«
»Dann dreh die Sicherung wieder rein, du Spacko!«
»Bei drei ist die Kiste wieder an, oder ich hau hier alles kurz und klein!«
»Beruhigt euch mal!«, schaltete sich Jaap ein und hielt sein Smartphone hoch. »Die Netzverbindung ist auch weg! Offensichtlich ist im ganzen Viertel der Strom ausgefallen. Da kann man nichts machen!«
Einige Männer zogen ihre Handys hervor. Doch der stämmige Typ mit den Hals-Tattoos wandte sich zu ihm um und blickte ihn finster an. »Was mischst du dich hier überhaupt ein, du Wurm?«, sagte er mit schleppender, aber nichtsdestotrotz aggressiver Stimme.
Jaap unterdrückte seinen aufkeimenden Zorn, hob die Hände und rang sich ein Lächeln ab. »Schon gut! Ramos hat bestimmt getroffen. Aus der Entfernung kann er ja kaum …«
Doch die Miene des Mannes verfinsterte sich weiter. Seine Augen waren blutunterlaufen, und Jaap konnte riechen, dass er deutlich mehr intus hatte als nur ein paar Bier. »Sag mal, biste ’n verfickter Hellseher oder was?«
»Okay, okay. Jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder. Es ist bloß ein Stromausfall!«
»Tickste nicht richtig? Nur ’n Stromausfall? Genau im Moment, wo Ramos schießt? Willste etwa behaupten, das ist Zufall?«
Jaap wusste nicht, was er darauf antworten sollte.
»Ich sag dir, was das ist«, fuhr der Typ fort. »Das ist Beschiss! Die wollen nicht, dass wir sehen, wie Ramos im letzten Moment gefoult wird! Und der verkackte Schiedsrichter nicht pfeift! Ist doch ein abgekartetes Spiel! Erst bestechen sie Ramos, dass er nicht trifft, und dann foulen sie ihn! Die wollen uns bloß fertigmachen!«
Das Gestammel des Typen war an Unlogik kaum zu überbieten, aber das schien die Umstehenden wenig zu kümmern.
»Echt? Ramos gefoult?«, rief jemand.
»So eine Sauerei!«
»Und kein Elfer!«
»Beschiss!«
Jaap hob verzweifelt die Arme. »Das ist doch Unsinn!«, rief er. »Niemand hat Ramos gefoult!«
»Ey, woher willst ’n du das wissen?«, rief ein Typ mit Glatze.
»Ja, genau, woher weißt du das?«, stimmte ein anderer zu.
»Ich weiß es nicht!«, rief Jaap. »Niemand hier weiß, wie das Spiel ausgegangen ist! Weil nämlich der Strom ausgefallen ist und keiner Handyempfang hat.«
»Wenn du’s nicht weißt, warum mischst du dich dann ein?«
»Genau!«, rief der Tätowierte. »Willst doch bloß, dass keiner mitkriegt, was hier gespielt wird! Bist wohl einer von denen! Miese Dortmund-Zecke!«
»Hör mal, ich bin genauso Berliner wie du, und …«
Doch der Typ war Argumenten gegenüber offensichtlich nicht mehr zugänglich. Er packte Jaap mit der Linken am Kragen seiner Jacke und holte mit der rechten Faust aus.
»Du kriegst jetzt …«
Jaap machte eine blitzschnelle Drehung und nutzte den Schwung des Angreifers, um dessen Schlagarm zu packen und ihm auf den Rücken zu drehen, so dass der Tätowierte vornübergebeugt vor Schmerz schrie. Umstehende sprangen erschrocken zur Seite, Biergläser zerschellten am Boden.
»Schluss jetzt!«, rief Jaap. »Ich bin Kriminalkommissar Jaap Klausen. Wenn du noch einen Mucks machst, verhafte ich dich wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses und Widerstands gegen einen Polizeibeamten. Kapiert?«
»Ja, ja, schon gut«, stöhnte der Mann. »Wusste ja nicht, dass du ’n … ich meine, dass Sie von der Polizei sind.«
Jaap ließ seinen Arm los. »Ihr geht jetzt alle nach Hause und schaut im Internet, wie das Spiel ausgegangen ist! Jeder, der weiter hier rumpöbelt, kriegt es mit mir zu tun, kapiert? Aber vorher bezahlt ihr noch eure Rechnungen!«
Einige murrten, doch die meisten folgten Jaaps Ansage. Sogar der Tätowierte zog sein Portemonnaie hervor und legte einen Zwanziger auf den Tresen. Allmählich leerte sich der Laden.
Als Jaap mit dem Bezahlen an der Reihe war, hob der Wirt abwehrend die Hand. »Dein Bier geht aufs Haus! Wenn du nicht gewesen wärst …«
»Okay, danke.«
»Ich hab zu danken! Das war knapp!«
»Ist aber auch echt Mist, dass ausgerechnet in diesem Moment der Strom ausfallen musste!«, kommentierte Daniel. »Gerade wo’s am spannendsten war. Man könnte wirklich glauben, das war Absicht!«
»Jetzt fang du nicht auch noch an!«, erwiderte Jaap. »Lass uns lieber zusehen, dass wir rauskriegen, wie es ausgegangen ist.«
Vor der Kneipe herrschte Chaos. Die Straße war verstopft, Autos hupten; offenbar war es in der Nähe zu einem Unfall gekommen, als die Ampeln ausfielen. Leute standen diskutierend auf den Bürgersteigen. Jaap sprach einen Mann an, der gerade aus einem Haus kam.
»Entschuldigen Sie, wissen Sie, wie das Spiel ausgegangen ist?«
»Welches Spiel?«
Sie fragten weiter, doch niemand schien Näheres zu wissen. Nur eine Dame in den Sechzigern mit grauen Locken schimpfte lautstark darüber, dass ihr Fernseher genau in dem Moment ausgefallen sei, als der überbezahlte Faulpelz Ramos endlich die Chance gehabt hatte, etwas für sein Gehalt zu tun. Ansonsten war die Stimmung entspannt, beinahe heiter wie bei einem Volksfest. Der Stromausfall war ein ungewöhnliches, aber kein beängstigendes Ereignis. Er brachte Menschen dazu, miteinander zu reden, die sich sonst aus dem Weg gingen. Alle waren sich einig, dass das marode Berliner Stromnetz, das von einem privaten Unternehmen betrieben wurde, schuld an der Sache war. Ein Volksentscheid zum Rückkauf des Netzes durch die Stadt war erst kürzlich knapp gescheitert.
Auch die U-Bahnen fuhren nicht. So blieb Jaap nichts anderes übrig, als die knapp vier Kilometer bis zu seiner Wohnung in Friedrichshain zu laufen. Er verabschiedete sich von Daniel, der in der Nähe wohnte.
»Ruf mich an, wenn du weißt, wie’s ausgegangen ist«, sagte sein Freund.
»Umgekehrt auch. Sobald das Handynetz wieder geht.«
»Es gibt ja noch Festnetz.«
»Das braucht auch Strom.«
»Ich dachte, Festnetz geht auch ohne. Früher die alten Wähltelefone hatten doch gar keinen Stromanschluss.«
»Ja, aber heute ist das doch längst alles digital. Und ohne Strom funktionieren auch die Verteiler nicht.«
»Wie auch immer, ruf mich an, sobald du kannst.«
»Mach ich.«
Als er eine knappe Stunde später seine Wohnung erreichte, gab es noch immer keinen Strom. Offensichtlich war die Energieversorgung der ganzen Stadt ausgefallen. Jedenfalls hatte Jaap auf dem Weg hierher überall dasselbe Bild gesehen: gestikulierende Menschen, hupende Autofahrer, hin und wieder ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr oder Polizei, das sich mit Blaulicht und Martinshorn einen Weg durch die verstopften Straßen bahnte.
Sein Laptop hatte einen vollen Akku, doch auch die DSL-Internetverbindung war tot. Schließlich klingelte er bei den Nachbarn, einer rumänischen Familie mit zwei kleinen Kindern, deren junge Mutter die Tür öffnete.
»Entschuldigung, aber haben Sie zufällig ein Radio?«
»Radio? Ja, wir haben Radio. Aber geht nicht, Strom kaputt.«
»Ich meinte, eins mit Batterie. So ein kleines zum Mitnehmen.«
»Nein, ich glaube nicht. Haben wir Handy zum Musikhören.«
»Vielen Dank!«
»Sie haben Auto? Dann vielleicht können Radio hören in Auto!«
Jaap unterdrückte den Impuls, sich an die Stirn zu schlagen. »Eine gute Idee, danke!« Er ging zurück in seine Wohnung, holte den Autoschlüssel und lief in die Seitenstraße, in der er mühsam einen Anwohnerparkplatz ergattert hatte. Die Straßen waren immer noch verstopft, aber er wollte ja nicht wegfahren. Er setzte sich in den silbergrauen 3er-BMW und schaltete das Radio ein. Der Sender, den er normalerweise hörte, verbreitete nur Rauschen. Auch viele der anderen Radiostationen schienen ausgefallen zu sein. Nur die öffentlich-rechtlichen Sender funktionierten.
»… auf das gesamte Stadtgebiet. Ein Sprecher des Energieversorgers sagte, die Ursache für den Ausfall sei noch unbekannt, man arbeite mit Hochdruck an einer Lösung.«
Über das Spiel wurde natürlich jetzt, über eine Stunde nach dem Abpfiff, nicht mehr gesprochen. Jaap musste bis zu den 19.00-Uhr-Nachrichten warten, in denen noch einmal ausführlich über den flächendeckenden Stromausfall berichtet wurde – das schwerwiegendste Ereignis dieser Art in Berlin seit der Wende. Dann endlich kam der Sprecher zum Sport: »Im Abstiegskampf hat sich Hertha BSC heute gegen Dortmund einen wichtigen Punkt erkämpft und beendet die Saison auf Tabellenplatz 16. Bei einem Sieg im Relegationsspiel gegen St. Pauli wäre der Abstieg abgewendet. Das Tor zum Ausgleich in der 89. Minute schoss Ramos. Während mehrerer Public-Viewing-Veranstaltungen kam es zu Ausschreitungen durch wütende Fans, weil die Übertragung durch den Stromausfall unmittelbar vor dem entscheidenden Tor unterbrochen wurde. Die Polizei musste einschreiten und nahm mehrere Randalierer fest.«
Jaap schaltete das Radio aus und kehrte gut gelaunt wieder in seine Wohnung zurück. Was war schon ein läppischer Stromausfall gegen den Klassenerhalt? Jedenfalls würde er dieses Spiel so schnell nicht vergessen.
2.
»Und dann hat er mich gefragt, ob ich am Wochenende mit ihm nach Stralsund fahren möchte. Er hat da anscheinend eine Datsche. Stell dir das mal vor! Der Typ ist über fünfzig! Das ist doch echt … Claudia? Hörst du mir überhaupt zu?«
Claudia Morani blickte von ihrer halb leeren Cappuccinotasse auf. »Wie bitte? Entschuldige, ich war in Gedanken.«
Adrienne sah sie skeptisch an. »Das glaub ich jetzt nicht! Ich erzähl dir hier im Vertrauen, wie ich von meinem Abteilungsleiter angebaggert werde, und das interessiert dich überhaupt nicht?«
»Doch, schon.«
»Erzähl mir keinen Quatsch! Ich langweile dich!«
»Tust du nicht, Adrienne, ehrlich. Ich bin froh, mal rauszukommen.«
»Aber du bist nicht wirklich hier!«
»Doch, bin ich. Also, was hast du ihm geantwortet?«
Adrienne grinste schief. »Ach komm, tu doch nicht so, als ob du das wirklich wissen willst!«
Claudia seufzte. »Tut mir leid. Es fällt mir nun mal schwer, einfach so zu plaudern.«
»Klar, weil es nichts gibt, worüber du plaudern könntest. Du lebst nur für deine Arbeit und für deine Mutter. Was dir fehlt, Claudia, ist ein Mann in deinem Leben.«
Claudia unterdrückte ein Schnauben. Das Letzte, was sie brauchte, waren noch mehr Komplikationen.
»Danke, aber ich bin ganz zufrieden, so wie es ist.«
»Zufrieden vielleicht, aber bist du glücklich?«
»Bist du es denn?«
»Herrgott, nein! Ich hab dir doch vorhin erzählt, dass Timo … ist ja auch egal. Ich war jedenfalls schon glücklich. Schon oft. Wenn man glücklich ist, wird man auch mal wieder unglücklich, das ist eben so. Aber wenn man nichts riskiert, verpasst man eine Menge im Leben.«
Claudia zuckte nur mit den Schultern. Verglichen mit ihrer eigenen Vorstellung von einem erfüllten Leben hätte Adriennes Sicht unterschiedlicher nicht sein können. Ihre Freundin suchte immer noch ihren Märchenprinzen, fand aber an jedem, den sie nach zwei Drinks ins Bett zerrte, schon am nächsten Morgen irgendetwas auszusetzen. Sie stürzte sich von einem Abenteuer ins nächste, lachte viel, weinte ebenso oft. Es war offensichtlich, dass sie im Grunde ihres Herzens zutiefst einsam war – und es auch immer bleiben würde, wenn sie nicht bereit war, ihre romantischen Fantasien über Bord zu werfen und sich wirklich auf eine Beziehung einzulassen. Aber Claudia war nicht hier, um Adrienne zu therapieren. Sie hatte Psychologie studiert, doch die Schwierigkeiten, derentwegen Menschen wie Adrienne zum Psychologen gingen, erschienen ihr trivial. Sie wollte der Gesellschaft auf andere Weise helfen – indem sie die wahren Problemfälle identifizierte, Menschen, die echten Schaden anrichteten, die niemals von selbst zu einem Psychologen oder Psychiater gehen würden, obwohl sie es dringend nötig hatten. Deswegen war sie Profilerin bei der Polizei geworden.
Es gab so viele Menschen mit unentdeckten psychischen Problemen. Die meisten kämpften im Stillen mit ihren Schwierigkeiten, verloren ihren Job, landeten irgendwann auf der Straße, nahmen Drogen oder wurden Alkoholiker. Einige rissen Menschen aus ihrem Umfeld mit in den Abgrund, die ihnen vertrauten oder von ihnen abhängig waren. Andere wurden kriminell, einige wenige gar zu Mördern – so wie der, den Claudias Einheit beim Landeskriminalamt, die Sonderermittlungsgruppe Internet, vor ein paar Monaten in einer nervenaufreibenden Jagd gestellt hatte. Nur in der Minderheit der Fälle wurde die Krankheit rechtzeitig erkannt, so dass die Abwärtsspirale gestoppt und die Betroffenen wieder stabilisiert werden konnten. Zwar waren die meisten psychischen Leiden nicht heilbar, aber man konnte die Symptome mit Medikamenten bekämpfen und so vielen Menschen ein halbwegs normales Leben ermöglichen. Menschen wie ihrer Mutter.
Obwohl sie nun seit sieben Jahren in Berlin lebten und es in dieser Zeit nur ein paar harmlose Aussetzer, aber keinen einzigen echten Anfall von Paranoia mehr gegeben hatte, fühlte sich Claudia immer noch nicht wohl dabei, ihre Mutter allein zu lassen. Natürlich war es nicht anders machbar, wenn sie zur Arbeit ging. Aber die Wochenenden verbrachte Claudia normalerweise zu Hause. Ihre Mutter ging nicht gern aus dem Haus, also unterhielten sie sich, spielten Gesellschaftsspiele oder sahen fern. Es waren langweilige Wochenenden, jedenfalls nach Adriennes Maßstäben. Aber nach all den Jahren der Angst, die Claudia als Kind erlebt hatte, ständig auf der Flucht vor unbekannten Gefahren, erschien ihr diese beschauliche, ereignislose Normalität immer noch wie ein Segen. Daher hatte sie nur zögerlich zugestimmt, als Adrienne sie überreden wollte, mit ihr am Samstag shoppen zu gehen.
»So, wie du rumläufst, wirst du nie einen Mann kriegen!«, hatte ihre Freundin gesagt, die bei der Spurensicherung des Landeskriminalamts arbeitete. »Du brauchst dringend was Neues zum Anziehen!«
Aus irgendeinem Grund, den sie selbst nicht genau verstand, hatte Claudia diese Bemerkung verletzt. Es stimmte, sie zog sich gern klassisch an: dunkle Farben, die gut zu ihren langen, schwarzen Haaren passten, enge, schnörkellose Schnitte. Sie hatte immer gedacht, ihr Stil sei elegant. Adrienne allerdings nannte ihn unscheinbar und langweilig.
»Probier’s doch wenigstens mal aus!«, hatte ihre Freundin gefordert, und Claudia hatte schließlich zugestimmt, halb, um ihr einen Gefallen zu tun, halb aus Neugier. Vielleicht fand sie ja tatsächlich etwas, das ihr gefiel und ein bisschen mehr Farbe in ihr Leben brachte.
Nun saßen sie hier in einem Café in der Friedrichstraße, umgeben von Einkaufstüten, die mit Adriennes Beute gefüllt waren. Claudia hatte sich nur einen dunkelgrauen Cashmerepullover gekauft, ein Sonderangebot, worüber Adrienne die Augen gerollt hatte.
»Sag mal, weißt du eigentlich, dass du verdammt gut aussiehst?«, sagte Adrienne nach einem Moment des Schweigens. »Ich wünschte, ich hätte dein glattes Haar und deine langen Wimpern. Und dann erst diese Lippen! Nur ein bisschen Lidschatten und Lippenstift, und die Männer liegen dir zu Füßen. Ich dagegen hab diese Strubbelhaare, mit denen ich selbst nach dem Frisör aussehe, als käme ich gerade aus einem Unwetter. Und meine Lippen hab ich mir schon zweimal machen lassen. Nach dem ersten Mal sah ich aus wie Daisy Duck, das zweite Mal war für die Schadensbegrenzung.«
Claudia lächelte. »Wenn du so hässlich wärst, wie du behauptest, würde dich doch wohl kaum ein Kriminaldirektor übers Wochenende nach Stralsund einladen!«
»Das ist es ja, ich krieg immer nur die alten Säcke und Loser ab!«
»Timo war keins von beiden.«
»Ach, hör mir auf mit Timo!« Adriennes Blick verdüsterte sich, und Claudia tat es augenblicklich leid, das Thema ihres Verflossenen angesprochen zu haben.
»Entschuldige, Adrienne. Ich wollte nicht …«
»Schon gut. Ich bin froh, dass ich den Idioten los bin.« Adrienne musterte ihre Freundin über den Rand ihrer Sonnenbrille hinweg. »Sag mal, wie lange ist es eigentlich her, dass du zum letzten Mal Sex hattest?«
Claudia verschluckte sich fast an ihrem Kaffee.
»Ich wüsste wirklich nicht, was dich das angeht!«
»Dachte ich’s mir doch!« Sie runzelte die Stirn. »Aber du hast doch schon mal …? Oder bist du etwa immer noch Jungfrau?«
Jetzt war es aber genug!
»Nicht ich bin es, die hier ein Problem hat, Adrienne!«
Claudia bereute den Satz in dem Moment, in dem sie ihn aussprach. Adrienne starrte sie erschrocken an.
»Was willst du damit sagen?«
»Ach, nichts. Vergiss es! Ich hab nur keine Lust, hier in aller Öffentlichkeit mit dir über mein Sexleben zu diskutieren.«
»Da gibt es ja offensichtlich auch nicht viel, worüber man diskutieren könnte.«
Claudia sah auf die Uhr.
»Ich glaube, ich muss langsam los.«
»Entschuldige!« Adrienne wirkte zerknirscht. »Ich bin zu weit gegangen. Tut mir leid.«
Anstatt etwas zu erwidern, sah sich Claudia abrupt um.
»Was ist denn?«, fragte ihre Freundin.
»Ich weiß nicht. Irgendwas ist passiert.«
»Was soll denn passiert sein?«
Sie konnte es nicht genau bestimmen, aber sie spürte, dass sich in ihrer Umgebung etwas verändert hatte. Es war wie eine Erschütterung, nur nicht körperlich. War der Tonfall der Gespräche an den Nachbartischen auf einmal anders? War der Fluss des Verkehrs langsamer geworden? Eine seltsame Unruhe befiel Claudia. Dann durchzuckte sie ein schrecklicher Gedanke: War dieses seltsame Gefühl die erste Vorstufe einer aufkeimenden Paranoia? Hatte sie das defekte Gen ihrer Mutter geerbt? Brach die Krankheit in diesem Augenblick zum ersten Mal aus?
»Lass uns reingehen und zahlen!«, bat sie.
»Okay.«
Im Inneren des Cafés war es ungewöhnlich düster. Der Mann hinter der Kasse zuckte nur mit den Schultern.
»Tut mir leid, aber der Strom ist ausgefallen. Die Kasse funktioniert gerade nicht.«
Erleichterung durchflutete Claudia. Das also war es, was sie unbewusst wahrgenommen hatte. Es war nicht bloß Einbildung gewesen, dass sich etwas verändert hatte.
»Heißt das, wir müssen nicht bezahlen?«, fragte Adrienne.
So etwas wie Panik trat in die Augen des sichtlich mit der Situation überforderten Mannes.
»Doch, doch, natürlich. Was hatten Sie denn?«
»Zwei Cappuccino und ein Stück Zitronenkuchen.«
Der Mann kritzelte eine Weile auf einem Zettel herum.
»Das macht dann zwölf fünfzig, bitte«, sagte er, als sei er sich seiner Sache nicht ganz sicher.
Claudia holte ihr Portemonnaie hervor, doch Adrienne winkte ab. »Ich mach das. Als kleine Entschuldigung für meine Bemerkung gerade.«
Claudia protestierte nicht. Sie wusste, wie wichtig solche kleinen Gesten der Großzügigkeit für eine Freundschaft sein konnten.
Als sie wieder auf die sonnendurchflutete Straße hinaustraten, hatte sich die Stimmung deutlich spürbar verändert. Autos hupten, Menschen diskutierten oder tippten hilflos auf ihren Smartphones herum. Erschrocken holte Claudia ihr eigenes Handy hervor. Kein Empfang. Dabei hatte sie ihrer Mutter versprochen, jederzeit erreichbar zu sein! Ihr Puls beschleunigte sich.
»Ich bin wirklich spät dran«, sagte sie. »Vielen Dank für den Cappuccino!«
»Gern geschehen. War schön, mit dir zu shoppen.«
»Ja, fand ich auch. Können wir ja mal wieder machen.«
»Das klingt nicht so, als hättest du wirklich Lust.«
»Tut mir leid, aber ich bin ein bisschen nervös. Meine Mutter … mein Handy geht nicht, und …«
»Deine Mutter ist erwachsen. Die kommt schon klar, auch wenn mal der Strom ausfällt.«
Claudia zuckte innerlich zusammen.
»Meinst du etwa, das ganze Stadtgebiet ist betroffen?«
»Woher soll ich das wissen?«
»Egal. Also, Tschüss!«
»Hey, warte! Vergiss die Tüte mit deinem mausgrauen Pullover nicht!« Sie grinste.
Claudia bemühte sich um ein Lächeln. Sie schnappte sich die Tüte, winkte noch einmal zum Abschied und hastete zur U-Bahn. Doch die Station war nur von einer Notbeleuchtung erhellt, die Anzeigetafeln schwarz.
Also ein Taxi. Mit zunehmender Verzweiflung sah sie sich um. Immer mehr Leute kamen aus den Häusern auf die Straße. Der Verkehr auf der Friedrichstraße war weitgehend zum Erliegen gekommen. Autos hupten, Fahrer gestikulieren. Ein Taxi war weit und breit nicht in Sicht.
Kalter Schweiß brach aus ihren Poren. Was, wenn tatsächlich auch im Süden der Stadt der Strom ausgefallen war? Durchaus denkbar, dass ein solches Ereignis bei ihrer Mutter Verunsicherung und Angst auslöste, vielleicht sogar einen Anfall. Und ausgerechnet jetzt war Claudia nicht erreichbar! Sie musste so schnell wie möglich nach Hause. Aber wie?
Sie zwang sich, die Lage nüchtern zu betrachten. Wenn der Strom auch im Süden ausgefallen war, konnte sie die öffentlichen Verkehrsmittel vergessen, und ein freies Taxi zu bekommen, wäre wie ein Sechser im Lotto. Also blieb ihr nur, abzuwarten, bis der Strom wieder funktionierte, oder die ungefähr fünfzehn Kilometer bis zur Wohnung ihrer Mutter zu Fuß zu gehen. Es sei denn …
Sie rannte zurück zum Café und blickte sich um. Keine Spur von Adrienne. Doch gerade als sie sich abwenden und den Fußmarsch Richtung Süden antreten wollte, kam ihre Freundin aus einem Modegeschäft. Typisch Adrienne: Während alle Welt über den Stromausfall debattierte, ging sie shoppen.
»Adrienne!«
»Claudia! Ich dachte, du musst unbedingt sofort nach Hause?«
»Muss ich auch. Aber die U-Bahn ist ausgefallen, und ein Taxi ist nicht zu kriegen. Ich dachte, vielleicht …«
»… könnte ich dich nach Hause fahren?«
»Ich weiß, es ist nicht deine Strecke, aber du würdest mir wirklich einen großen Gefallen tun. Ich mache mir Sorgen. Wenn der Strom auch bei uns zu Hause weg ist, weiß ich nicht, was meine Mutter macht.«
»Was soll sie schon machen? Wenn der Fernseher nicht mehr geht, liest sie eben ein Buch.«
»So einfach ist das nicht. Du kennst sie nicht. Sie wird glauben, jemand hat den Strom sabotiert, nur ihretwegen.«
»Echt?«
»Sie ist paranoid-schizophren. Das bedeutet, für sie verschwimmt die Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt. Deshalb hören Schizophrene ihre eigenen Gedanken manchmal als Stimmen, denken, zufällige Ereignisse passierten aus einem bestimmten Grund, der nur mit ihnen zu tun hat, und fühlen sich verfolgt.«
»Ich dachte, sie nimmt Medikamente dagegen?«
»Das tut sie auch. Aber ich habe in den letzten Jahren die Dosis immer weiter reduziert. Die Neuroleptika, die sie nimmt, haben nämlich starke Nebenwirkungen. Ich wollte versuchen, ihr ein möglichst normales Leben zu ermöglichen. Ist bisher auch gut gegangen, aber so ein Stromausfall könnte sie komplett aus dem Gleichgewicht bringen!«
»Hey, du weinst ja! Mach dir keine Sorgen, Claudia. So schlimm, wie du denkst, ist es bestimmt nicht. Wir wissen ja nicht mal, ob der Strom bei euch überhaupt weg ist. Komm, ich parke da hinten.«
»Danke, Adrienne!«
Der Smart ihrer Freundin stand halb auf dem Bürgersteig einer Nebenstraße. Adrienne entfernte schulterzuckend den Strafzettel unter dem Scheibenwischer. Sie drängelte sich in den Verkehr, der nur im Schritttempo voranging.
»So ein Mist! Ich weiß ja nicht, ob du zu Fuß nicht schneller bist«, kommentierte sie.
»Mach mal bitte das Radio an«, erwiderte Claudia.
Auf den meisten Kanälen kam nur Rauschen, was ihre Befürchtungen nur verschlimmerte. Schließlich bestätigte ein Nachrichtensprecher, dass der Strom im gesamten Stadtgebiet ausgefallen war. Über die Ursache wisse man noch nichts, der Energieversorger arbeite mit Hochdruck an der Lösung. Man solle am besten zu Hause bleiben, da die öffentlichen Verkehrsmittel ausfielen und die Straßen verstopft seien.
»Erzähl mir was Neues!«, rief Adrienne. Die Kreuzung vor ihnen war durch einen Unfall blockiert. In einem abenteuerlichen Manöver fuhr sie mit ihrem Kleinwagen über den Bürgersteig, an der Unfallstelle vorbei und in eine Seitenstraße. Doch auf der nächsten Straße Richtung Süden war die Situation nicht besser.
Adrienne ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie drängelte und quetschte sich durch Lücken. Einmal überholte sie auf dem Bürgersteig sogar einen Polizeiwagen, der mit Blaulicht im Verkehrschaos feststeckte. Die Beamten starrten sie entgeistert an. Adrienne grinste nur.
»Meinst du nicht, das gibt Ärger?«, fragte Claudia besorgt. »Ich bin sehr dankbar, dass du mir hilfst, aber du musst dafür nicht deinen Führerschein aufs Spiel setzen!«
»Ach was, die Bullen haben doch jetzt Wichtigeres zu tun. Wer weiß, vielleicht gibt es schon Plünderungen.«
»Wegen eines Stromausfalls?«
»Hast du Blackout von Marc Elsberg gelesen?«
»Nein.«
»Darin erzählt der Autor ziemlich anschaulich, wie Deutschland nach ein paar Tagen Stromausfall in Anarchie und Chaos versinkt.«
»Ist das nicht ein bisschen übertrieben?«
»Weiß nicht. Bei ihm klingt es jedenfalls plausibel. Aber ist ja auch egal, der Strom wird sicher nicht tagelang wegbleiben. Du wirst sehen, wenn wir bei deiner Mutter sind, sitzt sie bestimmt schon wieder vor dem Fernseher.«
Gut möglich, dass wir ein paar Tage brauchen, bis wir dort sind, dachte Claudia.
Tatsächlich brauchten sie fast zwei Stunden. Es kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Immer wieder starrte sie auf ihr Handy, doch es gab nirgendwo Empfang. Als sie endlich vor dem Mehrfamilienhaus in der Scheelestraße hielten, war sie schweißgebadet. Sie sprang aus dem Auto und rannte zur Haustür. Adrienne folgte ihr. Claudia schaffte es kaum, den Schlüssel ins Schloss zu stecken. Die Treppe zum zweiten Stock flog sie geradezu hinauf. Die Wohnung war dunkel und unnatürlich still. Sie spürte ihren Herzschlag in der Kehle, als sie das Wohnzimmer betrat.
»Mami?«
Keine Antwort.
In Panik durchsuchte sie jeden Raum, doch ihre Mutter war nicht da.
»Ich hab’s geahnt!«, schluchzte Claudia. »Jetzt irrt sie irgendwo da draußen rum. Bestimmt ist sie auf der Flucht vor irgendwelchen bösen Mächten. Vielleicht … vielleicht hab ich sie für immer verloren!«
Adrienne nahm sie in den Arm.
»Ganz ruhig! Jetzt fragen wir erst mal bei den Nachbarn, vielleicht wissen die was. Und dann gehen wir zur Polizei. Die finden sie bestimmt. Sie kann sich ja schließlich nicht in Luft auflösen.«
Claudias Kehle war wie zugeschnürt. Sie wusste, Adrienne wollte sie nur beruhigen. In Wirklichkeit aber war es sehr gut möglich, dass sie ihre Mutter nie wiedersah. Wenn die Paranoia sie im Griff hatte, konnte sie sehr geschickt darin sein, ihre Identität zu verschleiern und sich vor ihren imaginären Verfolgern zu verstecken. Es war möglich, dass sie ihre eigene Tochter verdächtigte, mit den dunklen Mächten unter einer Decke zu stecken – es wäre nicht das erste Mal. Die Polizei würde sie so schnell jedenfalls nicht finden, und ohnehin hatten die zurzeit sicher anderes zu tun, wie Adrienne vorhin selbst festgestellt hatte. Dennoch war sie froh, dass ihre Freundin da war, deren ruhige, selbstsichere Art ihr Halt gab.
Adrienne klopfte an der Tür der Kranzmanns, einer vierköpfigen Familien mit zwei lärmenden Kindern im Grundschulalter. Herr Kranzmann, ein hagerer Mann mit Halbglatze, der irgendwo bei der Stadtverwaltung arbeitete, öffnete nach einer langen Minute.
»Frau Morani! Sind Sie trotz des Stromausfalls gut hergekommen? Sagen Sie, Sie wissen nicht zufällig, wie die Hertha gespielt hat, oder?«
»Was? Nein. Herr Kranzmann, wissen Sie vielleicht, wo meine Mutter ist?«
»Und ob ich das weiß! Kommen Sie doch herein!«
Er führte sie durch einen dunklen Flur ins Wohnzimmer. Überall standen Kerzen, die dem Raum einen warmen Glanz verliehen, obwohl es draußen noch hell war. Leere Kuchenteller und Limonadengläser bedeckten den Couchtisch. Frau Kranzmann und die Kinder hatten es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht. Gegenüber, auf einem der beiden Sessel, saß Claudias Mutter, ein Buch auf dem Schoß.
»Mami! Hier bist du!«
»Wie schön, dass du da bist, Liebes. Setz dich doch! Und Sie auch, Adrienne! Ich lese den Kindern gerade aus der Unendlichen Geschichte vor. So ein Stromausfall ist doch was richtig Gemütliches, oder?«
3.
»Mach jetzt bitte den Computer aus, Simon.«
Sim Wissmann blickte weiter auf den mittleren der drei Monitore auf seinem Schreibtisch. Seine Finger streichelten die vertraute Tastatur, als sei sie ein freundliches Wesen.
»Nur einen Moment noch, Mama.«
»Jetzt, Simon!«
»Ja.«
Er speicherte den Programmcode, den er geschrieben hatte, legte eine lokale Sicherheitskopie davon an und sicherte ihn zusätzlich auf einem externen Flash-Laufwerk und in der Cloud. Dann fuhr er den Computer herunter.
»Ich gehe jetzt einkaufen. Ich bin in einer Stunde oder so zurück. Papa ist im Wohnzimmer und guckt Fußball.«
»Ist gut, Mama.«
»Bis gleich, mein Schatz.« Sie schloss die Tür.
Sim stand auf, streckte sich, sah sich um. Alles war, wie es sein sollte: die alphabetisch sortierten Buchrücken im Regal exakt ausgerichtet, die Tagesdecke auf seinem Bett ohne eine unnötige Falte, die Urkunden der Mathematikwettbewerbe, die er als Kind gewonnen hatte, in blank polierten Rahmen an der Wand aufgereiht. Nirgendwo lag etwas sinnlos herum.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























