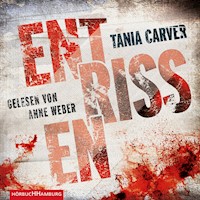8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er will dein Leid. Er will dein Leben. Er will dein Herz ... Gemma Adderley hat Angst. Sie will mit ihrer siebenjährigen Tochter vor ihrem gewalttätigen Ehemann ins Frauenhaus flüchten. Doch die beiden kommen nie dort an. Wenig später wird DI Phil Brennan zu einem Tatort gerufen. Gemmas Leiche wurde gefunden, ihre Tochter hat überlebt. Besonders grausam: Gemma wurde das Herz herausgetrennt. Phils Frau, Polizei-Profilerin Marina Esposito, übernimmt die Befragung des schwer traumatisierten Mädchens. Seit ihrem letzten Fall gehen sie und Phil eigentlich getrennte Wege. Doch als eine zweite Frauenleiche auftaucht, bei der das Herz fehlt, müssen die beiden eng zusammenarbeiten. Nur mit Marinas Täterprofil haben sie eine Chance, den Serienmörder zu finden …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Er will dein Herz
Die Autorin
Tania Carver ist der Autorenname von Martyn Waites. Der Debütroman Entrissen mit der Profilerin Marina Esposito war wochenlang in der Sunday Times Top 10 und auf der Spiegel-Bestsellerliste. Danach begann der weltweite Erfolg der Thrillerserie.Von Tania Carver sind in unserem Hause bereits die Marina-Esposito-Thriller erschienen: Entrissen · Der Stalker · Stirb, mein Prinz · Jäger · Morgen früh, wenn du willst · Du sollst nicht leben · Er will dein Herz
Das Buch
Seit ihrem letzten Fall gehen Polizei-Profilerin Marina Esposito und ihr Mann DI Phil Brennan eigentlich getrennte Wege. Doch dann führt ein grausamer Mordfall die beiden wieder zusammen.Nach Jahren der Misshandlung hat Gemma Adderley einen Entschluss gefasst: Sie will mit ihrer siebenjährigen Tochter ihren gewalttätigen Ehemann verlassen und ins Frauenhaus ziehen. Alles ist arrangiert. Ein Fahrer wird sie in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später wird Phil zu einem Tatort gerufen. Eine Frau wurde gefoltert, getötet, und man hat ihr das Herz entfernt. Es ist Gemma. Ihre Tochter wird währenddessen allein auf der Straße aufgegriffen. Marina übernimmt die Befragung des schwer traumatisierten Mädchens. Als eine zweite Frauenleiche auftaucht, der das Herz fehlt, ist klar: Es handelt sich um einen Serientäter. Nur mit Marinas Täterprofil haben sie eine Chance, den Killer zu fassen.
Tania Carver
Er will dein Herz
Thriller
Aus dem Englischen
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Deutsche Erstausgabe im Ullstein Taschenbuch1. Auflage September 2018© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018© 2015 by Tania CarverTitel der englischen Originalausgabe: Heartbreaker (First published in Great Britain in 2015 by Sphere, an imprint of Little, Brown Book Group)Umschlaggestaltung: zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®, MünchenE-Book-Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten.
ISBN 978-3-8437-1783-1
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
ERSTER TEIL
1
2
3
ZWEITER TEIL
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
DRITTER TEIL
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
VIERTER TEIL
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
FÜNFTER TEIL
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
SECHSTER TEIL
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
SIEBTER TEIL
97
Anhang
Social Media
Cover
Titelseite
Inhalt
ERSTER TEIL
ERSTER TEIL
FREIHEITSDRANG
1
Gemma Adderley hatte genug.
Sie hatte ertragen, was ein Mensch ertragen konnte, hatte immer nur eingesteckt, hatte alles geschluckt. Sie lebte in Angst, war gedemütigt, verzweifelt, verletzt. Ja, vor allem verletzt. Auf jede nur erdenkliche Weise.
Nachdem die Haustür mit einem lauten Knall ins Schloss gefallen war und sie einmal mehr von der Außenwelt abschnitt, sah Gemma sich um. Ließ den Blick über ihre Besitztümer schweifen. Ihr Leben. Was hatte Robert De Niro noch in diesem Film gesagt, den sie einmal gesehen hatte, als Roy nicht zu Hause gewesen war? »Du darfst dich niemals an etwas hängen, das du nicht innerhalb von dreißig Sekunden problemlos wieder vergessen kannst, wenn du merkst, dass es eng wird.« So oder so ähnlich. Sie saß am Küchentisch und betrachtete die Wände. Dann den Fußboden. Den Herd, an den er sie am liebsten gekettet hätte. Den Kühlschrank, der auf sein Geheiß hin gut gefüllt sein musste, selbst wenn sie nicht immer das nötige Geld dafür hatte. Es waren nicht ihre Sachen. Er hatte sie angeschafft. Hatte versucht, sie zur Sklavin all dieser Dinge zu machen. In der Küche – ja, im ganzen Haus – gab es nichts, was sie nicht von jetzt auf gleich hätte vergessen können. Hätte vergessen wollen.
Die einzige Ausnahme war Carly. Und genau deshalb würde sie ihre Tochter mitnehmen.
Mit klopfendem Herzen stand Gemma auf und ging ins Wohnzimmer. Sie dachte an Roy. Was er zu ihr sagen würde, wenn er wüsste, was sie vorhatte. Was er dann mit ihr machen würde. Wegen der Sünden, die sie angeblich begangen hatte. Er würde sie bestrafen – nein, nicht er; die Strafe kam nicht von ihm, sondern von Gott, weil sie es gewagt hatte, sich seinem Willen zu widersetzen. Das würde sie nicht noch einmal mit sich machen lassen. Nie wieder. Sie öffnete die Tür, wobei sie die Klinke fest umklammert hielt, damit sie nicht sehen musste, wie ihre Finger zitterten.
Carly lag auf dem Boden und sah fern. Irgendeine total überdrehte Realityshow. Solche Sendungen konnte sie nur schauen, wenn Roy nicht zu Hause war. Bei Gemmas Eintreten drehte ihre Tochter sich um. Wie immer zuckte sie zusammen und riss die Augen auf. War auf den Zorn Gottes gefasst. Gemma brach bei dem Anblick jedes Mal das Herz. Sie hatte überlegt, wo sie solche Augen schon einmal gesehen hatte, und eines Abends bei den Nachrichten wurde es ihr klar. Es wurden gerade Aufnahmen aus einem Kriegsgebiet im Nahen Osten gezeigt. Arme, geschundene Flüchtlinge, die in einem langsamen Tross aus einer Stadt zogen; die das Grauen, das sie gesehen hatten, einfach nur noch vergessen wollten, die an nichts anderes mehr dachten als ans eigene Überleben. In den Augen der Flüchtlingskinder hatte sie genau denselben Ausdruck gesehen wie bei Carly.
Ein Kriegsgebiet. Das trifft es ziemlich gut, dachte Gemma. Die reinste Hölle. Wie sollte man noch Angst vor der Hölle haben, wenn man bereits darin lebte?
»Hey«, sagte sie und bemühte sich, unbeschwert zu klingen. »Wir unternehmen was.«
Carly setzte sich auf und blickte nervös um sich. Auch sie hatte das Zuschlagen der Tür gehört. Normalerweise war das für sie beide das Zeichen zum Aufatmen. Die Gelegenheit, ungestört zusammen zu sein und neue Kraft zu finden. Dies hier allerdings war völlig neu. So etwas hatte das Mädchen noch nie gehört. Was die Mutter da vorschlug, verstieß gegen die Regeln. Und sie wusste, dass sie dafür bestraft würden.
»Aber …«, Carlys Blick zuckte zur Tür. »Das können wir nicht …«
»Doch, wir können«, sagte Gemma und hoffte, ruhig und bestimmt zu klingen. Sie befürchtete jedoch das Gegenteil. »Und wir werden. Los, komm.«
Carly stand auf. Sie gehorchte wortlos, selbst wenn es nicht richtig war. »Wohin …«
Ihrer Tochter zuliebe rang sich Gemma ein Lächeln ab. Sie lächelte immer nur für ihre Tochter. Es war schon lange her, dass sie um ihrer selbst willen gelächelt hatte. »Irgendwohin, wo es schön ist. Wo es uns gut geht.«
Carly schwieg.
»Na komm«, sagte Gemma und streckte dem Mädchen auffordernd die Hand hin.
Carly, der nicht wohl bei der Sache war, die ihrer Mutter den Wunsch aber auch nicht abschlagen wollte, kam zu ihr. Dann drehte sie sich wieder zum Fernseher. »Ich schalte den lieber aus. Wenn ich ihn nicht ausschalte …«
»Lass ihn an«, sagte Gemma.
Carly machte große Augen.
»Ja, lass ihn einfach an.« Wieder lächelte Gemma. Dieser kleine Akt des Aufbegehrens gab ihr Mut. Zusammen mit Carly verließ sie das Wohnzimmer.
Ihre Taschen hatte sie bereits gepackt und unter dem Bett versteckt. Jetzt holte sie sie hervor.
»Fahren wir … fahren wir in den Urlaub?«, wollte Carly wissen.
»Ja«, sagte Gemma. »Genau. Wir fahren in den Urlaub.«
»Wohin denn?«, fragte Carly, die sich trotz aller Furcht anfing zu freuen. »Wo es warm ist und die Sonne scheint? So wie in Benidorm?«
Die gleichnamige Sitcom war eine der Lieblingssendungen der Siebenjährigen. Gemma erlaubte ihr manchmal, länger aufzubleiben und sie anzuschauen, wenn Roy abends noch unterwegs war. Was ziemlich häufig vorkam.
»Nein, Schatz, nicht nach Benidorm. Aber irgendwohin, wo es genauso schön ist. Irgendwohin, wo wir uns …« Wo wir uns was? Was konnte sie ihrer Tochter überhaupt erzählen? Was sollte sie ihr sagen? »Wo wir uns sicher fühlen. Wo wir glücklich sind. Ja. Wo wir glücklich sind. Na los, zieh deine Jacke an.«
Carly wollte in ihr Zimmer gehen, blieb dann aber stehen und kam noch einmal zu ihrer Mutter zurück. »Kann Crusty auch mit?«
Ihr Teddybär. Sie nahm ihn überallhin mit.
»Crusty habe ich schon eingepackt. Den lassen wir doch nicht hier. Komm jetzt, wir müssen los.«
Doch Carly rührte sich nicht vom Fleck. Ihr schien ein Gedanke gekommen zu sein. Gemma stand abwartend da. Sie wusste bereits, was ihre Tochter gleich fragen würde. Hatte sich auch schon eine Antwort zurechtgelegt.
»Kommt … kommt Papa auch mit?«
»Nein, vorerst nicht, Schatz. Möchtest du gerne, dass er mitkommt?«
»Er ist Papa.« Auf einmal wurde Carlys Stimme flach und tonlos. Es war, als sage sie einen Text auf, den sie in der Schule auswendig gelernt hatte. »Wir sind seine Familie. Er ist der Herr im Haus. Er bestimmt. So wie Gott. Er muss immer wissen, was wir gerade tun.«
»Richtig. Er ist Papa.« Auf den Rest ging sie lieber nicht ein. Sie hoffte, dass ihre Tochter noch jung genug war, um das alles irgendwann zu vergessen. »Also, pass auf, wir machen es so: Wir fahren schon mal vor, und wenn wir wollen, kann er später nachkommen. Was meinst du?«
Wieder diese weit aufgerissenen Kriegskinder-Augen. Dann nickte Carly.
Gemma wusste, dass ihre Tochter es in Wahrheit gar nicht so meinte; dass sie nur genickt hatte, weil sie nicht offen ihre Meinung zu sagen wagte – und nicht etwa, weil sie wirklich wollte, dass ihr Vater nachkam. Sie konnte den inneren Konflikt, die Zerrissenheit ihrer Tochter in diesem Moment nur erahnen. Aber es musste sein. Es ging nicht anders.
»Gut«, sagte sie. »Wir müssen nur noch ein paar letzte Kleinigkeiten erledigen, dann können wir gehen.«
Sie nahm ihr Handy und wählte die Nummer, die sie sich eingeprägt hatte. Wartete.
»Gemma Adderley«, sagte sie, als jemand abnahm. »Safe Haven, bitte.«
Am anderen Ende wollte man wissen, wo sie gerade sei. Sie gab Auskunft. Im Gegenzug nannte man ihr eine Adresse und die Wegbeschreibung dorthin.
»Der Wagen wird in zehn Minuten da sein. Passt Ihnen das?«
»Ja«, sagte Gemma, die kaum glauben konnte, dass sie es allen Ernstes tat. Nachdem sie jahrelang mit dem Gedanken gespielt, nachdem sie es die ganze Zeit gewollt, aber nicht die Kraft und den Mut dafür aufgebracht hatte, würde sie Roy wirklich verlassen. Und mit ihm die Schmerzen, den Kummer und das Leid, die sie und ihre Tochter so lange hatten ertragen müssen.
»Ja«, wiederholte sie. »Das passt mir.«
»Die Fahrerin muss Ihnen ein Wort nennen, damit Sie auch wissen, dass sie von uns kommt. Das Wort lautet ›Erdbeere‹. Wenn sie es nicht nennt, steigen Sie nicht ein. Ist das so weit klar?«
»Klar.«
»Dann bis später.«
Gemma legte auf und sah Carly an, die sich inzwischen die Jacke zugeknöpft hatte und zu ihrer Mutter aufblickte. Sie versuchte, sich zu freuen, das sah man, doch ihre Augen waren voller Angst. In dem Moment dachte Gemma, dass es für sie unmöglich wäre, einen anderen Menschen mehr zu lieben als ihre Tochter.
»Komm, mein Schatz«, sagte sie. »Wir gehen.«
Sie waren an der Haustür angelangt.
»Ach«, sagte Gemma. »Eine Sache noch.«
Sie kehrte ins Wohnzimmer zurück und nahm das Buch – Roys einziges Buch – von seinem Ehrenplatz im Regal. Die Bibel. Die Familienbibel, eine Quelle der Unterweisung und des Gebets. Ein Ratgeber für das rechte Leben. Sie befühlte die Ecken. Hartes Leder, abgewetzt und voller Dellen, weil er sie und ihre Tochter damit geschlagen hatte. Ein Werkzeug des Zorns und der Unterdrückung.
Sie spürte Wut in sich aufsteigen. Wünschte, ein Feuer zu haben, um das Buch zu verbrennen. Sie wollte zusehen, wie es zu Asche zerfiel. Stattdessen begnügte sie sich damit, das Buch wahllos irgendwo aufzuschlagen. Dann begann sie, Seiten herauszureißen und sie durchs Zimmer zu werfen.
Irgendwann war sie erschöpft. Sie ließ das Buch auf den Boden fallen. Das sollte als Abschiedsbrief genügen. Sie ging zurück zu ihrer Tochter.
Erneut warf sie einen Blick auf die Tür. Er sperrte nie ab, wenn er wegging, erwartete aber trotzdem von ihr, dass sie im Haus blieb. Sie lebte in einem Gefängnis. Und was sie darin festhielt, waren nicht Schloss und Riegel, sondern Angst. Angst vor dem, was passieren würde, sollte sie es wagen, nicht zu Hause zu sein, wenn er zurückkam. Sollte sie auch nur daran denken, nach draußen zu gehen. Jetzt ging sie wirklich. Sie verließ ihn. Für immer. Sie hatte lange – viel zu lange – gebraucht, um diesen Schritt zu wagen. Ihrem offenen Gefängnis ein für alle Mal den Rücken zu kehren.
Gemma und Carly hielten sich an den Händen, so gut es mit dem Gepäck ging, und traten gemeinsam aus dem Haus.
Als Gemma die Tür zum hoffentlich letzten Mal hinter sich zuzog, kam ihr ein weiteres Zitat von Robert De Niro in den Sinn. Dass das Leben kurz ist und die Zeit, die man hat, pures Glück ist. Genau das hatte sie jetzt: Glück.
Sie hatte die Chance bekommen, neu anzufangen. Von nun an würde Gemma Adderley sich um ihr Glück selbst kümmern.
2
Nina freute sich über die angenehm kühle Luft im Gesicht. Schloss die Augen und ging weiter.
Der Klub war ziemlich gut gewesen, das musste sie zugeben. »Itchy Feet Night« im Lab 11. Bloß ein einziger Raum mit nackten Ziegelwänden und Bartresen, und es hatte ein bisschen muffig gerochen, aber es war genau die richtige Musik zum Tanzen aufgelegt worden. Ausnahmsweise mal nicht derselbe Mist, den all die anderen Läden immer spielten. Sondern Fünfzigerjahre-Musik, Swing. Retro. Genau ihre Schiene. Sie hatte sich amüsiert, jedenfalls die meiste Zeit. Es war nicht ihre Idee gewesen, tanzen zu gehen, aber sie hatte nicht als Außenseiterin oder Spielverderberin dastehen wollen. Vor allem, weil sie sich noch nicht lange kannten und überhaupt erst mal als Gruppe zueinanderfinden mussten. So war das eben im ersten Semester, etwas anderes hatte sie auch gar nicht erwartet. Sie wollte sich mit den anderen aus dem Wohnheim anfreunden, und das hier schien der beste Weg zu sein. Außerdem litt sie an einem besonders schweren Fall von FOMO. Bevor sie hergekommen war, hatte sie den Ausdruck noch nie gehört, aber er war ihr sofort im Gedächtnis geblieben. FOMO: Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Dass der Zustand einen Namen hatte, machte ihn gewissermaßen real, und sie war froh, endlich zugeben zu können, dass auch sie von FOMO befallen war.
Sie öffnete die Augen, sah sich nach den anderen um. Andrew kam aus Manchester, er war schwul und hatte eine ziemlich große Klappe. In der Oberstufe hatte sie einen schwulen besten Freund gehabt, und nun hoffte sie, dass Andrew sein Nachfolger werden könnte. Sie hatte beschlossen, dass jedes Mädchen einen schwulen besten Freund brauchte. Laura war das andere Mädchen in der Gruppe. Mit ihr, das spürte Nina, würde sie sich gut verstehen. Sie schienen eine Menge Gemeinsamkeiten zu haben, außerdem studierten sie dasselbe Hauptfach. Dann waren da noch Mark und John. Typische Jungs. Mehr konnte man über sie eigentlich gar nicht sagen. Man konnte Spaß mit ihnen haben; sie waren intelligent und witzig, wenn auch nicht wirklich auf Ninas Wellenlänge. Aber alles in allem ganz in Ordnung. Es machte ihnen jedenfalls nichts aus, mit Mädels auf die Piste zu gehen, und mit Andrews Homosexualität hatten sie auch kein Problem. Insgesamt eine lustige Truppe. Und bisher schienen sie sich alle prima zu verstehen. Klar, sie kannten sich noch nicht lange – aber das war definitiv schon mal ein gutes Zeichen.
Mark und John alberten herum, während sie weitergingen. Sie waren laut und lachten, als würde alle Welt ihnen zuschauen.
»Ach«, seufzte Andrew. »Ihr und eure Jungsspielchen …«
So war es scheinbar immer bei den beiden: Sobald sie ein bisschen Alkohol intus hatten, wurden sie kindisch. Sie waren das erste Mal von zu Hause weg und genossen die neu gewonnene Freiheit. Nina war da anders. Zurückhaltender. Sie versuchte, die Dinge so zu nehmen, wie sie kamen. Ohne etwas Bestimmtes zu erwarten. Auf diese Weise erlebte man nicht so schnell Enttäuschungen. Das sagte sie sich wenigstens immer. Trotzdem musste sie grinsen. Die beiden waren schon echt komisch.
»Ist dir der Typ vorhin aufgefallen?«, wollte Andrew von ihr wissen.
»Welcher Typ?«
»Der dich so angeglotzt hat – der Typ. Dunkle Haare, große Augen. Wie Jared Leto.«
Nina wusste genau, welchen Typen er meinte. Sie hatte ihn ziemlich scharf gefunden, wollte das aber nicht zugeben. Sie hatte andere Pläne. Sie wollte sich aufs Studium konzentrieren, nebenbei ein bisschen Spaß haben und neue Leute kennenlernen. Aber eine feste Beziehung? Nein.
»Nee«, sagte sie. »Muss ich wohl übersehen haben.«
Andrew verdrehte die Augen, ehe er sie in gespieltem Entsetzen aufriss. »Ihn übersehen? Wie konntest du nur? Du lieber Himmel, wenn du ihn nicht willst, hätte ich es doch versuchen können.«
Nina musste schmunzeln.
In ihrem Kopf dröhnten noch die Beats aus dem Klub, aber sie ließ Andrew trotzdem weiterreden und lauschte seinem Geplauder, das für sie wenig mehr war als ein gleichförmiges Summen in den Ohren. Es war bereits hell geworden. Samstagmorgen. Sie waren ziemlich spät losgezogen, und Nina hatte darauf geachtet, nicht zu viel zu trinken. Hatte immer nur Flaschen bestellt, die sie keine Sekunde lang aus den Augen ließ. Sie wusste immer genau, durch wessen Hände sie gegangen waren, um sicherzustellen, dass niemand etwas hineinschütten konnte. Sie hatte immer die Kontrolle. Das war ihr wichtig.
»Wo sind wir eigentlich?«, fragte Laura.
»Digbeth«, antwortete Nina. »Birmingham.«
»Schon klar. Aber wo genau? Und wie kommen wir nach Hause?«
Nina sah sich um. In Digbeth sahen irgendwie alle Straßen gleich aus. Ehemalige Lagerhäuser und Fabriken, alle renoviert und rausgeputzt, als hätte jemand nur kurz mit dem Zauberstab auf sie getippt. Der neue In-Bezirk. Hippe Bars und Vintage-Boutiquen. In der Ferne sah sie im Stadtzentrum eine silberne Riesenwelle aufragen. Die Fassade des Kaufhauses Selfridges. Es sah aus, als wäre dort eine gigantische Weltraumschnecke gestorben.
»Am besten gehen wir in die Richtung«, schlug sie vor. »Und nehmen uns dann ein Taxi.« Wenn die Kohle reicht, wollte sie hinzufügen. Sie hatte den Abend über auf ihr Geld geachtet. Die anderen hoffentlich auch. Sie hatte keine Lust, den ganzen Weg bis nach Edgbaston zu Fuß zu laufen.
»Nee«, meinte Andrew, »wir sollten lieber –«
»Leute.«
Sie verstummten. Weiter vorn waren Mark und John stehen geblieben. John drehte sich zu ihnen um. Seine Miene war ernst.
»Leute«, sagte er noch einmal und deutete in einen Hauseingang. Er schien schlagartig nüchtern geworden zu sein. »Kommt mal her. Jetzt kommt doch mal her …«
Nina ging zu den beiden hin und blickte zu der Stelle, auf die John zeigte. In einer Ecke des Hauseingangs hockte ein kleines Mädchen.
Das Kind hatte den Kopf zur Seite gedreht und sich ganz klein zusammengekauert. Die Augen hatte es fest zugekniffen; wenn es niemanden sah, konnte es auch nicht gesehen werden. Seine Kleider waren zwar schmutzig, sahen ansonsten aber tadellos aus. Das Gesicht des Mädchens war dreckverschmiert; Tränen und Rotz hatten ihre Spuren darin hinterlassen. Sie hatte einen Teddybären bei sich, den sie fest an ihre Brust gedrückt hielt. Sie sah aus wie ein Straßenkind. Wie die Kinder aus Kriegsgebieten, die man manchmal im Fernsehen sieht, schoss es Nina durch den Kopf.
Nachdem sie kurz abgewartet hatte, was die anderen machten – nichts –, ging sie vor dem Mädchen in die Hocke.
»Pass auf«, warnte Andrew sie. »Vielleicht hat die irgendwas Ansteckendes …«
Nina drehte sich um und strafte ihn mit einem eisigen Blick. Danach sagte er nichts mehr.
»Hallo«, begann sie leise. »Wie heißt du denn?«
Das kleine Mädchen gab keine Antwort. Kniff die Augen nur noch fester zu.
In Ninas Kopf überschlugen sich die Gedanken. Die Kleine war eine Kinderprostituierte; sie war von irgendwo weggelaufen; man hatte sie ausgesetzt. Vielleicht sprach sie nicht mal Englisch.
»Ich bin Nina«, versuchte sie es erneut. »Und du?«
Das kleine Mädchen begann zu weinen. »Geh weg«, sagte sie und klammerte sich wie eine Ertrinkende an ihren Teddy.
Nina rückte ein Stückchen näher heran. »Wie heißt du denn? Wir können dir helfen.«
Nichts.
Andrew kniete sich neben sie. Er wollte auch etwas tun. Doch das kleine Mädchen zuckte vor ihm zurück und sah aus, als würde es jeden Moment noch heftiger weinen. Andrew machte ein verdattertes Gesicht und trat dann vorsichtig den Rückzug an. Nina allerdings blieb hocken.
»Wo ist denn … deine Mama? Wo wohnst du? Weißt du das?«
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
»Pass auf, wir holen dir Hilfe, ja? Wir lassen dich hier nicht allein, okay?«
Noch immer sagte das Mädchen nichts. Klammerte sich nur in wachsender Verzweiflung an den Teddybären.
»Kannst du uns denn irgendwas sagen?«, hakte Nina nach, obwohl sie spürte, dass sie mit ihren Fragen nicht weiterkam. Wahrscheinlich wäre es wirklich das Beste, einfach die Polizei zu rufen. »Einen Namen? Irgendwas?«
Das kleine Mädchen sah zu ihnen hoch. Ihre weit aufgerissenen Augen waren voller Schatten.
»Warum sitzt du hier? Was ist denn passiert?«
Das Mädchen sah aus, als hätte es eine Antwort auf den Lippen, aber dann schwieg es doch. Als wären die Worte zu schrecklich, um ausgesprochen zu werden. Erneut wandte die Kleine den Kopf ab und starrte auf den Boden.
Was immer sie hatte sagen wollen, blieb ihr Geheimnis.
3
»Hallo.«
Psychologin Marina Esposito lächelte, bevor sie sich auf einem Stuhl niederließ, der viel zu klein für sie war. Sie betrachtete das Mädchen, das ihr gegenübersaß.
»Ich bin Marina. Und wie heißt du?«
Die Kleine sah mit großen Augen flüchtig zu ihr hoch, wandte den Blick jedoch gleich wieder ab und richtete ihn stattdessen auf den Bär in ihren Händen, den sie fest umklammert hielt.
Marina lächelte immer noch. »Ich weiß, dass dir etwas sehr Schlimmes passiert ist, und ich bin hier, weil ich dir helfen möchte, darüber zu reden.«
Das Mädchen sah sie nicht an. Marina musterte nachdenklich den Teddybären. Er war ziemlich schmutzig, aber Marina wusste, dass die Kleine ihn nicht aus der Hand geben würde. Seit sie gefunden worden war, hatte sie ihn keine Sekunde losgelassen.
»Wie heißt denn dein Bär?«, erkundigte sie sich.
»Crusty«, antwortete das Mädchen.
»Crusty. Hübscher Name. Hast du ihn schon lange?«
Die Kleine nickte.
»Und wie heißt du?« Marina wusste es bereits – es stand im Bericht –, aber sie wollte es von dem Mädchen selbst hören.
Die Kleine starrte unverwandt ihren Teddy an.
Als der Anruf gekommen war, hatte Marina gleich darauf hingewiesen, dass dies nicht ihr Fachgebiet sei. Für gewöhnlich behandelte sie keine Kinder, ob sie nun traumatisiert waren oder nicht. »Ich bin Kriminalpsychologin«, hatte sie betont. »Sofern die Kleine nicht ein Verbrechen begangen hat, glaube ich kaum, dass ich Ihnen weiterhelfen kann.«
»Aber sie ist Opfer eines Verbrechens«, hatte Detective Sergeant Hugh Ellison entgegnet. »Beziehungsweise haben wir Anlass zu der Vermutung, dass ihre Mutter Opfer eines Verbrechens wurde. Sie ist verschwunden. Die Tochter ist die einzige Zeugin.« Er machte eine Pause, damit Marina die Brisanz der Situation begriff. Dann fuhr er fort: »Klar, normalerweise würden wir einen Kinderpsychologen kommen lassen, aber aufgrund Ihrer speziellen Fähigkeiten sind Sie in diesem Fall besser geeignet. Außerdem wurden Sie uns empfohlen.«
»Aha.« Marina nickte, auch wenn Ellison das natürlich nicht sehen konnte. Sie ahnte bereits, von wem die Empfehlung gekommen war. Ihr Mann, Phil Brennan, war Detective Inspector bei der Kriminalpolizei der West Midlands in Birmingham. Sie hatte schon häufiger bei Fällen mit ihm zusammengearbeitet. Ihm bei seinen Ermittlungen geholfen.
Der Gedanke an ihn ließ sie unwillkürlich erschauern. Er konnte ihr nicht helfen. Nicht mehr. Und das trieb einen Keil zwischen sie. Denn sie bezweifelte, ob er ihr jemals wieder würde helfen können.
Darauf konnte sie es nicht ankommen lassen.
»Wie auch immer«, fuhr DS Ellison fort. »Sie wurde in Digbeth auf der Straße gefunden. Sagte, sie wäre mit ihrer Mutter auf dem Weg in den Urlaub gewesen, aber dann wäre ihre Mutter ohne sie weitergefahren. Die Kleine wurde aus dem Auto geworfen und einfach auf der Straße liegen gelassen. Eine Gruppe Studenten hat sie entdeckt.«
»Und was ist nun mit ihrer Mutter?«
»Ich hoffe, das können Sie rausfinden.«
Danach hatte er aufgelegt.
Schließlich hatte sich Marina – mit einem gewissen Widerwillen – bereit erklärt, das Mädchen zu treffen. Sie hatte sämtliche Berichte studiert, die man ihr vorgelegt hatte. Die Kleine hatte ihren Namen genannt – Carly –, aber darüber hinaus fast nichts gesagt. Sie wollte nicht verraten, wo sie wohnte, und allein der Gedanke, über ihre Mutter zu sprechen, schien ihr schreckliche Angst zu machen. Zwar glaubte Marina nicht, dass diese beiden Sachverhalte direkt miteinander zusammenhingen, allerdings legten die jeweiligen Reaktionen des Kindes eine Traumatisierung nahe. Vermisstenanzeigen, die auf ihre Beschreibung gepasst hätten, lagen nicht vor, insofern hatte sie nicht viel, womit sie arbeiten konnte.
Nun saß sie in dem Aufnahmezentrum, wohin man das Kind vorläufig in Obhut gegeben hatte. Die Wände waren hell und mit bunten Comicfiguren bemalt, doch selbst das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie sich in einer Anstalt befanden.
»Du heißt Carly, nicht wahr? Leslie, die sich um dich kümmert, hat mir deinen Namen verraten.«
Das Mädchen nickte.
»Und wie alt bist du, Carly?«
»Sieben.«
Marina nickte. »Ein gutes Alter. Ich habe auch eine Tochter, die ist ein bisschen jünger als du. Ihr Name ist Josephina.« Sie sah Crusty an. »Die hat auch einen Lieblingsteddy, den sie überallhin mitnimmt.«
Carly starrte sie an. Marina war nicht ganz sicher, meinte jedoch, erste Anzeichen von Interesse bei dem Kind zu bemerken, ein erstes zaghaftes Zeichen von Vertrauen.
»Wo ist denn dein Papa, Carly?«
Ein Schatten legte sich über ihre Züge. Sie war kurz davor gewesen, Blickkontakt zu Marina aufzunehmen, doch jetzt sah sie wieder weg.
»Zu Hause«, sagte sie.
»Und wo ist dein Zuhause?«
»Zu Hause eben.« Ihre Miene war voller Misstrauen, und sie hatte die Augen niedergeschlagen.
»Magst du mir vielleicht sagen, wie man da hinkommt, Carly?«
Carly blickte weiterhin auf ihren Bären. Schüttelte schließlich den Kopf.
»Warum nicht?«
»Mama hat gesagt, dass wir wegfahren. In Urlaub. Nicht nach Benidorm, aber irgendwohin, wo es schön ist, hat sie gesagt.«
»Benidorm? Warum gerade Benidorm? Hattest du dir das gewünscht?«
Carly nickte. »Wie im Fernsehen.«
Im Fernsehen?, dachte Marina verwirrt. Im nächsten Moment fiel es ihr ein: die Comedy-Serie. Wenn man es so nennen konnte. Jede Menge Sonnenschein und Schauspielkunst wie aus dem Bauerntheater. Sie nickte lächelnd. »Ach, die Sendung. Die gefällt dir, ja?«
Carly nickte. »Mama erlaubt mir manchmal, aufzubleiben und sie zu sehen. Wenn Papa nicht …«
Sie verstummte abrupt. Sie wirkte wieder verängstigt. Schuldbewusst.
Marina beobachtete sie genau. »Wenn Papa nicht … was? Wenn Papa nicht zu Hause ist?«
Carly schwieg. Umklammerte ihren Teddy so fest, dass ihre Knöchel weiß wurden.
Marina beugte sich vor – nur ein wenig, damit das Mädchen sie besser sehen konnte, jedoch ohne sie zu bedrängen. »Willst du was wissen, Carly? Über deinen Teddy? Und über den Teddy von meiner Tochter Josephina?«
Erneut sah das Mädchen auf. Sie war argwöhnisch, aber interessiert.
»Sie beschützen euch. Ihr haltet sie immer gut fest, und dafür beschützen sie euch. Wenn es mal eng wird, sind sie für euch da. Manchmal müsst ihr Dinge tun, die ihr nicht so gerne tun wollt, und dafür müsst ihr stark sein. Dabei helfen euch die Teddys.«
Carly starrte sie an. Marina, die spürte, dass das Mädchen ihr zuhörte, redete weiter. »Meine kleine Josephina … Als sie noch jünger war, musste sie … da musste sie mal sehr tapfer sein. Und sehr stark.«
»Was ist denn passiert?«, fragte Carly, wider Willen neugierig geworden.
»Na ja, sie …« Wurde entführt.Als Druckmittel gegen mich benutzt. Und ich musste sie finden. Ich musste die Entführer zur Strecke bringen und meine Tochter retten. »Sie … da waren böse Menschen, die wollten, dass ich etwas für sie tue. Und um mich dazu zu bringen, haben sie sie mir weggenommen.«
Carly machte große Augen. »Und ist … ist sie wieder zurückgekommen?«
Marina lächelte – aufmunternd, wie sie hoffte. »Oh ja. Ich habe sie befreit. Sie ist wieder nach Hause gekommen. Aber weißt du was? Als es richtig schlimm für sie wurde, richtig, richtig schlimm, da hatte sie immer noch ihren Teddy. Er hat sie die ganze Zeit beschützt. Er hat ihr Kraft gegeben. Genau wie Crusty dir jetzt Kraft gibt.«
Ich war diejenige, die sie gerettet hat. Ich habe sie nach Hause geholt. Nicht Phil, sondern ich.
Carly betrachtete erst ihren Teddy, dann Marina.
»Ganz egal, was hier drinnen passiert«, und um ihre Aussage zu unterstreichen, machte Marina eine Geste, die den gesamten Raum mit einschloss, »du bist sicher. Was immer du hier sagst, was immer du tust, dir kann nichts geschehen. Weil dein Teddy bei dir ist. Er passt auf dich auf.«
Carly sah Marina mit großen Augen an. Sie wollte ihr unbedingt glauben, ihr vertrauen. Doch noch konnte sie diesen letzten Schritt nicht tun.
»Ist …« Sie sah auf ihren Teddy, dann wieder zu Marina. »Ist Josephina jetzt immer noch in Sicherheit?«
Marina lächelte. Hoffentlich war es ein überzeugendes Lächeln.
»Aber natürlich ist sie das.«
Hoffentlich bemerkte das Kind nicht, dass sie log. Hoffentlich konnte sie Marinas Gedanken nicht lesen. Hoffentlich wusste sie nicht, dass es für Josephina so etwas wie Sicherheit nicht mehr gab. Und für Marina auch nicht. Nirgends. Nicht seit …
Sie schob die Gedanken beiseite. Darum würde sie sich später kümmern. Sie hatte ohnehin bereits entschieden, was sie tun würde. Jetzt musste sie sich auf Carly konzentrieren.
»Wir sind hier in Sicherheit, Carly. Du bist hier in Sicherheit. Wir können ganz ungestört miteinander reden. Bloß reden, mehr nicht. Möchtest du gerne reden? Mit mir?«
Carly dachte lange darüber nach. Irgendwann nickte sie.
»Ja«, sagte sie.
Marina lächelte. »Gut«, antwortete sie. »Das freut mich.« Dann setzte sie sich so entspannt wie möglich hin, wollte offen und zugänglich auf das Mädchen wirken. »Also. Erzählst du mir, was passiert ist?«
Auch diesmal suchte Carly Zuflucht bei ihrem Teddy. Sie betrachtete ihn lange und gründlich, als erhielte sie wichtige Informationen von ihm, als gäbe er ihr den Willen und die Kraft zum Sprechen. Schließlich sah sie auf. Sagte ein einziges Wort.
»Erdbeere.«
ZWEITER TEIL
SATURDAY BRIDGE
4
Es schüttete wie aus Kübeln, heftig und ohne Unterlass. Der Regen spülte alles Leben von den Straßen, wusch die Farben aus dem Nachmittag und ließ es vorzeitig dämmern. Die Tropfen wurden von einem kalten, böigen Wind vorangetrieben, der sie, wenn er plötzlich auffrischte oder die Richtung wechselte, in eisig scharfe Geschosse verwandelte. Dies war eine Mahnung an alle, die ihrer noch bedurften, dass der Sommer allenfalls eine blasse Erinnerung war und auch der Herbst schon in den letzten Zügen lag.
Nicht gerade der beste Tag, um sich länger im Freien aufzuhalten.
Nicht der beste Tag, um eine Leiche zu finden.
Detective Inspector Phil Brennan von der Abteilung für Kapitalverbrechen der West Midlands Police stand auf der Saturday Bridge in Birmingham, blickte unter seinem Regenschirm auf die fast leergelaufene Schleuse des Birmingham-und-Fazeley-Kanals hinunter und wartete auf das Signal, dass er sich nähern konnte. Das zweifarbige Plastikband, das quer über den Fußweg gespannt war, zeigte an, wo die normale Welt endete und die andere – die gefährliche, mörderische, tragische und brutale Welt – ihren Anfang nahm. Phil stand mit dem Rücken zur Absperrung. Er war schon oft genug an Orten wie diesem gewesen, um zu wissen, in welcher dieser beiden Welten er zu Hause war.
Der Regen hatte alle Gaffer bis auf die hartnäckigsten vertrieben, und das weiße Plastikzelt, das am Ufer des Kanals errichtet worden war, sorgte dafür, dass selbst diejenigen, die geblieben waren, nichts sahen. Phil ignorierte die Zuschauer. Er sah und hörte auch nicht die Handvoll Reporter und Fernsehcrews, die auf der Jagd nach einer Story den Elementen getrotzt hatten. Er blendete alles aus, was wertvollen Platz in seinem Kopf hätte einnehmen können, und konzentrierte sich ganz auf seine Arbeit.
Seine Hand, die den Schirm hielt, zitterte nur wenig. Na bitte. Sein unrasiertes Gesicht hätte als modischer Dreitagebart durchgehen können, und seine Kleidung, die auch sonst nicht die eleganteste war, sah vielleicht nur infolge des Regens an diesem Morgen besonders schäbig aus. Seine blutunterlaufenen, eingesunkenen Augen mit den dunklen Tränensäcken waren dagegen schon schwieriger zu erklären. Er hoffte einfach, dass sie niemandem auffallen würden. Er lutschte ein extra starkes Pfefferminz und gab sich einen Ruck.
Trotz des weißen Zelts waren die Chancen, den Tatort vor dem peitschenden Regen zu schützen, gering bis nicht existent, das wusste er. Da wäre schon unverschämtes, an ein Wunder grenzendes Glück nötig. Aber so oder so, die korrekte Vorgehensweise musste eingehalten werden. Er lief über die ausgelegten Metallplatten zum Zelt und blieb am Eingang stehen.
»Sind Sie schon so weit?«, rief er Jo Howe, der Leiterin der Spurensicherung, zu.
Jo, eine kleine, füllige Frau mittleren Alters, kniete auf der Erde und untersuchte gerade die nähere Umgebung der Leiche, wobei sie streng darauf achtete, diese nicht zu berühren. »Ich rufe Sie, wenn ich fertig bin. Gehen Sie solange in den Pub zu den anderen«, antwortete sie, ohne aufzusehen.
Eine Erwiderung lag ihm auf der Zunge: Ich will einfach nur was tun. Ich ertrage diese Untätigkeit nicht. Doch er schwieg. Machte kehrt und ging wieder in Richtung Brücke. Tat, was sie ihm vorgeschlagen hatte.
Die nasse Jeans klebte an seinen Beinen wie eine zweite Haut und schränkte ihn auf höchst unangenehme Weise in seiner Bewegungsfreiheit ein. Seine Lederjacke hielt zwar den Regen recht zuverlässig ab, allerdings lief ihm Wasser über die Hand, die den Schirm hielt, in den Ärmel und rann hinten in seinen Kragen. Er musste sich so schnell wie möglich umziehen, sonst erkältete er sich noch oder bekam eine Grippe. Aber irgendwie war ihm selbst das egal.
Er drängte sich durch die kleine Schar an Zaungästen, machte einen Bogen um die Journalisten, überquerte die Straße und steuerte auf den Pub zu. Das Shakespeare in der Summer Row gab es schon seit Jahren. Es lag in einem viktorianischen Gebäude und behauptete zwischen den moderneren Bars und Garküchen, die in seinem Umkreis wie Pilze aus dem Boden geschossen waren, eisern sein Traditionsbewusstsein.
Phil trat ein und zeigte dem Mann hinter der Theke seinen Dienstausweis. Der strahlte und fragte: »Was kann ich Ihnen bringen?«
Phil kannte Typen wie ihn zur Genüge. Sie brüsteten sich gerne damit, der Polizei geholfen zu haben. Hofften, dass auf diese Weise ein wenig vom Glanz einer wichtigen Ermittlung auch auf sie abstrahlte. Glanz. Sag das mal der Leiche, die da unten am Kanal liegt, dachte Phil.
»Einen Kaffee, bitte«, sagte er dann. »Ich bin im Hinterzimmer.«
Sie hatten den Pub zeitweilig in Beschlag genommen. Uniformierte, Polizisten in Zivil und Mitarbeiter der Spurensicherung suchten hier Zuflucht vor dem Regen, bis der Container der mobilen Einsatzzentrale aufgestellt wurde. Phil erspähte zwei Mitglieder seines Teams, Detective Sergeant Ian Sperring und Detective Constable Imani Oliver. Sie saßen an einem Tisch unter einer Shakespeare-Büste und schwiegen sich an. Er gesellte sich zu ihnen.
»Einmal hat mich hier einer gefragt, ob die beiden Brüder waren«, sagte Sperring, wobei er erst auf die Büste über ihren Köpfen, dann auf eine zweite, identisch aussehende Büste in einer anderen Ecke zeigte. »Shakespeare. Hat gefragt, ob der eine die Stücke geschrieben hat und der andere … keine Ahnung … auf der Bühne stand oder die Buchhaltung gemacht hat, oder was weiß ich.«
»Und was haben Sie geantwortet?«, erkundigte sich Imani, deren Augen amüsiert aufblitzten.
Sperring zuckte die Achseln. »Hab ihnen gesagt, was sie hören wollten«, antwortete er mit einer Miene, die so abweisend war wie eine geballte Faust.
Die beiden konnten sich nicht riechen, aber Phil hatte darauf bestanden, dass sie sich zusammenrauften. Schließlich gehörten sie zu demselben Team. Detective Constable Nadish Khan, das dritte ständige Teammitglied, befand sich gerade auf einer Fortbildung. Sperring, der zehn Jahre älter und etliche Kilos schwerer war als Phil, hatte sich mit seiner beträchtlichen Körpermasse in der Ecke niedergelassen und sah aus, als wolle er in absehbarer Zeit auch nicht wieder aufstehen. Imani dagegen saß hellwach ihm gegenüber auf einem Hocker.
Phil war glücklich gewesen in Colchester. Glücklich mit seiner Stelle bei der Kriminalpolizei von Essex. Doch nachdem einer seiner Fälle für ihn beinahe tödlich geendet hatte, hatte er sich in seiner Heimatstadt nicht mehr wohlgefühlt. Also hatten er und Marina sich für einen Tapetenwechsel entschieden und waren nach Birmingham gezogen, in Marinas Geburtsstadt. Phil hatte lange gebraucht, um von seinem neuen Team akzeptiert zu werden. Und um seinerseits das neue Team zu akzeptieren. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten hatte sich im Laufe der Zeit ein gutes Miteinander entwickelt. Inzwischen zollten Phils Kollegen ihm sogar einen gewissen Respekt für seine Arbeitsmethoden, auch wenn sie nicht unbedingt erpicht darauf waren, sie zu übernehmen.
Er zog sich die Lederjacke aus, hängte sie über den gepolsterten Stuhl und setzte sich zu den beiden. Es war so warm im Pub, dass man fast den Dampf von seinen klatschnassen Hosenbeinen aufsteigen sah. Sein Karohemd war vorn völlig durchnässt, ebenso das T-Shirt, das er darunter trug.
Phil erschien nie im Anzug zur Arbeit. Er kleidete sich so, wie es ihm gefiel. Red-Wing-Boots, Jeans aus schwerem japanischen Selvedge Denim, Westernhemd, Lederjacke – das war seine persönliche Art der Uniform. Sein Kleidungsstil hatte im Laufe der Jahre des Öfteren zu Auseinandersetzungen mit Vorgesetzten geführt und auch mit seinen neuen Kollegen. Er jedoch war der festen Überzeugung, dass ein unkonventionelles Äußeres der Kreativität und dem freien Ausdruck im Denken förderlich war. Seine Ansichten wurden nicht von allen geteilt, aber man tolerierte ihn. Solange er Ergebnisse lieferte.
»Können wir schon?«, fragte Sperring, wobei er allerdings kaum von seinem Becher mit extrastarkem Tee aufsah, in dem er gerade rührte.
»Sie rufen uns, wenn sie fertig sind«, erwiderte Phil.
»Und warum stehen Sie dann die ganze Zeit im Regen rum?«, fragte Sperring und hob nun doch den Blick.
Phil musterte seinen Untergebenen. Einige Monate zuvor war Sperring Opfer einer Messerattacke geworden. Der Vorfall hatte ihn altern lassen – nicht dass Sperring dies jemals zugegeben hätte, im Gegenteil, er hatte darauf bestanden, so schnell wie möglich in den aktiven Dienst zurückzukehren. Phil bewunderte ihn für seine Zähigkeit.
»Ich habe … gewartet«, antwortete er.
Sperring musterte ihn mit ungewohnt mitfühlendem Blick. Er schien etwas sagen zu wollen, überlegte es sich dann jedoch anders.
Phils Kaffee kam. Er bedankte sich beim Barkeeper und wollte sein Portemonnaie herausholen.
»Der geht aufs Haus«, sagte der Mann.
»Nein«, widersprach Phil. »Ich zahle.«
»Kommt gar nicht infrage. Den Kollegen in Blau hilft man doch gern.«
Der Mann blieb bei ihrem Tisch stehen und grinste. Wahrscheinlich hoffte er, die eine oder andere Information aufzuschnappen, die er später seinen Kumpels weitererzählen konnte. Oder einem Reporter, was weitaus wahrscheinlicher war.
»Na, dann vielen Dank«, sagte Phil, um den Mann loszuwerden. Sobald er außer Hörweite war, wandte Phil sich wieder an seine Kollegen. »Ich hasse es, wenn sie so was machen.«
»Was denn?«, fragte Sperring. »Neugierig um uns rumschleichen?«
»Nein. Wenn sie kein Geld von uns annehmen wollen. Ich komme mir dann immer wie ein Schnorrer vor.«
Sperring hob die Schultern. »In unserem Job hat man ja sonst kaum Vorteile«, meinte er. »Hin und wieder mal eine Tasse Tee für lau – das juckt doch keinen.«
»So fängt es an«, sagte Phil. »Aber egal. Wer hat die Tote gemeldet?«
»Eine Streife«, sagte Imani. »Die Kollegen wurden heute Morgen von einer Frau alarmiert, die ihren Hund ausführte.«
»Kein Dogger?«, fragte Sperring. »Die gibt’s hier in der Gegend doch wie Sand am Meer.«
»Um bei so einem Sauwetter vor die Tür zu gehen, muss man echt hart im Nehmen sein«, sagte Imani. »Oder reif für die Anstalt. Unsere Spaziergängerin hat die Leiche in einer der Schleusen entdeckt. Eigentlich hatten sie vor, das Wasser abzulassen. Unmöglich bei dem Regen.«
»Hat sie schon eine Aussage gemacht?«, wollte Phil als Nächstes wissen.
Sperring nickte. Überlegte, ob er einen Schluck von seinem Tee trinken sollte. Entschied sich dagegen. »Ja. Glaub aber nicht, dass sie uns weiterhelfen kann. Ihr ist sonst niemand aufgefallen – keiner, der irgendwie verdächtig aussah oder weggerannt ist, nichts. Sie hat nur was in der Schleuse treiben sehen. Der Hund wäre fast reingesprungen. Weibliches Opfer, Mitte bis Ende zwanzig, soweit man das von oben sehen konnte. Mehr wissen wir im Augenblick noch nicht.«
Phil nickte. »Und was ist sonst noch über diese Spaziergängerin bekannt?«, fragte er.
»Arbeitet in der Stadt als Büroangestellte. Kleiner Hund, einer von diesen Kläffern. Wohnt in einem der schicken Apartments drüben beim Kreisel. Geht mit dem Hund raus, damit er ihr nicht auf den Teppich scheißt, wenn sie bei der Arbeit ist. Machte nicht den Eindruck, als hätte sie was mit der Sache zu tun.«
»Das ist ja meistens so«, sagte Phil.
In dem Moment klingelte sein Handy. Er fuhr zusammen, und sein Herz setzte einen Schlag aus. Er fummelte das Gerät aus seiner Jackentasche, und es wäre ihm beinahe aus der Hand gerutscht, so eilig hatte er es, einen Blick auf das Display zu werfen. Er seufzte. Nein. Er hob es ans Ohr und lauschte. Nickte. Legte auf.
»Das war Jo«, teilte er den anderen mit. »Sie ist jetzt fertig.« Er stand auf. »Gehen wir.«
Die anderen beiden erhoben sich ebenfalls, Sperring ziemlich schwerfällig.
Phil spürte das Ziehen des nassen Jeansstoffs an den Beinen, als er sich in Richtung Tür bewegte. Das Gefühl war jetzt noch unangenehmer als vorhin. Er traf auf eine Wand aus kalter Luft, als er ins Freie trat, aber dass ihn fröstelte, lag nicht nur am Wetter. Er überquerte die Straße. Er freute sich nicht auf den Anblick, der ihn erwartete.
5
»Also, was haben wir?«, fragte Phil.
Jo Howe erhob sich und blickte auf die Leiche zu ihren Füßen. Der Regen prasselte auf das Plastikdach des Zelts wie ein nie enden wollendes lästiges Trommelsolo. Jedenfalls kam es Phil so vor.
»Schauen Sie selbst«, sagte Howe. »Und fragen Sie Esme. Das ist ihr Fachgebiet.« Die Formulierung legte nahe, dass sie froh war, mit diesem Aspekt der Ermittlungen nichts zu tun zu haben.
Neben der Toten kniete die Rechtsmedizinerin Esme Russell. Sie war gekommen, während Phil im Pub gesessen hatte. Sie war jung und hübsch und hatte die Haare zu einem straffen Pferdeschwanz gebunden. Phil fand, dass sie eher wie eine Debütantin aussah – und auch so sprach. Jedenfalls wirkte sie nicht wie jemand, der von Berufs wegen Leichen an Tatorten untersuchte.
»Hey, Esme«, sagte er. »Schön, Sie zu sehen.«
Sie schaute zu ihm hoch, nickte kurz und widmete sich dann wieder der Leiche. »Wir dürfen uns nicht länger so treffen. Die Leute werden anfangen zu reden.« Sie deutete auf die Tote. »Dieses arme Geschöpf allerdings nicht.«
Phil trat näher. Die Vliesüberzieher über seinen Stiefeln hatten sich bereits zur Hälfte aufgelöst. Seine Sohlen dröhnten und quietschten auf den Metallplatten. Er ging neben Esme in die Hocke und beugte sich so dicht über die Leiche, wie er es über sich brachte. Selbst nach all den Jahren als Mordermittler war sein erster Impuls immer, den Blick abzuwenden. Nicht vor Entsetzen, wohl eher aus Anstand. Natürlich wusste er, dass das nicht die richtige, nicht die professionelle Herangehensweise war. Diese Person als lebenden, atmenden Menschen zu rekonstruieren – das würde später kommen. Im Moment war dies allerdings weniger wichtig als der Körper selbst: eine Anzahl von Spuren. Ein Ansatzpunkt. Das Ende einer Geschichte, die er bis zu ihrem Anfang zurückschreiben musste. Ein Rätsel, das es zu lösen galt.
»Mein Gott«, sagte er. »Sie ist keinen leichten Tod gestorben …«
»Nein«, sagte Esme. »Also. Schauen wir mal, was wir haben. Weiblich. Vielleicht in ihren Zwanzigern oder Dreißigern, soweit man das anhand der Überreste beurteilen kann.«
Phil versuchte, die Leiche mit größtmöglicher emotionaler Distanz zu betrachten. »Ja«, pflichtete er Esme bei. »Überreste. Ganz zu schweigen davon, was das Wasser bei ihr angerichtet hat.«
»Und das, was im Wasser schwimmt«, fügte Esme hinzu. »Wo genau wurde sie gefunden?«
»Nicht weit von hier. Sie trieb in der Schleuse. Eine Passantin hat die Polizei gerufen.«
»Ein Glück, dass sie mit dem Gesicht nach unten lag«, meinte Esme. »Sonst hätte die Frau bestimmt ihr Frühstück wieder von sich gegeben.«
»Können Sie erkennen, welche der Verletzungen ihr vor und welche ihr nach dem Tod zugefügt wurden?«
»Ich gebe mein Bestes«, antwortete sie. »Aber das braucht Zeit.«
Phil nickte verständnisvoll und betrachtete dann erneut die Leiche. Es war schwer zu sagen, welche Wunden ihr vom Mörder und welche ihr im Wasser zugefügt worden waren. Schwer, aber nicht unmöglich. Er listete auf, was er bereits wusste.
Die Frau war weiß. Oder war es gewesen. Im Tod hatte ihre Haut eine andere Farbe angenommen. Das Wasser hatte den Körper stark aufgeschwemmt, ihr Gesicht war violett und aufgedunsen. An mehreren Stellen fehlte Gewebe. Die Wundränder waren ausgefranst.
Er deutete auf eine dieser Stellen. »Ratten?«
»Und was sich sonst noch so im Wasser tummelt.«
Phil erschauerte und versuchte, sich einzureden, dass es nur an der Kälte und dem Regen lag.
Die Arme und Beine der Toten wiesen zahlreiche Schnitt- und Schürfverletzungen auf. Er sah genauer hin. Außerdem waren da noch einige kleine runde Flecken auf ihrer Haut.
»Was haben die da zu bedeuten?«, wandte er sich an Esme.
»Sieht mir nach Brandmalen aus«, antwortete sie und untersuchte die Stellen eingehender. »Schauen Sie hier, an Oberschenkeln und Armen. Die meisten befinden sich auf den Schenkelinnenseiten.« Sie beugte sich tiefer. »Ich mache später noch ein paar Tests, aber auf den ersten Blick sehen sie so aus, als wären sie verheilt, und dann wären ihr an genau denselben Stellen ein zweites Mal Verbrennungen zugefügt worden. Schwer zu sagen, es ist alles so nass.«
Phils Magen krampfte sich zusammen. Er schluckte die aufsteigende Übelkeit hinunter und konzentrierte sich auf die objektive, analytische Seite seines Verstandes.
»Und was heißt das? Dass die Verletzungen schon älter sind?«
Esme zuckte die Achseln. »Sieht ganz danach aus.«
»Können Sie –«
Esme lächelte. »Ich weiß, was Sie mich fragen wollen. Und nein, ich kann Ihnen noch keinen Todeszeitpunkt nennen. Zu früh. Ich kann nicht mal eine Vermutung äußern.«
»Einen Versuch war es wert«, meinte Phil.
Wieder ein Lächeln, genauso grimmig wie zuvor. »Eigentlich sollten Sie es mittlerweile besser wissen.«
»Ich weiß.« Er wandte seine Aufmerksamkeit wieder der Leiche zu. »Was, glauben Sie, hat die Wunden verursacht?«
Der Großteil der Verletzungen an Armen und Beinen waren tiefe, gerade Einschnitte.
»Ein Messer, würde ich sagen. Gerade, scharfe Klinge. Kein Wellen- oder Zackenschliff. Die Schnitte wurden relativ zügig und mit viel Kraft ausgeführt. Der Wundtiefe nach zu urteilen – die hier geht bis runter auf den Knochen –«, sie wies auf eine Wunde am rechten Arm, »waren da heftige Emotionen im Spiel.«
»Ich kann mir schon denken, was für Emotionen das waren«, sagte Phil. »Und was ist damit?«
Endlich. Das Wichtigste hatte er bis ganz zuletzt aufgespart.
Da war etwas an der Leiche, das bislang keiner von ihnen angesprochen hatte, obwohl es das Auffallendste war – das, was sich am wenigsten ignorieren ließ. Die schrecklichste unter all den schlimmen Verletzungen. Das klaffende Loch in ihrer Brust.
»Nun«, sagte Esme. »Ich würde sagen, ihr wurde das Herz entfernt.«
»Ja«, erwiderte Phil nur. Der Anblick machte es ihm schwer, sich zu konzentrieren. »Da stimme ich Ihnen zu. Und das waren ganz sicher nicht die Ratten.«
»Nein«, sagte sie. »Es sei denn, die Ratten waren kräftig genug, um dieser Frau die Rippen zu brechen, sie nach außen zu biegen und ihr das Herz herauszuschneiden.«
Esme rückte ein Stück von der Leiche ab und atmete laut aus. Phil starrte nach wie vor auf die Tote in der Hoffnung, sie möge ihm ihre Geheimnisse preisgeben. Irgendwann merkte er, wie Esme ihn beobachtete. Er sah sie an. Sie lächelte.
»Gibt es Neuigkeiten bei Ihnen?«
Phil runzelte verdattert die Stirn. »Woher wissen …«
»Ach, Phil. So was spricht sich schnell herum. Ich fürchte, inzwischen weiß es jeder. Es tut mir leid.«
Phil schwieg.
»Wie geht es Ihnen denn?«
Phil erschauerte wieder, und auch diesmal hatte es nichts mit der Kälte oder dem Anblick der Leiche zu tun. »Ich habe die Arbeit«, sagte er. »Mir geht es gut.«
Sie richtete sich auf. Ihr Gesicht befand sich jetzt unmittelbar neben seinem. »Wenn Sie mal …« Sie seufzte, hätte fast den Kopf geschüttelt, fuhr dann aber fort: »Wenn Sie mal etwas trinken gehen möchten … oder vielleicht zu Abend essen … einfach nur als Freunde. Oder …« Sie zuckte die Achseln. »Als Freunde.«
Phil zwang sich zu einem Lächeln. »Danke, Esme, aber –«
»Können wir jetzt reinkommen?«
Beide wandten sich um. Sperring und Imani standen in der Zeltklappe im Regen. Ihre Schirme schienen ihnen nicht viel Schutz zu bieten.
»Entschuldigung«, sagte Phil und stand auf, als wäre er bei etwas Verbotenem ertappt worden. Er merkte, wie Esme hastig von ihm abrückte. »Wir waren beschäftigt. Passen Sie auf, wo Sie hintreten, wenn Sie reinkommen.«
Sie traten ein. Sahen die Leiche.
»Himmel«, stieß Sperring hervor. »Einmal alle tief durchatmen.«
»Oh mein Gott …« Imani kniff die Augen zu.
»Schauen Sie sie aus dem Augenwinkel an«, riet Sperring ihr. »Wie man nachts die Sterne betrachtet. So kann man nämlich die Konstellationen am besten erkennen.«
Schweigend standen sie da und betrachteten die Tote.
»Ist wohl naiv zu hoffen, dass sie einen Ausweis bei sich hatte, was?«, meinte Sperring irgendwann.
»Sie hat mehrere Tattoos«, stellte Esme fest. »Eins sieht so aus, als ob es ein Name wäre. Vielleicht ihr eigener? Oder der eines Kindes?«
»Wir fragen bei der Vermisstenstelle nach«, sagte Phil. »Mal schauen, ob die einen Fall haben, der zu ihr passt.«
»Also«, sagte Imani. »Nach wem suchen wir denn? Den Täter, meine ich.«
»Sie denken, es war ein Er?«, fragte Phil. »Ist das nicht ein bisschen voreilig?«
Imani zuckte die Achseln. »Na ja … wenn es ein Mann war, dann einer, der …« Sie brachte den Gedanken nicht zu Ende.
Phil starrte weiter auf die Leiche. Nickte. »Richtig«, sagte er, ohne auch nur einen Moment lang den Blick von der klaffenden Wunde abzuwenden. »Wer auch immer es war, er hat einen Hass auf Frauen.«
6
Janine Gillen ließ sich langsam und vorsichtig im Sessel nieder. Es gelang ihr nicht, ihr Zittern zu unterdrücken, als sie die Beine übereinanderschlug und die Hände auf die Armlehnen legte. Dann strich sie sich mit einer schnellen, ruckartigen Bewegung die Bluse glatt, die von Primark war, aber gut aussah. Sauber und in einwandfreiem Zustand. Es war ihr immer wichtig, gut auszusehen, wenn sie herkam. Sie freute sich, einen Anlass zu haben, sich hübsch zu machen, auf ihr Äußeres stolz zu sein. Selbst wenn es ein Anlass wie dieser war. Sie atmete ein paarmal tief durch. Versuchte, sich zu entspannen oder wenigstens einen entspannten Eindruck zu machen. Doch nicht einmal das gelang ihr.
Keith Bailey, der Mann, der ihr gegenübersaß, lächelte, und Janines Angespanntheit legte sich ein wenig. Sein Lächeln machte ihr Mut.
»Heute sind Sie allein gekommen?«, fragte er.
Janine nickte. »Ich … ich hab’s versucht …« Sie schniefte, holte zitternd durch die Nase Luft. »Ja, heute bin ich allein.«
»Also schön.« Keith nickte ebenfalls, dann lächelte er wieder. Er trug bequeme Freizeitkleidung: ein Hemd aus weichem Karostoff und Chinos. Blonde Haare, modischer Schnitt. Brille. Er hatte seine Notizen auf den Knien liegen, bislang aber noch nicht hineingeschaut. Er war mit Janines Geschichte vertraut. Sie kam seit einigen Wochen zu ihm. Meistens alleine, was nicht ideal war, aber … so war es eben manchmal. Leider.
»Also …« Keith machte eine Pause, damit Janine Gelegenheit hatte, sich zu sammeln, bevor sie ernsthaft mit dem Gespräch begannen. »Wie läuft es mit Terry?«
Janine seufzte. Ihre Hände begannen aufs Neue zu zittern. »Wie … wie immer. Er …« Sie nahm die Hände von den Armlehnen und stellte die Füße nebeneinander. Schlang sich die Arme um den Leib, weil sie merkte, dass ihre Hände immer stärker zitterten, vor allem die linke. Immer war es die linke. »Er …« Sie seufzte. »Ich … ich dachte, es würde besser werden. Nach – Sie wissen schon. Nachdem er hier war.«
Keith nickte. Diesen Satz – oder ähnliche Sätze – hatte er schon oft gehört. Viel zu oft.
»Aber er … er … Na ja, ein paar Tage lang war es ganz okay. Nach dem ersten Mal. Er hat … sich mehr Mühe gegeben. Mit mir und den Zwillingen. Er … hat nachgedacht, bevor er … was getan hat.«
Keith nickte und rutschte ein wenig auf seinem Stuhl hin und her. »Und hat er sich jemals Hilfe gesucht? War er bei dem Therapeuten, dessen Nummer ich ihm gegeben hatte?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Er … er hat gesagt, er würde es machen. Und ich glaube, er hatte es auch wirklich vor, aber dann … hat er es doch nicht gemacht.«
»Verstehe.« Keith nickte und notierte sich etwas auf seinem Block. »Verstehe. Und wie ist er im Umgang mit den Zwillingen?«
Das Zittern von Janines Hand wurde noch stärker. Sie presste sie fest gegen den Körper. »Er … er ist wieder wütend auf sie geworden.«
Mit einem Blick voll professioneller Anteilnahme beugte Keith sich nach vorn. »Hat er ihnen etwas getan? Ist er ihnen gegenüber in irgendeiner Form gewalttätig geworden?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Nicht …« Neuerliches Kopfschütteln, diesmal mit noch mehr Nachdruck. »Nein.«
»Sind Sie sicher?«
Sie nickte, ohne ihn anzusehen.
Keith lehnte sich zurück. Er war lange genug als Paartherapeut tätig, um zu merken, wann jemand log. Nicht nur log, sondern etwas vertuschte. Etwas Unangenehmes. »Sind Sie sicher, Janine?«
Noch immer mied sie seinen Blick.
»Janine?« Keith stützte die Ellbogen auf die Oberschenkel. Senkte die Stimme. »Ist er den Jungen gegenüber handgreiflich geworden?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein.«
Keith begriff und lehnte sich erneut zurück. »Hat er Sie wieder geschlagen, Janine?«
Sie nickte. Und gleich darauf begannen die mühsam zurückgehaltenen Tränen zu fließen.
Als sie Terry Gillen kennenlernte, glaubte Janine Darvill, den perfekten Mann gefunden zu haben. Groß, dunkelhaarig, gutaussehend, ein bisschen draufgängerisch. Erst später fand sie heraus, dass es mehr als nur ein bisschen war. Und dass sie nicht die Einzige war, die sich davon hatte einwickeln lassen. Leider war sie zu dem Zeitpunkt bereits mit ihm verheiratet und von ihm schwanger.
Die Vorstellung war so romantisch gewesen – oder zumindest hatte sie sich das eingeredet: einen gutaussehenden Mann kennenzulernen, Kinder mit ihm zu haben, für immer glücklich zu sein. Ihre Freundinnen waren alle auf der Schule geblieben, hatten ihren Abschluss gemacht und eine Ausbildung angefangen. Einige waren sogar zur Uni gegangen. Ursprünglich hatte Janine das auch vorgehabt: eine Ausbildung machen, zur Friseurin oder Kosmetikerin oder Ähnliches. Auf jeden Fall einen anständigen Beruf erlernen und eigenes Geld verdienen. Dann einen Mann finden und Kinder bekommen … Gut, die letzten beiden Vorhaben hatte sie ja verwirklicht. Mutter mit siebzehn, verheiratet mit achtzehn.
Terry war ihr erster richtiger Freund. Er war ein paar Jahre älter als sie und hatte vor ihr ein ziemlich wildes Leben geführt, aber darüber wusste sie Bescheid. Es gefiel ihr sogar; sie fühlte sich geehrt, dass so ein Mann von Welt sich ausgerechnet sie ausgesucht hatte.
Nur dass er das gar nicht getan hatte. Kaum waren die Zwillinge da, ging er wieder jeden Abend auf die Piste, trank und kam manchmal tagelang nicht nach Hause. Er arbeitete als Dachdecker – wenn er denn arbeitete –, und manchmal »vergaß« er ganz einfach, ihr das Haushaltsgeld dazulassen.
Janine verbrachte immer mehr Zeit allein. Beziehungsweise allein mit zwei plärrenden Babys, deren Pflege sie oft überforderte, zumal sie selbst noch fast ein Kind war. Sie hatte niemanden, an den sie sich wenden konnte. Ihre alten Freundinnen arbeiteten oder studierten.
Ihre Mutter half aus, wo sie konnte, aber sie hatte darüber hinaus auch noch für Janines Stiefvater zu sorgen, der dauerhaft krankgeschrieben war. Janine wusste genau, dass er Diabetes hatte, weil er zu viel trank und übergewichtig war, auch wenn ihre Mutter steif und fest behauptete, er hätte einen Arbeitsunfall gehabt.
Allmählich wuchs Janine die Situation über den Kopf. Sie sagte Terry, er müsse öfter zu Hause sein, mehr Verantwortung übernehmen. Das war der Tag, an dem er sie zum ersten Mal schlug.