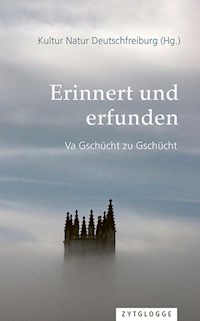
24,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zytglogge Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Veranstaltungsreihe "Va Gschücht zu Gschücht" setzen sich Autorinnen und Autoren aus Deutschfreiburg mit einem vorgegebenen Thema auseinander. Sie machen sich Gedanken zu ihrer Kindheit, ihrer Identität und ihrer Sprache. Ihre Texte behandeln essenzielle Fragen, geben verblüffende Antworten und unterhalten mit sprachlicher Kreativität. Wie zeichnen Freiburgerinnen und Freiburger ihre Lebenswelt nach, was für Gemeinsamkeiten lassen sich erkennnen und welche Unterschiede prägen sie? Wie Mosaiksteine schaffen ihre Beiträge im Gesamtbild ein lebendiges literarisches Porträt der Region.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 215
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Meinen ersten und einzigen Fluchtversuch unternahm ich mit fünf Jahren. Ich glaube, es war an einem Sonntagnachmittag im Sommer. Auf der Terrasse vor dem Haus sassen Eltern und Geschwister beim lockeren Gespräch. Meine Siebensachen hatte ich in einem Plastiksack verstaut, den ich hinter meinem Rücken versteckt hielt. Heimlich bewegte ich mich über den Vorplatz der Strasse zu. Ich, der Beobachter, nahm die Beobachtenden ebenso misstrauisch ins Visier wie sie mich. Ihre lachenden Gesichter verrieten mir: Du bist entlarvt, es gibt kein Entkommen mehr. Beschämt trat ich den Rückzug an.
Heute bin ich nicht mehr so sicher, ob ich es nicht von Anfang an darauf abgesehen hatte, entdeckt und also zurückgeholt zu werden. Was hätte ich als Fünfjähriger mit der gewonnenen Freiheit auch anfangen sollen. So blieb ich halt dort, wo ich hingehörte: daheim.
Hubert Schaller
KULTUR NATUR DEUTSCHFREIBURG (KUND) (HG.)
ERINNERT UND ERFUNDEN
Der Herausgeber und der Verlag danken herzlich für die Unterstützung:
Der Zytglogge Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
Deutschfreiburger Beiträge zur Heimatkunde Bd. 83
© 2019 Zytglogge Verlag
Alle Rechte vorbehalten
Redaktionelle Mitarbeit: Claudine Brohy
Lektorat: Angelia Schwaller
Korrektorat: Jakob Salzmann, Christian Schmutz
Fotografien: Romano P. Riedo
e-Book: mbassador GmbH, Basel
ISBN ePub 978-3-7296-2290-6
ISBN mobi 978-3-7296-2291-3
www.zytglogge.ch
Kultur Natur Deutschfreiburg (KUND) (Hg.)
Erinnert underfunden
Va Gschücht zu Gschücht
Bei der Schreibweise des Untertitels wurde bewusst auf die Sonderzeichen verzichtet.
Inhalt
Vorwort
Begleitwort
«Wier ggùgge de …»
Hildegard Emmenegger Riedo
Lǜǜge bim Byychte
Angelia Maria Schwaller
Ueli Johner-Etter
Mier luege de …
Rita Zumwald
Wier ggùgge de …
«Nit z vǜù grǜble»
Henrik Rhyn
Nit z vǜù grüble
Fränzi Kern-Egger
Nit z vùu grǜble
Debora Rupf
Frostils verflixte Wahl
«Dù chùnsch nit druus»
Thomas Vaucher
A verhängnisvoli Sprǜǜchereta
Simea Schwab
Dù chùnsch nit druus 1
Otto Piller
Die letzte Ehre für das ehemalige Verdingkind Joseph Z.
Urs Haenni
Mühlheim
«Wär bǜschù? Va wana chùnschù?»
Christian Schmutz
Di wichtigschte Fraage im Lääbe
Hubertus von Gemmingen
Von Wanderern und anderen Fötzeln
Josef Jendly
Ds Tschimpämperli ùs Eritrea
«Bǜschù bilänggi? Bǜschù bilängga?»
Josef Bossart
I bǜ mécol ù nit técol
Bernard Waeber
Ohne Titel / Sans titre
Thomas Kadelbach
Kimi lacht
Monique Baeriswyl-Mauron
Ùnderùm Stäärnehǜmù
«My Chinnhiit»
Hubert Schaller
Auf der Suche nach dem Kind, das mich sucht
Irène Fasel
Zum Goldenen Kreuz
Armin Schöni
Kindheit-en
«Ma redt nit drùber»
Marijke Schnyder
Es Plädoyer
Joseph Buchs
Jaun, abgelegen und doch in der Mitte
Anaïs Schneider
Im Spital
Biografien der Autorinnen und Autoren
Zu den Fotografien
Vorwort
Am 27. Juni 2013 startete die ‹Deutschfreiburgische Arbeitsgemeinschaft› (DFAG) mit der Lesereihe ‹Va Gschǜcht zu Gschǜcht›. Hildegard Emmenegger, Angelia Maria Schwaller, Ueli Johner-Etter und Rita Zumwald schrieben für diesen Abend einen Text zum Thema Wier ggùgge de … Diese Geschichtenreihe wird auch unter dem neuen Verein ‹Kultur Natur Deutschfreiburg› (KUND) weitergeführt.
Angefangen hat die Lesereihe eigentlich schon im Herbst 2001 mit einem Gedenkanlass für den verstorbenen Obwaldner Sagenforscher und Erzähler Hanspeter Niederberger. Geri Dillier von SRF und Christof Hirtler luden drei Autoren und eine Autorin nach Giswil/OW ein, die je eine Geschichte schrieben als Hommage an besagten Hanspeter Niederberger. Aus dem einmaligen Anlass wurde eine Reihe. Jedes Jahr im November lasen seither vier Autorinnen und Autoren extra für diesen Abend verfasste Geschichten. 36 Geschichten sind es geworden, die von 36 Autoren in der Krone in Giswl/OW vorgetragen wurden. Neben Schreibenden aus Obwalden und Nidwalden wurden aber auch «Auswärtige» wie etwa Franz Hohler, Max Huwyler, Linard Bardill, Gisela Widmer, Christian Schmutz, Lukas Hartmann und viele andere zum Leseabend eingeladen.
‹Va Gschǜcht zu Gschǜcht› ist also keine Erfindung der DFAG gewesen. Bei gemeinsamen Überlegungen, in welche Richtung ein Beitrag der DFAG bei ‹Wier Seisler› gehen könnte, hat mir Christian Schmutz von diesem Anlass in Obwalden erzählt – damit war die Idee für diese Lesereihe in Deutschfreiburg geboren.
Das Konzept ist einfach: Ein- bis zweimal im Jahr wird ein Leseabend durchgeführt. Für einen solchen Abend ist vorgesehen, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Persönlichkeiten oder Bürgerinnen und Bürgerinnen aus dem Sense-, See-, Greyerzbezirk, der Stadt Freiburg oder auch aus anderen Teilen des Kantons Freiburg sowie dem angrenzenden Gebiet des Kantons Bern zu einem bestimmten Thema, das vorgegeben wird, eine Geschichte, Gedichte, eine biografische Aufstellung oder Ähnliches schreiben.
Diese Geschichten finden sich in diesem Buch, das Sie in der Hand halten. Wer an dem einen oder anderen Anlass live dabei gewesen ist, mag sich wieder an die eine oder andere Episode erinnern. Ihnen allen wünsche ich viel Freude und gute Unterhaltung beim Lesen dieser Geschichten.
Martin Tschopp, ehem. Präsident der DFAG
Begleitwort
Va Gschücht zu Gschücht – Va Jaar zu Jaar
Seit nunmehr sechs Jahren werden in Deutschfreiburg in unregelmässigen Abständen Texte zu gestellten Themen geschrieben und vorgetragen. Die Autorinnen und Autoren dieser Texte sind bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller, Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Bildung, Kultur, Verlagswesen und Wissenschaft. Darunter sind aber auch Personen, die im stillen Kämmerlein ihre Freuden und Sorgen ihrem Tagebuch anvertrauen oder einfach gern schreiben; oder auch solche, die mit der Schriftlichkeit wenig Erfahrung haben und sich auf die Herausforderung eingelassen haben.
Seit Anfang der Veranstaltungsreihe haben wir eine Publikation der Beiträge in Aussicht gestellt. Heuer wurde diese Realität und wir konnten eine Auswahl der bisher präsentierten Texte in Form von Band 83 der ‹Deutschfreiburger Beiträge zur Heimatkunde› herausbringen.
Und Sie werden sehen, die Themen wurden sehr kreativ, persönlich und frei umgesetzt.
Deutschfreiburg wird sowohl geografisch als auch sprachlich weit gefasst. Die Teilnehmenden kommen aus den verschiedenen Teilen des Kantons Freiburg, aber auch von ausserhalb des Kantons, weil sie als ehemalige Bewohnerinnen und Bewohner oder sonst einen Bezug zu Freiburg hatten oder immer noch haben. Sie sind deutschsprachig oder zweisprachig, oder irgendetwas dazwischen, viele beherrschen auch noch andere Sprachen. Sie schreiben auf Hochdeutsch, in verschiedenen Dialekten, gemischt, auf Französisch oder auch in Bolz, sie flechten ganz spontan Umgangssprachliches, Helvetismen und auch Freiburgismen in ihre Texte ein.
Die Teilnehmenden waren auch sehr kreativ im Umgang mit Textsorten. Die Themen wurden in Form von Autobiografie, Tagebuchausschnitt, Reisebericht, Drama, Erzählung, Gedicht, Lied, Spoken Word usw. umgesetzt und wurden gelesen, geslammt oder gesungen. Verschiedene Generationen haben spontan mitgemacht, auch wenn wir gern mehr Junge für unsere Veranstaltungsreihe gewinnen würden.
Die gestellten Themen, darunter im Alltag häufig gebrauchte Wendungen oder Fragen, konnten sehr frei interpretiert werden: Die Autorinnen und Autoren schrieben über Wier ggùgge de …(Hildegard Emmenegger, Angelia Maria Schwaller, Ueli Johner-Etter und Rita Zumwald), Nit z vǜù grǜble (Henrik Rhyn, Fränzi Kern-Egger und Debora Rupf), Dù chùnsch nit druus (Thomas Vaucher, Simea Schwab, Otto Piller und Urs Hänni), Wär bǜschù? Va wana chùnschù? (Christian Schmutz, Hubertus von Gemmingen und Josef Jendly), Bǜschù bilänggi? Bǜschù bilängga? (Josef Bossart, Thomas Kadelbach, Monique Baeriswyl-Mauron und Bernard Waeber), My Chinnhiit (Hubert Schaller, Irène Fasel und Armin Schöni) und Ma redt nit drùber (Joseph Buchs, Marijke Schnyder und Anaïs Schneider) spannende und fesselnde Geschichten.
Der Titel der Publikation ‹Erinnert und erfunden› zeigt, dass zum Teil Persönliches preisgegeben wurde, dass aber die Grenze zwischen Erlebtem und Erfundenem schmal ist. Hie und da treffen verschiedene Welten aufeinander. Weltgeschichte vermischt sich subtil mit persönlichem Schicksal und alte Motive werden neu interpretiert. Mögen die dargestellten Identitäten und Sensibilitäten noch so unterschiedlich sein, sie zeigen alle die Komplexität des Menschseins auf.
Claudine Brohy, ehemaliges Vorstandsmitglied der DFAGund Vorstandsmitglied von KUND
«Wier ggùgge de …»
Hildegard Emmenegger Riedo
Lǜǜge bim Byychte
Was ii früer iis ggloge han bim Byychte, wan ii Chinn gsyy bǜn. Grad uusgrächnet bim Byychte z lǜǜge – dasch a Liida. Wier ggùgge de itze, wen i verzele, ob es hie ine nit no mee Lütt i mym Auter gitt, wa daas genau glyych erläbt hii wyn ii.
Fǜr üüs Katholyke isch öppis ganz Gäbigs erfùne choo, nämlich ds Byychte. Ma cha in as houzigs gröössersch Trùckli ychi chnöye, dǜrnas Ggitterli d Sǜnde im Pfaarer i ds Oor ychi chǜschele, ù nay ùberchùnt mù d Vergääbùng oder ma cha o sääge d Absolution. Aber dass dia cha i Chraft trätte, muess mù zeersch no tou bätte – je nach Schweeri va de Sǜnde as par ‹Gegrüsst seist du, Maria› oder ‹Vater unser›.
Asoo wyn iis itze beschryybe, isch es früer gsyy. Hütt isch daas ganz andersch, ù d Chinn müesse nümme Angscht haa. Hütt siit mù o Versöönùngsfyyr ù nümme Byychte.
Va där Byychteryy früer wott i ööch aber itze no a bitz mee verzele. Ùs Chinn isch daas fǜr mier a Ryysestress gsyy. Afange han i ds Sätzli am Aafang müesse ùswenig wǜsse: «Ich bin ein Mädchen von 10 Jahren. Meine letzte Beichte war vor 4 Wochen.» Ù nay isch ds grööscht Probleem choo – was sol ii i Gotts Naame nùme ga byychte?? Mier sy ifach ging z weenig Sǜnde i Sinn choo. Ù eppa aso dryù, vierù han i scho wöle sääge – dä Aasprùch han ii scho ghääbe a mier. Dewüle wan i ùfùm Chnöybänkli gwaartet han, bys i dra chùme, het daas i mym Hǜrni grùùchnet. I bǜ tùmmerwyys as tou as lùùbs ù gäbigs Miitli gsyy.
Auso: «Ich habe gestohlen» giit ging. Wäge, das han i de scho gmacht, aubeniinisch de Mama as Guetsi ùsùm Chùchischäftli gstybytzt.
Auso, i ha wytter gstudiert. Öppis, wan i o ging ha chene sääge, isch gsyy: «Ich habe gelogen.» Wül ii ja meischtens as par Sǜnde erfùne han.
So het sich de Kreis wùnderbaar gschlosse. I ha Sǜnde erfùne ù ha nay chene sääge, i hiigi ggloge. Das giit doch tipptopp uuf.
Nam Byychte han ii ging as wùnderbaarsch Gfüù i mym Chinderhärz ghääbe. Mier isch es liecht, waarm ù woou gsyy inefǜǜr. Asoo hett ds Byychte auso doch a gueta Zwäck ghääbe.
Itze chùmen ii ùmmi zù de Uusgangsfraag: Wier ggùgge de … ob daas no anderi da ine asoo erläbt hii. Da bǜn i tou sicher.
Z Byycht gange hütt nümme a Huuffe Lütt. Aber zwǜschenyy a Rǜckblick haute, zrùgg ggùgge – bsǜne – ruuig choo – ù nay vǜri ggùgge … Das tuet doch ging guet. Ù scho de Konfuzius het gsiit: «In der Ruhe liegt die Kraft.»
Genau häre ggùgge
Wier ggùgge de … cha a ganz a ùnverbindlichi Uussaag syy. «Jùù, wier ggùgge de … wier gsees de no.» Das hiisst, dass mersch amaau tüe verschiebe ù üüs no nit wii verpflichte.
We mer ds chlyyna Wörtli ‹de› awägg laa, bechùnt das Ganza a anderi Bedütùng: Wier ggùgge (oni ‹de›) – hiisst fǜr mier: häre ggùgge, genau ggùgge, d Ùùge nit zue tue, studiere ù nay handle.
Mengisch fraagen i mier, ob ii, wan i jùngi gsyy bǜn, das Wier ggùgge häre, besser chene hiigi. Wier sy doch ga demonschtriere, ga Sträässleni blockiere, hii scho denn Mǜhlebärg nit wöle, hii fǜr ‹Amnesty› Briefe gschrǜbe, sy ga Ùnderschrǜfte sammle ù hii nis probiert z were, ùf a Huuffe verschideni, mee oder weniger origineli Aarte. Vor alùm hii mer öppis gmacht.
«Wier müesse öppis ändere – fǜrna besseri Wäüt» – dasch denn üsa Lääbessinn gsyy. Oni dä ggläbt Idealismus weeren es nit ggange. Ù itze? Wo isch dä Kampfgiischt bblǜbe?
Myna isch mit mier zäme öüter choo ù lyysliger. Är isch gglùùben ii nit ganz verschwùnde – i hoffes ömù. I wott ifach itze nümme graad di ganzi Wäüt rette.
Vilicht probieren is im Chlyyne, im Ùmfäüd oder bi einzelne Sache. (Myna ökoloogischa Fuessabdrùck isch grösser aus ds 38, wa fǜr mier längti – i wetti nit ds Lääbe lang imena 45 ùmaschuene oder ging as grössersch Nùmmerù bruuche.)
I wetti ging möge häre ggùgge, asoo guet, wyn i chann, o wen ii öüter chùme.
A waari Gschǜcht
Wier ggùgge de … zù dier! Das hiisst o, zùnenand ggùgge ù anann ùnderstǜtze, wen es nöötig isch. Zù däm han i itz a bitz as lengersch Gschǜchtli fǜr ööch, wa mier ganz genau asoo passiert isch – asch nüüt erfùne.
I bǜ öppis ùber zwenzgjerigi gsyy ù vǜü mit mynneri Vespa ùma pfùret. Amana Karfryttig – ù ass isch wichtig, as es de Karfryttig isch – bǜn i mit mym Töff va Dǜdinge ùf Santwoufgang wùy gfaare zù myne Öütere. Asch am Yynachte gsyy, as hett ggräänet ù a dǜschteri Stǜmig het sich verbriitet. Myni Lampa a de Vespa het felig nùme wyn as Aarmeseeleliechtli möge zǜnte.
Daa, plötzlich ùnet Santwoufgang, han i ùf mynneri Straassesytta a Gstaut gsee lùùffe – imena lenge wysse Ggwann, wa bys ùf e Bode ay giit ù wa as grüselig groosses, houzigs Chrüz ùf de Schùutere triit het. Härrggott, bǜn ii erchlǜpft! I ha grad no chene ùmahaa ù a Kùrva schryysse, fǜr däri Erschyynig uuszwyyche.
Dehiim aachoo, han i de Töff abgstöut, bǜ ùf waggelige Chnöy i d Stùba ychi ù ha gsiit: «I gglùùbe, i spine! Itz han ii a Mändù gsee imana wyysse Chliid, wa as houzigs Chrüz triit. Dasch doch nit mǜglich!» I bǜ jùscht erschǜchni ù tou tuuchi gsyy. «Dasch doch bigoscht nit z gglùùbe! Ù daas am Karfryttig, wa Jesus am Chrüz gstoorbe isch.» I ha a mier zwyyflet.
Ù da het de Vatter gsiit: «Wier wii ggùgge!» Äär het ds Outo gnoo ù isch äbe ga ggùgge.
Ùngedùudig ù mit Härzchlopfe han i gwaartet, bys wan er ùmmi zrùgg chùnt. Endlich, endlich isch d Stùbetǜǜr uufggange: «I ha nüüt gsee.» Tondermùscht, itz bǜn i no mee zùnderobsi gsyy.
Was han ii wöle – nach alùm Vǜretsi- ù Hindertsistudiere han i probiert, di ùhiimeligi Begägnùng z vergässe.
As par Wùche speeter het mier de Vatter aagglüttet. Är wǜssi itze d Uuflöösùng va mynneri Erschyynig. Bim Aperitif na de Mäss im Ochse sygi uuschoo, dass di ‹Roti Bysa› am Karfryttig mit ama Chrüz zù de Kapuschynner ùf Frybùrg ychi bbilgeret sygi. Ù i däm Moment, wa de Vatter mitùm Outo isch gsyy ga d Kontroufart mache, syg en e graad im eerschte Huus va Santwoufgang yygcheert ù hiigi dette as Ggaffi ghǜǜsche, wül er chaut ghääbe hiigi.
(Itz muess i grad a Chlammara mache fǜr d Nit-Seisler ù di Jùnge da ine: Di ‹Roti Bysa› isch as Seisler Originaau; a öütera Maa mit rootùm Haar ù rootùm Bart. Är isch bekannt gsyy dǜr ùngwöönlichi Akzioone, sys Uufträtte ù ds speziela Outfit – fǜrnas Maau as modäärns Wort z bruuche. Äbe – no as jùschts Originaau.)
Ier chiit ööch villicht voorstele, wy di Bootschaft mier guet taa het. I spine nit! I ha nüüt arsùne – as gitt a Erkäärig.
Ù im Vattersch Wier wii ggùgge – wier wii dier häüffe – isch denn a däm Karfryttig Goud wärt gsyy.
Angelia Maria Schwaller
vǜri ggùgge
jeda moorge
i de wytti
va de wäut
staa
ù nit wǜsse
ob linggs
oder rächts
z gaa
statt
mitùm blick
ging
graduus
dyne trǜǜm
naa
wa flye
mit de zytt
häre ggùgge
i de lùft
flǜgt
as mùnzigs
bijeni
va iir blüeta
zù de näächschti
triit es
ds lääbe
ù ùf iinisch
chùnt
ds chlyyna
grooss
aaggùgge
iinisch
as lengs
anann
aaggùgge –
dǜr d ùùge
vam andere
di ganzi wäut
gspǜre
ù debyy
mee gsee
aus ali maau
devoor
as dehiim,
nit bbùne
ana oort,
ganz oni
wort –
dier sääge
fǜr hütt
oder ging 1
zùnann ggùgge
bi jedùm schritt
gäge vǜri
ù bi aune
lätze tritte
ùf jedùm graat
ù aune wääge
taff i öyi hann
nää
zùm wyttergaa
as lääbe lang
stanet ier
a myr sytta
zrùgg ggùgge
iis ùm ds andera
möbù
chùnt awägg
traage
ùs däm huus
usi
wa nümme
waarm isch
bblǜbe sy
di bruune egge
näbùm lache
ùf de fotto
ù dä vertrout
ggrùch va eener
wa mier
a dier psünt
ùnderùm dach
obe
am hǜmù
am nööchschte
Ueli Johner-Etter
Mier luege de …
Sit parne Jahr läbe my Frou, d Martha, und ig im Stöckli näbem Burehus, wo jetz dr Christoph, üse Suhn, mit syr Familie gwärbet. Letschthin isch my Frou nit deheime gsi, u drum bin i zum Zmittagässe übere i ds Burehus.
Dr gross Tisch, wo sinerzyt no mier hei la schrynere, gseht us wi ne grosse Chuechebitz, drum passt er schön i Egge. Mit em Bank u mit de vier Stüeu voor ar Ründi hei rundume guet u gärn zäh Pärsone Platz.
Won i yche chume, streckt mir dr zwöijährig Julian es schwarz tschägges Houz-Chueli entgäge, wo äs Bei fählt, u seit: «Kaputt!»
O sy Vatti mues das verunglückte Tierli beguetachte u seit em chlyne Stünggu: «Mier luege de …»
Dr chly Julian isch mit dere Antwort zfride. Mier luege de heisst für ihn, dr Papa cha das Malheur scho flicke und aus chunnt guet.
Es het mer gheimelet, i dr grosse Rundi dörfe Zmittag z ässe. Voor am Tisch d Schwigertochter, d Theres, u dr Christoph u zwüsche ihne i ihrne Tripp-Trapp-Stüeli d Zwillinge, dr Julian u d Leonie. Uf em Eggbank dr Jusei, üse japanisch Praktikant, dr Pioter, e junge Bursch us Pole, dr Dani, e Göttibueb vor Theres, wo i üsem Dorf Landmaschinemechaniker lehrt u hie zu syre Gotte chunnt cho ässe, und de für einisch äbe no ig.
Plötzlich het d Leonie gmerkt, dass ihre Nuggi vom Stüeli ungere Tisch gheit isch, u scho hets zetermordio tönt: «Nuggi, Nuggi …» Wiu grad keis vo de Eutere het Gluscht gha, unger Tisch u Bank z schnaagge, für dä Nüggu füre z sueche, seit Theres zu däm chlyne Pärsönli: «Leonie, s isch scho guet, mier luege de …» U prompt sy d Träne trochnet. We ds Mueti seit Mier luege de, isch das Troscht u Gwüssheit, dass dr Nuggi nit verlore isch.
Dä Spruch oder di Ussag Mier luege de gä emene Chlyching Vertroue, Troscht u Gwüssheit, dass öppis Kaputts, Verlornigs oder was o ging ume cha gflickt, gfunge oder ygränkt wärde.
Mier luege de … i ha aafa sinniere. Begleite di drü Wörtli üs nit dür ds ganze Läbe? Auerdings wärde si je nach Läbesabschnitt, Läbesphase, Bruef oder usserbrueflicher Tätigkeit verschide bbruucht, ygsetzt u überchöme je nach Situation e angere Sinn.
Sobau bim Ching oder bim ene junge Mönsch dr Wille stercher bis starch usprägt wird, ghört me aus erschti Antwort vo Mueter, Vater, Gotte oder Götti uf Wünsch für Spiuzüg, Ungerhautigselektonik, Velo, Töffli oder was o ging: Mier luege de … u das nit zletscht für chlei Zyt z gwinne vore definitive Zue- oder Absag.
Nit säute isch ja vo dr Erfüuig vo vilicht nit grad autäglich Wünsch a das Mier luege de no e Bedingig aaknüpft; zum Byspil ir Schuel im einte oder anger Fach meh Flyss z zeige u sech meh Müei gä oder deheime irgend es Ämtli, e uftreiti Arbeit erledige, wis öppe so Bruuch isch ir Familie.
Eis oder zwöi Jahr vor Schuelschluss sött sech dr jung Mönsch entscheide: Wott i wyter i d Schuel, i Gymer, machen i e Bruefslehr oder was wott i überhoupt lehre? Am Aafang vo dere erschte grosse Entscheidig im Läbe überchunnt das Mier luege de scho ganz e angeri Bedütig; mi mues sech würklech drum tue, entscheide u luege, wo gahn i i Gymer, wo überchummen i e Lehrsteu. Äs isch plötzlech äs konkrets «Was, Wenn, Wo, und Wie?» nötig.
U no speter bi de junge Bursche u Manne im Militär, da heisst de scho grad gar nümme Mier luege de …, u no weniger «Nei», nit emau es «Ja» isch gfragt! Da heissts «Verstange!» oder «Zu Befäu!»
So geits wyter, jede Mönsch mues sech geng u geng ume entscheide: bi Veränderige, für brueflichi Wyterbildig, sygs bim ene eigete Betrib oder i re Füerigsposition; je nachdäm für Aapassige, Umstrukturierige, Innovatione oder Inveschtitione.
Für es Zämeläbe mit Familie oder für es Alleiniblybe, für wie und wo z wohne, für x Entscheidige … Mi chönnti e ganzi Zylete vo Frage ufzeue, wo im mittlere Läbesabschnitt a eim häre treit wärde, wo me sech ir Regu mues oder sötti entscheide. Zueggä, viufach hilft o dr Zuefau, angeri säge vilich ds Schicksau oder d Vorhärsehig, mit u nimmt eim Entscheide ab.
Wiu dr Herrgott aber bekanntlech, wi me so seit, viu verschideni Choschtgänger het u d Lüt so ungerschidlich si wi üsi Friburgerlandschaft, hets o Mönsche wo ihrer Läbtig bim Mier luege de blybe u ihrer Läbtig Müei hei, für sech für ds einte oder ds angere z entscheide.
U de gits natürlech o derigi, wo sech ganz bewusst nit wei la feschtlege, niemer wei ertöibe oder bi aune wei guet Wätter ha.
Me seit so häregredt, das syg e Eigenart vo de Politiker, u das isch vermuetlich gar nit so fautsch. Zumindescht e Teu vo dere Spezie het öppe Müei, sech fadegrad für es «Ja» oder «Nei» z entscheide. Äs isch drum soumässig bequem uf enes Aalige, e Frag oder bi nere Diskussion statt emne «Ja», «Ja, aber» oder «Nei» mit em unverbindleche Mier luege de z antworte!
Aber was verzeuen i da, dier wüsst sicher scho, was i meine? Schliesslich hets ja im Grossratssau ygchlemmt zwüschem grüene Knopf für «Ja» u em rote für «Nei» äbe no e dritte, e gäube; mit däm chöi sech d Parlamäntarierinne und Parlamäntarier so ähnlich üssere wie, Mier luege de oder wi me da seit: «Enthautig.»
Dr Julian seit: «Fertig ässe! Itz Dässär!»
U ds Mueti git Antwort: «Mier luege de! Aber zersch wei aui angere no fertig ässe …»
Scho ume Mier luege de! E Momänt bin i ume ir Würklechkeit; aber i spinne my Fade no wyter.
Bekanntlech chunnt ja d AHV, wi me so seit, nit eleini; im Pengsionsauter chöme o Bräschteli u Bräschte u mi mues sech da dermit arrangiere u abfinge oder s ömu probiere, das isch zwar nit ging eifach. Mängisch wott me das drum eifach partout no nit wahr ha u überspiut e Empfählig vom Huusarzt, Zahnarzt, vo Aaghörige mit emene Spruch … Dier heits errate: Mier luege de.
I dänke zrugg, wos myre Mueter, wo bir Schweschter gwohnt het, gsundheitlech nümme guet ggange isch. Mier Ching hei gfunge, jetz wär dr Ytritt i ds Autersheim ds Beschte. Was seit me da uf ds «Nei» vo re 86-jährige Frou?
Mier luege de, gang doch afe für ne Wuche i ds Feriebett! Sicher gfauts der de dört. U so wird plötzlich ds Unvorsteubare vorsteubar u müglich oder mues, we villicht o mit Müei, akzeptiert wärde.
I dänke, mier wirds einsch uf irgend e Art o so ergah. Aber vorlöifig giut natürlich für mi no: Mier luege de!
Merci, Julian, danke, Leonie für öies Plapper, wo dr Grossätti während emene Mittagässe e chlei i ds Philosophiere bbracht, u schlussändlech o dr Aastoss für das Gschichtli ggä het.
Sicher wärdet o Dier, öiji Cousin u öiji Cousine uf em wytere Läbeswäg di drü Wörtli no mängisch i verschidene Situatione ghöre u de schlussändlech o säuber bruuche. Mier luege de!
Rita Zumwald
Wier ggùgge de …
As Thema zu drüüne Wort, wo wier ali woou ging ùmmi bruuche. I welùm Zämehang chäme mer drùf, daas z sääge? Isch es, we mer grad nit wǜsse, was mer sǜǜ antworte, oder isch es, wüù äbe eppis o di nöötegi Zytt bruucht oder isch es ifach, wüù mer no mee Informatione bruuche, fǜr nis chene fǜr eppis z entscheide? Iigentlich ganz as spannends Thema, we mù bitz lenger drùber nadeicht.
I ha maau as paar mǜglechi Bedütige vo wier ggùgge de … ùsenann gnoo ù soozsääge seziert. So ùf di Schnäli tönt wier ggùgge de … eener bitz trääg ù ùnentschlosse oder gar negativ. As muess nit syy, dass ier i däm Mùmänt o myri Miinig syd, aber i gaa itz maau devaa uus. Wen ii ǜberlege, wyn i säuber ùf wier ggùgge de … reagiere, isch das scho meischtens eener ùngedùudig. Auso fǜrnas Byschpǜü z nene: Wier ggùgge de … was debyy usachùnt. Das chii mer grad ùf beidi Sytte dütte. Ùf de einti Sytta töönt es na hinderilääne ù abwaarte, was passiert, oni sich wytter drùm z kǜmmere – ù ùf de anderi Sytta isch vilich genau dä Rumm nöötig, dass daas, wo setti wachse o cha wachse. So chan es mengisch o no schwirig syy, z wǜsse, was itz grad wichtig ù o richtig isch.
I wiis, das isch chli wytt ddeicht, aber i cha öich daas vilich no mit iim vo myne Gedicht a bitz anders erkläre:
As isch, wyn es isch …
As isch, wyn es isch,
sääge mer vǜü ù deiche nit dra,
dass üser Gedanke üsers Lääbe tüe gstaute …
As isch, wyn es isch,
ù wier gäbe uuf, vergässe dra z gglùùbe, dass mer a Chance hii,a Veränderig z erhoffe …
As isch, wyn es isch,
cha o a Muetloosigkiit syy ùn a Trääghiit,
eppis i d Fingere z nää, wo üüs d Spuur laat la wächsle …
As isch, wyn es isch,
töönt na resygniere, nit na Vertrue ù Motivation, a Wääg chene
z füne, wo in a anderi Richtig giit …
As isch, wyn es isch,
söu a Aareiz syy, eppis chene aaznää, wo i däm Mùmänt ifach
zue nis köört …
As isch, wyn es isch,
aber vo daa uus wyttergaa ù offe syy fǜr daas, wo üsi Sööu ù üsa
Geischt laat la wachse ù ryyffe …
As isch, wyn es isch,
so chää mer voran ùf üsùm Wääg, wo üüs bärguuf ù bärgab tuet
dǜr ds Lääbe wyyse …
As isch, wyn es isch,
dankbar syy ù Liebi gspǜre gitt Chraft, tuet üüs traage ù zùm
richtige Zyu füere …
Wen i itz di Gedanke mitùm Thema Wier ggùgge de … tue i Verbindig bringe, chùmen i drùf, dass wier ggùgge de … zùm Tǜü o bedütet «as isch, wyn es isch.» Emù i ggwǜssne Situatione. Wäge o daas erlùbt iim, maau a chli abzwaarte ù zuezggùgge, wyn es wyttergiit. Das isch zwar bequeem, aber äbe nit ging ds Böschta.
Wier ggùgge de … was dii z Friburg ine entscheide wäge üseri Zwǜǜsprachigkiit. We da a jeda, wo sich defǜǜr engagiert, dass di Zwǜǜsprachigkiit i üsùm Kanton o ggläbt wǜrd, nùme asoo wǜrdi deiche, de wǜrden es gaar nie di nöötige ù gwǜnschte Aapassige ù Veränderige gää. As bruucht äbe Entscheidige ù dass mù mengisch sofort handlet, ùm eppis chene z bewǜrke. I däm Fau wǜrdi wier ggùgge de … wärtvolli Zytt la verstryyche. Trotzdäm söu aber o nit eppis ǜberjùflet entschide cho, wüù mù sich di nöötegi Zytt nit wott nää. Das isch o nit föörder-lich.
Dette ds richtige Gspǜri z haa isch sicher nit ging ifach. Fǜr daas usizfǜne, hǜüft es, mitenand z rede. Das wǜrd ja bekanntlich vǜüfach no bitz z weenig gmacht oder emù z weenig dütlich ù gezyylt.
Wier ggùgge de … isch o chli ùnverbindlicher ù vor alùm ùnentschlosse, zùm Byschpǜü wen es ùmena Partnerschaft oder ùm Familieplaanig giit. Statt entscheide «Ja» oder «Neei», cha mù ja maau sääge wier ggùgge de … ob eppis druus wǜrd, oder wier ggùgge de … wenn won es yyschleet ù chiis ja chli la drùfab choo. I däm Fau töönt di Entscheidig gaar nit ǜberzügend, oder? Aber si schafft äbe o dette de nöötig Rumm ù di nöötegi Zytt – o wen es nit fǜr beidi Sytte passt.
Ùf de anderi Sytta muess i ùmmi sääge: Asoo wyn a Saame syni Zytt bruucht zùm Wachse ù Ryyffe oder o as Chinn, wo na normalerwyys nün Maanet ùs nüügeboores Gschöpf darf d Wäut erblicke – bruuche ggwǜssi Sache ifach syni Zytt ù denn töönt äbe as Wier ggùgge de … o na de nöötegi Gedùud. I däm Fau laat sich eppis nit la erzwinge u nit kǜnschtlich la beschlöinige – u das isch o richtig asoo.





























