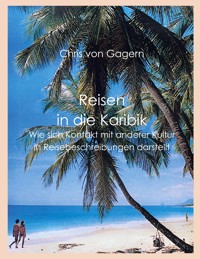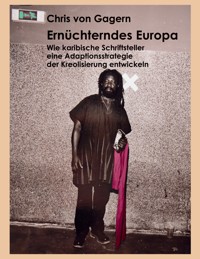
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In der Literaturanalyse geht es um die kritische Sicht, die Migranten von Europa gewinnen und wie sie sich auf die erfahrenen Verhältnisse einstellen. Untersucht wird dies am Diskurs karibischer Autoren, die Aufenthalte in London oder Paris darstellen. So ernüchternd die geschilderten Erfahrungen auch sind, der Befund überrascht insofern, als in ihren Romanen und autobiographischen Erzählungen kritischer Widerstand gegen die abweisenden Verhältnisse mit dem Konzept der Kreolisierung vereinbart wird. Kennzeichnend für den karibischen Weg ist die Überschneidung unterschiedlicher Kulturen, aus deren Vermischung neue Varianten entstehen. Vertreten wird die These, dass die karibische Expertise in flexibler Adaption zu Zeiten einer asymmetrisch konzipierten Globalisierung als richtungsweisend anzusehen ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Die vorliegende Publikation ist Ergebnis eines Forschungsprojekts, das durch Förderung der Volkswagen Stiftung ermöglicht und von 1999 – 2001 am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin durchgeführt wurde.
Über den Autor:
Chris von Gagern, geboren 1953 in München, hat sich als Romanist und Amerikanist auf Cultural Studies spezialisiert. Er ist Mitglied der Gesellschaft für Karibikforschung und lebt abwechselnd in Berlin und Ibiza. – In seiner Dissertation über europäische Darstellungen von Kulturkontakten in der Karibik ging es um eine Literaturanalyse umgekehrter Blickrichtung. Die Untersuchung des karibischen Diskurses über Europaerfahrungen stellt nun einen komplementären Schritt dar, der zum wechselseitigen Austausch über kulturelle Grenzen hinweg beitragen soll.
Außerdem erschienen: Reisen in die Karibik: Wie sich Kontakt mit anderer Kultur in Reisebeschreibungen darstellt. Frankfurt: Peter Lang, 1994.
www.chrisgagern.de
Inhalt
Vorwort
Einleitung
Die Europäer und die Anderen
„Limes-Ideologie“ oder „Kampf der Kulturen“
Vorgehen
Die Karibik als Diaspora und die Tradition beständiger Migration
Quellen und Methodik
Literatur als chaotisches System
Postkoloniale Literaturen
Korpus und Thesen
1 London
1.1
The Empire coming home
1.1.1
Black British Literature
und der Diskurs über die Migration
1.2 Motive und Dispositionen
1.2.1. Prädispositionen der Einwanderergeneration
1.2.2 Prädispositionen der zweiten Generation
1.3. Erfahrungen im sozialen Kontakt
1.3.1. Erfahrungen der Einwanderergeneration
1.3.1.1 Wohnsituation
1.3.1.2 Arbeit
1.3.1.3 Freunde und Bekannte
1.3.1.4 Zusammenfassung
1.3.2. Erfahrungen der zweiten Generation
1.3.2.1 Familie und häusliche Verhältnisse
1.3.2.2 Berührung mit öffentlichen Institutionen
1.3.2.3 Freunde
1.3.2.4 Zusammenfassung
1.4 Reaktionen und Konsequenzen
1.4.1 Konsequenzen bei Protagonisten der Einwanderergeneration
1.4.1.1 Integrationsbestrebungen
1.4.1.2 Unwillkürliche Gegenreaktionen
1.4.1.3 Selbsthilfe
1.4.2 Adaptionsstrategien bei Protagonisten der zweiten Generation
1.4.2.1 Integrationsbestrebungen mit Vorbehalt
1.4.2.2 Rückzug in die ethnische Gruppe
1.4.2.3 Relativieren ethnischen Exklusivismus
1.4.3 Zusammenfassung
1.5 Wirkungsabsichten der Autoren
1.5.1 Diskurs von Autoren der Einwanderergeneration
1.5.1.1 Appell an englische Leser
1.5.1.2 Appell an westindische Leser
1.5.1.3 Veränderung des Standpunkts
1.5.2 Diskurs der Autoren zweiter Generation
1.5.2.1 Kritik an den englischen Verhältnissen
1.5.2.2 Feedback für die eigene Gruppe
1.5.2.3 Rückblick auf die Elterngeneration
1.5.3 Zusammenfassung
2 Paris
2.1 Das Auftauchen der „dritten Insel“
2.1.1 Der literarische Diskurs über das Exil in der Metropole
2.2 Motive und Dispositionen
2.2.1 Beweggründe bei Protagonisten der Einwanderergeneration
2.2.2 Prädispositionen bei Protagonisten der zweiten Generation
2.3 Erfahrungen im sozialen Kontakt
2.3.1 Erfahrungen der Einwanderergeneration
2.3.1.1 Erfahrungen aus der Perspektive von Studenten
2.3.1.2 Erfahrungen aus der Perspektive von Arbeiterinnen
2.3.1.3 Erfahrungen aus der Perspektive von Exilanten
2.3.2 Erfahrungen der zweiten Generation
2.3.2.1 In die Defensive gedrängt
2.3.2.2 Zur Offensive provoziert
2.3.3 Zusammenfassung
2.4 Reaktionen und Konsequenzen
2.4.1 Adaption bei Zuwanderern
2.4.1.1 Adaption der Gebildeten
2.4.1.2 Adaption der gering Qualifizierten
2.4.2 Adaption bei Protagonisten der zweiten Generation
2.4.3 Zusammenfassung
2.5 Wirkungsabsichten der Autoren
2.5.1 Tenor in der Zuwanderungsphase
2.5.1.1 Botschaft an französische Leser
2.5.1.2 Botschaft an karibische Landsleute
2.5.2 Tenor in der Phase erfolgter Etablierung
2.5.2.1 Botschaft an die Pariser Diaspora
2.5.2.2 Botschaft an französische Leser
2.5.3 Zusammenfassung
3 Ein Plädoyer für kulturelle Hybridisierung
3.1 Zusammenfassung der Ergebnisse
3.1.1 Ein kontinuierlich anwachsender literarischer Diskurs
3.1.2 Angeführte Motivation
3.1.3 Geschilderte Erfahrungen
3.1.3.1 Perspektive der Folgegeneration
3.1.4 Entwickelte Adaptionsstrategien
3.1.4.1 Adaption der Folgegeneration
3.1.5 Vorläufiges Fazit
3.2 Hybridisierung und Theoriebildung
3.2.1
Everyday Racism
3.2.2
A City is not a Tree
3.2.3
Globalization and Ethnicity
3.2.4
Modernity and Double Consciousness
3.2.5
Le monde entier se creolise
3.2.6 Konklusion
Anhang
A city is not a tree
Bibliographie
Für Tina,
die sich abermals mit einem vorwiegend in Betrachtungen
versunkenen Lebensgefährten abzufinden hatte,
der jedoch ohne ihre Unterstützung –
so zwiegespalten sie auch sein mochte –
nicht zu dem Schluss gelangt wäre.
Vorwort
Die vorliegende Veröffentlichung stellt das Ergebnis zweijähriger Forschungstätigkeit dar, die von der Volkswagen-Stiftung im Rahmen ihres Anfang der 90er Jahre gesetzten Schwerpunkts „Das Fremde und das Eigene – Probleme und Möglichkeiten interkulturellen Verstehens” gefördert wurde. Angesichts der Internationalisierung europäischer Lebenswelt, mit deren Tendenz weltweiter Vernetzung und Angleichung die alltägliche Normalität jedoch kaum Schritt hält, sondern kulturelle Unterschiede verschärft hervortreten lässt und Unduldsamkeit gegenüber Fremdem bestärkt, sollte eingehendere Kenntnis über Prozesse interkultureller Begegnung geschaffen werden. Das Projekt einer Analyse von Migrationsliteratur karibischer Autoren, dessen Realisierung ich seit meiner Dissertation über europäische Beschreibungen von Kulturkontakten in der Karibik verfolgte, bot sich in meinen Augen beispielhaft dafür an, fand jedoch zunächst nicht die für einen Projektantrag erforderliche institutionelle Unterstützung. Erst in dem wissenschaftlichen Direktor des renomierten Ibero-Amerikanischen Instituts in Berlin fand sich ein eintschiedener Befürworter, der das Vorhaben ohne wenn und aber unterstützte. Zu unser beider Überraschung drohte seine Durchführung jedoch nicht etwa an der Bewilligung der vorgesehenen Mittel seitens der Stiftung zu scheitern, sondern am Widerstand der Institutsverwaltung, die gegen meine Einstellung als externer Mitarbeiter für die Laufzeit des Projekts juristische Bedenken äußerte. Dank der Intervention der für den Forschungsschwerpunkt zuständigen Sachbearbeiterin der Stiftung blieben dem erneut unbeheimateten Forschungsvorhaben die Fördermittel jedoch erhalten, wenn es auch galt, die kuriose Situation eines potenziell finanzierten Projekts, das nicht beherbergt werden soll, zu überwinden. Willkommene Aufnahme fand die Forschungstätigkeit schließlich am Lateinamerika-Institut der Freien Universität Berlin, wo karibische Literatur nicht nur zum Repertoire gehört, sondern in Ulrich Fleischmann auch einen engagierten Vertreter der Forschung aufzuweisen hat, der sich anbot, als Leiter des Projekts verantwortlich zu zeichnen. Sein Wissen und seine Erfahrung kamen dem Projekt zweifellos zugute, ebenso seine Tätigkeit als Vorsitzender der Gesellschaft für Karibikforschung, auf deren Kongress an der Universität in Wien 2001 erste Ergebnisse vorgetragen werden konnten.
Ursprünglich sollte der Literaturvergleich noch breiter angelegt werden und andere europäische Metropolen wie Amsterdam und Madrid einbeziehen, die ebenfalls karibische Diasporas beherbergen. Doch obwohl sich in jüngerer Zeit in Madrid durchaus nicht unerhebliche Exilgemeinden aus Kuba und der Dominikanischen Republik zusammengefunden haben, waren darüber nur sporadische Erwähnungen von Madrid als Durchgangsstation in Texten zu finden, die in Miami oder Paris spielen. – Die Niederlande wiederum werden – später zwar als London und Paris – ab Anfang der 70er Jahre zum Anlaufziel massiver Migration von den niederländischen Antillen und vor allem aus Suriname. Dessen Unabhängigkeitsbewegung wurde von den Niederlanden nicht zuletzt wegen des massiven Exodus nach Europa befürwortet und seine Entlassung in Unabhängigkeit 1975 besiegelt, um schrittweise die Kontrolle über die als problematisch empfundene Zuwanderung zurückzugewinnen. Die Aussicht auf drohende Einschränkungen des Niederlassungsrechts im Mutterland verstärkte jedoch zunächst den Andrang. Der Kontroverse entsprechend, findet sich über surinamische Migration, aber auch antillanische ein deutlicher Niederschlag in der Literatur. Nachdem es gelang, zwar nicht so viele Texte wie über London oder Paris, aber mehr als ein Dutzend über Amsterdam und Den Haag zu beschaffen und auch auszuwerten, tut es mir leid, dass ich letztlich darauf verzichten musste, sie in den Vergleich einzubeziehen, weil die für das Projekt bewilligte Zeitspanne bereits überschritten und die schriftliche Bearbeitung eines weiteren Kapitels nicht mehr möglich war. Nicht dass die Erfahrungen karibischer Migranten in Holland die Ergebnisse wesentlich modifiziert hätten (eher scheinen sie dazu angetan, in Bezug auf ein Land mit ausgeprägt liberalem Selbstverständnis die Erkenntnis über eingefleischte aber umso besser verschleierte Widerstände gegen außereuropäische Zuwanderung zu bestätigen und zu vertiefen, die schon über London und Paris zutage treten), aber eine spezifische Betrachtung in Form eines eigenen Kapitels stünde niederländisch-karibischen Autoren schon deshalb zu, weil eine transnationale Perspektive beabsichtigt wurde und die niederländische Karibik eine Facette darstellt, die im Zusammenhang eines potenziellen karibischen Ganzen häufig übersehen und insgesamt wenig beachtet wird. Augenblicklich muss es bei dem Vorsatz bleiben, das Versäumte eventuell bei einer zukünftigen Überarbeitung nachzutragen oder jemand anderen zur Beschäftigung damit anzuregen.
Speziellen Dank möchte ich Prof. Dietrich Briesemeister aussprechen, der durch seine Unterstützung das Projekt ermöglichte, obwohl er damit eine bestehende Kontroverse mit der Verwaltung des Ibero-Amerikanischen Instituts verschärfte und sich schließlich bewogen sah, seine Funktion als wissenschaftlicher Direktor vorzeitig aufzugeben. Dem persönlichen Einsatz von Dr. Hiltgund Jehle verdankt das Projekt, dass es nicht an den Verwaltungshürden des Ibero-Amerikanischen Instituts gescheitert ist. Herzlich bedanken möchte ich mich auch für die Unterstützung von Prof. Ulrich Fleischmann, der die institutionelle Leitung des Forschungsprojekts übernahm, obgleich er der Vorgehensweise ursprünglich misstraute.
Einleitung
Motiviert von dem Eindruck, dass in der anhaltenden und in jüngerer Zeit zunehmend verschärften Problematisierung außereuropäischer Zuwanderung die Perspektive der zu Fremden Stilisierten vernachlässigt wird, geht es in der folgenden Analyse um die Sicht, die karibische Migranten von bevorzugten Zielorten in Europa gewinnen und die Art, wie sie sich auf die erfahrenen Verhältnisse in den aufgesuchten Metropolen einstellen. Eruiert wird dies anhand eines vielstimmigen Diskurses karibischer Autoren, die Aufenthalte ihrer Protagonisten in London und Paris literarisch dargestellt haben. Zeitlich konzentriert sich die Betrachtung auf Publikationen seit dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Folge die Zuwanderung aus der Karibik nach England ebenso wie nach Frankreich eine substanzielle Größenordnung erreichte und auch literarisch zunehmend thematisiert wurde.
Literatur ist in dem Betrachtungszeitraum der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein Medium, in dem die Auseinandersetzung karibischer Protagonisten mit europäischen Verhältnissen nicht nur kontinuierlich reflektiert wird, sondern auch Adaptionsstrategien oder Konzepte der Einstellung darauf entwickelt werden. Die stetige Zunahme der Texte verhält sich dabei weniger proportional zur Migration aus der Karibik, die seit den 80er Jahren eher stagniert oder in eine zirkuläre Bewegung übergegangen ist, als vielmehr zu einem europäischen Klima wachsender Fremdenfeindlichkeit und Abschottung vor einer befürchteten Invasion aus der ehemals kolonialen Peripherie ins Zentrum von Wohlstand und Fortschritt. Diese Entwicklung regt vermehrt zu einer Stellungnahme der Betroffenen an, die sich nicht nur, aber auch in literarischer Form äußert. Denn die Lebensbedingungen verschärfen sich selbst für Eingebürgerte, wenn äußerliche Unterscheidbarkeit sie zu unerwünschten Eindringlingen stempelt. – Der entstandene Diskurs entwirft ein synchronisch wie diachronisch differenziertes Bild, das erlaubt, wiederkehrende Muster der Begegnung zu abstrahieren sowie charakteristische Probleme interkulturellen Kontakts zu dokumentieren, der in dieser Mobilitätsrichtung notorisch von Vorbehalten und Einschränkungen belastet ist. Auch wenn die narrative Perspektivierung einschlägiger Erfahrung in überwiegend fiktionaler Form nicht ohne weiteres als getreues Abbild sozialer Wirklichkeit angesehen werden kann, erscheint die Untersuchung ihrer Versinnbildlichung geeignet, nicht nur Blindstellen europäischer Selbstwahrnehmung zu erhellen, sondern darüber hinaus Einsicht in den mit der Darstellung verbundenen ideologiebildenden Prozess zu vermitteln: wie mit einer inhärenten Asymmetrie des Verhältnisses zwischen Einheimischen und Ankömmlingen umzugehen ist. Die Texte werden dazu auf die vermittelten Erfahrungen sowie die von den Protagonisten gezogenen Konsequenzen hin untersucht und vergleichend mit einander sowie zu den jeweils damit verbundenen Wirkungsabsichten der Autoren in Beziehung gesetzt. Diachronisch lassen sich so aus den festgestellten Veränderlichkeiten Entwicklungstendenzen absehen, synchronisch stellt der Vergleich die unterschiedlichen Bedingungen in London und Paris heraus.
Karibische Migration und ihre Reflexion in der Literatur wird deshalb herangezogen, weil sie in mehrfacher Hinsicht exemplarisch erscheint für jene globale Verflechtung, die unter anderem auch den Andrang auf europäische Metropolen verstärkt. Die besondere Affinität der Karibik zu den globalen Zentren ist nicht nur in wirtschaftlicher, sondern ebenso in kultureller Hinsicht augenfällig und macht die Region quasi zu einem Prototyp der Globalisierung. Kolonisiert von verschiedenen europäischen Mächten, die erbittert um karibische Territorien konkurrierten, waren sie deren Interessen nicht nur am längsten von allen Kolonien unterworfen, sondern wurden den Bedürfnissen der jeweiligen Mutterländer auch in besonders einschneidender Weise angepasst, die beispielsweise einen kompletten Bevölkerungsaustausch beinhaltete. Kulturell nach Kräften europäisiert, wenn auch nach Maßgabe unterschiedlicher Kolonialherren, sind sie heute nichtsdestoweniger zum Inbegriff besonderer rassischer wie kultureller Vielfalt geworden, deren charakteristische Gemeinsamkeit gerade in der Vermischung von Unterschiedlichem besteht. Aus europäischer Sicht haftet ihren Bewohnern „Farbigkeit“ jedoch eher als Stigma an.
Nachhaltige Außenabhängigkeit stellt auch nach Entlassung in Unabhängigkeit ein schwieriges Erbe dar. Emigration kennzeichnet daher die Region seit Mitte des 19. Jahrhunderts, als der wirtschaftliche Wert der ehemals exklusiven Zuckerproduzenten verfiel und ein nomadisierender Lebensentwurf zu einer Überlebensstrategie der heterogenen Bevölkerung wurde. Es ist folglich wenig verwunderlich, wenn die traditionelle Anbindung an die ehemaligen Mutterländer (ebenso wie an die regionale Hegemonialmacht USA) in umgekehrter Expansionsrichtung ausgenützt wird. Dass die Migration sich in verschiedene Metropolen der hoch industrialisierten Länder richtet, ermöglicht es, die beschriebenen Erfahrungen auch in Bezug auf die jeweiligen Zielorte zu vergleichen. – Als besonders interessanter Untersuchungsgegenstand erweist sich karibische Literatur aber auch deshalb, weil ihre Autoren eine so spezifische wie innovative Antwort auf notorische Probleme in europäischer Fremde entwickeln, die im Zuge fortschreitender Globalisierung als von besonderer Aktualität und übergreifender Bedeutung betrachtet werden kann. – Nicht zuletzt fußt die Entscheidung für die karibische Perspektive von Europa auf einer vorausgehenden Literaturanalyse umgekehrter Blickrichtung, die die europäische Darstellung von Kulturkontakten in der Karibik zum Gegenstand hatte.1 Damit wurde reziprok die Frage nach der fremden Sicht auf europäische Verhältnisse aufgeworfen. Eine Untersuchung des karibischen Diskurses über Europaerfahrungen stellt somit auch einen komplementären Schritt dar, um dem wechselseitigen Erfahrungsaustausch über kulturelle Grenzen hinweg gerecht zu werden.
Die Europäer und die Anderen
Um in groben Zügen eine Idee des Kontexts zu vermitteln, zu dem in dem analysierten Diskurs implizit oder explizit Stellung genommen wird, möchte ich zunächst anhand einschlägiger Veröffentlichungen die aktuelle Debatte über Phänomene wie Migration und europäische Abschottung dagegen, Globalisierung und die Formierung von Diasporas, die das Konzept der Nation in Frage stellen, und nicht zuletzt um eine kontroverse „neue Weltordnung“ skizzieren.
Etwa seit Ende des Zweiten Weltkriegs geraten die Metropolen der hoch entwickelten Industrieländer in den Brennpunkt einer graduell anwachsenden Wanderbewegung aus so genannten unterentwickelten Ländern der ehemals kolonialen Peripherie, von der sich die eingesessene europäische Bevölkerung in jüngerer Zeit mehr und mehr alarmiert sieht. Als kritische Punkte werden vor allem mangelnde Integration der Ankömmlinge sowie Probleme mit zunehmender Xenophobie der Eingesessenen angeführt. Denn im Zuge grassierender Furcht vor einer „Invasion von Armen aus der Dritten Welt“, die seit den 70er Jahren von wiederholten wirtschaftlichen Rezessionen geschürt wird, manifestieren sich um die Jahrtausendwende in ziemlich allen Ländern Europas ausländerfeindliche Gruppierungen und Parteien, die vor allem außereuropäischer Zuwanderung den Kampf angesagt haben. Andererseits lassen langfristig drohende Probleme durch schwindende Geburtenraten und zunehmende Überalterung einer allenthalben schrumpfenden europäischen Bevölkerung die Aufnahme von Einwanderern durchaus geboten erscheinen.
Die abendländischen Zentren von Wohlstand und Fortschritt geraten nicht ganz von ungefähr in den Brennpunkt migratorischen Interesses. Denn als primäre Ursache jener weltweiten Völkerwanderung, die heute als ernste Bedrohung des erreichten Zivilisationsstandards der Zielländer betrachtet wird, sehen Experten auch ohne polemische Intention, wie etwa Myron Weiner, die ungleiche Verteilung von Wohlstand und Rohstoffen2. Die Migration von der ehemals kolonialen Peripherie ins Zentrum steht somit in direktem Zusammenhang mit der vorausgehenden weltweiten kolonialen Expansion europäischer Mächte. Im Laufe kolonialer Herrschaft gelang es den meisten heute maßgeblichen Nationen, überproportionalen Reichtum auf Kosten der von ihnen Kolonisierten zu akkumulieren, um damit jenen rapiden Fortschritt in Gang zu setzen, den die „Entwicklungsländer“ seither so verzweifelt wie vergeblich einzuholen bestrebt sind. Indem deren Entwicklung jahrhundertelang systematisch auf die Bedürfnisse der Kolonialmächte abgestimmt wurde, ließ sich der gewonnene Vorsprung nachhaltig ausbauen. Als zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr zu verleugnen war, dass der Nutzen vieler der ausgepowerten kolonialen Besitzungen hinter den vielfältigen Kosten ihrer Beherrschung zurückblieb und das koloniale Projekt somit unleugbar im Abstieg begriffen war, wurde ein Prozess allmählicher Dekolonisierung eingeleitet, der eine Besitzung nach der anderen in Unabhängigkeit entließ und im Wesentlichen nach dem Zweiten Weltkrieg vollendet wurde. Doch auch Selbstverwaltung ließ den ehemaligen Kolonien nur beschränkten Freiraum; denn die engen Verflechtungen bestehen unter neuen Hegemonialmächten fort. In der Ära des Ost-West-Konflikts mit ihrer strengen Polarisierung in ein imperialistisches und ein kommunistisches Lager waren sie zwar nicht mehr unmittelbar einer Kolonialmacht unterworfen, aber sie bildeten Satelliten der beiden Supermächte USA oder USSR, die eifersüchtig Kontrolle über die als in ihrer Entwicklung rückständig verstandenen Schützlinge ausübten und ihre Fortschritte auf dem jeweiligen Weg ökonomischer wie sozialer Angleichung überwachten. Selbst nach Ende des Kalten Krieges und dem Zusammenbruch des Ostblocks perpetuieren die Entwickelten unter der Devise der Liberalisierung mit militärischen wie ökonomischen Mitteln weiterhin eine Weltordnung, die andere in Abhängigkeit hält und ihnen die Befriedigung minimaler eigener Bedürfnisse versagt.
Stimuliert von Nachkriegsaufbau und Anwerbung von Arbeitskräften in den noch verbleibenden Kolonien kam es nach dem Zweiten Weltkrieg, erstmals zu einem substanziellen Rückstrom in umgekehrter Expansionsrichtung, vorwiegend nach England und Frankreich. Doch so dienlich die fremde Hilfe dem wirtschaftlichen Aufschwung der 50er und 60er Jahre war, wurde sie seit der Rezession der 70er Jahre für immer überflüssiger oder problematischer erachtet. Zur Drosselung des Andrangs wurde Zuwanderung seither mit einer Serie von Restriktionen belegt. Die mittlerweile etablierten Fremden bekamen einen Stimmungsumschwung gegen sie zu spüren: sie sollten wieder gehen, da sie nicht mehr gebraucht würden. Gebotene Anreize zur Rückkehr fruchteten jedoch ebenso wenig wie zunehmender sozialer Druck auf sie, der sich seither vermehrt in einzelnen Anschlägen und Übergriffen manifestiert und verbreitete Vorbehalte gegen alle jenen zeitigt, von denen angenommen wird, dass sie die kulturelle Identität der jeweiligen Nation in Frage stellten. Vielmehr begannen sich die Eingewanderten lokal gegen xenophobe Anfeindungen seitens informeller wie politischer Gruppierungen zu organisieren und ihre erworbenen Rechte zu verteidigen.
Im Zuge europäischer Einigung fielen zwar schrittweise innereuropäische Grenzen, doch gegen bündnisfremde Eindringlinge wird die gemeinsame Außengrenze umso hermetischer befestigt. Denn Europa weigert sich gegen allen Augenschein hartnäckig, als Einwanderungsziel begriffen zu werden, und verpflichtete seine Mitgliedsstaaten entsprechend dazu, angestammte Bündnisverpflichtungen zu lösen, wie sie etwa Großbritannien mit dem Commonwealth pflegte, und entsprechende Maßnahmen gegen Zuwanderung zu ergreifen. 1992 einigt man sich auf eine gemeinsame, restriktivere Flüchtlingspolitik. – Andererseits kann und will sich Europa dem gegenläufigen Trend fortschreitender Globalisierung auf wirtschaftlichem und notgedrungen auch kulturellem Gebiet keineswegs entziehen. Die Internationalisierung der Metropolen im Zuge ihrer Entwicklung in global bedeutsame Handels- und Dienstleistungszentren diversifiziert irreversibel die einheimische Kultur und erfordert zwangsläufig gewisse Kompromissbereitschaft. Denn nicht nur die umworbenen fremden oder multinationalen Kapitaleigner lassen sich nieder, sondern machen auch ein Heer von Dienstleistenden geringer Qualifikation erforderlich. Globale Kommunikationsmedien verbreiten auch in die Dritte Welt entsprechende Information über Lebensbedingungen, Wirtschaftszuwachs, überproportionalen Arbeitskräftebedarf und stimulieren damit weltweite Migration. Lokal erhält die Anziehungskraft mythisch überhöhter Erwartungen an die Zentren des Wohlstands zusätzlich Schubkraft von korrupten Regierungen, Menschenrechtsverletzungen unter Diktaturen, Bürgerkriegen und Naturkatastrophen, die einen Aufbruch auf der Suche nach tragbaren Lebensbedingungen unausweichlich machen. Globale Verkehrsnetze ermöglichen, allen dagegen ergriffenen Maßnahmen zum Trotz, globale Mobilität. Unter restriktiven Bedingungen erhöht sich vor allem die Dunkelziffer illegaler Einwanderer. Mit ihnen hält in den Metropolen eine neue Schicht der Unterprivilegierten Einzug, was Kritiker zur Warnung vor einer neuen Form der Sklaverei veranlasst, da sich im Herz der Global Cities quasi koloniale Verhältnisse zu reproduzieren drohten.
Parallel zu einer Entwicklung, die die Welt unaufhaltsam zusammenrücken lässt, werden auch globale Normen entwickelt. So sieht etwa die universale Deklaration von Menschenrechten 1948 sowohl ein Recht auf Verlassen als auch auf Rückkehr in das jeweilige Herkunftsland vor. Zum europäischen Standard gehört auch ein Bekenntnis zum internationalen Abkommen über Non-Diskrimination in Bezug auf Rasse, Religion, Geschlecht und Sprache. Theoretiker fordern darüber hinaus im Zuge der Liberalisierung von Handel und Kapitalfluss eine weiter gehende Einlösung internationaler Freizügigkeit, die auch den wirtschaftlichen Faktor der Arbeitskraft im Sinne einer Selbstregulierung des Markts und der Realisierung von Chancengleichheit von allerorten wirksamen Niederlassungsbeschränkungen befreien soll. Doch dem geforderten Recht auf freie Wahl der erstrebten Gesellschaft setzen ihre Kritiker das Recht auf Schutz einer Gemeinschaft und ihrer entwickelten Lebensart entgegen und können sich in Europa bislang einer deutlich höheren Akzeptanz ihres Arguments sicher sein. Denn dumpfe Ängste und Befürchtungen (etwa vor ethnischen Konflikten, vor Verlust von Abstammungsprivilegien und europäischer Dominanz im Staat, vor Arbeitslosigkeit und sozialem Abstieg, vor Übervölkerung, unkalkulierbaren Umweltbelastungen sowie einem „unregierbaren Chaos“) motivieren Wähler wie Regierende in Europa zu einer defensiven Haltung und entsprechend restriktiven Regulierung von Migration, die sich das Recht auf strenge Selektion der zugelassenen Einwanderer vorbehält.
Kultureller Pluralismus ist besonders in den europäischen Metropolen zwar eine unübersehbare Tatsache geworden, aber die kulturell nach wie vor homogen gedachten Nationen Europas tun sich schwer damit und reagieren mit verstärktem Nachdruck auf Integration und kulturelle Assimilation der Migranten. Ein Kulturaustausch zwischen den durch Abstammung definierten Einheimischen und Fremden verläuft unter der rigiden Richtlinie der Anpassung an eine vorgegebene „Leitkultur“ asymmetrisch. – Zwar ist bei Zuwanderern keineswegs davon auszugehen, dass sie Integration oder Anpassung verweigern, aber zum Leidwesen der Europäer lassen sie es eher mit Adaption im Sinne von flexibler Einstellung auf die jeweiligen Gegebenheiten bewenden, als sich unmissverständlich zu integrieren und ihre hergebrachte Kultur dafür aufzugeben oder zurückzustellen. Sozialer Druck gekoppelt mit latenter Stigmatisierung von Fremden, denen allenthalben Misstrauen entgegen gebracht und die sporadisch zum Ziel von Anfeindungen und Übergriffen werden, erweist sich in dieser Hinsicht als kontraproduktiv und verstärkt deren Rekurs auf ihre Ursprungskultur. Entsprechend ist eine zunehmende Verweigerung exklusiver Loyalität zu einer Nation und deren Kultur bei ihnen festzustellen. Vielmehr affirmieren sie rassische und kulturelle Differenz, drängen auf Gleichstellung sowie das Recht auf freie kulturelle Entfaltung.
Verstärkt von der Globalisierung (eine Bezeichnung, die sich vor allem auf die seit den 80er Jahren betriebene ökonomische Liberalisierung bezieht, aber zunehmend auch mit deren weit reichenden kulturellen, sozialen und politischen Konsequenzen assoziiert wird, die das Entstehen einer „transnationalen Weltgesellschaft“ zeitigt) bilden sich in zunehmendem Maße Diasporas, Gemeinschaften von aus unterschiedlichen Gründen über die Welt Verstreuten, die jeweils ihre Bindung an gemeinsame Ursprünge eint. Das Entstehen transnationaler Gemeinschaften verbindet oft räumlich weit entfernte Ursprungs- und Zielorte. Zirkuläre Wanderbewegungen in Form eines Hin- und Her zwischen verschiedenen Orten lösen mehr und mehr eine unidirektionale Auswanderung ab. Entsprechend entstehen zunehmend transnationale Identitäten, deren Vertreter die ambivalente Zugehörigkeit zu mehr als einem Gemeinwesen verfechten. Besonders die Folgegeneration von Einwanderern, die unter dem überschneidenden Einfluss unterschiedlicher Kulturen aufwächst, neigt dazu, Elemente aus beiden zu selektieren und so dynamische wie hybride Kulturvarianten zu kreieren.3 Adaption an die örtlichen Verhältnisse ist dabei zwar in der Regel gewährleistet, aber zweifellos verbindet sich mit der Betonung kultureller Differenz auch eine gewisse Abgrenzung. Verfechter von kultureller Assimilation als unverzichtbarer Voraussetzung sprechen angesichts dieser Entwicklung von einem Scheitern der Integration und einer Bedrohung des Nationalstaats, dessen Zusammenhalt auf kulturelle Gemeinsamkeiten gegründet sei und durch schleichende kulturelle Pluralisierung ausgehöhlt würde.
Robin Cohen interpretiert die Zeichen der Zeit gelassener: Wir befinden uns unleugbar auf dem Weg in eine globale Zivilisation, und fortschreitende Globalisierung macht Staaten stärker interdependent und beschneidet damit in gewisser Weise ihre Souveränität. Diasporas fügen einer gegenseitigen wirtschaftlichen, technologischen und ökologischen Abhängigkeit eine kulturelle Verflechtung von Gesellschaften hinzu. Sie bilden eine Lobby sowohl im Ursprungs- als auch im Zielland. In letzterem machen sie sich für Chancengleichheit, Rechtssicherheit, Nachzug von Verwandten, Freizügigkeit und autonome Selbstorganisation stark, in ersterem machen sie ihren Einfluss für eine Verbesserung der Lebensbedingungen geltend, nicht selten auch für einen Regierungswechsel, und können ihren innovativen Vorstellungen häufig durch finanzielle Unterstützung von Familienclans und substanzielle Investitionen Nachdruck verleihen. Eine nach wie vor veranschlagte nationale Homogenität erscheint angesichts der Entwicklung von globalen Weltstädten und proliferierenden Diasporas obsolet. Angesichts von knapp 200 souveränen Staaten in der UNO, aber mehr als 2000 Ethnien, die Anspruch auf eine nationale Identität erheben, muss das Konzept, jeder Volksgemeinschaft ein nationales Territorium zuzugestehen, als gescheitert gelten. Staaten sind vielmehr gefordert, eine Vielfalt von sich überschneidenden sozialen Identitäten zu verwalten. Herrschende Konzepte werden den neuen Gegebenheiten nicht gerecht, doch das Konzept des multikulturellen Staats trifft in Europa aus Angst vor einer Auflösung der Nationalstaaten auf neo-konservative Widerstände, die zu seiner Aufgabe als politisch unrealisierbar zwingen, bevor es ernsthaft erprobt werden konnte.
Die Verfechter einer aktuellen Philosophie der Postmoderne sehen in den sozialen, politischen und kulturellen Konsequenzen der Globalisierung vorwiegend eine Befreiung von einem für die Ära der Moderne charakteristischen Exklusivanspruch auf Fortschritt nach abendländischem Muster, doch Kritiker befürchten, dass die Entgrenzung sich einseitig im Sinn eines Ausbaus kapitalistischer Dominanz vollzieht. Dass sich hinter der viel beschworenen „unsichtbaren Hand des globalen Markts“ ausgeprägte Hegemonialbestrebungen manifestieren, wird einerseits weithin ignoriert oder bestritten, ruft andererseits aber erbitterte Globalisierungsgegner auf den Plan. Darunter machen nicht nur militante Kritiker einer Globalisierung von sich Reden, die weltweit das Recht des Stärkeren durchsetze und der daher im Sinne einer symmetrischeren Entwicklung Einhalt zu gebieten sei, sondern in Europa wie darüber hinaus ist auch ein erneutes Erstarken von Nationalismus, Rassismus und Sexismus zu verzeichnen. Religiöser Fundamentalismus deutet nicht allein in der islamischen Welt eine erstarkende Tendenz der Abkehr vom dominierenden Modell angleichenden Fortschritts in eine einheitlich konzipierte Moderne an.
Seit Ende des Kalten Kriegs und dem Zusammenbruch des kommunistischen Ostblocks, der mit seinem Gleichgewicht des Schreckens die internationalen Beziehungen über 40 Jahre stabilisierte, ist zwar verstärkt von einer „neuen Weltordnung“ die Rede, aber die offensichtliche globale Verflechtung von Gesellschaften und die historische Erfahrung von Interferenzen kommt dabei wenig zum Tragen. Vielmehr gründet die vorwiegend US-amerikanische Rhetorik auf vorgeprägten dichotomen Denkmustern und ruft erneut eine Aufspaltung der Welt, diesmal in Entwickelte und Unterentwickelte ins Leben, die auch als Nord-Süd-Konflikt bezeichnet wird.
1 Chris von Gagern, Reisen in die Karibik: Wie sich Kontakt mit anderer Kultur in Reisebeschreibungen darstellt (1994)
2 zu Fakten und Einschätzungen globaler Migration vgl. Myron Weiner, The Global Migration Crisis: Challenge to States and to Human Rights (1995)
3 Bezüglich der Formation von Diasporas siehe Robin Cohen, Global Diasporas. An Introduction (1997)
„Limes-Ideologie“ oder „Kampf der Kulturen“
Im Zusammenhang mit dem Entwurf einer „neuen Weltordnung“ möchte ich zwei kontroverse Theorien ansprechen, deren Auslegung aktueller Entwicklungen paradigmatisch erscheint und insofern für die vorliegende Untersuchung relevant ist, als sie das Denkmuster über Zuwanderung in die hoch entwickelten Industrieländer nachhaltig beeinflussen. – Der Arzt und Entwicklungshelfer Jean-Christophe Rufin warnt in L’empire et les nouveaux barbares vor einer trivialen Polarisation und kritisiert eine entstehende Abgrenzung und Befestigung der Industrieländer des Nordens gegen eine befürchtete Invasion der „Barbaren aus dem Süden“, die in ein System weltweiter Apartheid zu münden drohe. – Der Politologe Samuel Huntington befürwortet in The Clash of Civilisations eine klare Abgrenzung in mehrere kulturell bestimmte Blöcke als Grundlage einer stabilisierten Politik im 21. Jahrhundert und betrachtet eine übergreifende kulturelle Durchmischung als gefährliche Subversion sozialen Zusammenhalts. Die in beiden Theorien angesprochene Aufspaltung der Welt widerspricht der aktuellen Tendenz der Globalisierung nur scheinbar, sondern betont deren inhärente Asymmetrie, die als destabilisierender Faktor eingeschätzt wird.
Rufin vergleicht die Krise internationaler Beziehungen nach dem Zusammenbruch des Ostblocks mit der Situation des Römischen Reichs nach dem Sieg über Karthago.4 Das Ausscheiden des zentralen Widersachers erfordere eine Neuorientierung, die damals wie heute im unifizierenden Gegensatz zu anderen gesucht werde, die von ihrer Gemeinschaft nichts wissen. Die historische Parallele bestehe in der Konfrontation einer zentralisierten Partei mit einer diffusen Vielheit, die mangels eines unifizierenden Gegners zur Gefahr stilisiert werde. Waren es damals die stereotyp zu „Barbaren“ erklärten Völker jenseits des imperialen Herrschaftsbereichs, gegen die das Römische Reich seine neue Identität als Zivilisationsbringer mit Anspruch auf Universalismus definierte und deren „Barbarei“ zum imaginären Gegner ihrer Mission erklärte, so werde heute der Gegner vorwiegend im Süden lokalisiert und die „Dritte Welt“ zu neuen Barbaren stilisiert, gegen deren Bedrohung sich das „Imperium der Zivilisierten“ als Verfechter der freiheitlichen Demokratie unifiziere. Die Konfrontation der reichen Länder des Nordens mit den armen im Süden sei nicht nur ein Konstrukt, in dem Identität gesucht werde, sondern auch Ausdruck eines einschneidenden Ideologiewechsels: von einem ideologischen Solidaritätspakt angleichender Entwicklung werde graduell auf ein Feindbild umgeschwenkt und nach Ende des Kalten Kriegs eine Ideologie der Ungleichheit und der Asymmetrie wieder erweckt, an der der Mythos von der Entwicklung für alle zerbricht. Denn es wird nicht nur deutlich, dass der Fortschritt der Entwickelten nicht mehr einholbar sei, sondern die Vergrößerung der Kluft werde auch zu einer entgegengesetzten Entwicklung stilisiert, die eine grundsätzliche Unvereinbarkeit signalisiert. Das neue Konzept beinhalte einen Bruch mit dem Süden sowie die Errichtung eines Schutzwalls um die Zivilisation der Entwickelten, vergleichbar mit dem Limes der Antike, der zum Schutz vor einer befürchteten Invasion der Barbaren diente. Indem die Panik vor einer Invasion der Armen geschürt und Maßnahmen gegen Migration getroffen werden, bereite sich der Norden darauf vor, seine Grenzen langfristig möglichst hermetisch zu verschließen, durchlässig nur in Richtung nach draußen, und beschwöre damit eine gewaltsame Konfrontation geradezu herauf. – Auf Seiten der Anderen mache umgekehrt eine Kultur der Armut als dauerhaft etabliertes Phänomen wachsende Bevölkerungsanteile bereit zur Invasion der Hochburgen des Wohlstands. Die Polarisierung werde reziprok aufgegriffen und die Ideologie des Bruchs bestätigt. Mit der Migration würden die Spannungen in Form von Konflikten unter ethnischen Vorzeichen auch in europäische Metropolen getragen.
Der veranschlagte Gegensatz zwischen Zivilisation und Barbarei muss zweifellos als ideologisch überhöht gelten: es geht weniger darum zu zeigen, wie es ist, sondern welche Richtung eingeschlagen werden soll. Im Sinne einer Ideologie des Bruchs zwischen den Welten werden imaginäre Gegensätze verschärft und eine Konfrontation zwischen den Antagonisten eingeleitet. Um den zeitlichen Fortbestand ihrer überlegenen Lebensart zu sichern, konformierten sich die hoch entwickelten Industrieländer des Nordens graduell mit einer räumlichen Beschränkung. Nach dem Scheitern der kolonialen Einverleibung der Welt gehe es um den Rückzug auf eine sichere Verteidigungslinie, die Armut und Instabilität ausgrenzen soll und dafür asymmetrische Entwicklung hinnimmt und befestigt. Der noch in Konstruktion begriffene Limes scheide eine geschlossene Welt von einem diffusen Draußen, das notgedrungen den Anderen überlassen wird. Doch die Abgrenzungspolitik greife nur, wenn es gelingt die Anrainerstaaten in der Kontaktzone am Limes zu stabilisieren und zu Pufferstaaten zu funktionalisieren. Deshalb richte sich das vordringliche diplomatische Interesse auf Einbindung dieser Kontaktländer, denen gewisse Vergünstigungen im Tausch gegen Schutzverpflichtungen geboten würden. Entwicklungshilfe im allgemeinen werde zunehmend an eine Stabilisierung der Verhältnisse geknüpft und sei vor allem auf Abwendung der sozialen Bedrohung für den Norden gerichtet. So konkurrierend die Interessen der Industrienationen sonst seien, so konvergierten sie doch augenscheinlich hinsichtlich einer Abwendung der Bedrohung ihres Wohlstands. Der Einigungsprozess Europas seit den 60er Jahren illustriere dies: während vorher erbitterte Konkurrenz der verschiedenen Nationen miteinander vorherrschte und eine Fusion eher mit den entsprechenden Kolonien im Süden angestrebt wurde, verbinde sie seit der Preisgabe ihrer Kolonien eine defensive Ideologie, für die sie ihren Exkolonien auch die letzten Vorrechte aufkündigten, um gemeinsam Schritt für Schritt eine schärfere Grenzziehung nach außen durchzusetzen. Zur Legitimierung zunehmend hermetischer Abschottung vor außereuropäischen Migranten werde ihr bisher relativ unerhebliches Hereinsickern als Hereinbranden dargestellt und so einer Abwehrhaltung in der Bevölkerung Vorschub geleistet. Die öffentliche Meinung sei bereits infiziert von der Ideologie, Wohlstand durch Eingrenzung zu schützen. Im Namen von Sicherheit setze die Limesideologie eine scharfe Trennung zum Ziel und suggeriere massiv, dass der Limes undurchlässig gemacht werden müsse. Zur Abwehr tauge jedes Mittel, denn für Gegner gelten die eigenen Gesetze und Ideale nicht – was innerhalb des Limes streng geahndet würde, sei außerhalb erlaubt. So würden Demokratie, Entwicklung und Rechtsstaatlichkeit auf Insider beschränkt. Die Sicherung des Errungenen, des Entwicklungsvorsprungs, der Privilegien würden so um den Preis der Gerechtigkeit erkauft. Bei seiner kritischen Auslegung einer vom „Imperium der Zivilisierten“ angestrebten neuen Weltordnung gibt Rufin zwar abschließend zu bedenken, dass Verteidigungsstrategien dieser Art historisch betrachtet früher oder später mit einem Dammbruch geendet haben. Doch das Beispiel des Römischen Reichs, das damit seinen Niedergang immerhin um Jahrhunderte hinauszuzögern imstande war, wird die maßgeblichen Verfechter kaum entmutigen, auch wenn von einer solchen Spanne in unserer schnelllebigeren Zeit niemand ernsthaft ausgehen dürfte.
Im Unterschied zu Rufin’s aufrüttelnder Intention bei der Entlarvung systematischer Segregation zwischen Nord und Süd als „neuer Weltordnung“ bereitet Huntington auf einen „Kampf der Kulturen“ als zukünftig bestimmender Auseinandersetzung vor und vertritt mit Überzeugung das Modell einer in verschiedene Zivilisationen aufgespaltenen Welt, in der die führenden Industrienationen sich auf ihre abendländische Identität besinnen müssten, wenn sie nicht untergehen wollten.5 Nach Beendigung des Kalten Kriegs und damit der Aufspaltung in zwei unifizierende ideologische Lager sieht er ein bedenkliches Erstarken unterschiedlicher kultureller Identitäten, das alle Hoffnung auf eine globale Zivilisation nach abendländischem Muster zerschlage. Unzweifelhaft verlören die USA als derzeitige Hegemonialmacht wie ihre europäischen Alliierten schon früher (und damit das Modell abendländischer Kultur als solches) an disziplinierendem Einfluss. Seit Ende der kolonialen Expansion Europas zu Beginn des 20. Jahrhunderts habe eine Revolte der Beherrschten gegen westliche Vormacht eingesetzt und sie im Lauf der Zeit wirksam unterminiert. Mit dem schleichenden Abstieg erst der europäischen Kolonialmächte und allmählich auch der USA von ihrer weltbeherrschenden Stellung schwinde die Vorbildfunktion und Verbindlichkeit eines einheitlichen zivilisatorischen Konzepts. Die internationale Ordnung, die lange westlich dominiert gewesen sei, destabilisiere sich. Unterschiedliche Kulturen drifteten unaufhaltsam auseinander anstatt sich weiter anzunähern. Inzwischen habe sich die proklamierte Universalität westlicher Kultur als Konstrukt erwiesen und einer Pluralität von Einflüssen aus verschiedenen Kulturkreisen mit jeweils unterschiedlichen Konzepten von Fortschritt Platz gemacht. Neue Regionalmächte in Asien, der islamischen Welt, im osteuropäischen Raum etc. demonstrierten nicht nur wachsenden Einfluss, sondern forderten den Westen und die von ihm aufrecht erhaltene Weltordnung heraus.
Unter diversen für möglich erachteten Szenarien des Niedergangs und resultierender Neuordnung (Huntington zitiert in diesem Zusammenhang neben der für unwahrscheinlich gehaltenen Behauptung westlicher Hegemonie im Zuge der Globalisierung noch andere Visionen wie eine Polarisierung unter dem Vorzeichen von armen Ländern im Süden mit den reichen im Norden oder eine multilaterale Konfrontation zwischen Einzelstaaten ohne disziplinierende Hegemonialmacht oder gar die Auflösung nationalstaatlicher Ordnung, die er mit einem Zusammenbruch staatlicher Autorität, Anarchie sowie ethnischen Konflikten unter Führung krimineller Warlords assoziiert, die unkontrollierbare Flüchtlingsströme mit sich brächten) tendiert Huntington zum Modell globaler Integration von 7-8 Kulturkreisen oder Zivilisationen, in dem Nationalstaaten überleben, aber sich unter Maßgabe kultureller Verwandtschaft um führende Kernländer zu miteinander konkurrierenden Blöcken formieren. In einem Gleichgewicht durch wechselnde taktische Allianzen zwischen den Blöcken, die sich im Grunde hostil gegenüberstehen, weshalb blockübergreifende Partnerschaften als instabil einzuschätzen wären, sieht er noch die den Umständen entsprechend beste Garantie für relative politische Stabilität. Denn kulturelle Einheitlichkeit betrachtet er als die entscheidende Voraussetzung für sozialen Zusammenhalt. Allerdings müsse der Westen in einer solchen Konstellation, ob er wolle oder nicht, um seinen Fortbestand kämpfen. Sein Überleben hänge davon ab, die gemeinsame abendländische Identität zu bekräftigen, um jene Unifizierung zu erreichen, die allein die Chance biete, der Herausforderung die Stirn zu bieten.
In Ländern mit verschiedenen ethnischen Bevölkerungsgruppen sieht er in dem Prozess der Integration um Kernländer unterschiedlicher Kulturkreise zehrende interne Konflikte und soziale Segregation voraus, die sie zu Verlierern prädestinierten. Denn eindeutige Identifikation mit und unverbrüchliche Loyalität zu einer Gruppe sieht er als archaisches Prinzip an, das seine Rechtfertigung daraus bezieht, dass eine straffe Organisation mit gemeinsamen Werten und Zielen sich in der Auseinandersetzung mit anderen als schlagkräftiger, wirkungsvoller und daher überlebensfähiger erweise. „Kulturell schizophrene“ Nationen mit Populationen, die zu unterschiedlichen Zivilisationen gehören, betrachtet er als instabil und über kurz oder lang von Zerfall bedroht. („We are different people and belong in different places“.) Augenblicklich versuche der Westen, seine Führungsposition zu behaupten, indem er seine Interessen als global definiere und alle in eine globalisierte Weltwirtschaft einzubinden hoffe. Doch die Bildung übergreifender globaler Verbände hält er angesichts desintegrativer Tendenzen für utopisch. Die bestehenden Gegensätze könnten nicht lange überdeckt werden. Aufgrund der Verflechtungen liefen die westlichen Industrieländer vielmehr Gefahr, als bevorzugte Zielländer von einer sich selbst verstärkenden globalen Migrations-Krise unterminiert zu werden. Denn es bestehe ernsthaft die Gefahr, dass Europa wie die USA zu zersplitterten Gesellschaften würden. Die Haltung gegenüber zunehmenden Migrationsströmen sei in den westlichen Industrienationen bisher noch ambivalent und schwanke zwischen einer Befürwortung auf Grund von Arbeitskräftebedarf, die bis in die 70er Jahre vorherrschend gewesen sei, und restriktiven Maßnahmen der Kontrolle und Auslese auf Grund von Arbeitslosigkeit, die seit den 80er Jahren im Kommen seien. Aber die bereits importierte Problematik zeichne sich nur allzu deutlich ab; denn die halbherzigen Versuche der Integration müssten angesichts eines in den Metropolen etablierten kulturellen Pluralismus, der der Instabilität Vorschub leiste, als gescheitert gelten. In der Bevölkerung wachse die Angst vor der Invasion und besonders in Europa komme es neuerdings zu Ausschreitungen gegen Migranten.
Wenn der Westen seinen Zenit auch überschritten habe, unmissverständlich angekündigt von wirtschaftlichen Depressionen, denen dann unweigerlich Invasionen der Barbaren folgten, könne der Niedergang doch noch abgewendet oder zumindest hinausgezögert werden, wenn eine Unifizierung des Westens durch ein erneuertes Bekenntnis zu abendländischen Grundwerten gelänge, als da wären: das Erbe der Antike, Christentum, Sprachenvielfalt, Trennung von Staat und Kirche, Rechtsstaatlichkeit, sozialer Pluralismus, repräsentative Demokratie und Individualismus. Fremde Enklaven eines kulturellen Pluralismus gelte es zu bereinigen, Immigranten aus anderen Kulturkreisen müssten strenger selektiert und integriert werden. Befürworter multikultureller Gesellschaften in den eigenen Reihen gelten Huntington als verkappte Separatisten und werden als Renegaten zum vordringlichsten Ziel seiner Kritik.
Beide Visionen einer „neuen Weltordnung“ signalisieren, ob kritisch oder befürwortend, ein abweisendes Klima außereuropäischer Migration gegenüber, das sich zukünftig eher verschärfen soll als im Sinne komplexeren Zusammenwirkens im Rahmen eines globalisierten Systems zu normalisieren. Der Formierung von komplexeren sozialen Organisationsmustern, etwa im Sinne von multipler kultureller Zugehörigkeit und hybriden Identitäten werden nicht nur wenig Chancen eingeräumt, sondern einem reduktionistischen Zug zu „archaischen Prinzipien“, zur Bekämpfung von Veränderungen und Vermischung stillschweigend Prädominanz zugebilligt. Wenn die angesprochene reaktionäre Zukunftsorientierung den komplexen Gegebenheiten auch weniger gerecht zu werden versucht als sie durch ideologische Überhöhung zu problematisieren und zuzuspitzen, so ist ihre rhetorische Wirksamkeit doch nicht zu unterschätzen. Wahlerfolge von neo-konservativen und rechtspopulistischen Parteien in den meisten Mitgliedsstaaten der EU deuten wachsende Akzeptanz von defensiven und vordringlich an Sicherheit orientierten Konzepten in der europäischen Bevölkerung an, und auch die verschärfte ideologische Polarisierung der Weltpolitik nach dem Anschlag auf das World Trade Center in Parteigänger „anarchischen Terrors“ oder „der Zivilisation“ weist auf eine gleichsam selbsterfüllende Prophezeiung hin.
4 Jean-Christophe Rufin, L’empire et les nouveaux barbares (1991)
5 Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order (1996)
Vorgehen
Die Betrachtung karibischer Migration kann als exemplarisches Beispiel dafür dienen, dass polarisierende Konzepte, so gängig sie sind, aktuellen Gegebenheiten nicht gerecht werden, sondern in globalem Maßstab komplexe und irreversible Verflechtungen, nicht zuletzt kultureller Art bestehen, die – trotz unleugbaren Unterschieden und Besonderheiten aller Varianten – ein Beharren auf unvereinbarer Gegensätzlichkeit absurd erscheinen lassen.1
Zunächst ist in Besonderheiten einzuführen, die nicht nur die Karibik kennzeichnen, sondern auch die von ihr ausgehende Migration, wie rassische und kulturelle Vermischung, oder das Bestehen einer Tradition der Mobilität und Abwanderung erklären. Sodann werden die der Untersuchung zugrunde liegenden Quellen, das methodische Vorgehen sowie die vertretenen Thesen zu erläutern sein.
Die Karibik als Diaspora und die Tradition beständiger Migration
Die Karibik kann als die am intensivsten und nachhaltigsten kolonisierte Region gelten. Mit der Entdeckung der Neuen Welt nahmen spanische Eroberer hier die ersten kolonialen Territorien in Besitz, von denen einige immer noch unter europäischer Herrschaft stehen (wie die französischen Überseedepartements und die Niederländischen Antillen sowie einige verbleibende British West Indies) oder übergangslos der regionalen Vormacht USA „assoziiert“ wurden wie Puerto Rico und die ehemals dänischen Virgin Islands. – In Ermangelung von Handelsware, wie den ursprünglich erhofften Gewürzen, oder Bodenschätzen, wie das ersehnte Gold, wurde die Karibik zur Wiege der Plantagenwirtschaft, die Europa unvergleichlichen Gewinn einbringen sollte. Bis Ende des 18. Jahrhunderts stellten sie die reichsten und begehrtesten Kolonien dar, um die von allen europäischen Kolonialmächten erbittert gestritten wurde. Plantagenwirtschaft und afrikanische Sklaven prägten die Region so nachhaltig, dass diese Kriterien heute als konstitutiv für eine vornehmlich kulturräumliche Definition der Region gelten, die die Inselwelt der karibischen See umfasst sowie jene Küstengebiete, die ebenfalls überwiegend von Plantagenwirtschaft und afroamerikanischen Kulturen geprägt sind, wie die drei Guyanas oder Belize.
Dadurch dass auf dem in der Folge unter Spanien, Großbritannien, Frankreich und die Niederlande aufgeteilten Archipel ein regelrechter Bevölkerungsaustausch vollzogen wurde, bei dem man die in wenigen Jahrzehnten praktisch ausgerotteten indianischen Bewohner zunächst mehrheitlich durch versklavte Afrikaner ersetzte und nach deren schließlicher Freilassung Mitte des 19. Jahrhunderts durch asiatische (im einzelnen: indische, javanische und chinesische) Kontraktarbeiter ergänzte, entstand auf engem Raum eine außergewöhnliche ethnische und kulturelle Vielfalt – gegen den Willen der Kolonialherren, die sich nach Kräften bemühten, die heterogene Bevölkerung der jeweiligen europäischen Kultur zu assimilieren. Abgesehen von einer charakteristischen rassischen Vermischung, die alle möglichen Nuancen der Hautfarbe hervorgebracht hat, präsentiert sich auch die Kultur heute als hybrides Produkt. Einerseits sind die Inseln nach jahrhundertelangen Assimilierungsbestrebungen nachhaltig europäisiert, andererseits weisen sie synkretistische Kulturzüge auf, die auf afrikanische, asiatische und gelegentlich indianische Ursprünge zurückgreifen. Aus dem erzwungenem Völkergemisch auf den Plantagen und der alltäglichen Überschneidung unterschiedlicher Kulturen sind in einem allmählichen Prozess der „Kreolisierung“ nicht nur eigenständige Kreolsprachen, sondern eine Vielzahl von hybriden, transkulturellen, kreolischen Identitäten hervorgegangen, deren gemeinsame Charakteristik in der Synthese von Elementen unterschiedlichen kulturellen Ursprungs besteht.
Migration hat in der Karibik eine lange Tradition. Zum einen stellt die heutige Population, ob europäischer, afrikanischer oder asiatischer Abstammung, eine in ihrer Gesamtheit im Laufe der Kolonialzeit zugewanderte – oder besser in ihrer Mehrzahl dorthin verschleppte – dar. Zum anderen sah sich ein Großteil von ihnen im Zusammenhang mit dem Bedeutungsverfall der vormals exklusiven Zuckerproduzenten, die im 19. Jahrhundert in eine Krise gerieten und sich zur Aufgabe der Sklaverei zugunsten von Lohnarbeit genötigt sahen, erneut zur Migration gezwungen. Da das halbherzige Zugeständnis der Emanzipation nicht ausreichte, die Kooperation der ehmals Versklavten zu gewinnen, zogen sich in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts viele europäische Pflanzer in die jeweiligen Mutterländer zurück. Den weniger Privilegierten blieb auf den von den Kolonialmächten mehr und mehr vernachlässigten Inseln nicht anderes übrig, als den Mangel an Verdienstmöglichkeiten durch saisonale Arbeitsmigration zu kompensieren: erst auf andere Inseln, wo noch Zucker angebaut wurde und temporär erhöhte Nachfrage nach Arbeitskräften bestand, um die Jahrhundertwende dann vermehrt auf das zentral- und südamerikanische Festland, um sich etwa beim Bau des Panamakanals zu verdingen. Rassischer Diskrimination und ausbeuterischen Arbeitsbedingungen anderswo zum Trotz, wurde Migration zu einem unverzichtbaren Faktor, zu einem notgedrungen akzeptierten Aspekt der sozialen Perspektive, zunehmend einbezogen in den Lebensentwurf jedes einzelnen, und ist über die Dekolonisierung der meisten Inseln bis Mitte des 20. Jahrhunderts hinaus aktuell geblieben.2
Unabhängigkeit aus eigener Kraft durchzusetzen, wie die Kolonien auf dem amerikanischen Festland, erwies sich für die so verstreuten wie unter verschiedene Herrscher aufgeteilten Inseln als aussichtslos (mit Ausnahme Haitis, das sich, angeregt von der Revolution in Frankreich, in einem blutigen Befreiungskrieg französischer Kolonialherrschaft sowie der Sklaverei entledigte und die errungene Unabhängigkeit auch gegen spanische und britische Restaurationsversuche europäischer Kolonialmacht verteidigte). Zwar dienten sich die USA wiederholt als Befreier – etwa Kubas und Puerto Ricos – an, doch bauten sie mit ihren Interventionen gleichzeitig den Einfluss als regionale Hegemonialmacht aus. Autonomie erscheint daher in der Karibik bis heute als eine von höheren Gnaden und widerruflich gewährte. Außenabhängigkeit und Fremdbestimmung setzen sich fort und lassen auch unter Selbstverwaltung nur beschränkt eigenständige Entwicklungsperspektiven für die geographisch wie politisch zersplitterten Inseln aufkommen, die für einander eher Konkurrenten auf dem Weltmarkt darstellen als Kooperationspartner. Das Moment einseitiger Entwicklung zu einer tropischen Extension und spezialisierten Ergänzung der Metropolen in Form von Plantagenkolonien erweist sich als nachhaltiges Handikap, das eine diversifizierende Entwicklung nach eigenen Bedürfnissen erschwert. Zum kolonialen Erbe gehört auch eine steil geschichtete Gesellschaft, die sozialen Aufstieg erschwert und – aller Vermischung zum Trotz – von nuancierten Kriterien der Abstammung und der Hautfarbe abhängig macht. Wer soziale Mobilität erstrebt, sucht sie – der Logik der Verhältnisse entsprechend – zumeist anderswo.
Seit dem Zweiten Weltkrieg richtet sich karibische Migration auf weiter gesteckte Ziele, bevorzugt in nordamerikanische und europäische Metropolen, und erstmals unter permanenter Perspektive. Zu überseeischen Unternehmungen ermutigte zum einen die Kriegsteilnahme französischer und britischer Kontingente aus Kolonien in der Karibik. Der Einsatz für die Alliierten belebte nicht nur die Verbindung zum Mutterland, sondern förderte auch das Bewusstsein, sich dort ein Niederlassungsrecht erworben zu haben. Zum anderen bewarb man sich von europäischer Seite in der Nachkriegszeit aktiv um Arbeitskräfte aus den verbleibenden Kolonien zur Beseitigung von Kriegsschäden. Außerdem rückte Europa auch deshalb verstärkt in den Fokus karibischer Migration, weil die traditionell bevorzugte Auswanderung in die benachbarten USA 1952 durch nationalitätsbezogene Quoten eingeschränkt wurde, die außereuropäische Zuwanderer benachteiligte.
Notgedrungen hat für Gesellschaften in der Karibik Mobilität immer eine wesentliche Rolle gespielt, Migration ist gleichsam konstitutiv für sie. Ein flexibler und nomadisierender Lebensentwurf hat sich als kulturelle Eigenart in ihnen verankert und fördert nicht nur bei einem Großteil ihrer Bewohner die Bereitschaft, Gelegenheiten, wo auch immer sie sich bieten, beim Schopf zu ergreifen und sich multiple Optionen aufzubauen, sondern auch die Adaptionsfähigkeit. und Angesichts wachsender Beschränkung von Migration macht sie dies beispielsweise zu Experten für bestehende Schlupflöcher. Weil viele sich auf die Wanderschaft begeben haben, hat beinahe jeder der Zurückgebliebenen Beziehungen ins Ausland. Die Mobilität derer, die sich in der Metropole eine Existenz aufgebaut haben, schürt umgekehrt Erwartungen bei den zu Hause Gebliebenen. Die Kunde über die Möglichkeiten anderswo, auch wenn sie oft beschönigend und wenig verlässlich sein mag, verstärkt den Wunsch zur Migration. – Die verbreitete Überzeugung, dass in den Metropolen der soziale Aufschwung zu realisieren sei, der in der Karibik so hartnäckig versagt bleibt, geht nicht zuletzt auf das Prinzip der Europäer zurück, koloniale Aneignung mit einem Programm allmählicher kultureller Angleichung zu rechtfertigen, die den Kolonisierten in Aussicht stellte, gleichberechtigt an den viel beworbenen Segnungen der Zivilisation Teil zu haben. So tun sie letztlich nichts anderes als das, worauf die ihnen so nachdrücklich vermittelte Kultur sie vorbereitet, wenn sie bestehende Bindungen ans Zentrum in umgekehrter Expansionsrichtung nützen.
Zwar sticht die Karibik nicht durch die absolute Größenordnung ihres Bevölkerungsexports hervor, aber im Verhältnis zu einer Gesamtpopulation von etwa 35 Millionen verzeichnet sie weltweit die höchste Auswanderungsrate. Zur Migration sieht sich ein breiter Querschnitt der Bevölkerung veranlasst, Fachkräfte und Intellektuelle ebenso wie gering Qualifizierte, Männer ebenso wie Frauen (wanderten in der Nachkriegszeit zunächst eher Männer ab, so überwiegen seit Ende der 60er Jahre die Frauen geringfügig). Von Seite karibischer Regierungen wird Auswanderung in der Regel nicht ungern gesehen, da sie die Probleme reduziert, die aus der traditionellen Übervölkerung der Inseln resultieren. Vor allem einige der kleinen Inseln sind mittlerweile wirtschaftlich auf finanzielle Rücksendungen von Migranten angewiesen. Da jedoch vorwiegend die Jungen abwandern, erwachsen daraus neue Probleme für die zurückbleibenden Alten.
Da die Karibik augenblicklich nicht als akuter Krisenherd gilt, wird Migration als freiwillig und überwiegend ökonomisch motiviert beurteilt, obwohl viele eine ausweglose Lage fliehen und in den Hochburgen der Zivilisation durchaus begründet Zuflucht suchen. Nur in Bezug auf Kuba und Haiti ist von Flüchtlingen die Rede, denen zwingende Gründe zugebilligt werden, ins Exil zu gehen. Im Fall von Kubanern wird politische Unterdrückung durch das kommunistische Regime in der Regel bereitwilliger anerkannt und entsprechend Exil gewährt als im Fall von Haitianern, deren Notlage duch diktatorische Machthaber verursacht wird, die sich meist mit Unterstützung der USA an der Macht halten.
Da die Region unter verschiedene Kolonialmächte aufgeteilt war und später überwiegend unter den Einflussbereich der USA geriet, bestehen Bindungen an eine Vielzahl von Metropolen die als Ziele in Frage kommen (von New York über London, Paris, Miami, Madrid bis Montréal, Toronto, Den Haag, Amsterdam und zuzeiten auch Moskau). Doch folgt die Wanderbewegung nicht nur der vorgezeichneten Linie von einer Kolonie in die entsprechende Metropole, sondern auch zwischen den Zielorten besteht eine immer regere Fluktuation von Migranten. Denn in praktisch allen erwähnten hat sich mittlerweile eine karibische Diaspora etabliert, die in losem Kontakt zu der in anderen Städten steht. Der permanente Charakter und irreversible Einfluss karibischer Migration macht sich auch in karibisch geprägten Vierteln deutlich, wie Brixton in London oder Barbés in Paris. Denn die Ankömmlinge kultivieren – nicht zuletzt wegen latenten Anfeindungen von europäischer Seite – eine starke Bindung an ihre Ursprünge, und rekonstruieren auch in den europäischen Metropolen eine spezifisch eigene Lebensart. Dabei wäre die Karibik selbst bereits als eine Diaspora anzusehen, wo um den Bezug zu den lange diskriminierten afrikanischen Ursprüngen gerungen wird. Ist also schon in der Karibik eine hybride kulturelle Identität maßgeblich, so wird diese bei der Fortsetzung ihrer Wanderung (tendenziell bevorzugt in die Zentren der Industrieländer und nur in geringem Maß zurück nach Afrika oder Asien) eher durch neue Facetten erweitert als vereinheitlicht.
Da sich karibische Migration breit gefächert darstellt und auf eine Vielzahl von Zielen in Europa, Nordamerika, aber auch in Lateinamerika, Afrika und neuerdings sogar in der arabischen Welt verteilt, bleibt der Impakt auf die jeweiligen Zielländer vergleichsweise gering. Sie bilden Minoritäten, die wenig Bedrohung für die dominante Gesellschaft darstellen, dafür aber notorisch mit Marginalisierung zu ringen haben. Der Umstand, dass es sich um Angehörige buchstäblich aller Rassen sowie deren vielfältige Vermischung handelt, macht sie, was Herkunft anbelangt, oft unkategorisierbar, verleiht ihnen aber speziell in europäischem Umfeld, wo es bis nach dem Zweiten Weltkrieg – im Gegensatz etwa zu den USA – kein nennenswertes Netzwerk von außereuropäischen Bevölkerungsgruppen gab, eine äußerliche Unterscheidbarkeit, die eine pauschale Einstufung als Fremde unterstützt, auch wenn sie, wie Antillaner in Frankreich beziehungsweise in den Niederlanden (oder Puerto Ricaner in den USA), als gleichberechtigte Staatsbürger zu gelten haben. Jene, die kein solches Privileg in Anspruch nehmen können, werden von zunehmend prohibitiven Einwanderungsbestimmungen behindert. Diese wirken sich auch auf die seit den 60er Jahren in Unabhängigkeit entlassenen British West Indies wie Jamaika, Trinidad, Barbados etc. sowie Guyana und das ehemals niederländische Surinam auf dem südamerikanischen Kontinent aus, die traditionell eine starke Affinität für die ehemalige Kolonialmetropole kultivierten. Aber mit der nicht ganz von ungefähr gewährten Selbständigkeit gingen ihre Bewohner auch der Niederlassungsrechte in Europa verlustig, nicht zuletzt weil sie mehrheitlich für eine als problematisch wahrgenommene Diaspora in Großbritannien beziehungsweise den Niederlanden verantwortlich gemacht wurden. – Indizien sprechen also dafür, dass die Karibik, deren Anschluss ans Zentrum so nachhaltig betrieben wurde und so lange außer Frage stand, im Begriff steht, zu einer problematischen Region „hinter dem Limes“ erklärt zu werden, vor deren Ansturm Europa sich schützen will.
Quellen und Methodik
Die Wanderbewegung von der ehemals kolonialen Peripherie in die Zentren der Industrieländer im allgemeinen wie auch die Migration aus der Karibik im besonderen wurden bisher vorwiegend unter sozialen und politischen, selten unter kulturellen Gesichtspunkten analysiert. So hat man sich etwa unter dem Schwerpunkt Migrationsforschung bemüht, Größenordnung, Ursachen, Wege, Verlauf, Konfliktpotenzial, Integrationschancen etc. zu erhellen. Die meisten Untersuchungen beziehen sich auf die USA, denn als umkämpftes Auswanderungsziel bestand dort schon früh ein Interesse, migratorische Tendenzen zu erkennen und zu steuern. So lässt sich dort auch schon ab den 20er Jahren eine Thematisierung interkultureller sowie interrassialer Beziehungen feststellen, die zunächst vor allem die Problematik eruierte, dass gewisse Ethnien nicht im amerikanischen Schmelztiegel aufgehen. Angeregt von der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung, hat in den 60er Jahren eine verstärkte Auseinandersetzung mit ethnischen Minoritäten unter Maßgabe der Forderung nach kulturellem Pluralismus eingesetzt und wird seither systematisch vertieft und differenziert. In diesem Zusammenhang wurde auch die benachbarte Karibik, die seit dem Rückzug der Kolonialmächte eine argwöhnisch überwachte Einflusszone der USA darstellt, eingehend beleuchtet und die Zuwanderung von einzelnen Inseln detailliert behandelt, was etwa Probleme der Integration oder Marginalität, sozialer Mobilität und kultureller Identität von Exilgemeinden betrifft. Besondere Aufmerksamkeit wurde in dieser Hinsicht der Migration aus Puerto Rico als den USA assoziiertes Territorium und den Flüchtlingswellen aus dem kommunistischen Kuba zuteil.
In Europa setzte die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Phänomen wachsender außereuropäischer Bevölkerungsgruppen in den Metropolen und dessen Ursachen sowie Konsequenzen erst Ende der 60er Jahre allmählich ein. Ähnlich wie in den USA dominieren auch hier soziologische Gesichtspunkte. Einschlägige Studien karibischer Migration beziehen sich in erster Linie auf Anlaufziele wie Großbritannien, in geringerem Maße auf Frankreich und vereinzelt auf die Niederlande. Über das fragmentarische Bild hinaus, das Erhebungen und Befragungen liefern, sind jedoch Sichtweise und Stellungnahmen der Ankömmlinge zu der Problematik, die sie vorfinden oder aufwerfen, bisher relativ unbeachtet geblieben.
Vielleicht weniger repräsentativ aber ungleich umfassender und differenzierter werden die Schicksale, Probleme, Adaptionsprozesse von Migranten in kulturellen Medien wie etwa Literatur reflektiert. Als Zeugnisse fremder Perspektive, die auf eigene Veranlassung entstanden, gewähren literarische Darstellungen der Erfahrungen von Zuwanderern von suggestiver Beeinflussung durch eine Untersuchung ungetrübte Einblicke und sind daher umso effektiver in der Lage, Blindstellen der Selbstwahrnehmung zu erhellen. Darüber hinaus nehmen jene Anderen, die Einzug in europäische Metropolen halten, auf diese Weise auch Stellung zu den vorgefundenen Verhältnissen und beeinflussen deren fernere Gestaltung mittels eigener Diskurse. Als Produkt kreativer Imagination beschränkt sich Literatur zwar nicht unbedingt darauf, verlässlich eine objektive Realität zu spiegeln, sondern wirkt darüber hinaus insofern ideologiebildend, als mitgeteilte Reflexion imstande ist, mittels Rhetorik Einstellungen zu verändern und ins Wirklichkeitsverständnis von Lesern einzugreifen. Aber insbesondere die Rolle der Ideologiebildung auf kulturellem Weg, erscheint in diesem Zusammenhang bisher noch wenig beachtet. In der Überzeugung, dass sie besonderer Aufmerksamkeit und entsprechender Kritik bedarf, greife ich die Anregung des Literaturwissenschaftlers Edward Said auf, die transkulturelle Wechselwirkung von Literatur und ihrem aktuellen gesellschaftlichen Kontext über Sprach- und Staatsgrenzen hinweg in den Brennpunkt zu rücken und „kontrapunktisch“ die beschriebenen Erfahrungen mit den sozialen Verhältnisse zu analysieren, von denen die Texte über karibische Migration nach Europa angeregt wurden und auf die sie sich kritisch beziehen.3
Literatur als chaotisches System
Da eine Literaturanalyse in diesem Sinn in diverser Hinsicht von derzeit gängigen systematisch theoretischen Ansätzen abweicht und auch bewusst den üblichen nationalen oder sprachräumlichen Vergleichsrahmen übersteigt, ist das zugrunde gelegte Verständnis von Literatur erläuterungsbedürftig. – Wesentlich inspiriert wird das Vorgehen durch die von Alexander Argyros in Kritik an Derridas radikalem Dekonstruktivismus und in Adaption von Erkenntnissen der Chaosforschung entwickelte Literaturtheorie, die zu einer systemischen Sicht der Beziehungen zwischen Kulturprodukten und natürlicher Umwelt anregt. Sie begreift Narrativik als chaotisches System und stellt sie in Zusammenhang mit der Erzeugung kultureller Veränderung.4
Vorauszuschicken ist eine stichwortartige Skizze von Chaos als Gegenstand der Erkenntnis, die sich im wesentlichen auf Argyros’ Darstellung stützt: In den Naturwissenschaften hat man sich bis vor kurzem vor allem mit linearen Systemen beschäftigt, deren Evolution voraussagbar oder deterministisch ist. In ihnen sind Ursache und Wirkung proportional und das Ganze kann entsprechend als Summe seiner Teile gelten. Die vielfacettige Chaostheorie verdankt ihre aktuelle Bedeutung der Erkenntnis, dass wir es offenbar in ungleich höherem Maße mit nonlinearen Systemen zu tun haben, deren Prozesse sich abrupt und unvorhersehbar ändern und bei denen kleinste Fluktuationen ihrer Variablen disproportionale Effekte zeitigen oder Turbulenzen auslösen. Beim Studium dieser Instabilität und ihres zufälligen Verhaltens zeigte sich das vermeintlich ungeordnete Chaos vielfach jedoch auf seltsame und unerwartete Weise regelmäßig im Sinne von stabil und strukturiert. Deutlich wurde eine Fähigkeit nonlinearer Systeme, im Chaos neue Ordnung zu finden. Eine Polarisierung von Zufälligkeit und Ordnung schien das Verhalten der meisten Systeme nicht zutreffend zu beschreiben. Vielmehr überbrückt Chaos diese Dichotomie und suggeriert eine dritte Möglichkeit, die als erwählte Strategie der Evolution erscheint, Konservation und Innovation flexibel zu vereinbaren. Denn was als zufällige Willkür anmutet, erweist sich als eine in produktiver Weise kanalisierte Zufälligkeit. Materie und Energie weisen selbstorganisierende Tendenzen auf. Chaos verleiht Systemen kreative Energien. Bezeichnend für die Systematik chaotischer Systeme ist ein koordiniertes Wechselspiel zwischen erratischen und deterministischen Zuständen. Typisch für das scheinbar zufällige Verhalten chaotischer Systeme ist, dass sie einen strange attractor anstreben, der weder stabil, noch zufällig zu nennen ist. (Als Attraktor wird jener Gleichgewichtszustand bezeichnet, auf den ein dynamisches System zuzusteuern scheint und der in einem „Phasenraum“ – einem graphischen Modell, das die prozesshafte Entwicklung abbildet, also gleichsam die Geschichte eines dynamischen Systems einbezieht – eine sichtbare Gestalt offenbart. Während lineare Systeme sich auf stabile Attraktoren wie einen Fixpunkt oder einen Kreis zubewegen und man von zufälligen Prozessen keinen Attraktor erwarten kann, konvergiert die Entwicklung nonlinearer Systeme zwar auf erkennbar ähnliche und dauerhafte Muster, aber die Wiederholungen sind non-periodisch und gleichen sich nie gänzlich.) Das Schwanken zwischen Zufall und Ordnung gründet sich auf die Sensibilität chaotischer Systeme, die auf Fluktuation der äußeren Bedingungen reagieren. Kleinste Differenzen des ursprünglichen Inputs verstärken sich durch Feedback, bis sie das makroskopische Verhalten des Systems beeinflussen. Entgegen der landläufigen Auffassung von Chaos als dem Inbild der Unordnung und der Unkontrollierbarkeit, begreift man in der Chaosforschung das Non-Equilibrium dynamischer, insbesondere lebendiger Systeme als Quelle für Ordnung und Evolution. Wenn nonlineare Systeme in Zustände fern vom Gleichgewicht gedrängt werden, zeigen sie eine Tendenz, diskontinuierliche, globale Organisationsschritte zu vollziehen. Ihre Selbstorganisation beginnt spontan, sie werden innovativ und neg-entropisch, das heißt, sie erweisen sich als im Stande, die Tendenz wachsender Entropie im Sinne eines allmählichen Verfalls von Ordnung, wie sie nach dem zweiten Satz der Thermodynamik für alle linearen Prozesse als unvermeidlich gilt, umzukehren. Entsprechend erscheint Evolution nicht mehr irreversibel der Degeneration verhaftet, sondern chaotische Prozesse verleihen ihr auch die Bedeutung der Erzeugung von zunehmend komplexeren Ebenen von Materie und Energie aus einfachen Bestandteilen, die eine globale Struktur der Selbstähnlichkeit und fraktaler Skalierung aufweisen. Chaotische Systeme generieren hierarchische Skalen, die genug Ähnlichkeit aufweisen, um Universalität zu begründen, aber nicht so viel dass sie stetige Innovation ausschlössen. Durch Wiederholung archetypischer Muster auf verschiedenen Ebenen der Evolution kreiert sich das Universum gleichsam selbst. Die fraktale Selbstähnlichkeit suggeriert, dass die Natur Lösungen für ähnliche Probleme durch Generieren von Strukturen findet, die über Skalen hinweg erkennbare Ähnlichkeit bewahren. Darüber hinaus erweisen sich flexible Systeme, die chaotische Sensitivität und selbstregelnde Adaptionsfähigkeit aufweisen, überlebensfähiger als rigide Systeme, die man für den Inbegriff der Ordnung und damit der Dauerhaftigkeit hielt. Auf Grund von Adaptionsfähigkeit und Innovationskraft überleben nonlineare, chaotische Prozesse offenbar nicht nur besser als lineare, statische, sondern „alles scheint besser zu gehen, wenn es sich dem im einzelnen unvorhersehbaren Verhalten eines chaotischen Attraktors annähert“. Folglich wäre die Unberechenbarkeit nonlinearer Innovationsfähigkeit nicht so sehr als Hindernis oder Bedrohung von Ordnung denn als legitimes und erforderliches Werkzeug der Evolution im Sinne der Erfindung einer Zukunft von komplexerer Ordnung zu sehen. Chaos bietet der Evolution die Stabilität ebenso wie die Sensibilität, die sie braucht, um sich periodisch neu zu erfinden.
Argyros konzentriert sich vor allem auf philosophische Implikationen der Chaostheorie und führt an, sie unterstütze eine Sicht, die den Gegensatz zwischen physischer Welt, wie sie Gegenstand naturwissenschaftlicher Erkenntnis ist, und geistigen Konstrukten aus dem Bereich menschlicher Kultur, mit denen sich die Geisteswissenschaften beschäftigen, überbrückt. Denn in Anbetracht der Tatsache, dass das Universum sowohl die Welt der vom Menschen unabhängigen Natur als auch die von ihm geschaffene soziale Umwelt enthält, beziehe sich das von der Chaosforschung begründete Verständnis für die Komplexität von Naturphänomenen auch auf kulturelle Produkte. Nicht nur Naturphänomene und physische Objekte seien überwiegend Ergebnis von dynamischen, hierarchischen, feedback-abhängigen, nonlinearen Prozessen, sondern auch kulturelle Phänomene und geistige Produkte. Insbesondere liege Chaos allen flexiblen und kreativen Prozessen zugrunde, ob sie nun natürlichen oder kulturellen Ursprungs seien. Die kulturelle Welt geistiger Konstrukte und die physische Welt der Naturwissenschaften verbindet so eine Isomorphie. Komplexität offenbart ein universales Verhalten, das über abgegrenzte Fachgebiete und spezialisierte Wissenschaften hinaus die globale Natur von Systemen nahe legt.
Für Kunst und Geisteswissenschaften entfaltet Chaosforschung, Argyros zufolge, insofern Bedeutung, als sie ein allgemeines Modell für die Strategie der Natur bietet, kreative Lösungen zu präsentieren. Er argumentiert, Kultur habe auf der Existenzebene sozialer Umwelten zufälliger genetischer Mutation die Rolle als primärer Erzeuger von Variation abgelaufen. Den Menschen betrachtet er als Spezies, die der wesentlich selbst gestalteten, sozialen Umwelt, auf die sie sich primär bezieht, alternative Optionen zu den aktuellen Gegebenheiten abringt. Menschlicher Geist – als Prädisposition eines komplexen biologischen Organismus, erklärende Theorien über seine natürliche wie soziale Umwelt zu bilden – entwickle sich durch Erfinden alternativer Zukünfte. Doch Menschen erzeugten Information in exponentialem Maß, indem sie sich selbst reflektieren. Im Prozess der Reflexion werde die Gegenwart im Hinblick auf zukünftige Alternativen in den Attraktor (jenes dauerhafte Muster, das der Prozess ihrer Entstehung im Phasenraum anzustreben scheint) zurückgespeist und damit modifiziert. Kulturelle Produktion stelle einen Weg dar, andere Seinsformen zu inszenieren, die dann erwogen, beurteilt, abgelehnt, ausgewählt oder verändert werden. Kulturelle Impulse wären somit im Stande, jene traditionellen Attraktoren, die eine aktuelle gesellschaftliche Situation symbolisieren, zu neuen Konfigurationen zu drängen. Kunst hätte somit die Aufgabe, kritisch Stellung zu nehmen und Wege aufzuzeigen, die Vergangenheit zu modifizieren, damit sie schließlich durch eine Alternative komplexerer Ordnung zu ersetzen sei. Soziale Regeln, die sich ihrer Natur gemäß kultureller Innovation widersetzen, erscheinen in diesem Bild quasi als Ballast gegen unvermittelten sozialen Wandel und stellen sicher, dass eine bestehende Konfiguration nur schrittweise und allmählich veränderbar ist.
Sprache stellt, Argyros zufolge, im Hinblick auf Gestaltung und Modifikation der uns gemeinsamen sozialen Umwelt das machtvollste Medium dar. Insbesondere der Narrativik spricht er eine Funktion als prinzipieller Agent kulturellen Wandels zu. Sie sei als wesentliche Komponente der Dialektik von Mensch und Natur anzusehen, die gleichsam eine Karte der Welt erstellt und den Prozess der Evolution spiegelt. Indem sie Hypothesen über die Natur eines