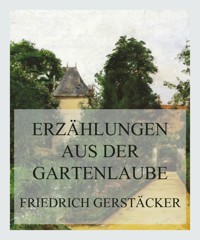
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 1872 in Braunschweig verstorbene Friedrich Gerstäcker war ein deutscher Weltreisender und Romancier. Der Abenteurer hinterließ ein Werk von 44 Romanen, die er selbst für seinen Jenaer Verleger H. Costenoble herausgab. Seine Erzählungen regten zahlreiche Nachahmer an: Karl May profitierte davon und verwendete Landschaftsbeschreibungen ebenso wie Sujets und Figuren. Auch Theater- und Filmgesellschaften nahmen Anleihen bei Gerstäcker. So führt der Kritiker George Jean Nathan die Handlung des Musicals "Brigadoon" (1954) auf Gerstäckers Kurzgeschichte Germelshausen zurück. In diesem Band findet sich eine große Auswahl der Geschichten, die er für die Zeitschrift "Die Gartenlaube" schrieb.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1042
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Erzählungen aus der Gartenlaube
FRIEDRICH GERSTÄCKER
Erzählungen aus der Gartenlaube, F. Gerstäcker
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849663667
Druck: Bookwire GmbH, Voltastr. 1, 60486 Frankfurt/M.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Javanische Skizzen.1
Die neue Geisterwelt.6
Reisbau und Reisbauer in Java.17
Das Entenfangen mit Kürbissen.25
Der Honigbaum.27
Civilisation und Wildniß.35
Die Stiefmutter.39
Die Gemsjagd.51
Ein Pirschpfad auf der Gemsjagd.59
Der Wilderer.63
Im Busch.67
Die freie Rede.97
Ein Pirschgang auf Gemsen.103
Die beiden Doppelgänger.113
Reisende.136
Zum Landkartenwesen.147
Australien und die australische Race.149
Ein Brief von Gerstäcker.156
Reisebriefe.160
Aus den Wäldern von Ecuador.167
Der neue Weg nach Quito und das Innere von Ecuador.173
Das Erdbeben Mendoza’s.185
Ein Ritt von Lima aus ins Innere.188
Deutsche Colonisation in Brasilien.202
Wohlgemeinte Warnung für Auswanderer.208
Unsere Vertretung im Ausland.212
Wohlgeboren und Hochwohlgeboren.216
Zur Beachtung.218
Feuerjagd auf Hyänen.220
Gerstäcker über die peruanische Auswanderungsangelegenheit.226
Eine neue Warnung für Auswanderer.231
Guarapo.238
Eine alltägliche Geschichte.240
Der Heimathschein.246
Wenn wir einmal sterben.288
Der Geschmack ist verschieden.292
Zur Versöhnung in der deutschen Schillerstiftung.293
Das heiße Klima in den Tropenländern.296
Eines amerikanischen Soldaten Brief und eines Mädchens Antwort.299
Helgoland noch einmal.301
Sakit latar.302
Lügen im Handel und Wandel.303
Mein alter Koffer.305
Eine verlorene Mutter.306
Ruine Wildenfels.307
Amerikanische Schlaf-Waggons.363
Ueberseeische Briefe.367
Zeitungs-Jungen in Nordamerika.369
Auswanderung nach Araucanien.371
Frauen-Emancipation.374
Eine südamerikanische Hauptstadt.376
Italienische Banditen in Chile.381
Frauen-Emancipation.382
Verheirathete Bäume.383
Deutsche Christbäume im Ausland.386
Süd-Brasilien und Herr Sturz.389
Telegraphenleger.390
Zu wirthschaftlich.392
Die Schillerstiftung.403
Geschichte eines Ruhelosen.405
Kein Kind im Haus.410
Ein Johanniter-Depôt im jetzigen Kriege.411
In den Parallelen einer belagerten Festung.416
Dreihunderttausend mehr.427
Um Paris herum.429
Unsere sächsischen Soldaten.454
Vorposten-Gepäck.456
Französische Tornister.461
Das gespenstige Steinewerfen.463
Für Reisende und Jäger.470
Für alle Fabrikanten und Industrielle.472
Eine Parabel.475
Für Fabrikanten und Industrielle.476
Javanische Skizzen.
I. Eine Kaffeeplantage mit ihren Arbeitern.
Am Sonnabend Abend hatte ich auf Tjioem boeloeit Hrn. Phlippeau wieder getroffen und mit diesem besprochen, daß ich am Montag nach Lembang hinaufkommen solle, die dortige Kaffeeplantage zu besuchen und eine ordentliche Rhinocerosjagd zu machen. Er hatte sich indessen nämlich genau erkundigen lassen und erfahren, daß nicht allein in letzterer Zeit mehrere Rhinocerosse, und zwar sehr starke Thiere, am Ufer eines kleinen, hoch in den Bergen liegenden Sees gesehen worden wären, sondern daß es auch dort Bantangs, oder wilde Kühe gäbe und eines der Rhinocerosse sehr stark den wilden Kühen den Hof machen solle, wenigstens immer in ihrer Nähe gesehen würde. –
Nun rede Einer von Kaffeegesellschaften bei uns zu Haus, wo der gute Ruf unserer Mitmenschen untergraben und den unschuldigstem Verhältnissen boshafte Deutungen untergeschoben werden – da soll man sich noch darüber wundern, wenn hier oben die Rhinocerosse in den Bergen nicht einmal sicher vor schlechter Nachrede sind.
Montag den 1. December also ritt ich auf einem Pferd des Regenten, der mich wirklich mit einer unermüdlichen Gefälligkeit stets mit Pferden versorgte, nach Lembang hinauf, und der Richtung des Taneuban prau, eines jener Krater zu, die noch immer wühlen und kochen im Innern, und dann und wann einmal die ganze Insel mit einer plötzlichen Eruption erschüttern, und mit glühender Lava das wieder, was sich an Vegetation schüchtern in ihre Nähe gewagt hatte, verwüsten.
Von Bandong aus ritten wir zuerst, denn ich hatte vom Regenten auch einen Burschen mit bekommen, der die Pferde wieder zurückführen sollte, einige Meilen im flachen Lande fort, durch die reizende Bandong-Ebene, dann aber betraten wir die Hügel, und stiegen von nun an, die sich ziemlich rasch hebende Höhe, fortwährend bergauf, dem von Bandong etwa neun Paalen entfernten Lembang zu. Lembang liegt etwas über 4,000 Fuß über der Meeresfläche.
Aber keine öden, wilden Berge sind es, in deren dichter, noch unentwegter Vegetation der Weg sich hinaufwindet, wie über den Megamendong, sondern jeder Fuß breit war hier benutzt, keine Stelle lag unbebaut, und oben vom Gipfel ab rieselten die lebendigen klaren Quellen nieder, und sprangen von Terrasse zu Terrasse aus regelmäßig und oft kunstvoll angelegte Reisfelder, die jungen Pflanzen zu frischen und zu tränken. Hier und da unterbrachen einzelne kleine Kampongs mit ihren Kaffebüschen, Arenpalmen und andere Fruchtbäume die aufgeschichteten Felder – nur die Cocospalme hörte hier oben auf zu wachsen, und wenn auch an einzelnen Stellen einzelne gepflanzt waren, und ihre feinen herrlichen federartigen Blätter aus dem fruchtbaren Boden heraustrieben, mußte ihnen doch die kalte hinüberwehende Bergluft nicht zusagen – sie gediehen nur kümmerlich und trugen keine Früchte.
Um zehn Uhr etwa erreichten wir Lembang, es liegt auf dem Gipfel der ersten Hügelreihe nach den Kraterbergen hinüber Front machend, und hat eine wahrhaft entzückende Aussicht auf die blauen Gebirge und über tief eingerissene, mit wilden Pisang bewachsene Schluchten hin. Hier fühlte man aber auch, daß man in eine andere Temperatur kam – dies war kaum noch ein tropisches Klima, so kühl und frisch wehten die scharfen Winde vom Talcuban prau herüber und so nebeldunkel zog’s von den bewaldeten Gipfeln in’s Thal, all die tropischen Früchte wollten hier, oben auf den Kuppen wenigstens, nicht mehr so recht gedeihen, aber dafür bot die Natur Ersatz in denen einer andern Zone, und ganze Beete mit Erdbeeren bepflanzt, standen in Blüthe und Frucht.
Herr Phlippeau war noch unten aus Tjioem boeloeit, kam aber bald zurück, und ich unterhielt mich indessen mit zwei jungen holländischen Officieren, die sich der Gesundheit wegen hier oben aufhielten und ebenfalls Hrn. Phlippeau’s Gäste waren. Frau Phlippeau befand sich leider auf Besuch in Tjanjor und wurde in der ersten Woche nicht zurück erwartet.
Für mich war jetzt das wichtigste die sogenannten Kaffeemühlen und ihre Einrichtung anzusehen. Mit den Kaffeemühlen geht’s aber gerade so wie mit den Kaffeegärten, sie haben hier denselben Namen wie bei uns, bedeuten aber etwas anderes. Es sind die Gebäude, in welche der frisch eingesammelte Kaffee gebracht, getrocknet, ausgehülst und durch Mahlen von seinen äußeren Schaalen befreit, dann gereinigt und verpackt wird, und die Waarenhäuser, in denen er lagert, schließen sich ihnen an.
Die Kaffebohnen, von denen, wie bekannt, zwei und zwei zusammen wachsen, sind im reifen Zustande von einer fleischigen Hülle umschlossen, die ihnen große Aehnlichkeit, an Aussehen und gewissermaßen auch in Geschmack, mit der Kirsche giebt. Diese Hülle nun zu beseitigen, kommt der frisch ein gebrachte Kaffee in große steingemauerte Platten und die Bohnen, nachdem sie hier eine bestimmte Zeit gelegen haben, werden dann in der Sonne, zum völligen Trocknen, ausgebreitet. Diese Trockenbehälter sind aber so eingerichtet, daß große Schilfgeflechte, und vollkommene regendichte Dächer, die auf kleinen niedern Rädern laufen, bei eintretender nasser Witterung, leicht und rasch darüber geschoben werden können.
Sind die Schaalen nun theils abgeweicht, theils gedörrt, so kommen sie in die „Mühle.“ – Es ist dies eine bis jetzt noch etwas unvollkommene, durch Menschenkraft getriebene Vorrichtung, ein runder Trog, in den eine gewisse Quantität Kaffee hineingeworfen wird, und in dem ein Stein sich fortwährend im Kreis herumwälzt, die trockenen Hülsen zerbrechend und außerdem, mit einer Art Rechen, die niedergepreßten wieder aufwühlend. Der Trog ist etwa zwölf bis funfzehn Zoll breit und in einen Cirkel gebaut, so daß der Stein von einem Arm des in der Mitte aufrecht stehenden Schaftes ausgebend, und von einem großen Wasserrad in Bewegung gehalten, fortwährend rund läuft.
Die Bohnen werden nachher gesiebt; dieser Stein aber kann nicht auf alle Bohnen gleich schwer niederpressen, und die Folge davon ist, daß die kleinen meist unzerdrückt bleiben und dann noch eine höchst mühselige Nacharbeit erfordern. Die Zeit raubenste Arbeit ist aber nachher jedenfalls das Sortiren. des Kaffees, das, wie bei dem Thee, durch Menschenhände geschieht. Die Arbeit ist ja aber hier, eben durch das gezwungene Arbeitssystem, so entsetzlich billig, daß ohne Schwierigkeiten all die nöthigen Kräfte zu bekommen sind. Auch dies geschieht fast nur durch Frauen und Kinder, jedoch ist es unangenehmer als das Theesortiren, da der Kaffee eine Masse Staub ausstößt, die der Thee nicht hat.
Die Kaffeepflanzungen oder Kaffeegärten, wie sie hier genannt werden, gleichen, wenn man sie zuerst betritt, eigentlich eher einem dichten Wald als irgend etwas anderem, und die regelmäßigen Reihen in denen sie stehen, erinnern an unsere deutschen Forstpflanzungen; hoch zwischen den Kaffeesträuchen aussteigende und dichtzweigige Bäume überschatten aber das Ganze und geben ihm eben, wenn die Kaffeebüsche nicht recht in Zucht gehalten werden, leicht das Ansehen einer Wildniß.
Der Kaffee muß nämlich im Schatten wachsen, und man pflanzt zu diesem Zweck besondere Bäume an, unter deren Schutz er aufschießen und Früchte tragen kann. Bis jetzt hat man hierzu gewöhnlich den sogenannten Dadap-Baum genommen, der dicht belaubt und mit ausbreitenden Zweigen hierzu ziemlich gut geeignet ist; auch hat er ein gar freundliches Ansehn mit seinen hellgrünen Blättern und den brennend rothen großen Blüthen, die er auf das dunkle Laub der Kaffeebüsche mit vollen Händen hinabstreut; außerdem ist er aber gar nichts nütz, und selbst sein nasses schwammiges Holz soll nicht einmal zum Brennen zu gebrauchen sein. Hier und da werden deshalb auch schon andere Bäume gewählt, die eben so gut Schatten bieten und sonst noch zu verwenden sind. Mehre Kaffeepflanzungen sollen schon den wilden Baumwollenbaum, den Pahon Kapas dazu genommen haben.
Der Kaffeebaum selber wird, wenn nicht nieder gehalten, wohl dreißig bis vierzig, ja vielleicht mehr Fuß hoch, ich glaube aber nicht daß dann seine Früchte so groß und schön werden, keinesfalls sind sie so leicht einzusammeln, und das Gebüsch würde in dem Fall auch so dicht, daß gar keine Sonne mehr Zutritt zu dem Stamm oder den unteren Zweigen hätte. Das gewöhnliche daher ist sie fünfzehn bis achtzehn Fuß hoch zu halten, und sie sollen dann die ergiebigste Ernte tragen. Durch diese Plantagen führen nach allen Richtungen hin breite vom Gras vollkommen frei gehaltene schöne Wege und theilen die oft viele Meilen langen Gärten in ihre verschiedenen, jeder besonders bezeichneten Distrikte, die jeder wieder ihre verschiedenen Arbeiter zum Reinhalten der Pflanzen und Einsammeln der Früchte haben. Alle diese Arbeiten werden aber vollkommen systematisch getrieben.
Der Pflanzer ist hier nicht, wie das in andern Colonien gemeinlich der Fall, Eigenthum des Landes und der Produkte die er baut, sondern die Regierung hält das Land, legt die Pflanzungen an und unterhält sie, baut Mühlen und Fabrikgebäude und stellt die Leute zu Arbeit. Der Pflanzer hat deshalb mit den Anpflanzungen selber auch gar nichts zu thun, es gehört diese in den Bereich der Culturen, und besondere Beamte sind dafür angestellt. diese anzulegen, zu erhalten und zu überwachen. Sei das nun Kaffe, Thee, Cochenille, Zimmt, Zucker, Indigo oder irgend ein anderes zum Handel und Ausfuhr gezogenes Produkt, diese Verhältnisse bleiben sich, natürlich mit einzelnen Abänderungen, die sich nach den Produkten selber richten, gleich.
Der Pflanzer hat dafür die Verarbeitung des Produktes, das Reinigen, Trocknen, oder Auspressen, je nachdem es nun ist, zu besorgen und jährlich ein gewisses Quantum fertiges Produkt zu einem bestimmten Preis – gewissermaßen für festgesetzte Procente – an die Regierung abzuliefern. Bei dem Quantum sind aber auch all die Beamten, welche die Aufsicht darüber führen, wie Resident und Regent des Distrikts interessirt – in ihrem Vortheil liegt es also, ebensoviel wie in dem der Regierung, daß viel erzeugt werde, während für die Güte des Produkts der Pflanzer größtenteils allein verantwortlich ist, und die Regierung hat sich dabei ihre eigenen Interessen durch das zweckmäßigste Mittel gesichert, das es auf der ganzen Welt gibt, durch das Interesse ihrer Aufseher, und hierin allein liegt sicherlich die Ursache, die Java in den letzten Jahrzehnten zu einer blühenden Colonie und einer wahren Schatzkammer des Mutterlandes und ihrer Beamten gemacht hat.
Die armen Eingeborenen sind dabei freilich am Schlechtesten weggekommen, denn dieses Zwangsarbeitsystem macht allerdings aus der Wildniß blühende Felder und Fluren, aber aus den Menschen – Sclaven. Rede mir Keiner davon, daß dadurch ihr eigener Zustand verbessert sei und sie in den Stand gesetzt wären, Bedürfnisse zu befriedigen, an die sie früher gar nicht hätten denken können; das eine ist nicht wahr, und das andere ein Unsinn.
Ihr Zustand ist nicht verbessert, denn wo ich einem Menschen den freien Willen nehme, wo ich ihn zur Arbeit für Fremde zwinge, da habe ich seinen Zustand nicht verbessert, und wenn ich ihm auch nachher die Mittel an die Hand gäbe Sammet und Seide zu tragen und Hühnerpasteten oder sonst irgend etwas Gutes zu essen. Und Bedürfnisse befriedigen, die sie nicht gekannt haben, ist ein Unsinn, denn was ich gar nicht kenne, kann mir noch kein Bedürfniß sein. Wenn ich aber Jemandem ein neues Bedürfniß kennen lehre, so begehe ich dabei, nach meiner Ansicht wenigstens und von einem strengrechtlichen Grundsatz aus, ein Unrecht, das damit noch gar nicht wieder gut gemacht ist, wenn ich ihm nachher die Mittel an die Hand gebe es zu befriedigen, noch dazu, wenn ich gerade aus diesen Mitteln heraus wieder meinen eignen Vortheil habe.
Es ist ungefähr gerade so, als ob ich Jemandem im kalten Wetter die Haare glatt vom Kopfe scheere, und kaufe ihm dann eine Mütze; die Mütze hält ihm den Kopf allerdings ebenso warm, als es die Haare gethan haben würden, aber weshalb hab’ ich ihm denn überhaupt nicht seine eignen Haare gelassene? – Blos um ihm die Mütze zu kaufen.
Das ist also keine Entschuldigung, nein, geht dem Kinde gleich den rechten Namen, sagt. „Wir scheeren uns den Teufel drum, was aus den Eingebogen wird, so sie nur gesund bleiben, und uns unsere Arbeiten verrichten und dadurch Geld in unsere Cassen zu bringen, und so wir sie auch nur so viel zufrieden stellen und unter dem Daumen halten, daß sie uns nicht wild werden und rebelliren, was allerdings eine höchst fatale Geschichte wäre.“ Und das ist dann nichts Schlimmeres, als in allen übrigen Colonien, wo sich die Eingebornen nur überhaupt zur Arbeit bringen ließen, oder durch die Lage des Landes begünstigt, dazu gebracht werden konnten, mit ihnen geschehen ist. Die Holländer gestatten ihnen doch wenigstens noch zwischen ihnen zu leben und treiben sie nicht durch kleine Kunstgriffe und Contrakte, von denen sie Nichts verstehen und an die sie doch nachher gebunden sein sollen, von den Gräbern ihrer Väter und aus ihren Jagdgründen, wie es die Engländer und Amerikaner thun. Der Holländer läßt den Eingebornen seine Religion und quält ihn nicht mit Missionären und neuen Glaubens-Bekenntnissen, die nur zu häufig Haß und Unfrieden in ihre Familien bringen und den armen Teufeln dann auch noch die letzten Stützen wegschlagen, auf die sich ihr Geist, von allen andern verlassen, zurückziehen könnte, – den Gott ihrer Väter. Selbst die letzte Entschuldigung wäre ihnen aber auch hierin freilich genommen, da ja die Javaner wenigstens schon lange ihrem alten Götzendienst entsagt haben und zu Allah, also zu einem einigen Gott, beten. Wieder eine neue Religion würde sie dann auch ganz confuß machen, denn wer bürgte ihnen dann dafür, daß sie diesmal die wahre bekämen, und nicht nach ein paar Jahren eine neue Sekte ihnen neue Lehren verkündigte.
Ich bin auch überzeugt, daß die christliche Religion die Eingebornen nicht besser machen würde, ja nicht besser machen könnte, als sie sich jetzt in ihrem ganzen Leben und Handeln erweisen, sie sind friedlich, fromm, gastfrei und ehrlich, in ihren Familienverhältnissen treu und anhänglich (was wahrhaftig mehr ist, als die prahlenden Missionäre in der Südsee von ihren sehr precären Christen sagen können) und die christliche Religion könnte von ihnen nicht mehr verlangen.
Die ihnen von der Regierung auferlegten Arbeiten sind nun, für die einzelnen Kampongs auch besonders eingeteilt. Bei den Kaffeeplantagen müssen sie in gewissen Distrikten die Pflanzungen rein halten, die Kaffeekirschen pflücken und in die Mühle tragen und hier verarbeiten und reinigen. Von jedem Quantum, was sie liefern, bekommen sie eine Kleinigkeit, die sie eben am Leben erhält, bezahlt, und lebte der Javane nicht so entsetzlich mäßig, genügten ihm nicht für seine tägliche Nahrung nur ein paar Hände voll trockenen Reises, und vielleicht ein paar Früchte, so könnte er damit nicht einmal leben. Sehr häufig kommt es dabei vor, daß da, wo sie die Produkte oder sonst ihnen von der Regierung auferlegte Arbeiten, wie Holz zu Bauten, z. B. sehr weite Strecken zu tragen haben, sie ebensoviel unterwegs verzehren mußten als ihr ganzer Lohn betrug und sie nun völlig umsonst gearbeitet hatten.
Auch auf Lembang, wo sich die Kaffeegärten viele Meilen weit ausdehnen, sind wohl früher ähnliche Uebelstände gewesen, dafür sollen aber jetzt an den entfernteren Stationen ebenfalls Mühlen errichtet und den Arbeitenden soviel näher gelegt werden.
Die Zahl der hier beschäftigten Arbeiter ist enorm, und soll in der rechten Erntezeit, wo die reifen Kirschen gepflückt und eingeliefert werden, nur auf dieser einen Plantage zu viertausend steigen. Das ist aber nur eine Zeit im Jahre, wo die Leute dann von früh bis spät einzig und allein für die Kaffeegärten beschäftigt sind, und es bleibt ihnen noch vollkommen Muße und Zeit ihre eigenen Reisfelder zu bestellen.
Ueberarbeiten thut sich der Javane überhaupt nicht, das Klima läßt das auch schon gar nicht zu, und ich habe während meines ganzen Aufenthalts dort, nicht einen einzigen gesehen, der in Eibe gewesen wäre, ausgenommen wenn er vielleicht eine recht schwere Last aus den Schultern hatte, und dann that der Last, sondern seiner eigenen Schultern zu liebe, daß er ein wenig größern und schnellere Schritte machte.
Herrn Phlippeau’s Plantage gibt jetzt in einem guten Jahre circa 30,000 Picol Kaffee (den Picol zu 125 Pfd.) die Pflanzungen sollen aber noch erweitert und ich glaube zwei oder drei Mühlen mehr darauf angelegt werden.
Der Kaffee ist auf Java nicht heimisch, sondern erst, wenn ich nicht irre, von Brasilien hierher verpflanzt; auf Sumatra wächst er dagegen wild, und die Eingebornen dort trinken allerdings ebenfalls Kaffee, aber nicht in unserer Art, sondern sie kochen die Blätter des Baumes und bereiten in der Art gewissermaßen einen Kaffee-Thee.
Die neue Geisterwelt.
Beim Maurermeister Brummhuber war Gesellschaft gewesen und es verstand sich von selbst, daß die Tische, als sie sonst ihre Dienste geleistet, und um ebenfalls etwas mit zur Unterhaltung beizutragen, sich drehen mußten zuletzt, wie es jetzt einmal Mode ist. Die Versuche mit den eben auftauchenden Klopfgeistern gelangen dabei so vollkommen, daß ein Theil der Gesellschaft, je mehr die Tische mit ihren Beinen klopften, desto mehr mit den Köpfen schüttelte und ein anderer Theil vor Staunen und innerem Grausen starr wirklich nicht wußte, was er sagen und denken sollte.
Nur einige junge Leute, besonders Anna, die Tochter vom Haus, die den schwersten Tisch blos zu berühren brauchte, um ihn ihrem Willen zu unterwerfen, waren übrigens wirklich aktiv bei dem ganzen Versuch geblieben, von dem alle Anderen bald als „störende Kräfte“ zurücktreten mußten.
Nur ein kleiner Spiegeltisch und ein Nähtisch ließen sich nicht, selbst durch sie, in Gang bringen, während dagegen ein schmaler, sehr elegant gearbeiteter Mahagoni-Theetisch mit einer Säule und vier unten auslaufenden Füßen ihrer leisesten Berührung auf unbegreifliche Weise folgte.
Die Aufregung der Gesellschaft stieg dadurch zu einem immer höhern Grad.
„Ich wollte, ich hätte jetzt den Geheimrath Nurnorden hier oben,“ rief der Maurermeister Brummhuber aus, „den könnten wir jetzt schön überführen mit seinem ewigen Schimpfen auf’s Tischrücken – aber wo’s Brei regnet, hat er gewiß keinen Löffel – jetzt könnt’ er sich überzeugen.“
Der Mann war ganz außer sich, so hatten ihn die unerwarteten Erfolge gepackt und er schwelgte in einem förmlichen Meer von unheimlicher Wonne.
Selbst die Dienstmädchen vergaßen fast Küche und Aufwartung, sich nur immer, wo sich die mindeste Gelegenheit bot, zur Thüre drängend, und Fanny, das Stubenmädchen, ein niedliches, blauäugiges Kind von siebzehn oder achtzehn Jahren, brannte ordentlich vor Verlangen, Theil mit nehmen zu dürfen an dem wunderlichen Spiel, und ihre Kraft zu versuchen an den Tischen. Aber das arme Mädchen durfte es nicht wagen, sich zwischen die Honoratioren zu drängen und nur verstohlen durfte sie zuschauen und sich mit hinanwünschen an den Tisch.
Bis um eilf Uhr etwa dauerte der Lärm, und wie die Leute endlich selber ermüdeten, schienen auch die Tische lässig zu werden und die Fragen lau zu beantworten. Hier und da brach schon Einer oder der Andere der Gäste nach Hause auf, und einmal begonnen, fanden bald Alle, daß es Zeit sei, zu Bette zu gehen.
Eine Viertelstunde später kam das Mädchen, das die Hausthüre hinter den Gästen geschlossen, langsam die Treppe herauf – unten auf dem ersten Absatz blieb sie stehen, setzte das Licht auf den Eckständer und zählte die Zwei- und Viergroschenstückchen, die sie eben eingenommen, schob, vorsichtig nach oben sehend, einen Theil in ihre Tasche, den Rest mit den Uebrigen zu theilen, und verschwand dann in der Küche, an die anschließend sich ihr Zimmer befand.
In dem großen, vor kaum einer halben Stunde noch so lebhaften Saale war es indessen gar still und öde geworden. Unordentlich standen noch die Tische und Stühle umher, wie sie von den Gästen verlassen worden – morgen früh mußte ja doch aufgeräumt werden, was sollte sich die Christel da noch heute Abend bemühen – nur der Mond stahl sich durch die nachlässig offen gelassenen Gardinen in den unheimlich öden Raum, und blitzte von der hellen Politur des Theetisches wider und blinzte nach dem breiten Spiegel hinüber, der ihm gerade gegenüber, über dem Sopha hing. – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
„Ach,“ seufzte da eine leise feine Stimme, und sie klang klar und deutlich durch den ganzen Saal. Wohl eine halbe Stunde hatte tiefes, auch durch keinen Laut unterbrochenes Schweigen auf dem düstern Raum gelegen, und selbst dieser leise Seufzer schien sich zu scheuen, den fast unheimlichen Frieden zu stören, und stahl sich nach allen vier Ecken hinauf, einen heimlichen Schlupfwinkel zu finden und Niemandem ahnen zu lassen, daß er es gewesen, der eben solch einen entsetzlichen Spektakel in dem Heiligthum vollführt.
Alles war wieder ruhig geworden, und nur das regelmäßige Ticktack der großen Bronzeuhr und das leise Bohren eines Holzkäfers klangen durch die Nacht, und es war fast. als ob der Käfer nach dem Takt der Uhr seine Arbeit fortsetzte, so genau hielt er das Zeitmaaß nach den scharfen abgemessenen Tönen.
„Ach,“ tönte da noch einmal derselbe Seufzer, lauter fast als vorher, und der Ton kam augenscheinlich von dem schön polirten Theetisch her, der noch, wie ihn die Gesellschaft verlassen, mitten in der Stube stand.
„Na, was ist denn das für ein Gewinsel da drüben,“ brummte da plötzlich eine etwas derbere Stimme von dem Secretair herüber, „soll man denn heute Nacht auch nicht einen Augenblick Ruhe haben? Gebt’s jetzt einmal Frieden da unten!“
„Ach,“ seufzte es vom Tische aus wieder, dem Gebot zum Trotz, und im Mondenstrahl war es, als ob eine klare, wunderliche Gestalt von kaum sechs Zoll Höhe auf der Platte säße, und das lockige Köpfchen gar schwermüthig in die Hand gestützt hielt.
„Und Sie haben ganz recht, Herr Secretair,“ sagte da die Chiffonniere, „das ist jetzt gerade zum Politur verlieren, was das seit den letzten sechs Wochen hier für eine Wirthschaft im Hause geworden“ – auf der Chiffonniere wurde eine runde winzige Frauengestalt in einem braunen Röckchen mit gelben Knöpfen, die an beiden Seiten wie Schubladenzieher saßen, sichtbar – „ich will nichts von mir selber sagen, ich weiß, zu welcher Klasse der Gesellschaft ich gehöre, und daß wir nicht „verrückt“ werden können, aber es ist auch schon ein Skandal, das nun in einem fort mit ansehen zu müssen, und der Schreibtisch sollte sich da alles Ernstes einmal bineinlegen und die alte Ordnung wieder herstellen.“
„Ganz Ihrer Meinung, Frau Base, ganz Ihrer Meinung,“ flüsterte der eine Rohrstuhl, der rechts neben ihr stand. „ich habe mich auch schon lange gewundert, daß der Herr Secretair, der so lange geduldig zugesehen hat, wie sie’s hier trieben und noch treiben; ich bin zwar nur ein Stuhl, aber die Galle ist mir wahrhaftig schon ein paar Mal übergelaufen, und ich genirte mich nur selber mit allen vier Beinen dagegen aufzutreten, so lange der Herr Secretair und die Frau Base zu dem ganzen Schwindel schwiegen.“
„Prosaische Gestelle!“ rief da endlich der Tisch, und das kleine Wesen sprang in der Erregung des Augenblicks empor, es war eine schlanke, zierliche Jünglingsgestalt mit braunem Teint wohl, aber lebendig blitzenden Augen und einem eigenen seelenvollen Ausdruck in den schönen, zartgeformten Zügen – „nüchterne Alltagsgebilde, die Ihr zürnt und grollt, daß die ertödtende Monotonie Eurer Existenz endlich einmal aufgerüttelt wurde zu That und Leben. Die Hand, die Euch hinsetzt, wohin es ihr beliebt, die Euch benutzt, wie sie es für gut findet, und Euch nur sauber und blank hält und vor Nässe oder Sonnenstrahlen bewahrt, duldet Ihr und lobt sie, lehnt Euch dann in starrem Hochmuth an die Tapete und blast aus allen Schlüssellöchern Eure Zufriedenheit heraus – aber dieselbe Hand, die Euch Gefühl und Seele geben will, die den Geist über Euch bringt, und Eure Poren mit zuckendem Leben füllt, die stoßt Ihr zurück, rümpft die Leisten und schreit über Revolution und Aufruhr.“
„Ei seht doch den Gelbschnabel,“ zürnte der Secretair, und auch auf ihm regte es sich, daß die dunklen Umrisse einer kleinen Figur in recht hochfahrender Stellung und mit sehr weißem Busenstreif und Manschette, mit Brille und Goldkette sichtbar wurden, „weil ihn jede neue Bewegung mit fortreißt, glaubt er sich das Recht herausnehmen zu dürfen über andere – vernünftigere Leute, die Gott sei Dank Gewicht in der Welt haben, loszuziehen, und ihnen am Ende gar vorzuwerfen, daß sie nicht auch seinen Tarantellewahnsinn theilen.“
„Das würde sich wohl von unser Einem schicken, wenn er mit den Beinen klopfte oder hinten ausscharrte,“ sagte die Chiffonniere.
„Ich bin überzeugt, ich bräche,“ lispelte der Glasschrank.
„Laß sie reden,“ wandte sich aber jetzt der Spieltisch, eine untersetzte breitkräftige Gestalt, zu seinem also plötzlich angegriffenen Kameraden, „sie verstehen uns doch nicht, wenn wir es ihnen auch erklären wollten, was für ein eigenes seliges Gefühl es ist, das neue kaum früher geahnte Wesen in sich überströmen zu fühlen, laß sie reden, sie sind doch nur arm, mit all ihrer Breite und Höhe, denn sie werden das nun und nimmer begreifen.“
„Ach geahnt hab’ ich es wohl schon in früherer Zeit,“ seufzte der Theetisch wieder, „wie eine Erinnerung an den alten rauschenden Wald ist es mir schon manchmal durch die Poren gezogen, wenn sie ihre Hand auf meine Fläche legte, oder ihr kleines Köpfchen sinnend gegen mich gelehnt, darin stützte.“
„Na nu bitte ich aber zu grüßen,“ knarrte ein dreiwinkliger Eckschrank, der sieh zwischen zwei Blumentische eingezwängt hatte, und jedesmal, wenn er aufgemacht wurde, mit der linken Klappe – denn die rechte war festgeriegelt – nach den Epheuzweigen hinüberschlug, die an ihm hinaufranken wollten (er konnte die Blumen nicht leiden), „da möchte man ja wahrhaftig gleich aus dem Leime gehen über solchen Unsinn. Ich habe außerdem den schlechtesten Platz in der ganzen Gesellschaft und alle Klappen voll zu thun, das Schmarotzerzeug hier von mir abzuwehren, und dann auch noch solch ein langweiliges Geschmachte mit anhören zu müssen – es ist zum Verzweifeln.“
„Nein, die Arroganz ärgert mich nur, das Geschmachte möchte noch angehn,“ sagte die Chiffonniere, „ganz auf einmal klüger sein zu wollen als der Herr Secretair und selbst der Schreibtisch und andere ältere Stücken – der Schreibtisch hat doch eine Menge geheime Gefache und er sagt nichts; da sieht man’s, wie sich Leute zu verhalten haben, die etwas in der Welt gelten und auf ihre Würde zu sehen wissen.“
Jetzt nahm sich aber der Spieltisch wieder seines Nachbars an, denn dieser schien auf das Zanken der übrigen Meubeln gar nicht zu achten und wirklich ganz in seinem Schmerz versunken zu sein.
„Was Schreibtisch und Secretair,“ sagte er verächtlich, „leere Gefache sind’s, die er hat, höchstens mit der Weisheit Anderer gefüllt – der mag recht nützlich sein, etwas nachzuerzählen oder aufzubewahren, was man ihm aufgeschrieben hat, aber was um ihn her vorgeht und was in der Welt passirt, davon weiß er Nichts. Geht mir mit seinem gelehrten Meubel.“
„Das ist recht, der Grünschnabel muß auch sein Maul dabei verbrennen,“ sagte die Chiffonniere, „glaubt, weil er inwendig und auswendig polirt ist, sei er allein klug, aber die Fußbank selbst hat gelacht, wie Ihr Euch da im Kreise herumgedreht und geknarrt, geschnarrt und geklopft habt.“
„Als ob etwas daran läge, wenn eine Fußbank lacht,“ sagte der Spieltisch.
„Der Spieltisch thut jetzt auch so, als ob er prophezeihen könnte,“ ließ sich jetzt noch eine neue Stimme hören, „und dann verlangt er auch noch, daß man es glauben soll“ – es war der Spiegel, der über einem kleinen Säulentisch zwischen zwei Fenstern stand.
„Und hab’ ich Euch nicht den Beweis gegeben, daß ich es kann?“ rief der Spieltisch, ärgerlich zu ihm aufblickend.
„Ich habe gesehen, wie der eine Student gedrückt hat“ sagte der Spiegel.
„Wenn Du noch einmal solch eine Lüge weiter erzählst,“ brummte dieser aber, „so laufe ich das nächste Mal in Dich hinein.“
„Das ist die Art aller gemeinen Naturen, gleich mit Zerstörung zu droben,“ sagte der Glasschrank, „die Starke thut’s freilich nicht; und wenn ich von Eisenblech wäre, ich würde keinem Schwächern drohen; alles Schwache ist edel.“
„Sein Sie nur ruhig, Jungfer Glasschrank,“ nahm aber hier ein kleines Pfeilertischchen die Partie des Spieltisches, „Ihr Edelmuth ist auch nicht so weit her, denn wie wir vor einem Jahr hier einzogen, und das Hausmädchen unten in der Flur eine arme entfernte Verwandte von Ihnen, die Stalllaterne, zu Ihnen hinsetzte, wollten Sie gar nichts von der wissen, und bließen sich so auf, daß zwei Scheiben sprangen.“
„Nun ich drehe mich nicht,“ sagte der Glasschrank.
„Ja, das glaub’ ich,“ lachte aber der kleine Pfeilertisch ein wenig boshaft zurück, „die Leute, bei denen der ganze Glanz und Flitter draußen sitzt – ich will auf Niemanden anspielen – und die hinten eben nur weißes Tannenholz haben, die drehen sich Alle nicht, so viel haben wir bis jetzt herausbekommen.“
„Es ist schändlich, einem sittsamen Frauenzimmer so etwas in’s Gesicht zu sagen,“ rief der Glasschrank.
„Sie sorgen wenigstens dafür, daß man nicht hinter Ihrem Rücken von Ihnen reden kann,“ sagte der Pfeilertisch.
„Laßt sie gehen,“ legte sich aber hier der Theetisch, der durch den Zank der Uebrigen erst auf den um ihn her immer lauter werdenden Lärm aufmerksam geworden war, in das Wort, „sie verstehen uns doch nicht, und es wäre deshalb auch vergeblich, ihnen das ganze Selige unserer Empfindung begreiflich machen zu wollen. Wir aber haben das Bewußtsein einer erstehenden Existenz in uns; nicht mehr nur die seelenlosen Träger der Lasten unserer Herren, sind wir plötzlich ihre Freunde, ihre Rathgeber geworden, von ihrer eigenen Kraft, ihrem Lebenstrieb theilen sie uns mit, die schon fast vertrockneten Poren saugen es gierig ein, und wir Geister des Waldes, die wir den liebgewordenen Aufenthalt unserer alten Stämme selbst dann nicht verlassen wollten, als wir niedergeworfen und verstümmelt in die Welt hinaus gestreut wurden, jauchzen in bebender Lust dem kaum mehr gehofften und doch o so heiß ersehnten neugewonnenen Dasein frisch und fröhlich entgegen“
„Es ist zum Verzweifeln.“ sagte der Secretair.
„Warum nur der Spiegel- und Nähtisch sich nicht rühren wollten?“ frug der Pfeilertisch.
„Der arme Nähtisch ist taubstumm,“ sagte der Theetisch, „ich kannte seine Aeltern in Mittel-Amerika, eine muthwillige Axt hatte ihn frühzeitig verstümmelt und er ist jetzt auch, trotz des glänzenden Aeußern, durch und durch wurmstichig, und der Spiegeltisch darf nicht,“ flüsterte er dann dem Pfeilertisch unter die Platte, „der Spiegel hat ihn einmal unter dem Daumen und läßt ihm seinen freien Willen nicht; aber ich bin darum dem Spiegel nicht gram, er ist zwar grob, aber doch ehrlich, und sagt’s frei vom Quecksilber heraus, wie es ihm gerade vor das Glas kommt.“
„Das eben ärgert mich so an dem Glasschrank,“ erwiederte der Pfeilertisch, „die Mamsell möchte am liebsten allen Andern Sand in die Augen streuen. Was sie hat, rückt sie vorn zur Schau und mit dem Spiegelglas dahinter thut sie, als ob’s gerade noch einmal so viel wäre, und faßt man sie nur an, so klirrt und klappert die ganze Bescheerung.“
„Ich bin furchtbar angegriffen heut’ Abend,“ sagte der Theetisch und knarrte, „ich fürchte fast, ich habe mir Schaden gethan.“
„Das geschieht Dir ganz recht, mit Deiner albernen Aufregung,“ brummte der Spiegel, „s’ist ja zum Zerspringen, nur so etwas mit ansehen zu müssen.“
„Ach, wenn es nur erst wieder Abend wäre,“ seufzte aber der Theetisch, ohne ihn weiter einer Antwort zu würdigen, „daß ich die weiche Hand wieder auf meiner Fläche fühle. Schon als Baum draußen kannte ich solch ein süßes liebes braunes Kind, das lag auch so gern in meinem Schatten, und ich flüsterte ihm aus den Zweigen manch holdes Liebeswort herunter und streute ihm Blüthen und Blätter über Stirn und Schläfe, es ist aber nun lange todt,“ setzte er seufzend hinzu, „und Jahre lang vorher, ehe der gierige Zahn der Axt meinen Stamm angriff, gruben sie ihm ein Grab zwischen meinen Wurzeln. O, die liebe, liebe Zeit!“
„Pst, da kommt Jemand!“ flüsterte der Pfeilertisch, der ein sehr feines Gehör hatte, und die Geister der Meubeln horchten einen Augenblick und glitten dann schweigend unter ihr Fournier zurück; nur der Mond lag auf den blitzenden Flächen und warf breite wunderliche Schatten in das stille Gemach.
Da öffnete sich leise und vorsichtig die Thür, und Fanny steckte schüchtern und ängstlich den Kopf herein. Die Tische standen noch alle wie sie verlassen worden. Kein Laut ließ sich hören und unschlüssig blieb sie auf der Schwelle stehen. Es sah auch gar so still und unheimlich aus in dem weiten Raum, und kein Wunder war’s, wenn das arme Kind den Ort zu betreten fürchtete, der noch vor kurzer Zeit der Schauplatz so geheimnißvollen, unbegreiflichen Lebens und Schaffens gewesen. Es ist wahr, nichts Feindseliges, Drohendes oder Gefährliches ließ sich irgendwo entdecken. Dort stand noch derselbe Theetisch auf allen vier Beinen, wie jeder andere harmlose Tisch auf der weiten Gotteswelt und nur die krankhaft erhitzte Einbildungskraft eines tollen Menschenkindes wäre im Stande gewesen, Unheimliches aus der blanken polirten Fläche des Mahagoni herauszulesen – und doch, doch lag eben jenes unheimliche Schweigen, jene sprechende Stille über dem Gemach, die das Herz des jungen Mädchens ängstlich klopfen machte. Endlich aber bezwang sie doch das Grauen, das ihr fast unwillkürlich die Brust beengen wollte, und mehr fast noch eine Ueberraschung von außen fürchtend, warf sie scheu den Blick über die Schulter zurück, den weiten, düstern Gang entlang, den sie eben gekommen, und dann, als sie dort alles ruhig sah, heimlich und still in’s Zimmer schlüpfend, drückte sie vorsichtig und geräuschlos die Thür wieder hinter sich in’s Schloß.
Es war, als ob das arme Mädchen etwas Böses begangen, und doch schaute das von der Angst wohl etwas gebleichte aber liebe und freundliche Gesichtchen so vertrauungsvoll und unschuldig in das milde Licht des Mondes auf; man hätte ihm, nicht um’s Leben, etwas Unrechtes zutrauen können.
Jetzt schien sie sich auch endlich von ihrer ersten Befangenheit erholt zu haben, denn plötzlich blieb sie stehen, strich sich das dunkelbraune volle Haar aus der Stirn und ging dann mit festem Schritt gerade auf den in der Mitte des Zimmers stehenden ovalen Theetisch zu.
Hier aber war es, als ob aufs Neue eine gewaltige innere Bewegung sie ergriff; scheu und zitternd stand sie noch einen vollen Schritt von dem Tisch entfernt, und wagte nicht, ihn zu berühren.
„Ob er mir denn aber auch wohl Rede und Antwort stehen wird, wie dem Fräulein?“ flüsterte sie da leise und wie zweifelnd vor sich hin: „ob er mir sagen wird, um was ich ihn so gerne fragen möchte?“
Hui, wie das plötzlich knisterte und knatterte in dem Holz. Sie schaute erschreckt empor, um sich her – aber Alles war ruhig, und nur Täuschung gewesen.
„Das Holz hat sich gezogen,“ sagte sie leise, wie um sich zu beruhigen, vor sich hin, „aber ich wag’s,“ setzte sie dann etwas lauter und entschlossener hinzu, „ich wag’s, und wenn ich ihn recht fest halte und warm, wird er mir ja auch wohl Kunde geben von dem, was er weiß, was er wissen muß, – wie ja fast jeder Tisch jetzt im ganzen Haus; er muß reden.“
Mit den Worten fast trat sie dicht hinan zu dem Tisch und ihre beiden warmen Hände flach und fest auf den blitzenden Mahagoni pressend, daß ein zarter Hauch unter dem Rand der Hand fort über die Fläche schoß, wie sich die Eisblumen in Winterzeit an den Fenstern bilden, stand sie und schaute still und lautlos vor sich nieder.
Da begann es wieder. Still wie festgewurzelt noch stand der Tisch, aber wie zu dem warmen Körper gehörig, der sich ihm anschmiegte, bebte er, bis in seine innersten Poren, und wie knitternde Funken sog sich der schimmernde Glanz in das Mondlicht ein.
„O mein Gott!“ stöhnte das erschreckte Kind, und in sich zusammenbrechend, sank sie auf einen daneben stehenden Stuhl und breitete die Arme aus, auf deren rechtem ihr Haupt ruhte, und Brust und Arme berührten die Platte.
Da regte und hob es sich in dem Holz, da quoll und drängte es in jenem eigenen geheimnißvollen, wunderbaren Leben durch die trockenen Fasertheile des Tisches, und des Mädchens Augen blitzten jetzt lebendiger in dem freudigen. Bewußtsein, die Kraft zu haben über jenes wunderbare Wesen, das in dem leblosen Tische da schaffe und treibe und zu dem Menschen in seiner eignen Sprache redet.
„Und willst Du mir eine Frage beantworten?“ flüsterte sie, „willst Du mir Rede stehen, jetzt, wie dem Fräulein Anna?“
„Frage nicht, frage nicht!“ tönte und zitterte es da um sie her, „tollkühnes Menschenkind, frage nicht! Du bist unser, Du bist unser, und wenn Du es wagst, und wie Du uns jetzt drängst und umspannst, umsponnen wir Dich in dem engen Haus, und Du schläfst tief, tief hinein in den sonstigen Tag.“
„Wie ist mir denn nur, träume ich denn oder wach’ ich?“ rief da das Mädchen, „das ganze Zimmer wird lebendig und regt sich und räuspert und knistert, mir fängt’s an zu grausen.“
„Frage nicht, frage nicht!“ rief’s da mit mürrischem, warnendem Ton vom Secretair nieder, und dem erstaunten Mädchen kam es vor, als ob es sich auch dort oben regte und hob, und der kleine wunderliche Geist lief auf und ab auf seinem Sims und schüttelte seinen kleinen Kopf und die Frackschöße, und rückte mit der Brille und scharrte mit den winzigen Füßen. „frage nicht, Unsinn. Tisch ist trunken, hat den ganzen Abend gesogen und gesogen, bis er toll und voll war und sich drehen mußte, frage nicht.“
„Warne Dich, warne Dich, Kind,“ knarrte es von der Chiffonniere, „hab Acht, hab Acht, bist hier in unserm Bereich, warne Dich, warne Dich, hab Acht.“
„Trauen Sie dem Tisch nicht, Liebwertheste,“ wisperte es aus dem Glasschrank herüber, „er ist falsch, er ist falsch. lange schon hat er sich um mich gedreht, aber er lügt, er lügt.“
„S’ist doch merkwürdig, wie Einem das bloße Handauflegen so durch die Nerven zuckt,“ flüsterte das Mädchen, sich ängstlich dabei nach allen Seiten umschauend, „in den Armen und Fingerspitzen kitzelt’s und dehnt’s, und vor den Ohren summt mir’s wie menschliche Stimmen und Worte, wenn er sich nicht bald dreht, lauf ich davon; aber wahrhaftig, er fängt an, ich fühl’s, ich fühl’s, er regt sich schon, er kommt.“
„Frage nur, frage nur!“ zischte und wisperte es da um sie hin, vom Spieltisch und Pfeilertisch her, „frage nur, furchtsames Kind, die Zeit ist günstig, die Geister sind wach, und wir Alle dienen Dir, helfen Dir, frage nur.“
Der Tisch fing sich jetzt mehr und mehr an zu regen und zu drehen, und das Mädchen mit klopfendem Herzen und fliegenden Pulsen folgte seiner Bahn.
„Ich habe große Lust, mich da mitten hineinzuwerfen in den Unsinn,“ kreischte da der Eckschrank, und stieß seine eine Klappe auf, gegen den Epheu, „ich kann mich so oben abheben! Prahlhans von einem Tisch, Prahlhans!“
„Er geht,“ jubelte Fanny, „ich habe die Kraft,“ und sie fühlte dabei, wie die Platte unter ihrem Tisch Leben und Weiche gewann und sich hob und drängte. „Frage nur,“ knisterte und wisperte es dann wieder vor ihrem Ohr, „frage, wie alt Du bist und den Datum, die Hausnummer und die Bilder an den Wänden, frage uns nach Reisen und Wiederkehr, nach Namen und Ehen und Briefen, wir wissen Alles, Alles, frage nur, frage nur!“
„Jetzt aber hab’ ich’s satt,“ schrie der Secretair, und all seine Fugen knackten und knarrten und unter seinen Füßen stöhnte der Boden. Und in dem Glasschrank klirrte und klapperte es, von rechts und links herüber zischten und summten die Laute.
„Ach, ich fürchte mich wahrhaftig,“ flüsterte das junge Mädchen vor sich hin, „das ganze Zimmer ist wie lebendig, und der Tisch dreht sich, daß ich anfange schwindlig zu werden; ob ich ihn frage? Ich wag’s, ich versuch’s, der Augenblick kehrt im Leben nicht wieder. Wenn er nur nicht die Dielen aus einander reißt. Willst Du mir antworten, Tisch?“
Es war, als ob ein elektrischer Schlag durch die Platte zucke, denn mit einem plötzlichen Ruck, daß die Fugen knackten, blieb er stehen, und sich auf zwei seiner Beine hebend, klappte er wieder nieder und zwar so bestimmt, so zuversichtlich, als ob er hätte sagen wollen: „Na, das versteht sich doch jetzt wohl von selbst.“
So unerwartet kam dabei dem jungen Mädchen diese entschiedene Bewegung, daß sie mit einem leisen Schrei in die Knie sank.
„Ha ha ha ha,“ lachte da und schüttelte sich die kleine Gestalt auf dem Secretair. und winkte und nickte nach der Chiffonniere hinüber, „närrisch Ding, närrisch Ding, hab’s mir wohl gedacht, wie es kommen würde. So geht’s, wenn man sich einläßt mit den wahnsinnigen Tischen und dem Unsinn das Ohr leiht; tolles Zeug, tolles Zeug.“
„Sie wird nicht ruhen, bis ihr alle Schiebladen verklommen sind,“ sagte die Chiffonniere, „und die Tische tragen nachher die Schuld mit ihrer unzeitigen Bewegung. Das kommt von den Neuerungen, da lob ich mir meine Ruhe.“
„Der Tisch fängt wahrhaftig an sich wieder zu bewegen,“ sagte der Glasschrank – wenn er nur nicht in mich hineinläuft.“
„Das geschieht ihr aber recht“ knurrte der Eckschrank – „jetzt freut mich erst mein Leben. Aber ich will den Unsinn auch gar nicht mehr mit ansehen – es wird überhaupt kalt hier im Zimmer.“
Und er schloß seine Klappe wieder, daß das Schloß einschnappte, und lehnte sich schweigend in die Ecke.
Aber nur der erste Schreck hatte die Fragende überrascht; scheu den Blick zurück über die Schulter werfend, richtete sie sich wieder auf und mit den mehr gehauchten als gesprochenen Worten – „so stehe mir Rede“ – hielt der Tisch regungslos an, und schien die Frage seht förmlich zu erwarten.
„Sage mir denn“ flüsterte das schüchterne Kind, und das Blut schoß ihr dabei in Stirn und Schläfe – „ob er bald Aktuar werden wird, wie wir es lang, ach lang erwartet?“
Der Tisch hob sich rasch und entschieden und schlug wieder nieder als „Ja!“
„In wie viel Jahren?“ drängte sie da, und die Augen blitzten ihr ordentlich in freudiger Erwartung.
„Eins, zwei, drei, vier, fünf!“
Halblaut zählte sie, immer ängstlicher werdend mit, und als der merkwürdige Antworter stehen blieb und sich, wie zum Zeichen, daß seine Rede beendet, ein klein wenig nach ihr hindrehte, seufzte sie wehmüthig und recht aus voller Brust.
„Ach, das ist gar so entsetzlich lang’ noch, Du böser, böser Tisch, und da gäbe es ja doch nur ein Mittel, dem zu begegnen auf der weiten Welt.“
Und die Platte unter ihr regte und drehte sich rasch jetzt und immer rascher, als ob sie ihre Bereitwilligkeit wolle zu erkennen geben, dabei zu helfen.
„Und weißt Du schon, was ich meine?“ flüsterte scheu und ängstlich das Mädchen.
Wieder stand der Tisch und hob sich rasch und entschieden zu einem „Ja.“
„Und willst Du mir helfen?“
Heftig hob sich der Tisch und stampfte bejahend, und wie von unten herauf klopfte es plötzlich noch eins, zwei, drei Mal, der Antwort gewissermaßen Bestätigung gebend, daß die Fragende erschreckt aufhorchte nach den fremden ungeahnten Lauten; aber diese verstummten wieder und das Mädchen flüsterte jetzt rasch und heimlich:
„Wenn Du denn weißt, was uns allein nur helfen kann, so nenne mir die Zahl – nenne mir die Nummer des Looses, das uns frei macht von jeder Noth – die Tausende erst, dann die Hunderte und die Einer nach, und nun klopf’ mein Tisch, klopf’ und antworte, antworte mir – ich frage Dich!“
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,“ hob sich der Tisch in raschen bestimmten Schlägen, die beiden Füße sich nur immer wenige Zoll vom Boden hebend, aber genug, einen klaren Laut zu geben – „sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn“ – weiter, weiter und weiter und in ängstlicher, aufmerksamer Spannung lauschte und zählte da Fanny.
„Klopf, klopf, klopf!“ kam es von unten dazwischen, als ob die Geister der Tiefe dem Treiben zürnten, und Einspruch thun wollten in das kecke Begehr: „klopf, klopf, klopf!“
„Ich werde irr’“, flüsterte ängstlich die Zählende, „dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn.“
„Klopf, klopf, klopf, klopf, klopf –“
„Vier und zwanzig, fünf, sechs, sieben, achtundzwanzig – Heiliger Gott – mir schwindelt es schon von dem tollen doppelten Zählen“ – aber weiter klopfte der Tisch, immer weiter und unverdrossen fort, und das unheimliche Echo unten schwieg eine Zeitlang, wie besiegt von dem eisernen Willen der oben arbeitenden Kraft.
„Sieben und dreißig –“ und der Tisch drehte sich knarrend auf einem Bein, während es unter seinen Füßen wieder zu toben und rühren begann.
„Sieben und dreißig Tausend“ – jubelte Fanny, kaum im Stande, ihre laute Freude zu unterdrücken, und der Secretair knarrte und ächzte wieder, und in der Chiffonniere war es, als ob ihr der ganze Rücktheil geplatzt wäre vor lauter Aerger, aber sie sagte kein Wort mehr, und wenn sie sich hätte ein Schlüsselloch abbeißen sollen.
„Und nun die Hunderte“, bat das Mädchen mit dringender Stimme.
Und „eins, zwei, drei, vier, fünf“ – begann wieder der Tisch und drehte sich.
„Also fünfhundert, und nun die Einer!“ bat die fragende mit flehender Stimme, und wieder begann der Tisch:
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht“ – unten war es still und ruhig geworden, er hatte den Sieg davon getragen – neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn –“
„Himmel, was war das?“ – Draußen am Vorsaal riß es an der Klingel, als ob es die Glocke ausreißen wollte mit dem Drahte.
„Achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig“.
„Tischchen dreh’ Dich, Tischchen dreh’ Dich!“ spottete es von der Chiffonniere herunter, „kommt Besuch, kommt Besuch!“ und der Glasschrank klirrte und klapperte wieder, und der Schmied, der auf der bronzenen Uhr stand, hob seinen Hammer und fing an drohend die Zeit zu schlagen auf dem silbernen Ambos – es war zwölf – und die Geister ringsum regten und reckten sich wieder und horchten hinüber nach dem noch immer wild und rastlos zählenden Tisch.
„Dreiundfünfzig, vierundfünfzig, fünfund –“
„Klingglinglinglingling!“
Das ganze Haus dröhnte von dem Reißen der Schelle, und Thüren klappten und Pantoffeln schlurrten über den Vorsaal, und das Mädchen ließ den Tisch los, barg ihr todtenbleiches Antlitz in den Händen und stöhnte verzweifelnd: „Vorbei – vorbei!“
Es war in diesem Augenblick todtenstill im Gemach, und geräuschlos glitten die Geister zurück in ihre Schlupfwinkel, nur der Schmied hämmerte ruhig und unbekümmert seine Schläge fort, bis er den zwölften gethan – er hatte ein gutes Gewissen – und dann ließ er den Hammer wieder ruhen und horchte aufmerksam nach dem Räderwerk nieder, das unter ihm schnarrte und rollte, das Zeichen abzuwarten, das ihn nach einer halben Stunde zu neuer Thätigkeit rufen würde.
Jetzt öffnete sich draußen die Thür, und mit einem „Himmel Heiland Donnerwetter!“ wurde eine Stimme laut, der die nächtliche Tischrückerin mit ängstlich klopfendem Herzen lauschte, und dabei die Klinke der Nachbarkammer ergriff, sich durch die Flucht, sobald es nöthig sein sollte, jeder Entdeckung zu entziehen.
„Aber mein Gott, Herr Geheimrath?“ sagte draußen die Stimme des Maurermeister Brummbuber – „und verdank ich denn die unverhoffte –“
„Herr, zum Donnerwetter!“ unterbrach ihn aber in wildem Zorn der späte vornehme Besuch – „geben Sie denn die ganze Nacht keine Ruhe mit ihrem unseligen Tischklopfen und Rütteln und Scharren?“
„Aber ich begreife nicht“ – stotterte der Ueberraschte, der eben im ersten Schlafe gelegen.
„Ach was, begreifen – den ganzen Kalk habe ich mir unten von meiner Decke gestoßen, daß das verdammte Klopfen hier oben aufhören soll – aber Gott bewahre! Herr, das ist zum wahnsinnig werden, und gerade über meinem Schlafzimmer – je mehr ich klopfte, desto toller wurd’s.“
„Aber ich gebe Ihnen mein Ehrenwort –“
„Was hilft mir Ihr Ehrenwort, wenn mein ganzes Zimmer voll Kalk jetzt liegt, und der Teufel hier los ist halbe Nächte lang über die Polizeistunde hinaus?“
„Aber ich liege ja schon mit meiner ganzen Familie zwei Glockenstunden im Bette, und muß mir jetzt hier in dem dünnen Anzug den Tod holen vor Erkältung.“
„Ueber meinem Schlafzimmer war’s!“ trotzte aber der Geheimrath, in seinen warmen Schlafrock gehüllt, die Mütze halb über die Ohren gezogen – „und ich kündige meine ganze Etage morgen, wenn mir der Skandal noch einmal vorfällt.“
„Hier ist das Zimmer, das über ihrem Schlafzimmer liegt!“ rief jetzt der Steuerrevisor in allerdings noch immer respektvoller, aber doch auch gerechter, sich seiner Unschuld bewußter Entrüstung, und riß in dem nämlichen Augenblick die Thür auf, als Fanny durch die gegenüberliegende verschwand – „wenn hier ein Tisch geklopft hat, Herr Geheimrath, so hat er mit sich selber gesprochen – und nach den heutigen Vorgängen wäre das allerdings nicht unmöglich – aber ich versichere Sie –“
„Mit sich selber gesprochen!“ rief der Geheimrath in unbeschreiblicher Verachtung, und zog sich die Nachtmütze bis über die Ohren – „mit sich selber gesprochen –“ und über den Saal schlurrte er hin und warf die Saalthür hinter sich in’s Schloß, daß die Scheiben klirrten und brummte und knurrte die Treppe hinunter – „mit sich selber gesprochen – toll, toll, toll werden sie im Kopf oben, im Schädel und unten in den Tischen – toll, reine toll – mit sich selber gesprochen.“
Und die Schritte verhallten unten im Haus – man hörte eine Thür öffnen und schließen – der Maurermeister Brummhuber war schon lange wieder in sein Bett gekrochen und hatte über den brummigen Miethsmann geschimpft, der ihm den Tod werde angethan haben mit Rheumatismus und Schnupfen. –
Auf ihrem Bett aber, das thränenfeuchte Antlitz fest in das Kissen gedrückt, lag Fanny und seufzte und schluchzte still vor sich hin.
„Vorbei – vorbei – siebenunddreißig Tausend fünfhundert und Gott weiß, welche andere Zahl. – O, der unglückselige Geheimrath – und noch fünf Jahre warten, ehe er Aktuar wird.“
Und der Schmied auf der bronzenen Uhr im Zimmer hob wieder aus, ließ den Hammer einmal klingend auf den silbernen Ambos nieder schlagen und horchte bedächtig nach unten – aber kein Laut ließ sich hören weiter wie das regelmäßige Ticktack der Wanduhr und das leise Bohren des Holzkäfers, der nach dem Takt der Uhr seine Arbeit fortsetzte – so genau hielt er das Zeitmaß nach den scharfen, abgemessenen Tönen.
Reisbau und Reisbauer in Java.
Am 14. Januar Morgens ritt ich mit Herrn Blumenberger, der in Geschäften nach Batavia gekommen war, nach Tjipamingis hinauf. Gerade mit Sonnenaufgang verließen wir die letzten Landhäuser, und einen schmalen Fuß- oder Reitpfad annehmend, der durch eine weitläufige Cocosgartenanpflanzung führte, erreichten wir die freien Reisfelder, durch die ein enger Weg, bald durch, bald an Gräben hin, jetzt über eine Strecke hohen trocknen Landes, jetzt wieder durch niedere sumpfige oder künstlich überschwemmte Gegenden führte.
Es war ein wunderherrlicher Morgen, die Gipfel der schwankenden im Winde rauschenden Cocospalmen, des schönsten, stolzesten Baumes, den die Tropenwelt geschaffen, glühten von den ersten Strahlen der jungen Sonne geküßt – über das niedere Land zogen noch dünne duftige Nebelstreifen, hier sich wie zum Spiel um eine hohe Gruppe dunkellaubiger Manga’s sammelnd, dort, von irgend einem Luftstrom erfaßt, wie ein Milchbach rasch ein enges Thal hinabfließend. Hier herrschte auch Leben in der Flur; dann und wann flog zwitschernd und scherzend ein muntrer Schwarm von buntgefiederten Reisvögeln in die niedern, die Felder umwachsenden und den Weg hier und da begrenzenden Büsche, wenn ein Ulang-Ulang vielleicht, dicht über ihnen wegstreichend, sie aufgescheucht hatte von ihrem Morgenschmauß. An den feuchten Rainen saßen kleine weiße ernsthafte Kraniche und schauten neugierig in das zu ihren Füßen leise quillende Wasser nieder, und über ein dann und wann trockenes Feld schritt wohl ein langbeiniger Bangun, eine Art Storch mit riesig dickem Schnabel und schwerfälligem Kopf, sich mühsam rechts und links nach den vorbeispringenden Pferden umschauend, ob sie ihn nicht auch etwa in seinem Morgenspaziergang stören und ihm die schöne Frühzeit verderben wollten.
In den Reisfeldern wurde es ebenfalls lebendig, Schaaren von Mädchen kamen aus den einzelnen Baumgruppen. in denen versteckt ihre Hütten lagen, heraus, ihr mühsames Tagewerk mit Pflanzen zu beginnen, und hier und da schlenderte langsam ein junger Bursch mit seinen beiden Karbauen heran und in den Schlamm der noch nicht zugerichteten Felder hinein, zu pflügen oder zu eggen.
Der Reis ist die Hauptnahrung nicht allein des Javanen, sondern fast aller indischen Völker, und der Reisbau deshalb eine ihrer wichtigsten, nothwendigsten Beschäftigungen.
Man baut hier auf Java zwei Arten von Reis, den nassen und trocknen. Das hauptsächlichste Handelsprodukt liefert der naßgebaute Reis, die Eingeborenen ziehen dagegen für ihren eigenen Bedarf den trocken gezogenen – und unter diesem wieder den rothen Reis vor, der nahrhafter und wohlschmeckender sein soll, als der andere, aber nicht so verkäuflich ist wie dieser, deshalb bauen sie den trocknen fast nur zu ihrem eigenen Bedarf. Einzig und allein dürfen sie sich aber auch nicht auf ihre trockenen Felder, die in der Anlage mit unsern Waizenfeldern Aehnlichkeit haben, verlassen, denn eine sehr trockene Jahreszeit könnte ihnen leicht eine Mißernte bringen, während der andere, durch lebendige Quellen und Ströme bewässert, weniger oder doch nicht so allein, von dem Regen abhängig ist.
Die hauptsächlichste und mühsamste Arbeit beim nassen Reis, d. h. solchem, der nicht allein im Wasser gepflanzt wird, sondern auch fast bis zur Reife mit den Wurzeln unter Wasser gehalten werden muß, ist jedenfalls die Herstellung der Felder selber, die vollkommen eben angelegt, und einzeln mit Rändern oder Rainen umgeben sein müssen, um das Wasser sowohl darin zu halten, als auch gleichmäßig zu verbreiten. Natürlich findet sich in diesen bergigen oder auch nur wellenförmigen Ländern selten eine Strecke Land, selbst nur von einem Acker groß, deren Fläche vollkommen wagerecht wäre, oder mit nur einiger Mühe dahin gebracht werden könnte. Die natürliche Folge davon ist denn, daß die Felder sehr klein angelegt und lieber mehrere tiefer und tiefer laufende Abtheilungen oder Schichten gegraben werden müssen, um das Wasser nach allen Seiten gleichmäßig verbreiten und benutzen zu können.
Um diese Felder zu ebnen und aufzuhacken, gebrauchen die Javanen eine breite, und wenn man sie so von weitem ansieht, scheinbar sehr schwere Hacke; der Javane hat aber viel zu viel Liebe für seine eigenen Gliedmaßen, als daß er sich wirklich mit schweren Werkzeugen nur irgendwie einlassen sollte. Die Hacke besteht aus dem leichtesten Holz, mit einem Stiel, den man ohne die geringste Mühe zwischen den Händen – nicht einmal vor dem Knie – durchbrechen könnte, und nur vorn an der Schneide liegt ein dünner, sehr dünner und schmaler langer Stahl, um dadurch dem Werkzeug doch eine Schneide zu geben. Das sämmtliche Eisen an der ganzen Hacke wird nicht über ein Viertelpfund wiegen.
Ist das geschehen und von abgeschlagenem Rasen ein etwa Fuß hoher und ebenso breiter Damm oder Rand um dasselbe gelegt, dann wird das Feld gepflügt. Ich glaube aber, sie lassen schon vor dem Pflügen Wasser hinein, um diese Arbeit leichter in dem sonst wohl etwas schweren Boden verrichten zu können, und gehen erst mit dem Pflug hinein, wenn sie die Erde in eine Art Schlamm verwandelt haben. Sehr oft sah ich sie wenigstens in solchem Schlamm, aber nie in trockenem Grunde, ausgenommen in den zu trockenem Reis bestimmten Feldern pflügen.
Haben sie den Boden gehörig aufgerissen, so kommt die Egge hinein – ein schwerfälliges Instrument, nicht wie unsere Eggen, sondern nach Art der Cultivatoren gebaut, und nur aus zwei Schenkeln bestehend, die vorn zusammenlaufen und ziemlich einen rechten Winkel bilden. In diesen stecken zehn oder zwölf starke hölzerne und etwas zugespitzte Zähne, und um dem Ganzen noch etwas mehr Schwere zu geben, und die Zähne tiefer in den Schlamm hineinzudrücken, setzt sich der junge Bursch, der die Karbauen gewöhnlich treibt, sehr häufig oben auf seine Egge drauf und läßt sich in dem Brei spazieren fahren.
Was die Saat des Reis anbetrifft, so geschieht die erst in besonders dazu hergerichtetem Feld, wie wir z. B. in Deutschland den Kraut- oder Kohlsamen säen. Er schießt dort dicht, Halm an Halm gedrängt enger und wird nur, sobald er die gehörige Reife erreicht hat, herausgenommen und büschelweis, d. h. immer drei, vier oder fünf Halme zusammen, von Menschenhänden in die nassen, unter Wasser stehenden Felder gepflanzt. Diese Arbeit besorgen fast allein Mädchen, ich habe wenigstens nie Knaben damit beschäftigt gesehen; sie nehmen sich eine tüchtige Hand voll der kleinen Pflanzen und drücken sie einzeln, ohne weiter ein Loch dazu bohren zu müssen, wie das bei den Krautpflanzen in trockenen Feldern der Fall ist, in den weichen Schlamm in ziemlich regelmäßigen Entfernungen und Reihen ein.
Von jetzt ab haben sie weiter nichts mit dem Reis zu thun, bis er reif ist, als einmal vielleicht, nach einigen Wochen durchzugehen und das dazwischen wuchernde Gras und Unkraut auszuziehen. Die Arbeit ist aber in sofern. obgleich nicht sehr hart, doch unangenehm und beschwerlich, da die Pflanzenden den ganzen Tag in dem fast Fuß tiefen Schlamm und in der heißen, durch nichts abgehaltenen Sonnenhitze, gebückt umhersteigen müssen.
Solche frisch angepflanzte Felder mit ihren hellgrünen, fast durchsichtigen Reispflänzchen, haben ein höchst freundliches Ansehen, und wo besonders in den einzelnen Abdachungen ältere und dadurch dunkler gewordenen Gefache, wie man fast sagen könnte, mit diesen abwechseln, thun die verschiedenen oft wie in regelmäßigen Zeichnungen ausgestreuten Farben dem Auge unendlich wohl.
Das Schneiden des Reises bewerkstelligen sie auch auf eine ganz eigene Art; die Frauen, welche diese wieder meist allein besorgen, haben eine besondere Art von Messern oder Instrumenten dazu, womit sie jeden Halm einzeln abknipsen, es geschieht dies aber mit einer solchen Uebung und Gewandtheit, daß sie doch eine sehr bedeutende Strecke in einem Tag beendigen sollen. Die reifen Halmen werden mit dem Stroh etwa fünfviertel Fuß lang abgeschnitten und in kleine starke Büschel gebunden, die sie dann, die Aehren herunterhängend, zu Markte tragen.
Eine Hauptnoth haben die Javanen aber von der Zeit an, wo der Reis zu reifen anfängt und eine wahrhaft unzählbare Schaar von Reisvögeln, seinem grimmigsten Feinde, oder vielmehr liebstem Freunde, herbeilockt. Dann muß die ganze junge Bevölkerung auf die Beine, und von früh bis spät mit allerlei entsetzlichen Lärminstrumenten und Scheuchmaschinen thätig sein.
Eine besondere Art dieser letzteren, die ich vorzüglich auf dem Wege von Batavia nach Buitenzorg sah, besteht darin, daß in gewissen Entfernungen in den Reisfeldern kleine, auf hohen Baumstangen ruhende Hütten oder vielmehr Körbe. mit einem Schutzdach gegen Sonne und Regen errichtet sind, in denen Knaben von sechs bis zehn Jahren auf der Lauer sitzen. Von diesen Körben aus, wo sie jeden Theil der in ihrer nächsten Umgebung liegenden Felder leicht übersehen und überwachen können, gehen aus Cocosnußfasern dünn gedrehte Seite nach den verschiedenen Theilen und stehen dort mit einem aufgesteckten Cocosblatt oder sonst einem vorragenden, leicht beweglichen Gegenstand in Verbindung. Lassen sich nun irgendwo in ihrem Bereich Reisvögel oder sonst dem Getreide nachtheilige Thiere blicken, so ziehen sie nur einfach in etwas raschen Zuckungen an der dort hinausführenden Schnur, und die scheuen Thiere fliehen, sobald sie sich so ganz urplötzlich etwas anscheinend Lebendes in ihrer Nähe bewegen sehen, rasch in’s Weite.
Wo sie diese Hütten nicht haben, laufen die Jungen mit wahrer Todesverachtung den ganzen Tag mit riesigen Schnurren in den Feldern herum, die sie von nur einem etwas gebogenen Bambusstab anfertigen und die ein schmähliches Geräusch machen. Aehnliche Instrumente befestigen sie auch auf hohen Bambusstangen und überlassen den Lärm dem Winde, der sich auch gewöhnlich ein Vergnügen daraus macht, ihnen zu willfahren. Den größten Spektakel aber und einen wahren Heidenlärm, der genau wie das tolle Brüllen eines wildgewordenen Stieres klingt, und den meisten Effekt auf die Reisdiebe hat, weil er nicht in einem fort tönt, sondern nur manchmal in unregelmäßigen Zwischenräumen und wie ihn gerade der Wind faßt, einsetzt, dann aber auch mit einer Kraft, daß ich selber schon zusammengefahren bin, wenn ich mich gerade unter solch einer Reisklapper befand, ohne sie früher beachtet zu haben, macht ein etwas abgeschorenes Cocospalmblatt, das gerade so aufgesteckt wird, daß der Wind schräg in die starren emporrankenden und aneinanderschlagenden Blattabtheilungen oder Zweigblätter hineinweht. Mag er dabei so stark blasen wie er will, er wird nie aus solchem Blatt ein gleichmäßiges Geräusch herausbringen können. Sobald es nur ein klein wenig aus der nöthigen Richtung tritt, muß der tönende Lärm aufhören, der aber augenblicklich und zwar mit voller Stärke wieder einsetzt, sobald es wieder die frühere Stellung annimmt.
Die Reisscheunen sind kleine eigenthümlich geflochtene Gebäude, vielleicht zehn bis zwölf Fuß hoch, acht Fuß lang und sechs bis sieben Fuß breit, nach unten etwas spitz zulaufend und mit hölzernen Füßen, wie ein richtiger Tragkorb. Sie können, wenn sie leer sind, leicht von einem Ort zum andern gewechselt werden und stehen wenn aufgestellt, mit diesen Füßen immer auf untergelegten Steinen. Das Dach ist ebenfalls von Bambusgeflechten und gewöhnlich mit den schwarzen Fasern der Arenpalme gedeckt.
Bei dem Reis darf ich aber auch nicht vergessen, des nützlichsten und von den Eingeborenen ungemein geschätzten Karbau, oder besser Malayisch, Karbo Erwähnung zu thun.
Diese Karbo’s oder Büffel gehören gewissermaßen mit zu einer javanischen Familie, und so sehr der Javane das Schwein, als ein unreines Thier, verabscheut, so zärtlich liebt er den schmierigen, fast stets mit Schlamm bedeckten Karbo, mit dem der Knabe gewissermaßen aufwächst und in die Schule geht. Schon das Aussehen dieser Thiere ist merkwürdig – sie haben fast gar keine Haare und eine Art Elephantenhaut, die nur in der Farbe wechselt, denn manche sind grau wie jene, andere aber auch wieder, und ein fast ebenso großer Theil vollkommen fleischfarben, weshalb sich einige Deutsche hier neulich ein Vergnügen daraus gemacht haben, einem gerade anwesenden Schiffscapitain weiß zu machen, diesen Karbos würde jedes Jahr die Haut abgezogen, weshalb sie auch keine Haare hätten und einen Theil im Jahr noch fleischfarben und den andern dann wieder grau aussähen. „Es ist wunderbar“, war Alles, was er sagen konnte.
Ihre Hörner, die oft eine unverhältnißmäßige Größe erreichen, biegen weder zurück noch vorwärts, sondern stehen in gerader Linie mit dem Vorkopf, so daß man, wenn man ein Lineal fest von der Nase über die Stirn des Thieres weglegt, die nach oben wieder zusammenlaufenden Spitzen der Hörner dadurch ebenfalls berühren würde. Da sie die Nase fast immer vorgestreckt halten, so liegen die Hörner dadurch natürlich vollkommen zurück, und es giebt ihnen das mit den kleinen Schweinsaugen und dem halboffenen Maul ein wirklich rechtswidrig dummes Gesicht.
Die Thiere sind aber gar nicht so dumm und wissen sich wohl recht gut, wenn das nur irgend ausführbar ist, von Arbeit und Quälerei wegzudrücken. Ueber dieselben haben nun gewöhnlich die Knaben die Oberaufsicht und es ist merkwürdig, was für eine gegenseitige Zuneigung zwischen den Beiden aufwächst. So wenig sich der Javane aus einem Pferd macht, und so sorglos und ohne Abwartung er dasselbe, selbst nach starkem Ritt laufen läßt, so äußerst ängstlich geht er dagegen mit diesen plumpen Geschöpfen um, und die Jungen sind ewig beschäftigt, sie in die Schwemme zu führen und abzuwaschen; was nebenbei gesagt, eine so nutzlose als undankbare Arbeit ist, da die Thiere sich kaum rein abgestriegelt und gespült fühlen, als sie auch schon wieder mit einem grenzenlosen Wohlbehagen im Schlamm liegen, und mit ihren schaufelartigen Schnauzen das kühlende, natürlich dickschmutzige Wasser sich über den Rücken werfen.
In dem Schlammwasser aber, wie draußen zur Weide gehend oder zu Hause ziehend, liegt der Knabe, der die Aufsicht über die Thiere hat, mit dem Bauch auf seinem Lieblingsbüffel, streckt die dünnen braunen Beine hinten in die Höh’, und jauchzt vor Lust und Vergnügen. Jemehr verschiedene Gespanne zusammen sind, desto größer ist die Freude, gehen sie dicht gedrängt, so wälzt sich das fröhliche Völkchen oft von einem zum andern, ohne daß sich die geduldigen Thiere auch nur im mindesten ungeberdig darüber zeigten; selbst beim Grasen bleiben sie oben liegen und manchmal sehr zum Aerger eines kleinen, spechtartigen Vogels, den die Balinesen Tjulik nennen (der malayische Name ist mir entfallen) und der sich ebenfalls, wenn der junge Javane einmal absteigen sollte, am liebsten auf dem Rücken des Karbo’s aufhält, und ihm das Ungeziefer absucht, womit Karbo ebenfalls vollkommen einverstanden ist.
Die unbepflanzten Reisfelder sind mit ihrem Schlamm eine wahre Erholung für diese Thiere, so lange sie nämlich nicht darin pflügen und eggen müssen, und sie wälzen sich förmlich ganze Tage lang aus einem in’s andere.





























