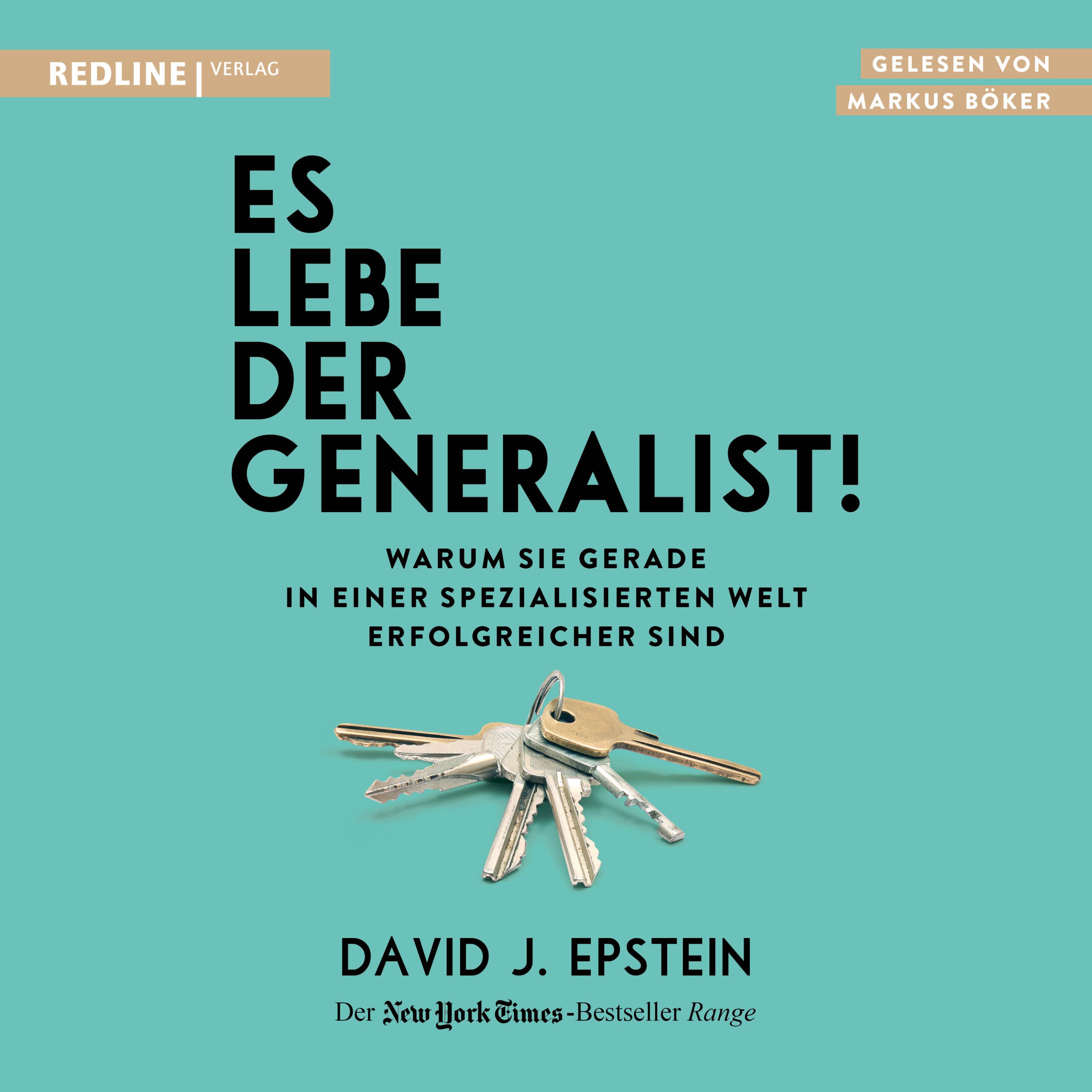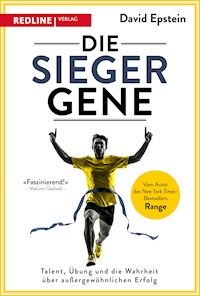21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Spezialisierung sei der Schlüssel zum Erfolg, sagen viele Experten. Um Fähigkeiten, Instrumente oder Themengebiete zu beherrschen, müsse man früh anfangen und lange üben. David J. Epstein analysiert in seinem Bestseller Top-Performer in Wirtschaft und Wissenschaft, Ausnahmekünstler wie Vincent van Gogh und Profisportler wie Roger Federer oder Tiger Woods und belegt: Das ist eher die Ausnahme, denn die Regel! Generalisten legen vielleicht später los, dafür aber meist kreativer, agiler und mit Blick über den Tellerrand. Und haben letztlich Erfolg. Das Buch ist ein eindrucksvolles Plädoyer, wieder mehr Überblick zu wagen – und zu fördern!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
DAVID EPSTEIN
ES LEBE DER GENERALIST!
DAVID J. EPSTEIN
ES LEBE DER GENERALIST!
WARUM GERADE SIE IN EINER SPEZIALISIERTEN WELT ERFOLGREICHER SIND
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
2. Auflage 2022
© 2020 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Türkenstrasse 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe 2019 by David Epstein
Die englische Originalausgabe erschien 2019 bei Riverhead Books, einem Imprint von Penguin Random House LLC unter dem Titel Range.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Almuth Braun
Redaktion: Silvia Kinkel, Königstein
Umschlaggestaltung: Marc Fischer, München
Umschlagabbildung: Shutterstock/ Olga Drabovich/ Bunch of keys isolated over white
Satz: Röser Medienhaus, Karlsruhe
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-86881-774-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-176-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-177-8
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Elizabeth, dieses und alle anderen.
Inhalt
EINFÜHRUNGRoger versus Tiger
KAPITEL 1Der Kult um den frühen Startvorteil
KAPITEL 2Wie die lernunfreundliche Welt entstand
KAPITEL 3Wenn weniger desselben mehr ist
KAPITEL 4Kurzfristiges versus nachhaltiges Lernen
KAPITEL 5Gedankliches Neuland
KAPITEL 6Das Problem mit dem Stehvermögen
KAPITEL 7Der Flirt mit den eigenen verschiedenen Persönlichkeiten
KAPITEL 8Der Außenseiter-Vorteil
KAPITEL 9Laterales Denken unter Einsatz altbewährter Technologien
KAPITEL 10Profundes Fachwissen kann täuschen
KAPITEL 11Wie man lernt, auf vertraute Instrumente zu verzichten
KAPITEL 12Bewusste Amateure
FAZITErweitern Sie Ihren Horizont
Danksagung
Über den Autor
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Er weigerte sich, sich auf irgendetwas zu spezialisieren, und zog es vor, seinen Blick auf das gesamte Gut anstelle irgendeines seiner Teile zu richten … Und Nikolais Verwaltung führte zu den besten Ergebnissen.
Leo Tolstoi, Krieg und Frieden
Kein Instrument kann alles. Es gibt keinen Zentralschlüssel, mit dem man alle Türen öffnen kann.
Arnold Toynbee, A Study of History
EINFÜHRUNG
Roger versus Tiger
Wir wollen mit einigen Geschichten aus dem Sport beginnen. Die erste kennen Sie wahrscheinlich.
Der Vater wusste, dass sein Sohn irgendwie anders war als andere Kinder. Mit kaum sechs Monaten konnte der Junge bereits auf der Handfläche seines Vaters balancieren, während dieser durchs Haus spazierte.1 Mit sieben Monaten gab ihm sein Vater einen Putter zum Spielen, und der Junge schleifte ihn in seinem kleinen runden Laufstall überall mit sich herum. Mit zehn Monaten kletterte er von seinem Kinderhochstuhl herunter, zockelte auf den Golfschläger zu, der auf seine Größe abgesägt worden war, und ahmte den Golfschwung seines Vaters nach, den er in der Garage beobachtet hatte. Weil der Vater noch nicht mit seinem Sohn reden konnte, malte er Bilder, um ihm zu zeigen, wie er den Schläger in der Hand halten musste. »Es ist sehr schwer zu vermitteln, wie man puttet, wenn ein Kind noch nicht sprechen kann«, merkte er später an.2
Mit zwei Jahren, ein Alter, in dem ein Kind laut den amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention wichtige Meilensteine für die körperliche Entwicklung erreicht haben sollte, wie zum Beispiel »tritt einen Ball« und »steht auf den Zehenspitzen«, war er bereits im nationalen Fernsehen zu sehen und schlug mit einem Golfschläger, der so groß war, dass er ihm bis zur Schulter reichte, einen Golfball an dem bass erstaunten Komiker Bob Hope vorbei.3 Im selben Jahr nahm er an seinem ersten Turnier teil und gewann in der Liga der unter Zehnjährigen.
Es gab keine Zeit zu verschwenden. Mit drei lernte der Junge, wie man einen Ball aus einem Sandhindernis schlägt, und sein Vater begann sich Gedanken über seine Berufung im Leben zu machen. Er wusste, dass sein Sohn für den Golfsport auserwählt und es seine väterliche Pflicht war, ihn anzuleiten und ihm Orientierung zu bieten. Man denke einmal darüber nach: Wenn Sie sich über den zukünftigen Pfad Ihres Kindes vollkommen gewiss wären, würden Sie Ihr dreijähriges Kind vielleicht auch auf den richtigen Umgang mit der unvermeidlichen und unersättlichen Medienaufmerksamkeit vorbereiten. Er fragte seinen kleinen Sohn aus, spielte den Reporter und lehrte ihn, kurze, knappe Antworten zu geben und sich exakt auf die Beantwortung der Frage zu beschränken. In jenem Jahr spielte er einen 9-Loch-Golfplatz in Kalifornien mit 48 Schlägen, elf über Par.
Mit vier Jahren lieferte ihn sein Vater um neun Uhr morgens auf dem Golfplatz ab und holte ihn acht Stunden später wieder ab, gelegentlich mit dem Geld, das er bei Wetten gegen Leute, die an den Ausnahmefähigkeiten seines Sohns zweifelten, gewonnen hatte.
Mit acht schlug der Sohn seinen Vater zum ersten Mal. Diesem machte es nichts aus, weil er davon überzeugt war, dass sein Sohn eine einzigartige Begabung besaß und er als Vater auf einzigartige Weise in der Lage war, ihn zu unterstützen. Er war selbst ein hervorragender Sportler gewesen, und das trotz extrem widriger Umstände. Im College war er der einzige schwarze Baseballspieler der gesamten Liga gewesen. Als Soziologe, der als Mitglied der militärischen Eliteeinheit Green Berets im Vietnamkrieg gekämpft hatte, besaß er eine gute Menschenkenntnis und wusste, was Disziplin bedeutete. Später unterwies er angehende Offiziere in psychologischer Kriegsführung.4 Er wusste, dass er für seine drei Kinder aus erster Ehe kein besonders guter Vater gewesen war, aber nun fühlte er, dass er eine zweite Chance erhalten hatte, es mit seinem vierten Kind besser zu machen. Und tatsächlich verlief alles nach Plan.
Als sein Sohn an die Stanford University ging, war er bereits berühmt und sein Vater prophezeite ihm eine große Zukunft. Sein Sohn werde mehr Einfluss gewinnen als Nelson Mandela, Gandhi und Buddha, versicherte er. »Er hat ein größeres Forum als jeder Einzelne von ihnen«, sagte er. »Er ist die Brücke zwischen Ost und West. Alles ist möglich, denn er wird vom Schicksal gelenkt. Ich weiß nicht genau, welche Form seine Zukunft annehmen wird, aber ich weiß, dass er auserwählt ist.«5
Die zweite Geschichte kennen Sie wahrscheinlich auch, wenngleich Sie sie vielleicht nicht auf Anhieb wiedererkennen.
Seine Mutter war selbst Tennislehrerin, aber sie trainierte ihn nie. Als er das Gehen lernte, kickte er mit seiner Mutter Bälle. Als Junge spielte er sonntags mit seinem Vater Squash. Er probierte sich im Skifahren, Wrestling, Schwimmen und Skateboarden. Außerdem spielte er Basketball, Handball, Tennis, Tischtennis, Badminton über den nachbarlichen Zaun und Fußball in der Schule. Später sagte er, die vielen verschiedenen Sportarten, die er in seiner Jugend praktiziert hatte, hätten ihm bei seiner sportlichen Entwicklung und der Auge-Hand-Koordination geholfen.
Ihm war es egal, welche Sportart er betrieb, solange daran ein Ball beteiligt war. »Ich hatte immer ein wesentlich größeres Interesse an einer Sportart, wenn sie mit einem Ball zu tun hatte«, erinnerte er sich. Als Kind war er sehr verspielt. Seine Eltern hegten für ihren Sohn keine besonderen sportlichen Ambitionen. »Wir hatten weder einen Plan A noch einen Plan B«, sagte seine Mutter später.6 Sie und der Vater des Kindes ermutigten ihn dazu, viele verschiedene Sportarten auszuprobieren. Sport war für ihn unverzichtbar. Wenn er länger stillsitzen sollte, wurde er »unerträglich«, so seine Mutter.
Zwar arbeitete sie als Tennistrainerin, aber sie wollte nicht mit ihm arbeiten. »Er hätte mich auf die Palme gebracht«, sagte sie. »Er probierte jede noch so merkwürdige Schlagführung aus; jedenfalls retournierte er den Ball nie auf normale Weise. Für eine Mutter ist das einfach kein Spaß.«7 Wie ein Reporter des Sportmagazins Sports Illustrated bemerkte, waren seine Eltern alles andere als fordernd und drängten ihn zu nichts, sondern ließen ihn gewähren. Als der Junge in die Pubertät kam, tendierte er stärker zu Tennis und »wenn sie ihn überhaupt ermahnten, dann nur, um ihn daran zu erinnern, dass er aufhören solle, Tennis so todernst zu nehmen«. Wenn er ein Match spielte, ging seine Mutter oft weg, um sich mit Freundinnen zu unterhalten, und sein Vater gab ihm nur eine Regel mit auf den Weg: »Schummle nicht.«8 Daran hielt sich der Junge und wurde allmählich richtig gut.
Als Jugendlicher spielte er so gut, dass eine örtliche Zeitung ein Interview mit ihm führte. Seine Mutter war bestürzt, als sie in dem Artikel seine Antwort auf die Frage las, was er mit seinem hypothetischen ersten Einkommen aus dem Tennissport kaufen würde: »Mercedes.« Und sie war erleichtert, als der Reporter ihr die Aufnahme des Interviews vorspielte und sie merkten, dass er sich verhört hatte – ihr Sohn hatte auf Schweizerdeutsch geantwortet: »Mehr CDs.«
Zweifellos war der Junge ehrgeizig. Doch als seine Tennistrainer beschlossen, ihn in eine Gruppe mit älteren Spielern zu stecken, bat er sie, zu seiner alten Gruppe zurückkehren zu dürfen, denn er wollte bei seinen Freunden bleiben. Immerhin war ein Teil des Spaßes die Zeit, die sie nach den Trainerstunden zusammen verbrachten, und ihre Gespräche über Musik, Wrestling und Fußball.
Als er die anderen Sportarten – vor allem Fußball – schließlich aufgab, um sich ganz auf den Tennissport zu konzentrieren, arbeiteten die anderen Nachwuchsspieler längst mit Krafttrainern, Sportpsychologen und Ernährungswissenschaftlern. Langfristig schien das jedoch kein Handicap für seine sportliche Entwicklung zu sein. Mit Mitte dreißig, einem Alter, in dem sich selbst legendäre Tennis-Asse üblicherweise aus dem aktiven Sport zurückziehen, war er immer noch Weltranglistenbester.
Im Jahr 2006 trafen sich Tiger Woods und Roger Federer zum ersten Mal. Beide befanden sich auf dem Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Tiger flog mit seinem Privatjet, um sich das Finale der U.S. Open anzusehen. Das machte Federer zwar besonders nervös, aber er gewann, und zwar zum dritten Mal in Folge. Woods traf sich mit ihm in der Umkleidekabine, um mit Champagner auf den Sieg anzustoßen. Sie hatten sofort einen Draht zueinander. »Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen, der das Gefühl, unschlagbar zu sein, so gut nachempfinden konnte«, beschrieb Federer ihre Begegnung später. Sie wurden nicht nur schnell Freunde, sondern auch zum Mittelpunkt der öffentlichen Debatte über die Frage, wer der beste Athlet der Welt sei.
Federer entging jedoch nicht die Gegensätzlichkeit zwischen ihm und Tiger. »Seine Geschichte ist vollkommen anders als meine«, erzählte er seinem Biographen im Jahr 2006. »Schon als Kind war es sein Ziel, den Rekord an Major-Siegen zu brechen. Ich träumte nur davon, eines Tages Boris Becker zu treffen oder irgendwann bei Wimbledon mitspielen zu können.«9
Für ein Kind, dessen Eltern kein großes Interesse an seiner sportlichen Entwicklung hatten, und das den Sport zunächst nicht besonders ernst nahm, ist es sehr ungewöhnlich, dass es sich zu einem der weltweit erfolgreichsten Athleten entwickelte. Anders als im Fall von Tiger Woods gab es Tausende von Kindern, die wesentlich bessere Ausgangsbedingungen hatten als Roger. Die unglaubliche Erziehung und Förderung, die Tiger als Kind zuteilwurde, ist das zentrale Thema zahlreicher Bestseller über die Entwicklung und Förderung von Spitzenleistungen, zu der auch ein Erziehungsratgeber aus der Feder von Tigers Vater Earl gehört. Tiger spielte nicht einfach Golf, er pflegte die »reflektierte Praxis« – die einzige Methode, die die inzwischen allgegenwärtige Zehntausend-Stunden-Regel für Spitzenleistung gelten lässt. Diese »Regel« steht für die Vorstellung, das alles entscheidende Merkmal der Kompetenzentwicklung, unabhängig vom jeweiligen Gebiet, sei die Zahl an fokussierten Übungsstunden. Laut einer Untersuchung über dreißig Violinisten, aus der diese Regel hervorging, besteht die reflektierte Praxis darin, dass Lernende »explizite Anweisungen über die beste Methode erhalten«, individuell von einem Lehrer oder Trainer betreut werden, »umgehendes informatives Feedback und Auskunft über die Ergebnisse ihrer Leistung erhalten« und »wiederholt dieselben oder ähnliche Aufgaben ausführen«.10 Eine Vielzahl von Büchern über das Thema, wie man Spitzenleistungen erzielt, zeigen, dass Elite-Athleten pro Woche mehr Zeit auf eine technisch ausgefeilte reflektierte Praxis verwenden als Sportler, deren Leistungsplateau bereits auf einer niedrigeren Ebene erreicht ist:
Tiger Woods ist zur Verkörperung des Dogmas geworden, erfolgsbestimmend sei die Zahl der Stunden, die auf eine reflektierte Praxis verwendet wird, und damit einhergehend der Vorstellung, Nachwuchstalente müssten möglichst früh mit der reflektierten Praxis beginnen.
Der Druck auf eine frühe, laserartige Fokussierung reicht weit über den Sport hinaus. Oft heißt es, je wettbewerbsintensiver und komplizierter die Welt werde, desto stärker müssten wir uns spezialisieren (und desto früher müssten wir mit der Spezialisierung beginnen), um uns erfolgreich im Leben behaupten zu können. Die prominentesten Protagonisten des Erfolgs werden für ihre Frühreife und Wunderkind-Merkmale gefeiert – Mozart am Klavier, Mark Zuckerberg an einer Tastatur ganz anderer Art. Egal um welches Gebiet es sich handelt, stets fand als Reaktion auf das ständig anwachsende menschliche Wissen und die immer enger vernetzte Welt eine Überbetonung der Fokussierung statt. Onkologen sind nicht mehr länger auf Tumore spezialisiert, sondern auf eine besondere Ausprägung, die ein bestimmtes Organ befällt, und dieser Trend verstärkt sich mit jedem Jahr. Der amerikanische Chirurg Atul Gawande merkte an, Ärzte würden über »Otologen für das linke Ohr« scherzen, allerdings mit dem Vorbehalt, »wir müssen aufpassen, was wir sagen. Am Ende gibt es sie vielleicht wirklich«.11
In dem Bestseller Bounce, der auf der Zehntausend-Stunden-Regel aufbaut, vertritt der britische Journalist Matthew Syed die Auffassung, die britische Regierung sei so schlecht, weil sich ihre Mitglieder anders als Tiger Woods nicht auf bestimmte Fachgebiete spezialisiert hätten. Die Rotation von Ministern zwischen verschiedenen Ressorts sei »nicht weniger absurd, als wenn Tiger Woods vom Golfsport nacheinander zu Baseball, Football und Hockey wechseln würde«.12
Nach Jahrzehnten im sportlichen Mittelfeld erzielte Großbritannien allerdings mithilfe von Programmen zur sportlichen Entwicklung erwachsener Athleten, die zunächst an verschiedene Sportarten herangeführt werden, und der Schaffung eines Pools an athletischen Spätzündern – sogenannte Slow Baker, wie einer der maßgeblichen Manager des Programms sie mir gegenüber bezeichnete – große Erfolge bei der jüngsten Sommerolympiade.13 Offenbar ist die Idee, Athleten zu Spitzensportlern zu entwickeln, indem sie wie Roger als Generalisten beginnen und zunächst verschiedene Sportarten ausprobieren, gar nicht so falsch. Spitzensportler, die sich auf dem Höhepunkt ihrer Leistungsfähigkeit befinden, verbringen mehr Zeit mit fokussierter reflektierter Praxis als ihre Beinahe-Spitzensportler-Kollegen. Bei einer wissenschaftlichen Untersuchung des Entwicklungspfads von Athleten, von ihrer frühen Kindheit bis zum Erreichen der Leistungsspitze, hat sich jedoch folgendes Bild ergeben:
Spätere Spitzensportler haben in jungen Jahren in der Disziplin, in der sie schließlich Spitzenleistungen erbringen, eher weniger Zeit mit reflektierter Praxis verbracht; vielmehr durchliefen sie zunächst eine »Phase des Ausprobierens«. In jungen Jahren praktizieren sie verschiedene Sportarten, und das üblicherweise in einer unstrukturierten oder nur gering strukturierten Umgebung. Dabei erwerben sie vielseitige körperliche Fertigkeiten, auf die sie sich später stützen können. Außerdem lernen sie dabei ihre eigenen Fähigkeiten und Neigungen kennen. Erst in einem späteren Alter beginnen sie, sich auf eine Disziplin zu konzentrieren und die technische Praxis zu intensivieren.14 In dem Titel einer Studie über Individualsportler wurde die »späte Spezialisierung« als »Schlüssel zum Erfolg« bezeichnet; eine andere Studie titelte »So wird man zum Spitzensportler in Teamsportarten: spät beginnen, intensiv trainieren und zielstrebig sein.«
Als ich begann, über diese Untersuchungen zu schreiben, stieß ich sowohl auf differenzierte Kritik als auch auf pauschale Ablehnung. »Das gilt vielleicht für andere Sportarten«, sagten Fans oft, »aber nicht für unseren Sport.« Der vehementeste Protest kam aus der Gemeinde des beliebtesten Sports weltweit, dem Fußball. Aber dann veröffentlichte ein Team aus deutschen Wissenschaftlern Ende 2014 wie auf Zuruf eine Studie, die belegte, dass die Mitglieder der deutschen Nationalelf, die kurz zuvor die Weltmeisterschaft gewonnen hatte, üblicherweise Sportler waren, die sich erst spät spezialisiert hatten und bis zum Alter von 21 Jahren oder älter lediglich in einer Amateurliga gespielt hatten. In ihrer Kindheit und Jugend hatten sie nur Freizeitfußball gespielt und auch andere Sportarten betrieben. Eine weitere Untersuchung über den professionellen Fußballsport, die zwei Jahre später veröffentlicht wurde, verfolgte über zwei Jahre die sportliche Entwicklung von Nachwuchsspielern im Alter von elf Jahren. Diejenigen, die mehrere Sportarten betrieben und nur Freizeitfußball spielten, hatten in den zwei Jahren größere Verbesserungen erzielt als die Spieler der Vergleichsgruppe. Inzwischen werden in den unterschiedlichsten sportlichen Disziplinen, von Hockey bis Volleyball, ähnliche Ergebnisse berichtet.
Die angebliche Notwendigkeit einer frühen Hyperspezialisierung bildet den Kern einer gewaltigen, erfolgreichen und gelegentlich gut gemeinten Marketingmaschinerie – im Sport, aber auch in anderen Bereichen. In Wahrheit gibt es weitaus mehr Spitzensportler, die als Generalisten begonnen haben, als hochfokussierte Wunderkinder. Im Allgemeinen sind Erstere aber nicht so öffentlichkeitswirksam – wenn sie denn jemals bekannt werden. Einige große Namen kennen Sie wahrscheinlich, nur ihr Werdegang ist unbekannt.
Mit der Einführung zu diesem Buch habe ich gleich nach dem Super Bowl von 2018 begonnen, in dem sich ein berühmter Quarterback, der vor seiner Karriere als Footballprofi als Catcher Baseball gespielt hatte (Tom Brady), ein spannendes Duell mit dem Quarterback der Gegenmannschaft lieferte, der in seiner Jugend Football, Basketball, Baseball und Karate praktiziert und sich erst auf dem College zwischen Basketball und Football entschieden hatte (Nick Foles). Zu einem späteren Zeitpunkt desselben Monats holte die tschechische Athletin Ester Ledecká als erste Frau bei einer Winterolympiade Gold in zwei verschiedenen Disziplinen (Ski und Snowboarding). In jüngeren Jahren hatte Ledecká viele verschiedene Sportarten ausgeübt (sie spielt immer noch Beachvolleyball und frönt dem Windsurfen), sich aber vorrangig auf die Schule konzentriert und hatte es auch nicht eilig, Jugendturniere zu gewinnen. In einem Artikel, der am Tag nach ihrem sensationellen doppelten Goldmedaillengewinn erschien, schrieb die Washington Post: »In einem Zeitalter der sportlichen Spezialisierung ist Ledecká eine leidenschaftliche Verfechterin der Vielfalt.«15 Kurz nach ihrer großartigen Leistung holte sich der ukrainische Boxer Wassyl Lomatschenko in drei verschiedenen Gewichtsklassen den Weltmeistertitel, und das schneller als jeder andere Boxer. Lomatschenko, der als Jugendlicher vier Jahre das Boxtraining unterbrochen hatte, um traditionelle ukrainische Tänze zu erlernen, sagte: »Als Junge habe ich ganz viel und ganz unterschiedlichen Sport gemacht – Gymnastik, Basketball, Football, Tennis – und ich glaube, letztlich haben all diese unterschiedlichen Sportarten dazu beigetragen, meine Fußarbeit zu verbessern.«16
Der prominente Sportwissenschaftler Ross Tucker fasst die Forschung auf diesem Gebiet in einem Satz zusammen: »Der Schlüssel liegt in der Vielfalt und im Ausprobieren.«
Im Jahr 2014 nahm ich einige der Feststellungen über eine späte Spezialisierung im Sport in das Nachwort meines ersten Buches mit dem Titel The Sports Gene auf. Im darauffolgenden Jahr erhielt ich eine Einladung, um vor einem ungewöhnlichen Publikum über die Ergebnisse dieser Forschung zu referieren – keine Athleten oder Trainer, sondern Militärveteranen. Bei meiner Vorbereitung stöberte ich in wissenschaftlichen Fachzeitschriften nach Beiträgen über eine frühe Spezialisierung und berufliche Umwege außerhalb der Sportwelt. Was ich dabei entdeckte, verblüffte mich. Eine Untersuchung hatte ergeben, dass Menschen, die sich zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn bereits spezialisiert hatten, nach dem College zunächst mehr verdienten als andere, die sich erst später spezialisierten. Dieser vermeintliche Startvorteil wurde jedoch dadurch wettgemacht, dass die Spätentwickler Arbeit fanden, die besser zu ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit passte. Ich stieß auf Unmengen von Studien, die zeigten, dass technische Erfinder ihre kreativen Leistungen steigern konnten, indem sie, anders als andere Kollegen, die sich schon früh voll und ganz in ein Thema vertieften, zuerst auf verschiedenen Gebieten Erfahrung sammelten. Tatsächlich profitierten die besten kreativen Köpfe im Verlauf ihrer Karriere davon, dass sie aus eigener Initiative ein wenig Profundität für eine größere Wissensbreite geopfert hatten. Eine Studie über kreative Schöpfer kam zu fast identischen Ergebnissen.
Allmählich wurde mir klar, dass der Werdegang einiger Menschen, deren künstlerisches Werk ich aus der Ferne tief bewunderte – von Duke Ellington (der als Kind den Musikunterricht schwänzte, um sich auf Baseball und Zeichnen zu konzentrieren) bis zu Maryam Mirzakhani (die davon träumte, Romanautorin zu werden und stattdessen die erste Frau wurde, der die Fields Medal, die berühmteste Auszeichnung auf dem Gebiet der Mathematik, verliehen wurde) –, eher dem Karrierepfad des Generalisten Roger Federer ähnelte als der Wunderkind-Entwicklung eines Tiger Woods. Bei meinen weiteren Recherchen stieß ich auf bemerkenswerte Personen, die nicht trotz ihrer breiten Erfahrung und ihrer breitgefächerten Interessen erfolgreich waren, sondern genau deswegen: Ein weiblicher CEO, die ihre erste Führungsposition in einem Alter antrat, in dem andere sich in den Ruhestand verabschieden; ein Künstler, der fünf verschiedene Berufe ausübte, bevor er seine Berufung fand und die Welt veränderte, und ein Erfinder, der mit seiner selbstfabrizierten Antispezialisierungsphilosophie aus einem kleinen Betrieb aus dem 19. Jahrhundert einen der berühmtesten Markennamen der heutigen Zeit machte.
Da ich gerade erst angefangen hatte, mich mit der Forschung über Spezialisierung in der breiten Arbeitswelt zu beschäftigen, beschränkte ich mich in meinem Vortrag vor den Militärveteranen auf den Sport. Wenngleich ich die anderen Ergebnisse nur am Rande streifte, sprang mein Publikum sofort darauf an. Es waren alles Menschen, die sich spät spezialisiert oder die Laufbahn gewechselt hatten. Im Anschluss an den Vortrag kam einer nach dem anderen auf mich zu, um sich vorzustellen, und dabei stellte ich fest, dass viele zumindest ein wenig besorgt über ihren beruflichen Lebensweg waren und einige sich beinahe sogar schämten.
Sie waren von der Pat Tillman Foundation eingeladen worden, die im Geiste des gleichnamigen verstorbenen Footballspielers der NFL, der den Profi-Football-Sport verlassen hatte, um Army Ranger zu werden, Stipendien an Veteranen, aktive Soldaten und ihre Ehefrauen vergibt, die sich beruflich neu orientieren oder noch einmal die Schulbank drücken. In diesem Fall waren alle Stipendiaten ehemalige Fallschirmjäger und Übersetzer, die eine zweite Karriere als Lehrer, Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmer anstrebten. Zwar barsten sie vor Enthusiasmus, unterschwellig war aber eine gewisse Angst zu spüren, weil ihre LinkedIn-Profile keinen linearen Karriereverlauf widerspiegelten, den, wie man ihnen eingebläut hatte, Arbeitgeber sehen wollen. Sie waren nervös und angespannt, denn sie saßen im Hörsaal neben jüngeren (manchmal sogar viel jüngeren) Studenten beziehungsweise nahmen in einem Alter, in dem andere längst fest im Sattel sitzen, einen Berufswechsel vor, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigt gewesen waren, eine unvergleichliche Lebens- und Führungserfahrung zu erwerben. Irgendwie war aus einem einzigartigen Vorteil in ihrer Wahrnehmung ein Nachteil geworden.
Einige Tage nach meinem Vortrag bei der Tillman Foundation schrieb mir ein ehemaliger Angehöriger der Navy SEAL, einer Spezialeinheit der US Navy, der direkt im Anschluss an den Vortrag auf mich zugekommen war, eine E-Mail mit folgendem Inhalt: »Wir sind alle dabei, unseren Beruf zu wechseln. Mehrere von uns sind nach Ihrem Vortrag zusammengekommen und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie erleichtert wir über Ihre Worte waren.«a
Ich war ein wenig amüsiert, dass ein ehemaliger Angehöriger der Navy SEAL mit einem Bachelor-Abschluss in Geschichte und Geophysik, der nun einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft und Verwaltung in Dartmouth und Harvard anstrebte, meine Bestätigung für seine Lebensentscheidungen brauchte. Wie allen anderen in dem Vortragssaal hatte man auch ihm implizit und explizit zu verstehen gegeben, dass es gefährlich sei, mitten im Rennen die Pferde zu wechseln. Mein Vortrag war auf eine solche Begeisterung gestoßen, dass die Stiftung mich einlud, auf der Jahreskonferenz von 2016 einen Keynote-Vortrag zu halten und dann vor kleinen Gruppen in verschiedenen Städten zu sprechen. Vor jedem Vortrag las ich weitere Studien, sprach mit weiteren Forschern und fand weitere Belege dafür, dass der Erwerb breitgefächerter Kompetenzen und Erfahrung, beruflich wie privat, eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt – was oft zu Lasten eines frühen beruflichen Erfolgs geht –, aber dass sich diese Umwege durchaus lohnen.
Ich vertiefte mich in Untersuchungen, die zeigten, dass hoch qualifizierte Experten einen derartigen Tunnelblick entwickeln können, dass sie mit zunehmender Erfahrung sogar schlechter werden, allerdings bei gleichzeitig steigendem Selbstvertrauen. Das ist eine gefährliche Kombination. Und ich war tief beeindruckt, als kognitive Psychologen mich in unseren Gesprächen an eine überwältigende Fülle von oft ignorierter Literatur heranführten, die belegt, dass ein Mensch die größten nachhaltigen Lernerfolge erzielt, wenn das Lernen in langsamen Schritten erfolgt, damit sich das Wissen setzen und langfristig abgerufen werden kann – selbst wenn es bedeutet, dass die Lernenden in kurzfristigen Lernkontrollen schlecht abschneiden. Soll heißen, die effektivste Art zu lernen ist die, die auf den ersten Blick am ineffektivsten wirkt und den Eindruck vermittelt, der Lernende bleibe hinter anderen zurück.
Eine berufliche Neuorientierung in der mittleren Lebensphase kann auf den ersten Blick ähnlich verlaufen. Von Mark Zuckerberg stammt der berühmte Satz: »Junge Menschen sind einfach intelligenter.«17 Allerdings sind die Erfolgsaussichten eines Menschen, der mit Mitte fünfzig ein Technologieunternehmen gründet, fast doppelt so hoch wie die eines 20-jährigen Unternehmensgründers. Forscher von der Northwestern University, dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der US-Statistikbehörde U.S. Census Bureau untersuchten Technologie-Startups und stellten fest, dass die wachstumsstärksten Unternehmen von Leuten gegründet worden waren, die zum Zeitpunkt der Gründung 45 Jahre alt waren.
Zuckerberg war 22 Jahre alt, als er seinen berühmten Satz vom Stapel ließ. Er hatte natürlich ein Interesse daran, diese Botschaft zu vermitteln, so wie die Manager von Jugend-Sportligen ein Interesse an der Behauptung haben, die frühzeitige laserartige Konzentration auf eine bestimmte Sportart sei eine notwendige Voraussetzung für den Erfolg, auch wenn es Belege dafür gibt, dass das Gegenteil der Fall ist. Der Antrieb zur Spezialisierung reicht aber noch weiter; er steckt nicht nur einzelne Menschen an, sondern bestimmt ganze Systeme, mit der Folge, dass sich diese in siloartige Gruppen aus hochspezialisierten Scheuklappenträgern fragmentieren, die nur noch immer kleinere Ausschnitte des Gesamtbilds erkennen.
Eine Offenbarung im Anschluss an die globale Finanzkrise von 2008 war das Ausmaß der fachlichen Segregation innerhalb von Großbanken. Legionen an hoch spezialisierten Finanzexperten, die sich scheuklappenartig einzig auf die Optimierung der Risiken ihres eigenen winzigen Mosaiksteinchens aus dem Gesamtbild konzentrierten, erzeugten schließlich den Beinahe-Kollaps des gesamten Systems. Verschlimmert wurde das Ganze durch die Reaktionen auf die Krise, die ein schwindelerregendes Ausmaß an spezialisierungsinduzierter Perversität offenbarten. Ein US-Programm, das im Jahr 2009 eingeführt wurde, bot den Banken einen Anreiz, die monatlichen Hypothekenzahlungen überschuldeter Hausbesitzer zu senken, die aber noch in der Lage waren, Teilzahlungen zu leisten. Eine nette Idee, in der Praxis funktionierte sie jedoch folgendermaßen: Die Hypothekenabteilung der Bank senkte die monatlichen Hypothekenraten; der Abteilung für Zwangsversteigerungen fiel auf, dass der Hausbesitzer plötzlich nur noch Teilzahlungen leistete. Daraufhin stellte sie den Zahlungsausfall fest und beschlagnahmte die Immobilie. »Niemand hatte sich vorstellen können, dass innerhalb der Banken eine derartige Silostruktur herrschte«, sagte ein Regierungsberater später.18 Eine Überspezialisierung kann zu einer kollektiven Tragödie führen, selbst wenn sich jedes Individuum für sich genommen durchaus verantwortlich und vernünftig verhält.
Hochspezialisierte Ärzte haben ihre eigene Version des Leitsatzes entwickelt: »Wenn das einzige Werkzeug, das man zur Verfügung hat, ein Hammer ist, sieht alles aus wie ein Nagel.« Kardiologen haben sich so sehr daran gewöhnt, bei jeder Form von Brustschmerzen Stents einzusetzen – das sind kleine Metallröhrchen, die vor allem in verkalkte Adern eingesetzt werden und diese erweitern, um den Blutfluss zu verbessern –, dass sie das schon reflexartig machen, und zwar selbst in Fällen, in denen umfangreiche Studien zu dem Ergebnis gekommen sind, dass sie entweder wirkungslos oder sogar schädlich sind. Eine Studie aus jüngster Zeit ergab, dass die Sterbequote von Herzpatienten niedriger ausfiel, wenn diese während eines Kardiologenkongresses ins Krankenhaus eingeliefert wurden, als alle Herzspezialisten außer Haus waren. Die Forscher stellten die Vermutung an, das könne daran liegen, dass in dieser Zeit seltener Standardtherapien mit zweifelhafter Wirkung angewendet würden.19
Ein international angesehener Wissenschaftler (den Sie am Ende des Buches kennenlernen werden), sagte mir, die zunehmende Spezialisierung habe in dem Drang zur Innovation ein »System aus parallel verlaufenden Gräben« geschaffen. Alle buddeln immer tiefer in ihrem eigenen Graben, richten sich aber selten auf, um über ihren aufgeworfenen Erdwall in den Nachbargraben zu blicken, selbst wenn die Lösung zu ihrem Problem dort zu finden ist. Besagter Wissenschaftler hat es sich zum Ziel gemacht, zu versuchen, die Ausbildung angehender Forscher zu entspezialisieren. Er hofft, dass sich diese Strategie irgendwann auf alle Gebiete ausbreitet. In seinem eigenen Leben hat er enorm von einer breiten Wissens- und Kompetenzentwicklung profitiert, obwohl auch er unter dem Druck der Spezialisierung stand. Inzwischen erweitert er seinen Wirkungsbereich und seinen Horizont erneut und entwirft ein Ausbildungsprogramm, in dem Versuch, anderen eine Chance zu geben, den Pfad der frühzeitigen einseitigen Spezialisierung zu verlassen. »Das ist womöglich das Wichtigste, was ich im Leben tun werde«, sagte er mir.
Ich hoffe, dass dieses Buch dazu beiträgt, die Gründe zu verstehen. Als die Stipendiaten der Tillman Foundation sagten, sie fühlten sich irgendwie haltlos und fürchteten, einen Fehler zu machen, verstand ich das besser, als ich zu erkennen gab. Nach dem College arbeitete ich auf einem Forschungsschiff im Pazifik, als ich beschloss, dass ich Autor und kein Wissenschaftler sein wollte. Ich hätte jedoch nie erwartet, dass mein Weg von der Wissenschaft zum Schreiben über den Umweg der Berichterstattung über nächtliche Gewalttaten für ein New Yorker Boulevardblatt führen würde, oder dass ich kurz darauf Senior Writer bei Sports Illustrated werden würde – ein Job, den ich zu meiner eigenen Überraschung kurz darauf wieder an den Nagel hängte. Ich begann mir Sorgen darüber zu machen, dass ich womöglich ein Jobhopper war, der sich nie festlegen konnte und es nirgendwo länger aushielt und diese ganze Karrieresache irgendwie vollkommen falsch anging. Die Beschäftigung mit den Vorteilen einer breiten Wissens- und Kompetenzbasis, umfangreicher Erfahrung und einer späten Spezialisierung haben jedoch die Art und Weise verändert, wie ich mich selbst und die Welt um mich herum erlebe. Die Erkundung der eigenen Fähigkeiten und Neigungen erstreckt sich über alle Lebensphasen, von der kindlichen Entwicklung in Mathematik, Musik und Sport, über frisch gebackene Uniabsolventen, die versuchen, sich einen Karrierepfad zu eröffnen, bis zu erfolgreichen Erwerbstätigen im mittleren Alter, die etwas ganz Neues anfangen wollen, und angehenden Ruheständlern, die eine neue sinnstiftende Aufgabe suchen.
Die Herausforderung, mit der wir alle konfrontiert sind, besteht darin, die Vorteile einer breiten Grundlage, vielfältiger praktischer Erfahrung, des interdisziplinären Denkens und einer späten Fokussierung in einer Welt zu wahren, die zunehmend zur Hyperspezialisierung aufruft und diese sogar einfordert. Zwar gibt es angesichts der steigenden Komplexität – hervorgerufen durch die technologisch bedingte immer engere Vernetzung von ganzen Systemen, von denen das Individuum nur noch minimale Ausschnitte sieht – zweifellos Gebiete, die Individuen mit Tiger Woods’ frühkindlicher Begabung und Zielstrebigkeit erfordern, aber wir brauchen auch mehr Menschen vom Typ Roger Federer: Menschen, die sich auf ihrem Weg zunächst breite Grundlagen schaffen und unterschiedlichste Erfahrungen und Perspektiven sammeln – kurzum: Menschen mit einem breiten Horizont.
KAPITEL 1
Der Kult um den frühen Startvorteil
Ein Jahr und vier Tage, nachdem der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands geendet hatte, wurde Lászlo Pólgar in einer ungarischen Kleinstadt geboren. Er hatte weder Großeltern noch Cousins oder Cousinen; alle waren dem Holocaust zum Opfer gefallen, ebenso wie die erste Frau seines Vaters und ihre fünf Kinder. Lászlo wuchs in der wilden Entschlossenheit auf, eine Familie zu gründen, und zwar eine ganz besondere.
Auf dem College bereitete er sich auf seine Vaterschaft vor, indem er die Biografien legendärer Genies von Sokrates bis Einstein studierte. Lászlo gelangte zu der Überzeugung, dass die traditionelle Bildung und Erziehung ausgedient hatte und dass er seine eigenen Kinder zu Genies machen konnte, wenn er ihnen nur die richtigen Startbedingungen bot. Damit schickte er sich an, etwas noch viel Bedeutenderes zu demonstrieren, nämlich dass jedes Kind es in jeder Disziplin zur Meisterschaft bringen kann. Jetzt brauchte er nur noch eine Frau, die ihn bei der Umsetzung dieses Plans unterstützen würde.20
Lászlos Mutter hatte eine Freundin, die wiederum eine Tochter namens Klara hatte. Im Jahr 1965 reiste Klara nach Budapest, wo sie Lászlo persönlich kennenlernte. Lászlo machte keine großen Umschweife; schon bei ihrem ersten Treffen ließ er sie wissen, er plane, sechs Kinder zu haben und würde aus jedem einzelnen ein Genie machen. Als Klara zu ihren Eltern zurückkehrte, fiel ihre Reaktion auf den potenziellen Bräutigam verhalten aus: Sie habe eine »sehr interessante Person« getroffen, könne sich aber nicht vorstellen, ihn zu heiraten.21
Sie schrieben sich jedoch weiterhin Briefe. Beide waren Lehrer und sich einig, dass das Schulsystem ein frustrierendes Einheitssystem war, das darauf abzielte, eine »graue, mittelmäßige Masse« hervorzubringen«.22 Eineinhalb Jahre Korrespondenz später fiel Klara endlich auf, dass sie einen ganz besonderen Brieffreund hatte. Lászlo rang sich schließlich zu einem Liebesbrief durch, der mit einem Heiratsantrag endete. Sie vermählten sich, zogen nach Budapest und machten sich an die Arbeit. Zsuzsa wurde Anfang 1969 geboren, und das war der Beginn des Experiments.
Für sein erstgeborenes Genie wählte Lászlo Schach aus. Im Jahr 1972, ein Jahr, bevor Zsuzsa das Training begann, schlug der Amerikaner Bobby Fischer den Russen Boris Spassky in einer Schachpartie, die als »Match des Jahrhunderts« in die Geschichte einging. Auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs galt diese Partie als eine Art Stellvertreterkrieg, und Schach mutierte plötzlich zu einer Popkultur. Laut Klara hatte Schach zudem einen herausragenden Vorteil: »Schach ist sehr objektiv und leicht zu messen.«23 Gewinnen, verlieren oder Patt, und ein Punktesystem, das die Fertigkeiten des Schachspielers im Vergleich zu allen anderen Schachspielern misst. Seine Tochter, so entschied Lászlo, würde Schachmeisterin werden.
Lászlo war geduldig und äußerst sorgfältig. Er begann Zsuzsas Training mit »Bauernkriegen«. Nur Bauern, und die erste Seite, der es gelang, zur hinteren Reihe vorzustoßen, würde gewinnen. Schon bald studierte Zsuzsa Endspiele und Eröffnungsfallen. Schach machte ihr Spaß und sie lernte schnell. Nach acht Monaten des intensiven Studiums nahm Lászlo sie in einen verrauchten Budapester Schachklub mit und forderte gestandene Männer heraus, gegen seine vierjährige Tochter zu spielen, deren kurze Beinchen vom Stuhl baumelten. Zsuzsa gewann ihre erste Partie, und der Mann, den sie besiegt hatte, stürmte wütend davon. Dann nahm sie an der ersten Budapester Mädchenmeisterschaft teil und gewann den Titel in der Kategorie der unter Elfjährigen. Mit vier Jahren hatte sie kein einziges Match verloren.
Mit sechs konnte Klara lesen und schreiben und war ihren Klassenkameraden in Mathematik um Jahre voraus. Lászlo und Klara beschlossen, sie zuhause zu unterrichten und ihr tagsüber Zeit für das Schachspiel zu lassen. Die ungarische Polizei drohte damit, Lászlo ins Gefängnis zu werfen, falls er seine Tochter nicht in eine reguläre Schule schickte, wie es die Schulpflicht vorsah. Er brauchte viele Monate, bis er das Bildungsministerium dazu überreden konnte, ihm eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen. Zsuzsas kleine Schwester Zsófia, die inzwischen geboren war, so wie Judit, die bereits unterwegs war und die Lászlo und Klara um ein Haar Zseni – ungarisch für »Genie« – genannt hätten, wurden ebenfalls zuhause unterrichtet. Alle drei Kinder wurden Teil eines großangelegten Experiments.
An einem ganz normalen Tag waren die Kinder um 7 Uhr morgens beim Sport und spielten mit Trainern Tischtennis. Um 10 Uhr gab es zuhause Frühstück, und anschließend spielten sie den ganzen Tag lang Schach. Als Lászlo an der Grenze seiner fachlichen Kenntnisse angelangt war, engagierte er Schachtrainer für seine drei angehenden Genies. Er verbrachte viele Stunden damit, aus Schachzeitschriften 200.000 Aufzeichnungen von Spielsequenzen auszuschneiden – viele boten eine Vorschau auf potenzielle Spielgegner – und daraus eine Kartothek zu erstellen. Noch bevor Computerprogramme für Schach entwickelt wurden, besaßen die Pólgars die größte Schach-Datenbank der Welt außerhalb – vielleicht – der Geheimarchive der Sowjetunion.
Mit 17 war Zsuzsa die erste Frau, die sich für eine Teilnahme an der Schachweltmeisterschaft der Männer qualifizierte, allerdings ließ der Schach-Weltverband ihre Teilnahme nicht zu. (Eine Regel, die dank ihrer Leistung bald darauf abgeschafft wurde.) Zwei Jahre später, im Jahr 1988, als Zsófia 14 und Judit zwölf waren, gehörten die drei Schwestern zu den vier Mitgliedern der ungarischen Mannschaft für die Schach-Olympiade der Frauen. Sie gewannen und schlugen sogar die Sowjetunion, die seit Beginn dieser Veranstaltung elf von zwölf Olympiaden für sich entschieden hatte. Die Pólgar-Schwestern wurden zu »Nationalschätzen«, wie Zsuzsa es ausdrückte. Im darauffolgenden Jahr brach der gesamte Ostblock zusammen und die Mädchen konnten an Turnieren in der ganzen Welt teilnehmen. Im Januar 1991 wurde Zsuzsa im Alter von 21 Jahren die erste Frau, die mit ihrer erfolgreichen Teilnahme an Männerturnieren den Großmeistertitel errang. Im Dezember war Judit mit 15 Jahren und fünf Monaten der jüngste Schachprofi aller Zeiten, und zwar sowohl in der Kategorie der männlichen als auch der weiblichen Schachspieler, dem der Großmeistertitel verliehen wurde. Als Zsuzsa im Fernsehen gefragt wurde, ob sie lieber die Weltmeisterschaft der Männer oder der Frauen gewinnen wolle, antwortete sie geschickt, sie wolle in der »absoluten Kategorie« siegen.24
Keine der Schwestern erreichte Lászlos höchstes Ziel der absoluten Weltmeisterschaft, aber alle drei Frauen waren herausragend. Im Jahr 1996 nahm Zsuzsa an der Weltmeisterschaft der Frauen teil und gewann. Zsófias höchste Leistung war der Rang eines internationalen Meisters, eine Ebene unter dem Großmeistertitel. Judit war von allen drei Geschwistern die erfolgreichste Schachspielerin; im Jahr 2004 schaffte sie es auf auf Platz 8 der Weltrangliste.
Lászlos Experiment hatte funktioniert, und zwar so gut, dass er Anfang der 1990er-Jahre sagte, wenn 1000 Kinder nach seiner frühkindlichen Spezialisierungsmethode unterrichtet würden, könne die Menschheit sogar Probleme wie Krebs und AIDS in den Griff bekommen.25 Immerhin war Schach einfach eine willkürlich ausgewählte Disziplin, an der er die Allgemeingültigkeit seiner These getestet hatte. Genau wie die Tiger-Woods-Story endete die Pólgar-Story in einer endlosen Popkultur-Schleife aus Artikeln, Büchern, Fernsehsendungen und Vorträgen als Beispiel für den alles entscheidenden Einfluss eines frühen Startvorteils. Ein Online-Kurs mit dem Titel »Bring Up Genius!« wirbt mit Lektionen aus der Pólgar-Methode, um »deinen eigenen Lebensplan für Genialität zu entwerfen26«. Im Bestseller Talent is Overratedb werden Tiger Woods und die Pólgar-Schwestern als Beweise angeführt, dass ein früher Startvorteil in reflektierter Praxis »auf praktisch jedem Gebiet, das dir wichtig ist« der Schlüssel zum Erfolg ist.27
Die eindrückliche Lektion daraus lautet, dass sich jedes Gebiet auf die gleiche Weise erobern lässt. Sie stützt sich auf eine sehr wichtige unausgesprochene Annahme: dass Schach und Golf repräsentative Beispiele für alle Aktivitäten im Leben sind.
Wie viele Disziplinen auf der Welt gleichen jedoch Schach und Golf, und wie viele Menschen wollen sie erlernen? Der Psychologe Gary Klein ist ein Pionier auf dem Gebiet der sogenannten naturalistischen Entscheidungsfindung (Naturalistic Decision Making, NDM); NDM-Forscher beobachten Spitzenperformer bei ihrer natürlichen Arbeitsweise, um herauszufinden, wie sie unter Zeitdruck wichtige Entscheidungen treffen. Klein hat dargelegt, dass Experten in einer ganzen Reihe von Fachgebieten insofern bemerkenswerte Ähnlichkeiten mit Schachmeistern aufweisen, als auch sie instinktiv vertraute Muster erkennen.
Als ich den vielleicht größten Schachmeister aller Zeiten, Garri Kasparow, bat, seinen Entscheidungsprozess vor einem Zug zu erklären, sagte er, »ich sehe vor meinem geistigen Auge fast augenblicklich einen Zug, eine Kombination«, und zwar auf Basis der Muster, die er bereits abgespeichert habe. Kasparow sagte, er würde darauf wetten, dass die Großmeister üblicherweise den Zug machen, der ihnen in den ersten zwei Sekunden einfällt. Klein studierte auch Einsatzleiter der Feuerwehr und kam zu der Einschätzung, sie würden 80 Prozent ihrer Entscheidungen instinktiv und innerhalb von Sekunden treffen. Nach jahrelangen Feuerwehreinsätzen erkennen sie an der Art und Weise, wie sich ein Feuer und kurz vor dem Einsturz stehende Gebäude verhalten, wiederkehrende Muster. Bei seinen Untersuchungen über Marinekommandanten in Friedenszeiten, die damit betraut waren, Katastrophen zu verhindern – zum Beispiel, dass ein Passagierflugzeug mit einem feindlichen Angreifer verwechselt und abgeschossen wurde –, stellte er fest, dass sie sehr schnell potenzielle Gefahren ausmachen konnten. 95 Prozent der Zeit erkannten die Kommandeure sehr schnell ein vertrautes Muster und entschieden sich für die vertraute Reaktion, die ihnen spontan in den Sinn kam.
Der Psychologe Daniel Kahnemann, ein Kollege Kleins, studierte die menschliche Entscheidungsfindung auf Basis des Heuristics-and-Biases-Modellsc und kam zu völlig anderen Ergebnissen als Kahn. Bei der Untersuchung der Entscheidungen hochqualifizierter Experten stellte er oft fest, dass die Erfahrung keinerlei positive Wirkung hatte – im Gegenteil, oft stärkte sie zwar das Selbstvertrauen, aber nicht die Kompetenz.
Kahnemann schloss sich selbst in die Kritik ein. Im Jahr 1955 kamen ihm als jungem Leutnant in der psychologischen Einheit der israelischen Verteidigungsstreitkräfte erstmalig Zweifel an der Verbindung zwischen Erfahrung und Fachwissen. Eine seiner Aufgaben bestand darin, Offiziersanwärter mithilfe von Tests zu bewerten, die von der britischen Armee übernommen und adaptiert worden waren. In einer Übung mussten Teams aus acht Kandidaten samt eines langen Telefonmasts eine zwei Meter hohe Mauer überwinden, ohne dass der Mast den Boden berührte und ohne dass einer der Soldaten oder der Mast die Mauer berührten.d Die Unterschiede in den individuellen Leistungen waren so groß – unter den Belastungen der gestellten Aufgabe kristallisierten sich eindeutige Anführer, Aufschneider und Feiglinge heraus –, dass Kahnemann und seine Assessment-Kollegen sicher waren, dass sie die Führungsqualitäten der Bewerber analysieren und diejenigen identifizieren konnten, die sich im Offizierstraining und im Kampf erfolgreich bewähren würden. Sie lagen völlig falsch. Alle paar Monate hielten sie einen sogenannten Statistiktag ab, an dem sie Feedback über die Genauigkeit ihrer Prognosen einholten. Jedes Mal stellten sie dabei fest, dass sie genauso gut blind hätten raten können. Jedes Mal erwarben sie dabei neue Erfahrungen und jedes Mal nahm ihr Vertrauen, Beurteilungen treffen zu können, zu. Und dann stellten sie jedes Mal aufs Neue fest, dass sich ihre Trefferquote nicht verbessert hatte. Kahnemann staunte über »das völlige Fehlen einer Verbindung zwischen den statistischen Informationen und dem schlüssigen Erkenntnisgewinn«.28 Ungefähr zur gleichen Zeit wurde ein einflussreiches Buch über die Urteilsfähigkeit von Experten veröffentlicht, das ihn, wie Kahnemann mir sagte, enorm beeindruckt hatte.29 Dabei handelte es sich um eine breit angelegte Überprüfung von Forschungsergebnissen, die die Psychologie erschütterten, weil sie zeigten, dass langjährige Erfahrung in den unterschiedlichsten Szenarien – von College-Administratoren, die das akademische Potenzial von Studienbewerbern bewerten, über Psychiater, die Prognosen über die Entwicklung und das Verhalten von Patienten treffen, bis zu Personalexperten, die entscheiden, wer von einer Schulungsmaßnahme profitieren wird –, schlichtweg keine kompetenzsteigernde Wirkung hat. Auf diesen Gebieten, die mit der Beurteilung des menschlichen Verhaltens zu tun haben und auf denen sich keine eindeutigen wiederkehrenden Muster feststellen lassen, führte Wiederholung nicht zu Lernprozessen. Schach, Golf und Brandbekämpfung sind die Ausnahme, nicht die Regel.
Die unterschiedlichen Ergebnisse, zu denen Klein und Kahnemann in ihren jeweiligen Untersuchungen über erfahrene Spezialisten kamen, gaben ein großes Rätsel auf: Werden Spezialisten mit zunehmender Erfahrung besser oder nicht?
Im Jahr 2009 unternahmen Kahnemann und Klein den ungewöhnlichen Schritt, einen Aufsatz in Co-Autorenschaft zu veröffentlichen, in dem sie ihre jeweilige Sichtweise darlegten und nach einem gemeinsamen Nenner suchten. Und den fanden sie. Ob Erfahrung unweigerlich die Kompetenz steigere, so waren sie sich einig, hänge allein von dem fraglichen Fachgebiet ab. Eine eng umgrenzte Erfahrung wirke sich positiv auf die Leistung von Schach- und Pokerspielern und Feuerwehrleuten aus, aber nicht auf die Prognosen über finanzielle oder politische Trends oder das Verhalten von Mitarbeitern oder Patienten.30 Die von Klein untersuchten Gebiete, auf denen eine instinktive Mustererkennung zu großen Erfolgen führte, gelten als sogenannte lernfreundliche Umgebungen, wie es der Psychologe Robin Hogarth bezeichnet hat.31 In diesen Umgebungen findet man wiederkehrende Muster und erhält üblicherweise recht schnell ein sehr genaues Feedback. Im Golfsport oder beim Schach wird ein Ball beziehungsweise eine Figur nach bestimmten Regeln und innerhalb festgelegter Grenzen bewegt; die Folgen der Bewegung sind sofort ersichtlich, und es kommt zu einer häufigen Wiederholung ähnlicher Herausforderungen. Wenn Sie einen Golfball abschlagen, schlagen Sie ihn entweder zu weit oder zu kurz, und er fliegt entweder geradeaus, dreht nach rechts ab (Slice) oder nach links (Hook). Der Golfspieler beobachtet die Flugbahn des Balls und seinen Aufprall, versucht, seine Fehler zu korrigieren, unternimmt einen erneuten Versuch und wiederholt das über Jahre. Das ist die Definition von reflektierter Praxis – eine sehr frühe Spezialisierung, ein ausgefeiltes technisches Training und unermüdliche Wiederholung über 10.000 Übungsstunden. Die Umgebung ist lernfreundlich, weil ein Lernender einfach dadurch kompetenter wird, dass er dieselben Schritte ständig wiederholt und versucht, sie jedes Mal besser zu machen. Kahnemann fokussierte auf das andere Extrem an Lernumgebungen; Hogarth bezeichnete sie als »lernunfreundlich«.32
Auf sogenannten lernunfreundlichen Gebieten sind die Spielregeln oft unklar oder unvollständig, es kann wiederkehrende Muster geben oder auch nicht, sie können klar erkennbar sein oder nicht, und das Feedback erfolgt oft mit einer zeitlichen Verzögerung oder ist ungenau oder beides.
In den lernunfreundlichsten Umgebungen wird die Erfahrung genau die falschen Lektionen verstärken. Hogarth erwähnte einen berühmten Arzt aus New York, der für seine außerordentlichen Diagnosefähigkeiten bekannt war. Seine besondere Spezialität war Typhus, und er untersuchte seine Patienten, indem er mit seinen Händen den Raum um ihre Zunge herum abtastete. Immer wieder ergaben seine Tests eine positive Diagnose, noch bevor die untersuchten Patienten ein einziges Symptom entwickelt hatten. Und immer wieder erwies sich seine Diagnose als zutreffend. Wie ein anderer Arzt später sagte, »war er nur mit seinen Händen ein effektiverer Krankheitsüberträger als Typhoid Mary«.33e Der wiederholte Erfolg lehrte ihn die denkbar schlechteste Lektion. Nur wenige Lernumgebungen sind derart lernunfreundlich, allerdings gehört nicht viel dazu, um selbst langjährig erfahrene Experten aus der Bahn zu werfen. Wenn erfahrene Feuerwehrleute mit einer völlig neuen Situation zu tun haben, zum Beispiel ein Brand in einem Wolkenkratzer, kann es sein, dass sie ihre in jahrelanger Arbeit entwickelte Intuition verlässt und sie eine schlechte Entscheidung treffen. Bei einer Veränderung des Status quo kann es auch passieren, dass ein Schachmeister plötzlich feststellt, dass die Kompetenzen, die er in vielen Jahren erworben hat, obsolet sind.
Im Jahr 1997 schlug der IBM-Supercomputer Deep Blue Garri Kasparow in einem Showdown, der überschwänglich als Endschlacht um die Überlegenheit zwischen der natürlichen und der künstlichen Intelligenz gefeiert wurde.34 Deep Blue bewertete zweihundert Millionen Schachpositionen pro Sekunde. Das ist ein winziger Ausschnitt aus allen möglichen Schachpositionen – es gibt mehr als Atome im beobachtbaren Universum –, aber er ist groß genug, um selbst den besten Schachspieler der Welt zu besiegen. Laut Kasparow »ist jede kostenlose Schach-App auf Ihrem Smartphone heute besser als ich«.35 Und das war keine Rhetorik.
»Alles, was wir tun können und von dem wir wissen, wie wir es tun müssen, werden Maschinen noch besser machen«, sagte er bei einem kürzlichen Vortrag. »Wenn wir dieses Wissen kodifizieren und in einen Computer einprogrammieren können, wird er es besser machen.« Seine Niederlage gegen Deep Blue brachte ihn jedoch auf eine Idee. Bei seinen Partien gegen Schachcomputer erkannte er, was Wissenschaftler auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz als Moravec’sches Paradox bezeichnen: Menschen und Maschinen haben oft gegenläufige Stärken und Schwächen.
Es heißt, Schach sei »zu 99 Prozent Taktik«. Taktiken sind kurze Zugkombinationen, die die Spieler verwenden, um sich einen unmittelbaren Vorteil zu verschaffen. Wenn Schachspieler all diese Muster studieren, beherrschen sie die Taktiken. Die Gesamtplanung eines Schachspiels – wie man die einzelnen Gefechte führt, um den gesamten Krieg zu gewinnen – wird als Strategie bezeichnet. Zuzsa Pólgar schrieb dazu, »Man kann sehr weit kommen, wenn man taktisch gut ist« – soll heißen, wenn man viele taktische Muster kennt – »und nur wenig Kenntnisse in strategischer Spielführung besitzt«.36
Dank ihrer Rechenkapazitäten sind Computer dem Menschen taktisch weit überlegen. Großmeister können zwar die nächsten Züge vorhersagen, aber Computer sind ihnen darin überlegen. Was würde passieren, überlegte sich Kasparow, wenn man die taktische Überlegenheit von Computern mit der übergeordneten strategischen menschlichen Denkfähigkeit kombinieren würde?
Im Jahr 1998 beteiligte er sich an der Organisation des ersten sogenannten modernen Schachturniers, bei dem die Schachspieler, auch Kasparow, gemeinsam mit einem Schachcomputer gegeneinander antreten mussten. So erübrigte sich das jahrelange Studium von Mustern. Der Schachcomputer übernahm die Taktik und sein menschlicher Partner konzentrierte sich auf die Strategie. Das war so, als würde Tiger Woods in einem Golf-Videospiel gegen die besten Gamer antreten.
Das jahrelange Studium und die unermüdliche Wiederholung von Spielzügen waren plötzlich obsolet; das Spiel hatte sich von der taktischen zur strategischen Spielführung verlagert. Damit veränderte sich auch augenblicklich die Rangordnung im Schach. »Unter diesen Umständen gewann die menschliche Kreativität erheblich an Bedeutung«, so Kasparow. Nun erzielte er gegen einen Spieler, den er nur einen Monat zuvor bei einem traditionellen Match mit 4 : 1 Spielen besiegt hatte, lediglich ein Remis von 3 : 3. »Der Computer hatte meinen Vorteil in der taktischen Kalkulation zunichte gemacht.«37 Der Hauptnutzen der jahrelangen Erfahrung, die er durch ein hochfokussiertes, spezialisiertes Training gewonnen hatte, war dahin. Plötzlich fand er sich in einem Wettbewerb, in dem die von Menschen entwickelte Strategie im Vordergrund stand, gegen Kontrahenten wieder, die ihm das Wasser reichen konnten.
Einige Jahre später wurde das erste Freestyle-Schachturnier abgehalten, bei dem sich die Teams aus mehreren Spielern und Computern bilden konnten. Der Vorteil, den Spieler durch eine lebenslange reflektierte Praxis erworben hatten und der vom sogenannten modernen Schachturnier bereits verwässert worden war, war beim Freestyle-Schachturnier gänzlich verschwunden. Einem Duo aus Amateurspielern mit drei ganz normalen Computern gelang es nicht nur, Hydra, den besten Schachcomputer überhaupt, auszuschalten, sondern sie spielten auch Teams aus Großmeistern an die Wand, die von Computern unterstützt wurden. Kasparow schloss daraus, dass die Spieler des Siegerteams von allen Teilnehmern am besten in der Lage waren, mehrere Computer zu füttern, um bestimmte Analysen zu erhalten, und diese Informationen anschließend zu synthetisieren und daraus eine Spielstrategie zu entwickeln.38 Teams aus Mensch und Maschine – auch unter dem Namen Zentauren bekannt – spielten auf dem höchsten Schachniveau, das die Welt je gesehen hat. Wenn Deep Blues Sieg über Kasparow die Übertragung der Schachkompetenz von Menschen auf Computer signalisiert hatte, symbolisierte der Sieg der Zentauren über Hydra etwas noch Interessanteres: Nicht mit dem jahrelangen fokussierten Studium wiederkehrender Muster, sondern mit Kreativität können Menschen zu Spitzenleistung gelangen.
Im Jahr 2014 lobte ein Austragungsort in Abu Dhabi ein Preisgeld von 20.000 Dollar für ein Freestyle-Turnier aus, das unter anderem Spiele beinhaltete, bei denen Schachcomputer ohne menschliche Beteiligung gegeneinander antraten. Das Siegerteam bestand aus vier Spielern und mehreren Computern. Der Teamkapitän und Hauptentscheider war Anson Williams, ein britischer Ingenieur ohne offizielles Schach-Rating. Sein Teamkollege, Nelson Hernandez, sagte mir: »Die Leute verstehen nicht, dass Freestyle eine Reihe an integrierten Kompetenzen erfordert, die zum Teil nichts mit Schach zu tun haben.«39 Beim traditionellen Schach würde Williams vermutlich den Rang eines soliden Amateurs einnehmen. Er kannte sich jedoch sehr gut mit Computern aus und war sehr versiert in der Integration von Informationsflüssen für strategische Entscheidungen. Als Teenager war er außerordentlich gut in dem Videospiel Command & Conquer gewesen, das auch als »Echtzeitstrategie« bekannt ist, weil sich die Spieler simultan bewegen. Beim Freestyle-Schach musste er Ratschläge seiner Teamkollegen und verschiedener Schachprogramme berücksichtigen und den Computern dann sehr schnell Befehle zur tieferen Analyse verschiedener Alternativen erteilen. Er war praktisch der Leiter eines Teams aus Mega-Großmeistern, die als seine taktischen Berater fungierten. Seine Aufgabe bestand darin, zu entscheiden, wessen Rat er eingehender prüfen und wem er letztlich folgen sollte. Er spielte jedes Spiel mit großem Bedacht und in der Erwartung einer Pattsituation, versuchte aber, Situationen zu erzeugen, die seinen Kontrahenten zu einem Fehler verleiten würden.
Am Ende fand Kasparow einen Weg, den Computer zu schlagen, indem er die taktische Spielführung dem Computer überließ – also genau den Teil der menschlichen Expertise, der sich am einfachsten ersetzen lässt und auf deren Erwerb er und die Pólgar-Wunderkinder viele Jahre verwendet hatten.
Im Jahr 2007 machte der Fernsehkanal National Geographic TV einen Test mit Zsuzsa Pólgar. Sie baten sie, sich auf dem Bürgersteig inmitten eines begrünten Häuserblocks in Manhattans Viertel Greenwich Village an einen Tisch zu setzen, auf dem ein vorbereitetes Schachbrett stand. Geschäftige Passanten in Jeans und Herbstjacken passierten den Tisch, als ein weißer Lastwagen, auf dem eine große grafische Darstellung eines Schachbretts prangte, auf dem 28 Figuren in einer bestimmten Spielsituation angeordnet waren, links in die Thompson Street abbog und an Zsuzsa Pólgar vorbeifuhr. Zsuzsa warf einen Blick auf den vorbeifahrenden Lastwagen und stellte die abgebildete Spielsituation komplett nach. Die Fernsehsendung knüpfte damit an eine Reihe berühmter Schach-Experimente an, aus denen sich interessante Erkenntnisse über den Erwerb von Fertigkeiten in lernfreundlichen Umgebungen ziehen ließen.
Das erste Schach-Experiment fand in den 1940er-Jahren statt, als der niederländische Schachmeister und Psychologe Adriaan de Groot Schachspielern verschiedener Kompetenzebenen kurz Bilder von Spielsituationen aus einer Partie zeigte. Anschließend bat er die Spieler, die jeweils eingeblendete Konstellation so genau wie möglich nachzustellen. Ein Großmeister stellte wiederholt vollständige Spielsituationen nach, obwohl er das vorgeführte Schachbrett nur drei Sekunden gesehen hatte. Ein Meisterspieler schaffte die Hälfte. Dem Gewinner eines Städteturniers und einem durchschnittlichen Spieler eines Schachklubs gelang es nicht, das Schachbrett nachzustellen.40 Genau wie Zsuzsa Pólgar schienen Großmeister im Gegensatz zu weniger kompetenten Schachspielern ein fotografisches Gedächtnis zu haben.
Nachdem Zsuzsa ihren ersten Test erfolgreich bestanden hatte, drehte National Geographic TV den Lastwagen um, sodass die andere Seite ins Blickfeld kam, auf der ein Schachbrett mit völlig willkürlich platzierten Figuren abgebildet war. Nachdem der Lastwagen erneut an Zsuzsa vorbeigefahren war, gelang es ihr nicht, irgendetwas davon nachzustellen, obwohl sich deutlich weniger Figuren auf dem abgebildeten Brett befanden.41
Mit diesem Test wurde ein Experiment von 1973 wiederholt, bei dem zwei Psychologen der Carnegie Mellon University, William G. Chase und der zukünftige Nobelpreisträger Herbert A. Simon, die Übung von De Groot mit einer leichten Abwandlung wiederholten. Dieses Mal erhielten die Schachspieler ein Schachbrett mit Konstellationen der Spielfiguren, wie sie in einem echten Spiel niemals vorkommen würden. Plötzlich sank die Leistung der Schachprofis auf das Niveau weniger kompetenter Spieler. Wie sich herausstellte, besaßen die Großmeister gar kein fotografisches Gedächtnis. Durch ein wiederholtes Studium von Spielmustern hatten sie gelernt, was Chase und Simon als »Chunking« – die Gruppierung von Einzelelementen in größere sinnvolle Konstellationen – bezeichnen.42 Anstatt sich mühevoll die Position jeder einzelnen Schachfigur einzuprägen, hatten die Gehirne der Spitzenspieler die Figuren auf Basis vertrauter Muster in kleinere Konstellationen gruppiert. Diese Muster ermöglichten ihnen, eine bestimmte Spielsituation auf Basis ihrer Erfahrung auf Anhieb zu erkennen. Das ist der Grund, warum Garri Kasparow sagte, die Großmeister wüssten üblicherweise innerhalb von Sekunden, welchen Zug sie machen müssen. Für Zsuzsa Pólgar bestand das auf dem Lastwagen abgebildete Schachbrett, das sie beim ersten Vorbeifahren des Lastwagens sah, nicht aus 28 Einzelfiguren, sondern aus fünf verschiedenen sinnvollen Konstellationen, die ihr den Spielverlauf anzeigten.
Chunking erklärt zum Teil das Phänomen, dass Meister ihres Faches scheinbar über ein fotografisches Gedächtnis verfügen – von Musikern, die lange Kompositionen auswendig spielen, bis zu Quarterbacks, die im Bruchteil einer Sekunde das Muster einer bestimmten Spieleraufstellung erkennen und sich zum Wurf entscheiden. Der Grund, warum Spitzensportler übermenschliche Reflexe zu haben scheinen, ist, dass sie Muster aus bestimmten Ball- oder Körperbewegungen wiedererkennen, die ihnen intuitiv mitteilen, was als Nächstes geschieht, noch bevor die Situation tatsächlich eintritt. Sobald sie außerhalb ihres sportlichen Kontextes getestet werden, sind jedoch keine scheinbar übermenschlichen Reaktionen mehr feststellbar.
Wir alle verlassen uns tagtäglich auf Chunking. Nehmen Sie sich zehn Sekunden und versuchen Sie, sich möglichst viele der folgenden 22 Worte einzuprägen:
Weil Gruppen zwanzig Muster
Sinnvollen kann Worte leichter einprägen man
Satz dabei zusammensetzt viel sich einen
wenn Wortgruppen sie vertraute zu bilden.
Und nun versuchen Sie es noch einmal:
Man kann sich zwanzig Worte viel leichter einprägen,
wenn sie einen sinnvollen Satz bilden,
weil man dabei vertraute Muster zu Wortgruppen zusammensetzt.
Beide Wortanordnungen enthalten dieselben 20 Informationsteilchen. Im Verlauf Ihres Lebens haben Sie jedoch Wortmuster gelernt, die Ihnen ermöglichen, augenblicklich einen Sinn in der zweiten Anordnung zu erkennen, und das erleichtert Ihrem Gehirn die Aufgabe, sich diese Worte einzuprägen. Die Bedienung in Ihrem Restaurant verfügt also nicht über ein fotografisches Gedächtnis, sondern hat genau wie Musiker und Quarterbacks gelernt, wiederkehrende Informationen zu sinnvollen Einheiten zusammenfassen.
Beim Schach ist das Studium einer möglichst großen Zahl an wiederkehrenden Mustern so wichtig, dass eine frühe Spezialisierung in technischer Praxis erfolgsentscheidend ist. Die Psychologen Fernand Gobet (Internationaler Meister) und Guillermo Campitelli (trainiert angehende Großmeister) haben festgestellt, dass die Chancen eines Turnier-Schachspielers auf den Titel Internationaler Meister (eine Ebene unter dem Großmeister) von 1 : 4 auf 1 : 55 sinkt, wenn der Schachspieler nicht bereits im Alter von zwölf Jahren mit einem fokussierten technischen Training begonnen hat.43 Chunking kann wie Magie wirken, tatsächlich ist es das Ergebnis intensiver Wiederholung. Lászlo Pólgar hatte recht, an den Wert der reflektierten Praxis zu glauben. Dafür gibt es übrigens noch eindrücklichere Belege als seine Töchter.
Über mehr als 50 Jahre studierte der Psychiater Darold Treffert Menschen mit einem unstillbaren Drang, sich einem bestimmten Gebiet zu widmen und auf diesem Gebiet herausragende Fähigkeiten zu entwickeln, die ihren Fähigkeiten auf anderen Gebieten weit überlegen sind. Treffert bezeichnet sie als Savanten – Menschen mit Inselbegabungen – und das Phänomen als »Savant-Syndrom«44.f Treffert dokumentiert die beinahe unglaublichen Leistungen von Savanten wie dem Pianisten Leslie Lemke, der Tausende von Songs auswendig spielen kann. Da Lemke und andere Savanten scheinbar über eine unbegrenzte Fähigkeit verfügen, Dinge aus ihrem Gedächtnis abzurufen, schrieb Treffert ihre Leistungen zunächst einem perfekten Erinnerungsvermögen zu; sie gleichen menschlichen Aufnahmegeräten – mit einer Einschränkung: Musische Savanten können nach dem einmaligen Anhören einer Melodie tonale Musik – dazu gehört fast die gesamte Popmusik und Klassik – leichter reproduzieren als atonale Musik, in der die Notenabfolge keinen vertrauten Harmonien folgt. Hätten die Savanten tatsächlich ein fotografisches Notengedächtnis, würde es bei der Reproduktion der gehörten Musikstücke keinen Unterschied machen, ob sie tonal oder atonal sind.
In der Praxis macht es einen Riesenunterschied. In einer Studie über einen inselbegabten Pianisten war der für die Untersuchungen verantwortliche Forscher, der den Pianisten viele hundert Kompositionen fehlerfrei hatte spielen hören, sehr verblüfft, als derselbe Pianist nicht in der Lage war, ein atonales Musikstück aus dem Gedächtnis zu spielen, obwohl er es sogar einmal geübt hatte. »Was ich hörte, war so unwahrscheinlich, dass ich mich verpflichtet fühlte, das Keyboard zu untersuchen, um zu sehen, ob es womöglich in den Transpositionsmodus gesprungen war«, erinnerte sich der Forscher. »Tatsächlich hatte sich der Pianist aber verspielt und machte anschließend noch weitere Fehler.«45 Muster und vertraute Strukturen waren für das außerordentliche Erinnerungsvermögen des Pianisten von maßgeblicher Bedeutung. Ähnlich verhält es sich mit bildenden Künstlern. Wenn man ihnen kurz Bilder zeigt und sie bittet, diese auf Leinwand zu reproduzieren, gelingt ihnen das weitaus besser, wenn es sich um dingliche Darstellungen handelt, als wenn sie abstrakte Bilder nachmalen sollen.46
Treffert brauchte Jahrzehnte, um zu erkennen, dass er von völlig falschen Voraussetzungen ausgegangen war und Savanten mehr mit Wunderkindern wie den Pólgar-Schwestern gemeinsam haben, als er dachte. Sie sind keine reinen Wiederkäuer; wie die herausragenden Leistungen der Pólgar-Schwestern stützt sich ihre Brillanz auf repetitive Strukturen, und das ist genau der Grund, warum sich die Fähigkeiten der Pólgar-Schwestern so leicht automatisieren lassen.
Angesichts der Fortschritte, die mit dem Schachprogramm Alpha-Zero (gehört zu einer KI-Sparte der Muttergesellschaft von Google) erzielt wurden, würden vielleicht sogar die besten Zentauren in einem Freestyle-Turnier besiegt werden. Anders als bisherige Schachprogramme, die mithilfe gewaltiger Rechenkapazitäten in einem Bruchteil von Sekunden die Zahl der möglichen Schachzüge kalkulieren und diese auf Basis der programmierten Kriterien bewerten, ist AlphaZero ein selbstlernendes Programm. Einprogrammiert wurden lediglich die Regeln; anschließend absolvierte AlphaZero zahllose Spiele, bei denen seine Algorithmen lernten, welche Züge und Taktiken sich bewähren, und welche eher nicht. Innerhalb kurzer Zeit wird es die besten Schachprogramme schlagen. Auch das Brettspiel Go, das wesentlich mehr Möglichkeiten bietet, beherrschte AlphaZero in kurzer Zeit. Die Lektion aus dem Einsatz von Zentauren bleibt jedoch gültig: Je stärker eine Aufgabe von den breiten Möglichkeiten strategischer Entscheidungen geprägt ist, desto wichtiger der menschliche Beitrag.
Die Programmierer von AlphaZero priesen ihre beeindruckende Leistung an, indem sie erklärten, ihre Erfindung habe sich aus eigener Kraft von einem »unbeschriebenen Blatt« zur Meisterschaft entwickelt.47 Das ist jedoch nur bedingt richtig. Das Programm operiert nach wie vor in einer begrenzten, regelbasierten Welt. Selbst bei Videospielen, die weniger an taktische Muster gebunden sind, haben Computer größere Herausforderungen bewältigt.
Die neueste Herausforderung im Bereich Videospiele für künstliche Intelligenz (KI) ist StarCraft, ein Echtzeit-Strategiespiel, in dem fiktive Wesen in irgendeinem entfernten Winkel der Milchstraße einen Krieg um die Vormachtstellung im Universum führen. Dieses Spiel erfordert wesentlich komplexere Entscheidungen als Schach. Es gibt Schlachten zu führen, Infrastruktur zu planen, zu spionieren, neue Räume zu erforschen und Ressourcen zu sammeln, wobei sich alle diese Elemente gegenseitig informieren. Computer hatten Schwierigkeiten, dieses Videospiel zu gewinnen, wie mir Julian Togelius, Professor von der Universität New York 2017 verriet, der Künstliche Intelligenz bei Videospielen untersucht. Selbst wenn sie menschliche Kontrahenten in einzelnen Spielen schlagen konnten, gelang es diesen, mithilfe von »langfristigen adaptiven Strategien« wieder die Oberhand zu gewinnen. »Das Denken ist sehr vielschichtig«, sagte er. »Wir Menschen zapfen alle diese Schichten einzeln an, aber wir haben eine ungefähre Vorstellung von jeder dieser Schichten und können sie kombinieren und uns so bis zu einem gewissen Grad anpassen. Das scheint der Trick zu sein.«
Im Jahr 2019 wurde ein Profi-Gamer zum ersten Mal bei einer eingeschränkten Version von StarCraft von künstlicher Intelligenz besiegt. (Der Gamer passte sich dann aber an die neue Herausforderung an und konnte nach einer Reihe von Niederlagen schließlich einen Sieg erzielen.) Die strategische Komplexität des Spiels bietet jedoch eine Lektion: Je komplexer das Gesamtbild, desto wertvoller der potenzielle menschliche Beitrag. Unsere größte Stärke ist die Fähigkeit zur breiten Integration, also genau das Gegenteil einer engen Spezialisierung. Laut Gary Marcus, Psychologe und Professor für Neurowissenschaften, der sein Unternehmen für maschinelles Lernen an Uber verkauft hat, »leisten Menschen in engen Welten möglicherweise schon bald keinen werthaltigen Beitrag mehr. Bei Videospielen, die kreative Lösungen erfordern, werden sie meiner Ansicht nach auf jeden Fall einen Beitrag leisten können. Aber nicht nur bei Videospielen, sondern allgemein bei allen realen Problemen, die eine kreative Lösung erfordern, sind wir Maschinen immer noch weit überlegen.«48