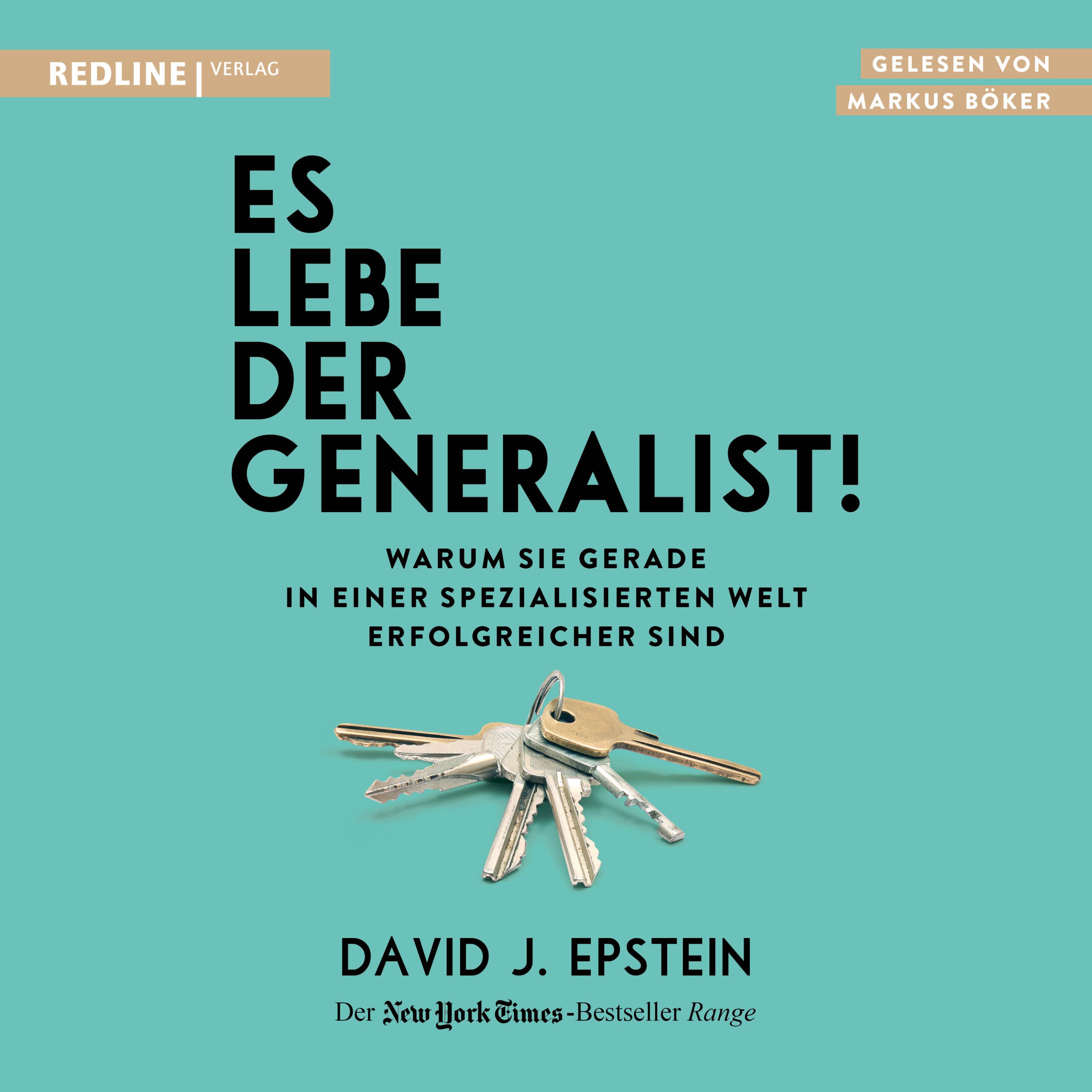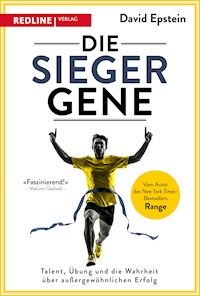
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: REDLINE Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Usian Bolt, Serena Williams und Michael Phelps – Ausnahmesportler, die jeder kennt, ganz gleich, ob sportbegeistert oder nicht. Doch was befähigt diese Menschen zu ihren Höchstleistungen? Genetische Besonderheit oder eiserne Willenskraft und knallhartes Training? Oder die Kombination aus allen dreien? David Epstein geht dieser kontroversen Frage um Erfolgsfaktoren und die sogenannte 10.000-Stunden-Regel nach, die besagt, man müsse nur so lange üben, um etwas zu beherrschen. Er führt Gespräche mit Wissenschaftlern, Olympiasiegern und Athleten und zwingt nicht nur Sportler dazu, die Natur des Erfolgs in allen Bereichen neu zu überdenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
David Epstein
Die Siegergene
David Epstein
DIESIEGERGENE
Talent, Übung und die Wahrheit über außergewöhnlichen Erfolg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen:
1. Auflage 2020
© 2020 by Redline Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH,
Nymphenburger Straße 86
D-80636 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
© der Originalausgabe by David Epstein 2013
Die englische Originalausgabe erschien 2013 bei Portfolio, einem Imprint von Penguin Random House LLC, unter dem Titel The Sports Gene.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Max Limper
Redaktion: Silvia Kinkel
Umschlaggestaltung: Marc Fischer
Umschlagabbildung: Shutterstock/
Ostill is Franck Camhi/ein kaukasischer junger Sprinter-Läufer
Satz: abavo GmbH, Buchloe
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
eBook: ePubMATIC.com
ISBN Print 978-3-86881-798-0
ISBN E-Book (PDF) 978-3-96267-227-0
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96267-228-7
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.redline-verlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Für Elisabeth, meine allerliebste MC1R-Mutantin
INHALT
EinführungAuf der Suche nach dem Siegergen
1
Gefährliche Mädchenbälle
Wie man Können ohne Gene erklärt
2
Zwei Hochspringer
Oder: 10.000 Stunden mehr oder weniger
3
Ein Auge für Baseball
Das Hardware- und Software-Paradigma
4
Warum Männer Brustwarzen haben
5
Das Talent der Trainierbarkeit
6
Superbaby, Superhund und die Trainierbarkeit von Muskeln
7
Der Urknall der Körpertypen
8
Der vitruvianische Basketballer
9
Wir sind alle (irgendwie) schwarz
Ethnische und genetische Diversität
10
Krieger, Sklaven und jamaikanische Sprinter
11
Malaria und Muskelfasern
12
Ist jeder Kalenjin ein Läufer?
13
Das größte (höchstgelegene) Talentsieb der Welt
14
Schlittenhunde, Ultraläufer und Faulpelz-Gene
15
Das Gen, das Herzen bricht
Tod, Verletzung und Schmerz auf dem Sportplatz
16
Der Mutant mit der Goldmedaille
EpilogDer perfekte Sportler
Nachwort
Über den Autor
Danksagungen
Anmerkungen und ausgewählte Quellenangaben
EINFÜHRUNG
Auf der Suche nach dem Siegergen
Micheno Lawrence war Sprinter in meinem Highschool-Team. Als Sohn jamaikanischer Eltern war er klein und mollig, und das Netzhemd, das er wie manche andere jamaikanische Teamkameraden zum Training trug, spannte sich über einen prallen Bauch. Nach der Schule jobbte er bei McDonald’s und man scherzte, dass er sich dort zu oft selbst bediente. Aber das hielt ihn nicht davon ab, beeindruckend schnell zu sein.
Als in den 1970er- und 1980er-Jahren ein kleiner Exodus jamaikanische Familien nach Evanston, Illinois, brachte, wurde an der Evanston Township Highschool Leichtathletik zu einem beliebten Sport. (In der Folge gewann unser Team zwischen 1976 und 1999 vierundzwanzig aufeinanderfolgende Turniere.) Wie es sich für Ausnahmesportler gehört, sprach Micheno von sich selbst in der dritten Person. »Micheno hat kein Herz«, pflegte er vor großen Wettkämpfen zu sagen und meinte damit, dass er seine Konkurrenten gnadenlos besiegen würde. Im Jahr 1998, meinem Abschlussjahr, gewann er die Meisterschaft des Bundesstaats Illinois, indem er als Schlussläufer der 4×400-Meter-Staffel vom vierten auf den ersten Platz schoss.
Einen solchen Sportler kennt jeder von uns aus der Schulzeit. Einen, der alles ganz leicht aussehen lässt. Egal ob es ein Quarterback oder Shortstop, eine Hochspringerin oder ein Point Guard war – es handelte sich um ein Naturtalent.
Wirklich? Haben Eli und Peyton Manning die Quarterback-Gene ihres Vaters Archie geerbt, oder sind sie zu NFL-Stars geworden, weil sie mit einem Football in der Hand aufwuchsen? Gewiss hat Joe »Jellybean« Bryant seine Statur an seinen Sohn Kobe weitergegeben, aber woher hat der Sprössling seinen explosiven Antritt? Wie kommt es, dass Paolo Maldini den AC Milan zum Champions-League-Titel führte – vierzig Jahre nachdem sein Vater Cesare dasselbe erreichte? Hat Ken Griffey Sr. seinem Jungen etwa Baseball-Gene vermacht? Oder bestand das wahre Vermächtnis darin, dass der Junior in einem Baseball-Clubhaus aufwuchs? Oder in beidem? Zum ersten Mal in der Sportgeschichte bildete im Jahr 2010 ein Mutter-Tochter-Gespann, bestehend aus Irina und Olga Lenskiy, die Hälfte der israelischen Nationalmannschaft in der 4-mal-100-Meter-Staffel. Hier lag offenbar das Geschwindigkeitsgen in der Familie. Aber gibt es so etwas überhaupt? Gibt es überhaupt »Siegergene«?
Im April 2003 verkündete ein internationales Konsortium von Wissenschaftlern den Abschluss des Human Genom Projekts. Nach dreizehn Jahren Arbeit (und 200.000 Jahre nach dem Aufkommen des anatomisch modernen Menschen) hatten die Wissenschaftler das menschliche Genom kartiert. Alle rund 23.000 DNA-Regionen, die Gene enthalten, waren identifiziert worden. Auf einmal wussten die Forscher, wo sie nach den Ursprüngen menschlicher Eigenschaften suchen mussten, von der Haarfarbe über Erbkrankheiten bis hin zur Hand-Auge-Koordination; aber sie wussten noch nicht, wie schwierig es sein würde, die genetischen Anweisungen zu lesen.
Das Genom muss man sich als ein 23.000 Seiten dickes Rezeptbuch vorstellen, das in jeder menschlichen Zelle steckt und Anweisungen für die Entstehung des Körpers bereithält. Wer diese 23.000 Seiten zu lesen vermag, könnte herausfinden, wie der Körper entsteht. So jedenfalls war das Wunschdenken der Wissenschaftler. Allerdings enthalten einige der 23.000 Seiten Anweisungen für viele verschiedene Körperfunktionen, und wenn eine Seite verschoben, geändert oder herausgerissen wird, können einige der anderen 22.999 Seiten plötzlich neue Anweisungen enthalten.
In den Jahren nach der Sequenzierung des menschlichen Genoms suchten sich Sportwissenschaftler einzelne Gene heraus, von denen sie vermuteten, dass sie die sportliche Leistung beeinflussen würden, und verglichen unterschiedliche Versionen dieser Gene von Sportlern und Nichtsportlern. Das Problem bei solchen Studien ist, dass einzelne Gene normalerweise so geringe Auswirkungen haben, dass sie in Studien an kleinen Gruppen nicht nachweisbar sind. Selbst bei leicht zu messenden Merkmalen wie der Körpergröße entziehen sich die dazugehörigen Gene meistens der Erkennung. Nicht weil es sie nicht gäbe, sondern weil sie in der Komplexität des Genoms verborgen sind.
Langsam, aber sicher gingen Wissenschaftler von den Studien einzelner Gene über zu neuen und innovativen Methoden zur Analyse der Funktionsweise genetischer Anweisungen. Nimmt man hinzu, was Biologen, Physiologen und Sportwissenschaftler zu den Auswirkungen von biologischer Veranlagung und Trainingseifer auf die Leistungsfähigkeit herausgefunden haben, dann erscheint die große Debatte über ererbte oder erlernte Sportlichkeit in ganz neuem Licht. Das erfordert allerdings, dass wir uns tief ins Gestrüpp solch sensibler Themen wie Geschlecht und Ethnizität wagen. Aber da sich die Wissenschaft dorthin vorgewagt hat, scheut auch dieses Buch nicht davor zurück.
In Wirklichkeit ist es so, dass Ererbtes und Erlerntes in allen Bereichen außergewöhnlicher Leistung so miteinander verflochten sind, dass die Antwort immer lautet: beides. Dies ist jedoch für die Wissenschaft kein zufriedenstellender Schlusspunkt. Wissenschaftler müssen der Frage nachgehen: »Wie wirken Erlerntes und Ererbtes ganz konkret zusammen?« Und »Wie groß ist der jeweilige Anteil?« Um diese Fragen zu beantworten, sind Sportwissenschaftler auf das Gebiet der modernen Genforschung vorgedrungen. Dieses Buch ist mein Versuch, ihre Wege nachzuzeichnen und gesichertes wie umstrittenes Wissen über die angeborenen Begabungen von Spitzensportlern zusammenzutragen.
Schon in der Highschool habe ich mich gefragt, ob Micheno und die anderen Kinder aus jamaikanischen Familien, die unser Team so erfolgreich machten, möglicherweise ein besonderes Geschwindigkeitsgen von ihrer winzigen Insel mitgebracht hatten. Im College hatte ich die Gelegenheit, gegen Kenianer anzutreten, und fragte mich, ob Ausdauergene die Reise aus Ostafrika mitgemacht hatten. Gleichzeitig fiel mir auf, dass sich fünf Teamkameraden, die Tag für Tag, Schritt für Schritt miteinander trainierten, dennoch zu fünf völlig verschiedenen Läufern entwickelten. Wie konnte das sein?
Nach dem Ende meiner College-Läuferkarriere studierte ich Naturwissenschaften und schrieb später für die Sports Illustrated. Bei der Recherche und der Niederschrift dieses Buches hatte ich die Möglichkeit, meine sportlichen und wissenschaftlichen Interessen, die ich immer getrennt gesehen hatte, in der Petrischale des Spitzensports zu vermischen.
Die Buchrecherchen führten mich jenseits des Äquators und des Polarkreises und brachten mich in Kontakt mit Weltmeistern und Olympiasiegern, aber auch mit Tieren und Menschen, deren seltene Genmutationen oder außergewöhnliche körperliche Eigenschaften einen drastischen Einfluss auf die körperliche Leistung haben. Unterwegs erfuhr ich, dass Charaktereigenschaften wie beispielsweise die Trainingsmotivation, die ich für eine Frage des Willens hielt, tatsächlich in großem Maße genetisch bestimmt sind, während andere vermeintlich angeborene Eigenschaften wie die blitzschnelle Reaktionsfähigkeit eines Baseball- oder Cricket-Schlagmanns womöglich gar nicht erblich bedingt sind.
Beginnen wir doch gleich damit.
1
Gefährliche Mädchenbälle
Wie man Können ohne Gene erklärt
Das American-League-Team lag weit zurück, und für das National-League-Team trat gerade Schlagmann Mike Piazza an. Also holte man die Geheimwaffe aufs Feld.
Jennie Finch schlenderte an einer Phalanx der weltbesten Batter vorbei auf das sonnenbeschienene Infield. Ihr flachsfarbenes Haar strahlte im klaren Wüstenlicht. Seit vierundzwanzig Jahren war das Pepsi All-Star-Softballspiel ein Ereignis, an dem nur Baseballspieler der Major League teilnahmen. Die Menge brummte vor Aufregung, als die 1,85 Meter große Spitzenpitcherin der Softball-Nationalmannschaft den Pitcher-Hügel erreichte und ihre Finger um den Ball legte.
Es war ein milder Tag im kalifornischen Cathedral City; 21 Grad warme Luft füllte die hiesige Nachbildung des Wrigley Field der Chicago Cubs, einer der uramerikanischen Sportkathedralen. Die Replik in Dreiviertel der Originalgröße glich dem Original bis hin zu den mit Efeu bedeckten Mauern. Sogar die geziegelten Wohnhäuser der Chicagoer Nachbarschaft waren dort in der Wüste am Fuße der Santa Rosa Mountains präsent, auf beinahe lebensgroß ausgedruckten Originalfotos.
Finch, die in wenigen Monaten bei den Olympischen Spielen 2004 eine Goldmedaille gewinnen sollte, war ursprünglich nur als Mitglied des Trainerstabs der American League eingeladen worden. Das änderte sich, als die Stars der American League im fünften Inning mit 9:1 in Rückstand gerieten.
Kaum war Finch auf dem Mound angekommen, machten es sich die Defensivspieler hinter ihr gemütlich. Der Yankees-Infielder Aaron Boone zog seinen Handschuh aus und legte sich hin, wobei er die zweite Base als Kissen benutzte. Hank Blalock von den Texas Rangers nutzte die Gelegenheit für ein Schlückchen Wasser. Immerhin hatten sie Finch während des Schlagtrainings pitchen gesehen.
Im Rahmen der Feierlichkeiten vor dem Spiel hatte eine Reihe von Major-League-Stars ihre Fähigkeiten gegen Finchs Unterhandgranaten getestet. Finchs Würfe kommen aus einer Entfernung von 13 Metern und erreichen Geschwindigkeiten von annähernd 110 km/h. So benötigt der Ball ungefähr die gleiche Zeit bis zur Home Plate wie ein 150 km/h schneller Fastball vom 18 Meter entfernten regulären Pitcher-Hügel. Ein solcher Fastball ist zwar schnell, aber für Profi-Baseballer auch Routine. Zudem ist ein Softball größer und sollte daher leichter zu treffen sein.
Trotzdem ließ Finch die Bälle mit jedem Windmühlenschwung ihres Armes an den verdutzten Männern vorbeisausen. Als Albert Pujols, der größte Batter einer ganzen Generation, beim Aufwärmtraining Finch gegenübertrat, drängten sich die anderen Starspieler gaffend um ihn herum. Nervös richtete Finch ihren Pferdeschwanz. Ein breites Lächeln huschte über ihr Gesicht. Freude durchströmte sie, aber auch die Sorge, dass Pujols ihren Wurf mit einem Line Drive erwidern könnte. Über seiner breiten Brust baumelte eine silberne Kette, seine Unterarme waren so breit wie der Kopf des Schlägers. »Na dann«, sagte Pujols leise und signalisierte damit seine Bereitschaft. Finch schwankte erst nach hinten, dann nach vorne und peitschte dabei den Wurfarm in weitem Bogen. Zunächst feuerte sie einen hohen Pitch ab. Bei dem Anblick taumelte Pujols erschrocken zurück. Finch kicherte.
Sie ließ einen weiteren Fastball folgen, der diesmal hoch und innenseitig ankam. Pujols wirbelte defensiv herum und drehte den Kopf weg. Hinter ihm lachten seine Kollegen laut auf. Pujols trat aus seiner Position heraus, fasste sich und nahm seinen Platz wieder ein. Er scharrte mit den Füßen, bis er sicher stand, und starrte Finch an. Der nächste Pitch ging ab durch die Mitte. Pujols wirbelte ihm einen mächtigen Schwung entgegen, aber der Ball segelte am Schläger vorbei und die Zuschauer johlten. Der nächste Wurf war weit außen und Pujols ließ ihn vorbeifliegen. Mit dem darauffolgenden erzielte Finch wieder einen Strike, während Pujols nur leere Luft traf. Für den verbleibenden Pitch rückte Pujols ganz nach hinten in die Batter’s Box und duckte sich tief.
Finch schwang erst nach hinten, dann nach vorne und feuerte. Pujols schlug weit daneben. Er wandte sich ab und ging zu seinen kichernden Kameraden. Dann blieb er verwirrt stehen. Pujols wandte sich wieder Finch zu, zog vor ihr die Mütze und setzte seinen Weg fort. »So etwas will ich nie wieder erleben«, schwor er später.
Die Abwehrspieler hinter Finch hatten also gute Gründe, es sich auf dem Spielfeld bequem zu machen, sobald sie ins Spiel kam: Sie wussten, dass es keine Hits geben würde. Und wie beim Aufwärmtraining bezwang Finch die beiden Batter, gegen die sie antrat. Piazza schwang an drei schnurgeraden Würfen vorbei. Brian Giles, ein Outfielder der San Diego Padres, verfehlte den dritten Strike so sehr, dass ihn sein Schwung in eine Pirouette zog. Anschließend beschränkte sich Finch wieder auf ihre Rolle als Ehrencoach. Aber dies sollte nicht das letzte Mal sein, dass sie Major Leaguer demütigte.
In den Jahren 2004 und 2005 trat Finch regelmäßig in einer Baseballsendung beim Fernsehsender Fox auf. In den Einspielern reiste sie zu den Trainingslagern der Major League und ließ die besten Baseballer der Welt wie Stümper aussehen.
»Die Mädels treffen solche Bälle?«, staunte Mike Cameron, Outfielder der Seattle Mariners, nachdem er einen Pitch um eine gute Handbreit verfehlt hatte. Nachdem der siebenfach als bester Spieler ausgezeichnete Barry Bonds Finch beim All-Star-Spiel der Major League gesehen hatte, drängte er sich durch die Reporter, um sie in einen Trashtalk zu verwickeln.
»Also, Barry, wann krieg ich’s endlich mit dem Besten zu tun?«, fragte Finch.
»Wann du willst«, antwortete Bonds zuversichtlich. »Du hast dich mit den ganzen Zwergen abgegeben … Jetzt musst du dich mal dem Besten stellen. Du siehst gut aus und hast es drauf, da kannst du doch keinen Mann abweisen, der auch gut aussieht und es drauf hat«, sagte Bonds, um sie gleichzeitig anzubaggern und einzuschüchtern. Dann riet er ihr noch, ein Schutznetz mitzubringen, falls sie sich an ihn herantraute, denn »das wirst du brauchen … Ich treffe nämlich«.
»An meinen Ball ist bisher nur einer rangekommen«, erwiderte Finch.
»Rangekommen?«, fragte Bonds lachend. »Wenn der Ball über die Plate kommt, dann komm ich ran, das kannst du mal glauben. Dann komm ich ran, aber wie.«
»Meine Leute melden sich bei deinen Leuten und dann machen wir was aus«, sagte Finch.
»Oh, das ist schon ausgemacht! Ruf einfach mich an, Mädchen«, sagte Bonds. »Ich nehme Herausforderungen gerne persönlich an … Wir senden das Ganze, im nationalen Fernsehen. Ich will, dass die Welt zusieht, dass alle es sehen.«
Also reiste Finch zu einem Treffen mit Bonds – diesmal ohne Fans und Reporter –, und sein spöttischer Ton verging ihm schnell. Bonds sah Pitch um Pitch vorbeisausen und bestand darauf, dass die Kameras ihn nicht aufnahmen. Finch schoss einen Pitch nach dem anderen an Bonds vorbei und seine anwesenden Teamkameraden deklarierten sie sämtlich als Strikes.
»Der gilt aber als Ball!«, quengelte Bonds, worauf einer seiner Kameraden antwortete: »Barry, hier sind zwölf Schiedsrichter.« Bonds ließ Dutzende von Strikes an sich vorbeiziehen, ohne auch nur den Schläger zu schwingen. Erst als Finch ihm ankündigte, wie sie den Ball werfen würde, erwischte er einen läppischen Foul Ball, der ein paar Meter weit rollte und liegenblieb. Bonds flehte Finch an: »Mach weiter, wirf noch einen.« Sie tat es – und schmiss an ihm vorbei.
Als Finch in der Folge auf Alex Rodriguez traf, den amtierenden Spieler der Saison, schaute Rodriguez ihr über die Schulter, während sie sich mit einem Catcher aus seinem Team aufwärmte. Der Catcher vermasselte drei der ersten fünf Würfe. Als Rodriguez das sah, weigerte er sich zu Finchs Enttäuschung schlichtweg, die Batter’s Box zu betreten. Er beugte sich zu ihr und raunte ihr zu: »Mich macht man nicht zum Affen.«
Seit vier Jahrzehnten versuchen sich Wissenschaftler ein Bild davon zu machen, wie Spitzensportler schnelle Objekte treffen können.
Eine intuitive Erklärung wäre, dass die Albert Pujolses und Roger Federers der Welt genetisch mit schnelleren Reflexen gesegnet sind und daher mehr Zeit haben, um auf den Ball zu reagieren. Allerdings stimmt das nicht.
Testet man Menschen auf ihre »einfache Reaktionszeit« – wie schnell sie auf ein Lichtsignal hin einen Knopf drücken können –, brauchen die meisten von ihnen, egal ob Lehrer, Anwalt oder Profisportler, ungefähr 200 Millisekunden oder eine fünftel Sekunde. Eine fünftel Sekunde entspricht in etwa der Mindestzeit, die eine Information braucht, um von der Netzhaut an der Rückwand des menschlichen Auges über zahlreiche Synapsen – den Lücken zwischen Nervenzellen, deren Querung jeweils einige Millisekunden dauert – zum primären visuellen Kortex im hinteren Teil des Gehirns zu gelangen und vom Gehirn aus als Signal ins Rückenmark übermittelt zu werden, von wo aus die Muskeln in Bewegung gesetzt werden. All dies geschieht so schnell wie ein Blinzeln. (Bei blendendem Licht dauert es schon 150 Millisekunden, bis die Augen zugekniffen werden.) Aber so schnell eine Reaktionszeit von 200 Millisekunden auch ist, angesichts von 160-km/h-Würfen und 200-km/h-Tennis-Aufschlägen ist das viel zu langsam.
Allein in den 75 Millisekunden, die die Sinneszellen in der Netzhaut benötigen, um einen Baseball im Sichtfeld wahrzunehmen und seine Flugbahn und Geschwindigkeit für die Weiterleitung ans Gehirn zu bestimmen, legt ein typischer Fastball im Profibaseball rund drei Meter zurück.
Der gesamte Flug des Baseballs von der Hand des Pitchers bis zur Plate dauert nur 400 Millisekunden. Und weil allein die Hälfte dieser Zeit für das Auslösen der Muskelaktion gebraucht wird, muss ein Batter in der Major League schon kurz, nachdem der Ball die Hand des Pitchers verlassen hat und lange bevor er überhaupt auf halbem Weg zur Plate ist, entscheiden, wohin der Schläger zu schwingen ist. Das Zeitfenster, in dem der Ball in Reichweite des Schlägers ist und überhaupt getroffen werden kann, misst 5 Millisekunden, und weil sich der Winkel, aus dem der Batter den Ball sieht, in Nähe der Plate so schnell ändert, ist der Ratschlag, den Ball im Auge zu behalten (keep your eye on the ball) buchstäblich unmöglich zu befolgen. Das Sehorgan des Menschen ist einfach nicht schnell genug ist, um den Ball in seiner ganzen Bahn zu verfolgen. Ein Batter könnte daher genauso gut die Augen schließen, wenn der Ball auf halbem Weg zur Homeplate ist. Angesichts der Wurfgeschwindigkeit und unserer biologischen Grenzen ist es eigentlich ein Wunder, dass überhaupt jemand irgendwelche Bälle trifft.
Dennoch erkennen und bewältigen Albert Pujols und seine All-Star-Kollegen 160-Sachen-Fastballs und verdienen damit sogar ihre Brötchen. Wieso verwandeln sie sich dann in Amateure, sobald sie mit 100 km/h lahmen Softballs konfrontiert werden? Der Grund ist, dass man einen Ball mit derart hoher Geschwindigkeit nur treffen kann, indem man in die Zukunft blickt, und wenn ein Baseball-Batter einer Softball-Pitcherin gegenübersteht, ist ihm der Blick in seine Kristallkugel verwehrt.
Vor fast vierzig Jahren, bevor Janet Starkes eine der einflussreichsten Sportforscherinnen der Welt wurde, war sie eine 1,57 Meter große Aufbauspielerin, die eine Saison in der kanadischen Basketball-Nationalmannschaft verbrachte. Ihren bleibenden Einfluss auf den Sport übte sie jedoch außerhalb des Spielfelds aus, nämlich mit ihrer Arbeit als Doktorandin an der Universität von Waterloo. Ihr Forschungsziel war es, herauszufinden, warum gute Sportler, nun ja, gut sind.
Tests an der »Hardware« – den angeborenen Körpereigenschaften von Sportlern, beispielsweise der einfachen Reaktionszeit – hatten erstaunlich wenig dazu beigetragen, sportliche Spitzenleistungen zu erklären. Die Reaktionszeiten von Spitzensportlern lagen immer um eine fünftel Sekunde herum, genau wie die Reaktionszeiten von zufällig ausgewählten Testpersonen.
Also suchte Starkes woanders nach der Antwort. Sie hatte von Untersuchungen an Fluglotsen gehört, bei denen man mithilfe von »Signalerkennungstests« gemessen hatte, wie schnell ein erfahrener Fluglotse visuelle Informationen durchkämmte, um das Vorhandensein oder Fehlen entscheidender Signale festzustellen. Und sie entschied, dass sich eine solche Untersuchung durch Übung erlernter kognitiver Wahrnehmungsfähigkeiten als lohnend erweisen könnte. Also erfand Starkes 1975 im Rahmen ihrer Abschlussarbeit für Waterloo den modernen »Okklusionstest«.
Sie sammelte Tausende von Fotos aus Frauen-Volleyballspielen und fertigte Dias von Bildern an, auf denen sich der Volleyball im Bild befand oder den Bildbereich gerade verlassen hatte. Auf vielen Fotos waren die körperliche Haltung und Dynamik der Spielerinnen nahezu identisch, egal ob der Ball im Bild war oder nicht, da sich seit dem Moment, in dem der Ball das Bild verließ, kaum etwas geändert hatte.
Starkes baute dann ein Spektiv vor einer Leinwand mit Diaprojektor auf und ließ Volleyballerinnen die Dias einen Sekundenbruchteil lang betrachten und anschließend raten, ob sich der Ball im aufblitzenden Bild befand oder nicht. Die Blickdauer war zu kurz, als dass die Betrachterinnen den Ball tatsächlich hätten sehen können. So sollte festgestellt werden, ob die Spielerinnen das gesamte Spielfeld und die Körpersprache der anderen anders wahrnehmen als ein Durchschnittsmensch und ob sie dadurch auf das Vorhandensein des Balles schließen.
Die Ergebnisse der ersten Okklusionstests verblüfften Starkes. Anders als bei den Untersuchungen der Reaktionszeiten war der Unterschied zwischen Spitzensportlern und Anfängern enorm. Den Elite-Spielerinnen genügte ein Sekundenbruchteil, um festzustellen, ob der Ball vorhanden war. Und je besser die Spielerin, desto schneller konnte sie jedem Dia relevante Informationen entnehmen.
Einmal testete Starkes Mitglieder der kanadischen Volleyball-Nationalmannschaft, zu der zu dieser Zeit eine der besten Stellerinnen der Welt gehörte. Anhand eines Bildes, das nur eine Sechzehntausendstelsekunde lang vor ihren Augen aufblitzte, konnte die Stellerin ableiten, ob der Volleyball vorhanden war. »Das ist eine erstaunliche Leistung«, versicherte mir Starkes. »Leute, die nicht Volleyball spielen, erkennen in sechzehn Millisekunden nur einen Lichtblitz.«
Die Weltklasse-Stellerin erkannte innerhalb von sechzehn Millisekunden nicht nur das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Balls, sondern erspähte mitunter genug visuelle Informationen, um zu wissen, wann und wo das Bild aufgenommen wurde. »Nach jedem Dia bestätigte sie mit ›ja‹ oder ›nein‹, ob da ein Ball war«, berichtet Starkes, »und dann sagte sie manchmal noch: ›Das war das Sherbrooke-Team, nachdem sie ihre neuen Trikots bekommen hatten, also muss das Bild zu dem und dem Zeitpunkt aufgenommen worden sein.‹« Was für die eine Frau ein Lichtblitz war, erzählte der anderen eine ganze Geschichte. Dies war ein deutlicher Hinweis darauf, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen erfahrenen und unerfahrenen Sportlerinnen nicht in ihrer schieren Reaktionsfähigkeit bestand, sondern darin, dass sie gelernt hatten, das Spiel wahrzunehmen.
Kurz nach ihrer Promotion wurde Starkes in die Fakultät der McMaster University aufgenommen und setzte ihre Okklusionsforschungen an der kanadischen Feldhockey-Nationalmannschaft fort. Zu dieser Zeit bestand die Lehrmeinung im Feldhockey aus der Überzeugung, dass angeborene Reflexe von vorrangiger Bedeutung seien. Umgekehrt war damals die Vorstellung, zur spielerischen Spitzenleistung gehörten erlernte Wahrnehmungsfähigkeiten, in Starkes’ Worten »Ketzerei«.
1979, als Starkes der kanadischen Feldhockey-Nationalmannschaft bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1980 half, war sie bestürzt darüber, dass sich die Nationaltrainer bei der Aufstellung der Mannschaft auf veraltete Ideen stützten. »Sie glaubten, alle würden das Spielfeld auf die gleiche Weise sehen«, sagt sie. »Sie setzten bei der Auswahl auf einfache Reaktionszeittests und meinten, das sei ein Indikator dafür, wer die besten Torhüterinen oder Stürmerinnen sein würden. Zu meinem Erstaunen war ihnen nicht klar, dass die reine Reaktionszeit möglicherweise gar nichts bedeutet.«
Starkes wusste es besser. Bei ihren Okklusionstests an Feldhockeyspielerinnen stellte sie genau das fest, was sie bei Volleyballerinnen herausgefunden hatte, und noch viel mehr. Elite-Feldhockeyspielerinnen konnten nicht nur mit weniger als einem Augenblick erkennen, ob sich ein Ball im Bild befand, sondern auch nach einem flüchtigen Blick das ganze Spielfeld genau rekonstruieren. Dies bestätigte sich bei Basketball und Football. Es war, als hätte auf wundersame Weise jede Spitzensportlerin ein fotografisches Gedächtnis, wenn es um ihren Sport ging. Die nächste Frage ist also, wie wichtig solche Wahrnehmungsfähigkeiten für Spitzensportler sind und ob sie das Ergebnis genetischer Veranlagung darstellen.
Eine Antwort darauf ließe sich nirgendwo besser finden als bei einer Art von Wettkampf, bei der die Spielzüge langsam und wohlbedacht sind und nicht von Muskeln oder Sehnen abhängen.
In den frühen 1940er-Jahren begann der niederländische Schachmeister und Psychologe Adriaan de Groot damit, dem Kern des Schachkönnens auf den Grund zu gehen. De Groot untersuchte Schachspieler unterschiedlicher Spielstärken, um herauszufinden, was einen Großmeister vom durchschnittlichen Profispieler und einen Profi vom Vereinsspieler abhob.
Nach damaligem Wissensstand dachten hoch qualifizierte Schachspieler weiter voraus als weniger qualifizierte Spieler. Dies trifft auch tatsächlich zu, wenn man erfahrene Spieler mit blutigen Anfängern vergleicht. Als de Groot jedoch Großmeister ebenso wie starke Spieler ihre Entscheidungsfindung in einer ungewohnten Spielsituation erläutern ließ, stellte er fest, dass Spieler trotz unterschiedlicher Spielstärke über gleich viele Schachfiguren nachdachten und im Wesentlichen die gleiche Anzahl möglicher Züge erwogen. Warum, fragte er sich, machten Großmeister dann die besseren Züge?
De Groot stellte eine Gruppe von vier Schachspielern als Vertreter unterschiedlicher Spielstärken zusammen: ein Groß- und Weltmeister; ein Meister; ein Stadtchampion; und ein durchschnittlicher Vereinsspieler.
Dann beauftragte de Groot einen weiteren Schachmeister damit, verschiedene Schachpositionen aus obskuren Spielen auszuwählen, und damit unternahm er dann etwas ganz Ähnliches wie Starkes dreißig Jahre später bei ihren Sportlerinnen: Er ließ die Schachbretter für einige Sekunden vor den Spielern aufblitzen und bat diese dann, die Spielsituation auf einem leeren Brett zu rekonstruieren. Es stellten sich Unterschiede zwischen den Fähigkeiten heraus, insbesondere zwischen den beiden Meistern und den beiden Nichtmeistern, die »so groß und eindeutig waren, dass sich weitere Nachweise im Grunde erübrigten«, wie de Groot schrieb.
In vier Versuchen rekonstruierte der Großmeister das komplette Brett, nachdem er es drei Sekunden lang betrachtet hatte. Der Meister vollbrachte das gleiche Kunststück zweimal. Keiner der schwächeren Spieler war in der Lage, auch nur ein Brett vollkommen korrekt zu reproduzieren. In sämtlichen Tests platzierten der Großmeister und der Meister mehr als 90 Prozent der Figuren korrekt, während der Stadtmeister rund 70 Prozent und der Vereinsspieler nur etwa 50 Prozent schafften. In fünf Sekunden durchschaute der Großmeister die Spielsituation besser als der Clubspieler in fünfzehn Minuten. Diese Tests legten dar, »dass Erfahrung die Grundlage für die überragenden Leistungen von Schachmeistern ist«, so de Groot. Aber es sollte noch drei Jahrzehnte dauern, bis jemand nachwies, dass es sich bei de Groots Beobachtungen tatsächlich um erworbene Fähigkeiten handelte und nicht um das Produkt einer angeborenen übermenschlichen Merkfähigkeit.
In einer 1973 veröffentlichten wegweisenden Studie wiederholten die Psychologen William G. Chase und Herbert A. Simon – ein späterer Nobelpreisträger – das Experiment von de Groot und fügten eine Besonderheit hinzu: Sie testeten das Erinnerungsvermögen der Spieler an Schachbretter mit zufällig angeordneten Stellungen, wie sie in einem Spiel niemals vorkommen würden. Als die Spieler fünf Sekunden Zeit hatten, um die zufälligen Figurenkonstellationen zu studieren, und sie dann rekonstruieren sollten, verschwand der Vorsprung der Meister. Plötzlich entsprach ihr Erinnerungsvermögen dem von durchschnittlichen Spielern.
Um ihre Beobachtungen zu erklären, postulierten Chase und Simon eine Theorie des »Stückelns« (chunking), die für das Verständnis von Spielen wie Schach, aber auch von anderen Sportarten wichtig wurde, und die die Erkenntnisse aus Janet Starkes’ Forschungsarbeit an Feldhockey- und Volleyballspielerinnen erklären half.
Schachmeister und Spitzensportler stückeln die Informationen auf dem Spielbrett oder Spielfeld. Mit anderen Worten: Anstatt sich mit einer großen Detailfülle auseinanderzusetzen, gruppieren Fortgeschrittene die Informationen unbewusst in wenige aussagekräftige Stückelungen, wobei sie von bereits bekannten Mustern ausgehen. Während sich der durchschnittliche Vereinsspieler in de Groots Studie an die Anordnung von zwanzig einzelnen Schachfiguren zu erinnern versuchte, musste sich der Großmeister nur ein paar Gruppierungen von jeweils mehreren Figuren merken, da die Beziehungen zwischen den Figuren für ihn eine große Bedeutung hatten.1
Großmeister sprechen fließend Schach und verfügen über eine mentale Datenbank mit Millionen von Figurenkonstellationen, aufgeteilt in mindestens 300.000 sinnhafte Stückelungen, die wiederum zu mentalen templates, großen Arrangements von Figuren (oder Spielern im Fall von Feldsportarten) gruppiert sind, innerhalb derer manche Elemente bewegt werden können, ohne dass das gesamte Arrangement unkenntlich wird. Wo Anfänger von neuen, chaotischen Informationen überfordert werden, erkennen Meister vertraute Ordnungen und Strukturen mit leicht auffindbaren Informationen, die die anstehende Entscheidung erleichtern.
»Was anfangs durch langsames, bewusstes, deduktives Denken erreicht wird, wird nun durch schnelle, unbewusste Signalverarbeitung erreicht«, so Chase und Simon. »Es ist keine Übertreibung, wenn ein Schachmeister behauptet, er ›sehe‹ den richtigen Zug.«
Forschungen, bei denen man die Augenbewegungen erfahrener Performer aufzeichnete – seien es Schachspieler, Pianisten, Chirurgen oder Sportler –, haben ergeben, dass Experten mit zunehmender Erfahrung visuelle Informationen umso schneller sichten und die Spreu vom Weizen trennen können. Experten lenken ihre Aufmerksamkeit schnell von irrelevantem Input weg und richten sie auf die Daten, anhand derer sie am besten entscheiden können, was als Nächstes zu tun ist. Während sich Anfänger mit einzelnen Figuren oder Spielern befassen, konzentrieren sich Experten mehr auf die Zwischenräume zwischen Figuren oder Spielern, die für die Verbindung der einzelnen Teile im Ganzen wesentlich sind.
Vor allem im Sport ist es wichtig, dass Ordnungen wahrgenommen werden, denn aus der Anordnung der Spieler oder aus subtilen Änderungen der Körperbewegungen eines Gegners können erfahrene Athleten entscheidende Informationen gewinnen, um unbewusst Vorhersagen darüber zu treffen, was als Nächstes passieren wird.
Ende der 1970er-Jahre war Bruce Abernethy Student an der University of Queensland. Als begeisterter Cricketspieler begann er, die Okklusionsmethoden von Janet Starkes zu erweitern. Abernethy nahm mit einer Super-8-Kamera Filme von Cricket-Bowlern auf. Das Filmmaterial führte er dann Battern vor, schnitt es aber vor dem Wurf ab und ließ sie vorhersagen, wohin der Ball fliegen würde. Es überrascht kaum, dass erfahrene Spieler die Flugbahn des Balls besser vorhersagen konnten als unerfahrene Spieler.
In den Jahrzehnten danach hat Abernethy, der heute stellvertretender Dekan für Forschung in Queensland ist, Okklusionstests immer raffinierter eingesetzt, um die Wirkungen von Wahrnehmungsfähigkeiten im Sport zu ergründen. Abernethy hat seine Studien vom Videobildschirm auf das Spielfeld und den Tennisplatz verlagert. Er hat Tennisspieler mit einer Brille ausgestattet, die undurchsichtig wird, kurz bevor der Gegner den Ball schlägt. Cricket-Battern hat er Kontaktlinsen mit unterschiedlichen Unschärfegraden verpasst.
Der Tenor von Abernethys Forschungsergebnissen lautet, dass Spitzensportler weniger Zeit und weniger visuelle Informationen benötigen, um zu wissen, was in der unmittelbaren Zukunft passieren wird, und dass sie wie erfahrene Schachspieler unbewusst auf entscheidende visuelle Informationen zugreifen. Elite-Athleten stückeln Informationen über Körperhaltungen und Spielerstellungen so, wie es Schachgroßmeister mit Türmen und Läufern tun.
»Wir haben erfahrene Cricketspieler getestet und ihnen nur den Ball, die Hand und den Unterarm gezeigt, und sie waren trotzdem besser als bei zufälligem Raten«, berichtet Abernethy. »Es wirkt bizarr, aber es stecken wichtige Informationen in der Hand- und Armhaltung, aus denen Topspieler entscheidende Hinweise gewinnen können.«
Top-Tennisspieler, so Abernethy, können an winzigen Haltungsänderungen des gegnerischen Oberkörpers vor dem Aufschlag erkennen, ob der Ball an ihre Vorhand oder Rückhand geht, während durchschnittliche Spieler dafür erst die Bewegung des Schlägers sehen müssen, was wertvolle Reaktionszeit kostet. (Als Abernethy beim Badminton den Schläger und den gesamten Unterarm verbarg, wurden Elite-Spieler wieder zu Anfängern – ein Hinweis darauf, dass die Stellung des Unterarms bei dieser Sportart von entscheidender Bedeutung ist.)
Profiboxer besitzen eine ähnliche Fähigkeit. Vierzig Millisekunden brauchte eine Gerade von Muhammad Ali, um das 50 Zentimeter entfernte Gesicht seines Gegenübers zu erreichen. Hätten sie keine Voraussagen anhand von Alis Körperbewegungen getroffen, wären Alis Gegner in der ersten Runde erledigt gewesen, da sie jeden einzelnen Schlag eingesteckt hätten. (Ali wusste die Flugbahn seiner Schläge so zu verbergen, dass seine Gegner sie schlechter voraussagen konnten und ohnehin ein paar Runden später erledigt waren.)
Sogar scheinbar rein instinktive Fähigkeiten – etwa der Rebound-Sprung nach einem missglückten Korbwurf beim Basketball – basieren auf erlerntem Wahrnehmungswissen und abgespeicherten Kenntnissen darüber, wie feinste Haltungsänderungen des Werfers die Flugbahn des Balls beeinflussen. Diese Kenntnisse bilden eine Datenbank, die nur durch diszipliniertes Üben entsteht.2
Ohne jene Datenbank ergeht es Sportlern wie einem Schachmeister vor einem zufällig aufgestellten Brett oder wie Albert Pujols vor Jennie Finch – ihnen fehlen die Informationen, anhand derer sie in die Zukunft sehen können.3 Da Pujols keine mentale Datenbank mit Finchs Körperbewegungen und Wurftendenzen hatte und nicht einmal mit den Spin-Eigenschaften eines Softballs vertraut war, blieb ihm nichts übrig, als jedes Mal im letzten Moment zu reagieren. Und Pujols einfache Reaktionsschnelligkeit ist stinknormal.
Als Wissenschaftler der Washington University in St. Louis ihn testeten, lag Pujols, der größte Schlagmann einer ganzen Ära, bei der einfachen Reaktionszeit im Vergleich mit einer Stichprobe von College-Studenten im 66. Perzentil.
Niemand wird mit der Fähigkeit zur Antizipation geboren, die ein Spitzensportler benötigt. Als Abernethy die Augenbewegungen von Badmintonspielern unterschiedlicher Leistungsklassen untersuchte, stellte er fest, dass Anfänger zwar den richtigen Bereich des gegnerischen Körpers beobachten, aber einfach nicht über die kognitive Datenbank verfügen, die zur Informationsgewinnung erforderlich ist.
»Wenn sie die hätten«, meint Abernethy, »wäre es verdammt viel einfacher, Sportler im Training auf Profiniveau zu bringen. Man könnte ihnen einfach sagen: ›Guck auf den Arm.‹ Oder bei Baseball-Battern wäre dann der richtige Tipp nicht: ›Ball im Auge behalten‹, sondern ›Schulter im Auge behalten.‹ Aber wenn man ihnen das sagt, werden gute Spieler tatsächlich eher schlechter.«
Wenn jemand eine Fertigkeit übt, sei es Schlagen, Werfen oder Autofahren, werden die mentalen Prozesse, die bei der Ausführung der Fertigkeit beteiligt sind, von den im Frontallappen liegenden bewussteren Bereichen des Gehirns nach hinten in die primitiveren Bereiche verschoben, wo automatisierte Prozesse und Fähigkeiten gesteuert werden, die man »ohne nachzudenken« ausführt.
Im Sport ist die Hirnautomatisierung sehr genau auf die ausgeübte Fertigkeit abgestimmt – so genau, dass in Untersuchungen mit bildgebenden Verfahren bei Sportlern, die eine spezifische Disziplin trainieren, die Hirnaktivität im Frontallappen nur dann nachlässt, wenn diese besondere Disziplin ausgeübt wird. Setzt man Läufer auf Fahrräder oder Armfahrräder (bei denen die Pedale mit den Händen statt mit den Füßen bewegt werden), ist die Aktivität des Frontallappens stärker als beim Laufen, obwohl das Radfahren oder Kurbeln nicht viel bewusstes Nachdenken erfordern sollte.
Eine körperliche Aktivität, die man trainiert, wird im Gehirn sehr spezifisch automatisiert. Um zu Abernethys Punkt zurückzukehren: Das »Nachdenken« über eine Bewegung verrät beim Sport den Anfänger und es ist ein Trick, um einen Könner wieder in einen Amateur zu verwandeln. (Sian Beilock, Psychologin an der University of Chicago, hat gezeigt, dass Golfer ihre durch Leistungsdruck hervorgerufene Lähmung beim Putten – sie nennt sie »Paralyse durch Analyse« – überwinden können, indem sie singen und so die bewussten Bereiche des Gehirns beschäftigt halten.)
Stückelung und Automatisierung sind Gefährten auf dem Weg zur Könnerschaft. Nur durch das Erkennen von Körpersignalen und -mustern mit der Schnelligkeit unbewusster Prozesse kann Albert Pujols, kaum dass der Ball die Hand des Werfers verlassen hat, entscheiden, ob er nach dem Ball schlagen soll. Gleiches gilt für Quarterback Peyton Manning. Er kann angesichts stürmender Linebacker nicht innehalten und die defensiven Aufstellungen und Muster bewusst durchgehen, die er in stunden- und jahrelangem Trainieren und Studieren von Spielaufnahmen abgespeichert hat. Er hat nur Sekunden, um das Spielfeld zu überblicken und zu werfen. Er ist ein Großmeister, der Blitzschach spielt, nur mit Linebackern und Safetys anstelle von Springern und Bauern. (Gleichzeitig verstellen die Defensivtrainer der NFL ihre Spieler so, dass das Schachbrett, das sie Manning vorführen, möglichst irreführend und chaotisch wirkt.)
Die Ergebnisse der Hochleistungsforschung von de Groot bis Abernethy können in einem Satz zusammengefasst werden, der bei meinen Gesprächen mit Psychologen, die Spitzenleistungen untersuchen, immer wieder erklang wie eine Schallplatte, die einen Sprung hat:
»Es liegt an der Software, nicht an der Hardware.«
Die sportspezifische Beobachtungsgabe, die den Könner vom Dilettanten trennt, wird durch Übung erlernt oder »heruntergeladen« (wie Software). Sie gehört nicht ab Werk zur menschlichen Maschine. Dieser Sachverhalt hat zur Entstehung der bekanntesten modernen Theorie der sportlichen Leistung beigetragen, einer Theorie, in der Gene nicht vorkommen.
Es begann mit Musikern.
Für eine Studie aus dem Jahr 1993 wandten sich drei Psychologen an die Westberliner Musikhochschule, die weithin den Ruf genoss, Weltklasse-Geiger hervorzubringen. Die Professoren halfen den Psychologen, die zehn »besten« Geigenstudenten zu identifizieren, die womöglich internationale Solisten werden würden; zehn Studenten, die »gut« waren und ihren Lebensunterhalt in einem Sinfonieorchester würden verdienen können; und zehn schwächere Schüler, die sie als »Musiklehrer« kategorisierten, weil dies ihre wahrscheinlichste Laufbahn sein würde.
Die Psychologen führten detaillierte Interviews mit allen dreißig Musikstudenten und es zeigten sich gewisse Ähnlichkeiten. Alle Musiker hatten mit etwa acht Jahren begonnen, systematischen Unterricht zu nehmen, und alle hatten ungefähr mit fünfzehn beschlossen, Musiker zu werden. Und trotz ihrer unterschiedlichen Spielstärke investierten die Geiger aller drei Gruppen satte 50,6 Wochenstunden in ihr musikalisches Fortkommen, wozu musiktheoretischer Unterricht ebenso gehörte wie Musik hören, üben und spielen.
Dann aber kam ein großer Unterschied ans Licht. Die Zeit, die die Geiger aus den beiden höheren Klassen alleine übten, betrug 24,3 Stunden pro Woche, verglichen mit 9,3 Stunden in der schwachen Gruppe. Es verwundert kaum, dass die Musiker das einsame Üben als den wichtigsten Aspekt ihrer Ausbildung sahen, obwohl es viel anstrengender war als Ensembleproben oder das Musizieren zum Vergnügen. Im Leben der Geiger aus den beiden oberen Gruppen schien sich alles um das Üben und die Erholung vom Üben zu drehen. Sie schliefen 60 Stunden pro Woche, anders als die Musiklehrergruppe mit ihren 54,6 Stunden Nachtruhe. Allerdings unterschieden sich die beiden oberen Gruppen nicht in der Übezeit.
Daher baten die Psychologen die Geiger, im Nachhinein zu schätzen, wie viel sie seit dem Tag, an dem sie mit dem Geigenspiel begannen, geübt hatten. Die besten Geiger hatten nach der ersten Begegnung mit dem Instrument die Zahl ihrer Überstunden nach kürzerer Zeit erhöht. Mit zwölf Jahren hatten sie einen Vorsprung von etwa 1.000 Stunden gegenüber den zukünftigen Musiklehrern. Und auch wenn die beiden besseren Gruppen im Musikstudium gleich viel Zeit mit der Pflege ihres Könnens verbrachten, hatten die zukünftigen Solisten im Alter von achtzehn Jahren durchschnittlich 7.410 Stunden Übungszeit angesammelt, verglichen mit 5.301 Stunden in der »guten« Gruppe und 3.420 Stunden bei den angehenden Lehrern. »Daher«, schreiben die Psychologen, »besteht eine klare Entsprechung zwischen dem Spielniveau der Gruppen und ihrer durchschnittlich angehäuften Übezeit mit der Geige.« Im Wesentlichen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass das, was man für angeborenes musikalisches Talent hält, eigentlich aus jahrelang akkumulierter Übung besteht.
Bemerkenswerterweise stellten die Psychologen fest, dass erfahrene Pianisten im Durchschnitt ähnlich viele Übestunden wie die besten Geiger angesammelt hatten, als ob es eine universelle Regel der Könnerschaft gäbe. Die Forscher schlossen aus den Schätzungen des wöchentlichen Übevolumens, dass Spitzenmusiker unabhängig vom Instrument bis zum Alter von zwanzig Jahren 10.000 Stunden Übung ansammeln, und dass gute Musiker eine größere Menge an »konzentriertem Üben«, schaffen, einer Art von anstrengendem Training, das die Kraftreserven des Schülers beansprucht. Einer Art von Üben, die oft allein betrieben wird.
In ihrem inzwischen berühmten Artikel The Role of Deliberate Practice in the Acquisition of Expert Performance dehnen die Autoren ihre Schlussfolgerungen auf den Sport aus und zitieren Janet Starkes’ Okklusionstests, die nachwiesen, dass erlernte Wahrnehmungsfähigkeiten wichtiger sind als reine Reaktionsschnelligkeit. Angesammelte Übestunden erschienen den Autoren zufolge sowohl in der Musik als auch im Sport als angeborenes Talent.
Der Hauptautor des Aufsatzes, der Psychologe K. Anders Ericsson, der inzwischen an der Florida State University lehrt, wird als der Vater der »10.000-Stunden-Regel« betrachtet, obwohl er selbst nie von einer »Regel« oder vom Deliberate Practice Framework gesprochen hat, wie es bei denjenigen bekannt ist, die sich mit dem Erlernen von Fähigkeiten befassen.
Ericsson gilt als Experte für Experten. Er und andere Befürworter des Frameworks gehen des Weiteren davon aus, dass hinter dem schönen Schein angeborener Begabung in Wirklichkeit angesammeltes Üben steckt, sei es beim Sprint oder bei der Chirurgie.
Als die Genetik an Bedeutung gewann, arbeitete Ericsson sie in seine Schriften ein. In einem Artikel aus dem Jahr 2009, Toward a Science of Exceptional Achievement, schreiben Ericsson und seine Mitautoren, dass die Gene, die einen Profisportler (oder jeden anderen Profi) ausmachen, »in der DNA jedes gesunden Menschen vorkommen«. So gesehen heben sich Könner durch ihre Übeerfahrung hervor, nicht durch ihre Gene. In den Medien wurde Ericssons Arbeit oft dahin gehend interpretiert, dass 10.000 Stunden sowohl notwendig als auch hinreichend sind, um irgendjemanden zu einem Könner in irgendeiner Sache machen. Niemand erreicht demnach Könnerschaft mit weniger Übung und mit ebendiesem Umfang erreicht sie jeder.
Die 10.000-Stunden-Regel (auch als Zehnjahresregel bezeichnet) fand den Weg auf die Backcover einiger Bestseller und in unzählige Artikel, bis sie sich tief in die Branche der Sportförderung einwurzelte und Anreiz gab, Kinder früh einem harten Training auszusetzen.
In manchen Fällen haben populärwissenschaftliche Autoren, die Ericssons Erkenntnisse verarbeiten, zusätzlich zu den durch Übung hervorgerufenen Leistungsdifferenzen auch individuelle genetische Unterschiede berücksichtigt, während andere die 10.000-Stunden-Regel als absolut starr darstellen und keinen Raum für genetisches Erbe sehen. Bei der Recherche für dieses Buch begegneten mir die 10.000 Stunden als Erfolgsrezept in den unterschiedlichsten Bereichen, in einem Interview mit einem Wissenschaftler des amerikanischen Olympischen Komitees ebenso wie im Jahresbericht eines Hedgefonds, der den Anlegern die Grundsätze des Erfolgs erläuterte. Ich habe sogar einen Golfer kennengelernt, der die Regel auf eine sehr persönliche Probe stellt.
2
Zwei Hochspringer
Oder: 10.000 Stunden mehr oder weniger
Am 27. Juni 2009, seinem dreißigsten Geburtstag, nahm sich Dan McLaughlin etwas Besonderes vor: seinen Job als Werbefotograf in Portland, Oregon, zu kündigen und professioneller Golfer zu werden. Seine Golferfahrung aus den letzten drei Jahrzehnten bestand aus zwei Besuchen auf einer Driving Range, in Kindertagen, mit seinem älteren Bruder. Bis auf ein bisschen Tennis in Jugendjahren und eine Saison im Laufteam der Highschool war McLaughlin nie Wettkampfsportler gewesen. Aber etwas musste sich ändern.
Nach seinem Abschluss in Journalistik an der University of Georgia im Jahr 2003 fotografierte er zwei Jahre lang für Zeitungen und arbeitete dann in verschiedenen Nischen der Werbung und Produktfotografie. Nach sechs Jahren Schreibtischjob, bei dem sich alles um Fotos von Dentaltechnik drehte, wollte McLaughlin etwas wagen, was seinem Sinn für Herausforderungen besser entsprach.
Zuerst hatte er an ein Aufbaustudium gedacht. Also sparte er genug Geld an, um ein BWL-Studium mit Finanzschwerpunkt zu beginnen. Aber gleich im ersten Kurs an der Portland State University, bei dem es um die Bedienung von Excel-Tabellen ging, merkte McLaughlin, dass ein BWL-Abschluss nicht die ersehnte Kursänderung war. Er überlegte, ob er Physician Assistant oder Architekt werden sollte, entschied dann jedoch, dass sein Neustart drastisch sein müsse.
McLaughlin hatte immer etwas Extremes an sich gehabt. Seine Vorstellung eines Winterurlaubs im Jahr 2006 war eine Reise nach Fidschi, wo gerade das Militär mit einem Putsch die Macht übernahm. Und doch ist McLaughlin in vielerlei Hinsicht der Jedermann. Er ist 1,75 Meter groß, wiegt 68 Kilo und ist »körperlich nicht besonders begabt«, wie er es ausdrückt. »Ich bin einfach ein ziemlicher Durchschnittstyp«, meint er, und sieht darin seine Stärke.
Seine Inspiration fand McLaughlin in dem, was er über Ericssons Arbeit in den Bestsellern Talent wird überschätzt von Geoff Colvin und Überflieger von Malcolm Gladwell gelesen hatte. Er erfuhr von der 10.000-Stunden-Regel, der »magischen Zahl der Hochleistung«, wie sie in Überflieger bezeichnet wird, und von der These, dass scheinbar angeborene Fähigkeiten oft nichts anderes sind als die Manifestation von Tausenden Stunden Übung.
Und so verzeichnete McLaughlin am 5. April 2010 seine ersten zwei Stunden konzentrierten Trainings mit dem Ziel, Profigolfer zu werden und an der PGA-Tour teilzunehmen. Sein Plan sieht vor, jede einzelne Stunde auf dem Weg zu insgesamt 10.000 zu protokollieren und zu beweisen, dass es »keinen Unterschied zwischen Profis und mir oder irgendjemandem gibt, nicht nur beim Golf, sondern in jedem Bereich. Wenn ich über zwei Meter groß wäre, würde das vielleicht nicht viele überzeugen, aber ich bin ein Normalo.«
McLaughlin sieht seinen Lernprozess – bis Ende 2012 waren 3.685 Stunden abgehakt – nicht als Werbegag, sondern als wissenschaftliches Experiment. Er engagierte einen PGA-zertifizierten Golftrainer und beriet sich mit Ericsson über seine Strategie. McLaughlin besteht darauf, nur die Übestunden zu zählen, die gemäß Ericssons Definition als wirklich konzentriert gelten. »Nach den Grundsätzen konzentrierten Übens muss man sich kognitiv anstrengen«, erklärt McLaughlin. Ein paar Stunden auf der Driving Range zu verbringen und Bälle zu kloppen, ohne auf Lerneffekt und Fehlerkorrektur zu achten, das reicht nicht. Deshalb übt McLaughlin an sechs Tagen in der Woche sechs Stunden lang voll konzentriert, wobei jeder Arbeitstag acht Stunden in Anspruch nimmt, denn McLaughlin legt häufig Pausen ein, um darüber nachzudenken, was er gut gemacht hat und was verbessert werden kann – etwa der Schlägerwinkel beim Auftreffen auf den Ball. Außerdem ist es ermüdend, stundenlang hoch konzentriert zu bleiben.
McLaughlin erlernt das Golfspiel von der Pike auf. Als ich ihn nach 1.776 Stunden Lernprozess zum ersten Mal spreche, hat er noch keinen Driver in die Hand genommen. »Ich bin erst beim Eisen 8«, sagt er, »also bewegt sich mein Spiel nur 130 Meter vom Loch.« Immer wenn McLaughlin mit seinem Eisen so etwas wie eine Runde spielen möchte, platziert er drei Bälle in unterschiedlichen Abständen vom Grün und spielt alle drei gleichzeitig. »Auf diese Weise«, sagt er, »kann ich auf nur neun Löchern siebenundzwanzig Löcher spielen.« Bei diesem Tempo hätte McLaughlin die 10.000 Stunden Ende 2016 erreicht. (Und dabei zählt er die Stunden, die er mit Krafttraining, Golftheorie oder seinem Ernährungsberater verbringt, nicht einmal mit.) McLaughlin ist zuversichtlich, dass er ein Profi wird, sobald er die magische Zahl erreicht. »Es gibt keine Garantie«, sagt er. »Ich kann auch einen Autounfall haben und morgen sterben. Aber mein oberstes Ziel ist es, es in die PGA-Tour zu schaffen.«
»Egal, was herauskommt«, fährt er fort, »für mich wird es ein Erfolg sein. Ich liebe das Spiel jeden Tag mehr. Als ich einen Vortrag bei einer Konferenz in Florida gehalten habe, habe ich mit Dr. Ericsson gefrühstückt, zu Mittag und zu Abend gegessen … Er fand es sehr interessant, zu sehen, wie es bei mir vorangeht, auch wenn ich nur eine Einzelperson bin. Er sagte, so lange habe er noch nie jemanden untersucht und konzentriertes Üben protokolliert.«
Niemand hat jemals eine solche Studie durchgeführt. Alle Daten, die die 10.000-Stunden-Regel stützen, stammen aus sogenannten Querschnitts- oder retrospektiven Studien. Dabei untersuchen Forscher Probanden, die bereits ein bestimmtes Qualifikationsniveau erreicht haben und bitten sie, ihre zurückliegenden Übungsstunden zu rekonstruieren.
Bei der ursprünglichen 10.000-Stunden-Studie handelte es sich bei den Probanden um Musiker, die bereits die Zulassung zu einer weltberühmten Musikhochschule geschafft hatten. Der größte Teil der Menschheit war damit von vornherein ausgeschlossen. Eine Studie, die sich nur auf ausgewählte Kandidaten beschränkt, ist hoffnungslos voreingenommen, wenn es darum geht, Beweise für angeborenes Talent zu finden. Eine »Längsschnittstudie« hingegen erfüllt einen viel höheren wissenschaftlichen Standard. Dabei verfolgt man, wie die Probanden ihre Übestunden ansammeln, und beobachtet, wie sich ihre Fähigkeiten entwickeln. Es ist leicht nachvollziehbar, warum Längsschnittuntersuchungen bei der 10.000-Stunden-Regel schwierig sind: Wie schwierig muss es sein, eine Gruppe von Dan McLaughlins für eine Studie zu rekrutieren – Menschen, die sich bereit erklären, jahrelang etwas zu üben, was sie zuvor noch nie getan haben – und diese dann auch noch gewissenhaft zu überwachen.
Der Erwerb von Fachwissen lässt sich jedoch mit einer Methode nachzuvollziehen, die zumindest einigen Unzulänglichkeiten des subjektiven Erinnerungsvermögens ausweicht.
Schachspieler werden nach der Elo-Zahl bewertet, benannt nach Arpad Elo, einem Physiker, der dieses Punktesystem entwickelt hat. Ein durchschnittlicher Schachspieler hat eine Elo-Zahl von ungefähr 1.200. Beim Rang eines Schachmeisters, dem minimalen Spielniveau, mit dem man seinen Lebensunterhalt durch Schachspiel bestreiten kann, sind es zwischen 2.200 und 2.400 Punkte. Ein internationaler Meister hat 2.400 bis 2.500, ein Großmeister mehr als 2.500 Elo-Punkte. Da die Elo-Zahl steigt, wenn sich ein Spieler verbessert, bietet das Bewertungssystem ein objektives Protokoll der zurückliegenden Fortschritte eines Spielers.
2007 rekrutierten die Psychologen Guillermo Campitelli von der Universidad Abierta Interamericana in Buenos Aires und Fernand Gobet von der Brunel University in Westlondon 104 Schachspieler unterschiedlicher Spielstärke, um an ihnen das Wesen des Schachkönnens zu studieren. Campitelli hatte spätere Großmeister trainiert, und Gobet, der in seiner Jugend täglich acht bis zehn Stunden Schach geübt hatte, war internationaler Meister und zweitplatzierter Spieler in der Schweiz.
Campitelli und Gobet stellten fest, dass 10.000 Stunden Übungsaufwand annähernd reichten, um den Meisterrang oder eine Elo-Zahl von 2.200 zu erreichen und Schachprofi zu werden. Der durchschnittliche Zeitaufwand bis zum Meisterniveau betrug laut der Studie ungefähr 11.000 Stunden – genauer gesagt 11.053 Stunden, also mehr als bei Ericssons Geigenstudie. Interessanter als die durchschnittliche zum Erreichen des Meisterrangs erforderliche Übungsdauer waren jedoch die Unterschiede in der Stundenzahl.
Ein Spieler in der Studie erreichte das Spielniveau eines Schachmeisters in nur 3.000 Übungsstunden, während ein anderer Spieler dafür 23.000 Stunden benötigte. Wenn ein Jahr generell 1.000 Stunden konzentrierten Übens hergibt, ergibt dies einen Unterschied von zwei Jahrzehnten des Übens für dasselbe Maß an Expertise.
»Das war der auffälligste Teil unserer Ergebnisse«, sagt Gobet. »Dass einer praktisch achtmal mehr üben muss, um das gleiche Niveau wie ein anderer zu erreichen. Und manche tun das und erreichen immer noch nicht das gleiche Niveau.«4
Mehrere Spieler in der Studie, die in früher Kindheit begonnen hatten, hatten mehr als 25.000 Stunden Übe- und Lernzeit hinter sich, aber den einfachen Meisterstatus immer noch nicht erreicht.
Auch wenn die durchschnittliche Zeit bis zum Schachmeister 11.000 Stunden betrug, war die 3.000-Stunden-Regel des einen die 25.000-Stunden-Regel des anderen. Die berühmte 10.000-Stunden-Studie an Geigern gibt nur die durchschnittliche Anzahl der Übungsstunden an. Sie verschweigt die Streuung bei dem für die Erlangung von Könnerschaft erforderlichen Übungsaufwand. Daher lässt sich unmöglich sagen, ob ein Einzelner in der Studie tatsächlich in 10.000 Stunden zum Stargeiger geworden ist, oder ob dies nur ein Durchschnitt unterschiedlicher individueller Werte war.
In einer Podiumsdiskussion bei einer Konferenz des American College of Sports Medicine im Jahr 2012 bemerkte Ericsson, dass die mittlerweile weltberühmten Daten von einer kleinen Anzahl von Testpersonen stammten und hinsichtlich der Zählung der Übungsstunden nicht ganz belastbar seien.
»Bekanntlich haben wir nur von zehn Personen Daten gesammelt«, sagte Ericsson. »Und [die Geiger haben] einige der Schätzungen aus der Rückschau mehrmals gemacht, und dabei gab es keine perfekte Übereinstimmung.«
Das heißt, die Geiger widersprachen sich bei mehrfachen Schätzungen ihrer Übezeit. Zudem, so Ericsson, schwankte die Gesamtdauer allein unter den zehn Elitegeigern – der 10.000-Stunden-Gruppe – immer noch »um sicherlich mehr als 500 Stunden.« (Ericsson hat, das sei angemerkt, selbst nie von der »10.000-Stunden-Regel« gesprochen. In einem Artikel aus dem Jahr 2012 im British Journal of Sports Medicine führte er die Popularität des Ausdrucks auf eine Kapitelüberschrift in Malcolm Gladwells Überflieger zurück, die ihm zufolge die Ergebnisse der Geigenstudie »missversteht«.)
Als ich Dan McLaughlin fragte, ob es ihm keine Sorge bereite, dass er, wie einige der Schachspieler, ein 20.000-Stunden-Typ und kein 10.000-Stunden-Typ sein könnte, sagte er, dass er seinen Lernprozess an sich schon als persönlichen Sieg betrachte.
»Wenn es zum Tag der Abrechnung kommt, und meine zehntausendste Stunde herum ist«, sagte McLaughlin, »wird es interessant sein zu sehen, ob ich immer noch 75 Schläge brauche, oder ob ich um einen Schlag an der Q-School [der Qualifikation der PGA-Tour] gescheitert bin, oder ob ich an der Tour teilnehme. Man kann wahrscheinlich in 7.000 oder 40.000 Stunden zum Meister werden, aber mit dieser Regel kann man Fortschritte gut festhalten.«
Irgendwie klingt »7.000-bis-40.000-Stunden-Regel« auch weniger griffig.
Bei den Schachspielern zeigen sich Unterschiede im Fortschritt sehr früh.
»Schauen Sie sich die Spieler an, die später Meister werden, und die Spieler, die unter diesem Niveau bleiben«, sagt Gobet. »Einige von ihnen haben in den ersten drei Jahren das gleiche Training, aber es gibt bereits große Unterschiede in der Leistung. Womöglich gibt es am Anfang sehr kleine individuelle Unterschiede [in der Begabung], die aber dann einen großen Effekt haben. Wir gehen davon aus, dass es ungefähr zehn Sekunden dauert, um eine Figurenkombination zu lernen, und wir haben geschätzt, dass man ungefähr 300.000 davon lernen muss, um Großmeister zu werden. Wenn jemand eine Kombination in neun Sekunden lernt, ein anderer aber elf Sekunden dafür braucht, verstärken sich solche kleinen Unterschiede.«
Es ist eine Art Schmetterlingseffekt des Lernens. Wenn zwei Übende mit leicht unterschiedlichen Anfangsbedingungen beginnen, kann dies laut Gobet zu sehr verschiedenen Ergebnissen führen oder zumindest zu sehr verschiedenem Übungsaufwand bei ähnlichen Ergebnissen.
Wie immer vor einem Wettbewerb bewahrte Stefan Holm am Morgen des 22. August 2004 seine Ruhe, indem er sich in ein Buch vertiefte. Diesmal war es Olympics in Athens 1896: The Invention of the Modern Olympic Games von Michael Llewellyn Smith. Wenn Holm als schwedischer Hochspringer zu Wettkämpfen reiste, nahm er gern Bücher mit, die mit dem Austragungsort zu tun hatten. Und dieses Buch war besonders passend, da er in wenigen Stunden im Athener Olympiakó Stádio zum olympischen Finale antreten würde.
Wie immer sorgte Holm mit allen Mitteln dafür, dass jedes Omen eine günstige Richtung bekam. Selbst wenn er das Buch eigentlich auf Seite 225 zuklappen wollte, würde er mindestens bis Seite 240 weiterlesen, denn falls die Latte während des Wettbewerbs auf 225 Zentimeter angehoben würde, sollte diese Nummer in seinem Kopf nicht mit Aufhören verbunden sein.
Um die mentale Belastung durch kleine Entscheidungen zu minimieren, befolgte Holm am Morgen ein eingeübtes Muster: zuerst Cornflakes und Orangensaft frühstücken; dann, eine Stunde bevor er auf den Sportplatz ging, das blau-gelbe Wettkampftrikot mit der schwedischen Krone auf dem Bett ausbreiten; dann duschen, Haare waschen – immer zweimal, ohne erklärbaren Grund – und rasieren. Seine Tasche packte er jedes Mal in der gleichen Reihenfolge. Er zog die gleiche schwarze Unterwäsche an, die er bei jedem Wettkampf trug. Er zog die rechte Socke vor der linken an, aber die Schuhe in umgekehrter Reihenfolge, den linken vor dem rechten.
An jenem Abend kulminierte Holms Leben in einem letzten Versuch bei 2,34 Meter. Die ersten beiden Male hatte er gerissen. Ein dritter Fehlversuch würde das Ende bedeuten. Wie vor jedem Sprung strich er mit den Händen zweimal nach hinten über sein kurz geschorenes Haar, rieb sich die Augen, zupfte an der Front seines Trikots und wischte sich dann den Schweiß von der Stirn. Er trippelte in Richtung Latte und brach dann in Vollspurt aus. Er schoss empor und segelte hinüber. Danach übersprang er noch 2,36 Meter und gewann die olympische Goldmedaille. Es war ein angemessener Höhepunkt für eine Geschichte, die mit jener jugendlichen Besessenheit begann, welche Genialität hervorbringen kann.
Inspiriert von den Olympischen Spielen in Moskau 1980 machte der nur vierjährige Stefan Holm mit seinem Nachbarn Magnus seine ersten Sprünge über das Sofa. Dieses Unterfangen endete damit, dass Magnus sich den Arm brach. Aber das Duo ließ sich nicht entmutigen.
Als Holm sechs Jahre alt war, baute Magnus’ Vater den Jungen aus Kissen und einer alten Matratze eine Hochsprunganlage und stellte sie im Garten auf. Zwei Jahre später, 1984, war Holm acht Jahre alt und sah in einem Turnier Patrik Sjöberg, den ungestümen schwedischen Hochspringer mit der goldenen Lockenpracht, den Weltrekord brechen. In ganz Schweden flogen nun Horden von Mini-Sjöbergs im Schersprung oder Fosbury-Flop über die elterlichen Sofas. Der junge Holm erflehte oft die Aufmerksamkeit seines Vaters mit verzücktem Quietschen – »Guck mal! Ich bin Patrik Sjöberg!« –, bevor er über die Couch setzte.
Zu dieser Zeit wurde Holm eingeschult, was ihn vor allem deshalb begeisterte, weil die Schule eine Hochsprunggrube hatte. Dort verbrachten er und Magnus viele Mittagspausen, um eine Fantasieversion der olympischen Hochsprungwettkämpfe nachzuspielen. Manchmal kamen sie zu spät zum Unterricht.
Am Tag des Finales in Athen saß Magnus auf der Tribüne, ebenso wie Johnny Holm, Stefans Vater und Trainer seit Kindertagen. In seiner Jugend war Johnny Holm ein katzenhafter Torhüter in Schwedens vierter Liga gewesen und hätte in die Profiriege aufsteigen können, aber er entschied sich dafür, in der Nähe seiner Heimat zu bleiben und seiner Arbeit als Schweißer nachzugehen. Schon als Teenager hatte Stefan Holm aus den Erzählungen seines Vaters das Bedauern darüber herausgehört, dass dieser die Chance verschenkt hatte, Profisportler zu werden. Johnny hatte es nie zugegeben, aber Stefan erkannte es daran, wie eifrig der Vater den Sohn dabei unterstützte, sich ganz dem Hochsprung zu widmen. Einer wie der andere waren sie von diesem Sport besessen.
Im Jahr 1987 öffnete in Westschweden, nur wenige Autominuten von Holms winziger Heimatstadt Forshaga entfernt, eine professionelle Leichtathletik-Halle namens Våxnäshallen ihre Pforten, als hätten sie die Götter des Hochsprungs herabgesandt, um Stefan Holm bei seinem Vorhaben zu unterstützen. So erhielt Holm im Alter von elf Jahren für den Rest seiner Karriere einen ganzjährig zugänglichen Trainingsort von Weltklasse.
Mit vierzehn Jahren schaffte Holm mit 1,83 Meter einen Rekord für seine Altersgruppe in seiner Region im Westen Schwedens, obwohl er in dieser Saison bei einer Handvoll Wettbewerben besiegt worden war. Mit fünfzehn gewann er die schwedische Jugendmeisterschaft und reiste mit seinem Vater nach Göteborg, um Patrik Sjöbergs Trainer Viljo Nousiainen zu treffen.
Das Treffen begründete eine dauerhafte Freundschaft zwischen Holm senior und Nousiainen, und Johnny Holm übernahm einige von Nousiainens Trainingsmethoden für seinen jugendlichen Sohn. Der Junge, der den großen Patrik Sjöberg vergöttert hatte, wurde auf einmal zu dessen Nachfolger herangezogen. Aber es gab einen augenfälligen Unterschied. Sjöberg war gut zwei Meter groß, während jeder Lokalzeitungsartikel über Holms Leistungen seine geringe Statur notierte. Als Erwachsener sollte Holm es auf 1,80 Meter bringen, geradezu liliputanisch für einen Hochspringer. In einer Sportart, bei der der Körperschwerpunkt so hoch wie möglich katapultiert werden muss, ist es ein enormer Vorteil, mit einem hohen Schwerpunkt anzutreten.
Als Teenager befiel Holm das hochspringerische Äquivalent zum Lampenfieber: Wurde die Latte auf eine Höhe über seinem Kopf angehoben, nahm er seinen gewöhnlichen Anlauf, rannte jedoch, statt zu springen, einfach unter der Latte durch auf die Matte. Bei mehreren Wettbewerben in seiner Jugendzeit tat Holm dies drei Mal hintereinander bei gleicher Lattenhöhe, weshalb er disqualifiziert wurde. Statt aufzugeben, intensivierte Holm sein Training, gab den Fußball auf und widmete sich ausschließlich dem Hochsprung. Mit sechzehn verlor er nur einen einzigen Wettkampf – ein Trauma, das ihn lange wurmte, und das er mit seiner niederlagenlosen Saison 2004 vergelten sollte – und stürzte sich in das, was er später als »zwanzigjährige Liebesbeziehung mit dem Hochsprung« bezeichnete (Während eines Großteils dieser zwei Jahrzehnte war es eine exklusive Liebesbeziehung, die Holm wenig Zeit für Lebensgefährtinnen ließ.) Man darf wetten, und Holm selbst stimmt dem zu, dass er mehr Hochsprünge gemacht hat als irgendein Mensch, der je gelebt hat.
Mit siebzehn war Holm gut genug, um sich seinem Helden Sjöberg im Wettbewerb zu stellen. Sjöberg gewann mit Leichtigkeit, aber Holm fragte sich, ob er, wenn er nur dranbliebe, eines Tages die schwedische Sportikone würde übertreffen können. Mit neunzehn Jahren begann Holm mit einem Krafttrainingsprogramm, das natürlich sein linkes Bein betonte und sich über ein Jahrzehnt hinweg immer weiter steigern sollte, bis er 140 Kilo, das Doppelte seines Eigengewichts, schultern und damit so tief in die Hocke gehen konnte, dass sein Hintern vor dem Aufstehen fast den Boden berührte.
Um seine Statur zu kompensieren, perfektionierte Holm einen sprintenden Anlauf, bei dem er eine Höchstgeschwindigkeit von rund 30 km/h erreichte, womit er wahrscheinlich schneller war als jeder andere Hochspringer auf der Welt.
Um diese Geschwindigkeit zu beherrschen, musste er immer weiter von der Latte entfernt abheben. Holm flog jedes Jahr schneller, weiter und höher, schoss zur Latte empor und bog und wickelte seinen Körper so eng um sie herum, dass ihm seine Fersen ein Geheimnis ins Ohr flüstern konnten. Von 1987 an verbesserte sich Holm Jahr für Jahr um einige Zentimeter. Bei einer Leistung, für die scheinbar fraglos das Motto »Entweder man hat’s, oder man hat’s nicht« galt, verwandelte sich Holm in das ultimative »man hat’s«.
1998 gewann Holm die erste von elf schwedischen Meisterschaften in Folge. Drei Jahre später verfehlte er die olympische Siegertreppe nur knapp und wurde Vierter in Sydney. Das war nicht gut genug. Holm hatte bei seinen Eltern gelebt und sporadisch die Uni besucht. Mit fünfundzwanzig brach er sein Studium ab und zog aus dem elterlichen Haus in eine Wohnung gleich neben der Våxnäshallen in Karlstad, einer Stadt mit sechzigtausend Einwohnern an der Nordküste des größten schwedischen Sees. Von da an trainierte Holm zwölfmal pro Woche. Sein Arbeitstag begann um zehn Uhr morgens mit zwei Stunden Krafttraining, Kastensprüngen oder Hürdenlauf – er und sein Vater hatten Hürden gebaut, die bis 1,70 Meter hoch eingestellt werden konnten. Dann kam eine Mittagspause und eine weitere Trainingseinheit am späten Nachmittag, die aus mindestens dreißig Hochsprüngen bei voller Wettkampfgeschwindigkeit bestand. Dreißig, wenn alles glatt lief. Holm ging weder nach einem Fehlversuch nach Hause, noch senkte er jemals die Latte, um einen erfolgreichen Sprung zu ermöglichen, also ging das Training so lange weiter, bis er es über die Höhe geschafft hatte, die er sich vorgenommen hatte. Als Athen näherrückte, hatte Johnny Holm seinen Sohn so viele Sprünge machen sehen, dass er immer schon vier Schritte vor dem Absprung merkte, ob Stefan die Latte passieren würde.
Ohne Anlauf lag Holms vertikale Sprunghöhe aus dem Stand bei 71 Zentimeter, was eine eher bescheidene sportliche Leistung ist. Aber sein rasend schneller Anlauf ermöglichte es ihm, seine Achillessehne mit großer Wucht zu belasten, sodass sie wie eine Sprungfeder wirkte und ihn über die Latte katapultierte. Als Wissenschaftler Holm untersuchten, stellten sie fest, dass seine linke Achillessehne dank seines Trainingsprogramms so zäh geworden war, dass sie erst unter einer Zugkraft von 1,8 Tonnen einen Zentimeter nachgab, was etwa der vierfachen Stabilität der Achillessehne eines durchschnittlichen Mannes entspricht. Dies war ein ungewöhnlich kräftiger Sprungmechanismus.
Im Jahr 2005, ein Jahr nach dem Olympiatitel, qualifizierte sich Holm als perfektes menschliches Projektil: Er überflog 2,40 Meter und zog mit dem bestehenden Rekord für die größte Differenz zwischen Lattenhöhe und Körpergröße des Springers gleich.