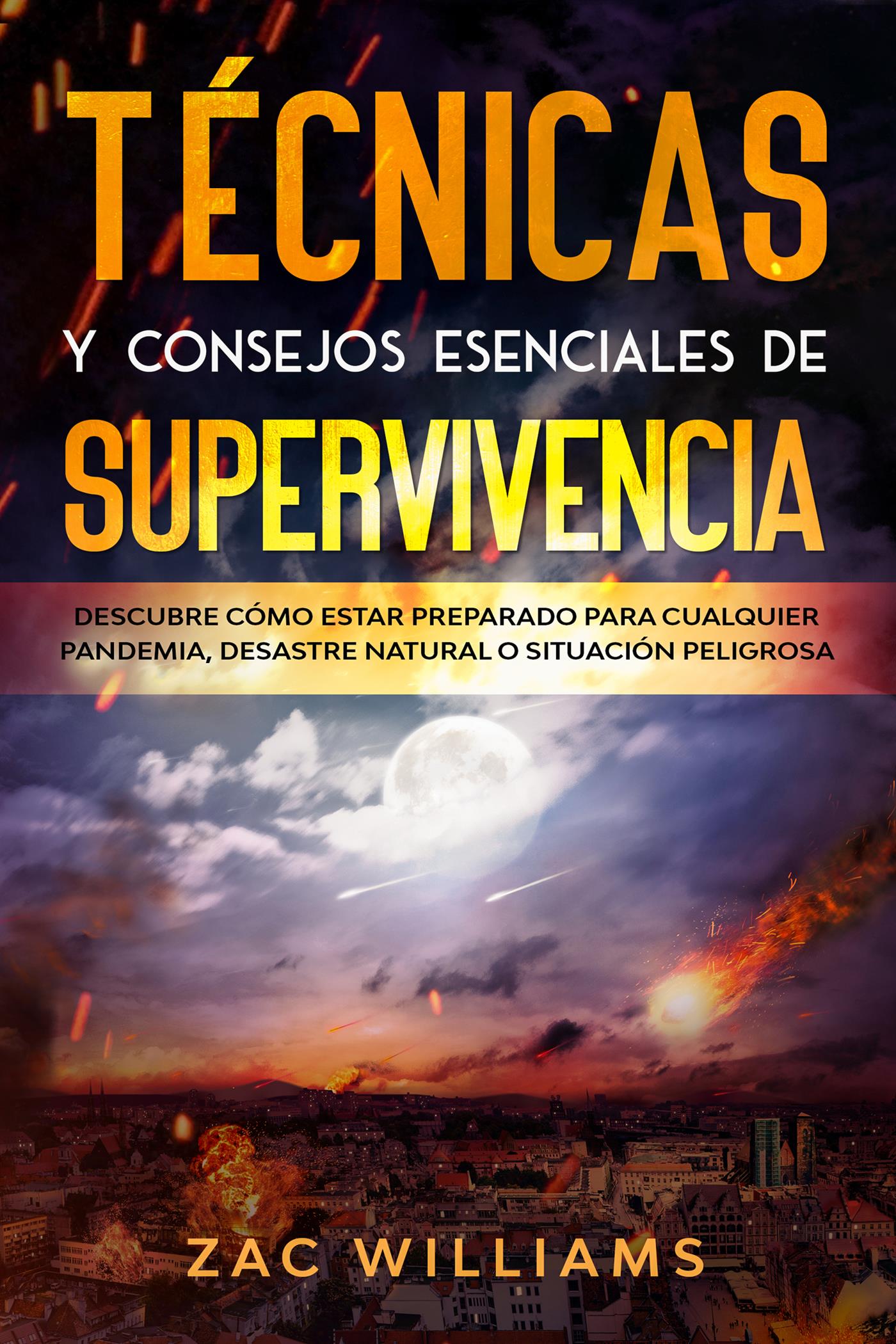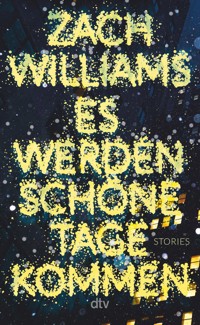
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diese Erzählungen werden Ihnen nicht mehr aus dem Kopf gehen. Sie werden Sie verändern.« Jonathan Safran Foer Barack Obama's Summer Reading List2024 The New Yorker's Best Books We've Read in 2024 So Far »Mögen alle die Kunde vernehmen: Zach Williams' ›Es werden schöne Tage kommen‹ gehört zu den Debüts der Superlative in diesem Jahr. Eine gloriose Gruselorgie.« Washington Post Ein Paar wacht in einer Ferienhütte im Wald auf und stellt fest, dass es in der ewig gleichen Idylle gefangen ist. Doch anders als sie selbst scheint ihr kleiner Sohn nicht zu altern. Ein Mann findet seine Nachbarin tot in deren Wohnung vor und beginnt eine irre Verfolgungsjagd. Ein anderer willigt ein, mit einer Frau zu schlafen, während ihr Freund aus dem Schrank zusieht, und kommt dem seltsamen Geheimnis des Paars auf die Schliche. Als wären sie dem kollektiven Albtraum unserer Zeit entsprungen, oszillieren die Geschichten in diesem Band zwischen dem Profanen und Bizarren, dem Vertrauten und Verstörenden. Zach Williams erzählt vom Grauen der Begegnung mit dem ganz und gar Unbekannten – und zeigt, dass wir unsere Wirklichkeit letztlich nur bewohnen wie ein Puppenhaus. »Voller Ironie und Absurdität, ohne je gerissen, clever oder gewollt witzig zu sein. Da treten Überraschungen, Wahrheiten und Dinge zutage, von denen wir nicht zu träumen gewagt hätten.« Percival Everett »Hin und wieder tritt ein Schriftsteller in Erscheinung, der, so scheint es, ein Gespür hat für das nicht ganz Rationale, für eine Stimmung oder ein Gefühl, das unter der Oberfläche der Dinge schlummert. Zach Williams ist ein solcher Schriftsteller. Seine hinreißend beunruhigenden Erzählungen sind profund im wahrsten Sinne des Wortes: sie gehen in die Tiefe.« Hari Kunzru »Ein großartiges Debüt.« Jeffrey Eugenides
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Ein Paar wacht in einer Ferienhütte im Wald auf und stellt fest, dass es in der ewig gleichen Idylle gefangen ist, doch anders als sie selbst scheint ihr kleiner Sohn nicht zu altern. Ein Mann findet seine ältere Nachbarin tot in deren Wohnung vor und beginnt eine aberwitzige Verfolgungsjagd. Ein anderer willigt ein, mit einer Frau zu schlafen, während ihr Freund aus dem Schrank zusieht, und kommt dem seltsamen Geheimnis des Paars auf die Schliche.
Ein Debüt wie ein Hochseilakt, von einem schwindelerregenden neuen Talent: Als wären sie dem kollektiven Albtraum unserer Zeit entsprungen, oszillieren die Geschichten in diesem Band zwischen dem Profanen und Bizarren. Zach Williams erzählt vom Grauen der Begegnung mit dem ganz und gar Unbekannten – und zeigt, dass wir unsere Wirklichkeit letztlich nur bewohnen wie ein Puppenhaus.
Zach Williams
Es werden schöne Tage kommen
Stories
Aus dem Englischen von Bettina Abarbanell und Clemens J. Setz
Für Rosalie
Probelauf
Ich flog durch die Tür zur Lobby und blickte mich dann keuchend zum Unwetter um. Es war schlimm da draußen. Die Stadt bestand nur noch aus vagen Umrissen und schwebenden Lichtern; der Schnee trieb in Wellen über die Nineteenth Street. Ich klopfte ihn mir von Mütze und Mantel, schlug die Stiefel zusammen. Unter den hohen Decken hallte jedes Geräusch nach. Nur die Notbeleuchtung war eingeschaltet, der Empfang verwaist, alle Fahrstühle standen offen und warteten. In einem Anfall von Hoffnung dachte ich, dass womöglich im gesamten Gebäude kein einziger Mensch war außer mir.
Der Fahrstuhl hielt im achten Stock, obwohl ich diesen Knopf nicht gedrückt hatte – Stille, nichts als Bürowaben im matten Licht eines Notrufschalters. Als die Türen im vierzehnten erneut aufgingen, sah ich Manny Mintauro, unseren Wachmann, wie einen Gesteinsblock hinter seinem Pult. Die Hälfte seines Gesichts lag im Schatten. Bei seinem Anblick verlor ich den Mut.
»Alles klar, Bro?«, sagte er todernst.
Die Fahrstuhltüren schlossen sich hinter mir. »Hey, Manny.« Schnee tropfte von meinen Jeans auf den Teppich. »Dachte schon, ich wär heut allein hier.«
»Ach was.«
Mannys Kopf war makellos kahl geschoren, und sein grauer Schädel, mit Haarbälgen gemasert und im Nacken von Fett gewulstet, wirkte wie etwas schauderhaft Bloßgestelltes. Er rief mir einen Traum ins Gedächtnis, den ich manchmal habe: Während ich mir ganze Haarbüschel vom Kopf reiße, stelle ich fest, dass sich darunter die gelblich weiße Schale einer Orange verbirgt. In wachsender Panik kratze ich daran.
»Bleibt wohl heute trotzdem eher tot«, sagte ich.
»Auf jeden Fall. Irres Wetter.« Er gab Wetter zwei harte Silben.
Es war schwer zu sagen, wann ein Gespräch mit Manny zu Ende war. Ich hatte mich noch nicht an seine Anwesenheit gewöhnt, daran, dass er all unser Kommen und Gehen überwachte. Seit dem Amoklauf bei Rantr im vergangenen Frühjahr war in den meisten Gebäuden downtown internes Sicherheitspersonal eingestellt worden. Manny hatte im Golfkrieg bei den Marines gedient. Ich fragte mich oft, ob er, dort am Pult, bewaffnet war oder wie genau seine Befugnis aussah, in einer Sicherheitslage Gewalt anzuwenden. Das war das Wort, das die Geschäftsleitung benutzte: Sicherheitslage. Während der monatlichen Lockdown-Übungen, die bei uns eingeführt worden waren, schritt Manny die leeren Flure ab und prüfte die Türklinken der Konferenzräume, ohne eine Miene zu verziehen, während wir drinnen am Boden kauerten.
»Bei mir ist der Strom ausgefallen, da fand ich es besser, hier zu sein. Unterm Strich«, sagte ich.
»Ich muss hier sein«, sagte Manny. »Übrigens, damit Sie Bescheid wissen. Gibt wieder ’ne TruthFlex-Mail. Ist gerade eben gekommen. Löschen Sie den Scheiß.« Er hielt sich den Mund zu. »Entschuldigen Sie den Kraftausdruck.«
»Ah. Verdammt. Noch eine. Tut mir leid – tut mir leid, das zu hören.«
»Braucht Ihnen meinetwegen nicht leidtun, Bro. Wenn Sie wissen, was ich meine.«
Wusste ich nicht. Und jetzt genügte es auch, die Begegnung war ausreichend. Ich holte Luft, drückte die Schultern durch. »Na dann – ich wünsch Ihnen was, Manny.« In der Hoffnung, er würde es gut sein lassen, bewegte ich mich auf seine linke Flanke zu.
Stattdessen riss er den Kopf hoch. »Ganz kurz, bevor Sie gehen – ich wollt Ihnen noch was sagen.« Seine kleinen Augen hielten meine fest. »Als ich Ihnen neulich erzählt hab, was das wichtigste Datum der Geschichte ist, meiner Meinung nach? Da hab ich Sie gar nicht gefragt, was Sie denken. Was für Sie das wichtigste Datum ist.«
In der Woche davor hatte Manny mich auf der Toilette abgefangen und sich lang und breit über die Balfour-Deklaration ausgelassen. Ich hatte nicht begriffen, worauf er hinauswollte, aber er lehnte die ganze Zeit an der Tür, und ich kam nicht weg.
»Hm«, sagte ich. »Ich weiß nicht, Manny.«
»Für mich ist das Balfour-Abkommen das wichtigste. Haben Sie’s inzwischen mal nachgelesen?«
»Noch nicht. Ich hatte ziemlich viel zu tun.«
»Hat die Weltgeschichte massiv beeinflusst.«
»Ich glaube, wir haben in der Schule was darüber gelernt.«
»Ach was«, sagte er, »in der Schule kann man nichts lernen. Wenn Sie wissen, was ich meine.«
»Jedenfalls hat man irgendwie schon mal davon gehört.«
»Sie müssen das selbst recherchieren. Ich sag nur: die Rothschilds. Follow the money.«
»Okay. Mach ich.«
»Gut.« Er musterte mich aufmerksam. »Und sagen Sie mir, was Sie denken. Ich bin bloß neugierig, mehr nicht.« Dann nahm er den linken Fuß runter, sodass sich ein Durchlass für mich öffnete. Er streckte die rechte Hand aus, den kleinen und den Ringfinger fest in die Handfläche eingerollt, und grinste auf mich herab, als ich sie nahm.
Es war dunkel in der vierzehnten Etage, alle Monitore schwarz und kalt. Außer mir war allerdings noch jemand gekommen. Shel Bunting. Er saß über seinen Computer gebeugt in der Ecke beim Fenster. Ich hätte froh sein können, ihn dazuhaben – Mannys wegen. Aber irgendetwas war komisch an Shel. In Meetings sah er fast nie auf, hielt den Blick einfach auf den Tisch gerichtet. Sein Gesicht war an manchen Stellen blass, an anderen rot gefleckt – auf der Stirn, unter einem Auge oder am Hals. Niemand kannte Shel wirklich, aber ich spürte eine stille Reserve der Sonderlichkeit in ihm; ich hatte immer das Gefühl, man müsse auf ihn achten, und als ich zu meinem Platz ging, sah ich stur auf mein Handy, um jede Möglichkeit eines Blickkontakts zu vermeiden.
Ich ließ meinen Rucksack fallen, hängte meinen Mantel über die Stuhllehne, setzte mich und drehte mich so herum, dass weder Manny noch Shel in meinem Blickfeld waren, nahm meinen Laptop aus dem Rucksack und strich über die verformte Stelle, wo der Akku sich aufgebläht hatte. Eine Nachricht von Lisa, unserer Managerin, stand noch weit oben in meinem Postfach – »Haltet euch warm, wir sehen uns am Donnerstag im Büro.« Aber gleich darüber war die Mail, die Manny erwähnt hatte, von TruthFlex00–[email protected]: »Lisa Horowitz ist eine KULTURMARXISTIN – ¡WEISSER GENOZID!«
Diese E-Mails bekamen wir jetzt seit sechs Wochen und wussten immer noch nicht, von wem sie stammten. Es war ein Mysterium. Wir hatten Anweisung, keine Nachrichten von TruthFlex zu öffnen, aber ich konnte nicht anders; ich klickte sie jedes Mal an. Falls TruthFlex eine Bedrohung für mich darstellte, wollte ich sie verstehen. Wir kannten alle jemanden, der jemanden bei Rantr kannte. Wie dem auch sei, die E-Mails waren weitgehend unentzifferbar – seltsame Ergüsse in wechselnden Schrifttypen. Manchmal waren YouTube-Links dabei: »White Pride ist gesund und moralisch« und »100 Fake Hate Crimes von linken DemokRATTEN inszeniert«. Fast alle E-Mails nannten Lisa namentlich, und die erste war eingegangen, kurz nachdem sie uns für einen Diversitätsworkshop angemeldet hatte, Teilnahme verpflichtend, weshalb wir uns natürlich fragten, ob TruthFlex womöglich jemand von uns war. Aber soweit wir wussten, hatten wir nicht mal Republikaner im Büro, von Rechtsextremen der radikalen Sorte ganz zu schweigen. Wir waren eine kleine Analysefirma, alle gebildet, und mit achtunddreißig Jahren war ich in meiner Abteilung einer der ältesten Angestellten. Wie auch immer, die Polizei hatte gemeint, TruthFlex könne ebenso gut niemand Besonderes sein, bloß jemand, der aus unerfindlichen Gründen aus der Tiefe hochgeblubbert sei, oder auch ein Bot – dergleichen passierte offenbar ständig. Die IT-Leute blockierten jede neue TruthFlex-Adresse; es nützte nichts. Sie konnten nicht verhindern, dass wir diese E-Mails weiterhin bekamen. Und die Polizei sagte, sie könne nicht viel tun, solange TruthFlex keine konkrete Drohung ausspreche. Außerdem, erinnerte uns die Geschäftsleitung, hätten wir ja Manny, der für unsere Sicherheit sorge. Vor der ersten Lockdown-Übung sollten wir alle Gegenstände in unserer Reichweite brainstormen, die eine Kugel abfangen könnten. Ich kam immer wieder auf die Fenster zurück – wenn ich nur eine Möglichkeit fände, auf deren andere Seite zu gelangen …
Irgendwo hinter mir nieste Shel. Ich blickte auf mein Handy. Es war noch nicht mal zehn.
Ich beschloss, Bradt zu schreiben: Sag Bescheid, wenn wir wieder Strom haben. Aber er wachte selten vor ein Uhr auf. Bradt war nach meiner Scheidung bei mir eingezogen, ein Craigslist-Mitbewohner, noch in den Zwanzigern. Ich schrieb ihm nach Möglichkeit nie – jede neue Nachricht exhumierte die vorangegangene, legte die Trostlosigkeit unseres Zusammenlebens bloß. Die heutige stand neben einer vom 19. Dezember: Hey, Mann, sorry, aber das ist zu laut. Bradt verdiente seine Brötchen als Videospielstreamer. Anscheinend schalteten Zehntausende junger Leute seinen Kanal ein. Ich hatte mir noch nie was davon angesehen, ihn aber hin und wieder gegoogelt; er generierte massenweise Kommentare in einem kleinen Kulturkampf, dessen Bedeutungshorizont mir verschlossen blieb. Allerdings blieb mir inzwischen so gut wie alles verschlossen. Wenn schon die Jahre zwischen Bradt und mir unüberbrückbar schienen, was wäre erst mit der Generation nach seiner? Schwer vorstellbar, dass sie überhaupt noch menschlich sein würde – ich sah so etwas wie ein wogendes blaues Seeanemonenbeet vor mir. Bradt arbeitete in seinem Zimmer an einem Desktop-Computer mit zwei Monitoren, meist in kurzer Trainingshose und mit Headset, und verbrachte die Wochenenden außerhalb der Stadt. Keine Ahnung, wo. Manchmal wachte ich nachts auf und hörte ihn im Flur vor sich hin brabbeln. Ich wusste nicht, was ihn in der Außenwelt verankerte, und in solchen Momenten, unfähig, mich zu rühren, träumte ich halb, dass Bradt die Tür öffnete, Licht in mein Zimmer fiel, die Grenze zwischen uns einbrach. Also konnte ich nicht nach Hause gehen. Bradt war da, offline und unverkabelt.
Für einen Kaffee aus der kleinen Küche hätte ich an Shel vorbeigemusst, also sah ich mir lieber ein Video von Louis C.K. auf Facebook an, der über Waffengesetze sprach, mit dem üblichen Streit unter Fremden im Kommentarbereich. Aber die siebte Folge lud und lud nicht, das Rädchen drehte sich bis in die Ewigkeit, und während ich es beobachtete, wurde mir klar, dass ich Shel nicht gut den ganzen Vormittag ignorieren konnte. Wenn ich auf dem Weg in die Küche kurz mit ihm plauderte, hätte ich es hinter mir: sowohl Manny als auch Shel verarztet.
Ich schloss den Laptop, stand auf, schob den Stuhl zurück.
Auf dem Weg zu seinem Platz beobachtete ich Shel angespannt, und Manny beobachtete mich.
»Morgen, Shel.« Ich beugte mich lächelnd über seine Wabe.
»Ah, hallo.« Er war unrasiert und trug einen unförmigen schwarzen Pullover. Unter seinem Schreibtisch war eine Sporttasche, prall gefüllt, dem Anschein nach schwer. Shel sah nicht so aus, als treibe er viel Sport. Er war dünn und schlaff.
»Bloß wir zwei heute, was?«
Seine Flecken glühten. »Und Manny.«
»Manny«, sagte ich und schaute kurz zum Pult – er sah von seinem Telefon auf und begegnete meinem Blick. »Seltsamer Typ.«
»Manny?«, fragte Shel. »Inwiefern?«
»Ach, ich weiß nicht. Hast du dich noch nie mit ihm über wichtige Daten unterhalten?«
»Nein.«
Er wartete ab, dachte wohl, ich würde noch weiterreden. Ich hatte das Gefühl, schon zu viel gesagt zu haben. Ein plötzlicher Windstoß peitschte gegen das Fenster, und wir drehten uns beide um; stellenweise klebte Schnee an der Scheibe.
»Ich hätte auf Long Island bleiben sollen«, sagte Shel. »Aber ich konnte nicht schlafen, bin früh los. Bevor es richtig schlimm wurde.«
»Na bitte. Gut gemacht.« Ich lächelte und er auch. Genügte das? Ja: Wir hatten uns auf exakt eine Banalität geeinigt. Jetzt konnte ich den Austausch guten Gewissens beenden. Ich hustete und sagte: »Okay, Shel, ich lass dich dann mal weitermachen.«
»Klar.« Er faltete die Hände auf dem Schreibtisch, blickte auf sie hinunter. »Bis später.«
»Ich wünsch dir was.« Ich klopfte mit den Fingerknöcheln auf die Trennwand seiner Wabe und ging weiter, frei.
Aber irgendwie spürte ich ihn hinter mir, schien er an mir zu ziehen, meine Schritte zu verlangsamen. Es war, als wüsste ich, dass ich ewig so weiterlaufen könnte und die Kaffeemaschine nie erreichen würde.
Und dann warf Shel über die Distanz, die ich zwischen uns gebracht hatte, die Angel seiner Stimme aus: »Hey, also eigentlich – kann ich kurz mit dir sprechen?«
Ich drehte mich um. Er saß da, sah mich an, die Hände auf den Knien, die Augen hinter dem blinden Glanz seiner Brillengläser verborgen. Langsam ging ich denselben Weg zurück, bis ich wieder vor ihm stand, aller Fortschritt dahin.
»Klar, Shel. Was gibt’s?«
Er seufzte, lachte dann; ich bemerkte ein Zittern in seinem Bein. »Ich hoffe, das ist jetzt nicht komisch, keine Ahnung – vielleicht ist es blöd, dann tut’s mir leid – aber, also, hier ist ja sonst gerade niemand und du bist rübergekommen und wir haben geredet, und da dachte ich, ich könnte, na ja, also, ich weiß, dass du und deine Frau, dass ihr euch getrennt habt.« Er hustete in seine Faust. »Tut mir leid, dass ich so was Persönliches anspreche, aber ich mache das, weil, also weil es was ist, das wir gemeinsam haben. Jetzt, meine ich. Du und ich.« Er lächelte matt.
»O Gott, Shel«, sagte ich und mimte Mitgefühl, indem ich mir eine Hand aufs Herz legte. »Das tut mir so leid. Es tut mir so leid, das zu hören.« Und ich begriff, dass ich verloren hatte. Er hatte mich geschickt in sein Leben eingesponnen. Unzählige Gänge zur Küche, Hunderte Fahrstuhlfahrten, so viele Dinge wären ab jetzt hiervon verdorben.
»Danke.« Er atmete tief und lange aus; sein ganzer Körper entspannte sich. »Du bist der Erste hier, dem ich davon erzähle. Ich halte mich ja gern abseits, aber – du warst immer nett. Und dann standst du da. Außerdem ist heute so ein komischer Tag.«
»Also, du bist ja noch jung«, sagte ich. »Du – wie alt bist du?«
»Einundvierzig.«
»Siehst du? Jung genug, um einen Neuanfang zu versuchen. Ich bin – also, meine Scheidung war … es wird leichter.«
Er wurde rot. »Okay. Ja. Ich wette, deine Ex hat dich nicht so übern Tisch zu ziehen versucht, wie meine es gerade mit mir macht. Das hoffe ich wenigstens.« Dann, unvermittelt: »Kann ich ernsthaft mit dir reden? Vertraulich?«
»Shel«, sagte ich. »Natürlich.«
Er verschränkte die Arme und sah aus dem Fenster. »Ich sitze ganz schön in der Klemme. Sie hat monatelang mit diesem Scheißkerl von einem Anwalt konspiriert.«
»Okay«, sagte ich. »Das tut mir leid.«
»Er hat sie dazu gebracht, mich mit ihrem Handy aufzunehmen. Heimlich. Wenn wir uns heftig gestritten haben.«
»Okay.«
»Sie hat mich aufgestachelt, verstehst du – mich absichtlich dazu getrieben, Sachen zu sagen, so Sachen, die übel klingen, die aber jeder sagen könnte, unter den Umständen.« Er warf mir einen kurzen Blick zu. »Habt ihr euch heftig gestritten, du und deine Ex?«
»Na ja – manchmal. Nicht – ich weiß nicht. Heftig?« Ich blickte über die Schulter. Manny beobachtete uns von seinem Pult aus.
»Anscheinend hat sie einen Mitschnitt – behauptet jedenfalls dieser schmierige, widerwärtige Anwalt, verstehst du – also, sie haben wohl einen Mitschnitt davon, wie ich zu ihr sage …« Er stöhnte, sein Gesicht lief rot an. »Wie ich zu ihr sage: ›Ich bring dich um, verdammte Scheiße.‹ Und noch anderes Zeug in der Richtung. Übles Zeug. Schlimmeres. Ich bin so ein Idiot.«
Shels Schreibtisch stand direkt am Fenster, aber es schneite jetzt so stark, dass man nicht viel sah, außer dort, wo der Schnee an den Straßenlampen vorbeifiel. Sie waren wegen des Unwetters eingeschaltet, und die Stadt hatte neue LED-Birnen eingesetzt, die ein kaltes, hartes Licht verströmten, wie über einem Stadion oder Gefängnishof.
»Aber sie hat nicht aufgehört, mich zu quälen.«
»Klar – ich meine, Mann, Shel.«
»Und jetzt werden sie das benutzen, um mich von meinem Sohn fernzuhalten. Wo doch jeder in meiner Lage solche Sachen sagen könnte, also, bei derartiger seelischer Folter. Das ist eine bewusst geführte Kampagne gegen meine – meine geistige Gesundheit letztlich. Und dieser Anwalt, der hat ein Team von Privatdetektiven, die mich bis in die Geschäfte hinein verfolgen. Sie überwachen meine Internetnutzung. Es ist eine illegale Kampagne.«
»Okay.«
Er taxierte mich. »Unter uns, ich mach mir Gedanken wegen Manny. Sie haben ihn genau zu der Zeit eingestellt, als die Lage hier brenzlig wurde. Mir war mulmig dabei, mit ihm allein zu sein. Aber ich hatte keine Wahl. Nach Hause kann ich nicht zurück, was Neues hab ich noch nicht, und – na ja, ehrlich gesagt hab ich heute hier geschlafen. Unter meinem Schreibtisch.«
Wir richteten beide den Blick auf das Stück Teppich zu seinen Füßen: ein mit Isolierband zusammengehaltenes Stromkabel, eine gerade gebogene Büroklammer.
»Ach, Shel«, sagte ich.
»Tut mir leid, dass ich vorhin gelogen habe.«
»Das macht nichts.«
»Von wegen, ich wär aus Long Island gekommen.«
»Das macht nichts, Shel.«
Sein Gesicht verzerrte sich. »Ich hatte gedacht, Manny wäre nicht da. Jetzt frage ich mich, ob sie ihn hergeschickt haben, weil sie sehen konnten, dass ich gestern Abend nicht ausgecheckt habe. Hat er was zu dir gesagt? Worüber habt ihr vorhin geredet?«
»Nichts – keine Ahnung.«
»Über mich hat er nichts gesagt?«
»Shel, nein, natürlich nicht.«
»Daten, hast du gesagt? Was für Daten? Aus dem Browserverlauf etwa?«
»Die Balfour-Deklaration«, sagte ich. »Manny mag die Balfour-Deklaration.«
Er beäugte mich. »Die glauben, ich wäre TruthFlex. Hat er das gesagt?«
»Nein, Shel. Himmel – nein.«
»Ich habe Lisa nämlich gemailt, dass ich nicht weiter zu diesen verdammten Diversitätsworkshops gehen werde, dass ich mich weigere. Dieser PC-Scheiß ist doch völlig außer Kontrolle. Und jetzt verhören mich die Cops wegen TruthFlex. Hat Manny dir das erzählt?«
»Shel, nein. Das würde ich dir sagen. Das würde ich dir nicht verheimlichen.«
Und dann war es, als wäre ein Bann gebrochen. Ein Ausdruck der Verwirrung zog über sein Gesicht; er nahm die Brille ab und ließ sie an der Hand baumeln, während er sich den Ballen in die Augenhöhle drückte. »Gott. Das hätte ich nicht tun sollen.«
»Schon gut«, sagte ich.
»Du hast mehr von mir gehört, als du je wolltest. Es war zu viel.«
»Nein, das stimmt nicht.«
»Doch, ganz sicher.«
»Nein. Im Gegenteil«, sagte ich mit Bedacht, »du kannst gern mit mir sprechen. Jederzeit.«
Er legte die Brille auf den Schreibtisch, lehnte sich zurück, sah aus dem Fenster. »Weißt du was? Ich kann dir gar nicht sagen, wie viel mir das bedeutet.«
Ich trat einen Schritt näher, legte ihm die Hand auf die Schulter und drückte zu; sein Pullover bauschte sich in die Falten meiner Handfläche. »Danke«, sagte er. Sein Computer ging in den Ruhezustand, der Bildschirm wurde dunkel. »Das bedeutet mir viel«, sagte er. »Dass du dir die Zeit zum Reden genommen hast. Im Ernst. Ich hab nicht viele Menschen, mit denen ich reden kann.« Er legte seine Hand auf meine. »Du bist ein guter Mensch.«
In der Behindertentoilette setzte ich mich auf den geschlossenen Klodeckel und schaute auf mein Handy. Allen Vorhersagen trotzend war die Unwetterfront urplötzlich vom Kurs abgeschwenkt, und der Schneesturm zog mit fast unglaublicher Geschwindigkeit aufs Meer hinaus, sodass wir von seiner vollen Wucht verschont bleiben würden. Ein absolut unwahrscheinliches Szenario, aber so war es. Meteorologen verteidigten sich hysterisch auf Twitter. Auf Facebook schienen die Leute empört, dass der Sturm uns nicht härter treffen würde; sie verhöhnten den Bürgermeister. Ein Meter, hatte es in den Vorhersagen geheißen, nach den neuen Berechnungen dagegen war jetzt von zwölf Zentimetern die Rede, die nahezu alle schon gefallen waren. Das Unwetter würde sich einfach verziehen.
Ich würde Shel melden müssen. Das stand außer Frage. Er war labil, möglicherweise wahnhaft, offenbar gewalttätig, und ihm fehlte das grundlegende Urteilsvermögen, all dies nicht vor einem Kollegen auszubreiten. Jedenfalls konnte es durchaus sein, dass er hinter TruthFlex steckte. Wer sonst, wenn nicht er? Shel brauchte Hilfe, ganz klar, und ich hoffte, er würde sie bekommen. Aber was, wenn in dieser Sporttasche Waffen waren? Ich würde Lisa Bescheid geben. Andererseits konnte ich wohl auch zu Manny gehen. War er für solche Sachen da? Stellte Shel eine Sicherheitslage dar? Ich sah die ausdruckslose Miene vor mir, die Manny zur Schau tragen würde, während ich durch meinen Bericht von dem Gespräch haspelte, mich immer wieder selbst unterbrechend, um wichtige Details hinzuzufügen, die ich ausgelassen hatte. Nein, ich würde warten, bis ich mit Lisa sprechen konnte. Es müsste ein persönliches Gespräch sein; ich wollte nichts Schriftliches darüber hinterlassen. Jetzt würde ich erst mal meine Sachen holen und mich davonstehlen. Ich müsste an Manny vorbei, was nicht ganz einfach war. Aber ein Tag allein mit Bradt zu Hause war mir lieber als das hier. Zunächst machte ich allerdings gar nichts – es war schön dort, geschützt auf der Toilette, vierzehn Etagen über der Erde.
Alles war heller, als ich an meinen Schreibtisch zurückkehrte. Es schneite nicht mehr, abgesehen von kleinen Flockenschauern, und die Sonne kam raus. Durch die Fenster sah ich unten ein paar Räumfahrzeuge Schnee von der Straße schieben. Ich packte so schnell wie möglich meine Sachen. Dann sah ich kurz hoch. Manny war im Anmarsch.
Seine Stimme hallte durch den Raum wie ein Schuss: »Alles klar hier, Bro?«
»Hey, Manny«, sagte ich und wies mit dem Kopf auf die Fenster. »Schneit nicht mehr.«
Er blinzelte. »Irgendwie komisch, oder? Vor ein paar Stunden waren die sich noch so sicher, dass es das ganz große Ding ist.«
»Also, ich denke, ich fahr jetzt mal nach Hause.«
»Gut, gut«, sagte er, über meine Wabe gebeugt. Irgendein Geruch ging von ihm aus, etwas Scharfes, Chemisches, wie ein Tonikum. »Würde ich auch gern.«
»Vielleicht wenn Shel weg ist?«, wagte ich mich vor, unsicher, ob er mich verstehen würde. »Ist es – müssen Sie … also, bleiben Sie wegen Shel?«
Er runzelte die Stirn. »Was ist los, Bro?«
»Ich sorg mich bloß ein bisschen wegen ihm.«
Er blickte auf mich runter. »Ach was«, sagte er. »Shel ist okay.«
»Er macht anscheinend gerade eine schwierige Zeit durch.« Ich scannte Mannys Gesicht nach Anzeichen von Verständnis. »Ich hab vorhin mit ihm geredet«, sagte ich, in der Hoffnung, das würde die Sache verdeutlichen. »Und – also der Punkt ist, ich glaube, er könnte etwas Unterstützung brauchen. Ich sorge mich um ihn. Verstehen Sie?«
»Sie und Shel? Sie beide sind hier die Einzigen, die nett zu mir sind. Alle anderen behandeln mich scheiße, entschuldigen Sie den Kraftausdruck.«
»Ich wollte es nur mal erwähnen.«
»Kein Problem.« Als ich kurz an Manny vorbeiblickte, sah ich, dass Shel sich mit verschränkten Armen auf seinem Stuhl zurückgelehnt hatte und uns beobachtete. »Es ist bloß so«, sagte ich, zunehmend verzweifelt, »dass wir uns über TruthFlex unterhalten haben.«
»TruthFlex.« Manny schüttelte den Kopf. »Alles Gerüchte, Bro.«
»Wie meinen Sie das? Es gibt keine Bedrohung? Wissen Sie, wer TruthFlex ist?«
»Sind Sie das nicht?« Er lachte und stach mich mit einem dicken Finger.
»Ich?« Ich zuckte zurück, hob die Hände.
»Ganz ruhig, Bro. Ich verscheißer Sie nur.«
»Nein, ich nicht. Ich bin nicht TruthFlex.«
»Klar, weiß ich. Weil ich nämlich TruthFlex bin.«
»Ja?«
Er verlagerte das Gewicht, ließ die Arme sinken. »Wollen Sie meine Meinung hören? Ich tippe auf Lisa.«
»Lisa?«
»Lisa ist nun wirklich nicht die typische Bitch.« Er hielt sich den Mund zu. »Entschuldigung. Aber wissen Sie, was ich meine? Die hat’s voll drauf. Hey, Bro, man kann nicht mit jedem so ehrlich reden – man muss wissen, wem man vertrauen kann. Aber wir verstehen uns.« Er gab mir die Hand, zwei Finger wieder so komisch gekrümmt wie zuvor. »Man muss sich bilden«, sagte er, meine Hand fest in seiner. »Das wichtigste Ereignis der neueren Geschichte, wenn man sich anguckt, wo wir jetzt stehen? Für mich das Balfour-Abkommen.«
»Ja.« Ich versuchte, meine Hand wegzuziehen; er ließ mich nicht.
»Also, Bro. Die aschkenasischen Juden sind extrem intelligent und fähig.«
Ich biss mir in die Wange. »Klar.«
»Und sie haben eine der schlimmsten Gräueltaten der Geschichte erlebt. Im Internet sieht man Bilder von diesen Konzentrationslagern. All die Menschen da, alle am Arsch.« Mit der freien Hand hielt er sich den Mund zu. »Entschuldigung.«
»Kein Problem.« Er ließ meine Hand los.
»Und trotzdem ist da eine Chance draus geworden. Wenn man sich so anguckt, wie die aschkenasischen Juden sich über den Globus verbreitet haben. Das waren Flüchtlinge. Die Nationen der Welt haben sie aufgenommen. Und jetzt? Schmeißen sie hier den Laden. Wenn Sie wissen, was ich meine.« An jedem anderen Tag hätte Manny längst wieder zu seinem Pult zurückgemusst, um einen Besucherausweis auszuhändigen, oder ich wäre im allgemeinen Betrieb auf der Etage weitergetragen worden. »Wenn man’s mal so betrachtet«, fuhr er fort, »nimmt man einen Verlust hin, um einen Gewinn zu erzielen. So läuft das im Geschäftsleben ja mitunter auch. Wenn Sie wissen, was ich meine.« Er knöpfte sein Jackett auf und beugte sich über die Wabentrennwand. Er stand sehr nah bei mir, direkt zwischen mir und dem Ausgang.
»Ich glaube, ja«, sagte ich und begriff, dass dies immer schon Manny gewesen war, der echte Manny, genauso wie das da hinten der echte Shel war, der sich hinter der Fassade der Routine versteckte und abwartete, mit der geballten Geduld des Fanatikers auf eine dunkle Eventualität wartete, in der er sich offenbaren konnte. Sie waren Mitglieder eines eigenartigen Bunds, die einander instinktiv erkannten, Blicke wechselten, sich heimlich auf etwas vorbereiteten, vielleicht nicht mal auf das Gleiche, aber gleich in ihrem Sinnen und Trachten. Und mich hatten sie als einen von ihnen ausgemacht.
»Lisa schickt den Scheißdreck selbst rum, Bro. Tut so, als ob jemand sie fertigmachen will. Verstehen Sie? So hat ihr Team das doch schon immer gemacht. Und so schnell, wie sie dann befördert wird, kann man gar nicht gucken. Warten Sie’s ab.« Er zuckte mit den Schultern. »Ist schon gut. Ich sage immer: Was mich betrifft? Ich halte den Ball flach. Aber ich weiß, dass da irgendwas läuft. Alles komisch gerade.« Er wies mit dem Kopf auf die Fenster. »Ist fast so weit da draußen. Überlegen Sie mal. Den Job hier hab ich nur gekriegt, weil in Schulen rumgeballert wird und so. Da kommt was, Bro. Ich weiß nicht, was. Ich beobachte nur. Ich warte. Verstehen Sie? Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wenn es passiert, kein Problem für mich. Klaro? Aber all die Leute hier« – er blickte in die Richtung der leeren Waben – »die glauben, alles geht immer so weiter wie jetzt.«
Mir kam eine Idee: Ich konnte mir ja einen Wagen rufen. Ich war nicht machtlos. Ich öffnete die App, sah, dass ich mich ausgeloggt hatte, gab zweimal das falsche Passwort ein. »Ich will nicht unhöflich sein, Manny«, sagte ich, den Blick gesenkt, »ich muss nur mal eben –«
»Und ich denk mir so: Wofür wollen die mich hier in Wirklichkeit haben? Die Leute vom Management, meine ich, und wer auch immer über die bestimmt und wer auch immer über die bestimmt. Ich versuche mitzukriegen, wenn sie einen Schnitzer machen – oder wenn sie wollen, dass man denkt, sie hätten einen Schnitzer gemacht. Wie bei diesem Schneesturm. Wie soll so ein Schneesturm einfach verschwinden?«
»Stimmt.« Ein Wagen war unterwegs, blinkte die Park Avenue runter. Entsetzt sah ich, dass Shel, am anderen Ende der Etage und im Schatten, aufstand, seinen Stuhl ranschob und sich auf uns zubewegte.
»Am Ende des Tages sind’s die Reptilien, die die Fäden ziehen. Hillary Clinton hat’s vermasselt und ihre Reptiliengestalt angenommen, als sie bei Kimmel war, Bro. Ich schick Ihnen den Link. Ich schick Ihnen Links zu all diesem Scheißdreck. Ist alles auf YouTube. Ich brauch bloß Ihre private E-Mail-Adresse.«
Mein Handy summte. TruthFlex00–[email protected]: »RASSISTIN Lisa Horowitz hasst alle Weißen.«
»TruthFlex«, flüsterte ich.
Er lachte. »Sehen Sie? Lisa schickt den Mist rum, beim Scheißfrühstück im Bett.«
Shel war jetzt noch fünfzehn Schritte entfernt; er ging mit den Händen in den Hosentaschen. Wir drei konvergierten zu einer Singularität. Und das war unmöglich – das Gebäude würde dem nicht standhalten. Zusammen hätten Manny und Shel vielleicht genügend Macht, um Wirklichkeit werden zu lassen, was auch immer sie eigentlich wollten.
Doch dann leuchtete auf meinem Handy die Benachrichtigung auf. Ich streckte es ihm hin. »Manny – tut mir leid. Mein Taxi ist unten.«
Er wich einen Schritt zurück, atmete scharf durch die Nase ein. Ich hielt das Handy weiterhin hoch, ein Talisman zur Abwehr gegen ihn.
Tonlos sagte er: »Alles gut, Bro.«
»Ich hab einen Wagen bestellt. Er ist jetzt hier.« Ich winkte Shel mit dem Handy; er schaute im Dunkeln zu mir.
Manny senkte den Blick. »Ich hab Sie zu lange aufgehalten.«
»Überhaupt nicht«, sagte ich. Ich behielt Shel im Auge, steckte das Handy wieder ein, nahm meinen Rucksack. »Tut mir leid, dass ich so schnell losmuss.«
Er zwinkerte. »Fortsetzung folgt«, sagte er und streckte mir wieder die Hand mit den zwei gekrümmten Fingern hin – die Form einer Pistole, wie mir jetzt in den Sinn kam.
Ich schüttelte Manny die Hand. Und als ich bei den Fahrstühlen ankam, nahm ich die Treppe.
Draußen gleißte die Sonne auf dem Neuschnee. Ich musste blinzeln und die Augen beschirmen, aber die Stadt war wieder zu erkennen. Falls der Schneesturm das gewesen war, was Manny behauptete – ein Schwindel oder ein Experiment, eine Notfallübung, ein Probelauf –, war es jetzt beendet, die Daten waren erhoben, die Menschen nahmen überall ihre gewohnten Posen wieder ein. Am Bordstein stand ein schwarzer Wagen mit eingeschaltetem Warnblinklicht. Der Fahrer reckte den Hals, um mich durchs Fenster sehen zu können; ich hielt ihm meinen Handybildschirm hin, um meine Identität nachzuweisen.
Als wir uns in den fließenden Verkehr einfädelten, schloss ich die Augen und versuchte, nicht an Manny und Shel zu denken, nach wie vor in der vierzehnten Etage, jetzt gemeinsam im Dunkeln. Vielleicht würde bis morgen alles vergessen sein. Würde es aber nicht. Ich sah mich selbst in einem anderen Universum, nah genug an diesem, um von ihm überlagert zu werden, sah mich dort bei ihnen, alle drei stumm neben dem Pult stehend, ein Dreieck, in dieser endgültigen Konstellation erstarrt. Ich würde Shel melden müssen. Und Manny. Beide. Ich wünschte, es wäre ein automatisierter Vorgang – irgendwie schon erfolgt, durch eine beobachtende oder vermittelnde Instanz, die mich von meiner Position am Rand des Geschehens befreite. Und vielleicht würde die Instanz dann mich melden. Ich wollte es nur hinter mir haben. Wenn ich wüsste, wo ich die Instanz finden könnte, würde ich alles beichten, was immer sie wissen wollte.
Ich würde beichten, dass auch ich die Diversitätsworkshops hasste; ich hasste Leigh Randi, den händeringenden und humorlosen Workshopleiter, der im Schneidersitz auf dem Tisch saß und in einer Art Internetslang mit uns sprach. Ich würde beichten, dass ich manchmal die Helligkeit von meinem Handy runterdimmte, um im Zug heimlich Fotos von Frauen zu machen. Und dass ich zu Bildern von der Schwester meiner Exfrau auf Facebook masturbiert hatte. Dass ich Shel angelogen hatte – wir hatten oft heftigen Streit gehabt, meine Exfrau und ich; einmal hatten wir uns vor einer Bar so laut gestritten, dass ein Mann über die Straße gesprintet war, um zu fragen, ob sie Hilfe brauchte. Dass ich sie einmal zu Fall gebracht hatte – aus Versehen, ich war entsetzt –, weil ich mich mit der Schulter gegen die Badezimmertür gestemmt hatte, als sie sie zuzuhalten versuchte. Ich würde beichten, dass ich durch die Scheidung einen Großteil meiner Freunde verloren hatte. Dass es mir beim Einschlafen half, mir vorzustellen, wie ich mich erschoss. Ich drückte den Kopf gegen die kalte Scheibe. Früher oder später würden mir alle auf die Schliche kommen.
Bilal, der Fahrer, redete von Mekka und Medina, den heiligen Städten. Sie verströmten ein sakrales Licht, sagte er. Es sei vom Weltraum aus zu sehen; Astronauten hätten es beobachtet, würden es aus Angst vor einer Massenhysterie aber geheim halten. Egal, die wichtigen Fakten seien online zu finden, verstreut, für jeden, der wisse, wo man suchen müsse. Er lachte oft, hoch und eulenhaft, und fragte, ob ich an Gott glaubte. Ich sagte Ja. Ich hätte ihm sonst was erzählt, und der Fluss funkelte in der Sonne unter der Manhattan Bridge.
»Hallo?«, rief ich, als ich in die Wohnung kam. Der Strom war immer noch aus; meine Stimme hallte in der Kälte.
»Bradt?« Keine Antwort. Aber in der Spüle sah ich eine Müslischale, randvoll mit Wasser und Milch.
Geistesabwesend versuchte ich, meinen Rucksack auf einem kleinen Tisch abzustellen, der nicht mehr da war. Wo die alten Möbel gestanden hatten, waren noch Schatten auf dem Parkett. Dann hörte ich etwas, weiter hinten in der Wohnung. Ein leises Dröhnen. Vorsichtig ging ich darauf zu.
Dort in der Tiefe des Flurs, fernab von den Fenstern, wurde es so dunkel, dass ich eine Hand an der Wand behalten musste. Als ich mich der Stelle näherte, wo der Flur nach rechts zu Bradts Zimmer abbog, wurde das Geräusch lauter. Tastend fanden meine Finger die Tür zu meinem Zimmer – dem Zimmer, das jetzt meins war, das kleinere, fensterlose, wo einst vielleicht ein Baby hätte schlafen sollen. Mit schwacher Stimme rief ich noch einmal Bradts Namen.
Dann ging ich um die Ecke.
Bradts Tür war zu, aber darunter und entlang den Seiten drangen blaues Licht und schauerliche Geräusche heraus: Schusswechsel, Explosionen. Bradt keckerte und johlte dazu, sein Ton war vulgär, die Wörter undeutlich. Und es war genau wie in einem Traum, den ich gelegentlich habe – nein, es war ein Traum, den ich gelegentlich habe. Der Traum und dieser Moment waren das Gleiche: wie ich das Licht betrachte, den Kippschalter an der Wand betätige, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, ohne Wirkung.
Das Sauerkleehaus
1
Es war ein bescheidenes Sommerhaus, so eins, wie Ronna es aus ihrer Kindheit kannte, von den Sommerferien in Maine, Vermont oder an den Ufern der Finger Lakes. Es stand in einer Lichtung an einem dicht bewaldeten Berghang, friedvoll und abgelegen, außer Sichtweite von Straßen oder Nachbarn oder Sonstigem. Jacob öffnete alle Türen, kam die Treppe runter und bemerkte etwas streng, dass man das Haus mal auf Vordermann bringen müsse: der Küchenherd wackelte, die Matratze sackte in der Mitte ein, und die Sofas mit ihren karierten Wollbezügen stammten aus einem anderen Jahrhundert. Dennoch strahlte der Ort etwas Idyllisches aus.
Sie legten ihre Sachen in die mit Gänseblümchenpapier ausgekleideten Schubladen und stellten ihre Zahnbürsten hinter den fleckigen Badezimmerspiegel. Max bekam sein eigenes Zimmer. Wenn er nachts wach wurde und weinte, ging Ronna durch den Korridor, um ihn aus dem Gitterbett zu holen, einer hölzernen Antiquität mit locker gewordenen Stäben. Auf den Regalen im Wohnzimmer dienten Hirschgeweihe als Buchstützen. An der Wand hing ein gerahmter Hi-and-Lois-Comicstrip. Der Text lautete: »Schon als kleines Mädchen bin ich hierhergekommen, in die alte Hütte. Ich liebe den Geruch von Mottenkugeln, die ramponierte Einrichtung … die morsche Veranda … Es gibt weder Fernsehen noch Telefon oder Internet. Aber so mag ich es am liebsten!«
In dieser Woche stieg eine Hitzewelle vom Tal herauf. Sie verbrachten einen Nachmittag am Bach im Wald. Drahtförmige Insekten glitten über die ufernahen Wasserwirbel, und aus den Bäumen tönte das Gehämmer von Spechten. Ronna wiederholte das Wort für Max: »Specht.« Er konnte nun schon viele Wörter und seit kurzer Zeit auch selbstständig laufen. Wenn er über eine Wurzel stolperte, stellte Ronna ihn wieder auf die Beine, wischte ihm die Kiefernnadeln ab, und sofort lief er weiter, in seinem Feuerwehr-T-Shirt und den blauen Sommerschuhen, und zog seine Stoffpuppe Quinn an einem Bein hinter sich her.
Auf dem Weg zurück zum Haus begegneten sie zum ersten Mal der Schnappschildkröte. Die Sonne stand schon tiefer, aber der Tag war noch heiß, die Luft voller Fliegen und Schnaken. Die Schildkröte blieb stehen, um die Besucher vom grasigen Wegrand aus zu studieren. Sie war riesig, hatte knorrige Haut und helle Schlammspuren auf dem Panzer. Die ist vielleicht hundert Jahre alt, dachte Ronna. Schildkröten erreichten ja manchmal so ein hohes Alter – schwindelerregend, cartoonhaft hoch.
Max verzog das Gesicht und wandte sich ab. »Unheimich«, sagte er.
Es war sein einziger abstrakter Begriff. Was genau er damit meinte, war schwer zu sagen. Die Schildkröte war »unheimich«, aber dasselbe galt für Spinat und Schlafengehen.
»Nein, sie ist doch schön«, sagte Jacob. »Schau.« Er stellte Max auf die Erde, hockte sich hinter die Schildkröte, krümmte seine Finger auf beiden Seiten unter den Rand des Panzers und hob sie hoch.