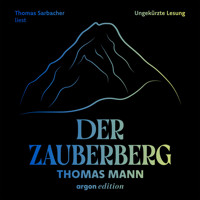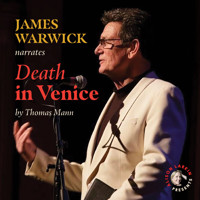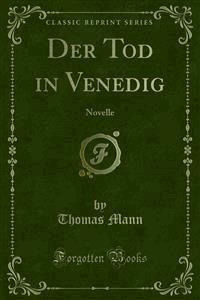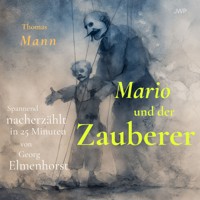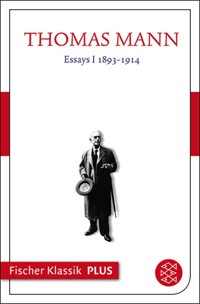
29,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Thomas Mann, Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke, Briefe, Tagebücher
- Sprache: Deutsch
Dieser Band beinhaltet alle nichtfiktionalen Texte Thomas Manns von den Beiträgen zur Schülerzeitung ›Frühlingssturm‹ 1893 bis zum Kriegsausbruch 1914. Die Essays beeindrucken durch die Vielfalt der Themen und Positionen und zeigen den jungen Thomas Mann als Literaturkritiker, Experimentator, Selbstdarsteller und Denker. Einige der wichtigen Texte zur Literatur und Dramatik (›Bilse und ich‹, ›Versuch über das Theater‹, ›Der Literat‹) oder Porträts großer Vorbilder (Fontane, Chamisso) entstanden in dieser Schaffensphase. Der Kommentar von Heinrich Detering (unter Mitarbeit von Stephan Stachorksi) liefert nicht nur alle zum Textverständnis nötigen Daten über Entstehung und Wirkung, sondern zeichnet Traditions- und Entwicklungslinien nach, die eine adäquate Würdigung des jungen Essayisten Thomas Mann überhaupt erst ermöglichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 474
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Thomas Mann
Essays I 1893-1914
Essay
FISCHER E-Books
In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA) Mit Daten zu Leben und Werk
Inhalt
[Frühlingssturm!]
Es war mittags. Nach der Schule. Zwischen 1 und 2 Uhr. Ich hatte noch keine Lust nach Hause zu gehen und bummelte, meinen Cäsar unterm Arm und eine Bostanjoglo zwischen den Lippen, durch die Straßen und vors Tor hinaus.
Vor welches? – Das ist erstens ganz egal, und zweitens weiß ich es selber nicht, denn ich gab nicht im mindesten acht darauf, wohin ich ging. Ich schlenderte völlig gedankenlos – wenn man aus der Schule kommt, ist man das immer, ins Ungewisse hinein, und ich weiß nur, daß ich mich nach geraumer Zeit auf einer Bank befand, vor der sich eine umfangreiche Grasfläche ausbreitete.
Es war ein merkwürdig warmer Frühlingstag. So warm, daß alles Knospen und Blühen um mich her ersichtlich darunter litt. Alles sah durstig und müde aus. Regungslos ragte eine Gruppe Kastanienbäume neben mir in die Höhe. Über der begrasten Höhe lag zolldick Staub.
Und kein Luftzug. Nicht das allergeringste merkbare Leben in all dieser schlaffen Trockenheit.
[Eine absolute Stille.
Für ihn lag in dieser staubigen Stille ein solcher Stumpfsinn, eine so blödsinnige Schlaffheit, daß er unwillkürlich eine heftige körperliche Bewegung machte, wie um die Natur aus ihrer dumpfen Regungslosigkeit aufzuschrecken. Und da plötzlich, als ob er das Zeichen dazu gegeben hätte, begann in der Ferne ein Rauschen laut zu werden, ein Säuseln eigentlich nur, aber näher und näher. Und dann kam es krachend und brausend durch Bäume und Buschwerk daher und fuhr durch die schlafenden Kronen der alten Kastanien und strich über die Grasfläche, daß der dumme Staub in Wolken sich erhob, verscheucht, aufgewettert … Frühlingssturm!
Dies Erlebnis wird für ihn zum Symbol. Und als er zu Hause wieder am Schreibtisch sitzt und den Cäsar mit kräftigem Wurf in die Ecke geschleudert hatte, greift er zur Feder:]
Frühlingssturm!
Unser würdiges Lübeck ist eine gute Stadt. O, eine ganz vorzügliche Stadt! Doch will es mich oftmals bedünken, als gliche sie jenem Grasplatz, bedeckt mit Staub, und bedürfe des Frühlingssturms, der kraftvoll das Leben herauswühlt aus der erstickenden Hülle. Denn das Leben ist da! Gewiß, das merkt man an einzelnen grünen Halmen, die sich frisch aus der Staubschicht erheben, voll Jugendkraft und Kampfesmut, voll vorurteilsfreien Anschauungen und strahlenden Idealen!
⟨…⟩
Frühlingssturm! Ja, wie der Frühlingssturm in die verstaubte Natur, so wollen wir hineinfahren mit Worten und Gedanken in die Fülle von Gehirnverstaubtheit und Ignoranz und bornierten, aufgeblasenen Philistertums, die sich uns entgegenstellt. Das will unser Blatt, das will »Der Frühlingssturm«! –
[Über Ibsens »Baumeister Solness«]
⟨…⟩ Apropos, wie war das noch mit dem »Robusten Gewissen«? Ich muß mich in dieser Beziehung wirklich über meine Neigung zum Zarten wundern, denn ich habe meine Schularbeiten zu morgen mit einer Gewissenhaftigkeit abgetan, die man superrobust zu nennen berechtigt wäre. ⟨…⟩
An unsere Leser [I]
Wie leicht erklärlich, ist die Expedition unseres Blattes im Monat Juli als während der großen Ferien unmöglich. Da wir jedoch unsere Abonnenten durch diesen Umstand in keiner Weise geschädigt wissen wollen, so haben wir den größten Teil unseres Manuskript-Vorrates zu einer Doppelnummer zusammengezogen, den wir hiermit den geschätzten Lesern hochachtungsvoll übersenden.
Die Leitung.
Heinrich Heine, der »Gute«
Daß Sympathie da ist – o gewiß, das ist sehr erfreulich, aber daß sie sich immer wieder darin äußert, ihn als »guten« Menschen rehabilitieren zu wollen, das ist wirklich komisch!
Es mag sehr Unrecht von mir sein, aber ich habe nun einmal die Gewohnheit, sobald ich den Ausdruck »ein guter Mensch« höre, ihn mir blitzschnell ins französische zu übersetzen: un bonhomme. Man könnte sagen, das sei ein Beispiel für den berühmten Schritt vom Süblimen zum Ridicülen; meiner Auffassung nach jedoch haftet dem »gut« in obengenannter Verbindung so herzlich wenig Süblimes an, daß ich mich geradezu beleidigt fühlen würde, wollte mir jemand dies Prädikat aufhängen.
Indem ich dies sage, stelle ich mich nicht einmal auf meinen sonstigen philosophischen Standpunkt, von dem aus ich die Wörter »gut« und »schlecht« als soziale Aushängeschilder ohne jede philosophische Bedeutung und als Begriffe betrachte, deren theoretischer Wert nicht größer ist, als derjenige der Begriffe »oben« und »unten«. Ein absolutes »gut« oder »schlecht«, »wahr« oder »unwahr«, »schön« oder »häßlich« giebt es eben in der Theorie ebensowenig, wie es im Raum ein oben und unten giebt.
Aber, wie gesagt, soviel Philosophie braucht man garnicht herbeizuziehn, um zu verstehn wie ich’s meine. Ganz abgesehn von aller grauen Theorie bitte ich nur, mir einmal in der grünen, goldnen Praxis einen wirklich guten Menschen zu zeigen. Ich schwöre, sofort reuig an meine Brust zu schlagen, denn ein solcher Mensch wäre eine wahrhaft süblime Erscheinung.
Aber bleibt mir nur vom Leibe mit diesen sogenannt »guten« Menschen, deren Gutheit aus praktischem Lebensegoismus und christlicher Moral mit möglichster Inkonsequenz zusammengestückt ist! Von dem süblimen, wirklich guten Idealmenschen bis zu diesem ridicülen Otterngezüchte ist nicht ein Schritt, sondern eine Ewigkeit!
Und zu einer solchen Spottgeburt sucht man immer und immer wieder meinen Heine zu stempeln?!
Da schwang sich wieder vor einiger Zeit im »Zeitgeist« (Beiblatt des Berliner Tageblattes) ein Dr. Conrad Scipio zu einem mäßig stilisierten Artikel auf, betitelt »Zur Würdigung Heinrich Heines«, in dem er aus Leibeskräften bewies, das lockere Privatleben Heines müsse man demselben unbedingt verzeihn, weil er doch im Grunde ein guter Protestant und ein guter Patriot – und was der Komplimente noch mehr waren – gewesen sei.
Es ist zu lächerlich! Glaubt denn dies Menschlein wirklich, dem toten Harry Heine einen nachträglichen Gefallen zu erweisen, wenn er ihm solche Beschränktheiten nachsagt?! – Und was das für Beweise waren! – Weil Heine mit Begeisterung von Martin Luther spricht, ist er ein Protestant! Mit demselben Rechte könnte Dr. Scipio sagen: Weil Heine – ich glaube, es war auf Helgoland – so eifrig die Bibel las und dies Buch sehr schön fand, war er ein Pietist! – Heinrich Heine, mein lieber Herr Doktor, bewunderte Napoleon, trotzdem er ein geborener Deutscher war, und er bewunderte Luther, trotzdem er kein Protestant war.
Wozu überhaupt der Versuch, ihn selbst Lügen zu strafen, der sich noch in der letzten Zeit seines Lebens, als er »zuweilen an Auferstehung glaubte« und die Hoffnung aussprach: »Dieu me pardonnera, c’est son métier –« eifrig gegen das ausgestreute Gerücht bewahrte, er sei »in den Schoß einer Kirche zurückgekehrt«? Für Geister, wie Sie keiner sind, werter Herr, sind dogmatische Zwangsjacken irgend welcher Art nun mal nicht geschneidert. –
Ach, und dann das Triumpfgeschrei, das man so oft anhören muß: »Ja, nichtwahr? Daß dieser Heine, der sein Lebtag unsere Moral mit Worten und Werken geschmäht hat, auf dem Totenbett zu seinem Gott zurückgekehrt ist, das beweist doch …« Was, bitte? Wann ist das Urteil eines Menschen am kompetentesten, wenn er in körperlicher und geistiger Blüte steht, oder wenn er zum »spiritualistischen Skelette« abgemagert der gänzlichen Auflösung entgegen siecht?! –
Und das Patriotentum Heines!
Ich muß gestehen, die diesbezüglichen Beweise Dr. Scipios sind mir zu weit entfallen, als daß ich sie hier heranziehen könnte. Aber wenn von Patriotismus überhaupt die Rede ist, fällt mir immer ein Wort ein, das ich einmal von einem meiner Schullehrer hörte. »Göthes Geist«, so sagte etwa dieser Brave, »war zu groß und gewaltig, um an der Vaterlandsliebe genüge zu finden; er umspannte die ganze Welt.« Bravo! Also der Mensch muß schon von einer gewißgradigen geistigen Beschränktheit sein, um Patriot sein zu können. – Ob wohl Heines Geist beschränkt genug dazu war, Herr Dr. Scipio? –
Nein, Heinrich Heine war kein »guter« Mensch. Er war nur ein großer Mensch. – Nur …!
Der Artikel war übrigens so dürr und würdig geschrieben, daß der Doktor dafür Professor zu werden verdiente. –
Lübecker Theater
Tivoli. Mittwoch den 24. Mai. Das Sonntagskind. Große Operette in drei Akten von Hugo Wittmann und Bauer. Musik von Carl Millöcker.
Nach den schweren Kunstgenüssen, die uns das Stadttheater im vergangenen Winter brachte, wirken die kleinen Tivoli- und Wilhelmtheateramüsements etwa wie ein Glas Selters nach einem großen Diner. – Die gewaltigen Wagner-Gerhäuser-Abende der Saison lagen mir – um im Bilde zu bleiben – noch schwer im Magen; so that mir Millöckers Kohlensäure-Musik wirklich ganz ausgezeichnet gut.
Wenn schon Blödsinn – denn schon gehörig. Das ist ein unbestreitbar richtiges Princip. Daher geh’ ich auch nicht gern zur Schule. Das ist halber Kram. Im »Sonntagskind« aber ist der Blödsinn mit reizender Konsequenz durchgeführt, und darum ist es ein durchaus lobenswertes und ästhetisch völlig unanfechtbares Stück. In den Couplets wird sogar Ibsen citiert. Ich meine, mehr kann man doch nicht verlangen!
Gespielt und gesungen wurde im allgemeinen ganz nett. Durch flottes Spiel und hübschen Vortrag zeichnete sich besonders Herr Paulson aus. Nur Herr Zähler als Sir Edgar wußte nicht recht, wie er sich benehmen sollte. Es ist aber auch eine unheimliche Rolle, und der Übergang von dem melancholischen Helden des ersten Akts zu dem ulkigen Drrrrr-Dragoner nachher ist wirklich etwas hastig. Na, – hübsch war’s doch!
Regie und Orchester waren gleich fürtrefflich. In der königlichen Oper zu Berlin mag es ja noch besser sein. So hörte ich wenigstens.
Paul Thomas.
An unsere Leser [II]
Wir wollen nicht verfehlen, die geneigten Leser darauf aufmerksam zu machen, daß momentan in Interessentenkreisen ein komisches Drama coursiert, dessen Tendenz scharf gegen unser Blatt gerichtet ist. Wenngleich wir Grund hätten, den glänzenden Humor des Werkchens, den, wie wir vernehmen, der Verfasser schon früher unfreiwilligerweise in Liebesliedern zum Ausdruck brachte, zu fürchten, so können wir andererseits nicht umhin, unserer Freude, über diese brillante Reklame für unser Blatt Ausdruck zu verleih’n! Wir raten also dringend zur Lektüre!
Die Leitung.
[»Das Liebeskonzil«]
Man weiß, daß neulich Herr Dr. Oskar Panizza bei Gelegenheit seiner sogenannten Himmelstragödie »Das Liebeskonzil«, die nur so ungefähr neunzig kleine Gotteslästerungen aufzuweisen hatte, vom Königlichen Landgericht München I zu einem Jahre Gefängniß verurtheilt worden ist, und man soll nun auch wissen, daß dieser Dichter, ebenfalls bei Schabelitz in Zürich, die Vertheidigungsrede hat erscheinen lassen, die er damals vor Gericht gehalten ist. – Es ist natürlich, daß, als das Urtheil gefällt war, die voll und ganz Modernen des Landes wieder einmal nicht genug des Hohns wußten über den deutschen Staatsanwalt an sich, der seine modern-dichtkünstlerische Unbildung aufs Neue fürchterlich bewiesen hatte. Es ist ferner natürlich, daß Panizza selbst in seiner Vertheidigungsrede den künstlerischen Standpunkt ebenso wenig verläßt, wie Dr. Conrad, dessen sachverständiges Gutachten der freundl. Leser für 60 Pf. mit in den Kauf bekommt. Aber es war, ist und bleibt bei allen derartigen Prozessen zu bedenken, daß das Gericht andere Interessen zu vertreten hat, als die künstlerischen; praktischere Interessen, die Dr. Conrad, der doch wohl für gewöhnlich mehr Politiker als Künstler ist, im Stillen und Geheimen gewiß nicht hat außer Acht lassen können. Aber er ist auch Künstler, und deshalb scheut er sich bei allem Wohlwollen nicht, von »mir persönlich widerlichen Geschmacklosigkeiten« zu reden, die das »Liebeskonzil« in Massen enthält. Was gilt es? sollten diese vom Künstler sogenannten »Geschmacklosigkeiten« nicht dieselben 90 oder 93 Fälle sein, die der Staatsanwalt »Gotteslästerungen« nennt? Kann man dann nicht auch vom künstlerischen Standpunkt aus mit der Verurtheilung einverstanden sein? Oder sind wirklich die Leute, die in der Kunst ein bischen guten Geschmack noch immer verlangen, nichts als zurückgebliebene Banausen?
T.M.
»Ze Garten«
Ze Garten. Ein deutscher Sang am Gardasee von Karl Habermann. (Pierson’s Verlag. Dresden, Leipzig und Wien 1895.)
Ein deutscher Sang, der unter fremdem Volke gesungen ward – und doch auf deutschem Boden. Formfrohe und breit hinfließende Sonette sind es, die vom Gardasee reden und seiner Märchenschönheit. Land und See liegen in tausend Stimmungen vor uns ausgebreitet, und alle diese Stimmungen sind mit sicherer Kunst in strenge und vornehme Form gebannt, ohne daß ein Hauch, ein Schmelz verloren gegangen wäre. Zwischen feierlichen Cypressen aber und süß duftenden Rosen lauscht das holde Mädchenhaupt hervor dem diese Lieder gesungen wurden, und dem dann doch, als der schöne Traum ausgeträumt, das ergreifendste gelten mußte: »Ein Scheiden war es …« – Allen Freunden deutscher Poesie sei das geschmackvoll ausgestattete Büchlein warm empfohlen.
T.M.
»Ostmarkklänge. Gedichte von Theodor Hutter.«
Ostmarkklänge. Gedichte von Theodor Hutter.(H. Lüstenöder, Berlin. 2 Mk.)
Unter den Lyrikern giebt es neuerdings einige Leute, die es lieben, ihre Stimmungen und Gefühle »mit sich durchgehen zu lassen«. Man nennt das »Dionysische Kunst«, und Dehmels »Tagloni gleia glühlala«, das allmählich zu lustiger Popularität zu gelangen scheint, ist das lehrreichste Beispiel dafür. Nun ist ganz sicher Der kein Künstler, kein Kenner, der nicht siegreich über seinen Gefühlen steht, sie nicht zu meistern vermag, sondern in ohnmächtig unartikulirten Lauten nur sich Luft zu machen sucht. Es handelt sich darum, ungreifbare Nebel in den Zustand der Kunst zu ver»dichten«, nicht sie irr zerflattern zu lassen. Es handelt sich darum, das scheinbar Unsägliche in strenge Form zu bannen, nicht in bacchantischem Geheul nur die eigene Unfähigkeit darzuthun.
Darum sind Dichter froh zu begrüßen, die das, was sie zu sagen haben, schlicht und groß zu sagen vermögen, und zu ihnen gehört Theodor Hutter. Seine neue Gedichtsammlung zerfällt in fünf Abtheilungen, von denen die erste ›Gott‹ überschrieben ist. Sie ist vielleicht die beste von allen. Man findet Strophen, in denen die ganze innige Kraft lutherischer Gesänge zittert:
»Wenn ich des Lebens müde
Einst bin, gieb Tröstung mir,
Denn, Herr, Dein ist der Friede
Und alle Kraft bei Dir!«
Welch’ schlichte, echt protestantische Zuversicht athmet aus einem Gedicht wie dieses:
»Zu Allerseelen.«
»Ruht das Saatkorn in der Erde,
Wird es keimend auferstehen,
Wenn die Frühlingssonne leuchtet,
Wenn die Maienlüfte wehen.
Schläft der Mensch im Erdenschooße,
Ruht er in des Friedens Hafen –
Wird ihn auch ein Frühling wecken? –
Oder wird er ewig schlafen?«
Und von wahrer Dichterfrömmigkeit, die in der weiten Natur ihr schönstes Gotteshaus findet, zeugt die »Waldandacht«, die mit den schönen Versen beginnt:
»Hier, in des Waldes grünen Hallen,
Wo Gottes Fuß vorübergeht,
Wo seiner Allmacht Schauer wallen,
Der Segen ew’ger Majestät
Sich fühlbar macht in allen Wesen,
In Thier und Pflanze wunderbar,
Da kann mein Herz die Messe lesen
Vor Gottes herrlichstem Altar.«
– Der Heimath des Dichters, den Bergen Nordböhmens, ist die zweite, kürzere Abtheilung gewidmet. Es finden sich hier Naturstimmungen von großer Feinheit, wie z.B. das dreistrophige »Im Wald« und der »Frühlingsmorgen auf der Ruine Hammerstein«. – Es folgen eine Reihe nationaler Lieder, die warme Liebe zum deutschen Vaterland und zur deutschen Sprache bekunden. Am bemerkenswerthesten in dieser Gruppe ist vielleicht ein Gedicht, das mit dem Weckruf: »Wach auf, mein Volk!« beginnt. Wir führen zwei Strophen an:
»Ein Feind ist da – er rastet längst
Inmitten deutscher Lande,
Er ward zum Fluche jedem Volk,
Und uns ward er zur Schande
Er stritt mit Hinterlist und Trug,
Hat allzeit uns befehdet,
Hat Scham und Ehr’ und Redlichkeit
Mit seinem Gift ertödtet.«
– – – – – – – – – – – – –
»Der Feind, der Dir von Außen droht,
Kann nimmer Dich besiegen,
Läßt Du Dich nicht vom innern Feind
In süße Träume wiegen.
Drum feg’ hinweg ihn zornentbrannt
Aus allen Deinen Gauen –
Und laß ihn nicht in Deinem Land
Nomadenzelte bauen.«
– Der vierte Abschnitt gilt der Liebe. Er scheint uns der schwächste zu sein, viel schwächer jedenfalls, als der erste. Warum? Wahrscheinlich, weil unsere Litteratur mehr gute Liebeslieder als religiöse Gesänge aufzuweisen hat. Aber Strophen wie diese:
»Wie Sang von Nachtigallen
In mondbestrahltem Grund,
Klingt mir das Wort der Liebe
Aus Deinem Rosenmund.«
– sind auch wirklich das, was die Maler »Kitsch« nennen. Indessen kann man auch hier Klänge vernehmen, die, ohne zwar besonders originell zu sein, tief empfunden sind und tief zu Herzen gehen:
»Ich fühle Deiner Nähe Segen,
Und ruh’ in Deiner Liebe Bann,
Wenn ich die Hand in Deine legen
Und in Dein Auge schauen kann.
Und wie sich auch mein Schicksal wende,
Mein Hoffen ruht in Deinem Blick,
Und still leg’ ich in Deine Hände
Mein Lieben und mein ganzes Glück.«
– Die Schlußabtheilung, die den Titel »Aus stillen Stunden« führt, bringt Gedichte verschiedenen Inhaltes. Ein Ton herrscht vor: ein wehmüthig leiser Klang, der von den Schatten des Abends spricht, und den Herbst, den Winter ahnt:
»Dir kündet bang des Herbstwinds Klage,
Der Vogelsang, der stumme Wald,
Daß auch der Winter Deiner Tage
Dir naht, o Herz, gar bald, gar bald!«
Das Buch wird den Beifall finden, den es verdient. Theodor Hutter ist Einer von Denen, die dafür sorgen, daß im Reiche der Dichtkunst die lichte Majestät Apollos herrsche, und die sich nicht anschließen dem wankenden Zuge lallender Tyrsusschwinger.
T.M.
Erkenne dich Selbst!
Deine Lieblingseigenschaften am Manne? Geist, Geistigkeit.
Deine Lieblingseigenschaften am Weibe? Schönheit und Tugend.
Deine Lieblingsbeschäftigung? Zu dichten ohne zu schreiben.
Deine Idee vom Glück?Unabhängig und mit mirselbst im Einverständnis zu leben.
Welcher Beruf scheint Dir der beste? Der künstlerische.
Wer möchtest Du wohl sein, wenn nicht Du? Thörichte Frage!
Wo möchtest Du leben? In Rom.
Wann möchtest Du gelebt haben? Vielleicht zu Anfang dieses Jahrhunderts.
Deine Idee vom Unglück? Mittellos und daher abhängig zu sein.
Dein Hauptcharakterzug?Höflichkeit, auch gegen michselbst.
Deine Lieblingsschriftsteller? Heine, Goethe, Bourget, Nietzsche, Renan …
Deine Lieblingsmaler und –Bildhauer? Polyklet, Guido Reni, Lenbach …
Deine Lieblingskomponisten? Wagner, Richard Strauß, Grieg, Lassen, Fielitz …
Deine Lieblingsfarbe und –Blume? Weiß und blau – Maréchal Nil-Rose.
Lieblingshelden in der Geschichte? Christus. –
Lieblingsheldinnen in der Geschichte? Habe ich nicht.
Lieblingscharaktere in der Poesie? Hamlet, Tristan, Faust und Mephisto, Parsifal …
Deine Lieblingsnamen? Angelo, Victor, Ada, Elsa …
Welche geschichtlichen Charaktere kannst Du nicht leiden? Die ich nicht verstehe.
Welche Fehler würdest Du am ersten entschuldigen? Die positiven!
Deine unüberwindliche Abneigung? Kant, der kategorische Imperativ, die Staatsbeamtenphilosophie.
Wovor fürchtest Du Dich? Vor meinen Schwächen.
Lieblingsspeise und –Trank? – – – Kaffee.
Dein Temperament? Kontemplativ, hamletisch, von des Gedankens Blässe angekränkelt –
München, d. 17. 12. 95
Thomas Mann
Tiroler Sagen
In den Klüften und Schluchten des Gebirgs, in dessen Schoß Innsbruck sich schmiegt, sind die seltsamsten Geschichten zu Hause. Ein kleines Buch erzählt uns davon, das – dem Erzherzog Ferdinand Karl gewidmet – im Verlage der Wagner’schen Universitätsbuchhandlung zu Innsbruck letzthin erschienen ist und dessen Autor Adolf Ferdinand Dörler heißt. Unter dem Titel »Sagen aus Innsbruck’s Umgebung mit besonderer Berücksichtigung des Zillerthales[«] finden wir hier mehr als hundert der merkwürdigen Begebnisse zusammengestellt, von denen in den Alpthälern die Sage zu raunen weiß, und lernen die wunderlichen Gestalten kennen, die die Phantasie der Tiroler erschuf.
Es ist die Phantasie eines Volkes, das nicht in lachender Ebene sanft und mühelos sein Leben verbringt, sondern das von tausend Gefahren umgeben gegen tausend feindliche Mächte sein Dasein zu verteidigen hat. Nichts von tanzenden Elfen und schönen, gütigen Feen erfahren wir da, sondern von unheimlichen, tückischen Wesen nur erzählen diese Geschichten, das Gefühl, das sie erwecken, ist beängstigend wie das dumpfe Rauschen des Sturzbachs, finster und drohend wie die umwölkten Felsriesen, zwischen die sie uns versetzen, und wenn wirklich einmal mit schneeweißer Brust und sternklaren Augen aus den grünen Tiefen eines Bergsees die schöne Wasserfrau sich hebt, so geschieht es doch nur, um – schlechtes Wetter zu verkünden.
Es ist interessant, die heidnischen Überreste ausfindig zu machen, die in den Sagen vorhanden sind. In dem kopflosen Schimmelreiter, der da und dort sein Wesen treibt, dürfen wir das Gespenst unseres höchsten Gottes, des Wodan erkennen, an dessen Nachtgejaide auch die »Kasermanndl« gemahnen, die am Martinsabende von den Alpen abfahren, und die »Venediger-Käfer« mögen eine Reminiszenz sein an den Käferkultus der alten Germanen. Diese Venediger Käfer wurden in den Dörfern Tirols von den sonst übel berüchtigten »Venediger Manndln« feilgeboten, die als Hausierer manchmal ihr spukhaftes Dasein fristeten, und wer so klug war, einen solchen Käfer zu kaufen und zu seinem Gelde zu stecken, dem erneute sich dasselbe, mochte er ausgeben so viel er wollte, immer aufs neue. Die »Venediger« sind niemand anderer als die Venezianer, die schon früh, von dem an edlen Mineralien reichen Lande angelockt, herbeikamen, um die Schätze zu heben und davonzutragen, und die für das Volk allmälig zu einer besonderen Spezies von Gnomen wurden; die mit allerhand schatzweisenden Instrumenten bewaffnet waren und, um das Handwerk zu erlernen, in ihrer Vaterstadt beim Teufel selbst in die »schwarze Schule« gingen. Dem Meister aber gehörte am Ende der Lehrzeit der Schüler, der als letzter zur Thüre hinausging.
Aber obgleich von Anmutigerem als geifernden Sündern, tobenden Leichen, boshaften Wichten und schlimmen »Rattenkönigen« kaum die Rede ist, fehlt es diesen Erzählungen nicht durchaus an Humor, und ein heiterer Trotz gegen all’ die widrigen Mächte tritt hie und da hervor, der für das starke Volk charakteristisch ist und der es wohlgemut unternimmt, selbst den Teufel um eine schon verlorene Seele zu prellen. Der Teufel nämlich spielt entschieden eine Hauptrolle, und von den unterhaltenden und lehrreichen Geschichten, in denen er erscheint, mögen hier rasch ein paar wiedererzählt werden.
Bei einer Mühle im Zillerthal zum Beispiel unterhielt sich eine Anzahl Burschen einmal mit Raufen. Einer von ihnen aber, der noch von keinem geworfen war, ließ sich im Vollgefühl seiner Stärke zu dem gefährlichen Ausruf hinreißen: »Jatz war i kod recht bein Joige, mit an gonz kluan Toifel z’raffe!« Was selbstverständlicher, als daß sofort ein zwar unscheinbares Teufelchen am Platze war, das aber alsbald begann, so gräßlich mit dem Burschen umzuspringen, das er nicht glaubte, mit dem Leben davonzukommen. Seine Geistesgegenwart rettete ihn: Schnell zog er den Rosenkranz aus der Tasche, hieb seinem Gegner damit in’s Gesicht – und der schlimme Gast verschwand.
In die Liebesangelegenheiten junger Leute hat der Teufel sich nicht selten gemischt, und manchem Burschen, dem er beim Fensterln als schwarzer Kerl mit grünen Glasaugen erschien, hat er solchen Leichtsinn für immer verleidet. Eine Dirne, die eines Abends ihren Bua vor der Hausthür erwartete, hörte auch wie sonst sein immer näher kommendes Pfeifen, und als er endlich wirklich selbst erschien, nahm sie ihn hocherfreut mit sich in die Stube. Kaum aber hatte sich die Thüre geschlossen, als sie statt des Liebsten ein entsetzliches Wesen erblickte, daß sie packte und zwischen den Wänden umherschleuderte, so daß sie jämmerlich schrie. Ihr Herr, der Bauer, der herzueilte, rettete sie, indem er ein weißes Lamm aus dem Stalle holte und über ihren Kopf hielt, was den Bösen gleich vertrieb. Überhaupt pflegt es in ähnlichen Fällen bei einem heilsamen Schrecken sein Bewenden zu haben.
Nicht selten tritt uns der Böse in der Gestalt eines »Grünen Jägers« entgegen, eine Erinnerung an den Samiel Böhmens und den »Wilden Jäger«. So erschien er jener Dirn, die auf der Schwazer Brücke ihren Geliebten erwartete und, da derselbe ein wenig verzog, die Geduld verlor. Da trat plötzlich ein unbekannter, aber ungemein liebenswürdiger Jägerbursche auf sie zu, der sie aufforderte, mit ihm zum Tanze zu gehen. Das Mädchen sagte zu und schloß sich ihm an; als sie aber ein Stück Weges gegangen waren, begegnete ihnen zum Glück ein Kapuziner, der das Mädchen hastig beiseite nahm und sie eindringlich vor ihrem Begleiter warnte: er habe, sagte er, sofort den bösen Feind in ihm erkannt. Der heilige Mann hatte nur zu recht, denn als das Mädchen sich umsah, war von dem ungemein liebenswürdigen Jägerburschen nichts mehr als ein abscheulicher Schwefelgestank zu bemerken. – Eine moralische Ausdeutung solcher Begebenheiten liegt nahe; die folgende lehrt uns, daß, wer reinen Herzens ist, sich mit dem Teufel sogar einen familiären Scherz erlauben darf. Diese prachtvolle Geschichte, betitelt »Der schlafende Teufel«, mag hier im Original wiedergegeben werden.
»In einer mondhellen Winternacht kamen einst mehrere etwas angeheiterte Bauernburschen von Finkenberg herunter nach Burgstall. Wie sie den Einzelhof Kohlstatt erreichten, sahen sie den Teufel mit gesenktem Kopfe auf dem Gelände des Söllers sitzen. Er hatte ihnen den Rücken zugekehrt und sein Schweif hing lang herunter. Aus dem lauten Schnarchen des ›Gabach’n‹ schlossen die Burschen, daß er eingeschlafen sei. Sofort begannen sie, ihn mit tüchtigen Schneeballen zu traktieren. Dabei neigte der Teufel seinen Kopf, je nachdem das rechte oder linke Ohr getroffen war, schlaftrunken hin und her, kurz, er war lange nicht aufzuwecken. Endlich aber fuhr er doch aus seinen süßen Träumen empor und schrie, als er die Ruhestörer gewahrte: ›Boatet’s nor (wartet nur), es Saulet’r, i wear enk ast schun einkant’n (einheitzen)![‹]«
Den vielen Teufelsgeschichten steht eine gegenüber, in der unser Herrgott in eigener Person erscheint. Der Herr hatte von der Bösartigkeit der Bewohner des früher sehr reichen Schwendau viel übles vernommen und beschloß, die Übermütigen selbst einmal auf die Probe zu stellen. Als altes Bettlermanndl zog er von Haus zu Haus und bat um Herberge, ward aber mit Hohn und Härte überall verjagt, und nur ein altes Mütterchen gewährte freundlich ihm Unterkunft. Um Mitternacht aber begann draußen ein so schreckliches Rauschen, Donnern und Krachen, daß das Weiblein herzlich erschrak, und als es am Morgen vor die Hütte trat, gewahrte es mit Grausen, daß der Sidanbach das ganze Dorf in eine Wüste von Schlamm und Felsblöcken verwandelt hatte. Das Bettlermanndl aber sagte ihr beim Scheiden: »Diese Überschwemmung sei nur das Füllen, das Roß kommt noch nach«, und in der That ist die Gegend von Schwendau heute so arm, wie sie ehemals reich und fruchtbar war.
Es ist der Gott des Gebirgsvolkes, der uns hier entgegentritt, ein starker, eifriger Gott, dessen Zürnen furchtbar ist und vernichtend wie das Stürzen der Lawinen, auf dessen gnädige Allmacht der Gute aber mit Zuversicht bauen darf.
Thomas Mann.
Ein nationaler Dichter
Dorsenne, der sensationslüsterne »Dilettant« in Bourget’s »Kosmopolis«, muß aus dem Munde des Marquis Montfaucon über den Kosmopolitismus harte Worte vernehmen. Der alte Katholik und Legitimist, der dem Typus des skeptischen ästhetisierenden Genußmenschen prachtvoll gegenübersteht, sagt es in seiner eifernden Weise heraus, daß diese Entwurzelten, die er haßt, fast immer letzte Ausläufer ihrer Rasse sind, die ererbte Kräfte, geistige und materielle, verzehren, ohne sie zu vermehren, entartete Spätlinge, deren Väter einst wahre Arbeit verrichteten und sie ihren Söhnen überlieferten, damit diese an derselben Stelle ihre eigene Leistung hinzufügten. Auf diese Arbeit ist die Familie gegründet, die Familien machen das Volk und die Völker die Rasse, – die Kosmopoliten aber, losgelöst von allen ihren Traditionen, untüchtig, unfruchtbar, können und wollen nichts als genießen …
Nationales Empfinden ist heute überall aufs neue ein litterarischer Geschmack geworden, und was in Paris viel mehr nicht als ein neuer Décadencescherz, eine neue Form Renan’scher piété sans la foi zu sein braucht, das hat in Deutschland tiefere Wurzeln, denn die Deutschen sind, als das jüngste und gesündeste Kulturvolk Europas, wie keine andere Nation berufen, die Träger von Vaterlandsliebe, Religion und Familiensinn zu sein und zu bleiben.
Dieser Gedanke ist, kurz gefaßt, das Resultat eines von Anfang bis zu Ende glänzend geschriebenen Buches von Karl Weiß, das kürzlich – in zweiter, verbesserter Auflage – bei Th. Schröter in Leipzig erschienen ist. Dem Titel nach, der »Von Gibraltar nach Moskau« lautet, erwartet man ein Reisewerk; indessen wird weit mehr geboten, denn der Verfasser, der sich auf dem Titelblatt allzubescheiden einen »Litteraten« nennt, ist in der That ein Dichter von ganz eigenartiger Kraft. Wir wandern an seiner Hand durch Europa, um nur an den Plätzen zu verweilen, an denen die geschichtlichen Erinnerungen sich drängen, Erinnerungen, die unser Führer, ein mächtiger Zauberer, wie wir bald erkennen, zu Visionen uns zu gestalten weiß, zu Bildern voll Farbenpracht und dramatischem Leben.
Wir haben Gibraltar und Cadix gesehen, haben im Löwenhof der Alhambra eine zauberische Mondnacht verlebt, waren zugegen bei dem Kampfe, der zwischen Alfons von Kastilien und den Mauren um Toledo hin und wider wogte, und blicken von der Höhe des Kapitols entzückt nun auf die ewige Stadt. Noch ist es mit seinen Trümmerstätten das neue Rom, das wir sehen, aber schon ändert sich das Bild, und vor uns auf steigt das alte, das älteste, das Rom der Könige. Ihr entartetes Geschlecht muß republikanischer Tugend weichen, aus dem Schutthaufen, in den Brennus’ rotbärtige Horden die Stadt verwandelt, ersteht sie aufs neue, erstarkt in tausend Kämpfen, Karthago muß, Griechenland und Spanien der Stolzen erliegen, deren Wort endlich dem Erdkreis gebietet. Aber im Überfluß beginnt das Volk zu verweichlichen, Religion und Sittlichkeit geraten in Verfall, schon lächelt der Priester selbst der dumpfen Menge, die an die ewigen Götter einfältig vielleicht noch glaubt, das Volk steht nicht mehr, wie einst in der Not, wie ein Mann zusammen, jeder denkt nur an sich und wie er am besten seinen Lüsten zu fröhnen vermag, Zwietracht entsteht im Innern, aus Parteifehden werden Bürgerkriege – die Zeit ist da, wo Rom eines Imperators bedarf. Und stürzt Julius Cäsar auch unter den Dolchen der Verschworenen, ein anderer wird Herr, und mit Grausamkeit und Schmeichelei halten die Kaiser fortan das verkommene Volk sich gefügig. Die Fäulnis schreitet fort. Was gilt noch Religion, Familie, Vaterlandsliebe? Genuß ist alles; ohne Rücksicht sorge ein jeder, daß er so viel wie möglich davon erhasche! Das ist das Ende, das Mark der Nation ist vertrocknet, die morsche Herrlichkeit ist reif, unter den Streichen blondlockiger »Barbaren« zusammenzustürzen …
Die Bilder wechseln, in Frankreich, Holland und England haben wir geweilt, und auf deutschem Boden befinden wir uns: am Fuße des Niederwalddenkmals. Die wundervolle Geschichte Deutschlands zieht an uns vorüber, wir betrachten auf dem großen Reliefbilde vor uns die Gestalten der Männer, denen das Vaterland seine Größe verdankt, wir gedenken dessen, der uns von ihnen noch lebt, und lesen die trotzigen Verse, die in den Sockel der Germania eingemeißelt sind:
Lieb’ Vaterland kannst ruhig sein:
Fest steht und treu die Wacht am Rhein.
»Bekümmert dich«, so fragt dieser Führer den Schutzgeist seines Volkes, »der tiefe Riß, der im Streit der religiösen und politischen Parteien mitten durch das Reich geht? Aber«, so fährt er fort, »gesund ist der Kern unserer Völker. Wo schäumend sich der Most gebärdet, gibt es mit der Zeit einen Feuerwein. Die Krankheiten neuer Tage werden wir überwinden, denn edel, klar und kräftig sind unsere besten Männer, fromm und voll Tugend die Frauen, in Zucht und Ordnung die Kinder, die erwerben sollen, was sie von ihren Vätern ererbten. Wir glauben, arbeiten und hoffen!« –
Dem müden Skeptiker, dem Helden jenes oben erwähnten französischen Romans, zeigt der alte Katholik, der mit ihm im päpstlichen Garten lustwandelt, die ehrwürdige Gestalt Leo des Dreizehnten, in dem er den Arzt sieht für die seelische Krankheit seines Freundes. Er könnte dazu die Worte sprechen, die Karl Weiß in seinem Kapitel über: »Die Heimat der Heimatlosen auf Sylt« geschrieben hat: »Der Baum lebt nur solange, als seine Wurzel in den mütterlichen Erdboden versenkt ist, das Blatt solange, als es am Zweige sitzt, die Feder, solange sie am Vogel haftet, der Mensch, solange er von des ewigen Vaters der Liebe geistigem Arm umschlungen sich fühlt: Kindlein, bleibt in ihm, in dem wir leben, weben und sind!« –
»Dagmar, Lesseps und andere Gedichte«
Dagmar, Lesseps und andere Gedichte.Von Maurice Reinhold von Stern. Mit dem Bilde des Verfassers. Dresden, Leipzig und Wien. E. Piersons Verlag. 1896.
Man empfindet, wenn man einen neuen Band Stern’scher Lyrik öffnet, eine frohe Zuversicht, hier manchen schönen und feinen Genuß zu finden, und solche Erwartung wird auch von dieser neuen Gedichtsammlung in keinem Verse getäuscht. Man darf vielleicht nicht sagen, wenn auch die Dankbarkeit einen wieder einmal dazu verführen möchte, daß dieser Band der beste von allen ist; andere frühere mögen prachtvollere Rythmen, glühendere Farben enthalten. Wovon aber diese Verse reden, was sie bezeichnet, das ist die Ruhe der Vollendung, was wir in ihnen genießen, das ist die Sonnenhöhe, der Mittag, die Meisterschaft. – Oder will es langsam schon Nachmittag werden? Es geht eine Sehnsucht durch diese Lieder, ein Heimweh nach der Jugend spricht wehmütig aus mancher Strophe –
»Sehnsucht, dem freudelosen
Zauberst Du zarte Zier!
Duft wie von welkenden Rosen
Schwebt durch die Seele mir.«
Und warum ist, mit seiner sinnenden Dämmerstimmung das wunderschöne »Somniferum« dem Buche zu Häupten gestellt? – Aber, das sind eben Stimmungen, und es folgen ihnen andere, die von Mut und Kraft wieder erfüllt sind:
»Drum vorwärts mit verhängtem Zügel,
Die Wahrheitslanze eingelegt,
Du Jugendglaube, bist der Flügel,
Der uns zur Sonnennähe trägt.«
Das dreiteilige Gedicht »Lesseps« ist bezeichnend für die Entwicklung des Dichters, der einst der Gleichstellung aller Menschen als einem Ideale nachträumte, und der es dann gelernt hat, am Anblick mächtiger Persönlichkeiten sich zu begeistern. Ferdinand Lesseps ist hier als das unbekümmerte Genie erfaßt, das an Aktien, Gold und Ehre nicht denkt, das rücksichtslos nur seinen hochstrebenden Willen zu erfüllen trachtet, und dem die kleinen, bürgerlichen, vorsichtigen, über ihren Verlust erbosten Seelen gegenüber gestellt sind. Diese Ansicht braucht nicht die richtige zu sein, um einem Dichter wohl anzustehen. – »Dagmar« ist eine freie Behandlung der Storm’schen Novelle »Ein Fest auf Haderslevhuus«. Die vierfüßigen Jamben, in denen das Gedicht geschrieben ist, sind mit einer Virtuosität gearbeitet, die ihresgleichen sucht, und enthalten die ganze Eigenart Stern’scher Kunst: Farbe vor allem, Stimmung und plastische Bilder von frappierender Schärfe. – Den beiden größeren Dichtungen sind lyrische Blätter verschiedenen Inhaltes angereiht, von denen der Cyklus hervorgehoben werden muß, der den Namen »Im Glanz der Liebe« trägt. Vergeistigte Sinnlichkeit ist die Seele dieser Liebeslieder, wie sie etwa aus den Versen spricht:
»Ich will nicht dich nur, wenn ich dich umfange,
Wenn ich die Form in ihrer Reinheit seh’;
Es ist der reine Geist, den ich verlange:
Dein Leib ist mir die Brücke zur Idee!«
Von den wundervollen Stimmungen, die dieser Teil des Buches enthält, mag zum Schlusse hier die »Feierstunde« mitgeteilt werden:
»Gestillt ist nun endlich mein Sehnen und Heischen,
Die Ruhe ich fand sie nach brennendem Weh.
Ich höre nur Zwitschern, ich höre das Kreischen
Jauchzender, badender Knaben im See.
Es glitzert der See durch die schimmernden Zweige,
Es leuchten die nackten Leiber im Licht.
Ich falte die Hände und sinne und schweige,
Und die Sonne küßt mein Angesicht.«
T.M.
Kritik und Schaffen
In der Kritik lese ich einen Aufsatz von Hans Brennert, der von Kritik und Schaffen handelt und sich an einen kleinen Skandal anschließt, der kürzlich in Berlin laut geworden ist. Der Fall ist bekannt. Herr Alfred Kerr, ein begabter Kritiker, hatte das letzte Werk eines Schwankdichters namens Richard Skowronek in einem Tone besprochen, durch den sich derselbe persönlich beleidigt fühlte. Er forderte den Kritiker zum Duell. Der Kritiker aber vertraute die Sache nicht einem Ehrengerichte an, sondern überließ die Entscheidung einfach der öffentlichen Meinung. Darüber ist nichts zu bemerken, denn die Verweigerung des Zweikampfes spricht für nichts, als für die Prinzipientreue des Herrn Kerr. Nachzudenken aber bleibt darüber, wie zwischen einem Kritiker von litterarischem Ehrgeiz und einem arbeitsamen Theaterschreiber, der meinetwegen sogar eine Art von Talent besitzt, solche Zwieträchtigkeiten überhaupt entstehen können. Ein ernsthafter Kritiker wird es meistens unterlassen, über Werke zu schreiben, die ihn nicht in günstigem oder ungünstigem Sinne, interessieren, wenn er aber, durch Amt und Pflicht, dennoch dazu gezwungen ist, so bleibt es vollkommen unbegreiflich, wie er sich dabei zu Äußerungen erhitzen kann, die auch nur im entferntesten geeignet sind, den Verfasser des Werks zu beleidigen.
Dieser sehr einfache Gedanke wird von dem Verfasser des erwähnten Artikels nicht ausgesprochen; in seinen allgemeinen Betrachtungen aber über das Verhältnis zwischen Kunst und Kritik gelangt er zu der Behauptung, daß »das Recht des Schaffenden, sich über die Kritik übermütig hinwegzusetzen, immerhin größer bleiben wird als das Recht des Kritikers, eine Suprematie der Kritik über das Schaffen ausüben zu wollen«. Denn hat die Kunst nicht selbst die Gesetze erschaffen, nach denen der Kritiker sie zu beurteilen hat? – Diese Auffassung wäre richtig, wenn man heute noch Lust hätte, den Kritiker als eine Art ästhetischen Schulmeisters zu verstehen, dessen vollkommen überflüssiges Amt es wäre, Censuren unter die Künstlerschaar zu verteilen; wenn man heute noch glauben möchte, daß ein Künstler, und sei er der größte, absolute Kunstgesetze zu schaffen vermöge.
Die Frage, ob der Künstler oder der Kritiker mehr Recht habe, auf den anderen herabzusehen, setzt ein feindschaftliches Verhältnis zwischen Beiden voraus, das schlechterdings nicht besteht. Mit dem Dahinsinken des Glaubens an ein »Schönes an sich« hat der Kritiker aufgehört, ein Richter zu sein und ist zum Erklärer geworden. Denn während dem Künstler die Gabe ward, seine Persönlichkeit Anderen aufzudrängen, seine Gedanken, Gefühle, Stimmungen auf Andere zu übertragen, so ist es des Kritikers Kunst, fremde Persönlichkeiten in sich aufzunehmen, in fremden Persönlichkeiten zu verschwinden, durch sie die Welt zu sehen und aus ihnen heraus ihre Worte, ja das Entstehen ihrer Werke zu erklären. Der Künstler ist einseitig, wie jede starke Persönlichkeit; der Kritiker ist vielseitig, eben weil er keine Persönlichkeit ist, denn er ist jeden Tag eine neue.
In dem hier erwähnten Artikel versuchte man, das künstlerische Moment in der Kritik hervorzukehren, aber das Hauptgewicht wurde dabei auf die Sehnsucht nach eigenem Schaffensvermögen gelegt, die der Kritiker empfinden soll. Das kann bestritten werden. Dem echten, dem geborenen Kritiker wird solche Sehnsucht fremd sein, und wenn man aus ihr die »Suprematie« des Künstlers über den Kritiker herleiten will, so darf man fragen, ob nicht gerade bei dem letzteren, der die unbewußte Persönlichkeit des Künstlers und ihr naives Werk voll Überlegenheitsgefühl analysiert, dem »Willen zur Macht« die weitaus größere Genugthuung zuteil wird, ob nicht grade dies Überlegenheitsgefühl des Kritikers seinem Verhältnis zum Künstler alles Feindschaftliche genommen und es freundlich und wohlwollend gemacht hat. –
Der Kritiker ist nicht, wie aus jenem Artikel hervorgeht, nur ein ästhetischer, sondern ein durchaus künstlerischer Mensch. Man sehe die großen Kunstkenner, an denen sich unsere Kritiker nun doch einmal heranbilden. Die Sainte-Beuve, Lemaître und Brandes sind neugierige, feingeistige Menschen, immer auf der Suche nach einer künstlerischen Persönlichkeit, in der sie verschwinden, in der sie aufgehen, in die sie sich verwandeln können; und dann ist es, als sei diese Persönlichkeit, die aus dunklen Instinkten und Ahnungen heraus ihre Werke erschuf, ihrer selbst bewußt geworden: ihre innere Logik wird uns klar, wir sehen, wie ihr Wesen sich entwickelte, ihre letzten, verstecktesten Triebe treten ans Tageslicht, wir erkennen, welche von ihnen schwächer wirken, welche überwiegen und wie grade aus diesem Verhältnis dies Werk entstehen mußte. Und hat der Kritiker, dieser Verwandlungskünstler, dieser vollendetste Typus des »Dilettanten«, die Welt eine Zeitlang mit den Augen dieser Persönlichkeit gesehen, diese Persönlichkeit vollkommen ausgeschöpft, ausgelebt, »ihre Psychologie geliefert«, wie man obenhin zu sagen pflegt, so schweift er weiter, begierig in einen neuen Horizont zu treten, einem neuen Gedankengange zu folgen, neue Gefühle zu fühlen, ein neues Leben zu leben, die Welt von einer neuen Seite zu sehen. – Georg Brandes, als private Persönlichkeit betrachtet, ist ein ganz uninteressanter freisinniger Jude; aber er vermag, unter Umständen, sich selbst auszulöschen und Heine oder Mérimée oder Tieck oder ein Anderer zu sein – oder ihn zu spielen.
Denn man bemerkt, daß der moderne Begriff des Kritikers mit dem des Schauspielers und des Interpreten zusammenfällt, – wie man, umgekehrt, zum Beispiel Hans von Bülow sehr wohl als den besten, den genialen Kritiker Beethovens verstehen darf. Ebenso thut der Schauspieler, der eine Dichtergestalt nachschafft, seine Persönlichkeit in ihr verschwinden läßt und uns mit bewußter Kunst ihr tiefstes Wesen offenbart, nichts anderes, als der Kritiker. Dieser ist in demselben Sinne Künstler wie der Schauspieler, – auch der tägliche Rollenwechsel ist Beiden gemeinsam – und man kann, umgekehrt, den Schauspieler einen Kritiker im vornehmsten Sinne nennen.
Im Falle eines näheren Verhältnisses zwischen Kritiker und Schauspieler ist, nebenbei bemerkt, die Wahrscheinlichkeit dafür, daß der letztere dem ersteren mehr zu geben haben wird, denn es ist seine Sache, das Kunstwerk noch unmittelbarer und mit vollerer Persönlichkeit zu durchleben, als jener. Der häufig hervortretende Anspruch des Kritikers, dem Interpreten Weisungen zu geben, ihn durch Auslegungen eines dichterischen Charakters zu verpflichten, stellt sich fast regelmäßig als verfehlt, wenn nicht als lächerlich heraus, wie noch vor kurzem in dem Wiener Zwist des Kritikers Gelber mit dem Hofburgschauspieler Bonn. –
Über das Alles nun ist der Kritiker Alfred Kerr sich natürlich vollkommen klar, und er wüßte es höchstwahrscheinlich weit treffender zu formulieren, als es hier geschehen konnte. Wenn es ihm aber auch nicht verübelt werden soll, daß er sich nicht zu entschließen vermochte, eine halbe Stunde lang die Welt mit dem Possenblick Richard Skowroneks zu betrachten, so bleibt es doch unverständlich wie er sich dazu hinreißen lassen konnte, einen unschuldigen Herrn, der auf vollkommen loyale Weise sein Brot verdient, persönlich zu beleidigen.
Thomas Mann.
Carl von Weber: »Ehre ist Zwang genug«
Carl von Weber: »Ehre ist Zwang genug.«Roman aus der Neuzeit. Dresden und Leipzig. E. Piersons Verlag 1894. Mk. 5,–.
Ein junger Edelmann, ehemaliger Offizier, der aus Ehr- und Pflichtgefühl das stark verschuldete Gut seiner Ahnen übernimmt, der aber sein väterliches Erbe in einem vergnügten Reiterlieutenantsdasein aus Jugendleichtsinn verthan hat, sieht sich genötigt, von seiner älteren Schwester ein Darlehen von drei mal hunderttausend Mark zu erbitten, um die Wirtschaft fortführen und heben zu können. Der Rechtsbeistand der gutherzigen und edelmütigen Dame, die ihrem Bruder in beinahe mütterlicher Liebe zugethan ist, stellt sie und ihre Kinder sicher durch den Contract, den der junge Mann mit einer Lebensversicherungsgesellschaft schließt; allein die Clausel, welche die Gesellschaft in den Vertrag schiebt, ist mißlich: Nur dann wird nach dem Tode Leos die hohe Summe ausgezahlt werden, wenn er auf natürliche Weise gestorben ist; zu den selbstverschuldeten Todesarten aber wird nicht nur Selbstmord, sondern auch Tod im Duell gerechnet. Nur zögernd giebt Leo seine Unterschrift. Er gerät, indem er sich der Satisfactionsfähigkeit beraubt, mit der Gesellschaft, der er angehört, in einen Widerspruch, der ihm leicht seine Existenz kosten kann. Aber er sieht in der Hingabe an die Pflicht das wahre Ehrgefühl, und höchste Pflicht ist es ihm das ehrwürdige Besitztum, das von dem nächsten Erben unthatkräftig verschmäht wurde, zu übernehmen und zu retten. Seinem kraftvollen Bemühen fehlt nicht der Erfolg. Aber während er von Jahr zu Jahr mehr sein Gut entlastet, während er die Einkünfte auf eine ungeahnte Höhe erhebt, tritt, nachdem er mehr als einmal der gefährlichen Versuchung widerstanden, das in seiner Stellung fast Unvermeidliche ein: Gereizt zwar, läßt er sich selbst dazu hinreißen, einen vornehmen Offizier aufs schwerste zu beleidigen, man fordert ihn und – er verweigert den Zweikampf. Das bedeutet seinen gesellschaftlichen Ruin. Das Ehrengericht spricht ihm den Offiziersrang ab, der Umgang mit ihm wird verpönt, und einsam lebt er fortan seiner Arbeit – von einem Teil seiner Bediensteten selbst verachtet. Aber das Bewußtsein nur seine Pflicht gethan zu haben, hält ihn stolz und aufrecht, und als im Jahre 1870 der Krieg hereinbricht, da besinnt er sich nicht zu den Waffen zu greifen, um als gemeiner Soldat für das Vaterland zu fechten. Und nun gelingt es ihm, sich im Verlauf des Feldzuges in einer Weise hervorzuthun, daß man nicht ansteht, ihn aufs Neue zum Offizier zu machen, daß alle Welt sich genötigt sieht, ihm die Achtung, die man ihm absprechen zu müssen glaubte, wiederzuschenken, und daß er das Mädchen, das er liebt, und mit dem er sein verachtetes Dasein nicht zu teilen wagte, als Gattin heimführen darf.
Verwickelungen, die aus Versicherungsverträgen konstruiert werden, pflegen Zweifeln an ihrer Wahrscheinlichkeit zu begegnen, und viel Größere als Herr von Weber – siehe Zola’s Pot-»Bouille« – haben Fehler dabei begangen. Aber man darf sagen, daß die äußere Handlung des Romans, die hier flüchtig nur und in ganz großen Zügen wiedergegeben werden konnte, nichts ist, als der Vorwand, uns einen Menschen mit wahrhaft vornehmem und hochentwickeltem Ehrgefühl zeigen zu können, der – um die Schlußworte des Buches zu gebrauchen – »seine Ehre nicht nur im Kopfe und im Munde führt, sondern der sie mutvoll liebt«.
Herr von Weber ist kein literarischer Mensch, der in seiner Sprache schon – es ist ein ziemlich alltäglicher Romanstil – einen persönlichen und entwickelten Geschmack zeigen würde; er besitzt auch nicht den empfindsamen Kopf eines routinierten Romanschreibers, der aus dem gegebenen Fall ganz andere – »spannendere« – Conflicte gezogen haben würde, und er schildert weniger als Künstler, der auf farbige und bewegte Wirkungen ausgeht, denn als Mann der Handlung und des Lebens, dem die Sache selbst, die er vertritt, wichtiger ist, als die Form. Eine ursprüngliche Kraft der Überzeugung, die seinem großen Problem – der Ehre – gegenüber nicht von dem leisesten Zweifel angekränkelt ist, eine sittliche Begeisterung, die Ehrfurcht einflößt, macht das Buch zu einer literarischen Ausnahmeerscheinung, deren Bekanntschaft man lohnend finden wird.
T.M.
Das Ewig-Weibliche
Wer kennt »Die Hochzeit der Esther Franzenius« von Toni Schwabe? »Der stehe auf und rede!« wie Pastor Frenssen sagen würde. Ich wüßte nämlich gern, was man von diesem Buche, das seiner Gattung nach so etwas wie ein Roman ist, nun eigentlich hält; denn ich bin ein wenig mitschuldig an seinem Erscheinen. Eine einzige Kritik habe ich bislang darüber gelesen, die absprechend und abschreckend war. Sie war von Damenhand, von einer Kollegin der Verfasserin, geschrieben, und dies erklärt ja manches. Aber ich schweige doch nicht still dazu, denn ich finde das Buch ungewöhnlich gut und schön, und es hat, zusammen mit Huchs »Geschwistern« und Straußens »Freund Hein«, unter den neuesten Sachen den stärksten Eindruck auf mich gemacht.
Ich weiß noch, wie ich’s entdeckte. Ich stöberte verdrossen in einem Manuskripthaufen, einem ganzen Berge von dummem Zeug, das keck, hoffnungsvoll und mit vorzüglicher Hochachtung Herrn Albert Langen eingesandt worden war, damit er es verlege, und stieß so auch auf dies kleine Paket beschriebener Blätter. Folioformat war’s und eine große, klare, gerundete Handschrift. Ich las – und fühlte mich gefesselt. Wodurch? O, auf die sanfteste Weise! Nichts von Atemlosigkeit. Nichts von wütenden und verzweifelten Attaquen auf des Lesers Interesse. Ein beseeltes Wort, das betroffen und glücklich aufhorchen ließ. Ein lebendiges Detail, das plötzlich irgendwo zart erglänzte und vorwärts lockte. Und bei jeder Zeile verstärkte sich die Gewißheit, daß dies etwas sei. Und zwar Kunst. Und zwar auserlesene Kunst …
Ich pries und empfahl es dann nach Kräften, und als es gedruckt war, las ich’s mit demselben stillen Entzücken zum zweitenmal … Erzählen? Ich werde mich hüten. Die Kollegin gab den »Inhalt« und erzielte die hämischsten Wirkungen damit. Nur ist die Sache ja die, daß sich ein gutes Buch überhaupt nicht erzählen lassen darf. Auch soll dies hier keine Besprechung sein, sondern nur ein Hinweis. Aber andeuten wenigstens möchte ich doch, worin der Zauber dieser romantischen Prosa-Dichtung besteht.
Da ist zunächst die Sprache, eine leise und innig bewegte Sprache von sanfter Gehobenheit, die in außerordentlichen Momenten das gehaltene Pathos der Bibel streift. Eine zarte Eindringlichkeit der Wirkungen wird erzielt, die, um es näher zu bezeichnen, ungefähr das Gegenteil ist von jener Blasebalgpoesie, die uns seit einigen Jahren aus dem schönen Land Italien eingeführt wird. Zuweilen bei Storm kommen Stellen, wo ohne den geringsten sprachlichen Aufwand die Stimmung sich plötzlich verdichtet, wo man die Augen schließt und fühlt, wie die Wehmut einem die Kehle zusammenpreßt. Ähnliches findet sich hier. Man staunt, mit welcher Schlichtheit der Anschauung und des Ausdrucks auf einmal etwas Durchdringliches und Unvergeßliches erreicht wird. Jemand weint, und es ist so gesagt, daß man sehr versucht ist, mit zu weinen. »Und langsam gingen Tränen aus ihren Augen.« Nicht etwa: »Sie brach in Weinen aus.« Nicht: »Ihr Körper krampfte sich im Schluchzen zusammen.« Sondern: »Und langsam gingen Tränen aus ihren Augen.« Zwei halten sich an den Händen und – weiter nichts. Aber dies wird auf irgend eine Weise zum unauslöschlichen Erlebnis. »Und sie ließ ihm ihre Hände. Gab sie ihm wie einen Trunk und schaute zu.« Das ist glänzend. Aber dergleichen simple Wunder sind auf jeder Seite zu finden. Wie gesehen wirkt zum Beispiel, ganz am Schlusse, der Steg, über den Esther ins Meer, in den Tod, zur »Hochzeit« schreitet, »das Ufer mit dem abgebrochenen Steg, der ziellos hinausführte – hinaus in die Unendlichkeit«. Und hie und da erscheinen ein paar Zeilen Zwiegespräch, die fast gar nichts besagen und doch wie Nebelstreifen sind, die über unergründlichen Tiefen schweben.
Es ist viel Liebe in dem Buch, ja, das Ganze ist eine einzige unendliche Melodie der Sehnsucht. Da ist die Liebe Esthers zu dem ernsten Lothar, zu dessen Seele sie die »Schwesterseele« zu besitzen glaubt, und der doch die schöne, heitere Maria liebt, welcher alle Liebe zu Füßen liegt. Da ist die Liebe zwischen Esther und dem jungen Arne Rude und die unheimliche und unmögliche Leidenschaft, die sie in dem alten Adam Rude, einem finsteren Sonderling von Greis, erregt. Da ist die Liebe des seltsamen Kindes Eliza zu Esther … Aber das Echteste und Schmerzlichste ist eben doch jene Episode, die zwischen der Heldin und dem jungen Arne spielt, diesem braven und knabenhaft aufgeklärten Gesellen, dem sie sich mit einer wissenden, traurigen, spöttischen Neigung ergiebt, um endlich einmal nicht mehr allein zu sein. Die ganze Überlegenheit einer Frau, deren Seele erlebt hat, über die theoretische Wissenschaftlichkeit des gleichaltrigen jungen Mannes kommt hier zum Ausdruck. »Ach wenn ich doch lieber ein Mann wäre!« seufzt sie einmal. »Dann wärst du kaum erst mit dem Gymnasium fertig – ein Student in den ersten Semestern«, sagt er, und sie antwortet: »Ja, das ist wahr: man kommt sich als Frau älter vor.« Aber das hindert ihn, der die »ersten Semester« schon hinter sich hat, durchaus nicht, sich als der Stärkere zu fühlen und beständig seine Kollegweisheit gegen ihr Wissen, das aus dem Schmerz und der Liebe stammt, ins Gefecht zu führen. »Der junge Mann wußte alles so genau. Er sprach mit einer so verblüffenden Sicherheit, die jede Gegenrede auszuschließen schien.« Und so sagt sie, zögernd und mehr für sich, als im Anschluß an das, was gesprochen wurde, ihre weniger anerkannten, weniger beweisbaren und sehr viel zarteren Meinungen, Dinge des Herzens, die er gar nicht versteht, obgleich sie sich auf ihn und ihre Liebe zu ihm beziehen … »Mir scheint, eine vollkommene Liebe ist Sehnsucht nach der anderen Seele – nicht nur Mittel zu einem Zweck der Natur … Wie nur alles Feine und Unantastbare so in die Verachtung der Menschen geraten kann – nur weil es vielleicht zu lange schon ein mißverstandenes und verbrauchtes Ideal gewesen sein mag? … Alles, woran die Menschen eine Zeitlang mit ihren Gedanken rühren, wird so schmutzig und verbraucht, daß es ihnen zuletzt selbst zum Ekel und zum Wegwerfen ist. Und dann kommen ein paar Nachzügler, sammeln es aus der Verachtung heraus und machen es zu neuen und wiederverspotteten Heiligtümern … Ich meine, man müßte an einer Liebe, die nie die höchste Vereinigung erreichen kann oder doch will, zugrunde gehen … Man muß nur einen Menschen über alles liebhaben, dann will man auch mit ihm die Ewigkeit. Dann will man nichts von der ewigen Seligkeit als diesen einen Menschen – dann glaubt man an das Jenseits und die ewige Vereinigung der Seelen – trotz aller Erkenntnis der Wissenschaft ...... Menschen wie ich wollen keinen Himmel, weil wir dort drüben nicht zu leben verständen. Denn wir sind nicht zur Freude geschaffen – wir würden den Kampf entbehren – und den Schmerz – und die Einsamkeit. Denn das alles haben wir lieben gelernt, als uns die Erde nichts andres zu bieten hatte. Wir können nie mehr in der Freude zu Hause sein …« – »Übrigens liebe ich es, wenn Frauen ein wenig Christentum haben«, antwortet er ihr einmal gönnerhaft; worauf sie Lust hat, ihn an den Ohren zu reißen und einen kleinen dummen Jungen zu nennen. Und dazwischen Augenblicke, wo sie sich dennoch beugt, sich demütigt und seine Hand küßt …
Man muß nicht glauben, daß, weil ein bißchen viel von »Seele« und »Ewigkeit« die Rede ist, eine dünne, fade und unsinnliche Empfindung aus dem Buche spricht. Es handelt sich hier vielmehr um jene überschwängliche Zartheit, die aus der tiefsten Inbrunst stammt, und freilich ohne Keuschheit, die ganze Spannung der Keuschheit nicht möglich ist.
Zuweilen blitzt Humor auf; und Humor ist oftmals dort, wo die Sinnlichkeit schwach ist. In den feinsten Fällen jedoch ist er eine helle Waffe des Geistes gegen die Sinnlichkeit: sie wird verspottet …
Aber wenn Humor verspottete Sinnlichkeit ist, so ist Metaphysik verklärte Sinnlichkeit, – und nun kommt das Schönste. Ich meine jene Stellen des Büchleins, wo das Gefühl sich ins Transcendentale erhebt und steigert, wo die Sehnsucht mit zitternder Schwinge das Liebesgeheimnis selber streift … »Sie neigte nur den Kopf und sah wie bisher weit hinaus auf das Meer. Und ganz da draußen, dort wo die Unendlichkeit beginnt, konnten sich vielleicht ihre Blicke begegnen. Und vielleicht wurde dort das Schweigen gebrochen, das sich hier jetzt über sie legte.« – »Aber sie regte sich nicht, folgte nur seinem fernen Blick. Und es wurde ganz ruhig in ihr, ruhig wie zu einem angestrengten Horchen. Und ihr war, als sähe sie dort draußen im unbestimmten Licht zwei Seelen zusammenfließen – dort draußen – weit – zwischen Himmel und Erde. Und ein tiefes, geheimnistrunkenes Glück verschleierte alle Wirklichkeit. Sie gab sich ganz dem Entzücken des Traumes hin.« Ja, in solchen Augenblicken wird eine kleine, leise Erinnerung an die Schauer und Wunder geweckt, die jener Mächtigste im zweiten Tristan-Akte bewirkt.
Viel Liebe ist in dem Buch und viel Kenntnis des Leidens. Denn wer die Liebe kennt, kennt auch das Leid. (Wer sie aber nicht kennt, der kennt höchstens »die Schönheit«.) Die Vornehmheit, Auserwähltheit, Weihe und bleiche Lieblichkeit, die Häßlichkeit, Lächerlichkeit und böse Verstocktheit des Leidens, – alles ist darin, und einmal, in jener kleinen, tief romantischen Scene am Berberitzenstrauch, tritt wie eine verdichtende und zusammenfassende Vision das Bild des Frauenhauptes daraus hervor, in dessen Haar die roten Beeren hängen, »wie Blut, das unter einem Dornenkranze niedertropft«, – ein Symbol der leidenden Liebe.
Genug! … Was ich sagen wollte, ist dies: Uns armen Plebejern und Tschandalas, die wir unter dem Hohnlächeln der Renaissance-Männer ein weibliches Kultur- und Kunstideal verehren, die wir als Künstler an den Schmerz, das Erlebnis, die Tiefe, die leidende Liebe glauben und der schönen Oberflächlichkeit ein wenig ironisch gegenüberstehen: uns muß es wahrscheinlich sein, daß von der Frau als Künstlerin das Merkwürdigste und Interessanteste zu erwarten ist, ja, daß sie irgendwann einmal zur Führer- und Meisterschaft unter uns gelangen kann. Ist das kleine Frauenbuch, von dem ich rede, nur ein zartes und schwaches Anzeichen dafür? Habe ich ihm vielleicht gegeben, was nicht sein ist? Manchmal beim Schreiben fürchtete ich’s. Aber es könnte mich nicht beirren. Es ist nichts mit dem, was steife und kalte Heiden »die Schönheit« nennen. Das Endwort des »Faust« und das, was am Schlusse der »Götterdämmerung« die Geigen singen, es ist Eins, und es ist die Wahrheit. Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan.
[Anmerkung zu »Das Ewig-Weibliche«]
Man sollte als Künstler nichts über Anderes, nichts Allgemeines veröffentlichen. Man sollte nur durch Werke reden. Das Allgemeine kompromittiert immer. Und eigentlich ist man ja viel zu sehr Wirrkopf und Rohr im Winde, um überhaupt etwas Allgemeines von sich geben zu dürfen. Aber wenn ich der Freistatt einen Dienst damit erweisen kann, so mag es diesmal hingehen.