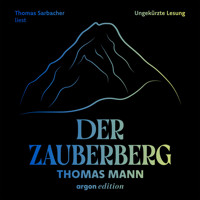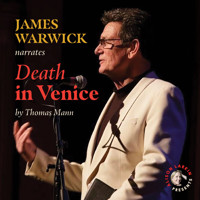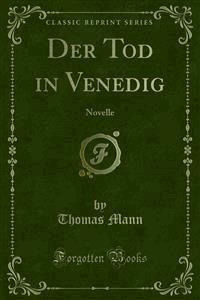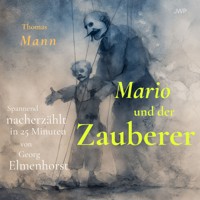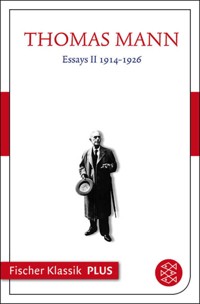
49,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Thomas Mann, Große kommentierte Frankfurter Ausgabe. Werke, Briefe, Tagebücher
- Sprache: Deutsch
Neben seinen großen Romanen und Erzählungen hat Thomas Mann ein nicht weniger eindrucksvolles essayistisches Werk geschaffen. Er hat sich von Anfang an während seines ganzen Lebens mit kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Strömungen auseinandergesetzt, fremde Thesen in Frage, eigene zur Diskussion gestellt – nicht zuletzt, um sich auf diese Weise, darin Montaigne und anderen ähnlich, selbst darzustellen, bekanntzumachen und Gleichgesinnte zu erreichen. Er hat dies als eine wesentliche Aufgabe des Schriftstellers in einer Zeit verstanden. Das essayistische Werk Thomas Manns umfasst neben großen Reden und Aufsätzen zahlreiche kurze Betrachtungen oder journalistische Beiträge, Polemiken oder Antworten auf Rundfragen, die den »Forderungen des Tages« geschuldet sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1515
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Thomas Mann
Essays II 1914-1926
Fischer e-books
In der Textfassung der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe (GKFA) Mit Daten zu Leben und Werk
{27}Gedanken im Kriege
Im Gebrauch der Schlagworte »Kultur« und »Zivilisation« herrscht, namentlich in der Tagespresse – und zwar der des In- und Auslandes –, große Ungenauigkeit und Willkür. Oft scheint man sie einfach als gleichbedeutend zu verwechseln, oft sieht es auch aus, als ob man das erstere für eine Steigerung des anderen halte, oder auch umgekehrt, – es bleibt ungewiß, welcher Zustand nun eigentlich für den höhern und edleren gilt. Für meine Person habe ich mir die Begriffe folgendermaßen zurechtgelegt.
Zivilisation und Kultur sind nicht nur nicht ein und dasselbe, sondern sie sind Gegensätze, sie bilden eine der vielfältigen Erscheinungsformen des ewigen Weltgegensatzes und Widerspieles von Geist und Natur. Niemand wird leugnen, daß etwa Mexiko zur Zeit seiner Entdeckung Kultur besaß, aber niemand wird behaupten, daß es damals zivilisiert war. Kultur ist offenbar nicht das Gegenteil von Barbarei; sie ist vielmehr oft genug nur eine stilvolle Wildheit, und zivilisiert waren von allen Völkern des Altertums vielleicht nur die Chinesen. Kultur ist Geschlossenheit, Stil, Form, Haltung, Geschmack, ist irgendeine gewisse geistige Organisation der Welt, und sei das alles auch noch so abenteuerlich, skurril, wild, blutig und furchtbar. Kultur kann Orakel, Magie, Päderastie, Vitzliputzli, Menschenopfer, orgiastische Kultformen, Inquisition, Autodafés, Veitstanz, Hexenprozesse, Blüte des Giftmordes und die buntesten Greuel umfassen. Zivilisation aber ist Vernunft, Aufklärung, Sänftigung, Sittigung, Skeptisierung, Auflösung, – Geist. Ja, der Geist ist zivil, ist bürgerlich: er ist der geschworene Feind der Triebe, der Leidenschaften, er ist antidämonisch, antiheroisch, und es ist nur ein scheinbarer Widersinn, wenn man sagt, daß er auch antigenial ist.
{28}Das Genie, namentlich in der Gestalt des künstlerischen Talentes, mag wohl Geist und die Ambition des Geistes besitzen, es mag glauben, durch Geist an Würde zu gewinnen, und sich seiner zu Schmuck und Wirkung bedienen, – das ändert nichts daran, daß es nach Wesen und Herkunft ganz und gar auf die andere Seite gehört, – Ausströmung ist einer tieferen, dunkleren und heißeren Welt, deren Verklärung und stilistische Bändigung wir Kultur nennen. Die Verwechselung des Geistigen, des Intellektualistischen, Sinnigen, ja Witzigen mit dem Genialen ist zwar modern; wir alle neigen ihr zu. Doch bleibt sie ein Irrtum. Wie sehr das Verhältnis zwischen Geist und Kunst das der Irrelevanz ist, hat Gontscharow einmal heiter und einfach ausgedrückt, indem er irgendeinen Redakteur einem schreibenden Dilettanten auf dessen Zusendung antworten läßt: »Sie haben viel Geist, aber Sie haben kein Talent. Und die Literatur kann nur Talent brauchen.«
Kunst, wie alle Kultur, ist die Sublimierung des Dämonischen. Ihre Zucht ist strenger als Gesittung, ihr Wissen tiefer als Aufklärung, ihre Ungebundenheit und Unverantwortlichkeit freier als Skepsis, ihre Erkenntnis nicht Wissenschaft, sondern Sinnlichkeit und Mystik. Denn die Sinnlichkeit ist mystischen Wesens, wie alles Natürliche.
Goethe, für dessen Naturforschung Helmholtz die Bezeichnung »naturwissenschaftliche Ahnungen« wählte, spürte des Nachts in seinem Schlafzimmer zu Weimar auf irgendeine natürlich-mystische Art das Erdbeben von Messina. »Hört, Goethe schwärmt!« sagten die Damen des Hofes, als er sein dämonisches Wissen verlautbarte und es für Beobachtung und Schlußfolgerung auszugeben versuchte. Aber nach Tagen kam die Kunde der Katastrophe. Dieser dämonischste Deutsche und kultivierteste Sohn der Natur, der je lebte, mußte sich nicht nur aus Ordnungssinn kalt verhalten gegen die französische {29}Revolution, sondern namentlich, weil sie so ganz ein Werk des zivilisierenden Geistes war.
Und die Kunst also? Ist sie eine Angelegenheit der Zivilisation oder der Kultur? Wir zögern nicht mit der Antwort. Die Kunst ist fern davon, an Fortschritt und Aufklärung, an der Behaglichkeit des Gesellschaftsvertrages, kurz, an der Zivilisierung der Menschheit innerlich interessiert zu sein. Ihre Humanität ist durchaus unpolitischen Wesens, ihr Wachstum unabhängig von Staats- und Gesellschaftsformen. Fanatismus und Aberglaube haben nicht ihr Gedeihen beeinträchtigt, wenn sie es nicht begünstigten, und ganz sicher steht sie mit den Leidenschaften und der Natur auf vertrauterem Fuße, als mit der Vernunft und dem Geiste. Wenn sie sich revolutionär gebärdet, so tut sie es auf elementare Art, nicht im Sinne des Fortschritts. Sie ist eine erhaltende und formgebende, keine auflösende Macht. Man hat sie geehrt, indem man sie der Religion und der Geschlechtsliebe für verwandt erklärte. Man darf sie noch einer anderen Elementar- und Grundmacht des Lebens an die Seite stellen, die eben wieder unsern Erdteil und unser aller Herzen erschüttert: ich meine den Krieg.
Sind es nicht völlig gleichnishafte Beziehungen, welche Kunst und Krieg miteinander verbinden? Mir wenigstens schien von jeher, daß es der schlechteste Künstler nicht sei, der sich im Bilde des Soldaten wiedererkenne. Jenes siegende kriegerische Prinzip von heute: Organisation – es ist ja das erste Prinzip, das Wesen der Kunst. Das Ineinanderwirken von Begeisterung und Ordnung; Systematik; das strategische Grundlagen schaffen, weiter bauen und vorwärts dringen mit »rückwärtigen Verbindungen«; Solidität, Exaktheit, Umsicht; Tapferkeit, Standhaftigkeit im Ertragen von Strapazen und Niederlagen, im Kampf mit dem zähen Widerstand der Materie; Verachtung dessen, was im bürgerlichen Leben »Sicher{30}heit« heißt (»Sicherheit« ist Lieblingsbegriff und lauteste Forderung des Bürgers), die Gewöhnung an ein gefährdetes, gespanntes, achtsames Leben; Schonungslosigkeit gegen sich selbst, moralischer Radikalismus, Hingebung bis aufs Äußerste, Blutzeugenschaft, voller Einsatz aller Grundkräfte Leibes und der Seele, ohne welchen es lächerlich scheint, irgend etwas zu unternehmen; als ein Ausdruck der Zucht und Ehre endlich Sinn für das Schmucke, das Glänzende: Dies alles ist in der Tat zugleich militärisch und künstlerisch. Mit großem Recht hat man die Kunst einen Krieg genannt, einen aufreibenden Kampf: schöner noch steht ihr das deutscheste Wort, das Wort »Dienst« zu Gesicht, und zwar ist der Dienst des Künstlers dem des Soldaten viel näher verwandt als dem des Priesters. Die literarisch gern kultivierte Antithese von Künstler und Bürger ist als romantisches Erbe gekennzeichnet worden, – nicht ganz verständnisvoll, wie mir scheint. Denn nicht dies ist der Gegensatz, den wir meinen: Bürger und Zigeuner, sondern der vielmehr: Zivilist und Soldat.
Wie die Herzen der Dichter sogleich in Flammen standen, als jetzt Krieg wurde! Und sie hatten den Frieden zu lieben geglaubt, sie hatten ihn wirklich geliebt, ein jeder nach seiner Menschlichkeit, der eine auf Bauernart, der andere aus Sanftmut und deutscher Bildung. Nun sangen sie wie im Wettstreit den Krieg, frohlockend, mit tief aufquellendem Jauchzen – als hätte ihnen und dem Volke, dessen Stimme sie sind, in aller Welt nichts Besseres, Schöneres, Glücklicheres widerfahren können, als daß eine verzweifelte Übermacht von Feindschaft sich endlich gegen dies Volk erhob; und auch dem Höchsten, Berühmtesten unter ihnen kam Dank und Gruß an den Krieg nicht wahrer von Herzen als jenem Braven, der in einem Tageblatt seinen Kraftgesang mit dem Ausruf begann: »Ich fühle mich wie neu geboren!«
{31}Es wäre leichtfertig und ist völlig unerlaubt, dies Verhalten der Dichter auch nur in den untersten, bescheidensten Fällen als Neugier, Abenteurertum und bloße Lust an der Emotion zu deuten. Auch waren sie niemals Patrioten im Hurra-Sinne und »Imperialisten«, schon deshalb nicht, weil sie selten Politiker sind – nach außen selten und kaum nach innen, so daß auch die Wunder und Paradoxien, welche der Krieg sogleich im Lande zeitigte: das brüderliche Zusammenarbeiten von Sozialdemokratie und Militärbehörde etwa, jene phantastische Neuheit der inneren Lage, die einen radikalen Literaten zu dem Ausruf begeisterte: »Unter der Militärdiktatur ist Deutschland frei geworden!« – daß auch dies alles den Dichtern wohl keine Lieder gemacht haben würde. Aber wenn nicht Politiker, so sind sie doch stets etwas anderes: sie sind Moralisten. Denn Politik ist eine Sache der Vernunft, der Demokratie und der Zivilisation; Moral aber eine solche der Kultur und der Seele.
Erinnern wir uns des Anfangs – jener nie zu vergessenden ersten Tage, als das nicht mehr für möglich Gehaltene hereinbrach! Wir hatten an den Krieg nicht geglaubt, unsere politische Einsicht hatte nicht ausgereicht, die Notwendigkeit der europäischen Katastrophe zu erkennen. Als sittliche Wesen aber – ja, als solche hatten wir die Heimsuchung kommen sehen, mehr noch: auf irgendeine Weise ersehnt; hatten im tiefsten Herzen gefühlt, daß es so mit der Welt, mit unserer Welt nicht mehr weitergehe.
Wir kannten sie ja, diese Welt des Friedens und der cancanierenden Gesittung – besser, quälend viel besser als die Männer, deren furchtbare, weit über ihre persönliche Größe hinausgehende Sendung es war, den Brand zu entfesseln: Mit unseren Nerven, unserer Seele hatten wir tiefer an dieser Welt zu leiden vermocht als sie. Gräßliche Welt, die nun nicht mehr ist – oder doch nicht mehr sein wird, wenn das große Wetter {32}vorüberzog! Wimmelte sie nicht von dem Ungeziefer des Geistes wie von Maden? Gor und stank sie nicht von den Zersetzungsstoffen der Zivilisation? Wäre sie nur anarchisch, nur ohne Kompaß und Glauben, nur wölfisch-merkantil gewesen, es hätte hingehen mögen. Aber ein geiler Mißbrauch eben jener Widerstände und Entseuchungsmittel, die sie aus sich hervorzubringen suchte, machte ihre Abscheulichkeit vollkommen. Eine sittliche Reaktion, ein moralisches Wiederfestwerden hatte eingesetzt oder bereitete sich vor; ein neuer Wille, das Verworfene zu verwerfen, dem Abgrund die Sympathie zu kündigen, ein Wille zur Geradheit, Lauterkeit und Haltung wollte Gestalt werden: Grund genug für alles kluge Lumpenpack, ebendies für das Neueste zu erklären und sich beizeiten darüber herzumachen. Äußerster Grad von Ratlosigkeit: Die Moral ward zur Spielart der Korruption. Anständigkeit grassierte als Velleität, als drittes Wort und Unmöglichkeit, Elende spreizten sich ethisch, und während der Schlechte aus Geist das Gute vertrat, so daß ein Greuel daraus wurde, setzten Gute aus Unsicherheit und Verwirrung sich für das Schlechte ein. Ist es zuviel gesagt, daß es kein Kriterium des Echten, nicht Mut noch Möglichkeit zur Verdammung mehr gab, daß buchstäblich niemand mehr aus noch ein wußte? Würde? Aber sie war Hochstapelei und Snobismus. Infamie? Aber sie hatte Talent; sie gab überdies zu verstehen, daß sie ein Opfer, eine schmutzige und blutige Form der Generosität selber sei, und sie fächelte sich vor Eitelkeit unter dem Beifall derer, die nur eine Sorge kennen: den Anschluß nicht zu versäumen. Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte!
Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheuere Hoffnung. Hiervon sagten die Dichter, {33}nur hiervon. Was ist ihnen Imperium, was Handelsherrschaft, was überhaupt der Sieg? Unsere Siege, die Siege Deutschlands – mögen sie uns auch die Tränen in die Augen treiben und uns nachts vor Glück nicht schlafen lassen, so sind doch nicht sie bisher besungen worden, man achte darauf, es gab noch kein Siegeslied. Was die Dichter begeisterte, war der Krieg an sich selbst, als Heimsuchung, als sittliche Not. Es war der nie erhörte, der gewaltige und schwärmerische Zusammenschluß der Nation in der Bereitschaft zu tiefster Prüfung – einer Bereitschaft, einem Radikalismus der Entschlossenheit, wie die Geschichte der Völker sie vielleicht bisher nicht kannte. Aller innere Haß, den der Komfort des Friedens hatte giftig werden lassen – wo war er nun? Eine Utopie des Unglücks stieg auf … »Da wir umringt sind, da unserem Gewerbefleiß die Zufuhr an Rohstoffen abgeschnitten und das Volk ohne Arbeit und Brot sein wird, so werden wir ungeheure Vermögenssteuern ausschreiben, Abgaben der Reichen bis zu zwei Dritteln, nein, bis zu neun Zehnteln ihres Besitzes, eine deutsche Kommune, freiwillig und voll Ordnung, wird sein, damit Deutschland bestehe.« Das war das mindeste. Und als dann die ersten Entscheidungen fielen, als die Flaggen stiegen, die Böller dröhnten und den Siegeszug unseres Volksheeres bis vor die Tore von Paris verkündeten – war nicht fast etwas wie Enttäuschung, wie Ernüchterung zu spüren, als gehe es zu gut, zu leicht, als bringe die Nervlosigkeit unserer Feinde uns um unsere schönsten Träume?
Unbesorgt! Wir stehen am Anfang, wir werden um keine Prüfung betrogen sein. Friedrich, nach allen Heldentaten, war im Begriffe, unterzugehen, als ein gutes Glück, der russische Thronwechsel, ihn rettete. Und Deutschland ist heute Friedrich der Große. Es ist sein Kampf, den wir zu Ende zu führen, den wir noch einmal zu führen haben. Die Koalition hat sich {34}ein wenig verändert, aber es ist sein Europa, das im Haß verbündete Europa, das uns nicht dulden, das ihn, den König, noch immer nicht dulden will, und dem noch einmal in zäher Ausführlichkeit, in einer Ausführlichkeit von sieben Jahren vielleicht, bewiesen werden muß, daß es nicht angängig ist, ihn zu beseitigen. Es ist auch seine Seele, die in uns aufgewacht ist, diese nicht zu besiegende Mischung von Aktivität und durchhaltender Geduld, dieser moralische Radikalismus, der ihn den anderen so widerwärtig zugleich und entsetzlich, wie ein fremdes und bösartiges Tier, erscheinen ließ. Sie wußten nichts von seiner Unbedingtheit – wie sollten sie, da es für sie nicht um Tod und Leben ging –: das war sein sittlicher Vorteil. Auch ist nicht glaubhaft, daß ihnen heute die Tiefe deutscher Entschlossenheit zugänglich sein sollte, – die einen sind zu weit verbürgerlicht, die andern zu roh und dumpf, um ihrer fähig zu sein. Aber heute ist Friedrich so stark geworden, daß auch die anderen, auch sie, um ihr Leben kämpfen – und sie sind drei gegen den einen. Unbesorgt! Wir werden geprüft werden. Deutschlands Sieg wird ein Paradoxon sein, ja ein Wunder, ein Sieg der Seele über die Mehrzahl – ganz ohnegleichen. Der Glaube an ihn ist wider alle Vernunft, – daß Deutschland fest und gelassen ist in diesem Glauben, das ist des Wunders Anfang, unvergeßbar schon er für alle Geschichte. Den Sieg aber seelisch vorwegnehmen, hieße, uns um die sittlichen Früchte des Kampfes, ja um den Sieg selber bringen. Für jeden Verstand, nur für unser letztes Wissen nicht, ist unsere Lage verzweifelter als selbst die des Königs. Wir sind in Not, in tiefster Not. Und wir grüßen sie, denn sie ist es, die uns so hoch erhebt.
Friedrich von Preußen hatte einen Freund, den er gleichermaßen bewunderte und verachtete, und der seinerseits den König bewunderte und haßte: Es war François Marie Arouet-de {35}Voltaire, der Schriftsteller, – Großbürger und Sohn des Geistes, Vater der Aufklärung und aller antiheroischen Zivilisation. Was er über den Krieg schrieb, in seinen »Questions encyclopédiques«, hat den König zweifellos außerordentlich amüsiert und dialektisch ergötzt. Und dann rückte er in Sachsen ein. Abwechselnd nannte er Voltaire Phöbus Apoll und einen kostspieligen Hofnarren.
Seit ich die beiden kenne, stehen sie vor mir als die Verkörperung des Gegensatzes, von dem diese Zeilen handeln. Voltaire und der König: Das ist Vernunft und Dämon, Geist und Genie, trockene Helligkeit und umwölktes Schicksal, bürgerliche Sittigung und heroische Pflicht; Voltaire und der König: das ist der große Zivilist und der große Soldat seit jeher und für alle Zeiten.
Aber da wir den Gegensatz in nationalen Sinnbildern vor Augen haben, in den Figuren des zentralen, immer noch herrschenden Franzosen und des deutschen Königs, dessen Seele jetzt mehr als je in uns allen lebt, so gewinnt er selbst, dieser Gegensatz, nationalen Sinn und aufschließende Bedeutung für die Psychologie der Völker.
Wir sind im Kriege, und was es für uns Deutsche »in diesem Kriege gilt«, das wußten wir gleich: es gilt rund und schlicht unser Recht, zu sein und zu wirken. Nicht ebenso zwanglos ergab sich für unsere westlichen Feinde eine polemische Formel, geeignet, ihrer Sache vor dem Urteil der Unbeteiligten und der Geschichte ein würdiges Ansehen zu geben. Und welche ist es denn nun, auf die sie sich geeinigt haben und die tagtäglich als Streitruf und Schmähung zu uns herüberschallt? Dieser Krieg, heißt es, sei ein Kampf der Zivilisation gegen – wogegen denn also? Nicht geradezu – »gegen die Barbarei«. Das ginge nicht recht. Es geht im Tumult so einmal mit hin, doch nicht auf die Dauer. Gewöhnlich zieht man es vor, zu schließen: »– gegen den Militarismus«.
{36}Nun ist diese Antithese: »Zivilisation gegen Militarismus« natürlich nicht die Ursache des Krieges. Auch ist sie nicht einmal redlich und richtig, denn daß Zivilisation in ihrer politischen Erscheinung, ich meine, daß Demokratie und Militarismus einander nicht ausschließen, beweist ja Frankreich mit seinem Volksheer, oder es möchte dies doch beweisen. Auch dürfte man fragen, was denn die Armeen Österreichs und Italiens, was Englands Riesenflotte selbst eigentlich sei, wenn nicht »Militarismus«. Worauf die beleidigte Zivilisation höchstens antworten könnte, Deutschlands besonderer und exemplarischer Militarismus bestehe darin, daß es die beste Armee und, wie es jetzt scheint, auch die beste Flotte habe, – eine Erwiderung, an der denn auch etwas Zutreffendes wäre, nur daß darin Ursache und Wirkung oder, wenn man will, das Symptom mit der Krankheit verwechselt würde. Die Parole »Zivilisation gegen Militarismus« – denn eine Parole ist es, wie man Wahlparolen hat, Abbreviaturen der Wirklichkeit, oberflächlich, populär und rückenstärkend – enthält allerdings eine tiefere Wahrheit, drückt eine internationale Fremdheit und Unheimlichkeit der deutschen Seele aus, die, wenn sie freilich nicht Ursache des Krieges ist, doch vielleicht diesen Krieg überhaupt erst möglich gemacht hat. Versuchen wir anzudeuten, welche Bewandtnis es damit hat.
Nüchtern betrachtet, bleibt ja die Behauptung, Deutschland sei ein unzivilisiertes Land oder es sei doch weniger zivilisiert als Frankreich und England, eine gewagte und undankbare Position. Der englische Ministerpräsident hat zwar neulich geäußert: zugegeben, daß man der deutschen Kultur von früher her manches verdanke, so habe doch Deutschland in letzter Zeit hauptsächlich in der Herstellung von Mordwerkzeugen exzelliert. Allein Herr Asquith weiß ja selbst, daß das nur Geschwätz ist. Er tut agitationshalber, als ob die Vorzüglichkeit {37}von Deutschlands kriegstechnischen Mitteln nicht einfach ein Merkmal unseres Niveaus überhaupt wäre; als ob nicht unsere Krankenhäuser, Volksschulen, wissenschaftlichen Institute, Luxusdampfer und Eisenbahnen ebenso gut wären wie unsere Kanonen und Torpedo; als ob unsere Kriegstechnik auf Kosten unserer sonstigen praktischen Kräfte hypertrophierte und nicht vielmehr Ausdruck einer Gesamthöhe wäre … Was ist, was heißt noch »Zivilisation«, ist es mehr als eine leere Worthülse, wenn man sich erinnert, daß Deutschland mit seiner jungen und starken Organisation, seiner Arbeiterversicherung, der Fortgeschrittenheit aller seiner sozialen Einrichtungen ja in Wahrheit ein viel modernerer Staat ist als etwa die unsauber plutokratische Bourgeois-Republik, deren Kapitale noch heute als das »Mekka der Zivilisation« verehrt zu werden beansprucht, – daß unser soziales Kaisertum eine zukünftigere Staatsform darstellt als irgendein Advokaten-Parlamentarismus, der, wenn er in Feierstimmung gerät, noch immer das Stroh von 1789 drischt? Ist nicht die bürgerliche Revolution im Sinne des gallischen Radikalismus eine Sackgasse, an deren Ende es nichts als Anarchie und Zersetzung gibt und die vermieden zu haben ein Volk, das Wege ins Freie und Lichte sucht, sich glücklich preisen muß?
Eines ist wahr: Die Deutschen sind bei weitem nicht so verliebt in das Wort »Zivilisation« wie die westlichen Nachbarnationen; sie pflegen weder französisch-renommistisch damit herumzufuchteln, noch sich seiner auf englisch-bigotte Art zu bedienen. Sie haben »Kultur« als Wort und Begriff immer vorgezogen – warum doch? Weil dieses Wort rein menschlichen Inhaltes ist, während wir beim anderen einen politischen Einschlag und Anklang spüren, der uns ernüchtert, der es uns zwar als wichtig und ehrenwert, aber nun einmal nicht als ersten Ranges erscheinen läßt; weil dieses innerlichste Volk, {38}dies Volk der Metaphysik, der Pädagogik und der Musik ein nicht politisch, sondern moralisch orientiertes Volk ist. So hat es sich im politischen Fortschritt zur Demokratie, zur parlamentarischen Regierungsform oder gar zum Republikanismus zögernder und uninteressierter gezeigt als andere, – woraus man schließen zu müssen, zu dürfen geglaubt hat, und zwar nicht nur extra muros, daß diese Deutschen ein exemplarisch unrevolutionäres Volk, das eigentlich unrevolutionäre unter allen seien … Warum nicht gar! Als ob nicht Luther und Kant die französische Revolution zum mindesten aufwögen. Als ob nicht die Emanzipation des Individuums vor Gott und die Kritik der reinen Vernunft ein weit radikalerer Umsturz gewesen wäre als die Proklamierung der »Menschenrechte«. – Mit unserem Moralismus aber hängt unser Soldatentum seelisch zusammen, ja, während andere Kulturen bis ins Feinste, bis in die Kunst hinein die Tendenz zeigen, völlig die Gestalt der zivilen Gesittung anzunehmen, ist der deutsche Militarismus in Wahrheit Form und Erscheinung der deutschen Moralität.
Die deutsche Seele ist zu tief, als daß Zivilisation ihr ein Hochbegriff oder etwa der höchste gar sein könnte. Die Korruption und Unordnung der Verbürgerlichung ist ihr ein lächerlicher Greuel. Unter Pariser »Affären« (deren letzte die Caillaux-Sache mit obligater Gerichtsfarce war) würde sie entsetzlich leiden, – viel mehr, als Frankreichs Gemüt offenbar darunter leidet. Und dieselbe tiefe und instinktive Abneigung ist es, die sie dem pazifizistischen Ideal der Zivilisation entgegenbringt: ist nicht der Friede das Element der zivilen Korruption, die ihr amüsant und verächtlich scheint? Sie ist kriegerisch aus Moralität, – nicht aus Eitelkeit und Gloiresucht oder Imperialismus. Noch der letzte der großen deutschen Moralisten, Nietzsche (der sich sehr irrtümlich den Immoralisten nannte), machte aus seinen kriegerischen, ja militäri{39}schen Neigungen kein Hehl. Zur moralischen Apologie des Krieges haben deutsche Geister das meiste und wichtigste beigetragen, und nur ein deutscher Dichter – freilich nur einer wiederum unter allen – konnte sprechen:
»Denn der Mensch verkümmert im Frieden,
Müßige Ruh ist das Grab des Muts.
Das Gesetz ist der Freund des Schwachen,
Alles will es nur eben machen,
Möchte gern die Welt verflachen,
Aber der Krieg läßt die Kraft erscheinen,
Alles erhebt er zum Ungemeinen,
Selber dem Feigen erzeugt er den Mut.«
Und also sucht Deutschland den Krieg? Also »hat es den Krieg gewollt?« – Das hat es nicht. Händlertum hat ihn angestiftet, skrupellos, lästerlich, denn es weiß nichts vom Kriege, es fühlt und versteht ihn nicht, wie sollte es Ehrfurcht kennen vor seinen heiligen Schrecken? Daß ein Volk kriegerisch sein könne und dabei geduldig aufs äußerste, bis zum Rande der Demütigung, bis zur Gefährdung der Existenz selbst, – das deutsche Volk, einzig hierin unter allen, beweist es. Der Soldat aus Moralität ist kein Kampfhahn mit rasch schwellendem Kamm, kein hitzig hochfahrender Draufgänger. Ob aber ein Volk wahrhaft kriegerisch ist, zeigt sich daran, ob es sich, wenn der Krieg Schicksal wird, verschönt oder verzerrt. Deutschlands ganze Tugend und Schönheit – wir sahen es jetzt – entfaltet sich erst im Kriege. Der Friede steht ihm nicht immer gut zu Gesicht – man konnte im Frieden zuweilen vergessen, wie schön es ist. Fürchtet wer, daß der feierliche Kampf, den es um sein großes Lebensrecht führt, es in seiner Gesittung, seiner Kultur zurückwerfen könnte? Es wird freier und besser daraus hervorgehen, als es war. Aber sehen wir nicht auch, daß der {40}Krieg die andern, die mit Auszeichnung zivilisierten Völker gemein und elend macht? Wo ist nun Englands Anstand? Es lügt, daß wir uns statt seiner schämen. Und Frankreich? Geht seine Generosität und Menschlichkeit nicht unter in einem Rausch von Tollwut und schimpflicher Hysterie? Wir lasen Äußerungen repräsentativer Geister Frankreichs, führender Politiker, berühmter Schriftsteller, Äußerungen über Deutschland, so irr, so qualgeboren, daß man nicht ohne Erschütterung gewahr wurde: Das Hirn dieses Volkes erträgt den Krieg nicht mehr. Was ist aus Frankreich geworden in sechzig Kriegstagen! Ein Volk, dessen Antlitz der Krieg von heute auf morgen dermaßen ins Abstoßende verzerrt, – hat es noch ein Recht auf den Krieg? Diese Franzosen waren einst ein kriegerisches Volk, – in einem anderen Sinn als das deutsche, auf eine brillante, galante, gloriose, bravuröse und etwas spiegelfechterische Art, – getragen von jugendstarken Ideen, geführt vom persönlichen Dämon konnten sie vorübergehend die Welt unterwerfen. Von diesem Schwunge ist viel auf die Urenkel vererbt; doch da er heute des Auftrages entbehrt, – was ist er noch als eine tragische Velleität? Zuletzt – ist man bürgerlich-republikanisch, so ist es ein Widersinn, auf militärischem Prestige zu bestehen, wie unterm Empire. Das Volk der Logik, – die Logik eben hätte es bei seinem physischen und seelischen Zustande längst überreden müssen, militärisch abzudanken und ganz seinem zivilen Ideal zu leben. Wer hätte nicht dieses geachtet? Wer hätte es darin gestört? Nur Eitelkeit hinderte es an solchem Verzicht, nur die ihm unerträgliche, ihm unverschmerzbare Tatsache, daß es von Deutschland militärisch aus dem Felde geschlagen war, nur die idée fixe der Revanche. Um sie zu verwirklichen verbündet sich das Volk der Revolution mit dem verworfensten Polizeistaat, – und auf Rußland blickt es nun, da es den Krieg hat, auf die Kosaken hofft es wie auf Himmelshilfe, denn {41}es weiß ja, weiß es längst und genau, daß es aus eigener Kraft Deutschland nicht schlagen kann. Aber was ist denn das für eine Revanche, die nicht aus eigener Kraft genommen wird? Kann eine solche Revanche der Eitelkeit Genüge tun? Als die französische Presse Tag für Tag von den fremden Hilfstruppen schwärmte, die man aus aller Welt erwarte, machte Georges Clémenceau darauf aufmerksam, daß, wenn es sich darum handle, Frankreich zu verteidigen, dies eine Ehre sei, die in erster Linie den Franzosen zukomme. Diese Auffassung schien wenig verbreitet. Frankreich wird stolz und befriedigt sein, wenn es, besiegt und okkupiert, nur eben aushält und den Frieden verweigert, bis, vielleicht, nicht sehr wahrscheinlich mehr heute, die Russen über Deutschland kommen. Ist das Revanche? Ist das soldatische Ehre? Nein, das ist nichts dergleichen.
Es ist auch wenig soldatisch, es ist sogar wenig männlich, ein halbes Jahrhundert lang Revanche zu heischen, mit furchtsamer Sehnsucht endlich in den Krieg zu tappen und dann das Toben der Elemente beständig mit dem dünnen Schrei zu überschrillen, der »Zivilisation« lautet. Man macht Reims zur Festung, man stellt seine Kanonen in den Schatten des Doms, man postiert Späher auf die Türme, und wenn der Feind danach schießt, so kreischt man mit Fistelstimme: »Die Zivilisation!« Aber erstens, Messieurs, hat die Kathedrale von Reims mit der Zivilisation durchaus gar nichts zu tun. Sie ist ja ein Denkmal christlicher Kultur, eine Blüte des Fanatismus und des Aberglaubens und müßte der Zivilisation des jakobinischen Frankreichs, wenn nicht ein Dorn im Auge, so doch mindestens höchst gleichgültig sein. Das ist sie ihr auch; und der katholische Offizier, der die Beschießung befehlen mußte, hatte sicher in seinem Blute mehr Ehrfurcht für das Heiligtum als die Citoyens, denen es im Interesse der Politik nicht zerstört {42}genug sein konnte. Zweitens aber erinnert euer Benehmen auffallend an die gewiß nicht dumme, aber nicht sehr ehrenhafte Taktik der Suffragetten, welche Bomben warfen und, wenn man sie einsteckte, zeterten: »Man martert Frauen!« Wie war es eigentlich, wollte man uns erdrosseln oder nicht? Und wollte das süße Frankreich nicht brennend gern dazu helfen? Es hat eine Art, den Gegner ins Unrecht zu setzen, – weiblich in dem Grade, daß einem die Arme sinken. Aus jedem seiner Blicke, jeder Proklamation und jedem Rundschreiben seiner Regierung klagt es: »Welche entehrende Roheit, die Hand gegen Frankreich zu erheben!« Aber wollte nicht eben dieses Frankreich seine von prächtig erstarktem Offensivgeist getragene Armee über die Vogesen werfen, um uns den Garaus zu machen? Diese Nation nimmt Damenrechte in Anspruch, es ist kein Zweifel. Zart und liebreizend wie es ist, darf das unbedingt entzückendste der Völker alles wagen. Rührt man es aber an, so gibt es Tränen aus schönen Augen, und ganz Europa erbebt in zornigem Rittergefühl. Was ist zu tun? Man will nicht erlauben, daß wir leben; aber wenn wir mit einigem Nachdruck auf der Tatsache unseres Daseins bestehen, so legen wir einen beklagenswerten Mangel an Galanterie an den Tag.
Ein Wunder nur, daß man sich wundert; denn seitens unserer westlichen Feinde ist der Krieg ja eben als eine Art von Zwangszivilisierung Deutschlands gedacht. In der Tat: man will uns erziehen. Die Äußerung Bernard Shaws: Der Krieg werde dazu dienen, den Deutschen »Potsdam« abzugewöhnen, wurde zeitig bekannt. Man hat auch die Betrachtungen des englischen, aber in französischer Atmosphäre lebenden Publizisten Robert Dell gelesen, der sich noch deutlicher ausdrückt. England und Frankreich, sagt er, kämpfen für die Sache der Demokratie gegen Gewaltherrschaft und Militarismus. Wörtlich: »Das Beste, was man jetzt für Deutschland erhof{43}fen kann, ist eine Niederlage, die zu einer Revolution gegen die Hohenzollernsche Tyrannei führt.« Ein demokratisiertes Deutschland sei sodann gegen Rußland bündnisfähig. »Es kommt vielleicht für uns der Augenblick, wo wir Deutschland gegen Rußland verteidigen müssen.« – Nach Tannenberg scheint es, als ob Deutschland sich eine Ehre daraus mache, Europa ohne den Beistand der Herren French und Dell gegen Rußland zu schützen. Aber so klärt sich denn alles, liebe Freunde, und jede Bitterkeit weicht! Es ist an dem: Man will uns glücklich machen. Man will uns den Segen der Entmilitarisierung und Demokratisierung bringen, man will uns, da wir widerstreben, gewaltsam zu Menschen machen. – Wieweit dies Heuchelei, wieweit freche Dummheit ist, wer will es sagen. Der englische Abgeordnete Ponsonby wendet nachdenklich ein, man unterstütze jedoch auf diese Weise die russische Autokratie, kräftige den russischen Militarismus und störe also die Entwicklung des russischen Volkes. Ja, das ist wahr. Und auf britischer Seite handelt es sich wohl vorwiegend um Heuchelei. Auf der französischen aber um einen Dünkel, unleidlicher selbst als Albions beschränkter und unbeirrbarer Arbitratorenwahn. Frankreich ist so eitel, so heillos vernarrt in sich selbst, daß es trotz Anarchie, Marasmus, Überholtheit noch heute glaubt, Vorkämpfer, Träger, Verbreiter menschheitsbeglückender Ideen zu sein. Seine Art von Vernunft zwingt es zu glauben, ein Volk stehe auf einer höheren, edleren, freieren Stufe, wenn es, statt durch einen Monarchen im Soldatenrock, durch einen ehrgeizigen Rechtsanwalt repräsentiert und parlamentarisch regiert wird. Ein spanisches Blatt, dem das Gerede von deutscher Barbarei zu dumm wurde, hat neulich die Zahl der deutschen Schulen, Hochschulen, Universitäten neben die vergleichenden Ziffern für Frankreich und England gestellt. Es fügte eine Aufstellung der für Kunst und {44}Wissenschaft aufgewendeten Summen, dann das prozentuale Verhältnis der Analphabeten und Schwerverbrecher für die drei Staaten hinzu, und es fand, daß in jedem Fall die Wagschale sich zugunsten Deutschlands neige. Was folgt daraus? Daraus mag immerhin folgen, daß dieses unerklärliche Deutschland sich unter allen Ländern der modernsten und solidesten Gesittung erfreut; aber der Geist, der Geistmangel, die Prinzipien, woraus diese Überlegenheit hervorgeht, sie bleiben barbarisch. Nach der ersten verlorenen Schlacht jedoch, so meint Robert Dell, in dessen Haupt englische Humanitätsgleisnerei und französische Damennaivität eine schwierige Mischung eingegangen sind, nach der zweiten spätestens wird Deutschland Revolution ansagen, »die Hohenzollern« absetzen, den Rationalismus annehmen und ein verständig-verständliches Volk werden, ohne Rätsel und Unheimlichkeiten fortan für eine gesittete Mitwelt. Dies ist seine Meinung. Er glaubt allen Ernstes, daß Deutschland durch eine Niederlage zu revolutionieren, zu demokratisieren ist – er sieht nicht, daß die politische Ausprägung unserer bürgerlichen Freiheit, schon angebahnt, schon bestens unterwegs, nur im Frieden, jetzt nur nach dem Siege, dem gewissen, im Sinn und der Konsequenz der Geschichte liegenden Siege Deutschlands sich nach deutschen – nicht nach gallisch-radikalen – Geistesgesetzen vollenden kann; daß eine deutsche Niederlage das einzige Mittel wäre, uns und Europa in der Gesittung zurückzuwerfen; daß nach einer solchen Niederlage Europa vor dem deutschen »Militarismus« nicht Ruhe noch Rast haben würde, bis Deutschland wieder da stände, wo es vor diesem Kriege stand; daß umgekehrt nur Deutschlands Sieg den Frieden Europas verbürgt. Man sieht das nicht. Man sieht in deutscher Art ein Barbarentum, dessen Kraft gewaltsam und ohne Ansehen der Mittel gebrochen werden muß. Man glaubt, ein Recht zu ha{45}ben, auf Deutschland Kirgisen, Japaner, Gurkhas und Hottentotten loszulassen, – eine Beleidigung, beispiellos, ungeheuerlich, und einzig nur möglich geworden kraft jener im stärksten Sinne des Wortes unerlaubten Unwissenheit über Deutschland, die aus jedem Worte der Bergson, Maeterlinck, Rolland und Richepin, der Deschanel, Pichon und Churchill, am wüstesten aber aus der Tatsache der ganzen vermessenen Zettelung selber spricht. Solche Unwissenheit über das heute wichtigste Volk Europas ist nicht statthaft, sie ist strafbar und muß sich rächen. Warum vor allem ist Deutschlands Sieg unbezweifelbar? Weil die Geschichte nicht dazu da ist, Unwissenheit und Irrtum mit dem Siege zu krönen.
Daß deutsches Wesen quälend problematisch ist, wer wollte es leugnen! Es ist nicht einfach, ein Deutscher zu sein, – nicht so bequem, wie es ist, als Engländer, bei weitem eine so distinkte und heitere Sache nicht, wie es ist, auf französisch zu leben. Dies Volk hat es schwer mit sich selbst, es findet sich fragwürdig, es leidet zuweilen an sich bis zum Ekel; aber noch immer, unter Individuen wie Völkern, waren diejenigen die wertvollsten, die es am schwersten hatten, und wer da wünscht, daß deutsche Art zugunsten von humanité und raison oder gar von cant von der Erde verschwinde, der frevelt.
Es ist wahr: der deutschen Seele eignet etwas Tiefstes und Irrationales, was sie dem Gefühl und Urteil anderer, flacherer Völker störend, beunruhigend, fremd, ja widerwärtig und wild erscheinen läßt. Es ist ihr »Militarismus«, ihr sittlicher Konservatismus, ihre soldatische Moralität, – ein Element des Dämonischen und Heroischen, das sich sträubt, den zivilen Geist als letztes und menschenwürdigstes Ideal anzuerkennen. Dies Volk ist groß auch auf dem Feld der Gesittung – nur lächerliche Ignoranz leugnet es. Jedoch der Gesittung verfallen will es nicht, und es ist gegen seinen Geschmack, von der Zivilisation ein {46}scheinheiliges oder eitles Aufhebens zu machen. Es ist wahrlich das unbekannteste Volk Europas, sei es nun, weil es so schwer zu kennen ist, oder weil Bequemlichkeit und Dünkel die bürgerlichen Nachbarn hinderten, sich um die Erkenntnis Deutschlands zu bemühen. Aber Erkenntnis muß sein, Leben und Geschichte bestehen darauf, sie werden es als untunlich erweisen, die sendungsvolle und unentbehrliche Eigenart dieses Volks aus wüster Unkunde gewaltsam zu verneinen. Ihr wolltet uns einzingeln, abschnüren, austilgen, aber Deutschland, ihr seht es schon, wird sein tiefes, verhaßtes Ich wie ein Löwe verteidigen, und das Ergebnis eures Anschlages wird sein, daß ihr euch staunend genötigt sehn werdet, uns zu studieren.
{47}Gute Feldpost
1.
Welchen Begriff von Flüchtigkeit, Frivolität, Uneigentlichkeit und Schwäche gewisse Leute mit dem Worte »Geist« verbinden, – ich weiß es nicht! Der Gedanke, der ganz Gefühl, das Gefühl, das ganz Gedanke zu werden vermag; ein Affekt, der zugleich Gefühl und Gedanke ist, – das ist der Geist. Wahrhaftig, ihr seid nicht ganz im Rechte, wenn ihr meint, es entwürdige das Leben, indem er sich einen Jux daraus mache – und das Leben nehme ihm alle Würde und lasse ihn gänzlich verbleichen, wenn es sich mächtig emporrichte. Geist ist Gefühl und Wahrheit, er ist wirklichster Ernst – wie sollte er Raub sein an ernstester Wirklichkeit!
Ernsteste Wirklichkeit dünkt euch der Krieg, – und also, meint ihr, dürfe sich der Geist nicht neben ihn stellen, nicht sich mit ihm in Beziehung setzen, ohne vom allgemeinen Hohngelächter hinweggefegt zu werden? Aber der Krieg, wie alles Leben, hat den Geist stets nötig gehabt. Er verdankt ihm die eigene Apologie: die moralische vor allem – wir wollen ganz von der ästhetischen schweigen – und wenn es unstatthaft und erbärmlich wäre, anläßlich des Krieges Geist zu haben, so dürfte ein braver Unteroffizier Schillern auf seine Lobpreisung des Krieges in der »Braut von Messina« entgegnen: »Lieg erst vier Tage lang ohne was Warmes in einem Schützengraben voll Regenwasser, so wirst du mitreden dürfen!«
Wie, der Gedanke bestünde nicht neben der Wirklichkeit? Aber wenn der Krieg Geist zeitigt, so geschieht es vielleicht, weil der Geist den Krieg zeitigte! Es ist Philister-Mesquinerie, sich mißtrauisch und abschätzig gegen die »Literatur« zu verhalten, als sei sie gänzlich ein Friedensluxus, die Prätension {48}lächerlicher Preziöser, mit welcher es unter den gewaltigen Wirklichkeitsumständen von heute »gründlich zu Ende« sei. Wißt denn ihr, welchen Anteil vielleicht gewisse Wendungen und neue Willensmeinungen der Literatur an der Wirklichkeit dieses Krieges haben und daran, daß er geistig möglich wurde? Unter den drei, vier Büchern, die sich am häufigsten in den Tornistern unserer im Feld stehenden Jugend finden, wird »Also sprach Zarathustra« genannt …
2.
Die Zweiheit von Gedanke und Wirklichkeit, die Kluft und Fremdheit zwischen dem Geist und dem Leben ist allerdings eine seelische Wahrheit, ein Künstlererlebnis zumal, – es war der Schmerz, den meine Jugend am besten erfuhr. Aber früh auch ward ich gewahr, daß in den Beziehungen zwischen ihnen alles Glück der Welt beschlossen sei. Neigte der Geist sich nicht werbend zum Leben und sagte ihm schmeichelnd, daß es die Schönheit sei? Aber wie lächelte nun gar die Natur, wenn das Leben sich huldigend vor dem Geiste neigte, – weil es sich in ihm wiedererkannte! Einige Weise und Dichter haben dafür gehalten, daß hier Eros sei und nirgends sonst, – in diesem zarten, seligen, schmerzlichen, diesem göttlichen Hin und Wider zwischen Leben und Geist.
3.
Was ist Künstlerfreiheit und Künstlerschicksal? – Im Gleichnis zu leben. – Nenne ein Beispiel! – Hier ist eins: Soldatisch zu leben aber nicht als Soldat. – Aber dabei ist keine Ehre; denn Ehre hat nur die Wirklichkeit. – Wirklich? Der große Kant jedoch war ein Krüppel, der nicht einmal zum Garnisonsdienst getaugt hätte, und er war der erste Moralist des deutschen Soldatentums.
{49}Ja und ja! Es gibt nur einen wirklich ehrenhaften Platz heute, und es ist der vor dem Feind. Wenn unser Herz für Deutschland im Kampfe liegt, – wir verstehen uns allzu gut auf jene Humanität, welche die Ehre des Leibes will vor der der Seele; und so mag derjenige wohl in seiner Ehre leiden, dem es auch heute nicht erlaubt ist, wirklich zu sein, dem es selbst diesmal verhängt bleibt, im Gleichnis zu leben. Doch siehe da …
Gute Feldpost kam an mehreren Tagen, kam aus den Argonnen, aus den Feldbefestigungen vor Verdun, dorther, wo die ehrenhafte Wirklichkeit, die wirklichste Ehre ist. Kämpfer für Deutschland, Ulanen, freiwillige Schützen, die ich nicht kenne, adelige und gelehrte Jugend, die sich täglich riskiert, – an einem Bauerntisch im Gebirgsquartier oder, die Flinte im Arm, den Rücken gegen den feuchten Abhang des Grabens gelehnt, schrieben sie, das Papier auf dem Knie, schrieben mit Bleistift, daß sie, »vor sich den Feind und den Sieg«, manchmal von dem miteinander sprächen, was ich gemacht, namentlich von dem letzten, einer Geschichte vom Tode, und daß diese ihnen »niemals näher war«.
Die ihr zu klug seid euch hinzugeben und spöttisch denen zuschaut, die es tun, – macht, was ihr wollt, daraus, daß ich es mitteile, lacht mich derb oder höhnisch aus, weil ich genügsam, sentimental oder eitel genug bin, glücklich darüber zu sein, – ich trotze dem, und es ist mir ganz einerlei. Ein Gebild, welches heute und dort besteht, vor den Augen derer, die dort draußen ein Leben der höchsten, wirklichsten Ehrenhaftigkeit führen, und welches ihnen »nie näher war«, – kann es so falsch, so schmählich sein, wie viele von euch ausschrieen, als ich es hingab? Welche Feuerprobe verlangt ihr, worin es sich als Affekt, als Geist, als Wahrheit bewähre?
Es ist Kleinmut, zu glauben, der Gedanke müsse vor der Wirklichkeit in Unehre vergehen; es ist nichts als gemein, sich {50}gar noch etwas zugute darauf zu tun, daß der Geist heute von der Wirklichkeit erdrückt und ins Nichts verwiesen werde. Der Geist, ihr Händereiber, war dem Leben »niemals näher« als eben jetzt, – das Leben selbst sagt es, und da ihr vorgebt, es so sehr zu achten, nun, so glaubt ihm!
Ich weiß wohl, wüßte es auch ohne Gruß und Bekräftigung von dorther, daß mein Denken und Dichten nicht ohne Beziehungen zu den Ereignissen war und ist. Mein bißchen Werk, sterblich und nur halbgut wie es immer sei, – wenn in seinen Gleichnissen etwas von dem lebendig ist, was heute mit einem Welt-Gassenwort »der deutsche Militarismus« heißt, so hat es Ehre und Wirklichkeit, so hat die Wirklichkeit von seiner Ehre und seinem Geist.
Thomas Mann
{51}[Gegen den »Aufruf zur Würde«]
Hochgeehrter Herr! München, den 24.X.14.
Ich möchte mich an dem Aufruf nicht beteiligen, nachdem ich einige Tage geschwankt, ob ich es dennoch tun sollte. – Daß wir uns gegen den Vorwurf, »Barbaren« zu sein, auch nur verteidigen sollten, finde ich absurd. Seitdem nun auch Herr Gorki und ein Senegalese ihn sich zu eigen gemacht haben, wird man sich in Europa wohl allmählich genieren, ihn zu erheben. Frankreich jetzt zur Würde ermahnen, heißt, zu viel verlangen: Die Forderung geht über seine Kräfte. Man protestiert nicht gegen die Äußerungen schwer Leidender. Was die geistigen Führer Frankreichs jetzt über Deutschland äußern, ist so irr, so qualgeboren, daß man nicht ohne Erschütterung gewahr wird: das Hirn dieses Volkes erträgt den Krieg nicht mehr. Aufrufe gleich dem Ihren sind ja schon mehrfach hinausgegangen, unterzeichnet mit großen deutschen Namen, – auch die Literatur war vertreten. Die Antworten aus dem Auslande lauteten höhnisch und gaben Befriedigung darüber zu erkennen, daß Deutschland sich moralisch in die Defensive gedrängt sehe. Das heißt die Dinge verdrehen. Es ist genug damit.
Ich habe nichts dagegen, daß Sie diese meine Meinungsäußerung wiedergeben. Unterzeichnen möchte ich, wie gesagt, nicht.
Ihr sehr ergebener gez. Thomas Mann.
{52}[Die Bücher der Zeit]
Zeiten wie diese üben auf Geist und Seele die widersprechendsten Wirkungen. Sie bessern, erheben, reinigen, aber sie schädigen auch sehr. Geben wir es nur zu, daß auch wir, die wir nicht des jetzt einzig ehrenhaften Aufenthalts im Schützengraben teilhaftig sind, große Gefahr laufen, zu verwildern. Man verschlingt mit heißem Kopfe Zeitungen, man bringt den Fleiß, die friedliche Sittsamkeit nicht auf, um ein Buch zu lesen. Alles, was sich nicht unmittelbar auf den Tag, den wilden, großen, hitzigen Tag bezieht und von ihm handelt, erscheint abstrakt, fern, gestrig, aus einer anderen Welt. … Wenn wir aber lesen – und das ist die Kehrseite –, wenn wir lesen, so sind unsere Ansprüche außerordentlich, so muß es das schlechthin Würdige, Hochstehende und Hochsinnige sein, das, was unser Vertrauen, unsere Hingabe sicher verdient, denn für das Experiment, das Fragwürdige in der Lektüre haben wir jetzt die Nerven nicht. Dies scheint mir der einzige Gesichtspunkt, unter dem das, was wir jetzt lesen sollen oder vielmehr lesen können, zusammenzufassen ist. Höhere Beziehungen des Buches zum Heute, insonderheit exemplarisch nationale Eigenschaften, werden willkommen, doch nicht Bedingung sein. Heiterkeit des Gegenstandes ist gewiß nicht ausgeschlossen. Unangemessen, der Zeit unanständig erscheint uns das Unernste.
Wie Sie es wünschen, gebe ich zehn Namen – Beispiele natürlich –, denn ich könnte auch andere nennen. Die große Philosophenreihe Plato, Kant, Schopenhauer, Nietzsche stehe am Anfang –, und so sind es schon vier Namen und viele Bände. Platos tiefe, herrliche Träume hat Rudolf Kaßner verdeutscht in einem außerordentlichen Sinn. Schopenhauers Weltorganisation, sei{53}ne Lehre vom Willen und von der Erlösung –, sie hat höchste Wohltaten bereit für den, der sich eben jetzt in sie vertieft. Und in Kant und Nietzsche haben wir die Moralisten des deutschen »Militarismus« –, ja, sie zeigen, daß das deutsche Soldatentum ein Soldatentum aus Moralität ist.
Bismarcks »Gedanken und Erinnerungen«, namentlich seine großartigen Darlegungen über die Gründung des Dreibundes, werden eifriger als je studiert werden, und wohl jeder, an den Ihre Rundfrage sich wendet, wird sie nennen.
Die Geschichte Friedrichs des Großen von unserem britischen Freunde Thomas Carlyle ist in besonderem Maße ein Buch der Zeit. Nur eine gewisse, höchst berechtigte politische Rücksicht verhindert heute, daß König Friedrichs Name und Taten so sehr ein Gegenstand des öffentlichen Gedächtnisses sind, wie es natürlich wäre. (Denn die Aehnlichkeit und Verwandtschaft von 1914 und 1756 ist bis in Einzelheiten hinein wahrhaft erstaunlich, sie verdiente eine ausführliche Analyse –, wie Lamprecht in seiner angekündigten Schrift über Deutschlands Aufstieg sie mutmaßlich geben wird.) Und so wird eine Beschreibung seines Lebens viele zu des Königs eigenem literarischen Werke führen, dessen erste große Ausgabe ja – eine merkwürdige Fügung! – unmittelbar vor Ausbruch des Krieges fertiggestellt wurde.
Die Romane Goethes sind das Geistigste und Höchste, was diese Kunstgattung überhaupt hervorgebracht hat. Sie kommen übrigens einem eigentümlichen nationalen Interesse noch besonders entgegen: dem pädagogischen.
Heinrich v. Kleist wird jetzt vielfach angerufen, und doch ist, meiner persönlichen Erfahrung nach, seine »Aktualität« weniger unmittelbar, als man glauben möchte. Sie beschränkt sich schließlich auf die gute Losung: »In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!« – Denn es müßte anders mit uns stehn, als {54}es heute steht, wenn sein Haßpathos dem Volke wirklich zugänglich sein sollte. Ein Volk, welches fühlt, daß die Hand der Geschichte, die Logik der Geschichte über ihm ist, so daß es unmöglich verderben kann, wird sich von dem namenlosen, die äußersten Mittel segnenden Affekt der »Hermannsschlacht« wohl allgemein erschüttert, aber nicht gegenwärtig getroffen fühlen. Aber was für zeitlose Meisterwerke sind seine Novellen! Und in manchem Feldpostbrief, den man heute liest, wird man den Rhythmus seiner Kriegsanekdoten wiedererkennen.
Noch eine persönliche Erfahrung möchte ich anführen. Das leidenschaftliche politische Engagement der Zeit bewirkt zweifellos, daß die freie Hingabe an fremdländische Kunst, an russische, englische, französische Novellistik etwa, auf innere Widerstände stößt. Ein reiner Genuß ist nicht möglich. So nenne ich noch zwei Erzähler deutscher Zunge – denn es bleiben mir nur noch zwei –: Meyer und Fontane. Historisch gestimmte Schriftsteller beide: jener gemessen und haltungsvoll, von lateinischer Formgebung, dieser, wenn auch nur scheinbar, bequemer und lässiger, unendlich erheiternd dabei und sorgenlösend. Die große, streitbare Gestalt des Jürg Jenatsch wird jetzt viele erbauen. Und wer in die Lebensstimmung des altpreußischen Offiziers sich vertiefen möchte, der lese Fontanes »Poggenpuhls«.
Thomas Mann.
{55}Friedrich und die große Koalition
EIN ABRISS FÜR DEN TAG UND DIE STUNDE
Ja, womit soll man anfangen! Der Geschichtschreiber – und nun gar der Gelegenheitshistoriker – ist immer jener Versuchung ausgesetzt, der Wagner auf das großartigste erlag, als er, eigentlich nur gesonnen, den Untergang seines Helden aufzuführen, von einer begeisterungsvollen Pedanterie sich immer weiter im Mythos rückwärts locken ließ, ein immer größeres Stück der »Vorgeschichte« mit aufzunehmen sich genötigt fand, bis er endlich am Grundanfange und Anbeginn aller Dinge notgedrungen haltmachte: beim tiefsten Es des Vorspieles vom Vorspiel, womit er denn feierlichst und fast unhörbar zu erzählen anhob. Da aber Raum und Zeit den lebhaftesten Protest dagegen erheben, daß wir bei dieser Skizze der Ursprünge eines Krieges, dessen Wiederholung oder Fortsetzung wir heute erleben, mit dem tiefen Es beginnen, so wollen wir uns einen Stoß geben und mit dem großen Mißtrauen den Anfang machen, dem tief wurzelnden und, wenn wir billig sein wollen, ziemlich begründeten Mißtrauen der Welt gegen König Friedrich II. von Preußen.
Man erinnere sich nur: Der junge Mann, knabenhaft seinen Zügen nach, zierlich und etwas dicklich von Statur, »das niedlichste Menschenkind im Königreich«, wie ein Fremder urteilte, von lebhafter Gesichtsfarbe und kindlichen Backen, mit großen, kurzsichtig glanzblauen Blicken, sowie einer Nase, die genau in der Linie der Stirn verläuft und vorn eine naive Rötung aufweist, nach damaligen Bildern zu urteilen, – dieser niedliche junge Mann, dessen teils liederliche, teils schreckhafte und momentweise fürchterliche Kronprinzenvergangen{56}heit bekannt ist, libre-penseur dabei, keck philosophisch, Literat, Verfasser des überaus humanen »Antimacchiavell«, durchaus unmilitärisch, wie es bisher den Anschein hatte, zivil, lässig, selbst weibisch, ein Schuldenmacher, auf Kurzweil und Prunk von Herzen bedacht, – wird König, weil ehrloserweise keine Tracht Prügel und kein Am-Halse-Würgen von seiten seines beängstigenden Papas ihn seinerzeit hat bewegen können, sich eine Kugel in den Kopf zu schießen oder wenigstens zugunsten seines Bruders zu resignieren, und benimmt sich als König in einer Weise, daß man nicht weiß, was man denken soll. Der Tag seiner Thronbesteigung hieß fortan: »La journée des dupes« – fast alles kam anders, als man es sich gedacht hatte. Diejenigen, die vor der Rache des neuen Herrn gezittert hatten, wurden nicht gestraft, und die, welche ihre Stunde gekommen glaubten, sahen sich enttäuscht. Die Glücksritter und Poeten, die den Thron umschwärmten und sich mit hoffnungstrunkenen Vivats nicht genugtun konnten, wurden zusehends kleinlauter, und ein lustiger Bruder von Rheinsberg, der die Harmlosigkeit hatte, das Tönchen von damals zutraulich wieder anzuschlagen, bekam einen glanzblauen Blick und das schneidende Wort: »Monsieur, à présent je suis Roi!« Auf deutsch: »Die Possen haben ein Ende!« Das ist die Stelle bei Shakespeare, die schönste vielleicht in seinem ganzen Werk, wo jemand unter einem ebensolchen Blicke zu jemandem sagt: »Ich kenn’ dich, Alter, nicht.«
Einiges, was der junge Herr gleich in den ersten Tagen tut, hat ja literarischen Habitus, – ist also keck und etwas extravagant. Er schafft die Folter ab, – desto besser für die Diebe. Er erklärt, daß Gazetten, wenn sie ein bißchen amüsant sein sollen, nicht geniert werden dürfen, und hebt die Zensur auf (führt sie übrigens ein Jahr danach wieder ein). Er proklamiert religiöse Toleranz, – nun, das ist die berühmte Aufklärung. {57}Aber was wird aus dem galanten, üppigen, sorglosen Musenhof, den man sich erträumt hatte und an dem die Mode und der schöne Geist herrschen sollten? Gar nichts wird daraus. Der Herr ist vor allen Dingen auf einmal eisern sparsam. Nichts von Gehaltserhöhung für die Beamten. Nichts von Aufhebung der hohen Zölle, – wie sehr auch gewisse Leute sich auf dergleichen gespitzt haben. Die Domänenkammern bekommen ausdrückliche Weisung, daß das genaue Finanzsystem des hochseligen Königs strikte zu respektieren ist. Finanzminister Boden, ein verhaßter Geizkragen, bleibt. Von Vertrauensseligkeit, Lässigkeit, Sorglosigkeit – auch nicht eine Spur. Jedem wird auf die Finger gesehen wie nie zuvor. Damals war es, daß Baron von Pöllnitz, Oberzeremoniemeister, wörtlich den Seufzer tat: »Ich wollte hundert Pistolen geben, wenn ich den alten Herrn wieder haben könnte!«
Kein irgendwie grundstürzender Systemwechsel also, keine Zügellockerung in der Verwaltung, keine neuen Gesichter im Ministerium. Aber eines bleibt doch wohl sicher: Die verkörperte Zivilität ist zur Herrschaft gelangt, die Literatur im seidenen Schlafrock, – der Korporalstock hat abgewirtschaftet, mit dem Potsdamer Militarismus wird es gründlich zu Ende sein. Ja, freilich! Gerade hier gibt es die vollkommenste Überraschung. Der schlappe und ziemlich wollüstige junge Philosoph entpuppt sich zur allgemeinen Verblüffung als passionierter Soldat, – welcher nicht daran denkt, das militärische Fundament des Staates zu schwächen. Zu schwächen? Er vermehrt die Armee um fünfzehn Bataillone, fünf Schwadronen Husaren (die er nach österreichischem Muster einführt) und eine Schwadron Gardedukorps, womit sie nun also rund neunzigtausend Mann stark ist. Die Uniform, früher ein vermaledeiter Sterbekittel, zieht er überhaupt nicht mehr aus. Sein Konservatismus geht so weit, daß er jede Veränderung in den {58}Kommandostellen unterläßt. Die Heeresorganisation ist ein Denkstein der Regentenweisheit von Unsers höchstgeliebtesten Herrn Vaters Majestät, sie ist im wesentlichen nicht anzutasten. Ein paar Plumpheiten im Werbewesen werden allenfalls abgestellt, das Fuchteln der Kadetten, Mißhandlungen des gemeinen Mannes haben ehrenhalber zu unterbleiben, – das ist alles. Was sich aber ändern zu sollen scheint, das ist der Sinn der Einrichtung, der Geist, in dem man sich ihrer bedient, kurzum: ihre politische Bedeutung, – und dies eben ist das Bedenkliche.
Das Militär war ja so etwas wie ein Puschel des höchstseligen Herrn gewesen, eine rauhe und ziemlich kostspielige Liebhaberei, über die man an allen Höfen gewitzelt hatte und die bei den europäischen Geschäften nie irgendwie ins Gewicht gefallen war. Auf einmal ist es »die Macht des Staates« – dies ist der Ausdruck Friedrichs in einem der ersten Briefe, die er als König schreibt, – eine sonderbar sachliche Auffassung, die übrigens auch darin zum Ausdruck kommt, daß der Institution das Schrullenhafte und Kuriose, das ihr anhaftete, genommen wird. Das Riesenregiment, sehenswürdig aber etwas stupid, wird abgeschafft – es tut bei der Leichenparade für Friedrich Wilhelm zum letzten Male Dienst, und nur ein Bataillon »Grenadiergarde« wird der Pietät halber beibehalten. »Die Macht des Staates« … Preußens Vertreter an fremden Höfen führen plötzlich eine Sprache, daß man seinen Ohren nicht traut. Preußen tritt auf, Preußen wünscht durchaus, sich als die beträchtliche Realität betrachtet zu wissen, die es ist, – sein überraschender junger König nimmt eine Miene an, als empfinde er seine Stellung nicht sowohl als die eines deutschen Reichsstandes, denn als eine europäische, er gibt zu verstehen, daß er nicht gemeint ist, »immer nur zu spannen und niemals abzudrücken«, wie das spöttische Europa es so lange von Preußen gewöhnt gewesen ist …
{59}Aber was soll man aus alldem nun machen! Hat er denn bis dahin Komödie gespielt? »Der größte Fehler an ihm«, hat Graf Seckendorff einmal über den Kronprinzen nach Wien geschrieben, »ist seine Verstellung und Falschheit, daher mit großer Behutsamkeit sich ihm anzuvertrauen ist.« Ja, das scheint so. Und wenn Seckendorff fortfährt: »… Er sagte mir, er wäre ein Poet, könne in zwei Stunden hundert Verse machen. Er wäre auch Musiker, Moralist, Physiker und Mechaniker. Ein Feldherr und Staatsmann wird er niemals werden,« – so sieht es jetzt aus, als ob auch dies Verstellung und Falschheit von seiten des jungen Menschen gewesen sei. Denn was nun kommt, ist denn doch das Stärkste an Überraschung und zeigt überhaupt erst, wessen man sich von ihm zu versehen hat.
Nicht ein halbes Jahr ist seit Friedrichs Thronbesteigung vergangen, als Karl VI. stirbt, und kaum ist der Kaiser unter der Erde, so erhebt Friedrich zur größten Bestürzung seiner eigenen Minister, Generale, Verwandten und der ganzen Welt irgendwelche Ansprüche auf Schlesien, – Ansprüche, vollständig unbegründet dem Buchstaben nach und feierlichen Verträgen zufolge, begründet, wenn man denn will, in mancherlei Untreue und Schnödigkeit, die Brandenburg von Habsburg je und je hat erdulden müssen, und Ansprüche jedenfalls, die Friedrich, wenn Maria Theresia sich nicht fügt, was sie unmöglich tun kann, mit dem Schwerte geltend zu machen sich anschickt. »Alles ist vorbereitet,« schreibt er an Algarotti; »es handelt sich nur um die Ausführung der Entwürfe, die ich seit langer Zeit in meinem Kopfe bewegt habe.« Seit langer Zeit? Und alles längst vorbereitet? Ohne daß irgend jemand eine Ahnung davon gehabt hat? Ohne daß er von solchen Ansprüchen und Absichten sich bisher das Geringste hat anmerken lassen? Aber dann ist er ja ein hinterhältiger, versteckter und in aller Rheinsberger Geselligkeit einsamer junger Mensch gewesen! – An Voltaire übri{60}gens schreibt er: »Der Tod des Kaisers zerstörte all meine friedlichen Ideen.« Damit nämlich Voltaire in Frankreich die Ansicht nicht aufkommen läßt, als sei der Angriff von langer Hand her vorbereitet gewesen. Ein sowohl einsamer als namentlich auch schlauer junger Mensch.
Es bleibt dabei: Friedrich überzieht das Kaiserhaus mit Krieg, – der Markgraf von Brandenburg, der als Erzkämmerer den Vorfahren Maria Theresias das Waschbecken zu reichen gehabt hat. »C’est un fou, cet homme là est fol,« sagt Ludwig XV., der doch von großer Politik irgend etwas verstehen muß. »Eine Unbesonnenheit, ein überaus tollkühnes Beginnen,« sagt ganz Europa. Und der englische Minister in Wien findet schon jetzt, daß Friedrich in den politischen Bann getan zu werden verdiene.
Aber eine Unbesonnenheit oder nicht, – Österreich ist schlecht in Form, die Sache geht gut aus für Preußen. Es kommt Mollwitz, wo Friedrich geschlagen wird und zehn Meilen weit ausreißt, während Schwerin nachträglich für ihn siegt, – es ist gar kein sehr königlicher Ruhmestag, aber es ist ein Erfolg. Übrigens langt auch Bayern nach der Kaiserkrone, Frankreich steht ihm bei, Wien ist in Bedrängnis, es kommt obendrein Chotusitz, wo Buddenbrock die Österreicher in das brennende Dorf wirft, und Maria Theresia, die »lieber an Bayern eine ganze Provinz, als an Preußen ein einziges Dorf abtreten wollte« (sie haßt diesen Friedrich mit ganzer Weibeskraft), muß, Kummer in ihrem weißen Busen, Tränen in ihren blauen Augen, einen Frieden unterfertigen, der dem König Ober- und Unterschlesien und die Grafschaft Glatz zusichert, – er hat sie, sie sind sein.
Was weiter? Es sind rund zwei Jahre vergangen, als Friedrich von neuem Krieg macht, – angeblich, um als Kurfürst des Reiches dem bedrängten bayrischen Kaiser Sukkurs zu bringen, in {61}Wirklichkeit wohl mehr darum, weil Maria Theresia unterdessen gegen Frankreich und Bayern etwas zu erfolgreich gewesen ist und weil Friedrich argwöhnt, daß sie sich, wenn die anderen am Boden liegen, gegen ihn wenden wird, um Schlesien wiederzunehmen, dieses schöne, unverschmerzbare Schlesien, über das sie in Schluchzen ausbricht, sobald sie nur davon hört. Auch ist sie nicht ohne mächtige Freunde, – wie denn König Georg II. von England, Besieger der Franzosen und Alliierter der Kaiserin-Königin seit Worms, 1743, ihr wörtlich geschrieben hat: »Madame, ce qui est bon à prendre est bon à rendre,« der Brief ist in Friedrichs Händen. England und Österreich haben sich gegenseitig die Besitzungen gewährleistet, die sie bis 1739 innegehabt. Bis 39? Das war ja wohl, bevor Friedrich Schlesien nahm! Und zwischen Österreich und Sachsen kommt es zu ähnlichen Verträgen … Genug! Die österreichischen Historiker schwören zwar himmelhoch, daß die Kaiserin damals keinen Angriff geplant habe, aber es war genug für Friedrich. Er steht sehr gut mit Frankreich, hat seit dem Juni einen Offensivvertrag auf zwölf Jahre mit Richelieu in der Tasche, ist also nicht ohne diplomatische Rückendeckung. Er hat »die Macht des Staates« in diesen zwei Jahren um achtzehntausend »Schnurrbärte« (wie Voltaire zu sagen pflegte) vermehrt, hat die schlesischen Festungen vortrefflich ausgebaut, und im Hochsommer 44 schlägt er abermals los, fällt, ohne auch nur den Krieg zu erklären, achtzigtausend Mann hoch in Böhmen ein, zieht auch durch Sachsen, ohne den dortigen Kurfürsten im geringsten um Erlaubnis zu bitten, rückt gegen Prag, rückt geradezu gegen Wien.
Die Sache geht sehr schwer, sie steht dann und wann direkt verzweifelt. Karl von Lothringen wirft sich vom Elsaß nach Böhmen und bedroht Friedrichs Verbindungen mit Schlesien, die sächsische Armee hat der König im Rücken, – es gibt eine {62}schlimme Retirade, verschuldet durch eine Menge Dummheiten, die Friedrich nach eigenem späterem Eingeständnis begeht und bei denen er manches lernt. Im folgenden Jahre stellt sich heraus, daß er als General in letzter Zeit arge Fortschritte gemacht hat. Auf Hohenfriedberg folgt Soor, und als er dann noch bei Kesselsdorf die Sachsen zugrunde richtet, kommt Graf Harrach als Unterhändler nach Dresden, und Maria Theresia bestätigt die Abtretung Schlesiens, während Friedrich ihren Ehegatten, den galanten Franz von Lothringen, als deutschen Kaiser anerkennt – in Gottes Namen, da Karl VII. ohnehin tot ist und Friedrich sich offen gestanden auch niemals so sehr für ihn interessiert hat.
Warum aber macht er Frieden mit Habsburg? Weil er sieht, daß Frankreich in den Niederlanden glücklich gewesen ist und es also mit dem Übergewicht der Kaiserin-Königin vorderhand nichts mehr auf sich hat. Zum größten Mißvergnügen Frankreichs schließt er auch Frieden mit England, zieht sich mit seiner Beute – Schlesien – zurück, widersteht in den nächsten drei Jahren – denn so lange dauert der Streit um die Pragmatische Sanktion zwischen Österreich und den Seemächten gegen Frankreich noch fort – weislich allen Versuchen, ihn aus der Neutralität herauszulocken und erhält im Aachener Frieden, welcher den Erbfolgestreit endgültig zugunsten Maria Theresias beilegt, auch noch die ausdrückliche Garantie seiner schlesischen »Erwerbung«.
Nun müssen wir aber eines sagen. Wenn man die schlesische »Erwerbung« für einen Raub hielt, für ein rechtswidrig errafftes Gut – und das tat man, und das war sie ja wohl auch –, so durfte man sie dem Räuber nicht feierlich garantieren. Wenn man sie ihm aber garantierte, so mußte man es der Zeit anheimstellen, aus Unrecht Recht zu machen – denn dazu ist die Zeit ja imstande –, so mußten Europa und Maria Theresia {63}fortan allen Machinationen und Konspirationen gegen den Räuber entsagen und sich mit der vollendeten Tatsache zufrieden geben. Das taten sie aber nicht, das tat insbesondere Maria Theresia nicht, sondern sie ließ die Hoffnung, Schlesien trotz dem Aachener Frieden zurückzugewinnen, beileibe nicht fahren, und das ist ein Einwand gegen die prächtige, naive, hochherzige Frau, die im übrigen die Sympathie und das Mitleid Europas so sehr verdiente. Woran lag es denn aber, daß Europa – oder doch seine Höfe und Regierungen – diesem König gegenüber innerlich nicht zur Ruhe kam? Es lag an dem großen Mißtrauen, mit dem wir anfingen, einem Mißtrauen, das der König ausgiebig erwiderte und das in seinem grund-fremdartigen, rätselhaften Charakter begründet war, einem Charakter, von dessen Gefährlichkeit man Proben hatte, und dessen Äußerungen und Manifestationen Europa auch in der Folgezeit beständig in Atem hielten.
Tatsache war vor allem einmal, daß unter allen Mächten, die sich um die Pragmatische Sanktion geschlagen hatten, Friedrich allein etwas gewonnen, sehr viel sogar gewonnen hatte. Daß er die schöne Provinz behielt, war das wenigste. Aber dies armselige junge Preußen mit seinen zwei Millionen Seelen hatte sich als ebenbürtiger Staat neben Österreich, oder ihm gegenüber, gestellt, es hatte sich unter die Mächte Europas gedrängt mit dem Anspruch, fortan in allen europäischen Angelegenheiten als Großmacht mitzureden, und die anderen gezwungen, fortan mit Preußen als mit einem erheblichen politischen Faktor zu rechnen, – einem ausschlaggebenden sogar; denn Friedrich hatte es fertiggebracht, zum mindesten den Anschein, die populäre Vorstellung zu erwecken, als sei er für das europäische Gleichgewicht, soweit nämlich das Balanceproblem Frankreich-Österreich in Frage kam, das »Zünglein an der Wage«. Eine solche Nötigung aber, umzudenken, sich {64}neu zu orientieren, fällt Europa entsetzlich schwer, es wird in Jahrhunderten nicht damit fertig. Es sperrt sich, es höhnt, es keift; es spricht der Neubildung jede politische, kulturelle, vor allem moralische Berechtigung ab, es kann sich nicht genugtun in Hohn und Erbitterung gegen den Eindringling, es prophezeit ihm den baldigen, notwendigen Wiederuntergang, und wenn solche Prophezeiung sich nicht prompt genug erfüllen will, so ist die alte, erbeingesessene Staatengesellschaft imstande, alle sonstigen Prestigestreitigkeiten und Interessengegensätze, auch die vitalsten und grimmigsten, zu begraben und zu vergessen, nur um sich zu dem hoffnungsinnigen Versuche zusammenzutun, den Störenfried einzuzingeln und abzuwürgen, – zweimal versucht sie das, wenn es sein muß, in nur einhundertfünfzig Jahren. Treuherzige Leute, wie Friedrichs philosophischer Freund Jordan, konnten es sich schon im zweiten schlesischen Kriege gar nicht erklären, »wie es doch komme, daß die Berichte der Zeitungen niemals günstig für uns seien«. Ja, das war sonderbar. Aber die Berichte der Zeitungen hatten es ja nicht hindern können, daß Friedrich Schlesien behielt. War er denn nun wenigstens, die Garantie in der Tasche, gesättigt und zufrieden? Maßnahmen gegen ihn vorbehalten, – aber schien er seinerseits nun wohl und friedlich gesinnt?
Auf Abrüstung war er nicht unmittelbar bedacht, den Eindruck hatte man nicht. Seit dem Frieden zu Dresden hielt er sein Heer auf dem Fuße von einhundertvierzigtausend Mann, doch waren da außerdem noch »überkomplette Mannschaften«, deren Zahl er verdoppelte, so daß er über einen ausgebildeten Heeresersatz von sechzehntausend Mann gebot. Das waren also einhundertsechsundfünzigtausend Schnurrbärte, – für ein Land von Preußens Größenordnung und ökonomischen Verhältnissen eine absurde Masse. Ludwig XV. hatte {65}nicht so viele Soldaten und namentlich nicht so widerwärtig gute; denn dieses Heer, über Gebühr stattlich seiner Ziffer nach, exerzierte Friedrich in einer Weise, daß man in ganz Europa davon sprach.