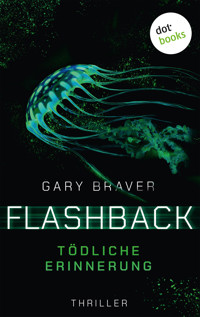4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Preis des ewigen Lebens: Der Wissenschaftsthriller »Eternal – Gefährliche Entdeckung« von Bestsellerautor Gary Braver jetzt als eBook bei dotbooks. Als der Biochemiker Christopher Bacon im Dschungel Papua-Neuguineas auf eine mysteriöse Pflanze stößt, weiß er sofort, dass es sich um die größte Entdeckung des Jahrhunderts handelt – denn die Tabukari-Blume hat die Kraft, den Alterungsprozess aufzuhalten. Voller Begeisterung forscht der Wissenschaftler an einem Elixier, das ewiges Leben verleihen soll – doch die Nebenwirkungen bleiben immer zu riskant. Als Quentin Cross, der skrupellose Chef des Pharma-Konzerns Darby Pharmaceuticals, Wind von Christophers Arbeit bekommt, setzt er alles daran, Profit aus dem »Wundermittel« zu schlagen. Um die Welt vor der Gefahr seiner unvollendeten Formel zu beschützen, taucht Christopher unter. Eine gefährliche Jagd beginnt, deren Ausgang über das Schicksal der Menschheit entscheiden wird … »Gary Braver hat nicht nur einen atemberaubenden Thriller geschrieben, er führt die Leser auch in die moralischen Abgründe der Biotechnologie.« Bestsellerautorin Tess Gerritsen Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der packende Thriller »Eternal – Gefährliche Entdeckung« von Gary Braver wird alle Fans von Frank Schätzing und Preston & Child begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 639
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Als der Biochemiker Christopher Bacon im Dschungel Papua-Neuguineas auf eine mysteriöse Pflanze stößt, weiß er sofort, dass es sich um die größte Entdeckung des Jahrhunderts handelt – denn die Tabukari-Blume hat die Kraft, den Alterungsprozess aufzuhalten. Voller Begeisterung forscht der Wissenschaftler an einem Elixier, das ewiges Leben verleihen soll – doch die Nebenwirkungen bleiben immer zu riskant. Als Quentin Cross, der skrupellose Chef des Pharma-Konzerns Darby Pharmaceuticals, Wind von Christophers Arbeit bekommt, setzt er alles daran, Profit aus dem »Wundermittel« zu schlagen. Um die Welt vor der Gefahr seiner unvollendeten Formel zu beschützen, taucht Christopher unter. Eine gefährliche Jagd beginnt, deren Ausgang über das Schicksal der Menschheit entscheiden wird …
Über den Autor:
Gary Braver ist das Pseudonym des amerikanischen Autors Gary Goshgarian. Nach seinem Schulabschluss studierte er Physik und machte schließlich seinen Doktor in englischer Literatur. Während seiner Arbeit als Dozent begann Braver schließlich mit dem Schreiben seiner Spannungsromane, die in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet wurden. Zusammen mit der Bestsellerautorin Tess Gerritsen schrieb er den erfolgreichen Thriller »Die Studentin«.
Die Website des Autors: garybraver.com/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autorseine packenden Wissenschaftsthriller »Eternal – Gefährliche Entdeckung und »Flashback – Tödliche Erinnerung«, sowie den Psychothriller »Skin Deep – Das Gesicht des Todes«.
***
eBook-Neuausgabe Dezember 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2000 unter dem Originaltitel »Elixir« bei Forge, Tom Doherty Associates, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Das Elixier« bei Goldmann, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2000 by Gary Goshgarian
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2001 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/seabreezesky, Kitsana 1980
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-889-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Eternal« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Gary Braver
Eternal – Gefährliche Entdeckung
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Carmen Jakobs und Thomas Müller-Jakobs
dotbooks.
Und so reifen und reifen wir von Stunde zu Stunde, und dann verrotten und verrotten wir von Stunde zu Stunde, und daran hängt unsere ganze Geschichte.
WILLIAM SHAKESPEARE, WIEES EUCHGEFÄLLT.
Prolog
IM REGENWALDVON PAPUA-NEUGUINEA
Oktober 1980
Es gibt keine angenehme Art zu sterben. Doch dies hier war sicher eine der schlimmsten.
Christopher Bacon richtete seine Pistole auf eine Stelle im Busch, war sich jedoch nicht sicher, ob dort tatsächlich jemand war oder ob er sich das nur einbildete. Was Iwati den »Buschwahn« nannte – wenn die grüne Wand sich immer dichter um einen schloss und Schatten lebendig wurden und sich bewegten wie Tiere auf der Jagd. Wenn das Summen der Moskitos bis ins Innerste des Gehirns drang und sich zur Erschöpfung Klaustrophobie gesellte. Und irgendeine verdammte Juju-Blume die Luft mit ihrem erstickenden Gestank erfüllte.
Doch Chris spürte Bewegung – ein Rascheln hinter diesem schwarzen Vorhang aus Ranken und Ästen, ein kaum wahrnehmbares Wispern. Er konnte in der Dunkelheit nichts erkennen, nur Schatten vor dem Licht des Feuers. Und das einzige Geräusch war das Schnarchen der Insekten und Baumfrösche – als ob gleich etwas passieren würde.
Der Regen hatte aufgehört, doch die Luft war so schwül, dass er am ganzen Körper klitschnass war; sein Hemd klebte ihm auf der Brust, seine dreckverkrustete Hose scheuerte an den Beinen, seine Zehen fühlten sich in den Stiefeln klebrig an. So nass, wie er in den vergangenen zwei Wochen ständig gewesen war, selbst wenn es gerade nicht regnete. So nass, dass sich sein Gesicht wie Gelee anfühlte und seine Fußsohlen mit toter, weißer Haut bedeckt waren, die er mit den Fingernägeln abschälen konnte. Der Boden bestand aus verrottendem Schlamm. Und alles tropfte. Der Regenwald tropfte immer. Ein unablässiges grünes Tropfen, das in seinem Kopf widerhallte.
Vielleicht hatte Iwati Recht: Dreizehn Nächte hatten ihn zerrüttet, hatten ihn auf ein Bündel bloßliegender Nerven reduziert, die aus dem kleinsten Geräusch Hirngespinste fabrizierten.
Vielleicht.
Doch all seine Instinkte sagten ihm, dass er nicht allein war, dass er beobachtet wurde, dass unmittelbar hinter diesen Ranken ein hungriger Schatten lauerte, der jede Sekunde ins Licht hervorbrechen und ihm die Eingeweide herausreißen würde.
Seit zwei Tagen hatte Chris das Gefühl gehabt, dass sie verfolgt wurden. Seit Iwati ihn und die fünf Träger in diese entlegene Gegend am Sepikfluss jenseits der Grenze zu Westirian geführt hatte – eine Tabuzone, vor der selbst der Wanebi-Stamm sie gewarnt hatte. Doch Iwati hatte trotz der Proteste seiner Träger auf diesem Abstecher bestanden. Also hatten sie sich einen Weg durch den dichten Dschungel gehackt bis zu diesem See im Schatten des vor Jahrhunderten erloschenen Omafeki-Vulkans – und das alles für diese Juju-Blume, die nach Äpfeln und verwesendem Fleisch stank. Und seitdem waren sie ständig auf der Hut gewesen, waren bei jedem ungewöhnlichen Geräusch zusammengeschreckt, sicher, dass es von den Okamolu kam, jenem zurückgezogenen Hochlandstamm, der mit Speeren und Pfeilen und einem heftigen Verlangen nach dem Fleisch des »langen Schweins« Jagd auf Eindringlinge machte.
Doch Iwati blieb unerschütterlich. Er zog an seiner Pfeife und sagte, es seien nur Baumkängurus oder Buschratten. »Kein Grund zur Sorge, mein Freund. Hier ist sonst niemand.« Chris tröstete sich mit dem Gedanken, dass sein alter Schulfreund ein Schamane des Tifalmin-Stammes war und sich in dieser Gegend auskannte. Baumkängurus, sagte sich Chris nun – und eine lebhafte Fantasie.
Und wo zum Teufel steckte Iwati? Während Chris ein Feuer anfachte, hatte Iwati seine Männer zu einer Lichtung geführt, um dort das Lager aufzuschlagen. Doch das war nur ein Stück weit den Pfad hinunter. Und er war jetzt seit mehr als einer halben Stunde verschwunden.
Chris kauerte sich hinter einen umgestürzten Baum, umklammerte die Pistole mit beiden Händen und machte sich bereit zu schießen. Hinter ihm glühte der Vulkan im feurigen Licht des Sonnenuntergangs. In Kürze würde die Nacht anbrechen.
»Iwati!«
Keine Antwort, aber Chris’ Stimme hatte den Busch wie ein Gewehrschuss durchdrungen, und die aufgeschreckten Tiere brachen in lautes Schnattern aus.
Unsichtbare Wesen mit Flügeln fraßen ihn bei lebendigem Leib auf. Seine Augen, Ohren und Lippen waren geschwollen, und winzige, bohrende Käfer waren in seine Schuhe eingedrungen und füllten seine Füße mit Gift. Tagsüber hatte er sich mit einem Mittel eingeschmiert, das Iwati aus Justicawurzel und Schweinefett zusammengebraut hatte. Doch es war längst von seinem Gesicht gewaschen worden, und das Zeug befand sich jetzt in Iwatis Tasche. Im Busch von Papua-Neuguinea waren Dutzende von Tieren in der Lage, einen Mann zu töten – von den Giftnattern über Wildschweine bis hin zu sechs Meter langen Krokodilen. Doch es waren die verfluchten Insekten, die ihn in den Wahnsinn trieben. Unsichtbare Wesen, die sein Fleisch und Blut fraßen. Und dazu dieser modrig-süße Gestank, der ihm die Kehle zuschnürte.
Plötzlich kam ihm ein furchtbarer Gedanke: Und wenn die Okamolus Iwati getötet hatten? Ein plötzlicher Pfeilregen, und Iwati und seine Männer wären tot, geräuschlos.
Oder vielleicht hatten die Träger gemeutert? Sie waren nervös gewesen, seit sie Wanebabi verlassen hatten. Was wäre, wenn sie Iwati ein Messer in den Rücken gejagt hatten und über den Fluss geflohen waren? Warum nicht? Die Okamolu waren für ihre Grausamkeit berüchtigt.
Chris fiel die Geschichte von einer japanischen Patrouille ein, die sich während des Krieges einen Weg hier heraus freigeschlagen hatte, um die Einheimischen dazu zu bringen, eine Landebahn zu bauen. Plötzlich waren sie von Okamolu-Kriegern umringt gewesen. Die Japaner mit ihren automatischen Gewehren sahen sich einer Übermacht an Speeren gegenüber, und nach einem spannungsgeladenen Zögern hatte der japanische Kommandant als Friedensgeste sein Gewehr fallen lassen. Der Anführer der Okamolu folgte seinem Beispiel und stieß seinen Speer in die Erde. Die Krise, so schien es, war vorüber. In der folgenden Nacht jedoch war acht der neun Männer im Schlaf die Kehle durchgeschnitten worden, und sie endeten am nächsten Tag mit Yams und anderen Wurzeln über Mumufeuern ohne Kopf wie Schweine. Das Letzte, woran sich der einzige Überlebende erinnern konnte, waren Kinder, die an einem verkohlten Bein nagten.
»Iwati!«
Chris presste sich gegen den Baum. Er war sich sicher, dass er bei Morgengrauen von Malaria geschüttelt werden würde, falls er die Nacht überleben sollte. Bastarde! Er wünschte, sie würden den Bann brechen und die Sache hinter sich bringen. Er hatte die Pistole für Krokodile mitgebracht, nicht für einen Schusswechsel mit Kannibalen. Selbst wenn er sich den Weg freischießen könnte, würde er es nie allein bis zum Fluss schaffen. Er würde sich entweder verirren oder in Treibsand geraten.
Dann geschah es. Der Vorhang aus Lianen teilte sich langsam.
Chris’ Finger zitterte am Abzug. Jemand kam auf ihn zu. Das war kein Lichtreflex. Kein Insulintief. Keine Halluzination. Die Lianen wurden beiseite geschoben. Der Angriff stand unmittelbar bevor. Showdown.
Im letzten Augenblick war Chris Bacon von dem Bild erfüllt, wie Wendy ihren neugeborenen Sohn Ricky in den Armen wiegte. Und von dem Gedanken: Dies ist mein Tod.
Er hatte vor 13 Tagen begonnen. Sie waren vom Dorf der Tifalmin aufgebrochen, um Pflanzenproben zu sammeln, die Chris mit in die Vereinigten Staaten nehmen wollte. Chris arbeitete als Biochemiker für Darby Pharmaceuticals, ein Laboratorium in Boston, das auf dem Gebiet der synthetischen Herstellung und Weiterentwicklung aller Heilmittel verschiedener Kulturen Vorreiter war. Seit der Entdeckung, dass Alkaloide von Catharantus roseus Hodgkin-Tumore zu schrumpfen vermochten, lieferte sich Darby ein Wettrennen mit anderen Pharmafirmen, überzeugt, dass noch andere Wunderdrogen auf Bäumen wuchsen. Chris war insbesondere damit beschäftigt, pflanzliche Steroide in tierische Steroide umzuwandeln und auf ihre mögliche empfängnisverhütende Wirkung zu testen. Darbys Ziel war es, die erste Pille für den Mann zu entwickeln. Dies wäre ein bahnbrechender Erfolg, der die Aktien des Unternehmens in den Himmel schießen lassen würde.
Chris Bacon war als Forschungsleiter der Hoffnungsträger von Darby, nicht zuletzt deshalb, weil er im Busch von Papua-Neuguinea aufgewachsen war. Sein Vater war in den späten 50er-Jahren amerikanischer Botschafter in Australien gewesen, und Chris hatte die Königliche Knabenakademie in Port Moresby besucht, wo er im Alter von 14 Jahren Iwati kennen gelernt hatte, einen der wenigen einheimischen Jungen aus der Hochebene, die die Schule besuchten. Iwatis Dorf hatte 1943 den amerikanisch-australischen Streitkräften geholfen, eine Landebahn in der Nähe des Dorfes der Tifalmin zu bauen. Das verschaffte den Alliierten einen Stützpunkt im Landesinneren und Zugang zum Chinconabaum, aus dessen Rinde Chinin hergestellt wurde, das wirkungsvollste Mittel gegen Malaria. Es war der erste Kontakt der Tifalmin zu Männern mit weißer Haut und mit Stahl – ein Kontakt, der dazu führte, dass Iwati mit der englischen Sprache aufwuchs. Und weil er intelligent war, finanzierten australische Missionare seine Ausbildung. Iwati war Diabetiker, wie Chris, und sie begegneten sich regelmäßig in der Krankenstation der Schule, wo ihr Blutzuckerspiegel gemessen und ihnen Insulin verabreicht wurde. Im Laufe der vier Jahre wurden Chris und Iwati Freunde – und ihre Freundschaft wurde auf ewig zementiert, als Chris Iwati in ihrem letzten Sommer das Leben rettete. Obwohl der Junge am Ufer des Sepikflusses aufgewachsen war, hatte er ironischerweise nie schwimmen gelernt, eine Tatsache, die Chris entdeckte, als ein anderer Junge Iwati am tiefen Ende ins Schwimmbecken stieß. Iwati ging unter wie ein Stein und wäre ertrunken, wenn Chris nicht gewesen wäre.
Wie schon sein Vater vor ihm, so war auch Iwati der Medizinmann der Tifalmin. Trotz all seines Juju-Schmucks und des ganzen Hokuspokus war er jedoch stark westlich geprägt. Er trug Bermudashorts, ein Harvard T-Shirt und die neue Bulova-Uhr, die Chris ihm mitgebracht hatte, wohingegen seine Männer nur im Lendenschurz durch den Busch marschierten. Wie sein Vater besaß Iwati die Gabe, zu erkennen, welche Pflanzen Heilkräfte besaßen und welche töteten, eine Gabe, die Chris um den halben Globus hatte reisen lassen. Iwati kannte eine Pflanze gegen jede Krankheit – Fieber, Zahnschmerzen, Magengeschwüre, Schlangenbisse, Wunden, Malaria, Syphilis. Und darin lag die Zukunft der Medizin der westlichen Welt.
Zum dritten Mal in zwei Jahren hatte Darby Chris auf Reisen geschickt. Doch diesmal war es ihm gelungen, Geld bei der Firma locker zu machen, um im Dorf der Tifalmin eine Schule zu bauen. Eine langfristige Investition in den Schamanenzauber. Und jetzt sollte das alles durch Speere und Pfeile enden.
Chris hob die Waffe und hielt den Atem an.
Keine Lichttäuschung. Keine paranoide Wahnvorstellung. Ein Mensch nahm in den dichten Schatten der Äste Gestalt an.
»Komm raus, du Dreckskerl!«, rief Chris.
Die Gestalt hielt inne, und für einen Augenblick wurde der Dschungel zum Stillleben.
Als die Gestalt plötzlich auf Chris zustürzte, durchbrachen grelle Schreie aus allen Richtungen die Stille. Reflexartig schoss er und hörte nicht auf, bis alle sechs Kammern des Colts leer waren und er klickend auf einen nackten Körper mit gefesselten Füßen abdrückte, der in der Luft hin und her schwang.
An den Opfermalen auf den Schultern erkannte er Maku, einen der Träger. Seine Brust war von den Kugeln aufgerissen worden, doch er war bereits tot gewesen. Er hatte keinen Kopf mehr.
Entsetzt beobachtete Chris, wie der Leichnam hin und her pendelte, bis er wenige Meter vor ihm zur Ruhe kam. Er riss Patronen aus seinem Gürtel, um nachzuladen, als plötzlich ein Dutzend Okamolu-Krieger aus den Schatten auftauchten, einen Kreis um ihn bildeten und ihre Speere drohend in der Luft schwenkten. Ehe Chris nachladen konnte, trat ein kleiner, runzliger Mann auf ihn zu. Er war nackt wie die anderen, trug aber eine lange weiße Feder durch die Nase, ein Halsband mit einem Halbmond und einen Kopfschmuck aus Federn. Sein Gesicht war mit weißen Streifen bemalt. Der Juju-Mann.
In seiner Hand hielt er einen Speer mit Makus Kopf, von dem noch das Blut troff. Er trat näher an Chris heran und plapperte in einer Sprache auf ihn ein, die Chris nicht kannte. Er versuchte sich darauf zu konzentrieren, Kugeln in die Kammern zu laden, doch der Juju-Mann stieß ihm Makus Kopf ins Gesicht. Eine Wolke aus schwarzen Fliegen umschwirrte ihn. Chris konnte das Blut riechen. Dunkle, warme Flüssigkeiten tropften auf seine Schuhe, und er musste würgen.
Der Juju-Mann hatte wilde Augen, und sein Mund war leuchtend rot von den Betelnüssen, die er kaute. Alle paar Sekunden spuckte er dicke rote Klumpen aus, als habe er den Kopf mit seinen eigenen Zähnen abgerissen. Mit seiner freien Hand berührte er Chris’ Gesicht und Arme, als wolle er überprüfen, ob seine Hautfarbe echt sei. Er schrie etwas, und seine Männer antworteten ihm im Chor. Einer von ihnen rief etwas Zorniges, und die anderen stimmten zu. Es klang wie ein Todesurteil. Sogleich begannen sie zu singen und wieder ihre Speere durch die Luft zu schwingen. Als der alte Mann zurücktrat, um das Ziel freizugeben, ließ ein durchdringendes Heulen die Speere in der Luft erstarren.
Aus dem Busch trat ein großer Mann, der einen Rock aus Laplap-Gras und einen kunstvollen Kopfschmuck aus den Federn des Paradiesvogels trug. Er wirkte besonders furchterregend, weil sein Gesicht mit leuchtend gelber Farbe bemalt und seine Augen rot umrandet waren. An Stelle der Muschelkette des Schamanen trug er eine Schnur mit Krokodilszähnen, an der ein geschrumpfter menschlicher Kopf baumelte, um den Hals.
In perfektem Englisch sagte er: »Sie werden dir nichts tun.«
Iwati.
Er trat an Chris vorbei zu dem Juju-Mann und sagte etwas mit klarer, ruhiger Stimme. Chris verstand kein Wort, doch die Wirkung war sofort erkennbar. Der alte Mann murmelte etwas, und die Krieger ließen ihre Waffen sinken. Dann senkten sie zu Chris’ ungläubigem Staunen demütig die Köpfe.
Chris lud rasch seine Pistole. »Die wirst du nicht brauchen«, versicherte Iwati.
»Mein Gott, Mann, schau dir an, was sie getan haben.« Makus Rumpf baumelte wenige Meter von ihnen entfernt; aus dem Stumpf seines Halses rann noch immer Blut.
Iwati nickte. »Sie werden dir nichts tun.«
Es war nicht nur Iwatis Auftreten, das Chris zurückhielt. Es war die Reaktion der Okamolu.
Sie ähnelten jetzt mehr einem Haufen verängstigter Schuljungen als berüchtigten Kannibalen.
»Wie kommt es, dass sie solche Angst haben? Sie haben doch schon öfter weiße Männer gesehen?«
Iwati antwortete nicht.
»Was wollen sie?«
»Sie sind nur neugierig.« Dann sagte Iwati etwas in der Stammessprache.
Der Juju-Mann murmelte seinen Männern etwas zu. Er schickte sie weg, und sie schienen dankbar zu sein, dass sie gehen durften. Sie drehten sich um und zogen sich auf dem gleichen Wege in das dunkle Unterholz zurück, auf dem sie gekommen waren. Bevor sie verschwanden, blickte jeder von ihnen noch einmal zurück. Und Chris hätte schwören können, dass das, was er in ihren Gesichtern sah, nackte Angst war.
Sie begruben Makus sterbliche Überreste auf einer Lichtung und entzündeten ein Feuer auf dem Grab, um Aasfresser fern zu halten. Die Träger blieben im Lager zurück, und Iwati führte Chris zum See. Das Wasser sah aus wie schwarzes Glas. Der Kegel des urzeitlichen Omafeki zeichnete sich als Silhouette im letzten Tageslicht ab. Eine erfrischende Brise war aufgekommen und hatte die Ekel erregende Süße davongeweht. Unter ein paar Palmwedeln zog Iwati einen kleinen Einbaum hervor.
»Wohin fahren wir?«
Iwati deutete über das Wasser. Im schwachen Licht konnte Chris eine kleine Insel erkennen, die ein paar Hundert Meter vom Ufer entfernt war. »Was ist dort draußen?«, fragte er. Iwati antwortete nicht.
Chris hockte vorn im Kanu, während Iwati im Mondlicht auf die Insel zupaddelte. Je näher sie kamen, desto stärker wurde der eklige Geruch. Sie legten an einer schmalen Lichtung an, die von mit Kletterpflanzen überwucherten Bäumen umringt war. Chris wollte aussteigen, doch Iwati hielt ihn zurück. Aus seiner Tasche zog er ein totes Baumkänguru und schleuderte es in Richtung Ufer. Im Mondlicht sah Chris, wie es auf eine Stelle zusegelte, an der besonders viele Blüten hingen. Einen Bruchteil einer Sekunde, bevor es zu Boden fiel, brach etwas Riesiges aus dem Dunkel hervor und schnappte es. Ein gewaltiges Um-sich-Schlagen und das Aufblitzen eines Bauches, dann verschwand es wieder in der Schwärze. Ein riesiges Krokodil.
»Es wartet auf Vögel«, erklärte Iwati.
Das Reptil tauchte ein Stück weit entfernt noch einmal auf. Sein Schwanz zeichnete eine Schlangenlinie im Mondlicht, als es sich entfernte wie ein frühzeitlicher Wächter, der seinen Tribut kassiert hat.
Sie gingen an Land, und wenig später saßen sie auf einer Klippe über dem Wasser vor einem Feuer. Iwati warf ein Bündel Baumstöcke in die Flammen, um die Moskitos fern zu halten. Er trug einen Breiumschlag aus Piperblättern und den Früchten des Mammeabaumes auf Chris’ Gesicht auf, um die Schwellungen und den Juckreiz zu lindern. Dann lehnte er sich zurück und zog an seiner alten Bruyèrepfeife. Er wirkte seltsam in sich gekehrt – wahrscheinlich von dem Zeug, das er rauchte, mutmaßte Chris.
Die Bootsfahrt hatte Chris beruhigt, doch er fragte sich immer noch, warum sie hier herausgerudert waren. Iwati hatte seinen Kopfschmuck abgelegt, nicht aber den Schrumpfkopf um seinen Hals. Das Ding war abstoßend, schlimmer als ein frisch abgeschlagener Kopf. Es war die obszöne Parodie einer kunstvollen Maske. Iwati hatte ihm geschworen, dass sein Volk den Kannibalismus und die Kopfjagd seit langem aufgegeben hatte, dass nur noch ein paar zurückgezogene Stämme wie die Okamolu dieser Praxis anhingen, weil sie glaubten, die Lebenskräfte ihres Feindes in sich aufzunehmen, wenn sie sein Fleisch verzehrten.
Chris betrachtete den Talisman und dachte, wie wenig er doch über Iwati wusste. Ja, sie waren in ihrer Kindheit Freunde gewesen, doch 20 Dschungeljahre hatten sie voneinander entfernt. Iwati hätte Arzt in Port Moresby oder Sydney werden können, wenn er seine Ausbildung fortgesetzt hätte, stattdessen hatte er sich dafür entschieden, in die Steinzeit zurückzukehren, zu dem Lebensstil seiner Vorfahren mit ihren Grasröcken und Schrumpfköpfen, als sei die Zeit stehen geblieben. Statt einen Arztkittel und ein Stethoskop zu tragen und Penicillin zu verabreichen, heilte er mit gemahlenen Käfern und Pflanzensalben. Nein, es trennten sie weit mehr als zwei Jahrzehnte: Jahrtausende. Im Geiste sah Chris Iwati vor sich, wie er sich über diesen Kopf beugte, ihm sorgfältig die Augen ausstach und Hirnmasse aus den Augenhöhlen kratzte, die Schädel- und Kieferknochen zertrümmerte und stückweise entfernte, die Augenlider und den Mund mit Kängurudarm zunähte, wie er die Haut mit Schweinefett einbalsamierte und den Hautsack mit heißem Sand füllte, bis er zu diesem obszönen kleinen Affengesicht mit dem glänzenden Haar getrocknet, geschrumpft und gedunkelt war, das wie ein Orden um den Hals getragen wurde.
»Iwati, was ist da vorhin geschehen? Diese Männer hatten Angst, und ich glaube, du weißt warum.«
Iwati paffte, ohne zu antworten. Er erklärte auch sein Schamanengewand nicht, das, wie Chris wusste, für Dorfrituale und Stammestreffen vorbehalten war. Trotzdem hatte Iwati es auf diese Expedition mitgenommen.
»Ich habe dich etwas gefragt«, beharrte Chris. »Du hast mir das Leben gerettet, aber ich verstehe nicht, wie.«
Nichts.
»Dann sag mir, warum in Gottes Namen du mich den ganzen Weg hier rausgeschleppt hast, Mann. Ich muss das Land in fünf Tagen verlassen, und wir werden allein zwei Tage brauchen, um den Fluss zu erreichen, und noch mal zwei, um an die Küste zu kommen.« Und dann würden weitere vier Tage Flüge mit häufigem Umsteigen folgen, bevor er wieder in der sauberen, gut beleuchteten Welt von Boston sein würde. »Und wenn wir schon einmal dabei sind, warum zum Teufel sind wir hier draußen und nicht im Lager? Und überhaupt, was ist das für ein Gestank hier?«
Iwati zündete seine Pfeife am Feuer neu an. »Ja.«
»Ja was?«
»Ja, ich werde es dir erklären. Aber du musst versprechen, es niemandem weiterzuerzählen, mein Freund.« Iwati sprach mit gesenkter Stimme, obwohl seine Männer außer Hörweite im Lager am anderen Ufer waren und keiner von ihnen Englisch verstand.
»Okay.«
»Schwöre bei deiner Seele.«
Chris musste über dieses alberne alte Schuljungenritual lächeln, doch Iwati war es todernst. »Ich schwöre bei meiner Seele.«
»Schwöre bei der Seele deiner Großmutter.«
»Ich schwöre bei der Seele meiner Großmutter.«
»Schwöre bei der Seele der Queen.«
»Ich schwöre bei der Seele der Queen.«
»Schwöre bei der Seele von Jesus.«
»Um Himmels willen, Mann, hör endlich auf mit dem Spielchen.«
»Schwöre es!« Iwatis Augen schauten ihn eindringlich an.
»Okay, ich schwöre bei der Seele von Jesus.«
Iwati hatte die Reihenfolge nicht vergessen, den Eid, den sie als Kinder geschworen hatten, wenn sie heimlich Zigaretten rauchten. Doch nichts in Iwatis Gesicht deutete darauf hin, dass er ein Spiel spielte.
Als er schließlich zufrieden war, sagte er nur ein einziges Wort: »Tabukari.«
»Tabu wie?«
»Tabukari.«
Iwati ging zu dem Baum hinüber, der unten am Ufer wuchs und bis zu ihnen heraufreichte. Wie Pythons hingen dicke Ranken an ihm, die voller kleiner weißer Blüten waren – die Quelle des ekligen, süßen Gestanks. Er schnitt ein Stück der Ranke ab und reichte es Chris. »Tabukari. Eine besondere Blume.«
Im Feuerschein waren die Blütenblätter dick und weiß; ihr Inneres mündete in einen blutroten Fleck. Es war eine Art Orchidee, jedoch anders als alle, die Chris bisher gesehen hatte. Die fleischigen Blütenblätter und der rote Fleck verliehen ihr etwas Sinnliches, fast Animalisches. Doch am ungewöhnlichsten war der Geruch. Aus einiger Entfernung war es ein fruchtiger Duft, doch von Nahem machte die Süße einer Übelkeit erregenden Schärfe Platz; Äpfel und darunter der Gestank von verwesendem Fleisch. Das, was Eva Adam gegeben hatte, würde Chris sich später sagen.
»Der Geruch lockt Insekten an«, erklärte Iwati. »Und die Insekten Wasservögel.«
»Was das Krokodil erklärt.«
»Ja. Sie kommen wegen der Vögel. Dies ist die einzige Stelle im ganzen Dschungel, wo Tabukari wächst.«
Chris war kein Botaniker, doch er war sich sicher, dass die Einzigartigkeit dieser Pflanze mit den örtlichen Gegebenheiten zusammenhing: Die Vulkanasche im Erdreich, der See mit seinen Mineralien, die nebelige Hochlage und natürlich der Regenwald. »Was ist daran so besonders?«
Zum ersten Mal an diesem Abend lächelte Iwati. »Alles.« Doch er führte dies nicht weiter aus.
»Wie verwendest du sie?«
Iwati blies eine Rauchwolke zu ihm herüber. Er hatte die Blüten die ganze Zeit über geraucht. »Manchmal mache ich Tee daraus. Manchmal mische ich sie unter Yamspüree. Aber das ist nur für den Medizinmann. Möchtest du mal probieren?«
»Nein.«
Ein viertägiger Umweg durch den Urwald voller Moskitos, Kannibalen und Monsterkrokodile. Nur um Iwatis privaten Drogengarten zu besuchen. Chris war müde, schmutzig und konnte es kaum erwarten, zum Lager zurückzufahren und sich auf seiner Matte zusammenzurollen. Er konnte es nicht erwarten, nach Boston zurückzukehren, wo die Luft kühl und trocken war, wo er ein gutes Steak essen und ein langes, heißes Bad nehmen konnte, ohne sich Gedanken wegen Blutegeln oder Krokodilen machen zu müssen. Wo er endlich wieder richtig trocken werden konnte. Wo er sich an Wendy und Ricky kuscheln konnte und keine Tausendfüßler abwehren musste. Iwati hatte ihn im Stich gelassen.
»Der Name bedeutet ›die verbotene Blüte des langen Tages‹.«
In Chris’ Ohren klang das albern, doch das sprach er nicht aus. »Und ich vermute, sie verschafft einem ein gutes Gefühl.«
»Ja.«
»Naja, das tut Scotch auch – und dafür braucht man sich nicht einen Weg durch den halben verdammten Urwald zu schlagen.«
»Nein, nein, so nicht.« Dann fügte er hinzu: »Sie ist gefährlich. Sie macht sehr abhängig.«
Vermutlich eine hiesige Art des Kokabusches, mutmaßte Chris. »Ich verstehe.«
»Nein, du verstehst nicht. Sie macht die Seele süchtig.« Er klopfte sich auf die Brust. »Sie ist gefährlicher als all deine Pülverchen. Deshalb heißt sie tabu.« Iwati hielt den Blütenzweig hoch und flüsterte: »Niemals alt werden.«
»Wie bitte?«
»Niemals alt werden.«
Für eine Weile hingen seine Worte in der Luft. Über den Kreis glühender Asche hinweg starrte Chris Iwati an, dessen Augen umschattet waren und wie Höhlen in seinem Schädel aussahen.
»Ich verstehe nicht.«
Iwati nickte. Wieder Schweigen.
Doch der Boden unter ihnen schien leicht zu beben, als sei ein Schauder der Erkenntnis durch die Erde gelaufen. »Du willst damit sagen, dass diese Blume ... das Leben verlängert?«
»Ja.«
»Wie lange?«
»Sehr lange.«
»Und was hat sie für dich getan?«
Er lächelte. »Ich bin immer noch hier.«
Sein Grinsen entblößte Zähne, die vom jahrelangen Rauchen des Zeugs braun geworden waren. Doch wie viele Jahre? Vor 20 Jahren in der Schule war Chris 16 gewesen, und er hatte angenommen, dass Iwati ungefähr im gleichen Alter war. In der Zwischenzeit hatte er sich nicht sehr verändert, doch bei den Papuanern war das schwer zu sagen. Ihre Haut war fettig, und sie schmierten sich zum Schutz vor der Sonne und vor Insekten mit Pflanzensalben und Schlamm ein. Schlank wie er war, könnte Iwati als Teenager durchgehen.
»Also, wie alt bist du?«
Iwati schüttelte den Kopf.
»Das willst du mir auch nicht verraten?«
»Ich weiß nicht, wie alt ich bin.«
Urwaldbewohner lebten nach der Bewegung der Sonne; sie zählten die Jahre. Außerdem liebte Iwati Uhren. »Wie kannst du nicht wissen, wie alt du bist, Mann?«
»Ich wurde geboren, bevor die Missionare kamen.«
Das konnte hinkommen. »Die Missionare vom Roten Kreuz waren während des Krieges hier.« Das würde bedeuten, dass Iwati irgendwann Anfang der vierziger Jahre geboren worden war.
»Nicht die Missionare vom Roten Kreuz«, korrigierte Iwati ihn. »Die Maristen.«
Chris lief es eiskalt den Rücken hinunter. »Die Maristen? Das war 1857.«
»Ja.«
»Aber das ist unmöglich! Dann wärest du mindestens ... hundertdreiundzwanzig Jahre alt.« Er fing an zu lachen, doch Iwatis eindringlicher Blick ließ ihn verstummen. »Das ist unmöglich. Du kannst nicht älter als vierzig sein.«
Iwati lächelte nachsichtig. »Ich bin aber älter. Viel, viel älter.«
»Du kannst nicht so alt sein, Iwati. Das lässt unsere Biologie nicht zu.«
»Deine Biologie.«
»Iwati, das ist doch lächerlich.« Er wollte sagen, dass Iwati nur versuchte, ihm Angst einzujagen, dass sie vier Jahre lang in derselben rationalen Welt der Wissenschaft gelebt hatten –, doch das schien plötzlich so weit entfernt. Und Iwati ebenfalls.
»Ich war fünfzehn, als ich von meinem Vater gelernt habe, welche Kraft Tabukari hat.«
»Und wann wurde er geboren?«
»Das weiß niemand. Irgendwann vor der Kontaktaufnahme.«
»Vor der Kontaktaufnahme? Mein Gott, Mann, hältst du mich für einen kompletten Idioten? Du redest vom 17. Jahrhundert.«
Iwati nickte.
»Und was ist aus ihm geworden?«
»Die Portugiesen haben ihn umgebracht. Die Expedition unter Antonio d’Orbo.«
Antonio d’Orbo war der erste weiße Mann gewesen, der den Sepik hinaufgefahren war, Mitte des 19. Jahrhunderts, erinnerte sich Chris. Nur eine Hand voll seiner Männer war zurückgekehrt.
»Du glaubst mir nicht«, stellte Iwati fest.
»Ehrlich gesagt, nicht ein Wort.«
Iwati starrte ihn einen Augenblick lang an, dachte über irgendetwas nach. Dann nahm er den Schrumpfkopf von seinem Hals und streckte ihn Chris entgegen. »Schau. Schau ihn dir an.«
So abstoßend er auch war, Chris betrachtete den Schädel im Feuerschein. Das Gesicht war klein und verschrumpelt, die Haut wie dunkles Leder, Lippen und Augenlider waren zugenäht. Chris hatte in Museen schon mehrere solche Köpfe gesehen, doch dieser hier war irgendwie anders. Einen Augenblick lang konnte er nicht einordnen, was es war. Dann fiel es ihm auf: die Haare. Anders als bei den anderen waren sie nicht schwarz, sondern hellbraun, und nicht kraus, sondern glatt. Der Kopf hatte einem Weißen gehört. Iwati hob den Zopf an und legte ein Ohr frei. Es sah aus wie eine schwarze Aprikose, nur war das Ohrläppchen mit Metall durchstochen, an dem eine Goldmünze hing. Die Inschrift darauf war ein wenig abgeschliffen, doch Chris konnte römische Buchstaben ausmachen – die Worte Anno Dei und arabische Zahlen.
»Da steht 1866«, sagte Chris. »Was beweist das?«
»Das ist er.«
»Wer?«
»Antonio d’Orbo.«
»Iwati, was zum Teufel redest du da?« Iwati antwortete nicht. Starrte ihn nur an. »Willst du damit sagen, dass du Antonio d’Orbo umgebracht und seinen Kopf geschrumpft hast?«
»Er hat meinen Vater getötet.«
Chris hob die Hände und schüttelte den Kopf. »Tut mir Leid, mein Freund, aber ich glaube dir nicht. Kein Wort.« Er stand auf und wollte gehen. »Danke für die Gutenachtgeschichte, aber jetzt würde ich mich gern schlafen legen.«
Iwati erhob sich. »Christopher, hör mir zu. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre es.« Iwati wirkte durch und durch aufrichtig. »Ich bin es dir schuldig, weil du mir das Leben gerettet hast.«
Chris blickte in Iwatis Augen, doch sie waren ohne Arg. Plötzlich schoss Chris das Bild der verängstigten Okamolu-Krieger durch den Kopf. Und das des kleinen Juju-Mannes. Sie glaubten daran.
Sie glaubten daran!
Als seien seine Ohren plötzlich frei geworden, begannen die Dinge, auf seltsame, erschreckende Art und Weise einen Sinn zu ergeben. Es war nicht Chris’ Hautfarbe gewesen, die die Okamolu zu furchtsamen kleinen Jungen hatte werden lassen. Sie hatten schon früher weiße Männer gesehen, vermutlich hatten sie sogar schon einige verzehrt. Auch nicht die Pistole. Es war Iwati gewesen, der sie in Angst und Schrecken versetzt hatte. Iwati! Zuerst waren sie sich nicht sicher gewesen, ob er es war, mit seinem T-Shirt, den Shorts und der Sonnenbrille. Erst als er sein Gesicht bemalt und seinen zeremoniellen Kopfschmuck und den Schrumpfkopf angelegt hatte. Die Zurschaustellung seiner Juju-Identität. Nicht einfach ein Schamane eines anderen Stammes, sondern Iwati mit dem geheimen Tabukari-Zauber. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb die Träger ihn als Gott betrachteten. Der Grund, warum sie ihm zwei Wochen lang sogar ins Tabuland der Kannibalen gefolgt waren. Der Grund, weshalb ihre Köpfe noch auf ihren Schultern saßen und nicht auf Okamolu-Speeren steckten.
In ihren Augen war Iwati unsterblich.
Iwati nickte, als könne er Chris’ Gedanken lesen. Dann zuckte er die Achseln und legte sich den Schrumpfkopf wieder um. »Vielleicht ist es besser so, mein Freund«, sagte er und warf die blütenbesetzte Ranke in die Glut.
Die Flammen loderten auf. Doch bevor sie die weißen Blüten verschlingen konnten, fuhr Chris’ Hand ins Feuer und zog sie heraus.
Erster Teil
3 155 414 400 Sekunden
52 590 240 Minuten
876 504 Stunden
36 521 Tage
5218 Wochen
1200 Monate
400 Jahreszeiten
100 Jahre
1 Leben
LEONARD HAYFLICK
Kapitel 1
APRICOT CAY, KARIBIK
Oktober 1986
Quentin trank einen Schluck Champagner. »Mein höchstes Angebot ist drei Millionen Dollar, Sie können es annehmen oder ablehnen.«
»Abgelehnt«, sagte Antoine Ducharme ohne zu zögern.
Du Drecksack!, dachte Quentin. »Dann haben wir ein Problem.«
»Nein, mein Freund, Sie haben ein Problem. Der Preis beträgt fünf Millionen pro Tonne.«
Quentin Cross, mit 37 Jahren Finanzmanager und künftiger Chef von Darby Pharmaceuticals, saß in unbehaglichem Schweigen auf dem hinteren Deck der Reef Madness, einer langen, schnittigen Jacht, die Antoines Freundin Lisa gerade zwischen den Korallenbänken hindurchsteuerte. Um die Anlegeleine kümmerte sich im Bug Marcel, einer von Antoines Wachleuten, der einen Revolver mit kurzem Lauf und ein Paar Handschellen an seinem Gürtel trug.
Sie befanden sich inmitten des Korallenriffs an der Nordküste von Apricot Cay, einer palmengesäumten Insel 15 Meilen südöstlich von Jamaika, die Antoine Ducharme gehörte, einem eleganten und hochgebildeten Jachtbesitzer, Unternehmer und Drogenhändler. Antoine war seinem Aussehen nach zu schließen Mitte vierzig, groß und kräftig gebaut, mit kurzem, grau meliertem Haar und einem offenen Gesicht, das hinter seiner randlosen Brille wie das eines Gelehrten aussah. Es war ein Gesicht, das daran gewöhnt war, wichtige Entscheidungen zu treffen, und das binnen eines Augenblicks versteinern konnte.
Antoine trug einen grünen Freizeitanzug. Er hatte seine zehn Teilhaber zu einem Abendessen bei Sonnenuntergang eingeladen: Hummerschwänze, sautierte Brotfrucht und französischer Käse, gefolgt, natürlich, von frischen Aprikosen.
Quentin wusste sehr wenig über die anderen Männer, außer dass sie alle zu einer internationalen Gruppe sehr wohlhabender und einflussreicher Männer mit einem Hang zu undurchsichtigen Investitionen und Extravaganzen gehörten. Ihre Verbindung zu Antoine Ducharme ließ vermuten, dass sie keine ethischen Bedenken hegten, sich die Hände schmutzig zu machen. Sie wurden einander nicht vorgestellt. Die Männer aßen an einem anderen Tisch und unterhielten sich beim Essen in Französisch und Deutsch, dann zogen sie sich in die Kabine zurück und sahen sich ein Fußballspiel an, das sie über die Satellitenschüssel auf der Jacht empfangen konnten. Für Quentin waren sie einfach »das Konsortium«.
Bei Quentin und Antoine saß ein etwa 3 5-jähriger Amerikaner. Vince Lucas war Antoines »Finanzoffizier«; schlank und attraktiv, strahlte er etwas Wildes aus. Er hatte glatte, fleischige Lippen, ein gebräuntes, schmales Gesicht und glänzendes schwarzes Haar, das glatt nach hinten gekämmt war, sodass sein in der Stirnmitte spitz zulaufender Haaransatz zu sehen war. Seine Brauen bildeten makellose schwarze Linien, und seine Augen waren so dunkel, dass sie nur aus den Pupillen zu bestehen schienen. Auf seinem Unterarm prangte die Tätowierung eines Raubvogels mit einem Totenschädel. Er sah anders aus als alle Finanzfachleute, denen Quentin je begegnet war.
»Wenn Sie mich fragen, sind fünf Millionen ein Schnäppchen«, sagte Vince Lucas.
»Fünf Millionen Dollar kommen nicht in Frage«, bekräftigte Quentin. Doch er wusste, dass sie ihn im wahrsten Sinne des Wortes an der Kehle hatten.
Lisa räumte die Teller ab. Sie trug einen knappen schwarzen Bikini, ein gelbes Haarband und die Tätowierung einer Rose auf der Schulter. Sie war eine umwerfende, exotische Frau von Anfang zwanzig mit kakaofarbener Haut und tiefen, hemmungslosen Augen. Wenn diese Augen Quentin ansahen, wurde er sich seines großen rosafarbenen Gesichts, seiner schütteren Haare und seines über die Shorts hängenden Bauches schmerzlich bewusst. Als sie mit Abräumen fertig war, gab sie Antoine, der doppelt so alt war wie sie, einen langen, leidenschaftlichen Kuss und ging, gefolgt von Marcel, nach unten, damit die Männer ungestört über ihre Geschäfte reden konnten.
»Hören Sie mir gut zu, mein Freund«, sagte Antoine. »Wir haben hier über achthundert Hektar Regenwald im Hochland, weitere vierhundert Hektar Obstplantagen mit Bergströmen zur Bewässerung, geschützte Häfen, eine eigene Landebahn, Speichergebäude – das ganze Drum und Dran, wie ihr Amerikaner sagt. Und vor allem: völlige Ungestörtheit.«
Quentin hatte all das schon vorher gehört. Er hatte die Insel und den Regenwald besichtigt. Doch es war nicht die biologische Vielfalt, die ihn interessierte. Und auch nicht die Cannabisfelder, die in den Plantagen verborgen waren. Ebenso wenig die getarnten Schuppen, in denen importierte Kokablätter zum raschen Transport nach Norden zu Kokain verarbeitet wurden, ein Unternehmen, das Apricot Cay zum gelobten Land der Drogen in der westlichen Hemisphäre machte.
Was Quentin Cross wollte, waren Aprikosen, und zwar eine bestimmte Sorte, Prunus caribaeus, die es nur in Apricot Cay gab. Und er war bereit, drei Millionen Dollar für eine Tonne davon zu bezahlen.
Nein, Darby Pharmaceuticals wollte seine Produktion nicht auf Früchte ausweiten. Was diese Sorte so einzigartig machte, waren die Kerne: Sie enthielten Zyan-Verbindungen, die hochgiftig auf Krebszellen wirkten. Die Wirkstoffe der Aprikosen hatten bei der Behandlung von mexikanischen Patienten mit bösartigen Tumoren die erstaunliche Erfolgsquote von 80 Prozent erzielt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hatte noch keine klinischen Tests in den Vereinigten Staaten genehmigt, doch nach Quentins Ansicht versprach das Mittel mit dem geplanten Handelsnamen Veratox die erste Krebswunderdroge der Welt zu werden.
Darby Pharms hatte den Wirkstoff hauptsächlich aus zwei Gründen geheim gehalten. Zum einen hatte die FDA das Mittel noch nicht abgesegnet, doch das war kein Problem, da Ross Darby ein alter Studienfreund von Ronald Reagan war. Der zweite Grund hieß Antoine Ducharme. Bei Darby wusste außer Quentin niemand, dass er ein internationaler Drogenbaron war, auch Ross Darby nicht, Quentins Schwiegervater und der derzeitige Chef der Firma, ein Mann von untadeliger Moral. Wenn das herauskäme, würde Darby Pharmaceuticals nicht nur seine Zulassung zur Medikamentenherstellung verlieren, sondern könnte darüber hinaus noch in polizeiliche Ermittlungen verwickelt werden, die Quentin Cross und Ross Darby für Jahre hinter Gitter bringen könnte.
Antoine wusste das und forderte dafür seinen Preis. Was Quentin zudem Sorge bereitete, war Antoines Unberechenbarkeit. Sollte Veratox die heißeste Wunderdroge der Welt werden, könnte Antoine den Preis künftiger Lieferungen einfach verdoppeln. Oder er könnte eine Auktion für Bieter mit unbegrenzten Mitteln einberufen, etwa Eli Lilly oder Merck. Die einzige Lösung dieses Dilemmas war, das Mittel künstlich herzustellen. Doch trotz monatelanger Bemühungen von Darbys Chefchemiker Christopher Bacon blieb das Toxogen schwierig zu reproduzieren. Der Prozess erforderte so viele Zwischenschritte, dass der Ertrag winzig ausfiel. Prunus caribaeus erwies sich bislang als eine Aprikose, die nur die Natur herstellen konnte.
»Ich muss Sie daran erinnern, dass es sie nur in Apricot Cay gibt. Und wissen Sie warum?« Antoine entblößte wieder seine Zähne zu einem Lächeln. »Weil ein Pilz, der nur Prunus caribaeus befällt, seltsamerweise die gesamten Aprikosenbestände auf den benachbarten Inseln vernichtet hat.«
Quentin wollte schon fragen, wo dieser Pilz hergekommen war, doch etwas in Antoines Augen verriet ihm die Antwort. Der Dreckskerl war sogar noch gerissener, als er vermutet hatte.
»Und was verhindert, dass der Pilz auch auf diese Insel gelangt?«
»Die Tatsache, dass hier niemand ohne meine Erlaubnis anlegen darf.«
Das stimmte. Antoine hatte die Strände der Insel mit ausgeklügelten elektronischen Sicherheitssystemen versehen lassen – Kameras, Bewegungsmelder, Stacheldrähte –, ganz zu schweigen von den bewaffneten Männern, die ständig von Türmen und Jeeps aus die Insel überwachten. Er hatte sogar Autowracks in den flachen Gewässern der Bucht versenken lassen, damit sich Korallenbänke bildeten, die die Durchfahrt der Boote gefährlich machten. Apricot Cay war eine tropische Festung.
»Sie verlangen zu viel.«
»Dem Wall Street Journal zufolge nicht«, bemerkte Vince Lucas. Aus seinem Aktenkoffer zog er eine Ausgabe der Zeitung. »Darby Pharms’ Profit ist im vergangenen Jahr um dreißig Prozent gestiegen – etwa fünfzig Millionen Dollar. Barron’s bezeichnet Darby sogar als ein Wachstumsunternehmen par excellence. Außerdem ist Ihr Mr. Darby ein alter Freund von Ronald Reagan. Wenn Sie erst einmal den Segen der FDA haben, wird Darby auf der Fortune-Liste der fünfhundert Top-Unternehmen landen, n’est-ce pas?«
Quentin wünschte sich, er hätte die Verbindung zum Weißen Haus nie erwähnt. In einem Anfall von Großspurigkeit hatte er einmal damit geprahlt, dass Ross Darby und Reagan zusammen in der Footballmannschaft des Eureka College gespielt hatten und dass Darby hunderttausende Dollar für Reagans Wahlkampf gespendet und durch die Organisation von Spendenveranstaltungen für die Republikaner weitere Millionen zusammengebracht hatte. Ironischerweise hatte Ross sogar Nancy Reagans Anti-Drogen-Initiative mit dem Motto »Sag einfach nein« großzügig unterstützt. Diese Prahlerei hatte den Preis der Aprikosen vermutlich verdoppelt.
Quentin trat an die Reling. Die Sonne war am wolkenlosen Horizont untergegangen und hatte das Meer mit flammendem Orangerot übergossen. Selbst wenn Reagan Druck auf den FDA-Vorstand ausübte, könnte es noch zwei Jahre dauern, eine Genehmigung zu bekommen. Dann noch weitere zwei Jahre, bis Veratox auf den Markt käme. Bis dahin stünde Darby mit 25 Millionen Dollar bei einem karibischen Verbrecher in der Kreide. Was die Sache noch schlimmer machte, war, dass ihr bester Mikrobiologe, Dexter Quinn, vor zwei Monaten in den Ruhestand gegangen war. Damit blieben für ihr Paradeprojekt nur noch Chris Bacon und zwei Assistenten. Sie arbeiteten rund um die Uhr, hatten jedoch noch keine Fortschritte bei der künstlichen Herstellung des Stoffes gemacht. Und etwas an Bacon beunruhigte Quentin. Er wirkte ständig abgelenkt, als verfolge er unter der Oberfläche einen ganz anderen Plan.
»Natürlich«, sagte Antoine und trat zu ihm an die Reling, »ist es immer möglich, dass sich eine andere Firma für unsere schöne Ernte interessiert, nicht wahr?« Antoine lächelte breit.
Der Bastard hatte ihn im Sack. Auf dem Tisch lagen die in Leder gebundenen Geschäftspläne der Scheinfirma, die Quentin gegründet hatte, um tropische Früchte zu exportieren, mit allen Verkaufsbedingungen, allen Zahlen und Paragrafen im schönsten Juristenlatein. Es war alles sehr raffiniert und legitim, säuberlich in Französisch und Englisch formuliert. Das Ganze war hieb- und stichfest und würde vor jedem Gericht Bestand haben.
Quentin spürte, wie er innerlich nachgab. Veratox war ein Molekül, das Milliarden wert war, und er würde der nächste Chef der Firma sein. Wenn es Chris Bacons Gruppe erst einmal gelungen wäre, den Extrakt künstlich herzustellen, würden sie Antoine Ducharme und seine Insel nicht mehr brauchen. »Sie verhandeln ganz schön hart.«
»Aber nein, mein Freund. Das ist ein echtes Sonderangebot.«
Quentin schlurfte zurück zum Tisch und unterschrieb den Vertrag. Bis zum ersten November musste er zweieinhalb Millionen Dollar als Vorschuss auf ein Konto bei einer Bank auf den Bahamas überweisen. Eine zweite Zahlung in derselben Höhe würde dann im Juni fällig werden. Und niemand würde davon erfahren, weil Quentin doppelte Bücher führte und die Erträge aus den Auslandsverkäufen anderer Produkte abzweigte.
Antoine schenkte Champagner nach, und sie saßen da und sahen zu, wie der Himmel schwarz wurde, während die anderen drinnen beim Fußballspiel johlten. Nach ein paar Minuten erhob sich Antoine. »Vertrauen, meine Freunde. Es ist sehr wichtig, nicht wahr?«
Die Frage brachte Quentin aus der Fassung. Vince Lucas zuckte nur die Achseln.
»Wichtiger als Liebe.« Antoines Augen leuchteten mit seltsamer Intensität.
Quentins erster Gedanke war, dass Antoine betrunken war. Doch dieser ging zielsicher auf eine Wand neben der Instrumentenkonsole des Bootes zu und schob die Verkleidung zurück. Dahinter war ein kleiner Fernsehmonitor zu sehen. Er drückte ein paar Knöpfe, und ein Farbbild erschien auf dem Schirm. Einen Augenblick lang dachte Quentin, es sei ein Pornovideo. Zwei Menschen beim Sex. Antoine murmelte etwas auf Französisch, harsch und resigniert, dann drehte er an einem Knopf. Die Kamera zoomte auf Lisa, die vom Orgasmus geschüttelt wurde, während Marcel, der immer noch sein rotes Hemd trug, hart in sie hineinstieß.
Antoines Gesicht nahm einen seltsam neutralen Ausdruck an. Er schaltete das Gerät aus, dann ging er zum Telefon und sagte etwas auf Französisch. Keine Minute später kam Marcel auf Deck. Er war vollständig angezogen, am Gürtel trug er immer noch seine Pistole im Holster.
Quentin spürte, wie sich sein Herzschlag beschleunigte.
»Alles klar da unten?«, fragte Antoine.
»Ja, natürlich«, sagte Marcel. Er wirkte nervös.
»Gut.« Dann wandte sich Antoine an Quentin. »Mein amerikanischer Geschäftspartner schließt sich uns nämlich an. Er wird kräftig in unser Unternehmen hier investieren, und wir müssen ihm zeigen, dass unser Sicherheitssystem lückenlos ist, n’est-ce pas?«
»Aber natürlich.«
Antoine trat auf Marcel zu und erhob einen Finger wie ein Lehrer, der einen Merksatz zitiert. »Vertrauen«, sagte er, dann griff er an Marcels Seite und zog die Pistole aus dem Holster. Marcel rührte sich nicht. »Siehst du? Vollkommenes Vertrauen.« Marcel grinste unsicher. Antoine erhob einen zweiten Finger. »Vollkommene Sicherheit«, fuhr er fort. »Wesentliche Bestandteile des Erfolgs, nicht wahr?«
Vince Lucas lächelte und forderte Marcel mit wie zum Toast erhobener Hand auf, die Charade mitzuspielen.
Dann bedeutete Antoine Marcel, die Hände auszustrecken. Der Mann sah verblüfft aus, aber Antoine war sein Boss, der gerade einen Gast beeindrucken wollte. Also spielte Marcel mit, während Antoine die Handschellen von seinem Gürtel löste und ihm einen der beiden Metallringe um ein Handgelenk schloss. »Absolutes Vertrauen, nicht wahr?«
Marcel nickte, dann bedeutete Antoine ihm, sich umzudrehen, was er auch tat und dabei fast stolz die zweite Hand in vollkommenem Gehorsam hinter sich hielt. Antoine legte ihm die zweite Handschelle an und redete dabei weiter, während Quentin ängstlich und fasziniert zugleich zusah. »Ohne Vertrauen scheitern Freundschaften, lösen sich Familien auf, brechen Imperien zusammen.«
Er führte Marcel an die der Hafenseite zugewandte Reling. Jenseits des Wassers glitzerte Antoines Villa wie das Ausstellungsstück eines Juweliers. Über ihnen dehnte sich das unendliche schwarze Himmelsgewölbe, verziert mit Millionen von Sternen und einem Halbmond, der dicht über dem Horizont schwebte. »Und es ist für all dies«, fuhr Antoine fort, »eine Paradiesinsel in einem Paradiesmeer unter einem Paradieshimmel – die Sterne, der Mond, die Luft. All jene Augenblicke, die wir den Göttern stehlen. Wir sind der Unsterblichkeit so nahe, wie Menschen es nur sein können.«
»Ja, Monsieur.«
»Ja, Monsieur«, wiederholte Antoine. Er wies Marcel an, hinunter ins Wasser zu schauen. »Aber nicht das Gesicht des Verrats.«
Bevor Marcel antworten konnte, nickte Antoine Vince Lucas zu, der Marcel mit einer einzigen geschmeidigen Bewegung über die Reling wuchtete.
Marcel kam hustend und röchelnd an die Wasseroberfläche.
»Du hast den falschen Leib bewacht, mein Freund«, rief Antoine.
Marcel schrie und flehte Antoine an, ihm eine Strickleiter zuzuwerfen. Er wusste genau, dass sie über eine halbe Meile weit draußen waren und dass ein kräftiger Wind ihn dorthin trieb, wo die Brandung gegen das zerklüftete Riff donnerte und zu Schaum zerstob.
Vince zog eine Pistole unter seinem Hemd hervor und zielte damit auf Marcels Kopf.
»Nein, lass der Natur ihren Lauf«, befahl Antoine. »Das verlängert den Spaß.«
Lisa kam nach oben an Deck geklettert. Sie hatte Marcels Schreie gehört. »Was ist passiert? Was hast du mit ihm gemacht?«
Antoine wirbelte heftig zu ihr herum. »Er wollte sich den Schwanz nass machen.«
Entsetzt starrte sie ihn an, dann die beiden anderen Männer, die mit ihren Champagnergläsern daneben standen, während das Konsortium drinnen ein Tor bejubelte. Sie wollte zurückweichen, doch Antoine stieß sie zur Reling. Er wollte auch sie über Bord schleudern, doch Quentin rief: »Nein, bitte nicht, Antoine. Tun Sie das nicht. Bitte!«
Antoine fuhr zu ihm herum, wütend über die Einmischung. Doch dann fing er sich und ließ die Frau los. »Du kannst gehen«, zischte er. »Aber du wirst denselben Fehler nicht noch einmal machen, nicht wahr?«
Sie blieb stehen und keuchte in ungläubigem Entsetzen, während Marcel unten im Wasser seine letzten röchelnden Atemzüge tat.
»Nicht wahr?«
»Nein«, jammerte sie, dann stolperte sie rückwärts die Treppe hinunter zu ihrer Kabine.
Gelähmt vor Entsetzen schaute Quentin Hilfe suchend Vince an, der ihm jedoch nur zuzwinkerte und auf eine Sternschnuppe deutete, während Antoine sich mehr Champagner einschenkte und dann an die Reling zurückkehrte, um Marcel beim Sterben zuzusehen.
Zwei furchtbare Minuten lang würgte er und bettelte um sein Leben. Seine Worte gurgelten durch die dunklen Wellen, seine Beine traten mit letzter Kraft, um seinen Kopf über der nächtlichen Brandung zu halten, bis er völlig erschöpft in der Schwärze versank.
Quentin brachte vor Schrecken kein Wort heraus. Er starrte in sein Glas und dachte über die grausame Gerechtigkeit Antoine Ducharmes nach, über die Beiläufigkeit, mit der Vince Lucas zugesehen hatte, als werde er ständig Zeuge von Morden, darüber, welche Strafen Antoine wohl für Lisa auf Lager hatte. Zugleich war ihm völlig klar, dass er es mit einem Menschenschlag zu tun hatte, der in einer finsteren und protzigen Welt lebte, einer Welt, deren Prinzipien dem Rest der zivilisierten Gesellschaft fremd waren.
Doch was Quentin Cross fast ebenso sehr zu schaffen machte wie das Ertrinken des jungen Mannes, war das Wissen, dass er jetzt Teil dieser Welt war, ein Komplize und Teilhaber, der seine Unterschrift in Blut geleistet hatte.
Und sein einziger Ausweg war Christopher Bacon.
Oder sein eigener Tod.
Kapitel 2
CANTON, OHIO
November 1986
Karen Kimball hätte es nicht genau sagen können, doch der Typ in dem braunen Jackett kam ihr irgendwie bekannt vor.
Es waren seine Augen. Die schweren Lider, die dunkelblaue Iris mit den tanzenden Sternen darin. Es ist schwer, Augen zu vergessen, ganz gleich, was mit dem übrigen Gesicht geschieht. Sie hatte diese Augen vor langer Zeit gekannt. Und die Art, wie sie ihr folgten. Nicht lüstern, nicht unanständig, sondern mit einer Art von warmem Interesse. Doch er war zu jung, um ihr nachzustellen.
Sie wischte den Tisch in der Nische gegenüber der seinen ab und schalt sich selbst. Sie war schließlich 59, eine geschiedene Frau mit Übergewicht, drei Kindern und einem Enkel, kein Teenager, der bei jedem gut aussehenden Kerl, der ihr über den Weg lief, knallrot anlief.
Sie trocknete sich die Hände ab und zückte ihren Block. »Möchten Sie etwas trinken, Sir?«
Er betrachtete ihre Kellnerinnenuniform. »Sind Sie nicht die Besitzerin?«
Das wusste jeder in der Stadt. »Eines meiner Mädchen hat sich krank gemeldet, also müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Was darf’s denn sein?«
»Ich denke, ich nehme ein Black Cow.«
»Ein was?«
»Vermutlich machen Sie die nicht mehr. Also stattdessen ein Heineken.«
Karen spürte einen Augenblick lang Ärger in sich aufsteigen. Er machte sich über sie lustig, weil sie keine Bar hatte, die neumodische Drinks mixte. Doch als sie seinen Tisch verließ, fiel ihr ein, was er bestellt hatte – ein Black Cow: Rootbier mit Vanilleeis. Sie hatte den Namen seit Jahren nicht mehr gehört. Nicht mehr seit ihrer Schulzeit, als sie bei Lincoln Dairy gejobbt hatte.
Karen holte sein Bier und ging an den Tisch zurück. Sie fühlte sich jetzt ein wenig unwohl in ihrer Haut. Während sie seine Bestellung aufnahm, betrachtete sie sein Gesicht genau. Ein gutes Gesicht: offen und angenehm, mit schmalen, leicht geschwungenen Lippen, einem ausgeprägten Kinn mit einer Kerbe, dichtem braunen Haar und diesen sternenfunkelnden blauen Augen.
Mein Gott, ich kenne dieses Gesicht, sagte sie sich. Und diesen Blick. Jedes Mal, wenn ihre Augen sich trafen, konnte sie spüren, dass etwas zwischen ihnen geschah, etwas, das über das normale Verhältnis zwischen Gast und Kellnerin hinausging.
Sie kehrte in die Küche zurück und beobachtete den Mann durch das kleine Fenster in der Schwingtür. Sie merkte ihm an, dass er sie kannte, obwohl sie ihn nirgendwo einordnen konnte. Und er schien sein Verwirrspiel zu genießen. Er sah aus, als sei er zwischen 30 und 40 Jahre alt. Vielleicht war er der Sohn eines Freundes, eines Mannes, den sie seit ihrer Kindheit nicht gesehen hatte. Sie rief Freddie zu sich. »Kennst du den Kerl an Tisch sieben?«
Freddie spähte durch das Fenster. »Nie gesehen. Warum, macht er Ärger oder so was?«
»Nein, er kommt mir nur bekannt vor.«
»Warum fragst du ihn nicht einfach?«
Sie nickte und erforschte ihr Gedächtnis einige Augenblicke lang nach einer Verbindung, beobachtete ihn, wie er sich umsah, als suche er nach bekannten Gesichtern. Die Art, wie er seinen Kopf bewegte und sich mit der Hand durch die Haare strich, die Linie seines Kinns. Und diese Augen. Diese Augen.
Großer Gott. Es machte sie noch wahnsinnig. Vielleicht hatte sie ihn in einem Kinofilm oder im Fernsehen gesehen. Doch was hätte so jemand in der Casa Loma zu suchen? Es war ein nettes Familienlokal, aber nicht gerade das Ritz.
Sie starrte durch das Fenster und konzentrierte sich, so sehr sie konnte; sie spürte, wie es ihr fast einfallen wollte, wie ein Vogel, der von draußen aus der Dunkelheit hereinfliegt und sich, kurz bevor er landet, umdreht und wieder davonflattert.
Das ist doch lächerlich, sagte sie sich. Sie bediente andere Tische, versuchte, neutral auszusehen, beobachtete ihn jedoch weiter aus dem Augenwinkel. Als sein Essen fertig war, nahm sie ihren ganzen Mut zusammen und fragte ihn: »Ich möchte nicht unhöflich sein, aber kenne ich Sie nicht von irgendwoher?«
Der Mann lächelte schüchtern. »Könnte schon sein.«
»Sind Sie hier aus der Gegend?«
»Nicht mehr.« Wieder dieses neckische Lächeln. Er nippte an seinem Bier.
»Es ist nur, weil Sie mir bekannt vorkommen.«
»Na ja«, begann er, doch dann beschloss er offenbar, sein Spielchen weiterzuspielen, sie noch ein wenig zappeln zu lassen.
»Vermutlich nicht«, sagte sie kurz und wandte sich ab. Dabei dachte sie: Zum Teufel damit!
Wenn er jemand war, den sie kennen sollte, dann sollte er sich verdammt noch mal zu erkennen geben. Sie würde sich keinesfalls auf ein Spielchen mit irgendeinem Spinner einlassen, der den Laden ein bisschen aufmischen wollte, bevor er wieder aus der Stadt verschwand.
Karen brachte ihm sein Essen ohne ein weiteres Wort oder einen Blick. Sie stellte den Teller auf das Platzdeckchen vor ihn und drehte sich auf dem Absatz um, so cool und professionell sie konnte. Doch als sie sich entfernte, begann der Mann leise einen Refrain zu singen: »Sometimes I wonder why I spend the lonely nights dreaming of a song. The melody haunts my reverie ...«
Karen tat so, als hörte sie ihn nicht, und eilte durch das Lokal in die Küche, ohne sich umzudrehen.
Freddie sah vom Herd zu ihr herüber. »Hey, alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du gerade ein Gespenst gesehen.«
Karen lehnte sich gegen die Wand und starrte durch das Fenster. Die Augen. Der ganz leicht schiefe Mund. Die kleine Narbe im Winkel seiner linken Augenbraue.
»Das kann nicht sein«, sagte sie laut.
»Was kann nicht sein?«
Sie schüttelte den Kopf, um ihm zu bedeuten, dass es nichts weiter sei.
Dieses Lied. »Stardust.« Plötzlich war sie wieder in der Turnhalle der Alfred E. Burr Junior Highschool und tanzte zu Helen O’Connor und der Jimmy Dorsey Band. Es war ihr Lieblingslied. Sie hatte gesagt, dass seine Augen wie Sternenfunken aussahen – Stardust.
Unmöglich! Er ist zu jung. Zu jung!
»Macht dieser Typ dir Ärger?«
»Nein, verdammt noch mal!« Sie wusste nicht, warum sie aufbrauste, doch mit einem Mal fühlte sie sich aufgewühlt und desorientiert. Sie trat zur Hintertür hinaus, zündete sich eine Zigarette an und versuchte, ihre innere Ruhe wiederzufinden.
Der Parkplatz füllte sich. Die Bäume, die sich im Osten vor dem Himmel abhoben, hatten ihre Blätter verloren; die Äste bildeten vor dem Licht der Straßenlampen knorrige Muster. Als sie dorthin starrte, befand sie sich plötzlich auf einer hölzernen Hollywood-Schaukel in einem Garten in der Brown Street am südlichen Ende von Canton. Er saß neben ihr und lächelte dieses alberne, schiefe Lächeln. Diese Sternenaugen. Er redete vom College und davon, dass er eines Tages Wissenschaftler werden wollte, und im nächsten Augenblick küsste er sie.
Die Woge der Erinnerung überrollte sie so plötzlich, dass sie sich ganz schwach fühlte.
Sie ging wieder hinein und durchquerte die Küche. Freddie fragte sie etwas, doch sie winkte ab und schloss sich in der Personaltoilette ein. Drinnen kämmte sie ihr Haar und zog sich die Lippen nach. Das Gesicht im Spiegel wirkte bestenfalls fünf Jahre jünger, als es war. Und er sah aus wie ein junger Mann.
Er konnte es nicht sein. Aber warum zitterte sie dann plötzlich, richtete ihr Gesicht her und gurgelte mit Mundwasser?
Das war doch verrückt!
Sie trat durch die Küchentür ins Lokal.
Er hatte seine Mahlzeit beendet, saß aber immer noch dort und sah sie an. Dieselben Augen. Dieselbe Kerbe im Kinn. Dieselbe Narbe. Sie verspürte eine merkwürdige Angst, weil das alles keinen Sinn ergab. Er sah halb so alt aus wie sie. Während sie noch nach den richtigen Worten suchte, bemerkte sie etwas in seiner Hand.
Dann wurde ihr klar, dass er nicht mehr lächelte. Und dass seine Augen riesig und rund geworden waren. Sein Mund öffnete sich, und ein Speichelfaden tropfte auf sein Hemd. Aus seiner Kehle drang ein tiefes, gurgelndes Stöhnen. Plötzlich begann sich seine Brust zu heben.
Karens erster Gedanke war, dass er zu ersticken drohte, dass er keine Luft mehr bekam, dass sie den Heimlich-Handgriff anwenden musste, denn sein Gesicht verlor schon jegliche Farbe.
Doch dann begann sein Körper zu zucken wie unter einem elektrischen Schock. Mit einer einzigen Bewegung seiner Hände fegte er das Geschirr zu Boden, und zugleich traten seine Füße wie in einem furchtbaren Reflex um sich. Doch was Karen aufschreien ließ, war die Art, wie sein Gesicht sich vor Qual anspannte und wie er den Kopf zurückwarf, als wolle er ihn von seinem Hals losreißen.
»Schnell, ruft einen Arzt!«
Mein Gott!, dachte sie. Er hat einen Herzinfarkt. Sie schrie einem ihrer Kellner zu, sofort einen Krankenwagen zu rufen.
Plötzlich war das ganze Lokal in Bewegung; Gäste riefen und sprangen auf, um zu helfen; ein Mann sagte, er sei Arzt.
Während Menschen um sie herumschwirrten und der Arzt versuchte, die Krawatte des Mannes zu lockern, stand Karen wie erstarrt da. Etwas Merkwürdiges passierte mit dem Gesicht des Mannes.
Während er sich wand und den Kopf hin und her warf, hätte Karen schwören können, dass die Haut seines Gesichtes sich veränderte, sich verschob, dunkle Flecken bekam. Doch darüber hinaus schien sie sich zu bewegen, sich zu verbiegen, als löse sie sich von innen, als wäre es plötzlich zu viel Haut für seinen Schädel.
Zuerst konnte sie nicht glauben, was sie sah, zumal sie durch die Zuckungen und das Gurgeln in seiner Brust abgelenkt war. Dann bemerkte sie seine Hände. Auch an ihnen veränderte sich die Haut – verrunzelte und welkte, als löse sich das Fleisch darunter auf, verwandelte sich in durchsichtiges Pergament, durch das die Venen lange blaue Vs auf den Handrücken formten. Auch andere bemerkten dies, und ihre Stimmen wurden leiser, während sie dem Schauspiel zusahen. Dann begannen die Leute zu schreien und den Arzt zu drängen, etwas zu tun.
Doch das hier war kein Herzinfarkt, auch kein Schlaganfall oder ein Aneurysma oder irgendetwas anderes, das Karen sich vorstellen konnte. Und auch nichts, das irgendeiner der Umstehenden, die sich gegen sie pressten, kannte, der Arzt eingeschlossen. Vergebens hatte er die Krawatte des Mannes gelockert, in dem Wissen, dass er hier Zeuge von etwas wurde, das er noch nie gesehen hatte, etwas, auf das ihn seine medizinischen Lehrbücher nicht vorbereitet hatten, etwas, das nichts mit der normalen menschlichen Pathologie zu tun hatte. Welche Krankheit konnte den menschlichen Körper so schnell und mit solch brutaler Gewalt verfallen lassen? Kein Virus, kein Bakterium, keine Seuche, von der er je gehört hatte. Was auch immer diesen Mann ereilt hatte, hatte einen Blitzkrieg gegen die DNA in seinen Zellen geführt.
Während andere nach Luft schnappten und schrien, stand Karen wie festgenagelt da. Ein Schrei steckte ihr in der Kehle, während sie beobachtete, wie der Mann vor ihren Augen ein halbes Jahrhundert alterte, wie er zugleich schwer wurde und zu einer aufgeblähten Mumie seines ehemaligen Selbst zusammenschrumpfte. Nur Minuten zuvor hatte dort ein großer, gut aussehender junger Mann gesessen. Jetzt war er in der Ecke der Nische zusammengesunken, die Schultern vornüber gebeugt, der Hals geschrumpft, die blicklosen, entzündeten Augen auf die Zuschauer gerichtet, der Mund umgeben von faltigem Fleisch, das zu einem stummen Schrei erstarrt war.
Dann drang ein langer, dünner Schrei aus Karens Lungen. Sie hatte seine verdorrte Klaue aufgebogen. Darin hatte er ein Schwarz-Weiß-Foto umklammert, das er ihr mitgebracht hatte, ein Foto, das sie nur zu gut kannte, ein wenig vergilbt und zerknittert zwar, doch nicht genug, um das Bild von ihnen beiden in Smoking und Abendkleid beim Schul-Abschlussball unkenntlich zu machen: »Stardust Night – 1948«.
Ein Duplikat davon klebte zu Hause in ihrem Fotoalbum, mit einer Widmung auf der Rückseite: In Liebe auf immer, Dexter.
Kapitel 3
BOSTON
13. Dezember 1986
Chris Bacon sah in den Rückspiegel und zupfte sich abwesend ein weißes Haar aus der Augenbraue. »Was würdest du sagen, wie alt du bist, wenn du es nicht wüsstest?«
»Ist das eine Art Fangfrage?«, wollte seine Frau Wendy wissen.
»Nein.«
»Na ja, an manchen Tagen fühle ich mich wie neunzig«, scherzte sie.
»Du weißt schon, was ich meine.«