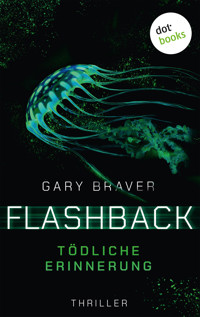
0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Manche Erinnerungen sollten besser begraben bleiben: Der Wissenschaftsthriller »Flashback – Tödliche Erinnerung« von Bestsellerautor Gary Braver jetzt als eBook bei dotbooks. Bei ihrer Arbeit im Altenheim macht die Pharmazeutin René Ballard eine erschreckende Entdeckung: Mehreren Alzheimer-Patienten wurde heimlich ein illegales Medikament verabreicht. Das sogenannte »Memorin« bringt zwar die Erinnerungen der Kranken zurück – jedoch mit furchtbaren Nebenwirkungen: Sie sind plötzlich gefangen in Flashbacks, die sie die schlimmsten Ereignisse ihrer Vergangenheit wiedererleben lassen. Benutzt ein skrupelloser Pharma-Konzern die Hilfsbedürftigen als Testobjekte? Bei ihren Nachforschungen lernt René durch Zufall Jack Koryan kennen, dessen Gedächtnis seit einem Tauchunfall mit einem Schwarm giftiger Quallen unnatürlich detailliert ist. Gemeinsam forschen die beiden weiter nach dem Ursprung des »Memorins« – und geraten so bald ins Visier eines brutalen Gegenspielers … »Ein würdiger Nachfolger von Michael Crichton und Tess Gerritsen.« Publishers Weekly Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Thriller »Flashback – Tödliche Erinnerung« von Gary Braver wird alle Fans von Frank Schätzing begeistern. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch:
Bei ihrer Arbeit im Altenheim macht die Pharmazeutin René Ballard eine erschreckende Entdeckung: Mehreren Alzheimer-Patienten wurde heimlich ein illegales Medikament verabreicht. Das sogenannte »Memorin« bringt zwar die Erinnerungen der Kranken zurück – jedoch mit furchtbaren Nebenwirkungen: Sie sind plötzlich gefangen in Flashbacks, die sie die schlimmsten Ereignisse ihrer Vergangenheit wiedererleben lassen. Benutzt ein skrupelloser Pharma-Konzern die Hilfsbedürftigen als Testobjekte? Bei ihren Nachforschungen lernt René durch Zufall Jack Koryan kennen, dessen Gedächtnis seit einem Tauchunfall mit einem Schwarm giftiger Quallen unnatürlich detailliert ist. Gemeinsam forschen die beiden weiter nach dem Ursprung des »Memorins« – und geraten so bald ins Visier eines brutalen Gegenspielers …
Über den Autor:
Gary Braver ist das Pseudonym des amerikanischen Autors Gary Goshgarian. Nach seinem Schulabschluss studierte er Physik und machte schließlich seinen Doktor in englischer Literatur. Während seiner Arbeit als Dozent begann Braver mit dem Schreiben seiner Spannungsromane, die in zahlreiche Sprachen übersetzt und mehrfach ausgezeichnet wurden. Zusammen mit der Bestsellerautorin Tess Gerritsen schrieb er den erfolgreichen Thriller »Die Studentin«.
Die Website des Autors: garybraver.com/
Bei dotbooks veröffentlichte der Autor seine packenden Wissenschaftsthriller »Eternal – Gefährliche Entdeckung und »Flashback – Tödliche Erinnerung«, sowie den Psychothriller »Skin Deep – Das Gesicht des Todes«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2023
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2005 unter dem Originaltitel »Flashback« bei Forge Book, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Memoria« bei Heyne, München.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2005 by Gary Braver
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2007 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Neuausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/catmando, Kitsana 1980
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98690-656-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Flashback« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Gary Braver
Flashback – Tödliche Erinnerung
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Imke Walsh-Araya
dotbooks.
Dieses Buch ist dem Andenken meiner Mutter, Rose Goshgarian, und meiner Tante, Nemza »Nancy« Megrichian, gewidmet.
So viele Träume – da fällt es schwer, den richtigen zu wählen.
E. B. White (der an Alzheimer starb)
Als ich jung war, konnte ich mich an alles erinnern, ob es sich tatsächlich ereignet hatte oder nicht. Aber nun lassen meine Fähigkeiten nach, und bald werde ich mich nur noch an Dinge erinnern können, die nie geschehen sind.
Mark Twain
ERSTER TEIL
Kapitel 1
Homer’s Island, Massachusetts
Von seinem Platz oben auf dem Skull Rock sahen sie wie blasse Spiegeleier aus, die sich direkt unter der Wasseroberfläche bewegten. Irgendeine Quallenart. Ein halbes Dutzend muskulöse Fallschirme, die sich kraftvoll pulsierend durch die schwarze Brandung arbeiteten.
Merkwürdig. Als Kind hatte Jack Koryan häufig den Sommer hier draußen verbracht und dabei nur einige wenige Male Quallen in der Bucht gesehen. Meistens wurden sie von der nächtlichen Flut an den Strand gespült – tellergroße Schleimbomben mit Rüschenschürzen und fetten, langen Tentakeln. Aber diese Geschöpfe sahen aus wie kleine runde Klumpen, durchsichtige Geleebäuche, die nichts Sichtbares hinter sich herzogen.
Vielleicht eine tropische Art, die das warme Wasser mitgebracht hat, dachte er.
Jack sah zu, wie die ganze Formation pumpend vorüberzog, getrieben von einem primitiven Drang und der warmen Strömung. Irgendwo hatte er gelesen, dass Quallen zu fünfundneunzig Prozent aus Wasser bestanden – Wesen ohne Gehirn, Knochen oder Blut, die auf ihre Umwelt nur dank eines Netzwerks aus Nerven reagierten. Was für ein erbärmliches Schicksal, dachte Jack. Nervenenden als einzige Verbindung zur Welt: ein Leben ohne Denken, Leidenschaft oder Erinnerung.
In der kühlen, feuchten Luft war eine Brise aufgekommen, die die Wasseroberfläche kräuselte. Die Flut kam herein. Bald würde der Felsen vom Wasser bedeckt sein.
Skull Rock.
Er sah aus wie immer – ein kuppelförmiger Granitblock, der etwa fünfzig Meter vor der Küste aus der Brandung ragte. Generationen von Seepocken hatten seine Kuppe weiß gefärbt, und um den Sockel hing eine Mähne aus Seegras. Schimmernde schwarze Muscheln schmückten die Hochwasserlinie wie eine exotische Perlenkette. Als Kinder hatten er und sein Cousin George die Weichtiere in Eimer gesammelt und seiner Tante Nancy für ihre armenischen Gerichte oder ihre Bouillabaisse gebracht.
Es war fünfzehn Jahre her, seit Jack zuletzt zum Felsen hinausgeschwommen war. Damals hatte er mit seinem Cousin und anderen Sommerkindern ganze Stunden dort draußen verbracht. Bei Ebbe drängten sich manchmal bis zu zehn zappelnde kleine Körper auf der Kuppe, deren einziger Halt die verwitternden Seepocken unter ihren Füßen waren. Fast konnte er das grölende Gelächter hören, wenn einer von ihnen das Gleichgewicht verlor oder ins Wasser geschubst wurde. Wer zuerst reinfällt, hat verloren.
Hinter ihm erstreckte sich das rollende Meer wie flüssiges Eisen bis zu den dunklen regenschweren Wolken, die von Norden hereindrängten. Irgendwo da draußen war Jacks Mutter gestorben – am 20. August 1975. Sie war zu ihrem kleinen Segelboot hinausgepaddelt, das direkt hinter dem Skull Rock ankerte, wahrscheinlich keine fünfzig Meter von dort entfernt, wo er jetzt stand. Sie mussten Nordostwind gehabt haben, weil das Beiboot achthundert Meter weiter unten an den Strand gespült wurde. Die Rettungswesten lagen noch im Boot, aber ihre Leiche wurde nie gefunden.
Heute war ihr dreißigster Todestag. Alle paar Jahre kam er zu einer stillen Gedenkstunde hier heraus. Als sie starb, war er nicht einmal zwei Jahre alt gewesen. Seine Tante Nancy und sein Onkel Kirk hatten ihn wie ihr eigenes Kind großgezogen.
Unter ihm schwammen weitere Quallen direkt unter der Wasseroberfläche vorbei. Eine schräge Phalanx durchscheinender Körper, in deren Mitte sich violette Ringe kreuzten.
Dies war ein ganz besonderer Ort. Das Strandhaus war ursprünglich für den Verwalter des großen Sherman-Anwesens oberhalb der Steilküste vorgesehen gewesen. Rose, seine Mutter, hatte es vor Jahrzehnten als Ferienhaus gemietet, wegen des ungewöhnlich warmen Wassers, das auf komplizierte klimatische Phänomene wie El Niño zurückzuführen war. In regelmäßigen Abständen brachten Strömungen tropische Geschöpfe vom Golfstrom in das Gebiet: Mondfische, Echte Karettschildkröten, Thunfische und kleinere Tiere, die seine Mutter faszinierten. Seiner Tante Nancy zufolge hatte Rose eine geradezu mystische Beziehung zum Meer gehabt und war oft stundenlang am Strand spazieren gegangen, um merkwürdige Lebewesen zu sammeln. Aber Jack besaß keine Erinnerung an sie, sondern war auf die bruchstückhaften Informationen seiner Tante angewiesen, die vor dreizehn Jahren verstorben war. Sein Vater war bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, als Jack sechs Monate alt gewesen war, sodass er auch an ihn keinerlei Erinnerung hatte.
Dafür wusste er noch gut, wie er sich einmal im flachen Wasser an einer großen orange leuchtenden Feuerqualle verbrannt hatte – ein Gefühl, als hätte ihm jemand eine Peitsche über die Wade gezogen. Nur mit Mühe hatte er die Tränen unterdrücken können, als Tante Nancy in aller Ruhe mit ihm zum Haus zurückging und seine Haut mit Essig abwusch. »Auf keinen Fall reiben«, hatte sie gesagt, »das macht es nur noch schlimmer.« Dann hatte sie mit der stumpfen Seite einer Messerklinge ein kleines Stück Tentakel abgeschabt. Ein altes armenisches Hausmittel, hatte sie erklärt, das sie von ihrer Mutter gelernt habe. Er fragte sich, ob das stimmte.
Im schwächer werdenden Licht sah Jack seine Kleider am Strand liegen, wo er sie ausgezogen hatte, um hinauszuschwimmen. Ein kleines Stück weiter oben am Strand erhob sich die dunkle Silhouette des Verwalterhäuschens. Der Sandstrand von Buck’s Cove war völlig verlassen, aber in der Sherman-Villa darüber brannte Licht. Obwohl die Insel in Privatbesitz war, ankerten hier an Sommerwochenenden Boote, deren Besitzer die unberührte Schönheit der Gegend genießen wollten. Heute Abend jedoch war weit und breit kein Mensch zu sehen.
Am Horizont zuckten Blitze. Bald musste der Sturm losbrechen.
Von seinem Felsen aus wirkte das unbeleuchtete Haus am dunklen Strand düster. Dabei hatte er nur schöne Erinnerungen an diesen Ort. Nach dem Tod seiner Mutter hatten die Shermans das Haus im Sommer jeweils ein oder zwei Wochen an seine Familie vermietet. Er wusste noch genau, wie er und seine Cousins über den Sand gelaufen waren und sich ins Wasser gestürzt hatten, ohne sich von der Kälte beeindrucken zu lassen, die die Erwachsenen davon abhielt, sich weiter als bis zu den Knien ins Meer zu wagen.
Aus der Dämmerung tauchte eine Möwe auf, die sich im Sturzflug auf das Wasser stürzte, aber in letzter Sekunde mit einem enttäuschten Kreischen abdrehte. Immer noch schimpfend landete sie am Ufer in der Nähe von Jacks Kleidung.
Jack fühlte einen Stich in der Brust. Aus dem halben Dutzend Quallen war unter dem von Blitzen durchzuckten Himmel ein ganzer Schwarm geworden. Er warf einen Blick auf das Wasser hinter ihm.
»Herr im Himmel!«
Kein Schwarm. Er stand mitten in einer Quallenplage. Hunderte der Tiere schaukelten dicht an dicht an seinem Felsen vorbei. Die Bucht wimmelte nur so von Quallen.
Im schwächer werdenden Licht konnte er seine Kleider am Ufer erkennen. Seine Jeans lud ihn ein, wieder hineinzuschlüpfen, aber es sah aus, als wäre sie meilenweit entfernt.
Wo zum Teufel kommen die her?
Und wenn sie giftig sind?
Aber es gibt Hunderte verschiedene Quallenarten, und nur eine Handvoll ist giftig.
Er überlegte, ob er zum Test seinen Fuß ins Wasser halten sollte. Das war in Ordnung, wenn er keine Reaktion zeigte. Aber was, wenn er sich verbrannte? Sollte er das Gewitter abwarten, bis ihn ein Blitz zu Holzkohle verschmorte? Außerdem würde der Felsen binnen einer Stunde überschwemmt werden. Dann schwappten ihm die Quallen so oder so über die Füße. Großer Gott!
Prüfend betrachtete er die schwarze Wasserfläche, die ihn vom Ufer trennte. Seine beste Zeit bei auflaufender Flut war eine Minute und zwanzig Sekunden. Aber damals war er achtzehn gewesen. Jetzt war er zweiunddreißig und konnte das Ufer frühestens in zwei Minuten erreichen. Zwei kurze Minuten ... Aber der Gedanke, durch Wasser zu schwimmen, in dem es von Quallen nur so wimmelte, war widerlich. Und falls sie giftig waren, konnte die Sache höchst unangenehm werden.
Aber die Dinger sind nicht größer als ein Tennisball und ernähren sich wahrscheinlich von Elritzen.
Stimmt, und genau die werden von ihrem Gift gelähmt.
Du bist doch keine Elritze.
Nein, aber bei Hunderten von Quallen dürfte das keine Rolle spielen.
Verflucht!
Der Himmel erstrahlte in einem bedrohlichen Grün. Dann zerriss ein hoher, metallischer Knall die Luft. Bei auflaufender Flut und Rückenwind konnte er es, vom Adrenalin getrieben, vielleicht in hundert Sekunden schaffen.
Im Geiste sah er Tante Nancy mit einer Stoppuhr lächelnd am Strand stehen. Drei, zwei, eins. Los!
George war zwar zwei Jahre älter, aber Jack war der bessere Schwimmer.
Mickrige hundert Sekunden.
Das Wasser war dunkel, doch es sah so aus, als würden die Quallen dicht unter der Oberfläche treiben. Wenn er tief genug tauchte und die Hälfte der Distanz knapp über dem Grund zurücklegte, musste er nur noch etwa sechs Meter kraulen, bis er seichtes Wasser erreicht hatte und den Rest zu Fuß zurücklegen konnte.
Er versuchte, sich einzureden, dass er es mit harmlosen Schleimklumpen zu tun hatte. Vermutlich schwamm es sich in dem Schwarm wie in einer Flut silikongefüllter Plastiktüten.
Nicht nachdenken. Sieh zu, dass du zum Strand kommst. Drei ... zwei ... eins.
Der Himmel explodierte erneut. Stroboskoplicht erhellte die Bucht. Sein Herz stockte: Das Wasser war bis hin zum Ufer von Quallen durchsetzt. Er sprach ein stilles Gebet, füllte seine Lungen mit Luft und sprang.
Aber er hatte sich getäuscht. Die Quallen besaßen einen Meter lange, unsichtbare Tentakel.
Und sie waren giftig.
Jack schwamm vielleicht zehn Meter unter Wasser und schoss dann an die Oberfläche.
In den ersten Bruchteilen von Sekunden, während er nach Luft rang, hätte er nicht sagen können, wo das Epizentrum des Schmerzes lag. Die Tentakel hatten Striemen über seine Arme, seinen Rücken und die Beine gezogen und seinen Kopf mit einer widerlichen Schleimschicht bedeckt.
»Nicht reiben.«
Er wischte sich die Dinger aus dem Haar. Dabei strichen ihre Spaghettiarme über sein Gesicht und seine Ohren. Er schrie so laut, dass es ihm fast die Kehle zerriss. Sein Körper brannte, als hätte er sich in einem Geflecht aus glühendem Draht verfangen.
»Nicht reiben. Nicht reiben.«
Im Geknatter der Blitze sah er, wie ihm eine Frau, die wie Tante Nancy aussah, vom Strand aus zuwinkte.
Aber es war zu spät, seine Hand glühte bereits vom Gift. Seine Schultern und sein Rücken fühlten sich an, als hätte man sie mit der Machete bearbeitet. Jack hatte nicht gewusst, dass es solch unerträglichen Schmerz geben konnte. Er rang nach Luft, schloss die Augen und stieß sich mit den Füßen ab, um unter den Kreaturen hindurchzutauchen. Während er Arme und Beine blindlings durch das Wasser zog, spürte er, wie die Schleimklumpen an seinem Gesicht vorüberglitten und seinen Körper geißelten.
Wieder kam er an die Oberfläche. Sein Verstand empörte sich gegen das Entsetzen, während er verzweifelt versuchte, sich auf den Weg zum Ufer zu konzentrieren, bevor das Gift anfing, seine Muskeln zu lähmen. Das war alles, was zählte.
Die Frau am Strand war verschwunden. An ihrer Stelle pickte ein großer weißer Meeresvogel an seinen Kleidern.
Irgendwo krachte Donner, aber Jack nahm es nicht wahr. Er nahm gar nichts mehr wahr, außer dem Schmerz, der seinen Körper durchzuckte. Es war, wie durch Strudel geschmolzener Lava zu schwimmen.
Mit einer Bewegung des ganzen Körpers schnellte er vorwärts.
Er war halb da. Auf der Anhöhe über ihm leuchtete die Sherman-Villa vor dem schwarzen Himmel. Selbst wenn er noch eine Stimme gehabt hätte, um zu schreien, hätte sie nicht so weit getragen. Und ihm fehlte die Luft dafür. Also konzentrierte er sich darauf, seine Arme und Beine durch das Wasser zu ziehen und das Gesicht über der Oberfläche zu halten.
Deine Augen. Augen zu!, brüllte sein Verstand.
Du willst doch nicht blind werden. Die Hautverbrennungen überstehst du schon irgendwie, aber du willst doch um Gottes willen dein Augenlicht nicht verlieren.
Er kniff sie zu. Tentakel hatten sich halb um sein rechtes Ohr geschlungen und verbrannten ihm die Haut.
»Auf keinen Fall reiben.«
Aber er schlug reflexartig nach ihnen und machte dadurch alles nur noch schlimmer, weil er sich die Toxine ins Ohr, über das Kinn und auf die Lippen schmierte. O Gott! Das Zeug war in seinem Mund, verbrannte ihm Zunge und Kehle, als hätte er kochendes Wasser geschluckt. Er fuhr mit den Fingern über seine Badehose, um den Schleim zu entfernen.
Jetzt brannten beide Hände wie der Rest seines Körpers. Das letzte bisschen Verstand, das ihm geblieben war, sagte ihm, dass Schultern, Rücken und Beine mit einem Gitternetz von Blasen und Striemen überzogen sein mussten. Falls er überlebte, würde er übel aussehen.
Im flackernden Licht sah er das Ufer mit dem Vogel, der ihn beobachtete. Vielleicht noch dreizehn Meter. Das Wasser war nur einen Meter fünfzig tief, aber er konnte nicht an Land waten. Also kniff er die Augen zu und trat wild mit den Beinen. Die Hände, die sich in nutzlose Klumpen der Qual verwandelt hatten, zog er hinter sich her. Er bemühte sich nach Kräften, das Gesicht über Wasser zu halten, aber seine Augen fingen an zu brennen. Lieber Gott, lass mich nicht blind werden. Bitte.
Während er mit den Füßen trat, spürte er Quallen über seine Haut gleiten. Das glühende Gift ihrer Tentakel strömte über seinen Oberkörper.
Nach weiteren sieben Metern riss er die Augen auf. Wenige Meter vor ihm schlugen die Wellen auf den Strand. Beißende Tränen trübten seine Sicht, aber er konnte seine Kleidung noch erkennen. Er fokussierte den Blick auf sein Hemd und seine Hose, auf die der Vogel einhackte wie ein Aasgeier.
Jack Koryan bot jeden Funken Muskelkraft auf, der ihm noch blieb, um sich mit den Füßen abzustoßen.
Plötzlich ließ das Brennen nach.
Danke, lieber Gott.
Es war wie ein Wunder. Seine Arme und Beine kühlten rasch ab. Vielleicht hatten die Toxine ihr böses Werk getan und wurden nun von den natürlichen Abwehrkräften seines Körpers neutralisiert. Oder er hatte sich irgendwie angepasst.
Er versuchte aufzustehen, um an Land zu waten, aber er spürte den Grund unter seinen Füßen nicht. Nicht einmal aufrichten konnte er sich. Er versuchte weiterzuschwimmen, doch seine Füße gehorchten dem Befehl nicht.
Gott im Himmel! Sein Körper wurde taub, als würde das Blut in seinen Adern zu Wachs erstarren.
Bis zum Ufer waren es vielleicht fünf Meter, aber er konnte sich nicht bewegen. Gelähmt trieb er auf der Brandung und starrte auf seine Turnschuhe und Kleidung. Kurz vor der Ziellinie gescheitert. Ein dummer Meeresvogel glotzte ihn an. Das milchige Auge funkelte im Blitzlicht.
Da kam eine Frau aus dem Verwalterhaus und lief über den Strand. Sie winkte ihn mit ausgebreiteten Armen zu sich heran. Tante Nancy und doch nicht Tante Nancy.
Ich verliere den Verstand ... Die letzten Halluzinationen eines Sterbenden.
Er sah den Vogel an und spürte, wie zäher Nebel die Windungen seines Gehirns füllte.
Der Vogel stieß einen langen, heiseren Schrei aus.
Das ist mein Tod.
In der Brandung, nur ein paar Meter von zu Hause. Drei ... zwei ... eins.
Das waren Jack Koryans letzte Gedanken, bevor er das Bewusstsein verlor.
Kapitel 2
Beth Koryan schlief tief und fest, als das Telefon klingelte. Nebelhaft nahm sie wahr, dass die Uhr an der Set-Top-Box 0:22 zeigte. Da Jacks Seite des Bettes leer war, rollte sie sich zum Telefon. Wahrscheinlich hatte er einen Zwischenstopp bei Vince eingelegt, um noch einmal die Speisekarte für die Eröffnung des »Yesterdays« im nächsten Monat durchzugehen. Jack wollte sich mit dem Restaurant einen Traum erfüllen, aber sie hatten sich dafür bis über beide Ohren verschulden müssen.
Obwohl sie und Jack keine Kinder hatten, klangen Beth noch die Worte ihrer Mutter im Ohr – ein Telefonanruf nach Mitternacht könne nichts Gutes bedeuten, hatte sie immer gesagt. »Bete, dass sich jemand verwählt hat.« Vielleicht sein hatte Wagen schon wieder eine Panne, und er musste irgendwo abgeholt werden. Genau das, was sie um diese Uhrzeit am liebsten tat: Raus aus dem warmen Bett und los! Sie hatte ihn gewarnt, dass es das Auto vielleicht nicht bis nach New Bedford und zurück schaffen würde, aber er hatte nicht hören wollen. Er musste unbedingt zu seiner blöden Insel fahren, um in Erinnerungen zu schwelgen.
Jack besaß einen starken Willen und legte größten Wert auf seine Unabhängigkeit, aber manchmal gewannen seine sentimentalen Anwandlungen die Oberhand. So hatte ihn sein Urteilsvermögen offenbar im Stich gelassen, als er seine Stelle als Englischlehrer an der Carleton Prep School kündigte, um ein Restaurant zu eröffnen, das eine bunte Mischung von Gerichten aus der alten Welt anbot. Daher der Name: »Yesterdays«.
Jack unterrichtete gern und war beliebt, aber er wollte sich nicht für den Rest seines Lebens festlegen. Nach zehn Jahren hatte er die Nase voll von den Budgetkürzungen und immer größer werdenden Klassen, worunter die Bildung zunehmend litt. Carpe diem, sagte er sich und beschloss, einer alten Leidenschaft nachzugeben. Seine Tante Nancy hatte seine Begeisterung für das Kochen geweckt, und sein alter Freund Vince Hammond hatte sich als Partner angeboten. Das Risiko war natürlich groß. Jack hatte trotz Beths Protest ihre Konten leer geräumt. Aber so war er eben: enthusiastische Entschlossenheit, hinter der sture Zielstrebigkeit stand.
Sie war noch benommen vom Schlaf, als sie beim vierten Klingeln abhob.
»Mrs Koryan?«
»Ja?«
»Ist Jack Koryan Ihr Ehemann?« Der Mann nannte ihre Adresse.
Sie spürte einen Stich in der Brust. »Ja.«
»Hier ist Dr. Omar Rouhana. Ich bin Arzt in der Notaufnahme des Cape Cod Medical Center in Barnstable. Ihr Mann ist bei uns. Er hat einen Unfall gehabt. Sein Zustand ist ernst.«
»Was?« Beth war jetzt hellwach. Notaufnahme? Wieso Notaufnahme? »Was ist passiert?«
»Wir halten es für sehr wichtig, dass Sie zum Krankenhaus kommen. Ist jemand bei Ihnen? Jemand, der Sie fahren könnte?«
»Lebt er noch? Lebt er?«
»Ja, Mrs Koryan, er lebt, aber es ist wichtig, dass Sie herkommen. Die Einzelheiten erklären wir Ihnen, wenn Sie hier sind. Haben Sie Kinder?«
»Was? Nein. Würden Sie mir bitte sagen, was passiert ist? War es ein Autounfall?« Es folgte eine lange Pause, in der Beth ihren eigenen keuchenden Atem hören konnte.
»Ihr Mann wurde von einem Bergungstrupp der Küstenwache hergebracht. Er wurde an einem Strand auf Homer’s Island gefunden. Bitte kommen Sie her, damit wir darüber reden können. Kann Sie jemand fahren?«
Er blockte ab, weigerte sich, Einzelheiten zu nennen. Sie rang um Beherrschung. »Ist er bei Bewusstsein? Können Sie mir bitte sagen, ob er bei Bewusstsein ist?«
»Nun, ich glaube, es ist am besten ...«
»Verdammt noch mal! Ist er bei Bewusstsein?«
»Nein.« Nach einer entsetzlichen Pause sprach der Arzt weiter. »Kommen Sie aus Carleton, Massachusetts?«
»Ja.«
»Das sind fast hundertfünfzig Kilometer. Kann Sie jemand fahren, oder sollen wir die Polizei vor Ort verständigen?«
Du lieber Himmel! War es so schlimm? Sie hatte keine Lust, die nächsten zwei Stunden im Fond eines Streifenwagens mit einem Wildfremden zu verbringen. Und Vince oder andere Freunde wollte sie auch nicht belästigen. »Ich kann selbst fahren.«
Der Mann beschrieb ihr den Weg, und sie machte sich hastig Notizen.
»Was ist passiert?«
Der Arzt ignorierte auch diese Frage. »Und bringen Sie bitte alle Medikamente mit, die Ihr Mann nimmt.«
Kurz vor drei Uhr morgens fuhr Beth auf den Parkplatz des Cape Cod Medical Center. Den spärlichen Details entnahm sie, dass Jack vermutlich beim Schwimmen ohnmächtig geworden war, was bedeutete, dass er einen Sauerstoffmangel erlitten hatte. Als sie die Notaufnahme betrat, wünschte sie sich, sie hätte Vince angerufen.
Die Eingangshalle war ein Bild trostloser Helligkeit. Im Empfangsbereich hielten sich zwei Personen auf: ein Mann, der sich über zwei Stühle gelegt hatte und schlief, und eine ältere Frau, die mit leerem Blick auf einen Fernsehbildschirm ohne Ton starrte. Die Frau an der Rezeption hatte sie erwartet, denn als Beth ihren Namen nannte, gab sie auf dem Telefon eine Nummer ein. »Mrs Koryan ist hier.« Nach wenigen Sekunden kamen ein Arzt und eine Krankenschwester durch die Schwingtür. Ihre Gesichter wirkten wie versteinert. Die beiden stellten sich vor, aber Beth registrierte die Namen überhaupt nicht. Sie folgte ihnen in ein kleines Besprechungszimmer, das von der Eingangshalle abging, und schloss die Tür.
»Er ist tot, nicht wahr?«, fragte sie.
»Nein, er ist nicht tot, Mrs Koryan«, erwiderte der Arzt. »Bitte setzen Sie sich.«
Beth ließ sich den beiden gegenüber auf einen Stuhl sinken. Ihre Mienen waren finster. Auf den Namensschildern stand »Omar Rouhana, Arzt« und »Karen Chapman, Krankenschwester«.
»Mrs Koryan, bevor Sie Ihren Mann sehen können, müssen wir Sie darauf hinweisen, dass er ein schweres Trauma erlitten hat. Abgesehen davon, dass er fast ertrunken wäre, hat er akute toxische Verbrennungen erlitten.«
»Verbrennungen?«
»Er ist in einen Quallenschwarm geraten.«
Das klang wie ein schlechter Witz. »Quallen?«
»Wir kennen keine Einzelheiten, aber ein Beamter der Küstenwache hat einen großen Schwarm beobachtet. Glücklicherweise hat er ein paar der Tiere eingesammelt. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Meeresbiologen von den Labors der Woods Hole and Northeastern University in Nahant, die uns bei der toxikologischen Analyse unterstützen.«
»Wa-was soll das heißen?«
»Dass Ihr Mann schwere Verbrennungen erlitten hat«, sagte Schwester Chapman. »Leider sieht er nicht gut aus.«
Beth nickte benommen. Dann stand die Krankenschwester auf, nahm sie am Arm und führte sie durch die Tür zur Notfallstation. Sie gingen durch einen Gang, an dessen Ende mit Vorhängen abgetrennte Betten standen. Um sie herum piepsten und summten elektronische Geräte. Vor dem dritten Abteil blieben sie stehen, und die Krankenschwester zog den Vorhang zurück. Obwohl Arzt und Schwester ihr Bestes getan hatten, um den Schock zu mildern, wäre es unmöglich gewesen, Beth auf diesen Anblick vorzubereiten.
Ihr erster Eindruck war, dass sie nicht ihren Mann, sondern eine abscheuliche, fremdartige Karikatur von ihm vor sich hatte. Jack lag mit ausgebreiteten Gliedmaßen auf einer Liege. Seine Augen waren mit Gaze abgedeckt, über seine Genitalien hatte jemand ein weißes Tuch gelegt, und seine Füße steckten in dicken Verbänden. Von sämtlichen Körperteilen – Mund, Kopf, Armen und Genitalien – führten Schläuche zu Monitoren, Geräten und Dauertropfinfusionen. Einer davon war unter seinem Schlüsselbein implantiert und an verschiedene Dauertropfinfusionen angeschlossen worden. Wirklich mulmig wurde es Beth jedoch, als sie seinen Körper sah. Er war auf die doppelte Größe angeschwollen, und Hals, Brust, Arme, Schenkel und Waden waren mit feuerroten, Flüssigkeit absondernden Striemen überzogen. Die Haut war von Kopf bis Fuß mit einer glitzernden schmerzstillenden Salbe bedeckt. Er sah aus, als wäre er brutal ausgepeitscht und dann bis zum Platzen mit Flüssigkeit aufgepumpt worden.
Die Luft entwich in kurzen, abgehackten Stößen aus Beths Lungen, während sie benommen vor Entsetzen versuchte zu verarbeiten, was aus Jack geworden war – dem attraktiven Mann mit dem dichten schwarzen Haar und den sprühenden grünen Augen, nach denen seine Schülerinnen verrückt waren. Beths Blick fiel auf die kleine Rose, die Jack zur Erinnerung an die Mutter, die er kaum gekannt hatte, auf seinem rechten Arm eintätowiert hatte. Dann brach sie in Tränen aus.
Die Schwester nahm sie in die Arme. »Ich weiß, aber zumindest ist seine Herzfrequenz stabil, und die Vitalfunktionen sind in Ordnung.«
»W-warum ist er so aufgeschwemmt?«
»Das Toxin. Dadurch sickert Wasser in Gewebe und Körperhohlräume. Deswegen hydrieren wir ihn auch.«
»Die Testergebnisse werden erst in ein paar Tagen vorliegen«, erklärte der Arzt, »aber bis jetzt zeigt sein Blutbild keine größeren Anomalien.«
»Was ist ihm zugestoßen?«
Der Arzt übernahm die Beantwortung dieser Frage. »Das Meereslabor meint, es sei eine seltene tropische Art gewesen. Bis die Giftanalyse vorliegt, behandeln wir ihn mit Steroiden und Antikonvulsiva, um ihn stabil zu halten.« Der Arzt prüfte Jacks Fieberkurve. »Seine Temperatur ist schon fast wieder normal.«
Jacks Augen waren dick verbunden, und das wenige, das sie von seinem Gesicht erkennen konnte, war zu einer rotlila Maske verquollen. Seine Lippen sahen aus, als hätte jemand mit den Fäusten darauf eingedroschen: blau, aufgedunsen, blutig und mit Desinfektionsmittel bedeckt. In seinem Hals steckte ein Trachealtubus. Bis auf die Tätowierung erinnerte nichts mehr an den Mann, mit dem sie sich vor wenigen Stunden gestritten hatte. Ihr letztes Gespräch war eine Auseinandersetzung über seine Fahrt zur Insel gewesen.
»Was ist das an seinem Kopf?« Jacks Haar war bis auf die Kopfhaut abrasiert worden, um ein Gerät zu implantieren.
»Eine ICP-Sonde. Wir messen den Schädelinnendruck.« In seinem Kopf steckte eine Art Reifendruckmessgerät, das über Leitungen mit einem elektronischen Monitor verbunden war.
»Wie manche Schlangenbisse«, erklärte der Arzt, »verursachen auch die Toxine von Meeresorganismen einen rapiden Anstieg des Blutdrucks und führen zu Gehirnblutungen.«
An einer Wand hing ein Röntgenfilmbetrachter mit Bildern, die offenbar Jacks Gehirn zeigten. Die Krankenschwester war Beths Blick gefolgt. »Wir haben eine Kernspintomografie durchgeführt, um ihn auf Ödeme ... Schwellungen und Blutungen zu untersuchen.«
»Glücklicherweise sieht es nicht so aus, als müssten wir operieren«, sagte der Arzt. »Die Entwicklung ist günstig. Der Hirndruck ist in den letzten beiden Stunden nicht mehr angestiegen.«
»Sie meinen, er hat eine Hirnblutung erlitten?«
Der Arzt nickte. »Aber wir können noch nicht beurteilen, welche Auswirkungen das hatte. Wir wissen nicht genau, wie lange er bewusstlos war. Im Augenblick behandeln wir ihn mit Steroiden, um eine Gehirnentzündung zu vermeiden. Außerdem bekommt er Antikonvulsiva gegen epileptische Anfälle. Wir bemühen uns, ihn zu stabilisieren.«
Beth nickte. Ein grauenhafter Gedanke schnitt wie eine Haiflosse durch ihr Bewusstsein: Jack trägt vielleicht einen Hirnschaden davon.
Ihr Blick wanderte über die leise piepsenden Monitore, die blinkende rote und orange Schnörkel und Kurven zeigten, die Ständer mit den Dauertropfinfusionen, das Beatmungsgerät, das Luft in seinen Hals pumpte, den Katheter-Urinbeutel, die Absauggefäße und die Sauerstofftanks neben seinem Bett. Urinschläuche führten zu irgendeinem Gerät auf dem Boden.
Ich werde ihn verlieren.
Ihr Blick blieb an dem Herzmonitor hängen. Sie arbeitete noch, die große Pumpe. Stark wie ein Pferd.
Quallen.
»Wird er durchkommen?«, fragte sie mit kaum hörbarer Stimme.
»Wir tun, was wir können«, sagte der Arzt. »Wenn sein Zustand stabil bleibt, wird er ins Massachusetts General Hospital verlegt. Dort gibt es die besten Neurologen und Geräte der Welt. Außerdem ist es für Sie nicht so weit.«
Schwester Chapman gab Beth Papiertücher, damit sie die Tränen trocknen konnte, die ihr mittlerweile über das Gesicht strömten.
»Seine Füße ...« Sie waren komplett mit Verbänden umwickelt.
»Die lagen im Wasser, als er an den Strand gespült wurde.«
Sie stellte sich vor, wie Jacks Füße stundenlang in Quallengift mariniert wurden.
Eine zweite Schwester kam mit einem Medikamententablett herein.
»Mrs Koryan, wir müssen ihn umdrehen, um seinen Rücken zu verbinden. Vielleicht warten Sie besser draußen. Falls Sie Hunger haben, wir haben eine Kaffeemaschine und eine Kantine. Folgen Sie einfach dem Gang.«
Sie wollten ihr den Anblick von Jacks Rücken ersparen. Beth nickte. Hunger hatte sie keinen, aber nachdem sie den Rest der Nacht wach sein würde, konnte sie einen Kaffee brauchen. In einer halben Stunde sollte sie zurück sein. Als sie sich zur Tür wandte, fiel ihr Blick auf Jacks Hände. Seine Finger sahen aus wie lila Würste. Sein Ringfinger war bandagiert. Dann entdeckte sie das kleine Plastiktütchen mit dem verbogenen gelben Metallstreifen auf dem Nachttisch. Die Erkenntnis entwickelte sich wie ein Polaroidfoto: Jacks Ehering. Sie hatten ihn aufgeschnitten, damit er die Durchblutung nicht abschnürte.
»Sie können ihn mitnehmen«, sagte Schwester Chapman und reichte ihn ihr.
Aber Beth schüttelte den Kopf und ging aus dem Zimmer.
Kapitel 3
Eddie Zuchowsky hatte sich schon gedacht, dass es kein guter Tag werden würde, aber so schlimm hatte er ihn sich nicht vorgestellt.
Zuerst stand er auf der Route 3 keine dreieinhalb Kilometer vom Zentrum von Cobbsville im Stau und kam deswegen erst zehn Minuten vor der Öffnungszeit am Laden an. Dann stellte er fest, dass sich zwei der Mädchen krankgemeldet hatten, was hieß, dass sie auf dem Dave-Matthews’-Konzert an der University of New Hampshire gewesen und erst um fünf Uhr früh nach Hause gekommen waren. Weil Freitag und sicher viel los war, würde Eddie die Fototheke übernehmen und gleichzeitig seine anderen Aufgaben als stellvertretender Filialleiter wahrnehmen müssen.
Und jetzt sah er auch noch auf dem Überwachungsmonitor, wie sich eine alte Dame am Cover-Girl-Regal die Taschen mit Lippenstiften vollstopfte.
Du meine Güte, das hat mir noch gefehlt, dachte Eddie.
Er starrte ungläubig auf den Monitor. Die Frau kam ihm irgendwie bekannt vor, aber er wusste nicht recht, woher. Er stellte das Bild schärfer. Dann fiel es ihm wieder ein: Clara, eine seiner Seni-Stammkunden. So nannten einige seiner Mitarbeiter die Patienten aus dem nahe gelegenen Pflegeheim Broadview. »Seni« stand für »senil«.
Das war natürlich nicht sehr nett. Als stellvertretender Filialleiter des CVS-Drogeriemarkts von Cobbsville untersagte er seinem Personal solch unfreundliche Ausdrücke. Einmal hatte er einem Jungen aus dem Lager sogar damit gedroht, ihn zu melden, weil er den Spruch »Alzies but Goodies« geprägt hatte. Eddie musste zugeben, dass er das auch witzig fand, erinnerte den Jungen aber daran, dass jeder von ihnen dereinst mit Alzheimer enden konnte.
Sie kamen häufig auf dem Rückweg von einem Baseballspiel oder einem Restaurant vorbei, wenn die Pfleger Medikamente für die Patienten abholten. Statt die alten Leute in den Minibussen sitzen zu lassen, wo sie schnell unruhig wurden, ließen sie sie im Laden herumlaufen – natürlich nur unter Aufsicht und in Gruppen. Während der eine Pfleger die Medikamente besorgte, blieben die anderen zwei bei den Patienten, die wie Schafe durch die Gänge trotteten.
Sie machten nie Ärger und belästigten auch die anderen Kunden nicht. Manchmal wurden sie ein wenig laut. Gelegentlich stieß einer einen völlig unmotivierten Ruf aus, der keinen Sinn ergab. Wenn sie in ihrer Verwirrung Angst bekamen und anfingen zu weinen, wurden sie von den Pflegern beruhigt oder nach draußen zum Bus gebracht. Einige ganz Mutige sprachen gelegentlich Kunden an, machten harmlose Bemerkungen wie geistig zurückgebliebene Kinder. Vor ein paar Wochen hatte ein Mann Allison an der Kasse gefragt, ob sein Papa wieder nach Hause kommen könne. Offenbar dachte er, er war ein Kind und Allison seine Mutter, die seinen Vater vor die Tür gesetzt hatte. »Natürlich«, hatte Allison, die nicht auf den Kopf gefallen war, gesagt, und der alte Mann hatte vor Freude gestrahlt.
Normalerweise durften sich die alten Leute eine Kleinigkeit aussuchen – ein Bilderbuch, ein Spielzeug, eine Packung Kekse, Make-up. Wenn die Artikel nicht zu teuer oder ungeeignet waren, bezahlten die Pfleger dafür, bevor sie die Patienten einsammelten und sie nach draußen zu den Minibussen zurückbrachten. (Eddie wusste mittlerweile, dass alle Heimbewohner kleine Konten hatten.) Erstaunlich war nur, dass ein Besuch in dem Drogeriemarkt, der kaum sechs Kilometer von Broadview entfernt war, für diese Leute eine große Unternehmung war – wie eine Fahrt nach Disneyland. Einige hätten den Unterschied vermutlich überhaupt nicht bemerkt.
Aber sie schienen diese Ausflüge zu genießen, und für das Geschäft war es auch gut, weil es der Stadt zeigte, wie sozial CVS eingestellt war. Im Laufe der Monate hatte Eddie einige der Heimbewohner unterscheiden gelernt – wie Clara, die keine zierliche alte Dame, sondern eine große, stämmige Frau mit einem runden, flachen Gesicht war. Sie sprach nicht viel, sondern schlurfte an der Hand des Pflegers durch die Gänge und musterte die Regale. Was auch immer man zu ihr sagte, die Antwort lautete stets »Ja.«
»Hallo, Clara. Alles in Ordnung?«
»Ja.«
»Geht es Ihnen gut?«
»Ja.«
»Sie haben aber ein schönes Kleid.«
»Ja.«
»Hätten Sie gern eine Schüssel Würmer zum Essen?«
»Ja.«
Eddie ließ die Fototheke im Stich und machte sich unverzüglich auf den Weg zu Gang 1A. Aber als er um die Ecke bog, erstarrte er.
Clara stand noch am Cover-Girl-Regal. Für einen Augenblick dachte er, sie würde aus dem Mund bluten, aber dann begriff er, dass sie ihr Gesicht mit Lippenstift beschmiert hatte. Sie stöhnte furchterregend, und auf dem Boden lagen glänzende Lippenstifthülsen und Packungen von Scheren mit bunten Griffen – diese Woche im Sonderangebot für drei Dollar neunundneunzig. Aus Claras Hüfttasche ragte eine große rosa Schere, die andere Tasche war zum Platzen voll mit Lippenstiften.
»Clara, was tun Sie da? Lassen Sie das!«
Und wo zum Teufel sind die Pfleger? Die Frau ist ja wahnsinnig.
Und sie stinkt. Ihre Füße und Beine sind schlammig. Hat sie die Nacht im Wald verbracht? Außerdem richtet sie hier ein totales Chaos an.
Aber Clara war vollauf damit beschäftigt, sich einzuschmieren und zu stöhnen. Ihre Augen rollten unkontrolliert. Du lieber Himmel, das ist ja furchtbar.
Am anderen Ende des Ganges entdeckte Eddie eine junge Mutter mit zwei kleinen Kindern.
»Schluss damit, Clara!«, rief Eddie. Er musste die Pfleger anpiepsen. Allison oder eine der älteren Verkäuferinnen sollten sich um die Frau kümmern. Die Situation war völlig außer Kontrolle, und er wollte die Frau nicht anfassen. Sie hatte eindeutig den Verstand verloren.
Plötzlich entdeckte sie ihn. Ihre Augen weiteten sich, und Eddie spürte geradezu körperlich die Aggressivität, die von ihr ausging.
»Donny Doh, tsee-tsee go.«
»Was?«
»Donny Doh, tsee-tsee go«, krächzte sie wieder und wieder, bis sie schließlich brüllte. Ihr großflächiges rotes Gesicht war verzerrt, und ihr fleischroter Mund schleuderte ihm ohne Unterlass »Donny Doh, tsee-tsee go« entgegen.
Verdammter Mist! Das kann ich wirklich nicht brauchen. »Clara, hören Sie auf. Es ist gut. Es kommt alles in Ordnung.«
Die Mutter am Ende des Ganges schnappte sich ihre Kinder und verschwand eilig in die andere Richtung.
Wo zum Teufel sind die Pfleger?
Audrey, eine der älteren Verkäuferinnen, hatte den Lärm gehört und eilte in den Gang. »Ach, du lieber Himmel!«
»Donny Doh, Donny Doh, tsee-tsee go, tsee-tsee go.«
Clara beachtete Audrey, die sich ihr von hinten näherte, überhaupt nicht. Ihr Kopf hatte sich in eine riesige rote Melone verwandelt, und ihre Augen traten derart hervor, dass Eddie fürchtete, sie könnten ihr aus dem Kopf springen. Sie sah aus, als wäre sie besessen.
»Clara, hören Sie auf!«
Aber Clara hörte nicht auf, im Gegenteil, sie fing jetzt an, sich zu reiben, wobei sie ihr Kleid mit Lippenstift beschmierte. Der Gang war erfüllt von ihrem entsetzlichen Stöhnen.
»Rufen Sie die Polizei«, rief Eddie Audrey zu. »Schnell!« Dann wandte er sich Clara zu. »Clara, hören Sie auf! Hören Sie auf damit!«
»Tsee-tsee go!«
In dem verzweifelten Versuch, sie zu beruhigen, streckte er die Hand nach ihr aus. Hinter sich hörte er Rufe – Kunden, weitere Angestellte, vielleicht die Pfleger, dachte er.
Als er sich umsah, nahm er aus dem Augenwinkel einen rosa Blitz wahr. Immer noch den hässlichen Babyreim kreischend, den er mit ins Grab nehmen sollte, stürzte sich Clara auf ihn und rammte ihm die spitze Scherenklinge in den Hals.
In dem allgemeinen Gebrüll und Aufruhr versuchte Eddie einen langen, gurgelnden Augenblick lang zu verstehen, dass ihm eine über siebzigjährige Alzheimerpatientin, deren Gesicht mit Cover Girl Rose Blush verschmiert war und die ihm einen unsinnigen Reim entgegenschrie, eine Schere mit rosa Griffen für drei Dollar neunundneunzig in den Hals gestoßen hatte.
Er sank auf die Knie. Gesichter drehten sich vor seinen Augen, und Gebrüll verstopfte seinen Kopf. Er drückte die Hand an seinen Hals und spürte die Schere und das klebrige warme Blut, das durch seine Finger sickerte. Das Letzte, was er bemerkte, war, dass ihn jemand auf den Boden legte. Das kühle Licht der Leuchtstoffröhren verwandelte sich in eine weiche, verschwommene Dämmerung, als das Leben aus seiner Halsschlagader entwich.
»Donny Doh, tsee-tsee go.«
Kapitel 4
Jack schlief die nächsten beiden Tage und Nächte durch, ohne dass sich etwas veränderte.
Beth verließ das Cape Cod Medical Center erst, als sich Jacks Zustand so weit stabilisiert hatte, dass er auf die Intensivstation des Massachusetts General Hospital in Boston verlegt werden konnte. Da sie nicht im Hubschrauber mitfliegen konnte, fuhr sie mit dem Auto. Sie legte einen Zwischenstopp zu Hause in Carleton ein, um sich umzuziehen und Vince Hammond zu informieren. Er bot ihr an, sie zu begleiten, aber sie lehnte ab. Jack hätte nicht gewollt, dass ihn jemand in diesem grässlichen Zustand sah.
Während Jack vorbereitet wurde, wartete Beth in der Lobby der Intensivstation. Seit dem furchtbaren Anruf waren vierzig Stunden vergangen, aber sie konnte es immer noch nicht glauben. Ziellos blätterte sie in Illustrierten und Zeitungen. Die Schlagzeilen des Boston Globe sprachen vom Krieg im Irak, einem weiteren Selbstmordattentat in Israel und einer Schießerei in Dorchester. Die üblichen Schrecken. Aber unten auf der ersten Seite stach ihr der Titel »Pflegeheimpatientin wegen Mordes verhaftet« ins Auge. Offenbar hatte eine Sechsundsiebzigjährige den Filialleiter des örtlichen CVS-Drogeriemarkts mit einer Schere angegriffen und getötet. Zeugen berichteten, die Frau habe sich merkwürdig verhalten. Als der Filialleiter nachsehen wollte, was los war, habe ihm die Frau eine Schere in die Halsschlagader gestoßen. »Es scheint völlig sinnlos«, wurde Captain Steven vom Manchester Police Department zitiert. »Clara Devine war eine friedliche alte Dame.«
Alles ist sinnlos, dachte Beth und legte die Zeitung beiseite.
Nach fast einer Stunde kam eine Krankenschwester namens Laura Maffeo und teilte ihr mit, sie könne zu ihrem Mann.
»Wie geht es ihm?«, fragte Beth.
»Er schläft immer noch, aber sein Zustand ist stabil.« Die Krankenschwester führte Beth zu einem Zimmer weiter hinten im Gang. Jack hing in einer Vorrichtung, die aussah wie ein mittelalterliches Foltergerät in Chrom. Sein Körper steckte zwischen zwei Plattformen, die an einem großen runden Rahmen befestigt waren. Beth fühlte sich an ein riesiges Hamsterrad erinnert. Eine der beiden Schwestern drückte einen Knopf, und das Gebilde, das die Schwester später als Rotationsbett bezeichnete, drehte Jack um ein paar Grad, sodass er auf dem Rücken lag.
»So können wir Rücken und Vorderseite verbinden, ohne ihn bewegen zu müssen.«
Obwohl Beth ihn vor kaum achtzehn Stunden zuletzt gesehen hatte, war sein Aussehen an diesem Morgen ein Schock für sie. Jacks Körper war nach wie vor aufgedunsen und mit dicken roten und lila Striemen überzogen. Rumpf und Gliedmaßen waren mit einer dicken weißen Salbe bedeckt. Seine Augen waren immer noch verbunden, und er war an ein halbes Dutzend elektronische Monitore, Dauertropfinfusionen, Katheter und intravenöse Verweilkanülen angeschlossen. An seinem Kopf war mit Klebeband eine ICP-Sonde befestigt. Er wurde weiterhin beatmet. Das Gerät knackte und zischte in einem beharrlichen Rhythmus. Jacks Brust hob und senkte sich, als spielte er ein merkwürdiges Blasinstrument. Umgekehrt sah es aus, als spielte die Maschine auf ihm, als wäre Jack ein Sack, ein aufblasbares Michelin-Männchen, das von der Maschine aufgepumpt wurde.
»Die meisten seiner Vitalfunktionen sind stabil«, sagte die Krankenschwester. »Sein Herz ist stark. Leber und Nieren arbeiten gut. Wir haben ihm Medikamente gegeben, um den Blutdruck auf einem normalen Niveau zu halten.«
Eine Frau in Weiß betrat den Raum und stellte sich als Dr. Vivian Heller, Neurologin, vor. Sie war hochgewachsen und schlank, hatte dichtes rotes Haar, das sie zurückgebunden trug, und große, dunkle Augen. »Mrs Koryan, es tut mir leid, dass es Ihrem Mann so schlecht geht, aber wir überwachen ihn genau. Bisher ist sein Zustand ziemlich stabil. Die Leute von Woods Hole haben die Quallen als eine in der Karibik heimische Art identifiziert und stehen in Kontakt mit Spezialisten in Jamaika. Die Giftanalyse ist noch nicht abgeschlossen. Bis jetzt sind die Wirkstoffe nicht vollständig identifiziert, wobei das Gaschromatogramm ungewöhnliche Spitzen zeigt. Das Labor bemüht sich, die chemische Struktur zu isolieren.«
Beth sah sie hilflos an. »Ich verstehe kein Wort.«
»Das soll nur heißen, dass es sich um eine merkwürdige, neurotrope Signatur handelt, die uns bis jetzt nicht begegnet ist. Aber es ist denkbar, dass sein Körper die Substanz bereits ausgeschieden hat, bis wir sie identifiziert haben. In der Zwischenzeit überwachen wir die lebenswichtigen Organe und versuchen, das Ausmaß der Schädigung abzuschätzen.«
»Wird er ... Soll das heißen, dass er bleibende Schäden davontragen wird?« Beth brachte die Frage kaum über die Lippen.
»Wir glauben, dass die Sauerstoffversorgung eine Zeit lang unterbrochen war, aber wir wissen noch nicht, wie sich das auswirkt. Es kam anfänglich zu einer Hirnblutung, doch die hat aufgehört, und der Schädelinnendruck ist wieder auf normale Werte gesunken.«
Der ganze Fachjargon verwirrte Beth. Sie blickte auf Jack herunter. »Warum wacht er nicht auf?«
»Weil sein Nervensystem schwer geschädigt wurde. Wir wissen noch nicht, was das für Folgen haben wird. Wir können nur abwarten.«
»Aber wie lange?«
»Es kann noch einige Tage dauern, bis er aufwacht. Bis jetzt hat er noch nicht auf Anweisungen oder Reize reagiert. Aber das ist angesichts der Schädigung nicht ungewöhnlich.«
»Wie lange muss er noch beatmet werden?«
»Bis wir sicher sind, dass er selbst atmen kann.«
Ein Telefonanruf unterbrach das Gespräch. Schwester Maffeo nahm ab. »Ein Vince Hammond möchte Ihren Mann besuchen.«
Beth nickte erleichtert. »Das ist ein Freund von uns.«
Eine Minute später kam er ins Zimmer. Vince Hammond war groß, etwa einen Meter fünfundachtzig, und besaß einen athletischen Körperbau, den er sich in langen Jahren des gemeinsamen Fitness-Trainings mit Jack erworben hatte. Aber als er Jack sah, schien er in sich zusammenzufallen. »Gütiger Himmel!«, flüsterte er, während ihm die Tränen in die Augen traten. »Wie ist die Prognose?«
Dr. Heller wiederholte, was sie Beth gesagt hatte. »In einigen Tagen werden die Schwellung und die Hautreizungen zurückgehen.«
Vince schüttelte ungläubig den Kopf. Er konnte es nicht fassen, dass das sein alter Freund und Partner sein sollte, der in weniger als einem Monat zur großen Eröffnung des »Yesterdays« die Champagnerkorken knallen lassen wollte. »Was glauben Sie, wie lange er bewusstlos bleibt?«
»Wie ich Mrs Koryan schon erklärt habe, lässt sich das schwer sagen. Bei Komapatienten, die fast ertrunken sind oder einen toxischen Schock erlitten haben, werden in einem Zeitfenster von zweiundsiebzig Stunden Reaktionen auf Reize beobachtet. Wir behalten ihn ständig im Auge.«
»Mhm«, sagte Vince und legte den Arm um Beths Schulter.
Beth nickte der Ärztin reflexartig zu, aber das Wort »Komapatient« zuckte wie ein Lichtbogen durch ihr Gehirn.
Die Cafeteria des Massachusetts General Hospital lag drei Stockwerke tiefer. Jetzt, am Nachmittag, saßen nur wenige Menschen an den Tischen. Vince und Beth entschieden sich für einen kleinen Tisch an der hinteren Wand.
»Ich habe Angst«, sagte Beth und streckte die Hand nach Vince aus, der sie mit beiden Händen nahm. Ihr fiel ein, wie sie sich das letzte Mal so an den Händen gehalten hatten. Damals war Vince zu ihnen nach Hause gekommen, um ihnen zu sagen, dass er und Veronica sich trennen würden. Jetzt ging es um Jack, der mit dem Tod rang.
»Natürlich hast du Angst. Ich auch. Was zum Teufel hatte er da draußen zu suchen?«
»Es war der Todestag seiner Mutter. Kannst du dir das vorstellen? Sie verschwindet vor dreißig Jahren bei einem Bootsunfall, und er fährt da raus, um ihrer zu gedenken.« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn es um seine Mutter geht, ist er komisch. Dabei kann er sich noch nicht einmal an sie erinnern. Es war idiotisch, bei aufziehendem Sturm allein hinauszufahren. Dafür liegt er jetzt im Koma.«
»Er kann jederzeit aufwachen. Das hat die Ärztin selbst gesagt.«
»Und wenn nicht? Was soll ich dann tun? Was ist mit dir und dem Restaurant? Ich kann es einfach nicht fassen.« Sie fing erneut an zu weinen.
Er drückte ihr die Hand. »Komm, halt durch.«
»Es ist meine Schuld, dass er gefahren ist. Wir hatten einen Streit, einen dummen Streit. Seit ich das Baby verloren habe, redet er sich ein, dass wir nie Kinder haben werden, dass er nie Vater sein wird. Das macht ihm zu schaffen, weil er sich eine große Familie wünscht. Ach, ich weiß auch nicht ...«
Vince nickte und ließ sie weiterreden.
»Er wollte, dass ich mitkomme, aber ich hatte keine Lust. Da ist er wütend geworden und beleidigt weggefahren.« Sie trocknete sich die Augen. »Quallen. Kannst du dir das vorstellen?«
»Habt ihr über eine Adoption nachgedacht?«
»Das wollte er nicht. Außerdem hatten wir andere Probleme. Zwischen uns lief es nicht gut ... Ich dachte daran, ihn zu verlassen.«
»Vielleicht wechseln wir besser das Thema.«
»Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Aber wenn er nicht überlebt, kann ich ihm nie sagen, dass es mir leid tut.«
»Er kommt durch. Dann kannst du ihm alles erklären, was du auf dem Herzen hast.«
Sie sah Vince an und nickte. In ihr kämpften düstere Empfindungen, die sie nur zu gern losgeworden wäre. Aber sie konnte es nicht. Und die richtigen Worte konnte sie auch nicht finden. Wie hätte sie Vince erklären können, was sie selbst nicht verstand – dass ihre erste Reaktion Erleichterung gewesen war, als die Ärzte ihr mitgeteilt hatten, Jack würde vielleicht nicht überleben?
Kapitel 5
Es war kurz nach acht am Samstagmorgen, als das schrille Klingeln der Türglocke René aus dem Schlaf riss. Silky, ihre schwarzweiße Katze, strich ihr um die Beine, während sie barfuß ans Fenster ging. In ihrer Einfahrt stand ein Streifenwagen, der dem Kennzeichen nach aus Cobbsville, New Hampshire, stammte.
Sie warf sich einen Bademantel über, gurgelte kurz mit Mundwasser und ging nach unten zur Haustür. Ein großer Mann um die vierzig stellte sich lächelnd als Officer Steven Menard von der Mordkommission des Manchester Police Department vor. Er trug ein marineblaues Sportsakko, ein blaues Arbeitshemd und eine Chinohose. »René Ballard?«
»Ja.«
Er zeigte ihr seine Marke. »Tut mir leid, dass wir Sie stören müssen, aber wir ermitteln wegen der Ermordung von Edward Zuchowsky im CVS gestern. Sagt Ihnen der Name etwas?«
»Nein. Wie war das noch einmal?«
»Edward Zuchowsky.«
»Tut mir leid, aber von dem habe ich noch nie gehört.«
»In Ordnung. Kann ich trotzdem hereinkommen und Ihnen ein paar Fragen stellen?«
»Natürlich.« René öffnete die Tür. Silky flitzte nach draußen, als der Beamte das Haus betrat. René führte Menard ins Wohnzimmer, wo er auf der Couch Platz nahm.
Er entnahm einer Mappe ein vergrößertes Foto von einem Mann, der mit einem Billardstock in der Hand in einer Art Hobbykeller stand und lächelte. »Edward Zuchowsky. Er war stellvertretender Filialleiter des CVS von Cobbsville.«
René sah sich das Bild genau an und schüttelte den Kopf. »Tut mir leid, aber den kenne ich nicht.«
Der Beamte nickte und legte das Foto wieder in die Mappe. »Gut. Sagt Ihnen der Name Clara Devine etwas?«
»Clara Devine?« Seit zwei Monaten überwachte René als beratende Apothekerin die Medikamentenversorgung von fast sechshundert Patienten in Pflegeheimen im südlichen New Hampshire und östlichen Massachusetts. Im Augenblick waren die meisten für sie nur Namen auf Aktendeckeln. Der Beamte zeigte ihr ein Bild einer älteren Frau mit ausdruckslosen dunklen Augen und einem breiten Gesicht.
Er warf einen Blick auf sein Klemmbrett. »Sie war in Broadview untergebracht.«
»Das ist eines meiner Heime.« Clara Devine. Der Name löste keine Erinnerung aus. »Ich muss in meinen Aufzeichnungen nachsehen. Ich mache das noch nicht lange.« Sie lächelte nervös. Es war ihr peinlich, dass sie den Namen einer Patientin nicht zuordnen konnte. »Gibt es ein Problem?«
»Sie wurde wegen Mordes an Mr Zuchowsky verhaftet.«
»Was?«
»Sie hat ihm im CVS in der Everett Street eine Schere in den Hals gestoßen.«
»Mein Gott, das ist furchtbar! Sind Sie sicher, dass es sich um dieselbe Frau handelt? Die meisten meiner Patienten sind alt und dement.«
»Es waren mehrere Zeugen zugegen. Außerdem wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt.«
»Das ist unglaublich.« René stand auf und holte ihren Laptop, auf dem sie Krankengeschichte und medikamentöse Versorgung ihrer Patienten gespeichert hatte. Sie stellte den Laptop auf einen Tisch und begann mit der Suche. »Das mit dem jungen Mann tut mir sehr leid, aber ich kann kaum glauben, dass jemand wie Mrs Devine so etwas getan hat.« Sie scrollte durch ihre Dateien.
»Da sind Sie nicht die Einzige. In welcher Eigenschaft sind Sie für Broadview tätig?«
»Ich bin beratende Apothekerin für CommCare.«
»Was ist das?«
»CommunityCare, eine Apotheke, die Patienten in Pflegeheimen und Rehakliniken mit Medikamenten versorgt. Laut Bundesgesetz müssen sämtliche Krankenblätter jeden Monat von einem Apotheker geprüft werden. Das ist mein Job: Ich suche die Pflegeheime ein- oder zweimal pro Monat auf, um mir die Krankenblätter im Hinblick auf eventuelle Probleme mit der Verabreichung von Medikamenten anzusehen. Wenn ich solche Probleme erkenne, empfehle ich dem Arzt der Patienten eine Umstellung.«
»Interessant. Und wenn der Arzt mit Ihren Empfehlungen nicht einverstanden ist?«
»Das ist natürlich sein gutes Recht, aber laut Bundesgesetz muss er sich trotzdem daran halten.«
»Aha. Wie gut kennen Sie die Patienten?«
»Na ja, meine Informationen entnehme ich in erster Linie der Krankengeschichte und den Gesprächen mit dem Personal der Pflegeheime. Manche Patienten lerne ich aber auch persönlich kennen.«
»Wann waren Sie zuletzt in Broadview?«
»Vor etwa drei Wochen.«
»Und Sie sagen, Sie kannten die Täterin nicht?«
Täterin. Es fiel ihr schwer, sich die alte Frau auf dem Bild als Täterin vorzustellen. Ein Täter war für sie ein Gangster im T-Shirt. »Ich kenne sie nicht.«
»Aber sie ist eine Ihrer Patientinnen.« Das klang vorwurfsvoll.
»Sie steht auf meiner Liste. Sie sagten, der Mord hat sich im Drogeriemarkt ereignet. Wo waren denn die Pfleger? Patienten dürfen das Heim nur unter Aufsicht verlassen.«
Menard sah zu ihr auf. »Sie war allein.«
»Allein? Wie war das möglich?«
»Es war niemand vom Heim bei ihr.«
»Aber die Patienten dürfen ihre Station nicht ohne Begleitung verlassen. Wie ist sie aus dem Heim herausgekommen?«
»Das wüssten wir auch gern.«
René bildete mit den Lippen ein stummes »O«, um zu signalisieren, dass sie verstanden hatte. »Sie gehen davon aus, dass sie weggelaufen ist?«
»Das vermuten wir.«
»Aber ... das ist unmöglich.«
»Trotzdem ist genau das passiert.« Menard schlug ein paar Seiten auf seinem Klemmbrett um. »Könnten Sie bitte Ihre Aufzeichnungen überprüfen? Laut Pflegepersonal bekam Mrs Devine keinerlei Psychosemittel. Ist das richtig?«
René scrollte durch Clara Devines Akte. Die Frau hatte leichte Herzprobleme, hohen Blutdruck, zu hohe Cholesterinwerte sowie eine Depression und mäßige Demenz. Ihre Schwester hatte sie vor einem Jahr im Alter von zweiundsiebzig Jahren in Broadview einweisen lassen. Laut Unterlagen war diese Schwester, eine gewisse Cassandra Gould aus Dudley, New Hampshire, die einzige lebende Verwandte. Clara war Mündel des Bundesstaates, was bedeutete, dass ihre Schwester keine Vollmacht für sie hatte haben wollen. »Wie Sie wissen, darf ich ohne Durchsuchungsbeschluss keine Einzelheiten weitergeben. Auch ihre Medikamente sind vertraulich.«
»Natürlich, aber darum kümmern wir uns, wenn es so weit ist.« Reiten Sie bloß nicht auf den Vorschriften herum, sagte sein Blick.
Sie wussten beide, dass er die Aufzeichnungen beschlagnahmen lassen konnte, aber das würde dauern. Er wollte wissen, ob Clara Devine Medikamente bekommen hatte, die Wahnvorstellungen auslösen konnten. Sie scrollte die Liste herunter: Atorvastatin, um die Cholesterinwerte zu senken, Hydrochlorthiazid, Atenolol, Captopril und schwach dosiertes Aspirin für die Herzerkrankung und den hohen Blutdruck, Paroxetin gegen die Depression, Donepezil für die Demenz. Für eine ältere Pflegeheimpatientin war eine solche Liste Standard. Manche dieser Mittel konnten zwar den Geisteszustand beeinträchtigen, aber keines davon löste explosive Mordlust aus. Laut diesem Profil bekam Clara Devine seit Monaten dieselbe Dosis, was die Wahrscheinlichkeit weiter verringerte, dass eines der Medikamente ihre plötzliche mörderische Aggressivität ausgelöst hatte. »Sieht mir wie die übliche Wäscheliste für ältere Patienten aus.«
»Nichts, was einem ins Auge springt?«
»Nichts.« Dann blätterte sie vor zum aktuellen Datum. Plötzlich stieß sie auf eine Lücke. Sie scrollte zurück und überprüfte ihre Aufzeichnungen noch einmal. »Das ist merkwürdig«, sagte sie.
»Was ist merkwürdig?«
In den vergangenen sechs Monaten erschien Clara Devine nicht mehr auf Renés Patientenliste. Die letzten Bestellungen stammten vom Februar. René fühlte, dass Menard sie nicht aus den Augen ließ. Er wartete auf eine Erklärung. Wenn sie überreagierte, würde er wissen wollen, wie es möglich war, dass in ihren Aufzeichnungen ein halbes Jahr fehlte. Dann würde er sich in Broadview beschweren, und bevor sie wusste, wie ihr geschah, würden sich ihre Vorgesetzten bei CommCare fragen, wieso sie sie eingestellt hatten. »Ein kleiner Computerirrtum«, behauptete sie. »Soweit ich sehen kann, hat sie keine Medikamente bekommen, die ein solches Verhalten auslösen könnten.«
»Gibt es Hinweise auf psychotisches Verhalten auf der Station oder vor der Einweisung?«
René überprüfte die Eintragungen des Pflegepersonals bis zu der Lücke. Sie fühlte, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. »Nein. Sie scheint sich ziemlich gut benommen zu haben.« Einige der Notizen brachten sie zum Lächeln. »Anscheinend hat sie sich ein paar merkwürdige Reime einfallen lassen.« Sie las vor: »›Rosen sind rot, Veilchen sind blau, und meine Titten sind eine Schau! Wir haben laut gelacht‹, hat eine Schwester geschrieben. Außerdem hat sie behauptet, ein Kind zu bekommen. Klingt nicht nach jemandem, der einen Wildfremden angreifen würde.«
»Nein, aber offenbar hatte sie Wahnvorstellungen.«
»Das trifft auf viele Demenzpatienten zu, aber deswegen werden sie nicht gewalttätig.«
Menard legte die Hand mit dem Stift auf das Klemmbrett. »Und was glauben Sie, ist passiert, Miss Ballard?«
»Ich habe keine Ahnung.« Auf jeden Fall würde sie sich die Original-Krankenblätter im Heim ansehen. Vielleicht war ihr etwas entgangen. Außerdem wollte sie eine Erklärung dafür, warum in ihren Daten eine Lücke von sechs Monaten klaffte. Besorgt wegen der Unstimmigkeiten, klappte sie den Laptop zu. Sie war stolz auf ihre genauen Aufzeichnungen gewesen, auf ihre Fähigkeit, sich Hunderte von unaussprechlichen Silben, aus denen das Arzneimittelbuch bestand, und die technischen Einzelheiten komplexer chemischer Strukturen sowie deren Wirkung und Nebenwirkungen zu merken. Sie hatte sich bemüht, Namen und Gesichter mit den Unmengen von Daten in Verbindung zu bringen. Trotzdem fehlten ihr die Unterlagen einer Patientin, die im Mittelpunkt einer Morduntersuchung stand. »Was passiert jetzt mit ihr?«
»Sie wird zur Begutachtung ins McLean Hospital geschickt.«
Das McLean Hospital in Belmont, Massachusetts, gehörte zur medizinischen Fakultät von Harvard und war eines der führenden psychiatrischen Krankenhäuser der Vereinigten Staaten. Gefährliche Patienten wurden dort begutachtet.
Menard stand auf und ging zur Tür. An einem Tisch mit Fotos blieb er stehen. Eines davon zeigte René mit Akademikerhut und Robe neben ihren Eltern und Nick Mavros, ihrem Lieblingsprofessor an der New England School of Pharmacy. Daneben standen Bilder ihres Vaters vor seiner Erkrankung. Eines davon zeigte ihn als kleinen Jungen in einem Schaukelstuhl – ein Foto, das sie besonders liebte. Menard griff nach einer Nahaufnahme von Silky. »Ist das die Katze, der ich vorhin begegnet bin?«
»Ja, das ist Silky.« Das Bild hätte gut als Steckbrief in einer Mäusepost hängen können, so bedrohlich blickte der langhaarige, schwarz getigerte Kater mit dem weißen Fleck auf der Nase drein. Im Moment war der kleine Gauner im Garten auf der Jagd nach Backenhörnchen.
»Nur zur Information: Leben Sie allein?«
Bei der Frage wurde ihr unbehaglich zumute. Bis vor wenigen Monaten hatte sie mit Todd in Boston gewohnt und ihre Hochzeit für den Juni geplant – für den 26. Juni, um genau zu sein. Nachdem sie fast zwei Jahre zusammengelebt, das Brautkleid gekauft, den Mietsmoking reserviert, Businessclass-Flüge mit Delta nach Maui, ein Zimmer mit Meerblick im Kapalua Bay Hotel, die Spezial-Katamaran-Kreuzfahrt für Flitterwöchner in den Sonnenuntergang einschließlich Mai-Tai-Cocktails gebucht hatten und hundertzwanzig Einladungskarten mit der Aufschrift »René und Todd« hatten drucken lassen, war der liebe Todd in letzter Minute von Panik ergriffen worden. Er war zurück nach New Jersey gezogen und hatte die Beziehung zu seiner Freundin von der Highschool wieder aufgenommen.
Wenn es nicht so wehgetan hätte, sitzen gelassen zu werden, hätte sie es geradezu komisch gefunden. In den neunundzwanzig Jahren ihres Lebens war René noch nie jemandem begegnet, der kurz vor der Hochzeit versetzt worden war. Sie hatte Todd angebrüllt, ihm Vorwürfe gemacht, aber er war trotzdem gegangen. Nachdem sie drei Monate lang ihre Wunden geleckt hatte, hatte sie ihre Stelle in einer nahen Apotheke gekündigt. Nick Mavros hatte ihr den Job bei CommCare vermittelt, der sie nach Dover Falls geführt hatte. Hier lebte sie nun in einer umgebauten Scheune, die nur mit dem Notwendigsten ausgestattet war. Damals hatte René beschlossen, dass sie Todd nicht brauchte. Sie wollte die Trennung als Gelegenheit betrachten, ihrem Leben einen neuen Sinn zu geben und sich für eine gute Sache einzusetzen – für etwas, das größer war als sie selbst und dem Wohlergehen anderer diente. »Ja, ich lebe allein.«
Er bedankte sich und reichte ihr seine Karte. »Falls Ihnen doch noch etwas einfällt, das erklären könnte, was Claras Verhalten ausgelöst hat oder wie sie aus dem Heim entkommen konnte ...«
»Sie haben das bestimmt schon überprüft, aber funktioniert die Sicherheitstür richtig?«
»Die ist völlig in Ordnung, das haben wir kontrolliert.«
»Und es hat sie auch kein Angehöriger abgeholt.«
»Nichts in der Art. Und das Fenster hat sie auch nicht eingeschlagen.«
Und ich muss erklären, wieso in meinen Aufzeichnungen sechs Monate fehlen.
Kapitel 6
Der Artikel erschien unten auf der Titelseite. »Seniorin aus dem Pflegeheim ersticht Drugstore-Manager in Cobbsville.« Es wollte einfach keinen Sinn ergeben.
René kaufte die Zeitung und fuhr nach Broadview. Das Pflegeheim war in einer hübschen, im Stil eines neuenglischen Dorfes gehaltenen Anlage untergebracht. Die Alzheimer-Station befand sich in einem neu renovierten Flügel im hinteren Bereich des Komplexes. Sie parkte den Honda und ging nach drinnen, wo sie der Rezeptionistin grüßend zuwinkte. Die Anspannung war schon in der Lobby spürbar. Es herrschte eine Stille wie vor einem Gewitter. Pflegepersonal und andere Mitarbeiter tauschten geflüsterte Bemerkungen aus, wenn sich ihre Wege kreuzten.
René ging zur Alzheimer-Station. Eine merkwürdige Vorahnung erfüllte sie, als sie den vierstelligen Code auf der Tastatur eingab. Die elektrisch betätigte Verriegelung öffnete sich, und René trat auf die Kreuzung zwischen zwei Gängen. In einem Korridor saßen mehrere Patienten in Rollstühlen, die mit leerem Blick vor sich hin starrten, während andere an den Wänden entlangschlurften. Im anderen Gang unterhielt sich Carter Lutz, der medizinische Leiter von Broadview, mit einem großen, schwarzhaarigen Mann, in dessen Sportsakko ein Monogramm eingestickt war. Bei Renés Anblick verschwanden die beiden in einem kleinen Büro und schlossen die Tür hinter sich.
Alice Gordon, die Stationsschwester, saß an ihrem Schreibtisch. »Hallo! Ich dachte, Samstag wäre Ihr freier Tag.«
»Normalerweise schon, aber die Polizei war gerade bei mir zu Hause.«
Das Lächeln verschwand so schnell, wie es gekommen war. »Dann haben Sie es also schon gehört«, flüsterte sie. »Gestern Abend wimmelte es hier nur so von Polizisten.«
»Wie konnte das passieren?«
Alice Gordon zuckte nur die Achseln und wandte den Blick ab. »So was kommt eben vor.«





























