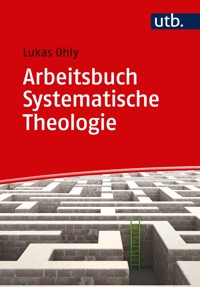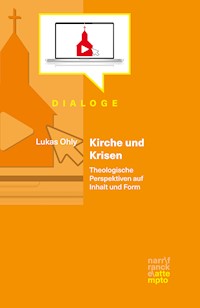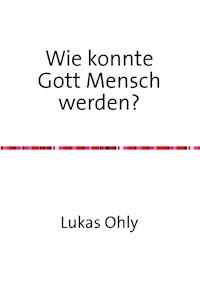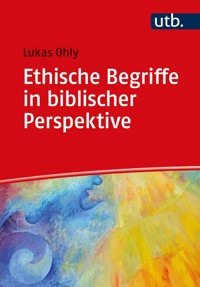
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Wie verhalten sich ethische Argumente zu biblischen Texten und welche normativen Schlüsse lassen sich aus biblischen Motiven ziehen? Mittels 30 ethischer Begriffe informiert dieses Buch zügig über eine biblische Perspektive. Zu jedem Begriff wird die aktuelle Diskurslage zum jeweiligen Thema skizziert. Darauf folgt ein biblischer Abschnitt, der interpretiert und zur Deutung des jeweiligen Grundbegriffs zugespitzt wird. Die Auswahl wird begründet und mit biblischen Alternativtexten konfrontiert. Die Interpretationen werden zu den biblischen Texten aktuell situiert. Leser:innen erhalten schnelle Informationen über ethische Probleme und ihre gegenwärtigen Lösungsansätze. Zugleich bietet das Buch einen Zugang zur Debatte, welche Rolle biblische Texte in ethischen Diskursen überhaupt noch spielen können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Ethische Begriffe in biblischer Perspektive
Lukas Ohly
Narr Francke Attempto Verlag · Tübingen
Umschlagabbildung: angel with trumpet and light rays, mammuth, Stock-ID: 482783447 © iStock
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
utb-Nr. 5809
ISBN 978-3-8385-5809-7 (Print)
ISBN 978-3-8463-5809-2 (ePub)
Inhalt
Für Catharina
Einleitung
In der theologischen Ethik spielt die Bibel aktuell nur noch eine unbedeutende Rolle. Die Zeit, in der die biblischen GeboteGebot auf Themen unserer Zeit angewendet wurden, ist vorbei. Man wittert fundamentalistische Motive, wenn man Abtreibung oder Homosexualität verbieten will mit unmittelbarem Bezug auf biblische Texte. Es stimmt auch: Man müsste zunächst mehrere Probleme lösen, bevor man die biblischen Gebote unmittelbar für heutige Konflikte anwendet. Zum einen müsste man klären, ob göttliche Gebote deshalb ethisch gerechtfertigt sind, weil sie von GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) stammen. Und indem man das klärt, verlässt man bereits den Ansatz, Gott zum Ursprung ethischer Rechtfertigung zu erheben. Daher müsste man, um diesen Widerspruch zu vermeiden, die Bibel fundamentalistisch lesen: Man darf dann nicht die Frage stellen, ob die göttlichen Gebote ethisch gerechtfertigt sind. Sie werden dann aber auch nicht für richtig gehalten, weil sie ethisch wären, sondern weil sie von Gott stammen. Eine fundamentalistische Position wehrt also die Aufgabe der Ethik ab, moralische Aussagen daraufhin zu überprüfen, ob sie sich ethisch rechtfertigen lassen.
Das zweite Problem, biblische GeboteGebot unmittelbar zu verwenden, besteht darin, unterstellen zu müssen, dass die biblischen Gebote von GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) stammen. Historische Forschung jedoch gibt keinen Hinweis darauf. Die Entstehung der biblischen Gebote ist vielschichtig. Sie stammen aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturen, sind teilweise den Religionen der UmweltUmweltIsraelsIsrael/Juden entnommen und nicht an einem Ort am Berg Sinai Mose übermittelt worden. Und auch die Bergpredigt Jesu (Mt 5–7Mt 5–7), der wohl prägnanteste ethische Text des Neuen TestamentsTestamentNeues, ist nur eine Stilisierung des Matthäusevangeliums und fasst dabei gesammelte JesusJesus Christus-Worte aus unterschiedlichen Gelegenheiten und Quellen zusammen, von denen man nicht einmal sicher sein kann, ob sie Jesus wirklich gesprochen hat. Man vergleiche nur einmal die Bergpredigt mit der Feldrede aus dem Lukasevangelium (Lk 6Lk 6), um die Unterschiede zu bemerken. Diese Differenzen lassen sich nicht einfach damit lösen, dass Jesus vielleicht zweimal eine entsprechende Rede gehalten hat. Denn dann hätte er auch verschiedene Gebote aufgestellt. Und welche sind dann gültig?
Jetzt immer noch die biblischen GeboteGebot unmittelbar anzuwenden, würde wieder in einen Widerspruch führen: Denn man würde sie nur deshalb verwenden, weil sie in der Bibel stehen, und nicht, weil sie von GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) stammen. Vielmehr müsste man ja vorher klären, dass das, was in der Bibel steht, von Gott stammt. Und das kann man nicht allein mit biblischen Mitteln leisten.
Das sind die Hauptgründe, warum eine biblische Ethik nicht unmittelbar auf die Gegenwart angewendet werden darf: Sie ist sowohl ethisch als auch theologisch unzureichend. Inzwischen hat sich die Meinung durchgesetzt, die Bibel fasse religiöse Erfahrungen zusammen, die es deshalb auch wert sind, als einzelne Orientierungspunkte für MenschenMensch mit religiösen Erfahrungen heute zu dienen. Die Bibel vermittelt dann keine einlinige Ethik, sondern liefert nur einzelne Schlaglichter. Das macht sie aber theologisch-ethisch nicht bedeutungslos. Es trifft auch nicht zu, dass man mit der Bibel nur moralische Unverbindlichkeiten äußern könne. Auch wenn die Bibel nicht von GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) stammt, thematisiert sie ihn, und zwar so, dass Christen von ihm gar nicht reden könnten, wenn es die Bibel nicht gäbe. Die Bibel thematisiert Gott dabei so, dass sie Verbindliches über ihn aussagen will, woran sich Menschen orientieren sollen.
Dieses Buch macht sich zur Aufgabe, die ethischen Verbindlichkeiten in der Bibel zu entdecken, die einer ethischen Überprüfung standhalten. Dabei nehme ich Begriffe auf, die entweder selbst biblisch sind (z. B. GerechtigkeitGerechtigkeit) oder aus unserer Zeit stammen (MenschenwürdeMenschenwürde), und reflektiere dazu je einen biblischen Text, der ihre Bedeutung entfaltet. Natürlich gibt es für alle Begriffe auch Alternativtexte. Aber das macht die Interpretation der gewählten Texte nicht unverbindlich. Vielstimmigkeit mag für ein logisches System unzufriedenstellend sein. Im faktischen LebenLeben jedoch fragen wir nicht, wenn wir vor einer ethischen Herausforderung stehen, ob ihre Lösung alle anderen Probleme mit löst. Vielmehr ist es umgekehrt: Unser Verhalten in einzelnen Fällen gibt uns eine Grundorientierung, um uns bei anderen Herausforderungen ähnlich zu verhalten oder den gleichen Weg einzuschlagen, wie wir nach einer Lösung suchen.
Im Zentrum dieses Buches werden dabei nicht biblische GeboteGebot stehen, sondern eher biblische Beschreibungen und Interpretationen GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) und der MenschenMensch, die aber eine lebensorientierende Wirkung haben. Ein Beispiel: Sagt man, dass Gott die Ungerechten straft, so hat diese Aussage eine orientierende Wirkung, und zwar so oder so. Entweder werden Menschen dann versuchen, gerecht zu sein und darüber nachzudenken, worin GerechtigkeitGerechtigkeit besteht. Oder sie werden sich gegen einen Gottesbegriff auflehnen, der Gott diese strafende Rolle zuweist. Dazu könnten sie sich über einen solchen Gottesbegriff lustig machen oder auch theologische Gründe suchen, die ihm widersprechen. Man kann sich also nicht unbetroffen stellen, wenn man mit der Ansage eines strafenden Gottes konfrontiert ist.
Es mag etwa auf dem ersten Blick überraschen, wenn ich zur Lösung auf die ethische Frage, was GerechtigkeitGerechtigkeit ist, das Gleichnis vom Verlorenen Sohn behandle. Denn diese Geschichte enthält weder ein GebotGebot, noch beschreibt sie, worin Gerechtigkeit unter MenschenMensch besteht. Und dennoch hat dieses Gleichnis eine orientierende Kraft auch für Gerechtigkeitsdiskurse. Kurz gesagt: Auch was nur über GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) gesagt wird, gibt doch zugleich eine ethische Orientierung für Menschen.
Dieses Buch richtet sich vor allem an Theologiestudierende sowie an Christen in theologischen Berufen. Es vermittelt zentrale ethische Begriffe, die Studierende brauchen, um erfolgreich ethische Themen zu bearbeiten. Und es dient als Nachschlagewerk für Religionslehrerinnen und -lehrer, die im Unterricht oft ethische Themen behandeln und dabei einer Grundlage bedürfen, die zwar pluralismusfreundlich ist, ohne dabei jedoch beliebig zu werden. Dazu benutze ich einschlägige Begriffe, die den Unterrichtseinheiten in Lehrplänen oder Schulcurricula oft vorangestellt sind. Ebenso brauchen Pfarrerinnen und Pfarrer zunehmend ethische Kompetenz. Das trifft zum einen auf die Frage zu, welche Prioritäten in der pfarramtlichen Tätigkeit angesichts von Arbeitsverdichtung zu setzen sind. Zum anderen berühren auch seelsorgerische Fragen ethische Themen. Da die Autonomie des MenschenMensch in den letzten Jahrzehnten angewachsen ist, wächst auch der individuelle Entscheidungsdruck. Bis in Traupredigten, Beerdigungs- oder Taufansprachen fließen daher ethische Themen mit ein. Dabei soll das Buch eine Hilfestellung sein, um einen dritten Weg zu gehen. Weder soll in theologischen Berufen die ethische Normativität mit göttlicher Autorität verordnet werden, noch sollen die moralischen Bewertungsmaßstäbe von außen an biblische Texte angelegt werden. Vielmehr soll die Orientierungskraft biblischer Texte selbst zur Entfaltung kommen. Dass sie dazu fähig sind, für Fragen zu sensibilisieren, die ihre Verfasser damals noch nicht im Blick haben konnten, lässt sich sogar an aktuellen Themen wie dem der Digitalisierung zeigen.1
Die vorliegende Auswahl biblischer Texte mag willkürlich anmuten. Die Gründe für die Auswahl lagen für mich daran, die dort enthaltenen moralischen Ansprüche nicht einfach hinzunehmen, sondern an ihnen eine Überprüfung ihrer normativen Plausibilität vorzunehmen. Eine theologische Ethik kann sich eben nicht einfach auf Bibelverse beziehen, um damit schon ihre ethische Richtigkeit festzustellen. Vielmehr vermitteln biblische Texte unterschiedliche Ahnungen ethischer Orientierungen. Wie daraus eine in sich stimmige und gerechtfertigte Leitorientierung wird, ist der ethischen Überprüfung überlassen. Insofern handelt es sich mit dem vorliegenden Arbeitsbuch nicht etwa um eine bloße Darstellung, sondern um die kritische Untersuchung, welche ethischen Horizonte biblische Texte zu Recht abstecken dürfen. Ihre kritische Überprüfung lässt sich davon leiten, dass ethisch valide Aussagen schlüssig und überzeugend sein sollen. Ich behaupte also nicht, dass ich einen einheitlichen Querschnitt einer biblischen Ethik rekonstruiert habe, den es vermutlich nicht gibt; denn dafür ist die Bibel zu vielstimmig. Vielmehr verstehe ich die Bibel als theologische Ressource, auf unterschiedliche Probleme einzugehen, die MenschenMensch zwar zu anderen Zeiten gehabt haben, deren jeweilige Vorschläge die Bibel aber dennoch als Ideengeberin für die heutige Bearbeitung von Problemen ausweist. Bei der Interpretation biblischer Texte wird ermessen, welche Perspektive sich von ihnen aus entdecken lässt, die ethische Erkenntnisse anstößt, die vor einer ethischen Prüfung standhalten. Dann verliert die Auswahl dieser biblischen Texte ihre Willkürlichkeit. Die Auswahl folgt keinem inneren biblisch-ethischen Kanon, sondern ethischen Problemlagen, die ich mit Hilfe dieser Texte besser verstehen und lösen möchte. Also folgt die Auswahl bereits einer ethischen Deutung. Damit ist auch gesagt, dass die Leserin selbst herausgefordert ist, die Plausibilität der vorliegenden Argumentationsgänge mit eigenen ethischen Überprüfungen zu ermessen.
In diesem Zusammenhang mag man gleich zu Beginn kritisch feststellen, dass auffallend viele Texte aus dem Alten TestamentTestamentAltes aufgenommen worden sind. Daran könnten sich zwei Einwände hängen: Zum einen könnte man kritisch rückfragen, ob es nicht typisch christliche Aussagen gibt, die von denen des Alten Testaments abweichen. Und zum anderen könnte man – geradezu entgegengesetzt – einwenden, hier werde die Ursprungsquelle einer anderen ReligionReligion, des Judentums, ausgebeutet. Müsste man nicht eher von einer jüdisch-biblischen Ethik sprechen? Oder steht einem christlichen Theologen überhaupt die ethische Beurteilung jüdischer Texte zu?
Eine jüdische Ethik zu schreiben, würde ich tatsächlich einer jüdischen Theologin oder einem jüdischen Theologen überlassen. Allerdings ist zu beachten, dass das Alte Testament die Bibel der ersten Christen war, mit der sie das Geschehen Jesu Christi gedeutet haben. Die Unterscheidung von AltemTestamentAltes und Neuem TestamentTestamentNeues macht auf eine Kontinuität und Verklammerung der Heilsgeschichte aufmerksam, von der Christen nur die Hälfte sehen könnten, wenn sie auf das Alte Testament verzichten würden. Vom christlichen Standpunkt liegen nicht etwa zwei verschiedene Testamente vor, sondern es handelt sich „um das eine Testament GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) in der Differenz des AltenTestamentAltes und des Neuen. TestamentNeues“2 Wenn zudem sinntheoretisch der Kontext das Verständnis eines Textes mitbestimmt und wenn der Kontext von Christen ein anderer ist als von JudenIsrael/Juden, so gebrauchen Christen und Juden die gleichen Texte verschieden und erzielen somit unterschiedliche Verständnisse.3 Deshalb widerspricht es nicht der christlichen Selbstreflexion, wenn Christen Texte des Alten TestamentsTestamentAltes interpretieren. Und gerade dann wird dem Judentum nicht die hebräische Bibel weggenommen, weil ein jüdisches Verständnis nicht zurückgewiesen wird, wenn der Kontext ein anderer ist.
Für mich ist aber ein anderer Gedanke noch entscheidender: Ich habe Texte des Alten TestamentsTestamentAltes vor allem deswegen herangezogen, weil an ihnen ethische Ansprüche reflektiert werden können, für die es im Neuen TestamentTestamentNeues oftmals keine Parallele gibt. Und wenn Christen das Alte Testament ethisch lesen, gewinnen sie Einsichten für ihre ethische Orientierung. Biblisch-ethische Aussagen überzeugen nicht deshalb ethisch, weil sie christlich oder jüdisch sind, sondern weil sie eine ethische Perspektive eröffnen, die sich zudem in der ethischen Überprüfung bewähren. Sie gelten dann nicht nur für Christen, sondern beanspruchen, auch für Nicht-Christen und Nicht-JudenIsrael/Juden überzeugungsfähig zu sein.
Texte aus dem Alten TestamentTestamentAltes sind oft von der politischenPolitik oder religiösen Oberschicht verfasst worden. Sie behandeln deshalb auch oft gesamtgesellschaftliche Themen. Dagegen sind fast alle neutestamentlichen Texte von einer religiösen Randgruppe aus formuliert, die ihre gesellschaftlichen Integrationsprobleme verhandelt. Diese wechselseitige Ergänzung der Perspektiven ist nützlich für einen differenzierten Blick auf ethische Themen. Daher bewährt sich gerade auch aus ethischer Perspektive, Texte der ganzen Bibel im Auge zu behalten, die für Christen aus dem Alten und Neuen TestamentTestamentNeues besteht. Damit wird gerade auch dem Klischee entgegengewirkt, das Alte Testament sei rachsüchtig und verurteilend, während das Neue Testament die Gnade und LiebeLiebe verkündige. Christlich-ethische Orientierungen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern entstehen in Kontinuität zum jüdischen Denken.
Die Übersetzungen der zugrundeliegenden biblischen Texte gehen von einer der neueren revidierten Luther-Übersetzungen aus. Allerdings habe ich in die vorliegenden Fassungen mit eigenen Übersetzungsvarianten eingegriffen, wenn dies dem Sachgehalt der Ursprungstexte besser entsprochen hat. Dadurch mögen manche Bibeltexte noch fremder wirken, als sie es oft schon mit den bekannten Übersetzungen tun. Die bewusste Verfremdung dient jedoch der Akzentuierung des jeweiligen ethischen Anspruchs, der sich an den Texten rekonstruieren lässt.
Das Buch reflektiert Begriffe und Themen der Ethik in einer mittleren Anzahl. Berücksichtigt sind die Themen, die in Schule und Gemeinde verstärkt behandelt werden und deshalb oft von Studierenden als Examensthemen ausgewählt werden. Ein Lehrbuch soll keine fertigen Antworten auf alle Fragen geben, sondern die Leser zum eigenständigen ethischen Denken motivieren. Wer ethisch denkt, ist nie allein. Sonst könnte er oder sie nicht ethisch denken. Denn ethische Konflikte haben MenschenMensch immer gemeinsam. Dazu gehört das Verständnis dafür, wie andere Menschen gedacht haben. Die Bibel ist eine Sammlung gedeuteter Wirklichkeit. Dass GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) bei dieser Deutung zu berücksichtigen ist, zeigen ihre Texte in unterschiedlicher Weise auf. Dieses Deutungsangebot will das Lehrbuch aufgreifen und weiterführen.
Die Themen habe ich in drei Teile gegliedert. Der erste Teil umfasst Grundbedingungen ethischen Urteilens, der zweite sozialethische Themenstellungen, in denen nicht nur Einzelpersonen als Akteure auftreten, sondern auch Gruppen, Organisationen und Institutionen. Im dritten Teil wird an den ethischen Fragen deutlich werden, inwiefern hier Bedingungen des LebensLeben berührt sind. Es mag bisweilen irritieren, in welchen Teil ich manche Begriffe untergebracht habe: Warum ist etwa das GewissenGewissen keine Grundbedingung ethischen Urteils, sondern eine Lebensbedingung? Und warum sind Ehre und TugendTugend angeblich keine sozialethischen Begriffe? Nun bezweifle ich nicht, dass viele Begriffe auch aus anderen Perspektiven betrachtet werden können. Die Teile schließen sich insofern thematisch nicht aus. Dennoch wird an der Art meiner Textinterpretationen deutlich werden, warum die jeweiligen Kapitel ihren Ort in dem entsprechenden Teil haben.
Das Buch ist so gestaltet, dass jedes Kapitel und jede Sektion unabhängig von den anderen gelesen werden kann. Jedem Thema wird zu Beginn ein Block vorangestellt, der die jeweils aktuelle Debatte umreißt und eine kurze Begründung für die biblische Textauswahl gibt. Dadurch eignet es sich zur schnellen Einholung von Information. Wer sich genauer in die jeweiligen Themen vertiefen möchte, findet am Ende jeder Sektion Literaturtipps und biblische Alternativvorschläge mit kurzen Erläuterungen.
H. Deuser: Die zehn Gebote. – Das Büchlein interpretiert die Zehn Gebote über ein Muster, das jeder Interpretation zugrunde liegt. Ethischen Urteilen liegen die Prinzipien unbedingten Vertrauens, der angestrebten Realisierung und Verallgemeinerung ethischer Orientierungen zugrunde. Das trifft sowohl auf die Zehn Gebote zu wie auf ihre Interpretation, weshalb sie in einem kontinuierlichen Zusammenhang zueinanderstehen.
J. Fischer: Die Bedeutung der Bibel für die Theologische Ethik, 262–273. – Im Artikel wird nicht nur vor einer fundamentalistischen Auslegung der Bibel für ethische Fragestellungen gewarnt, sondern auch auf die Orientierung in der affektiven Betroffenheit wert gelegt. Die Bibel bietet Anschauungsmaterial für moralische Phänomene und schult das Mitgefühl.
J. Lauster: Erfahrungserhellung, 207–220. – Die Bibel erfüllt die Funktion der „Erfahrungserhellung“, die an den christlichen Erfahrungsgrund heranführt. Die TheologieTheologie geht den Dreischritt Erleben, Deuten, Erinnern. Lauster formuliert hier keine ethischen Aussagen, legt aber eine erfahrungstheologische Basis dafür.
I. Grundbedingungen der Ethik
1Wie die Bibel verstehen? Orientierung durch WahrnehmungWahrnehmung
Die Diskurslage
Gegenüber einer bloß vergleichenden religionsgeschichtlichen Methode haben Vertreter der sogenannten Dialektischen TheologieTheologie immer wieder betont, dass die Bibel eine echte „Sache“ hat, die sie thematisiert.1 Diese Sache, GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist), ist aber kein innerweltlicher Gegenstand, da die Welt aufgrund ihres geschlossenen Kausalzusammenhangs keinen Raum für Gott freihält. Die Bibel selbst hat vielmehr die Welt entmythologisiert.2 Die „Sache“ Gottes kann nur in kategorial anderer Weise erfasst werden, nämlich indem Gottes Wort einen MenschenMensch „trifft“3 und in einem Hörereignis die Sache ansichtig macht.4 Gottes Wort ist ein Ereignis, das weder den weltlichen Kausalzusammenhang aufhebt noch eine übernatürliche Ursache für die weltliche Geschichte setzt,5 sondern die menschliche WahrnehmungWahrnehmung in kategorial anderer Weise bestimmt, also begrifflich unterscheidend, „ohne daß Gott und Welt deshalb auseinanderträten oder auseinanderfielen.“6 Indem das Moment des Getroffenseins oder des Ereignisses so das Wort Gottes charakterisiert, wird es als „Begegnung“7 gefasst, die sich nicht in der Kategorie der Kausalität bestimmen lässt.
Die Hauptgedanken der Dialektischen TheologieTheologie sind zeitgleich entwickelt worden mit den Anfängen der dialogischen PhilosophiePhilosophie (Martin Buber, Eberhard Grisebach). Insbesondere Friedrich Gogarten hat sich ausdrücklich auf sie bezogen.8 Bultmann hat Gogartens Blick geweitet, indem nicht lediglich die Du-Begegnung das Wort GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) in der Geschichte etabliert.9 Vielmehr wird Geschichte überhaupt durch Begegnung und Widerfahrnisse konstituiert.10 In beiden Fällen aber bestimmt die Begegnung die WahrnehmungWahrnehmung auf die Wirklichkeit. Gott kann nur insofern zur „Sache“ des MenschenMensch werden, sofern er ihm begegnet.
In der Theologischen Ethik ist dieser Zusammenhang von Begegnung, WahrnehmungWahrnehmung und normativer Verbindlichkeit bei Johannes Fischer und Christopher Frey aufgenommen worden. GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) begegnet dem MenschenMensch laut Frey so, dass die Begegnung seine ganze Lebensgeschichte bestimmen kann.11 Bei Fischer fungieren einzelne geschilderte Kurzgeschichten als Rechtfertigungen für eigenes Verhalten, weil sie ihren Gesprächspartnern eine Situation vor Augen führen, die es ihnen dann erlaubt, das normative Gewicht des Verhaltens selbst zu erschließen.12 Ethik hat es dann weniger mit rationalen Begründungen zu tun, sondern mit der Wahrnehmung von Situationen, die Menschen ins Engagement ziehen. Theologisch sind diese Rechtfertigungen dadurch, dass sich die verbindliche „Sache“ „nur selbst“13 zeigen kann.
1. Joh 3,1–61. Joh 3,1–6
Zur Textauswahl
Texte erhalten ihre Bedeutung durch die Interaktion mit ihren Rezipienten. Der vorliegende Bibeltext ist danach ausgewählt worden. In Gottesdiensten wird er in der Weihnachtszeit gelesen, also in der Zeit des Kirchenjahres, in der die Menschwerdung GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) thematisiert wird: So wie Gott MenschMensch wird, so nimmt der theologische Gehalt in Texten und in ihrer Rezeption Gestalt an. Deshalb halte ich den vorliegenden Text für passend in diesem vorangestellten Kapitel.
1 Seht, welch eine LiebeLiebe hat uns der VaterVater (Gott der) erwiesen, dass wir GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) Kinder heißen sollen – und wir sind es auch! Darum kennt uns die Welt nicht; denn sie erkannte ihn nicht.
2 Meine Lieben, wir sind schon GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) Kinder; es ist aber noch nicht sichtbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es sichtbar wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
3 Und ein jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist.
4 Wer SündeSünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht.
5 Und ihr wisst, dass er gesehen worden ist, damit er die Sünden wegnehme, und in ihm ist keine SündeSünde.
6 Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht; wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt.
Eigentlich spielt der Sehsinn im christlichen GlaubenGlaube keine besondere Rolle, da GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) für unsichtbar gehalten wird. Hier aber kommt das Wort „sehen“ sechs Mal vor und sogar im Zusammenhang damit, Gott zu sehen. Anscheinend kann man Gott sehen, wenn man MenschenMensch sieht. Der Bibeltext spricht vom Menschen JesusJesus Christus, der „gesehen worden ist“ und in dem „keine SündeSünde“ ist.
GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) sehen heißt also, den MenschenMensch sehen; am Menschen ablesen, was Gott ist. Und da Gott nicht einfach sichtbar ist, zeigt sich seine Unsichtbarkeit auch am sichtbaren Menschen:
„Meine Lieben, wir sind schon GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) Kinder; es ist aber noch nie gesehen worden, was wir sein werden. Wir wissen aber: wenn es gesehen wird, werden wir ihm gleich sein; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.“
Nicht ist gemeint, dass MenschenMensch dasselbe wie GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) sind. Vielmehr erfährt man Gott mit, indem man sich Menschen ansieht. Und man erfährt ihn anscheinend so, dass das, was man sieht, auch das Sehen selbst auffällig macht. Man sieht das Sehen.
Der Verfasser dieses Textes will beschreiben, was Christen erwarten können. Dazu räumt er ein, nur die Richtung dieser Erwartung zu ahnen, aber nicht das Ziel zu erkennen: „Es ist noch nicht gesehen worden, was wir sein werden.“ Aber sobald man uns sehen kann (unsere Verheißung, was wir sein werden), werden wir GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) gleich sein, weil wir dann nämlich ihn sehen. Indem wir in Zukunft Gott sehen werden, werden wir auch sehen, wie wir sein werden.
Es klingt so, wie wenn sich im Anblick GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) unser eigenes Wesen widerspiegelt in einem Spiegel. Denn auch in einem Spiegel sehen wir ja nicht nur, wie wir aussehen. Sondern wir sehen ja auch, wie es aussieht, wenn wir sehen. Wir sehen unsere eigenen Augen, wie wir schauen, unseren Blick. Und ebenso wie wir meistens unseren Blick verändern, wenn wir ihn im Spiegel sehen, wird sich offenbar auch etwas an unserem Blick verändern, wenn wir Gott sehen. Anscheinend wird dieser Moment unser zukünftiges Wesen sein.
Es klingt kompliziert. So kompliziert ist es aber gar nicht. Es ist höchstens etwas erstaunlich, was behauptet wird: GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) sehen macht uns mit dem Gesehenen gleich. Oder auch: Indem wir MenschenMensch sehen, sehen wir das Sehen. Im Anblick eines Menschen reflektiert sich für uns, was wir sind, und zwar so, dass wir das werden, was sich auf uns reflektiert. In der Weihnachtsgeschichte bekommt daher eine scheinbar belanglose Notiz theologische Bedeutung: Die Hirten wollten die Geschichte „sehen“ (Lk 2,15Lk 2,15). Was sie sahen, könnte nun auf sie zurückgespiegelt haben, auf sie „umgekehrt“ sein. „Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten“ (Lk 2,20Lk2,20).
Kein anderer menschlicher Sinn scheint das Sichtbare so stark auf uns reflektieren zu können wie der Sehsinn. Wer Musik hört, wird nicht selbst ein Ton. Beim Geruch und bei Tastsinn ist es ebenso wenig so. Aber beim Sehen kann das manchmal schon so sein. Das liegt merkwürdigerweise daran, dass der Sehsinn eine Schwäche hat; eine Schwäche, die bei ihm besonders ausgeprägt ist. Der Sehsinn ist nämlich flüchtig. Wir können ihn nicht festhalten, wenn das, was wir gesehen haben, nicht mehr bei uns ist. Denn uns selbst können wir nicht sehen. Wir sehen uns nur durch die anderen, die wir sehen.
Was jemand sieht, bleibt nicht verlässlich in Erinnerung. Die Erinnerung konfiguriert unsere Eindrücke jedes Mal neu, wenn wir sie wachrufen. Dadurch entfernen sich unsere Erinnerungen von den Gestalten, wie wir sie ursprünglich sahen. Vielleicht ist das anders bei Gerüchen oder Geräuschen, die wir oft auch nach Jahren wiedererkennen können.
Sehen ist ein flüchtiger Sinn. Dahinter steckt aber seine besondere Bedeutung: Sehen ist nämlich dadurch besonders bei der Gegenwart, beim Neuen. Auch das ist bei den anderen Sinnen nicht so sehr der Fall: Hört jemand eine Melodie, so ist man meistens schon zwei Takte voraus, obwohl man sie noch gar nicht gehört hat. Riecht man einen Geruch, dann erinnert man sich zugleich an eine Geschichte von früher.
Könnte das die Entdeckung des biblischen Textes aus dem Ersten Johannesbrief sein? Dass eine Person durch das Sehen auch am ehesten gleich werden mit dem, was sie sieht? Das könnte deshalb der Fall sein, weil sich ja in der Gegenwart alles entscheidet, wie sich die Person verhält, über etwas nachdenkt und was sie erlebt. Weil ein MenschMensch beim Sehen besonders im Jetzt ist, prägt ihn das Gesehene auch so stark, dass es sich auf ihn reflektiert.
Auch das hat eine Ambivalenz. Was jemand sieht, macht ihn mit dem Gesehenen gleich, aber eben nur in der Gegenwart. Diese Ambivalenz drückt der Schreiber aus diesem Bibeltext als Spannung zwischen Gewissheit und Zweifel aus: „Wir sind schon GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) Kinder; es ist aber noch nicht sichtbar geworden, was wir sein werden.“ Jetzt orientiert uns das, was wir sehen. Aber was wir sein werden, wissen wir jetzt noch nicht. Denn das Sehen kann nicht vorausschauen. Wir können immer nur jetzt sehen. Das Gesehene wird uns immer nur jetzt mit sich selbst gleichmachen.
Also kann man nur dann GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) dauerhaft gleich sein, wenn man ihn auch dauerhaft sieht. Nicht nur ein flüchtiger Blick, der jemanden einige Augenblicke erfüllt, sondern indem ein MenschMensch Gott dauerhaft sieht, wird es ihn endgültig mit Gott gleichmachen. Es wird dauerhafte Gegenwart sein. Vergangenheit und Zukunft werden keine Rolle mehr spielen, sondern nur das, was wir zu jedem Jetzt sehen: uns selbst, indem wir Gott sehen.
Auch wenn man GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) nicht sehen kann, setze ich die ethische Betrachtung dieses Buches hier an, an der WahrnehmungWahrnehmung dessen, was jetzt am Mitmenschen geschieht. Der christliche GlaubeGlaube sieht Gott im MenschenMensch. Und wer einen Menschen sieht und damit ganz ins Jetzt versetzt ist, lässt sich selbst von diesem Sehen prägen.
Biblische Alternativen
Psalm 1Ps1 beschreibt eine Person, die über die biblischen Weisungen „Tag und Nacht sinnt“. Eine solche Person wird mit einem fruchtbaren Baum verglichen. Das fortlaufende Sinnen ist also lebensförderlich. Die göttliche Weisung ist als bloßer Text anscheinend wie tot, wenn sie nicht lebendig wird durch die beständige menschliche Betrachtung, Reflexion und Deutepraxis.
Eine Herausforderung für die ethische Interpretation liegt in der Gegenüberstellung der „Gottlosen“: Die „Spötter“, die diese beständige Deutepraxis nicht vollziehen, werden für wenig lebensbeständig gehalten. Steckt dahinter eine Diskriminierung religiös Andersdenkender? Zumindest müsste überprüft werden, ob die MenschenMensch, die hier als „Gottlose“ tituliert werden, keine beständige Deutepraxis leisten und wie das möglich ist. Könnte es nicht sein, dass sich religiös Andersdenkende darin treffen, dass sie alle deutefähig und -bedürftig sind?
M. Buber: Ich und Du, 13–16. – Der Religionsphilosoph beschreibt an der Begegnung mit einem Baum, wie sich dabei das erkennende Ich mit dem Du des Baums „ununterscheidbar vereinigt“. Begegnung bahnt den Weg zu GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist), nämlich zur Beziehung, die jeglicher Erkenntnis zugrunde liegt.
2Wissenschaftsethik
Die Diskurslage
Wissenschaftsethische Kontroversen handeln davon,
ob bestimmte Forschungsmethoden zulässig sind, um die Wahrheit herauszufinden (zum Beispiel Tierversuche, sogenannte verbrauchende Embryonenforschung, Experimente an Patienten mit irreversibler Bewusstlosigkeit).
wie sich WissenschaftWissenschaft zur politischenPolitik Macht verhalten darf. Sollten etwa Virologen bei einer Pandemie entscheiden, welche Maßnahmen zur Eindämmung der Gefahr in der Bevölkerung einzuhalten sind, weil nur sie die Gefahrenlage adäquat einschätzen können? Oder sollten nach wie vor demokratisch gewählte Politiker entscheiden, die aber auch nicht-wissenschaftliche Erwägungen in ihre Entscheidungen aufnehmen, die aus wissenschaftlicher Sicht fatale Auswirkungen haben können?
ob die Forschungsfreiheit beschnitten werden muss, um allgemeingültige Kriterien für die wissenschaftliche Wahrheitsfindung zu erheben. Zum Beispiel wird immer wieder der wissenschaftliche Charakter der TheologieTheologie in Frage gestellt. Darf die Theologie selbst ihren Wissenschaftscharakter bestimmen, oder müssen allgemeine Wissenschaftskriterien an alle Disziplinen angelegt werden, durch die dann die Theologie als Pseudowissenschaft überführt werden kann?
Innerhalb der Theologischen Ethik werden die Diskussionen zu den ersten beiden Punkten ähnlich kontrovers geführt wie im allgemein ethischen Diskurs. Dagegen sind sich die Positionen innerhalb der TheologieTheologie beim dritten Punkt ähnlicher. Juristisch besteht die Forschungsfreiheit darin, dass nicht der StaatStaat die Forschungsgegenstände bestimmen darf,1 sondern jeder Fachdisziplin überlässt, ihren Gegenstand selbst zu beschreiben sowie sich auf die geeigneten Methoden zu einigen, wie Hypothesen zu ihrem Gegenstand überprüft werden.2 Theoretisch ist es dann jedoch denkbar, dass pseudowissenschaftliches Gedankengut wie Verschwörungstheorien oder Rassismus wissenschaftliche Geltung erlangen können, weil sich ihre Protagonisten innerhalb ihrer Gruppierung für ihre abstrusen Vorstellungen auf ebenso abstruse Methoden einigen (zum Beispiel die Selbstimmunisierungstaktik, alle anderen Quellen als Fake News zu brandmarken, oder rassistische Vermessungsmethoden des menschlichen Körpers). Zwar ist keine WissenschaftWissenschaft isoliert von den anderen Disziplinen. Deshalb kann ethisch gefordert werden, dass jede Wissenschaft auf das Problem- und Lösungsniveau der jeweils gegenwärtigen wissenschaftlichen Situation eingehen kann.3 Aber keine Wissenschaft darf von außen bevormundet werden, wie sie ihren Forschungsgegenstand untersucht.
Innerhalb der evangelischen TheologieTheologie wird teilweise die Einrichtung biblizistischer Hochschulen kritisiert, und zwar mit dem Argument fehlender Forschungsfreiheit in den dortigen Einrichtungen.4 Die verwendeten Methoden müssen sich nämlich im interdisziplinären Diskurs so bewähren, dass man ihnen nicht aus willkürlichen oder ideologischen Gründen folgt, sondern dass sie sich im Wechselspiel des Diskurses als frei herausstellen und AnerkennungAnerkennung verdienen. Michael Moxter hat aus dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs die Anforderung gefolgert, dass die Theologie eine universitäre WissenschaftWissenschaft sein muss, weil die Gesellschaft nur auf diese Weise Fundamentalismusgefahren der ReligionReligion abwehren kann.5
5. Mose 18,20–225. Mose 18,20–22
Zur Textauswahl
Der vorliegende Text benutzt ein „wissenschaftliches Modell“ für die Untersuchung, welche prophetische Rede von GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) stammt. Dieses Modell betrachtet die prophetische Rede wie eine wissenschaftliche Hypothese, die in einem zweiten Schritt überprüft, also verifiziert oder falsifiziert wird. Obwohl Propheten theologische Aussagen treffen, wird die Überprüfung der Hypothese wie in einer Naturwissenschaft empirisch vorgenommen.
20 Doch wenn ein Prophet so vermessen ist, dass er redet in meinem Namen, was ich ihm nicht geboten habe, und wenn einer redet in dem Namen anderer Götter, dieser Prophet soll sterben.
21 Wenn du aber in deinem Herzen sagen würdest: Woher wissen wir das Wort, das der HERR ihm nicht gesagt hat?
22 Wenn der Prophet redet in dem Namen des HERRN, und nicht wird das Wort/Ereignis und nicht kommt das Wort/Ereignis, das GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) ihm nicht gesagt hat, dann hat der Prophet im Übermut seines Wortes geredet; fürchte dich nicht vor ihm.
Auch im Bereich der ReligionReligion gibt es ein wissenschaftliches Bedürfnis, welche Verheißungen und Weissagungen wahr sind. Aber der Religion traut man oft keine wissenschaftlichen Fähigkeiten zu. Tatsächlich hat ja auch Religion nicht dieselben Wissenschaftskriterien wie etwa die Naturwissenschaften. Deshalb klingt dieses Bibelwort auch so naiv, wenn man es im naturwissenschaftlichen Sinn versteht. In Naturwissenschaften stellt man eine Hypothese auf, entwickelt eine Versuchsanordnung und führt damit ein Experiment durch. Und wenn das Experiment die Hypothese regelmäßig bestätigt, gilt sie als wahr. Aber in religiöser Hinsicht wäre es doch arg trickreich, wenn man die gleichen Regeln anwenden würde. Nehmen wir an, eine Prophetin weissagt, dass GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) in 100 Jahren Frösche schicken wird, damit sie die Weltherrschaft übernehmen. Dann hilft die Regel Moses aus diesem Bibeltext nicht, uns heute zu versichern, ob wir der Prophetin glauben sollten oder nicht.
Ich schlage deshalb vor, die wissenschaftlichen Kriterien für religiöse Sachverhalte anders zu bestimmen als für die Natur. Dann scheint Moses Empfehlung eine höhere Überzeugungskraft zu gewinnen, die sogar über religiöse Bedürfnisse hinaus anwendbar ist. WissenschaftWissenschaft verdankt sich nämlich einem Rahmen, der in diesem Bibeltext angedeutet ist – und auf dem sogar auch naturwissenschaftliche Versuchsreihen stehen.
Derselbe hebräische Ausdruck, der hier mehrfach verwendet wird (dbr), kann „Wort“ und „Ereignis“ oder auch „Sache“ heißen. Hier wird dieser Ausdruck in den beiden ersten Verwendungen benutzt, was ich in meiner Übersetzung angedeutet habe. Anscheinend hat die hebräische Sprache keine eindeutigen Unterschiede zwischen Wort und Ereignis/Sache empfunden, vielleicht, weil Worte selbst Ereignisse sind, die etwas bewirken. „Woher wissen wir das Wort, das der HERR ihm nicht gesagt hat?“ Die Antwort heißt: GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) hat es nicht gesprochen, wenn das Wort nicht „wird“ und nicht „kommt“. Es muss eine Wirkung entfalten, damit es von Gott sein kann – und zwar jetzt schon. Die Weissagung, dass Frösche in 100 Jahren die Weltherrschaft antreten, muss also jetzt „werden“. Und wenn sie das könnte, dann wäre sie sogar dann von Gott, wenn in 100 Jahren nichts passiert. Denn das Wort-Ereignis muss sich jetzt einstellen, damit es von Gott ist.
Das ist etwas anderes als mühsame naturwissenschaftliche Experimente. Und Kritiker könnten einwenden, dass damit auch jede Pseudowissenschaft den Rang einer WissenschaftWissenschaft bekäme, solange sie nur irgendeinen Effekt hat, also bei irgendwelchen Leuten „ankommt“. Tatsächlich können Pseudowissenschaften damit beeindrucken, dass sie bloße formelle Korrelationen zwischen Ereignissen beschreiben und damit MenschenMensch verblüffen können. Die Aussage „Eintracht Frankfurt schießt nie zwischen der 5. und 18. Spielminute ein Tor nach einem Eckball“ klingt mit ihren statistischen Belegen und ihrem verblüffenden Informationsgehalt dann wissenschaftlich belegt, sagt aber nichts über die Spielkunst der Mannschaft aus und macht es nicht einmal wissenschaftlich wahrscheinlich, dass es im nächsten Spiel auch so bleibt. Solche statistischen Spielereien sind daher nicht mit Wissenschaft zu verwechseln.
Meint Mose wirklich, dass jede verblüffende Aussage, die „ankommt“, schon wissenschaftlich ist? Dagegen spricht, dass seine eigene Aussage nicht wissenschaftlich ist. „Ein Wort muss eine Wirkung entfalten, damit es von GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) sein kann.“ Diese Regel trifft nicht deshalb zu, weil Mose sie vorher wissenschaftlich untersucht hätte, sondern weil Gott sie so bestimmt hat. Man kann diese Begründung anzweifeln. Aber für die Israeliten ist eines ja nicht zweifelhaft, nämlich dass sie Mose vertrauen. Deshalb „kommt“ sein Wort auch bei ihnen an und „wird“ im selben Moment, in dem er es sagt.
Wissenschaftliche Erkenntnisse können nie ganz neu sein. Schon gar nicht können sie völlig aus Weissagungen bestehen. Wenigstens das Vertrauen muss das „alte“ sein. Das gilt für das Vertrauen gegenüber einer charismatischen religiösen Figur und gegenüber bereits erworbenen Grundeinsichten, aber auch für das Vertrauen gegenüber naturwissenschaftlichen Versuchsaufbauten. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse müssen also das Vertrauen wert sein. Und das können sie nur, wenn sie „währen“, wenn sie sich also einbinden lassen in die Erkenntnisse und Verlässlichkeiten, die MenschenMensch der Wirklichkeit zugrunde legen.
Deshalb müssen prophetische Weissagungen sich bestätigen lassen. Und deshalb kann keine wissenschaftliche Aussage aus Übermut getroffen werden. Denn der Übermut sprengt den Rahmen, in dem sie als wissenschaftliche Aussage überhaupt AnerkennungAnerkennung verdienen könnte.
Es entspricht also keiner göttlichen Anordnung, dass die Menschheit in 100 Jahren von einer Frosch-Herrschaft heimgesucht wird. Denn das „Werden“ und „Kommen“ des göttlichen Wortes bindet sich an bisherige Verlässlichkeiten. GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) bindet sich an die Kontinuität seiner Vertrauenswürdigkeit: MenschenMensch können ihm nur vertrauen, wenn sein Wort wiedererkennbar bleibt. Ebenso können wissenschaftliche Erkenntnisse nur dann gesichert sein, wenn sie in den Rahmen bisheriger Erkenntnisse passen.
Wissenschaftsethisch fragwürdig sind also Forschungsvorhaben, die unglaubliche Versprechungen machen. Dazu gehören in der ReligionReligion apokalyptische Weissagungen, die behaupten, dass bald „alles anders“ wird, die Welt untergeht oder sich der MenschMensch bald in ein übermenschliches Wesen verwandelt. Denn wenn alles anders wird, gibt es keinen verlässlichen Rahmen mehr, an dem sich diese Behauptung bemessen lassen könnte und durch den das Vertrauen gerechtfertigt wäre. Zu den fragwürdigen Versprechungen gehören aber auch Heilungsversprechungen, die von Forschungszweigen abgegeben werden, die sich noch im Stadium der Grundlagenforschung befinden. Und schließlich gehören dazu auch pseudowissenschaftliche Aussagen, die bloße formelle Korrelationen herstellen. Denn nicht auf die formelle Korrelation kommt es an, sondern auf die Einbindung ins reale LebenLeben. Wenn also jemand über eine Wunde ein Pendel hält und sich in den nächsten Tagen die Wunde schließt, hat man nur eine formelle Korrelation zwischen beiden Ereignissen festgestellt. Wundersame Ereignisse müssen aber eingebettet sein in die Kontinuität unseres Vertrauens, damit sie bei uns wissenschaftlich „werden“ und „kommen“. Sie müssen also mit dem Vertrauen in unsere bisherige Lebenswirklichkeit zu tun haben. Ansonsten redet man von irgendwelchen anderen abseitigen Welten.
Pseudowissenschaften können nicht anders als sich vor diesem Vertrauen verschließen. Sie müssen sich davor verschließen, was „währt“. Neuartige Erkenntnisse bedürfen nämlich der Verlässlichkeit der Wirklichkeit. Beides kann WissenschaftWissenschaft nicht garantieren. Sie kann nicht wissenschaftlich garantieren, dass man der Wissenschaft glaubt. Und sie kann nicht die verlässliche Wirklichkeit sicherstellen, weil sie ja gerade neue und verblüffende Erkenntnisse generiert und weil Verlässlichkeit die vorwissenschaftliche Grundlage für Wissenschaft ist.
Deshalb ist Moses Ahnung folgerichtig: GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) verbürgt beides, sowohl dass die Wirklichkeit beständig ist als auch dass Unerwartetes auftritt. Und nur weil er beides verbürgt, kann es WissenschaftWissenschaft geben.
Biblische Alternativen
Kol 2,3–10Kol2,3–10 integriert Glauben und Wissen, ohne dass sie sich aufteilen lassen könnten in den wissenschaftlichen Zweischritt von Hypothese (GlaubeGlaube) und Verifikation (Wissen). Die Erkenntnisse des Glaubens werden hier vielmehr als leibhaftig evident beschrieben. Angeblich würden „PhilosophiePhilosophie“ und „Lehren von MenschenMensch“ dieser Einheit entgegenstehen. Die wissenschaftliche Zweiteilung von Hypothese und Überprüfung steht dann im Gegensatz zur Einheit von Glauben und Vernunft in der Christusoffenbarung.
In dieser Gegenüberstellung besteht eine Herausforderung für die ethische Interpretation. Denn es ist nicht mit den wissenschaftlichen Mitteln von Hypothese und Überprüfung beweisbar, dass diese Zweiteilung wissenschaftlich korrekt ist. Insofern kann man wissenschaftliche Erkenntnisse nicht selbst wissenschaftlich erzwingen, sondern muss an sie „glauben“ – in dem existenziell unbezweifelbaren Sinn, wie die Textstelle GlaubeGlaube und Wissen integriert. Zwischen Glauben und WissenschaftWissenschaft besteht dann keine Alternative. Vielmehr bauen beide aufeinander auf. Die angebliche Alternative von Glauben und Wissenschaft darf dann nicht zum Ausschluss der Wissenschaft aus dem christlichen Bewusstsein führen.
J. Fischer: Theologische Ethik, 291–312. – WissenschaftWissenschaft und Ethik sind allein schon deshalb miteinander verbunden, weil Wissenschaft Werte erstrebt und auf Werten basiert. Keine Wissenschaftlerin kann sich nur isoliert mit ihrem Forschungsgegenstand beschäftigen, sondern ist dabei auch zur VerantwortungVerantwortung für andere Personen verpflichtet und auf ihre Kooperation angewiesen. Forschungsergebnisse müssen publiziert werden, um der weiteren wissenschaftlichen Auseinandersetzung ausgesetzt zu werden. Allerdings müssen sich Wissenschaftler auf hypothetische Empfehlungen beschränken und dürfen für die PolitikPolitik keine apodiktischen Forderungen aufstellen.
Th. S. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions, Kap. 6+7 (52–76). – WissenschaftWissenschaft basiert auf einem Paradigma, das so lange erhalten bleibt, bis Unregelmäßigkeiten nicht mehr darin integriert werden können und ein neues Paradigma erzwingen. Zwischen beiden Paradigmen besteht keine Kontinuität, sondern ein Bruch.
3PluralismusPluralismus
Die Diskurslage
Wenn MenschenMensch verschiedene Meinungen und Lebenspraktiken entwickeln, bedarf ihre Konfrontation gemeinsam anerkannter Regeln, damit ihre Vertreter in einer Gesellschaft friedlich zusammenleben können. In diesem Fall ist PluralismusPluralismus eine ethische Herausforderung, die in der Frage besteht, wie diese Regeln zu formulieren sind.
PluralismusPluralismus kann aber auch Wertschätzung erfahren. Er stellt dann nicht das Problem für die Ethik dar, sondern ist dann selbst ein Gut, das es zu schützen gilt. Es ist also zu unterscheiden, ob man die Vielfalt von Lebensformen, Kulturen und Religionen selbst wertschätzt, obwohl man selbst nur eine Lebensform und sie nicht alle praktiziert, oder ob man das Konfliktpotenzial pluraler Lebensformen eindämmen will. Im ersten Fall gehört der Pluralismus zur eigenen Lebensform dazu: Obwohl man selbst keine Vegetarierin ist, freut man sich daran und unterstützt, dass es Vegetarier gibt, und ebenso schätzt man andere religiöse Praktiken, politische PolitikVorstellungen, vielfältige Geschlechteridentitäten und fremde kulturelle Lebensformen. Im zweiten Fall dagegen erscheint Pluralismus als Konfliktstoff und unter Umständen als Gefahr.
Doch welche ethischen Gründe hat man, eine Lebensform zu verteidigen, die man selbst nicht lebt und die der eigenen Lebensweise sogar widerspricht? Der Philosoph John Rawls hat beide Zugänge zum PluralismusPluralismus kombiniert: Danach wird Vielfalt wertgeschätzt, weil sie zur eigenen Vorstellung des Gerechten gehört.1 Es besteht sogar eine „Kongruenz“2 zwischen meiner eigenen Vorstellung eines guten LebensLeben und meiner Wertschätzung, dass alle anderen MenschenMensch ebenso ihre persönlichen Vorstellungen davon entwickeln sollen, auch wenn sie von meiner abweichen. Der Haken an dieser Versöhnung verschiedener Lebensformen besteht jedoch darin, dass dazu bereits Vielfalt wertgeschätzt werden muss. Lebensformen, die eine eindeutige Vorstellung davon haben, wie man richtig zu leben hat, werden dabei ausgeschlossen.3 Dieser Pluralismus lässt nur ähnliche Anschauungen zu und hat keine Lösung für Lebensformen, die unversöhnlich nebeneinanderexistieren.
Der Theologe Eilert Herms sucht eine gemeinsame Basis für die AnerkennungAnerkennung von Vielfalt und findet sie im wechselseitigen VerstehenVerstehen.4 Weil jeder MenschMensch sich bereits selbst verstehen muss, sind sich Menschen auch wechselseitig zu verstehen gegeben.5 Das Verstehen erreicht damit eine Gemeinsamkeit in aller Verschiedenheit. Wo diese Gemeinschaft als gemeinsame Verstehenspraxis aber nicht geteilt wird, muss die staatliche Gewalt die Ordnung garantieren. Ihre Gewaltanwendung muss zwar selbst verstehbar sein,6 aber da sich Lebensformen der gemeinsamen Verstehenspraxis verweigern können, stößt der PluralismusPluralismus hier an eine Grenze, wo er nicht mehr positiv bewertet werden kann.
Joh 4,5–14Joh 4,5–14
Zur Textauswahl
PluralismusPluralismus ist eine Tatsache. Bevor man ihn ethisch bewerten kann, muss man ihn als Tatsache hinnehmen. In der vorliegenden biblischen Szene begegnen sich zwei MenschenMensch unterschiedlicher Religionen mit dieser Selbstverständlichkeit. Der ethische Diskurs wird erst eröffnet, als die gewöhnlichen Umgangsformen zwischen den Religionen herausgefordert werden.
5 Da kam JesusJesus Christus in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab.
6 Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun JesusJesus Christus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder; es war um die sechste Stunde.
7 Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. JesusJesus Christus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken!
8 Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen.
9 Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du bittest mich um etwas zu trinken, der du ein JudeIsrael/Juden bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern.
10 JesusJesus Christus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du erkenntest die Gabe GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, du bätest ihn, und der gäbe dir lebendiges Wasser.
11 Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief; woher hast du dann lebendiges Wasser?
12 Bist du mehr als unser VaterVater (Gott der) Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh.
13 JesusJesus Christus antwortete und sprach zu ihr: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten;
14 wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige LebenLeben quillt.
Hat jetzt JesusJesus Christus Durst oder nicht? Wenn er Durst hat und die Hilfe dieser Frau braucht, dann klingt es wie eine trotzige Angeberei, wenn er sie darauf anspielt, wer er ist: „Wenn du wüsstest…“ Wenn er dagegen keinen Durst hat, dann hat er von Anfang beabsichtigt, die Frau zu provozieren. Jesus war religiös gebildet. Er wusste, an welchem Brunnen er sich befindet. Sowohl die JudenIsrael/Juden als auch die Samariter sehen beide Jakob als ihren Erzvater an, wollen aber miteinander keine Gemeinschaft haben. Also könnte es bei diesem Gespräch eigentlich um die Frage gehen, wem der Erzvater Jakob „gehört“, den Juden oder den Samaritern. Wollte Jesus eigentlich auf dieses Thema hinaus?
Also hatte er eigentlich keinen Durst? Dagegen spricht, dass hier ausdrücklich erzählt wird, dass Mittag war. JesusJesus Christus war vermutlich wirklich müde und durstig. Und er hatte schlecht vorgesorgt. Seine Jünger waren unterwegs; vermutlich hätten sie etwas zum Schöpfen dabeigehabt. Er offenbar nicht. Also ist er auf die Frau angewiesen und muss sie fragen.
Die Samariterin aber bemerkt, dass hier ein Tabu gebrochen wird: Ein JudeIsrael/Juden spricht mit ihr. Sie wird sich vielleicht weniger daran gestört haben als er es ihrer Meinung nach tun musste. Immerhin, so drückt sie das aus, haben damals die Juden von den Samaritern nichts gehalten. Das schließt die Möglichkeit ein, dass man umgekehrt aufgeschlossener war. Die Frau wird sich somit eher darüber gewundert haben, dass JesusJesus Christus sich nicht daran stört, sie anzusprechen.
JesusJesus Christus hat also Durst, aber die Frau entwickelt daraus umgehend ein Gespräch über religiöse Identität und bestimmt die wahre religiöse Identität über den Ort, an dem Jakobs Brunnen steht: Die wahren Nachkommen von Jakob wohnen dort, wo dieser Brunnen steht, den Jakob vererbt hat.
JesusJesus Christus lässt sich auf die Frage der religiösen Identität ein, obwohl er eigentlich ja nur Durst hat. Ihm bleibt auch kaum etwas anderes übrig, wenn er doch von der Frau Wasser haben will. Also redet er darüber, worüber sie reden will. Seine Position ist aber zwiespältig. Einerseits besteht er darauf, worauf jeder JudeIsrael/Juden bestehen würde, und hält den Brunnen für irrelevant für die religiöse Identität. Andererseits bietet er ihr aber auch Gemeinschaft an – zwar in einem zänkischen Ton, aber immerhin: „Wenn du erkenntest die Gabe GottesGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) und wer der ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken!, du bätest ihn, und der gäbe dir lebendiges Wasser.“ Jesus wäre also bereit, der Frau lebendiges Wasser zu geben, und zwar unabhängig von der unterschiedlichen religiösen Identität. Obwohl Jesus Gemeinschaft anbietet, gibt er seinen jüdischen Standpunkt nicht auf. Die Frau würde dennoch von ihm lebendiges Wasser bekommen, wenn sie es will.
Über die religiöse Identität setzt JesusJesus Christus die FreiheitFreiheit, die Befreiung von den alltäglichen Bindungen, welche die menschliche Identität prägen.
„Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige LebenLeben quillt.“
Das Symbol dieses lebendigen Wassers ist die Taufe. Auch sie führt in eine religiöse Identität, die aber die Prioritäten umkehrt. Sie lässt sich nicht von Traditionen oder Kulturen bestimmen, sondern umgekehrt bestimmt die Befreiung des lebendigen Wassers die religiöse Identität. Jesu Angebot ist eine religiöse Identität der FreiheitFreiheit, bei der eine Person sich nicht deshalb zu GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) zählt, weil der Brunnen Jakobs im eigenen Dorf steht, sondern weil sie Gott selbst erkennt.
Am Ende der Geschichte holt die Frau ihre Nachbarn herbei, weil sie so beeindruckt von JesusJesus Christus ist. Die Nachbarn wiederum laden ihn ein, ein paar Tage bei ihnen zu bleiben, und er bleibt. Und nachdem er sie verlässt, sagen die Nachbarn zu der Frau:
„Von nun an glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen; denn wir haben selber gehört und erkannt: Dieser ist wahrlich der Welt Heiland“ (Joh 4,42Joh4,42).
Die religiöse Identität vollendet sich in der religiösen Eigenständigkeit.
Der Geist Christi ist offenbar etwas anderes als das, was JesusJesus Christussagt. Was Jesus sagt, ist zänkisch. Er ist angriffslustig und er beharrt auf seinem Standpunkt. Was er mit seinen Worten erreicht, ist aber Gemeinschaft. Der Geist Christi, der über das hinaus geht, was Jesus sagt, überbrückt alte Trennungen zwischen JudenIsrael/Juden und Samaritern und führt in eine Gemeinschaft.
Dieser Geist muss auch etwas anderes sein als nur das, was JesusJesus Christus sagt: Denn der Geist Christi ist ja das, was jeder in sich selbst haben soll, der das lebendige Wasser in sich hat. „Das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden.“ Religiöse Eigenständigkeit durch den Geist Christi – das ist etwas, was MenschenMensch verbinden kann, und zwar obwohl sie alle ihren eigenen Standpunkt haben.
In dieser Situation, wo MenschenMensch ihren eigenen Standpunkt einnehmen und trotzdem eine Gemeinschaft bilden, entstehen auch schillernde Symbole dieser Geistgemeinschaft.
Würde man bei den Standpunkten bleiben – bei dem, was die reine Lehre sagt oder die Tradition ausdrückt –, wäre aus dieser zänkischen Unterhaltung keine Gemeinschaft entstanden. Aber der Geist Christi geht über feste Standpunkte hinaus. Er baut Brücken zwischen dem, was auseinander steht, und ist mehr als das, was Worte sagen können.
Nicht der Konsens führt zu Gemeinschaften, sondern der Geist, der sie verbindet, auch wenn sie im Dissens liegen. Der Geist Christi ist pluralismusfreundlich. MenschenMensch können diesen Geist nicht erzeugen. Die Geschichte zweier trotziger Gesprächspartner macht aber deutlich, dass dennoch Bindungen entstehen. Respekt vor einer pluralistischenPluralismus Gemeinschaft zeigt sich im Respekt vor dem Geist, der sich in ihr bildet. Dieser Respekt zeigt sich bei der Frau, die ihre Nachbarn herbeiholt, bei den Samaritanern, die JesusJesus Christus einladen, und bei Jesus, der bei ihnen verweilt. Warum sie sich so verhalten haben, erklärt sich nicht von ihren Standpunkten, sondern vom Geist, den sie achten, auch wenn die Kontroverse um den Brunnen Jakobs bestehen bleibt.
Biblische Alternativen
„Wer nicht gegen uns ist, ist für uns“ (Mk 9,40Mk 9,40). So kommentiert JesusJesus Christus die Taten eines Wunderheilers, der sich der Jesusbewegung nicht angeschlossen hatte. Unterschiede werden dadurch stark eingeebnet. Wie sehr sich Gruppierungen inhaltlich unterscheiden, spielt keine Rolle, solange sie sich nicht ausdrücklich bekämpfen. Inhaltliche Konturen von Bewegungen, Kulturen oder Religionen treten hinter diese pragmatische Entscheidung zurück.
Eine ethische Herausforderung liegt darin, dass diese pragmatische Entscheidung jederzeit wieder geändert werden kann, wenn die pragmatischen Kontexte sich verändern. Wenn etwa die Jesusbewegung mehr Macht besitzt, kann sie fremde Bewegungen unterdrücken, auch wenn diese nicht ausdrücklich gegen JesusJesus Christus sind. Pragmatik bietet also keine ethisch verlässlichen Kriterien, wie man sich im PluralismusPluralismus orientieren soll. Wie kann die Parole „Wer nicht gegen uns ist, ist für uns“ ethisch verlässlich gelesen werden, so dass sich alle verträglichen Gruppierungen darauf verlassen können, dass man ihnen nicht in den Rücken fällt? Was bedeutet also „nicht gegen uns“ ausgedrückt in ethischen Begriffen?
I.U. Dalferth: Kombinatorische Theologie, 65–72. – Zwischen verschiedenen Anschauungen und Moralkonzeptionen liegt kein allgemeiner Konsens, auf den sich alle MenschenMensch berufen könnten. Vielmehr prägen Menschen eine segmentäre Rationalität aus: Sie konstruieren je nach Gesprächspartnerin andere Argumentationsbrücken. Auf diese Weise können sie sich einigen und zugleich PluralismusPluralismus zulassen.
H. Schmitz: Der unerschöpfliche Gegenstand, 321–362. – Die moralische Orientierung wird atmosphärisch erschlossen, was Schmitz mit dem Heiligen GeistHeiliger Geist in Verbindung bringt. Aber da Subjekte von unterschiedlichen Atmosphären betroffen werden können, ist ein moralischer Relativismus unausweichlich. Er bedroht aber nicht den unbedingten Ernst ethischer Normen, sondern ist die Voraussetzung dafür, dass sie aus moralischen Gründen anerkannt werden und nicht nur aus Zwang.
4FreiheitFreiheit
Die Diskurslage
Man kann anzweifeln, dass der MenschMensch einen freien Willen hat, weil das Gehirn Entscheidungen schon getroffen hat, bevor sich das Ich bewusst macht, was es will.1 Daraus folgern einige Wissenschaftler, dass die moralische Zurechnungsfähigkeit des Menschen dann nur eine soziale Konstruktion (oder Fiktion) ist.2 Allerdings kann zwischen der Willens- und Handlungsfreiheit unterschieden werden: Auch wenn der Mensch nicht für seinen Willen verantwortlich ist, kann er für seine Handlungen verantwortlich gemacht werden.3
Die Fiktion, der MenschMensch hätte einen freien Willen, täuscht darüber hinweg, dass FreiheitFreiheit von anfänglichen Bindungen abhängig ist, denen Menschen nie entkommen. Sie entkommen daher auch nicht ihrer Freiheit,4 und zwar auch dann nicht, wenn sie an ihr scheitern.
Genau dieses Risiko des Scheiterns durch FreiheitFreiheit soll gegenwärtig durch Künstliche Intelligenz eingedämmt werden. Autonome künstliche Systeme sollen anstelle des MenschenMensch Entscheidungen treffen – in Lebenslagen, in denen es um LebenLeben und TodTod geht (autonom fahrendes Auto, Pflegeroboter), um RechtRecht und Unrecht (künstliche Assistenzrichter) oder Gewinn und Verlust (Computerbörsenhandel). Diese Transformation von Entscheidungen belegt, wie riskant es ist, dass Menschen frei sind, und zugleich, wie sehr sie die Kontrolle verlieren, wenn sie nicht mehr frei sein wollen.5
Vom Standpunkt der Theologischen Ethik ist FreiheitFreiheit daher ambivalent. Sie wird aus einem Grund hergeleitet, der ihr entzogen ist: Sie entsteht aus Widerfahrnissen, die MenschenMensch nicht herstellen können, an die sie aber gebunden sind6 und zu deren Bindung sie sich auch bewusst entscheiden können (positive Freiheit im Gegensatz zur Unverbindlichkeit der negativen Freiheit7). Weil Menschen an der Freiheit scheitern können, bleiben sie abhängig vom Grund ihrer Freiheit, der sie ihnen bleibend gewährt. Diese „schlechthinnige Abhängigkeit“ ist das theologische Moment der Freiheit.8
Wie zentral die menschliche FreiheitFreiheit in ihrer Ambivalenz für eine christliche Ethik ist, belegen die vielen biblischen Texte, die sie aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben und dabei jeweils andere Schwerpunkte setzen. Dem soll dieses Kapitel gerecht werden, indem es unterschiedliche Facetten des Freiheitsbegriffs beschreibt.
Zur Textauswahl
Die ausgewählten Texte dieses Kapitels entdecken einen Trend biblischer Freiheitsemphase, die sie mit der Bindung an GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) verbinden. FreiheitFreiheit ist sowohl in ihrer Konstitution als auch in den Folgen ihres Gebrauchs auf Bedingungen angewiesen, von denen sie sich wiederum nicht befreien kann. Die Angewiesenheit auf Gott markiert hier eine grundsätzliche existenzielle Abhängigkeit, dass Freiheit primär eine gewährte ist.
4.1Das Geschenk der FreiheitFreiheit (2. Mose 13,20–222. Mose 13,20–22)
20 So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste.
21 Und der HERR zog vor ihnen her, am Tage in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten.
22 Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage noch die Feuersäule bei Nacht.
Wann haben die Israeliten eigentlich geschlafen? Folgt man dem Text, dann anscheinend nie! Denn sie wanderten Tag und Nacht. Aber weil man nun einmal schlafen muss, kann die Geschichte wohl nicht wortwörtlich so passiert sein, wie sie hier erzählt wird. Unvermeidlich wird allerdings gewesen sein, dass die Israeliten sich bewegen mussten – mehr, als ihnen lieb war, und mehr, als sie eigentlich an Erholung brauchten.
Zugleich ist merkwürdig an dieser Geschichte, dass sich das Volk IsraelIsrael/Juden am Rande der Wüste „lagerte“, sich also ausruhte und folglich stehengeblieben sein musste. Denn im nächsten Moment „zog der HERR vor ihnen her, um sie den rechten Weg zu führen.“ GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) könnte also das sich lagernde Volk aufgescheucht haben, dass es weiterziehen musste.
Vom Volk IsraelIsrael/Juden erzählt die Bibel, dass es immer wieder die Sehnsucht hatte, nach Ägypten zurückzukehren, so wie es gewohnt war zu leben, in dem Land, in dem die meisten von ihnen geboren, unterdrückt und von der ägyptischen Mehrheitsgesellschaft versklavt wurden (2. Mose 16,32. Mose 16,3). Vom Standort der Wüste aus hätten sie sich in der Sklaverei wohler gefühlt, als in die FreiheitFreiheit herausgeführt zu werden. Aber GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) führt sie in die Freiheit. Das spürt man, wenn sich die Flüchtenden in der Wüste lagern, aber Gott sie aufscheucht, damit sie frei werden.
Irgendwie gehen sie doch freiwillig mit. Sonst müsste GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) sie vor sich hertreiben und folglich hinter ihnen stehen. Aber Gott geht „vor ihnen her“. Und wer vorgeht, dem folgt man freiwillig. Das Volk folgt der Wolke nach. Somit werden sie doch freiwillig den Weg in die FreiheitFreiheit gegangen sein.
Diese knappe Erzählung ist eine Geschichte der FreiheitFreiheit, die darauf aufmerksam macht, dass der MenschMensch nicht von Natur aus frei ist. Er muss dazu vielmehr angestiftet werden, frei zu werden. Aber dann gehen Menschen diesen Weg auch freiwillig mit.
Ist FreiheitFreiheit überhaupt eine typische menschliche Sehnsucht? Mindestens ebenso sehr sehnen sich MenschenMensch nach festen Bindungen, nach vorgegebenen Traditionen und manchmal auch danach, dass andere stellvertretend für sie schwerwiegende Entscheidungen treffen. Und sind Menschen eigentlich frei, die immer alles so machen wollen, wie sie es gewohnt sind? Fördert es die Freiheit, alte Gewohnheiten zu wiederholen? Wie würde diese biblische Geschichte darauf antworten?
In ihr GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) begegnet den MenschenMensch auf zwei Weisen, zum einen verlässlich „Tag und Nacht“, also in alter Gewohnheit. Aber zum zweiten begegnet Gott so, dass alte Gewohnheiten verunsichert werden, so dass der Mensch gezwungen ist, etwas zu ändern. Oder anders: Der Mensch wird gezwungen, sich frei zu verhalten. Denn frei verhalten wir uns nur dann, wenn wir auf etwas Unvorhergesehenes reagieren müssen.
Die Geschichte verbindet beides miteinander: GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) führt also „Tag und Nacht“ in die FreiheitFreiheit, also verlässlich dahin, dass MenschenMensch auf Unvorhergesehenes frei reagieren. Deshalb ist die Sehnsucht unrealistisch von allen, die lieber wieder zurück wollen zu den Fleischtöpfen Ägyptens oder zur guten alten Zeit, wo die Obrigkeit festgesetzt hat, was zu tun ist. Gott bringt Menschen verlässlich in Situationen, in denen sie nicht einfach auf Traditionen zurückgreifen können, sondern selbst entscheiden müssen, was sie nun tun werden.
MenschenMensch könnten nicht flexibel reagieren, wenn nichts Unvorhersehbares passieren würde. Unsere FreiheitFreiheit verdanken wir also Situationen, wo wir aufgescheucht werden, während wir uns eigentlich gemütlich lagern wollten.
GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) mutet uns zu, freie MenschenMensch zu sein, und zwar Tag und Nacht. Vielleicht gefällt uns das nicht, und wir wünschen uns dann lieber einen Gott, der uns verlässlich in Ruhe lässt. Aber es geschehen eben unvorhergesehene Ereignisse. Und darauf kann man nur realistisch reagieren, wenn man frei ist. Offenbar will Gott, dass wir frei sind – während wir vielleicht feste Gewohnheiten lieber haben. Aber wenn wir dann befreit sind, dann folgen wir unserer FreiheitFreiheit auch freiwillig, so wie das Volk IsraelIsrael/Juden freiwillig der Wolkensäule gefolgt ist.
Es ist nicht zu erwarten, dass man stets atemlos von einer Unvorhersehbarkeit zur nächsten stolpert. Man muss eben zwischendurch auch schlafen und sich lagern. GottGott (s. Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist) begegnet eben nicht nur, wenn etwas Neues passiert, sondern auch auf verlässliche Weise, eben „Tag und Nacht“. Aber auch wer sich lagert, wird immer wieder überraschend von irgendetwas heimgesucht. Auch darauf können wir uns verlassen. Und wir können uns dann darauf verlassen, dass uns die FreiheitFreiheit bleibt, darauf zu reagieren.