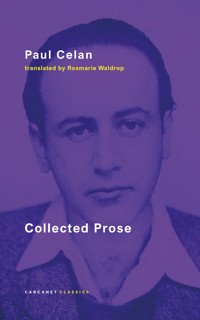89,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Paul Celan, der meistgedeutete deutschsprachige Dichter nach 1945, ist auch der Autor eines eminenten Briefwerks. Mit dieser Ausgabe wird es nun erstmals als eigenes Werk sichtbar: in 691 Briefen, davon 330 bisher unpubliziert, an 252 Adressaten. Wer sind die Adressaten? Es sind die Mitglieder der Familie, geliebte Frauen, befreundete Autoren, sehr junge und begeisterte Leser, Übersetzerkollegen, französische Philosophen ebenso wie deutsche Germanisten und die Mitarbeiter vieler Verlage. Aus alledem entsteht in chronologischer Folge über vier Jahrzehnte ein Leben aus Briefen.
In ihnen zeigt sich Celan als herausragender Korrespondenzpartner mit einer enormen stilistischen Bandbreite, ausgeprägt in seiner Fähigkeit, auch auf Unbekannte einzugehen. Die Briefe offenbaren eine Vielzahl bisher verborgener biografischer Fakten, ermöglichen eine Präzisierung seiner Poetologie und zeigen ihn zugleich als Menschen in seinem ganz gewöhnlichen Alltag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1826
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Paul Celan
»etwas ganz und gar Persönliches«
Briefe 1934-1970
Ausgewählt, herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann
Suhrkamp
Inhalt
Briefe
Kommentar
Paul Celan – Ein Leben in Briefen
Zur Edition und Textkonstitution
Zum Kommentar
Register
Verzeichnisse
Erstkommentare zu Ortsangaben
Einzelkommentar
Personen- und Adressatenverzeichnis
Werkregister Paul Celan
Rechtevermerk
Briefe
1 An Minna Brettschneider, Czernowitz, 30. 1. 1934
Czernowitz, den 30 Jänner 1934
Liebe Tante Minna!
Vor allem entschuldige mir, bitte, das Nichtschreiben. Eine Motivierung für dasselbe habe ich auch nicht. Also, pardonnez-moi, bitte!
Was Angelegenheit Zeugnisa betrifft, ja, hm! ich bin der Zweite, aber ‥‥ nicht der erste, wie es von Rechtswegen hätte sein sollen. Die Professoren,1 die Angehörigkeit zum jüdischen Zweig der semitischen Rasse, und noch viele andere Hindernisse! Ja, was den Antisemitismus in unserer Schule betrifft, da könnte ich ein 300 Seiten starkes Buch darüber schreiben. Als Beispiel diene Dir nur die Tatsache, daß mein Herr Geografieprofessor, Zoppa nennt sich das Übel, schon zwei Monate »sitzt«,b wo, kannst Du Dir schon denken.
Du wirst ja wahrscheinlich wissen daß Onkel David2 schon hier ist. Ich vertrage mich sehr gut mit ihm. Wir sind sogar dicke Freunde.
Leider habe ich heute nicht in die Schule gehen können, da ich gestern am Eis gefallen bin und mir den Popo tüchtig zerschlagen habe. Es sei zu Deiner Beruhigung gesagt, es ist schon Alles bald wieder gut. Diesem ersteren Umstand hast Du es zu verdanken daß Du schon jetzt Antwort bekommst; sonst, wer weiß wann ‥‥.
Tante Regina3 kommt in der letzten Zeit sehr oft zu uns.
Wie geht es Dir? Hast Du schon welche Arbeit? Wie ist's mit der Wohnung? Schreibe bitte darüber.
Und wie geht's mit den Sprachen? Speake-you English? Und Hebräisch?
Mit den herzlichen Grüßen und Küssen
verbleibe ich Dein
Paul
P. S. Grüße an Donia4
D. U.5
Jetzt bist Du ja in Palästina! Schicke mir bitte dortige und sonstige fremde Marken. Du weißt ja ich bin Markensammler
2 An Gustav Chomed, Tours, 7. 12. 1938
Tours, am 7 Dezember 1938.
Mein lieber, lieber Gusti,
Es ist eine riesige Schuld, daß ich Dir bis heute nicht schrieb. Es ist mein einziger Trost, daß ich weiß, Du würdest es mir verzeihn, wärst Du hier, hier in Tours und könntest mich sehn, meine Lage hier sehn, meine unerträgliche Lage. Siehst Du, ich weiß, Du könntest es mir verzeihn. Ich weiß es. – Von heute an werde ich Dir oft schreiben, sehr sehr oft, Du wirst ja sehn. Übrigens – ich hatte schon zwei Briefe an Dich geschrieben, als ich in Paris war und ich konnte sie nicht wegschicken, da ich wußte wie unsicher mein Bleiben in Paris sei und da ich Dir ja eine Adresse angeben wollte, damit auch Du mir schreibst. Jetzt kann ichs tun …
Ich hatte Dir von der Reise geschrieben, von der weiten Reise, die eine große Anspannung war, manchmal eine frohe Anspannung. Und von allen Ländern, die ich sah, hatte ich Dir geschrieben, von allen und von Deutschland.1 Von Deutschland … Ich will Dir alles noch einmal erzählen, aber diesmal kann ichs nicht tun, glaub mir, ich kanns nicht. Es wäre eine Mühe, die ich nicht ertrüge. Denn sieh: ich war über zwei Wochen in Paris, fast drei Wochen war ich dort. Ich wäre dort geblieben, wär es nicht so teuer gewesen, ja, für mich allein war es zu teuer, der Kerl, der ja mit mir hätte wohnen sollen, mußte weiter, nach Tours. (Im Grunde trägt er ja gar keine Schuld.)a Ist man so weit fort und allein, fühlt man die Bürden, die die Leute in der Heimat tragen müssen, damit man hier sein kann, doppelt. Mein Vater2 ist kein reicher Mann und dazu schwach. Nur Tours ist billiger als Paris. – Schau, in Paris ist es so, daß überall das Leben herumsteht, auf den Straßen und in den Häusern, überall. Da ist Notre-Dame und der Louvre und das Musée Rodin, Kirchen und Gärten, Konzerte, Theater. Tours, das ist Öde, Alleinsein, Bangnis. Und deshalb ist es so, daß abends – jetzt ist gerade auch Abend – daß abends mein Alleinsein fühlbarer wird und die Trauer größer. Ich wollte Dir schon gestern abends schreiben, aber ich konnte es nicht, weil ich weinen mußte, weinen, weinen, weinen. Ach, Du weißt wirklich nicht, Du kannst es nicht wissen, was das heißt, allein sein, so fürchterlich allein. Was soll ich Dir sagen darüber? Nur ich habe überhaupt keinen Trost, überhaupt keinen Trost. Oder vielleicht hab ich einen – wenn Tränen ein Trost sind. Ich hab viele Tränen. Ich weiß nicht, ob es mir ganz gelingt verständlich zu sein; so verständlich, wie ich vielleicht sein könnte, wenn wir miteinandergingen. Nah nebeneinander, und es wäre dunkel, und ich würde ein einfaches Wort davon sagen, ein schlichtes Wort ‥ Du würdest alles begreifen, auf einmal ganz begreifen, denn solch ein Wort ist wie eine Träne. Siehst Du, es wäre ein Trost, wenn ich nur Deine Hand hierhätte und sie wäre offen und hielt eine Träne, die mir gehört. Es wäre ein Trost.
Ich weiß nicht ob das Gewinn ist oder Verlust: daß ich hier bescheiden werde, in einem weiten Sinn bescheiden und geneigt vieles zu lieben, was ich früher verwarf, hörst Du: zu lieben. Und daß mir auf einmal ist, als könnte ich es wirklich tun, – während ich dieses schreibe, fällt mir ein, daß ich einmal eigentlich ähnlich dachte, diese Gedanken aber später »überwand«.3
Als ich anfing, Dir diesen Brief zu schreiben, dachte ich, das Papier würde gar nicht reichen, wenn ich Dir darauf schreiben sollte von all meinem Kummer. So groß ist er. Ist das nicht öde?: vormittags Travaux pratiques, praktische Arbeiten, on détermineb la densité d'un corps solide, d'un liquide,4 man schneidet einem Blutegel den Bauch auf, man zählt die Gedärme, dann zeichnet man sie; nachmittags Vorlesungen ‥
Siehst Du, sie sollen mehr als ein Brief sein, diese Zeilen hier. Sie sollen sein – ich sagte es schon – wie ein verdunkeltes Gespräch. Wenn Gespräche alles sein können ‥
In Paris, wo ich auch oft traurig war, traurig und bekümmert, ging ich in eine Kirche. Meist war es Notre-Dame. Da geschieht es nun, daß man zwar nicht von seiner Bangnis erlöst wird, nein, im Gegenteil, es ist so, daß man eine größere Bangnis fühlt, eine geläuterte Angst, die ein Größerer als wir trägt. Dann ist es, als müßte man Jenem eine Last von den Schultern nehmen oder aus den Händen, oder ein Stück Trauer aus seinem Blick oder die Schwerfälligkeit seines fliegenden Atems. Und Jener sind ja wir alle ‥ Es ist fast wie aus Eigensinn, wenn wir ihm helfen.
Und sieh, wir wachsen immer an fremdem Kummer /oder eigenem?/. Ich sah einmal einen Blinden im Louvre. Vor den Farben einen Blinden. Soll ich da noch weiter reden? Begreifst Du's?
Denn Leben, fällt mir ein, ist hier dies: die Atemnot der Armut und die Verzerrtheit des Hungers und sein Haß und tausendtausend gleiche Gesichter, wirre und einfache Gesichter und der Staub in den Falten der Mäntel und das Grau der Straße und eine ferne Freundschaft (wenigen) und viel Gier und ein lächerlicher Tod ‥ Und die Liebe? Die Liebe vielleicht …
Ich kann nicht weiterschreiben. Aber ich verspreche es Dir, von nun an, oft, oft, oft, zu schreiben. Schreib auch Du mir oft. Schreib mir gleich, schreib mir ‥
Dein
Paul
/Schreib mir auch Onius5 Adresse
Hat er meine Karte bekommen?
War die Adresse richtig?/
3 An Friederike Antschel, wohl Tours, Anfang Mai 1939
Anfang Mai 1939 –
Mama, meine liebe, gute Mama,
Sonntag ist Muttertag, ich freu mich schon lange drauf, nun kann ich diesen Brief schreiben.
Wie ich hier lebe, einsam und ungeduldig, und verzichten mußte auf die meisten Gewohnheiten meines Herzens (ich hatte sie steigern und vermehren wollen ‥), ist mir jeder geringste Anlaß, das Beiläufige des täglichen Lebens zu vergessen, eine kleine Freude.
So denk ich mir diesen Brief, der Dich an Deinem Tag, am Muttertag erreichen soll, aus lauter Gefühl, das Dir gehört.
Oft, wenn mir ist, als hörte mein Leben auf, sinnvoll zu sein, und eine fürchterliche Trägheit mich einkreist, weiß ich mir keinen andern Rat, als an Dich zu denken. Entstehn Briefe in mir, so sind sie alle wie ein Hilferuf, und wer hört ihn?
Jetzt aber ist mein Brief lauter Ruhe, denn ich weiß, Du bist da, immer ‥
Dein
Paul
4 An die Medizinische Fakultät Tours (Verwaltung), Czernowitz, 16. 9. 1939
Cernauti,1 le 16 septembre 1939.
Monsieur le Secrétaire,
En raison de la guerre je me vois obligé de continuer mes études en Roumanie. Je vousa prie donc, Monsieur le Secrétaire,b de bien vouloir me renvoyer mon Diplôme de Baccalauréat (l'original roumain) et le Certificat d'Etudes P. C. B.2 que j'ai obtenu à la session d'été 1939. J'ai besoin de ces deux documents pour continuer mes études de médicine.
Je me permets de souligner encore une fois l'importance capitale qu'ont pour moi les deux diplômes et je vous prie, Monsieur le Secrétaire, de me les envoyer le plus tôt possible dans un envoi recommandé.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, l'assurance de ma plus profonde reconnaissance
Paul Antschel
10, str. Masaryk
Cernauti, Roumanie
Annexés, pour frais d'envoi recommandé, 4 coupons-réponses internationaux
Czernowitz, am 16. 9. 1939. / Sehr geehrter Herr Sekretär, / Wegen des Krieges sehe ich mich gezwungen, meine Studien in Rumänien fortzusetzen. Ich bitte Sie daher, sehr geehrter Herr Sekretär, mir mein Abiturzeugnis (das rumänische Original) und das PCB-Diplom,2 das ich bei den Prüfungen im Sommer 1939 erworben habe, zusenden zu wollen. Ich brauche diese beiden Dokumente, um mein Medizinstudium fortsetzen zu können. / Ich erlaube mir, noch einmal die außerordentliche Bedeutung hervorzuheben, welche die beiden Zeugnisse für mich haben, und bitte Sie, sehr geehrter Herr Sekretär, sie mir so schnell wie möglich als Einschreiben zurückzusenden. / Hochachtungsvoll / Paul Antschel / Masaryk-Str. 10, Czernowitz, Rumänien / Beigefügt als Porto für das Einschreiben: 4 internationale Antwortscheine
5 An Ruth Kraft, wohl Fălticeni, ca. 23. 7. 19421
Ruth, meine gute Ruth,
ich kann Dir jetzt schreiben, wie es mir geht, aber ich weiß nicht wie, glaub es mir. Im Brief an Edith2 steht einiges, das Wichtigste über meine Arbeit usw., ich habe nichts hinzuzufügen. Im allgemeinen geht es mir gut hier.
Aber Du, Ruth. Du? Ich bin so besorgt Euretwegen. Aber was kann ich denn sagen zu alldem? Du fragst mich in Deiner letzten Postkarte, ob ich schreibe. Nein, Ruth, es fehlt mir jeder Anlaß dazu. Überhaupt glaube ich, daß Dein Buch – wenn es je ein Buch3 wird – abgeschlossen ist, höchstens einige Gedichte werde ich noch hinzufügen können. Es tut mir nur leid, daß ich die Gedichte nicht ordnen konnte, aber vielleicht kann ich es noch tun, einmal.
Du schreibst, jetzt verstehst Du die Gedichte besser: hatte ich nicht recht, als ich es Dir voraussagte, weil ich selber viele von ihnen schrieb mit dem Gefühl, sie bleiben da und ich bin weit fort. Weit fort bin ich ja eben nicht, aber immerhin ‥
Ich hoffe, Ruth, es wird alles wieder gut bei Dir, Du hast das so nötig. Was ist mit Georg?4
Meinetwegen sei unbesorgt, ich bin ruhig, ruhiger als Du es Dir vielleicht vorstellst. Du schreibst, ich soll nicht verzweifeln. Nein, Ruth, ich verzweifle nicht. Aber meine Mutter5 tut mir leid, sie war so krank in der letzten Zeit, sie denkt sicherlich fortwährend, wie es mir geht, und so ganz ohne Abschied bin ich weg, wahrscheinlich für immer. Auch an Frau Alper6 denke ich viel: was sie fortwährend mir entgegentrug, war alles was sie besaß: sie bot es mir mit dem Herzen und ich nahm es kaum mit der Hand. Und ich weiß, wie das ist.
Nicht Bitternis spricht zu Dir, Ruth, sondern im Gegenteil, größere Einsicht als je.7
Wie einst und wie immer seh ich Dich an und will Dich küssen, und während ich das schreibe, glaub es mir, sind Tränen in meine Augen gekommen
Dein
alter Paul
6 An Ruth Kraft, wohl Fălticeni, 31. 8. 1942
– Puppenspiel –
Wem in dem Land der schmerzlichen Beweise
bringt dieses Leben hölzernen Bescheid?
Das Jahr zieht in den Ebenen die Kreise.
Den Puppen blüht es leise um das Kleid.
Das tolle Kasperl und der freche Kater;
die Maid der Stille, der Korsar vom Meer:
Für alle sorgt der große Puppenvater
mit Drähten, Farbe und mit Teer ‥
Daraus entwirft ihr schlafendes Gefühl
die Welt der Tränen und der Flammenwinke ‥
Und niemals wird ihnen die Bühne schwül.
Trotz schlechter Winde und trotz schlechter Schminke.
Doch vielen beben manchmal unterm Holz
die großen Herzen aus Papier und Kleister.
Dann bäumt sich seltsam weh ihr Puppenstolz
gegen den Draht und gegen seinen Meister.
Dann geben ihre Hände, ihre Knie,
nur schwer die vielen fremden Zeichen weiter,
die alles andre sind, und doch nur sie,
auf ihrem Weg zur schwanken Himmelsleiter …
Der Hand am Draht entrollt der Würfel Liebe.
Dem sieht ein Glasaug nach, verzückt und scheel.
Dann fragt sich stumm, ob ihr kein Lächeln bliebe,
die Puppe ohne Falsch und ohne Fehl ‥
Mitunter aber spielen sie das Spiel ‥
(Und sind fast froh, daß sie es spielen dürfen?)
›Wir wissen von der Täuschung viel zu viel:
was gebt ihr uns den Wein der Welt zu schlürfen?‹
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vom Aste baumelt jetzt der Neunmalkühne ‥
Die Winde stolpern in ein Morgenrot ‥
Mit roten Buckeln grüßen von der Bühne
der Affe Leben und der Affe Tod.
x
31. VIII. 42.
Liebe, ich schicke Dir diese Verse, die einen Monat alt sind und nur flüchtig aufgeschrieben. Ein bindendes Gefühl fehlt ihnen wahrscheinlich.
. . .
Ja, Ruth, es sind zwei Jahre.1 Ich knie in Deinem Herzen.
. . .
Ich hatte gestern indirekte Nachricht von Fritzi. An einen Jungen, der hier arbeitet und seine Eltern drüben hat. Sie sind in Ladijin.2 Ich selber habe, trotz vieler Karten, persönl. keine Nachricht.
Ruth, ich esse hier wirklich genug. Genug Brot (soviel ich will), auch Früchte. Schicke kein Paket; wenn ich etwas brauche, schreib ich Dir. Auch wegen des Geldes.
Küsse
Paul
7 An Ruth Kraft, Tăbăreşti,1 6. 4. 1943
6. IV. 43
Liebe, ich bin bestürzt über diesen Brief, der so spät kam, obwohl aus ihm schon Beruhigung spricht. Ich war schon beunruhigt, zwölf Tage lang keine Post von Dir zu haben, – Gottseidank, daß alles gut ablief.
Ich habe mir, als ich davon hörte, gleich gedacht, daß der Tod der kleinen Mila Harth2 viel Unheil in den Gemütern verschiedener Bekannter (Ginninger,3 Silbermann4) anrichten wird, daß aber der Tod einer immerhin Fremden (oder nicht?)aDein Gemüt so erschüttern würde, konnte ich nicht übersehn. Daß ich nun Zusammenhänge vermuten muß (um Gotteswillen, Ruth, es sind doch auf keinen Fall Zusammenhänge!) ist mir furchtbar. So furchtbar, daß ich die Tragik dieser schrecklichen Verwirrung eines geblendeten Herzens aus den Augen verliere. – Schreibe etwas deutlicher, Ruth, bitte. Ich hoffe, Du bist nun ganz ruhig, ja? –
Was ist mit Alexandrescus5 Übersiedlung, das ist doch von Wichtigkeit, – warum schreibst Du nicht darüber?
(Eine Bitte, die meine Gedichte6 betrifft: die Übersetzungen nicht mit den übrigen Gedichten zu binden (sondern überhaupt nicht); keinen Namen auf das Titelblatt zu schreiben und keinen Titel, höchstens: ›Gedichte‹.)
Ich bin glücklich, meine Ruth, daß das Schlaflied7 dazu beitrug, Dich zu beruhigen; ich bin glücklich.
Geliebte, wir wissen doch, daß Menschenschicksal etwas Wirres und Dunkles ist, und wir wissen es von uns selbst. Aber wir werden doch reifer und dürfen uns nicht mehr so fürchterlich erschüttern lassen von Schwerem, wenn es auch eigenem Schweren ähnlich sieht, dazu verpflichtet uns doch vieles Gemeinsame, nicht wahr? – Ich liebe Dich, Ruth, – reicht Dir das nicht, in ängstlichen Stunden,b zu einem Gefühl der Geborgenheit aus? Das Schlaflied hat Dir Deine Trauer nehmen können und das Schlaflied ist doch nichts als ein einziges Wort unter tausend unsäglichen.
Dein bekümmerter
Paul
Ich füge ein kleines Gedicht hinzu, – vielleicht kommt es recht ‥
8 An Ruth Kraft, Tăbăreşti, 16. 4. 1943
16. IV. 43.
Von diesen Stauden mit dem rötlich-weißen
Geheimnis ist dein dunkles Herz erfaßt.
An deinen Wangen laß mich, an den heißen,
verweilen mit dem Duft vom Seidelbast.
Was sich entschließt an deinem Blut zu leuchten,
ist, sagen sie, beseelt von einem Gift ‥
Ist es von einem Schimmer, einem feuchten,
das dich verwandelt und mich übertrifft?
Wie nie, Geliebte, ist die Nacht heut zart.
Die kleinen Blüten flüstern dir Befehle.
So bleibt, was dir mein Herz vertraut bewahrt,
ein starker Duft im Süden deiner Seele.
Chérie, nun ist mir ein viertes Blumengedicht gelungen und dazu eines vom Seidelbast. (Hast Du die andern drei – ›Tulpen‹, ›Rosenschimmer‹ und ›Windröschen‹ – bekommen?). In einer Landschaft, der auch die allergeringste Blume fehlt, kann ich diese Gedichte schreiben – auch Du mußt glücklich sein darüber, denn ein Wunderbares ist möglich geworden durch Dich. Ja, Ruth, meine Gedichte sind reifer geworden und schöner, und vielleicht kannst Du schon stolz sein, daß sie Dir gehören.
Dein Paul
9 An Ruth Kraft, Tăbăreşti, 23. 8. 1943
23. VIII. 43
Ich schreibe für den Abend des sechsundzwanzigsten August.1 Ich will etwas in Deine Hände legen, Ruth, wie damals mein Leben in Deine Hände gelegt wurde, seltsam, im Taumel und tönend. Was ich über die Ferne hinweg schenken kann, als einen Schimmer, als einen leisen Ruf (wo ist die Beredsamkeit des sternhellen Herzens, wo ist der Rausch der Gärten?) ist nur ein Gedicht. Es will für einen Augenblick (oder für viele?) den Atem einer südlichen Landschaft durch Dein Haar wehen lassen, und wenn das Meer Deinen Blick dann wieder losläßt, hofft einer der im Dunkel weilt, nahe, mit den Wellen der einzig Wirkliche zu bleiben.
Das Gedicht lehnt sich an ein provençalisches Lied2 an, das Du vielleicht kennst: ›O Magali, ma tant amado, mete ta tèsto au fenestroun‹ (O Magali, ma tant aimée, mets ta tête au fenêtron).
Wenn ich Dich jetzt ansehe, erstaune ich wie damals von dem Glanz Deiner Augen.
Dein
Paul
Das Fenster im Südturm.
Dir sinkt die Schwinge vor dem Niederschlag
der Stille: Pfeile gehn in schrägen
tiefgrünen Sträußen nieder in den Rosenhag.
Doch weht mein Blut dem Kirschenbaum entgegen.
Wenn nicht mein Aug der Wolkenspiegel wär,
erriet der Turm den Schimmer deiner Hände?
Wo der Jasmin den Blick allein läßt, ist das Meer.
Und weiter unten ist die Welt zuende.
Ist noch dein Mund ein Nest von Schlangenbissen,
und von der Lanze blutig noch mein Knie:
Hier kann dein Herz, dem schwarzen Stern entrissen,
mir leicht sein wie ein Mondstrahl, Magali.
10 An Ruth Kraft, Tăbăreşti, 22. 12. 1943
22. XII. 43.
Meine teuere Ruth,
eben ist der Brief mit dieser wunderbaren Nachricht1 gekommen. Ach Ruth, ich bin so glücklich, ich kann es nicht fassen. Wenn es nur wahr ist, liebe, liebe Ruth, wenn es nur wahr ist! Geliebte, Ruth, meine süße, meine einzige Ruth, ich weiß wirklich nicht, wie ich dazu Worte finden soll. Hoffentlich kommt bald nähere Nachricht.
Liebe, ich habe von all Deinen Briefen nur zwei (mit diesem letzten) bekommen,a jetzt kann ich wenigstens froh sein, daß Du meine Briefe (und vor allem den Geburtstagsbrief2 – hoffentlich rechtzeitig –) bekommen hast.
Von Hans Castorp3 habe ich Nachricht, er wohnt sehr gut, auf einem Gutshof, und ist gesund.
Chérie, gestern ist hier zum erstenmal Schnee gefallen, ich war allein auf der Landstraße, allein, ohne Dich, und habe denken müssen, wie schön es wäre mit Dir zu sein, auch im Winter, und nachhausezugehn im Schnee ‥
Ich sehne mich nach Dir, Ruth, ich sehne mich unsagbar.
Alles ist öde, wo Du nicht bist, ich möchte eilen zu Dir, jede Stunde, jeden Augenblick, wie hat das nur sein können, daß ich schon so oft fortmußte? Ich bin glücklich, daß Du da bist, ich lebe, weil Du lebst, und ich bin stolz auf Dich und auf diese ganze lange Zeit, wo wir schon zusammen sind. Was brauchen wir noch Worte, Ruth, wir sind doch glücklich!
Ich umarme Dich noch viel fester und küsse Dich tausendmal
Dein
Paul
Es ist nicht ausgeschlossen, daß wir am ersten Jänner nachhausefahren.4
11 An Ruth Kraft, Tăbăreşti, 9. 1. 1944
9. Jänner 44.
Geliebte,
das soll nun ein Brief werden, rasch, in aller Eile – wie wird er sein?
So viel möchte er sein und doch bin ich froh, daß ich ihn schreiben muß ohne nachdenken zu können, ohne viel zu überlegen, daß er vielleicht so sein kann wie meine Sehnsucht nach Dir, wild, unüberlegt, nur unterwegs, über den Schnee, über die Fernen, zu Dir, Ruth, zu Dir.
Siehst Du, Dein Brief ist nun da und viele wichtige Dinge stehn drin, die Nachricht von meinen Eltern1 und jene andere,2 von der mein Herz jetzt ganz erfüllt ist, obwohl sie doch nichts bedeutet als eine kleine Möglichkeit, ein schwankendes Vielleicht für uns – aber ich will nicht denken, es begeistert mich irgendwie, wahrscheinlich begeistert mich nicht einmal die Möglichkeit, sondern der gemeinsame Weg, bin ich glücklich, daß am Kreuzweg nicht mehr Abschied ist, sondern wira und dasselbe Leben.
So, und nur noch, daß Glahn3 mir schreibt. Daß er schreibt, er möchte mit Edvarda3 sein, mit ihr bleiben oder mit ihr fahren. Daß er wissen möchte, wie das mit ihrer Mutter werden soll. Ihn, schreibt er, kann nichts von seinem Entschluß abbringen, nichts, nie, niemals, als höchstens das Wissen um die Unentschlossenheit ihres Herzens. Aber er weiß, wie stark sein Gefühl ist und er vertraut ihm. Und dem seltsamen Stern. Und den Augen aus Samt. Die trägt er herum durch den Wald (wo er an Schafgarbe denkt), und fährt hinaus übers Meer.
Ja, er ist ein Schwärmer, dieser Glahn ‥
Aber ich denke, daß Edvarda sich freut.
Ruth, Ruth, Ruth, ich bin einsam – was liegt dran – Wenn ich nur bald bei Dir bin!
Aber ich werde kommen, jeden Tag bin ich näher, und dann bleib ich bei Dir, hörst Du: ich bleibe.
Dein
Paul
12 An Erich Einhorn, Kiew, 1. 7. 1944
Kiew, 1 Juli 1944.
Lieber Erich,
ich bin für zwei Tage in Kiew (auf Kommandirowka)1 und freue mich auf die Gelegenheit, Dir einen Brief zu schreiben, der Dich rasch erreicht.
Deine Eltern2 sind gesund, Erich, ich habe mit Ihnen gesprochen, bevor ich hergekommen bin. Das ist sehr viel, Erich, Du kannst Dir nicht vorstellen, wie viel.
Meine Eltern sind von den Deutschen erschossen worden. In Krasnopolka am Bug.3
Erich, ach Erich.
Lieber Erich, wo ist Tanja Adler?4 Ich weiß nur, daß sie lebt, aber wo ist sie? Schreibe ihr, Erich, daß ich lebe, daß ich sie bitte, mir zu schreiben. Auf meine alte Adresse. Viel ist zu erzählen. Du hast soviel gesehn. Ich habe nur Demütigungen erlebt und Leere, unendliche Leere. Vielleicht kannst Du nachhause kommen. Konrad Deligdisch ist gekommen.
Frau Alper, unsere gute Frau Alper, ist tot ‥ Gerta ist in Czernowitz.5
Erich, bitte, schreibe Tanja, oder vielleicht telegraphierst Du.
Wo ist Erika,6 ihre Mutter weiß nichts über sie.
Ich umarme Dich, Erich,
Dein alter
Paul
13 An Max Rychner, Bukarest,1 3. 11. 1946
Bukarest, am 3. November 1946.
Sehr verehrter Herr Rychner,
wie Ihnen danken? Wie Ihnen sagen was Ihr Brief an Herrn Alfred Sperber2 für mich bedeutet? Vielleicht, indem ich Ihnen erzähle, daß beinah jedes meiner Gedichte von dem Gefühl begleitet war, ich hätte nun mein letztes Gedicht geschrieben, es wäre mir eine allerletzte Gnade zuteil geworden, oder – und jetzt, da ich mich dessen wieder entsinne, weiß ich es deutlicher – es war oft auch nicht mehr jenes Gefühl, sondern das Rauschen nur einer fremden (finsteren) Schwinge, ihr Verrauschen, das durch mich verklang, die Mahnung des unsichtbaren Engels, ein Wink, den ich kaum mitzuteilen vermochte.
Gelingt es mir, Ihnen zu sagen wie allein ich war? Allein, nicht etwa weil ich rief und niemand war da, mich zu hören. Einige hatten mich rufen hören, aber wer waren sie? »Du rufst, hielten sie mir entgegen, aber so wird nicht gerufen. Hast du geglaubt, uns zu verblüffen, wenn du also rufst. Rufe anders.« Mir ward es angst, denn ich wußte nicht, daß ich nicht sie gerufen hatte. Und dann schwieg ich. Später versuchte ich es wieder, aber ich rief nicht mehr so laut. Ich rief auch nicht mehr in dieselbe Richtung, ich wollte auch nicht gehört werden, ich rief mich selber. Und so lernte ich, langsam, mir Antwort geben. War es nur dies? Nein, denn ich rief auch die Kastanien an, den Rotdorn und die Gräser, ich rief eine Frau, ich rief sie alle und sprach auch zu ihnen, bis wir vertraut wurden und auch flüstern konnten. Am Ende kannten wir einander so gut, daß es eine stumme Unterhaltung wurde. So brach eine Zeit redeerfüllten Schweigens an und ich schrieb keine Gedichte. Ich glaube, damals wußte ich schon, daß ich ein Dichter war.
Habe ich von Rufen gesprochen? Und war das alles? War es nicht vielmehr, selbst als ich rief, eine Bitte um Einlaß, der Wunsch mit dabei zu sein, wenn es dunkelte und geflüstert wurde? »Ich rief«, so fing ich an, die Wanderung zu schildern, die nun auch zu Ihnen führte – aber es war wohl das Suchen nach Namen und die Schwierigkeit bestand für mich wohl darin, sie zu finden, denn sie wurden geheim gehalten. Von wem? Weiß ich es heute, da ich weiß, daß erst jenseits der Worte und zwischen ihnen die Räume sich dehnen, die, vom Astwerk der Worte überschattet und ins Dunkel getaucht, die kleinen Büsche bergen, aus denen das Feuer schlägt?
Bin ich vorgedrungen bis zu diesem Feuer? Sie sagen es in Ihrem Brief und hier hört meine Einsamkeit auf. Gewiß, ich hatte Flammen erblickt, aber es konnte auch Täuschung sein. Ein einziger Mensch hatte mich in meinen Unternehmungen bestärkt: Alfred Sperber. Er beschirmte mich und trat für mich ein vor jenen, die mich schweigen hießen. Er gewann mir Freunde. Ich war nicht mehr allein mit meinen Gedichten, aber ich glaube, ich darf sagen, daß wir nun beide einsam blieben, wenn auch zu zweit. Nun sind auch Sie hinzugetreten und sehen wohl, daß diese Zeilen nur deshalb so sind, wie sie sind, weil ich nicht weiß, wie Ihnen danken.
Ich bin mir dessen genau bewußt, daß dieser Brief nur ungenügend Bescheid gibt von den Dingen, die mich bewegten und deren Vertrauter ich bleiben möchte, von jenem Flügelpaar, das aufrauschte hinter mir und verrauschte durch mich – dazu ist meine Freude zu groß. Aber etwas muß ich doch noch hinzufügen, beklommenen Herzens, und in diesem Augenblick rede ich wohl aus dem Dunkel, das mich auch mit Raubtierfängen zu umkrallen wußte: ich will Ihnen sagen, wie schwer es ist als Jude Gedichte in deutscher Sprache zu schreiben. Wenn meine Gedichte erscheinen, kommen sie wohl auch nach Deutschland und – lassen Sie mich das Entsetzliche sagen – die Hand, die mein Buch aufschlägt, hat vielleicht die Hand dessen gedrückt, der der Mörder meiner Mutter war … Und es könnte noch furchtbarer kommen …
Aber mein Schicksal ist dieses: deutsche Gedichte schreiben zu müssen. Und ist die Poesie mein Schicksal – und hier danke ich Ihnen wieder, daß Sie es bejahen – so bin ich froh, Anlaß zu Ihrem schönen Gleichnis vom aufgesprengten Bannkreis zu sein und mir sagen zu können, daß jenes andere Deutschland fortlebt, daß wenigstens das von den »deux Allemagnes«3 seinen (traurigen) Sinn nicht verloren hat.
Verzeihen Sie, sehr verehrter Herr Rychner, diese Verdüsterung am Ende eines Briefes, der doch nur die Freude hätte ausdrücken dürfen, jenen Beifall gefunden zu haben, den ich mir erträumte, als ich, von Speeren umgeben, sah daß ein Blatt fiel und wußte, daß es eine Botschaft war – und seien Sie nochmals innigst bedankt von Ihrem
Paul Celan
14 An Alfred Margul-Sperber, Wien,1 wohl 28. 12. 1947
Wien, am 28. Dezember 1947.
Mein lieber, guter Herr Sperber!
Verzeihen Sie, daß diese Zeilen erst heute kommen: ich wartete, um Ihnen ausführlicher über meine Pläne und Aussichten schreiben zu können, weiß aber auch jetzt noch nichts Bestimmtes zu sagen. Wie Sie ja wissen, erscheint eine größere (darf ich sagen: zu große?) Auswahl meiner Gedichte im Jännerheft des ›Plan‹.2 Herr Basil ist sehr nett zu mir, aber mit Literatur, besonders mit Poesie, läßt sich hier in Wien nicht viel anfangen. Immerhin ist ja etwas erreicht und in einigen Tagen hoffe ich in der Lage zu sein, Ihnen Genaueres zu berichten. Ihre Karte an H. Eder3 mußte ich leider unterwegs vernichten. Meine Reise4 war sehr schwer.
Lieber, lieber Herr Sperber, ich verdanke Ihnen so gut wie alles, lassen Sie mich Ihnen schön dafür danken. Ich grüße Sie u. Ihre Frau Gemahlin5 aufs herzlichste,
Ihr Paul
Adr.: Armin Sabath, Wien IX, Severing. 3.6
15 An Ruth Kraft, Wien, 28. 12. 1947
Wien, am 28. Dez. 47.
Liebe Ruth,1
ich bin zwar schon zehn oder mehr Tage hier, weiß aber noch immer nicht, wie alles werden soll. Es sieht so aus als müßte ich den Winter hier verbringen, was ja nicht so schlimm wäre, wenn ich für den Augenblick nicht so ganz ohne Geld2 wäre. Ich hatte eine sehr schwere Reise,3 Ruth. Siehst Du, ich bringe noch keinen rechten Brief zustande, Du aber kannst es wohl. Schreibe mir über alles. Viele Grüße Paul
Schreibe an: Armin Sabath, Wien IX, Severing. 3 Tür 11.4
16 An Alfred Margul-Sperber, Wien, 11. 2. 1948
Wien I, Rathausstraße 20,1
am elften Februar 1948.
Mein lieber, guter Herr Sperber,
nun grollen Sie wohl und diese Zeilen kommen vielleicht zu spät, um Sie noch versöhnen zu können. Darf ich Ihnen trotzdem sagen, daß ich in Gedanken zu wiederholten Malen an Sie schrieb, es mir aber dann anders überlegte, weil ich Ihnen nicht das sagen konnte, was mir, aber ja auch Ihnen, am Herzen lag. Wirklich schienen die Aussichten, meine Gedichte herausgeben zu können, eher schlecht zu sein. Zwar bedeutete mir der Umstand, daß ein Teil meiner Gedichte (etwa fünfzehn, also mehr als viel) im ›Plan‹ gedruckt wurde (der ›Plan‹ erscheint nächsten Freitag2), sehr viel – besonders nach der furchtbar schweren Reise,3 ich hinter mir hatte –, aber dann kam ein Stillstand, die Uhr war stehngeblieben, es war eine schlechte Uhr, Ziffern hatte sie schon vorher nicht gehabt, jetzt aber standen auch die Zeiger still. Ein paar Besuche bei Basils Freunden, Geschwätz und Diskussionen, die mich nicht interessierten, sonst nichts. Basil wurde auch so ziemlich distant, ich sah ihn immer seltener. Aber da hat mich ein Mann in sein Herz, oder doch zumindest in einen Vorhof seines Herzens eingeschlossen, ein Maler, Edgar Jené,4 er wurde mein hiesiger Sperber – oh, gewiß ein kleinerer als Sie! –, lud Leute zu sich ein, ich las meine Gedichte vor und vernahm viel Lob. Wollen Sie es mir glauben, daß ich nicht weiß Gott wie glücklich war, als man mir sagte, ich sei der größte Dichter in Österreich und – soviel man wisse – auch in Deutschland. Einer der Menschen, die mir das sagten, war auch Dr. Werner Riemerschmid,5 er war jahrelang Leiter der Literatursendung der Ravag, war es auch unter den Nazi, und da hat er wohl anderes getan als zu einem jüdischen Dichter zu sagen: »Endlich soll der homo alpinus sehn, was ein Dichter ist.« Er mag ja ein ganz netter Mensch sein und nur deshalb Parteimitglied geworden sein, weil er um seiner Familie willen den Posten nicht verlieren wollte – ich hörte auch, daß er emigrieren wollte, es aber seiner allzu zahlreichen Familie wegen nicht konnte, – aber er hat da gerade zu einer Zeit im Rundfunk Worte gesprochen, unbekümmerte oder bestenfalls halbbekümmert, als … aber Sie wissen es ja …
Da fällt mir ein calambour6 ein, dena ich machte, ein Spiel mit ein paar Worten, die ein anderer – unbedeutender – Schriftsteller, Johann Muschik7 (er gehört der Redaktion des ›Plan‹ und des »Österr. Tagebuchs«8 an, ist Kommunist) über Georg von der Vring,9 mit dem er während des Krieges korrespondiert hat, äußerte: G. v. d. Vring, so meinte Muschik, sei nur deshalb umgefallen, weil er um seiner neun oder zehn Kinder willen diesen Weg »gehn mußte« … »Müssen ging«, habe ich dazu gesagt …
Aber Edgar Jené ist anders und wirklich ganz ungemein nett zu mir. Er ist Saarländer, hat viele Jahre in Paris gelebt, wurde seinerzeit in Berlin von Paul Westheim10 gefördert, und ist bestimmt vorurteilsfrei. Er ist hier sozusagen der »Papst« des Surrealismus und ich bin nun sein einflußreichster (einziger) Kardinal. Allerdings habe ich ihm prophezeit, daß sein Vorgesetzter, der heilige Petrus also, André Breton, ihn als Statthalter in Wien bestimmt nicht anerkennen wird und schon garnicht mich, der ich doch so Verwerfliches wie Reime gemacht habe. Edgar Jené bereitet jetzt eine surrealistische Sondernummer des »Plan«11 vor, die er im April nach Paris mitnehmen will (das Material dazu hat A. Breton geschickt, ich habe da auch eine Übersetzung eines kleinen Gedichtes von Aimé Césaire und eine mit Jené gemeinsam gezeichnete »Lanze«12) zusammen mit meinem Buch. Ja, mit meinem Buch. Denn mein Buch, mit dessen Druck heute begonnen wurde, wird in fünf oder sechs Wochen fertig sein. Das Geld dazu haben mir Freunde gegeben. Es kostet 4600 Schilling, hat eine Auflage von 500 Exemplaren, einen sandfarbenen Leineneinband, eine Lithographie von E. Jené und erscheint bei Erwin Müller.13 Es soll etwa 40 Gedichte enthalten, einen einzigen Zyklus, bestehend aus allen Gedichten des letzten Zyklus und anderen früheren, bei deren Auswahl ich Sie bitte, mir behilflich zu sein. Wenn Sie mir Undankbaren postwendend antworten, werde ich noch in der Lage sein, die Reihenfolge der Gedichte zu ändern und Gedichte auszutauschen.
Daß das Buch bei Müller erscheint, ist nicht Basils, sondern Edgar Jenés Werk; Basil ist natürlich einverstanden, daß es erscheint, hat sein Erscheinen aber, solange Jené es nicht zustande brachte, nicht befürwortet. Noch etwas aus der Vorgeschichte zu dem Erscheinen der Gedichte: eine Verlegerin, Frau Luckmann,14 der ich bei Jené Gedichte vorlas, war so begeistert, daß sie sich sofort bereit erklärte, sie auf ihre Kosten herauszugeben. Nach ein paar Tagen, nachdem sie das Manuskript nachhause genommen hatte, überlegte sie es sich aber wieder, weil ihr ihr Lektor und einer ihrer Autoren, P. Gütersloh, sagte, der Zeitpunkt für die Veröffentlichung dieser allerdings »sehr begabten« Gedichte sei »noch nicht gekommen«. Ein recht schwarzer Punkt, dieser Zeitpunkt!
Lieber Herr Sperber, an einem der letzten Mittwoche habe ich Ihre Stimme gehört.15 Aber es war nur Ihre Stimme. Bitte, vergessen Sie, daß ich so lange nicht geschrieben habe, und schreiben Sie mir einen Brief: dann höre ich auch Ihr Herz schlagen. In einem meiner nicht niedergeschriebenen Briefe habe ich Sie in der Anschrift neu getauft: mein großer und gütiger Schirmherr Der Sperber. So, und jetzt gehn Sie bitte noch bis an die Glastür und klopfen Sie leise an und sagen Sie mit meiner Stimme (das machen Sie mir sicherlich gut nach): Küß die Hand, gnädige Frau, auf Wiedersehn. Ich aber will auf den Tisch steigen, wie zum Schlafen, und Sie umarmen Ihr Paul
Viele, viele Grüße an Petrică, Nina, Margareta,16 Mony,17 Costin
17 An Petre Solomon, Wien, 12. 3. 1948
Wien I, Rathausstraße 20
12 · III · 1948.
Dragul meu Petrică,
între ceeace numeşti tu o tăcere nesemnificativă şi ceeace ar putea fi o semnificaţie tacită mai creşte o iarbă, care e mai mult decât un calambur.1 De când am realizat ceeace ne-a propus acel vers al lui Fundoianu,2 răsucit pe neînţelesul tău şi al meu, am avut câteva zeci de ocazii, oferite de tot atătea absenţe sau prezenţe înregistrate cu pumnii la tâmple, pentru a mă gândi la tine şi la ceilalţi. Menţionez doar (şi fără poate) apariţia din tenebre a Omului-şapcă,3 venit la Budapesta4 pentru a-şi ispăşi porecla între păduchi, oameni şi vizite nocturne mai mult sau mai puţin uniformate. Din clipa în care l-am cules depe jos şi l-am luat să doarmă împreună cu mine în casa unei merituoase ţaţe, alături de un dobitoc pe nume Ursu şi un tânăr şofer cu vagi cunoştinţe de limba franceză şi relaţii în lumea bună depe ambele maluri ale Gârlei,5 pe care cu onoare o reprezinţi în coloanele mai multor ziare iubitoare de poezie – din clipa aceea am simţit, cu toată ascuţimea care mă caracterizează în anii în care nu dorm, prezenţa ta, petre şi Poete.
A mai contribuit la aceaste – dupăcum desigur ţi-a povestit cu lux de măruntaie susamintitul individ, care n'a fost lăsat să-şi umple pipa cu un tutun mai deştept – intervenţia unui personaj de tristă amintire, Edma,6 căreia am reuşit în cele din urmă, nu fără concursul aproape conştient al aceluia, pe care din mare abundenţă de materie cenuşie l-ai avansat acum »înapoiat din dobitocie«, să-i spargem un vas chinezesc sau aşa ceva, drept decompensă pentru o primire care merită toate epitetele ornate în floare pe-unde te mai încăpăţânezi să te joci în mod public cu rimele şi cu alte gunoaie pentru fertilizarea surzeniei.
De atunci, adică de când am învăţat să număr până la zece şi să cer un bilet de tramvai în limba lui Petőfi,7 şi până la descălecarea mea în acest oraş, în care acum o sută de ani s'a făcut o revoluţie, au trecut câteva zile, în care n'am călcat pe covoare persane şi nu am cetit niciun poem eminamente realist şi aşa mai departe, tradus dintr'o limbă vecină sau bulgară de ultima deţinătoare autentică a profilului lui Dante Alighieri.8
Ce aş putea să-ţi spun despre acest tărâm, de care mă întrebi şi care nu e un tărâm, ci o râmă cu toate atributele pe care le poate implica trecerea dela masculin la femenin plus pierderea capului? Petrică, frate, noi ăştia cu profilul mai mult sau mai puţin levantin (cum îţi şade bine să-l defineşti) şi cu un sejur mai mult sau mai puţin îndelungat (cum îmi permit să mă consolez) în oraşul lui Matei Caragiale,9 suntem nişte adevăraţi titani. Păcat de noi, Petrică. Păcat şi de acel prea scurt anotimp care a fost al nostru, cette belle saison des calembours, care cine ştie când va mai reveni, acum când nu mai jucăm Question-Réponse10 în vecinătatea domnului bibliotecar şi ne spunem drăgălăşenii cu ochii închizi.
Iată-mă acolo, unde e mai bine să mă întrerup. Ce aş putea să-ţi mai spun decât că te sărut, aşa cum ar fi trebuit s'o fac înainte de plecare, cu puţin amar pe buze (unde mă duc? unde te las?) şi că le spun la revedere tuturor celorlalţi prieteni, întâi Ninei, strania călătoare din funicular, mare-ducesă a plictiselilor de sămbătă-seara; lui Vladimir Maiacolin,11 autorul celor 25 de poeme, pe care nu am putut să le iau cu mine; Margaretei, pe care cu permisiunea lui Hugo12 o sărut botaniceşte pe botişor; Despinei,13 avertizată şi nocturnă; lui Mony,14 care a şi intrat în istoria morăritului românesc ca un mare Critic şi Sache; lui Rafi-atletul15 şi lui Piţ-actorul16 (sau ambasatorul?); lui Milo,17 căruia să-i mai spui că suntem singuri ca vai de Sartre; lui Dulă, care ştie, şi tuturor celorlalţi printre care nu s'o uit pe Veronica Porumbacu.
Lui Yvonne18 o foarte adâncă plecăciune.
Liei,19 blondei Lie să-i faci semn cu mâna, mâine, când ai s'o întâlneşti din întâmplare la telefon şi să-i vorbeşti despre altcineva, al cărui scris seamănă cu al meu ‥
Al tău
sincer prieten şi trist poet de limbă teutonă
Paul
Salutări d-lui Philippide,20 lui Popper, Aurel, Marcel şi tuturor celorlalţi de la editură
Unde e Paula? Plecată?
Nu uita: salutări lui Deleanu,21 căruia aş vrea să-i scriu, am uitat însă numărul casei în care locuieşte
Mein lieber Petrică, / zwischen dem, was Du ein unbedeutendes Schweigen nennst, und dem, was eine stillschweigende Bedeutung sein könnte, wächst noch ein Kraut, das mehr ist als ein Calambour.1 Seit ich ausgeführt habe, was uns jener zu meinem und Deinem Unverständnis verdrehte Vers von Fundoianu2 vorschlug, hatte ich Dutzende von Gelegenheiten, dargeboten von ebenso vielen mit den Fäusten an den Schläfen registrierten An- oder Abwesenheiten, um an Dich und an die anderen zu denken. Ich erwähne nur (und ohne Aber) das Auftauchen des Kappen-Mannes3 aus den Finsternissen, der nach Budapest4 kam, um seinen Spitznamen unter Läusen, Menschen und nächtlichen, mehr oder weniger gleichförmigen Besuchen abzubüßen. Seit dem Augenblick, da ich ihn vom Fußboden aufgelesen und mitgenommen habe, damit er mit mir in dem Haus einer verdienten Vettel schläft, neben einem Rindviech namens Ursu und einem jungen Chauffeur mit vagen Französischkenntnissen und Verbindungen zur guten Gesellschaft auf beiden Ufern der Gârla,5 die Du ehrenvoll in den Spalten mehrerer poesieliebender Zeitungen darstellst – seit diesem Augenblick habe ich, mit aller Scharfsicht, die mich in meinen schlaflosen Jahren kennzeichnet, Deine Gegenwart gefühlt, o peter und DICHTER. / Dazu hat auch – wie Dir mit eingeweidlichem Prunk das oben genannte Individuum, das man seine Pfeife nicht mit schlauerem Knaster stopfen ließ, sicher erzählt hat – das Eingreifen einer Gestalt traurigen Angedenkens, Edma,6 beigetragen, der ich schließlich, nicht ohne die fast bewußte Unterstützung von demjenigen, den Du wegen überreichlicher grauer Materie jetzt zum »rindviechhaft Zurückgeblieben« befördert hast, eine chinesische Vase oder so was zerschlagen konnte, gerechter Ausgleich für einen Empfang, der alle blumengeschmückten Epitheta verdient, wo Du Dich weiter darauf kaprizierst, öffentlich mit dem Reim und anderem Mist zu spielen, um Taubheit fruchtbar zu machen. / Seither, seitdem ich nämlich gelernt habe, in Petőfis7 Sprache bis zehn zu zählen und ein Straßenbahnbillet zu kaufen, und dann in dieser Stadt abgestiegen bin, in der vor hundert Jahren eine Revolution stattfand, sind einige Tage vergangen, in denen ich nicht auf Perserteppichen gelaufen bin und kein einziges eminent realistisches Gedicht und so weiter gelesen habe, von der letzten Inhaberin von Dante Alighieris Profil8 übersetzt aus einer benachbarten oder bulgarischen Sprache. / Was könnte ich Dir über diese Gegend sagen, nach der Du mich fragst und die keine Gegend ist, sondern ein Regenwurm mit allen Attributen, die der Übergang von Maskulin zu Feminin plus Verlieren des Kopfes einzuschließen vermag? Petrică, Bruder, wir, die mit dem mehr oder weniger levantinischen Profil (wie es Dir zu definieren gut ansteht) und mit einem mehr oder weniger ausgedehnten Aufenthalt (wie ich mich zu trösten wage) in Matei Caragiales Stadt,9 wir sind wahre Titanen. Schade um uns, Petrică. Schade auch um jene zu kurze Jahreszeit, die uns gegeben war, diese schöne Wortspiel-Jahreszeit, die wer weiß wann wiederkommt, wo wir jetzt nicht mehr Frage-und-Antwort10 in der Nähe des Herren Bibliothekar spielen und uns mit geschlossenen Augen Nettigkeiten sagen. / Und da bin ich an einer Stelle, wo ich besser aufhöre. Was könnte ich Dir denn noch sagen, als daß ich Dich so küsse, wie ich es vor dem Wegfahren hätte tun sollen, mit etwas Bitterkeit auf den Lippen (wohin gehe ich? wo lasse ich Dich zurück?), und daß ich all den anderen Freunden Aufwiedersehn sage, zuallererst Nina, der seltsamen Seilbahn-Reisenden, Großfürstin der Samstagabend-Langeweilen; Vladimir Maiacolin,11 dem Autor jener 25 Gedichte, die ich nicht mitnehmen konnte; Margareta, die ich mit Erlaubnis von Hugo12 botanischerweise auf das Schnäuzchen küsse; die vorgewarnte Nacht-Despina;13 Mony,14 der in die rumänische Müllereigeschichte als großer Kritiker und Sake eingegangen ist; den Rafiathleten15 und den Pitzakteur16 (oder -gesandten?); Milo,17 dem Du mal sagen sollst, daß wir einsam sind, mein Gott Sartre!; und Dulă, der Bescheid weiß, und allen anderen, unter denen ich Veronica Porumbacu nicht vergessen darf. / Vor Yvonne18 eine sehr tiefe Verneigung. / Gib Lia,19 der blonden Lia, morgen ein Handzeichen, wenn Du sie zufällig beim Telefon triffst, und sprich mit ihr über jemanden, dessen Schrift der meinen ähnelt ‥ / Dein / aufrichtiger Freund und trauriger Dichter teutonischer Sprache / Paul / Grüße an Herrn Philippide,20 an Popper, Aurel, Marcel und all die andern vom Verlag. / Wo ist Paula? Weg? / Und vergiß nicht Grüße an Deleanu,21 dem ich gerne schreiben will, ich habe aber seine Hausnummer vergessen.
18 An Alfred Gong, wohl Wien, 26. 6. 19481
Mein Lieber,
ich bin froh, den Zeitungsausschnitt mit der Geschichte und den Photos der Weißen Rose2 wiedergefunden zu haben. Ich fahre in wenigen Stunden.
Es hat mir leid getan, im letzten Augenblick, dadurch, daß ich die Photos verloren glaubte, nicht herzlicher sein zu können, um es auch Dir leichter zu machen, so zu sein wie ich es gern gewünscht hätte: herzlich.
Aber nun ist alles wieder gut. Ich grüße Dich
Paul
19 An Ruth Kraft, Innsbruck, 6. 7. 1948
Innsbruck,1 den 6. Juli 1948
Mein liebes Rutherle,
gestern war ich in Mühlau, auf dem Kirchhof,a wo Trakl begraben ist. Ich hatte Blumen mit, von Erica Jené und von mir, und unterwegs habe ich von einer Weide einen kleinen Zweig gebrochen, den ich von Dir auf das Grab gelegt habe. Am Abend habe ich dann bei Ludwig von Ficker, Trakls Freund, Gedichte gelesen. Du kannst Dir denken, daß ich befangen war. Aber Ludwig von Ficker sagte mir dann, ich sei dazu berufen, das Erbe von Else Lasker-Schüler anzutreten. Else Lasker-Schüler ist für die Fickers ebenso wie Trakl der Inbegriff wahrer Poesie. Sie war selber oft draußen in Mühlau, und einer ihrer Gedicht-Zyklen ist »Ludwig von Ficker, dem Landvogt von Tirol und seiner schönen Schwedin« zugeeignet.b Die »schöne Schwedin«, Frau von Ficker, ist heute eine alte Dame, die jetzt, nach dem Selbstmord ihrer älteren Tochter,2 den Dingen dieser Welt nicht mehr ganz gehört und den seltsamen Zauber der immer Entrückteren hat. Sie findet, daß ich Else Lasker-Schüler ähnlich sehe – dasc sagte sie mir noch ehe ich meine Gedichte gelesen hatte, und dabei bleibt es für sie wohl für allezeit. Reizend ist auch ihre (jüngere) Tochter, Birgit von Ficker,3 die ich heute fragte, ob meine Gedichte ihrem Vater auch wirklich so gut gefallen hätten, was sie mir bestätigte.
Du siehst, daß ich mich freuen darf.
In etwa einer Woche fahre ich nach Paris, ich muß nur noch um das Laisser-passer durch die französische Zone Deutschlands warten, Paß und französisches Einreisevisum habe ich schon.
Ich denke, mein letzter Brief aus Wien mit den Gedichten und den zwei Photos hat Dich erreicht. Ich würde mich freuen, in Paris einen Brief von Dir vorzufinden. Hier eine Adresse: Paul Celan c/o Gabrielle Cordier,4 26 Avenue Dode de la Brunerie, Paris 16e. Schreibe also gleich morgen.
Ich umarme Dich
Paul
Sieh Dir die Marken auf dem Briefumschlag an: es sind auch Buschwindröschen5 dabei.
20 An Erica Lillegg, Paris, 19. 8. 1948
31, Rue des Ecoles
Paris, den 19. August 1948.1
Erica, meine liebe Erica,
weder die Platanen sind schuld, daß es so lange dauert bis nicht sehr weit nach Mitternacht die Lampen ein ruhigeres Licht auf das Papier werfen – dazu sind die Platanen schon vielzulange da, wo sie sind, nämlich tief unter mir und hoch über meinem Herzen; noch ist es der Himmel, der von Unzeit zu Unzeit doch wieder daran denkt, wie sehr ich die Herbstzeitlosen liebe;2 sondern es ist vielmehr und zum Ärger meiner immer noch nicht königsblauen Augen die ein wenig heisere Stille meines Herzens, das, allen Entschlüssen zum Trotz, die Weisheit seiner in den Baumkronen verbrachten Jahre in dieser Stadt am Ufer ihres eigenen Flusses noch garnicht an den Mann, will sagen an den Baum bringen kann.
Wohin soll das führen? Das wirst Du eher wissen als ich, denn Du hast ja in Kärnten3 mehr Glockenblumen als ich hier. Obwohl ich hier mehr Glockentürme habe. Aber ich habe noch garnicht nachsehn können, ob sie innen blau sind. Wenn ja, so geschieht vielleicht das Wunder, daß ich schon morgen erfahre, wie spät es ist. Das wäre so wichtig!
Ich weiß, Du eilst mir zu Hilfe, Du kommst noch heute, es mir zu sagen – aber war es nicht mein Ehrgeiz, es zu wissen, eh Du da bist? Wenn Du mir aber sagst, daß es eine Stadt gibt, wo die Uhren in den Häusern wohnen (heißt es nicht jetzt schon, daß jede Uhr ihr Gehäuse hat?), die Menschen aber auf den Straßen Zeit und Stunde anzuzeigen wissen – wonach zu fragen, die Uhren eine Begabung besitzen, die ich Dir und mir zum Geburtstag wünsche – so entschließe ich mich vielleicht doch, nie wieder einen Entschluß zu fassen, in der Hoffnung, eines Tages ein Bürger jener Stadt zu werden. Denn was wäre ich bei all meiner Kopflosigkeit, wenn es mir nicht gelänge?
Habe ich nicht einmal, als die Seine noch die Donau war und bis zur Friedensbrücke4 nur soviel Wegs blieb als man brauchte, um ein junges Jahrhundert lang über Samt zu streichen, gesagt, daß Du, um für allezeit meine Nelken zu behalten, nur eine einzige Wimper herzugeben brauchst und zwar dann, wenn ich aus meinem rechten Schatten in meinen linken Schatten trete? Habe ich es nicht gesagt und hast Du es nicht getan?
Der Mond ist nicht so rund wie der Teller, aus dem ich die Speise esse, zu der Du den Wein trinkst.
Paul
Hier ist noch ein Gedicht, das Dir gehört:
+
Wer wie du und alle Tauben Tag und Abend aus dem Dunkel schöpft,
pickt den Stern aus meinen Augen eh er funkelt,
reißt das Gras aus meinen Brauen eh es weiß ist,
wirft die Tür zu in den Wolken eh ich stürze.
Wer wie du und alle Nelken Blut als Münze braucht und Tod als Wein,
bläst das Glas für seinen Kelch aus meinen Händen,
färbt es mit dem Wort, das ich nicht sagte, rot,
schlägts in Stücke mit dem Stein der fernen Träne.5
+
21 An Greta Freist, Paris, wohl 31. 8. 1948
Paris, am letzten Augusttag.1
Ich bin gewiß nicht grausam, Greta – nichts ist mir fremder als Grausamkeit. Was ich hier erzählen muß, ist vielleicht dies: die Welt ist gegen mich losgezogen und ich habe mich gewehrt. Es regnete Sterne, während ich angegriffen wurde, doch durfte ich kein Auge dafür haben, ich, der ich mich nur wehrte, um warten zu dürfen, bis es Sterne regnen würde. Denk nur: meine Augen waren weit offen, und ich durfte die Sterne nicht sehn! Ich war sehr jung, als dies begann. Und darüber verstrich viel von dem, was man das Leben nennt und Anspruch erhebt auf Stunden und Jahre.
Am Ende dieses Kampfes – denn Du mußt wissen, daßa der Kampf beendet ist und daß ich nicht unterlag – war meine Sehkraft nicht mehr die alte, aber ich konnte noch sehen. Genug, um zu wissen, daß ich nun sehr lange zu warten hätte, bis es wieder Sterne regnen würde.
Ist es nicht eine Gnade, daß ich hoffen darf, diese Stunde zu erleben, ohne erblindet zu sein und ohne daß Schwerter mich bedrängen? Ist es grausam (und gegen wen?), wenn ich die Augen nur zur Hälfte öffne, wenn es zu rauschen beginnt, heute, wo es noch nicht die Sterne sein können? Ich bin nicht grausam, Greta, ich will nur meine Sterne sehn!
Wer das weiß, dem gehören meine Gedichte nicht anders als mein Herz.
Paul
22 An Klaus Demus, Paris, 5. 9. 1948
Paris, den 5. IX. 48
Mein lieber Klaus Demus,
ich denke oft an Sie und Ihre dunklen Vögel, die sich nicht klarsingen können.1 Vielleicht ist das gut so, denn auf diese Weise sind sie gezwungen, ihren Gesang nicht zu unterbrechen. Meine Vögel sind vielleicht nicht weniger dunkel als die Ihren, aber vom Klarsingen wollen sie scheinbar nichts wissen. Im Gegenteil: das schwärzeste Schwarz2 schwebt ihnen vor. Und da sie es nun nicht mehr sehr weit haben dürften bis dorthin, singen sie selten. Ich wage nicht zu sagen: immer seltener. Vielleicht haben sie Angst, wer weiß? Denn im Dunkel ist es immer noch finsterer als im Hellen, wo es auch schon so düster wird …
Dies, um Ihnen zu zeigen, daß ich Grund habe, mich zu freuen, wenn Sie mir schreiben Ihr Paul Celan
Paul Celan
31, Rue des Ecoles, Paris 5e
23 An die Zeitschrift »Die Wandlung«, Paris, 9. 9. 1948
31, Rue des Ecoles
Paris, den 9. September 1948.
Sehr geehrter Herr Schriftleiter,1
Indem ich Sie bitte, die beigeschlossenen Gedichte2 in Ihrer Zeitschrift veröffentlichen zu wollen, erlaube ich mir, da ich weiß, daß Ihnen nicht ganz gleichgültig sein kann, zu wissen, wie das Leben eines unbekannten Autors bisher verlief, das Wenige, das mein äußeres Leben umschreibt, zu erwähnen.
1920 in Czernowitz, in der östlichsten Provinz der ehemaligen Habsburgermonarchie geboren, habe ich, außer einem einjährigen Aufenthalt in Frankreich, meine Geburtsstadt vor 1941 fast überhaupt nicht verlassen. Was während der Kriegsjahre das Leben eines Juden war, brauche ich nicht zu erwähnen. 1945 kam ich nach Bukarest, das ich 1947 verließ, um nach Wien zu gehn. Seit Juli 1948 lebe ich in Paris.
Nicht um meine Gedichte in ein Licht zu stellen, das den Blick bannen muß, aber um die Stille rings zu vertiefen, wenn Sie sie lesen, darf ich wohl hinzufügen, daß ich manchmal denken muß, die Bitterkeit ihrer Einsamkeit hätte genügen mögen, um ihnen die Sprache zu verleihen, die sie brauchten, um mehr zu sein als ein schönes Wort im Staube.
Von meinen Gedichten sind bisher erschienen: eine größere Auswahl in der von Otto Basil in Wien herausgegebenen Zeitschrift ›Plan‹ (Februar 1948)3 und eine kleinere in einer Literaturbeilage der Zürcher ›Tat‹, wo ihnen Dr. Max Rychner eine kurze Würdigung4 voranstellte. Die vorliegenden Gedichte sind zum Teil (›In Aegypten‹, ›Wer wie du‹) unveröffentlicht, zum Teil meinem im Oktober in Wien erscheinenden Gedichtband ›Der Sand aus den Urnen‹ entnommen.
Sehr spät stehen diese Gedichte jetzt vor der Tür, die vielleicht die erste hätte sein sollen. Werden Sie mir sagen können, daß der späte Gast auch ein willkommener Gast ist? Es ist nicht sehr hell, während ich frage. Lassen Sie mich, bitte, nicht allzu lange auf klaren Bescheid warten.
Ihr
Paul Celan
24 An Max Rychner, Paris, 24. 10. 1948
31, Rue des Ecoles Paris 5e,den 24. Oktober 1948.
Sehr verehrter Herr Doktor,
so groß ist meine Schuld, daß ich kaum mehr weiß, wie ich Sie wegen meines Nichtschreibens um Vergebung bitten soll. Vielleicht gelingt dies meinen Gedichten,1 die ich diesem Brief beilege.
Als ich vor einem Jahr Rumänien verließ, um ins Ausland zu gehen, ohne Paß2 und allein meinem Stern vertrauend, wußte ich, daß es geraumer Zeit bedürfen würde, bis ich aufgehört hätte, das zu sein, was ich immer noch bin und vielleicht bleiben muß: ein Wandernder im Dunkel. Eines hatte ich mir jedoch unberührt von all den Windstößen erhofft: meine Gedichte. Um ihretwillen ging ich nach Wien, in der Hoffnung, sie veröffentlichen zu können. Aber ich hatte kein Glück. Mein erster Verleger, Erwin Müller,3 erklärte sich zwar sofort bereit, meine Gedichte herauszugeben, machte jedoch ihr Erscheinen von einer vorherigen Subskription abhängig, weil ja Poesie kein Geschäft ist. Freunde stellten mir den erforderlichen Betrag zur Verfügung. Was aber tat mein Verleger? Nach einiger Zeit bekam ich zwar ein paar Fahnen zum Korrigieren, aber bald darauf geriet alles ins Stocken. Wochen verstrichen, bis mir endlich gesagt wurde, die angezahlten zweitausend Schilling seien zur Deckung von Verlagsschulden verbraucht worden, so daß mein Buch nicht mehr erscheinen könne. Müller versprach, das Geld in vier Wochenraten zurückzuzahlen, aber schon bei der zweiten Rate wurde er wortbrüchig. Inzwischen war ein halbes Jahr verstrichen, und mir wurde es in Wien immer ungemütlicher. Ich bin in einer ehemaligen Provinz der Habsburgermonarchie, in der Bukowina geboren, die später zu Rumänien, jetzt aber zu Rußland gehört. Einem nach heutigen Begriffen in Rußland geborenen Flüchtling bot Wien wenig Sicherheit.4 Doch wollte ich, obwohl zur Weiterreise entschlossen, mein Buch veröffentlicht wissen. Freunde stellten mir einen weiteren Betrag zur Verfügung, der diesmal direkt der Druckerei bezahlt wurde. Voller Zuversicht ging ich im Juli nach Paris und wartete. Später als vorgesehen, Ende September, erschien mein Buch. Wie groß war mein Entsetzen, als ich es bekam! Freunde hatten es übernommen, die notwendigen Korrekturen zu besorgen, denn es galt ja, keine Zeit mehr zu verlieren – und das Buch5 erschien voller Druckfehler, mit dem geschmacklosesten Einband, den ich je gesehn, und obendrein mit zwei Illustrationen eines Freundes, der Maler ist, und der es nicht unterlassen konnte, mein Buch mit zwei Beweisen äußerster Geschmacklosigkeit zu versehen. Und die Druckfehler waren von der entsetzlichsten Sorte! Ich war gezwungen, telegraphisch zu veranlassen, das Buch aus dem Verkehr zu ziehen.
Wundern Sie sich bitte nicht, verehrter Herr Doktor, wenn ich nun Ihnen mein Leid klage. Herrn Sperber kann ich nicht mehr schreiben,6 ohne ihm Unannehmlichkeiten zu bereiten: ich bin ja Flüchtling, und ihm schreiben hieße, die geringe Bewegungsfreiheit, die er noch hat, gefährden.
Vielleicht darf ich auch nicht allzu laut klagen: meine Gedichte haben in Österreich überall, wo man noch weiß, daß Gedichte etwas bedeuten, jene Anerkennung gefunden, die ich mir erhoffte. Zuletzt war es der Freund Trakls, Ludwig von Ficker,7 der mich in meinem Entschluß, ein Dichter zu bleiben, bestärkte. Vielleicht sollte es mir genügen,a Gedichte zu schreiben, ohne an ihre Veröffentlichung zu denken. Aber ich fühle, daß ich es nicht kann, wenn ich auch denken muß, daß das nicht zum Wesen der Poesie gehört.
Aber nur die wenigsten haben darauf verzichten können, und ich selber habe viel zu lange in der bittersten der Einsamkeiten gelebt, um nicht endlich die Worte der Menschen zu brauchen –.
Ich habe nicht, wie Sie, verehrter Herr Doktor, denken, deutsch gelernt8 – Deutsch ist meine Muttersprache, und doch mußte ich deutsche Gedichte als ein Verbannter schreiben. Während der Kriegsjahre hatte ich es nicht leicht: als Jude kam ich in ein Lager, und meine Eltern fielen der SS zum Opfer. Als Kind zweier Österreicher, die nie die rumänische Sprache erlernt haben,9 wuchs ich in Rumänien auf, um 1940, als meine Geburtsstadt an Rußland fiel, neu zu beginnen und Russisch zu lernen. 1945 gelang es mir, Rußland zu verlassen und nach Rumänien zu gehn. 1947 ging ich nach Wien, jetzt bin ich seit drei Monaten in Paris. Nun sind mir zwar Jessenin,10 Lautréamont und Rimbaud ebenso vertraut wie Hölderlin und Jean Paul und ich weiß, wieviel ich den Kulturen, durch die ich gehn mußte, verdanke, aber ich hätte doch gern gehört, was meine Gedichte den Menschen bedeuten, in deren Sprache sie geschrieben sind.
Wenn es nun auch nicht so ist, daß ich in einem rumänischen Dorf geboren bin, so entbehrt mein Schicksal doch nicht des Merkwürdigen, aber nicht dies ist, was meinen Gedichten Leben geben kann, wenn sie nicht durch die Poesie selber zu leben vermögen. Denn ich glaube, in meiner Einsamkeit, oder gerade durch meine Einsamkeit, manches vernommen zu haben, was diejenigen, die eben erst Trakl oder Kafka entdecken, noch nicht gehört haben –
Vielleicht vermissen Sie, werter Herr Doktor, in diesen Zeilen den Wohllaut der Bescheidenheit, les résédas de la modestie,11 und ich muß mir am Ende dieses Briefes sagen, daß es mir nicht gelungen ist, das zu sagen, was ich sagen wollte, und zwar daß ich sehr einsam bin, und mir keiner Rat weiß mitten in dieser wunderbaren Stadt, in der ich nichts habe als das Laub der Platanen.
Vielleicht gelingt es meinen Gedichten, Sie eindringlich genug zu bitten, mir ein paar Zeilen zu schicken
In Dankbarkeit
Ihr
Paul Celan
25 An Ingeborg Bachmann, Paris, 26. 1. 1949
31, Rue des Ecoles
Paris, den 26. 1. 1949.
Ingeborg,
versuche einen Augenblick lang zu vergessen, daß ich so lange und so beharrlich schwieg1 – ich hatte sehr viel Kummer, mehr als mein Bruder2 mir wieder nehmen konnte, mein guter Bruder, dessen Haus Du gewiß nicht vergessen hast. Schreibe mir so als würdest Du ihm schreiben, ihm, der immer an Dich denkt und der in Dein Medaillon das Blatt eingeschlossen hat, das Du nun verloren hast.
Laß mich, laß ihn nicht warten!
Ich umarme Dich
Paul
26 An Hans Paeschke, Paris, 2. 3. 1949
Paul Celan
31, Rue des Ecoles
Paris 5e
Paris, den 2. Maerz 1949.
Sehr verehrter Herr Doktor,
ich erlaube mir, Ihnen einige meiner Gedichte einzusenden, um deren Veroeffentlichung in Ihrer Zeitschrift ich Sie bitte. Herr Dr. Max Rychner, der vor einigen Monaten ein paar meiner aelteren Gedichte in der Literaturbeilage der »Tat« abdruckte, besass die Freundlichkeit, mir zu erlauben, dies unter Berufung auf ihn zu tun.1
Veroeffentlicht wurde von meinen Gedichten ausser der erwaehnten kleinen Auswahl noch eine weitere groessere, und zwar in der in Wien von Otto Basil herausgegebenen Zeitschrift »Plan«.2
Meinen Gedichtband »Der Sand aus den Urnen«, der im letzten Oktober in Wien herauskam, musste ich wegen der allzu zahlreichen Druckfehler – ich war so unvorsichtig gewesen, die Durchsicht der Fahnen einem Freunde zu ueberlassen, waehrend ich selber nach Paris fuhr – wieder aus dem Verkehr ziehen.3
Darf ich Sie, werter Herr Doktor, am Ende dieses Briefes bitten, mir zu sagen, wie Sie ueber diese Gedichte denken?4
In Dankbarkeit
Ihr
Paul Celan
27 An Erica Lillegg, Paris, 8. 3. 1949
Paris, den 8. Maerz 1949a
Liebe,
Dr. Rychner, dem ich das »Gegenlicht«1 einsandte, schreibt mir: »Ihr Gegenlicht soll in der TAT scheinen und erscheinen; es sind zum Teil wunderbare Gedichtchen, zum Teil experimentierende Paradoxe, die aber zu ihrem Glueck nicht anmassend auftreten wie manche ihrer Gattung bei andern, die sich Stellvertretung von Wahrheit arrogieren. Bei Ihnen spielt sich das Entscheidende doch im Element Ariels ab.«
Heute werde ich mit der Bearbeitung der letzten Seiten von Herrn Z.2 fertig. Milo3 wird Dir inzwischen gesagt haben, dass das Manuskript erst knapp vor seiner Abreise einlangte.
Ein paar Gedichte schickte ich an die Zeitschrift »Merkur« Baden-Baden, unter Berufung auf Dr. Rychner.4
Zwei Tage lang arbeitete ich an der Uebersetzung einer kleinen, nicht sehr bedeutenden Sache von Cocteau, die mir ein Freund Sperbers, Rainer Biemel, den ich aus B. kenne und der Lektor bei Grasset ist, gab.5 Er schickte sie nach Deutschland und in die Schweiz, aber ich erwarte nicht viel davon. Kennst Du Madame Rouveyre,6 Oesterreicherin und Frau eines frueheren franz. Gesandten in Wien? Sie vertritt den Amandus-Verlag in Paris, und Biemel will mich mit ihr bekannt machen. Ich will ein Manuskript nach Deutschland schicken. In den letzten Tagen habe ich naemlich aufgehoert, einzusehen, warum ich meine Gedichte selber herausgeben soll.
Am 22. gastiert hier die Wiener Oper. Kommt Ursula Schuh?7 Wuerde sie vielleicht zwei Baende Jean Paul8 fuer mich mitnehmen?
Liebe, dieser Brief ist nicht der eigentliche Brief. Vielleicht aber das Gedicht, das ihn begleitet. Umarme es.
Paul
Wir schliefen nicht mehr,
denn wir lagen im Uhrwerk der Schwermut
und bogen die Zeiger wie Ruten,