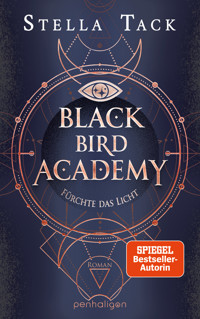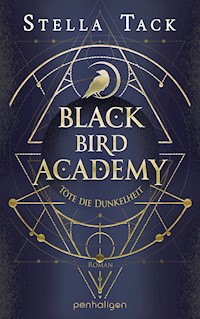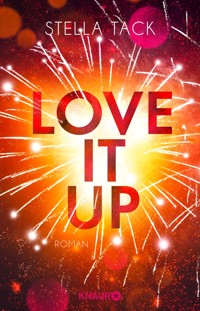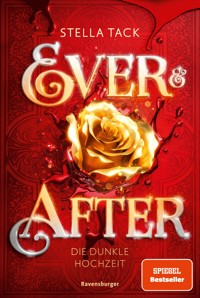
Ever & After, Band 2: Die dunkle Hochzeit (Knisternde Märchen-Fantasy der SPIEGEL-Bestsellerautorin Stella Tack) E-Book
Stella Tack
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Ever & After
- Sprache: Deutsch
Wahre Märchen enden nicht mit " … so leben sie noch heute", sondern mit dem Tod. Mit einem einzigen Kuss hat Rain alles verloren, was ihr lieb und teuer ist. Seit der Prinz aus dem Grab auferstanden ist, stürzt seine Magie das Land ins Chaos. Rain versucht verzweifelt, ihrem düsteren Schicksal zu entkommen. Denn als Schneewittchen-Erbin soll sie den Prinzen heiraten und damit die Prophezeiung erfüllen, die allen den Untergang bringt. Ihr letzter Ausweg: ein Deal mit Rumpelstilzchen. Doch einer Märchenfigur zu vertrauen, ist genauso gefährlich, wie sich in eine zu verlieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
TRIGGERWARNUNGLiebe*r Leser*in,dieser Roman enthält Themen, die potenziell emotional belasten oder triggern können. Hier befindet sich ein Hinweis zu den Themen. ACHTUNG: Dieser enthält Spoiler für die gesamte Handlung.Als Ravensburger E-Book erschienen 2024Die Print-Ausgabe erscheint in der Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg© 2024 Ravensburger Verlag GmbHText © 2024 Stella TackDieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de).Umschlaggestaltung: Alexander Kopainski unter Verwendung von Fotos von Shutterstock: © VladyslaV Travel photo, Ole moda, kaisorn, Media Guru, Breezy Point, Mischokom, Mr. Rashad, popular.vector, KASUE, Iryna_Shancheva, Gizele, armo.rs, Turan Ramazanli, Croisy, soponyono und DISTROLOGO. Sowie unter Verwendung eines Motivs von Turbosquid: © Nardid.Lektorat: Ulrike Gerstner (www.ulliverse.de)Alle Zitate aus Märchen stammen aus: Brüder Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Gesamtausgabe mit allen Zeichnungen von Otto Ubbelohde in zwei Bänden [Erster Band Märchen Nr. 1–93, zweiter Band Märchen Nr. 94–200]. Nach der Großen Ausgabe von 1857. München 2005. Der Märchen- und Eigenname »Sneewittchen« wurde im vorliegenden Werk in »Schneewittchen« umgewandelt.Alle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-473-51210-2ravensburger.com/service
Für meinen Großvater Leopold… der die schlechtesten, aber liebevollsten Zöpfe der Welt geflochten hat.… der voller Hingebung in seinem Garten stand und sich um seine Sonnenblumen gekümmert hat.… der vor Aufregung beim Fußballschauen immer mit den Füßen gewackelt hat wie ein Dackel mit dem Schwanz. … der seine Schokolade immer in der Schublade neben dem Sofa versteckt hat. Sorry, ich hab das Versteck entdeckt, Opa!… der immer mitsummen musste, wenn im Radio Blasmusik lief. … der es liebte, im Heurigen mit seinen Freunden Karten zu spielen.… der mir immer voller Liebe über das Haar gestrichen hat.… der nie ein Buch von mir gelesen hat und dennoch stolz auf mich war.… der mich bis zum Ende angelächelt und versichert hat, ich solle mir keine Sorgen machen. … dessen Hand ich halten durfte. Bis zum letzten Atemzug.Wir vermissen Dich, Opa. So sehr.Ich hoffe, wir sehen uns bei den Sonnenblumen unter den Apfelbäumen wieder.In LiebeDeine Stella
KAPITEL 1
In der Nacht, während alles schlief, stand sie auf und nahm von ihren Kostbarkeiten dreierlei, einen goldenen Ring, ein goldenes Spinnrädchen und ein goldenes Haspelchen; die drei Kleider von Sonne, Mond und Sternen tat sie in eine Nussschale, zog den Mantel von allerlei Rauhwerk an und machte sich Gesicht und Hände mit Ruß schwarz. Dann befahl sie sich Gott und ging fort …
Aus »Allerleirauh«Gebrüder Grimm
Es platschte, als meine Füße in einer Pfütze landeten. Das Wasser spritzte mir dabei bis zu den Waden hoch und durchnässte den Saum des dämlichen Kleides, das so ausladend war, dass ich mich kaum darin bewegen konnte. Obwohl es meine Sicht einschränkte, zog ich mir die Kapuze des blauen Mantels tiefer ins Gesicht und drückte mich dabei so weit in den Schatten, wie ich konnte. Mein Puls hämmerte so laut in meinen Ohren, dass ich kaum etwas anderes hören konnte, auf meiner Zunge lag der blutige Geschmack von geplatzten Äderchen in der Lunge.
Keuchend hielt ich den Atem an, um über das hektische Pochen meines Herzens hinweg auf Schritte zu lauschen, die nicht zu mir gehörten. Meine drei Bewacher waren so leise wie ein Windhauch, und in den zwei Wochen, die ich nun schon im Carneval de Masquerade festgehalten wurde, hatten sie sich jeden meiner Schritte, meine Bewegungen und Gewohnheiten so genau eingeprägt, dass ich quasi nicht einmal furzen konnte, ohne dass es einer der drei bereits vorausahnte.
Und von ihm wollte ich gar nicht erst anfangen. Er war nicht nur wie ein Schatten, der mir folgte, er war der Schatten. Ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass er mit mir spielte wie die Katze mit einer Maus. Er ließ mich los, ließ mich laufen, nur um gelangweilt auszuholen und mich im letzten Augenblick wieder an sich zu ziehen. Obwohl er jedes Mal vor Wut kochte, wenn ich erneut versuchte, von hier abzuhauen, war ich mir ziemlich sicher, dass er dieses Spiel insgeheim genoss, was die ganze Sache hier noch bizarrer machte, als sie ohnehin schon war. Wegen ihm wurden meine Fluchtversuche zu einem Spiel. Wegen ihm wurde ich zu etwas, mit dem man spielen konnte … Und mit jedem Fluchtversuch, der scheiterte, entwürdigte er mich ein Stückchen mehr. Es machte mich schwach und ihn stärker.
Allein der Gedanke ließ mich wütend mit den Zähnen knirschen.
»Worauf wartest du? Lauf endlich. Die Strecke ist frei«, piepte es unter meinem Arm hervor.
»Pssst«, zischte ich und drückte den Vogelkäfig enger an mich. Den Vogelkäfig, in dem ein Spatz saß – der sich verzweifelt mit den kleinen Krallen an der Stange festhielt, um von meinem Gerenne nicht wild hin und her geschleudert zu werden.
»Du sollst …«, begann der Spatz.
»Halt die Klappe, Avery«, zischte ich meinem Cousin zu, der sich beleidigt aufplusterte. »Du weißt, was letztes Mal passiert ist, als wir dachten, die Luft sei rein.« Ich musterte vielsagend seine deutlich geschrumpfte und gefiederte Gestalt. Avery hatte bei dieser gescheiterten Aktion eindeutig den Kürzeren gezogen. Wortwörtlich. Er war winzig.
»Diesmal klauen wir einfach kein Pferd«, knurrte Avery.
»Wer hätte auch ahnen können, dass selbst die Pferde hier böse sind und uns fast zu Tode trampeln und zurückschleifen?«
Der Spatz machte ein Geräusch, das beinahe wie ein verächtliches Schnaufen klang. »Alles hier hat ’nen Knall.«
Das war noch eine Untertreibung. Ich hatte noch nie so viel Angst gehabt wie in den letzten zwei Wochen meines Lebens. Ganz zu schweigen von den subtilen Grausamkeiten, die sich Black zu seinem persönlichen Vergnügen ausdachte. Noch jetzt spürte ich das schreckliche Gefühl des Insekts, das sich in mein Ohr gepresst und mich dazu gezwungen hatte, all meine Gedanken auszuplaudern. Ich hasste diese Ohrwürmer.
Ich drückte Avery fester an mich und lief weiter gebückt und im Schatten der dunklen Gassen, vorbei an dem großen Platz, der sich vor uns auftat. Der Himmel über uns verblasste zu tiefem Grau, als würde die Farbe – nun, da die Sonne untergegangen war – langsam aus der Welt gewaschen werden. Aber selbst nachts war der Carneval nie wirklich dunkel. Dafür war es viel zu voll, zu laut, zu bunt, als versuchte dieser Ort, absichtlich viel Leben auszustrahlen, um all die Menschen anzulocken. Doch wenn sie einmal drinnen waren, kamen sie nicht mehr raus. Keiner von ihnen. Wie eine gigantische Venusfliegenfalle.
Die Grenzen des Carnevals waren von meiner Position aus nur schwach als Waldrand zu erkennen. Ein Schatten, der beständig dunkler wurde, während der Carneval immer heller strahlte. Ich musste nur die Grenze erreichen und mit der Nacht verschwinden. In ihr verschwinden.
Heute war zudem Neumond. Wenn ich eine Chance hatte, mit der Nacht zu verschmelzen, dann war es heute. Es musste einfach funktionieren. Es gab keine Alternative mehr. In den letzten zwei Wochen hatten Avery und ich bereits alles Mögliche versucht, um auszubrechen. Inzwischen war ich müde, wütend und rastlos. In mir klaffte ein Loch, das ich nicht kannte. Es war dunkel, so dunkel … und je länger ich hierblieb – bei ihm! –, desto schlimmer wurde es. Ich durfte nicht aufgeben. Ich hatte Angst, was aus mir werden würde, wenn ich es tat.
Ich zog mir die Kapuze noch tiefer ins Gesicht und rannte los. Das Lachen der Besucher wehte von überall und nirgendwo gleichzeitig zu mir herüber. Ebenso der Duft von Rosen und Zucker. Selbst der leichte Nieselregen war warm, schimmerte wie Diamanten und roch süßlich. Musik zog und zerrte an meinen Muskeln, verwirrte meine Gedanken, doch ich hatte jeden Schritt geübt, ich wusste, was ich tat.
Nicht hinhören, so flach atmen wie möglich, nicht hinsehen.
Ich fixierte einen Punkt vor mir und lief, so schnell ich konnte, während ich mir Mühe gab, mich nicht von der Welt um mich herum einlullen zu lassen. Mein Kleid raschelte leise, als ich über eine gewölbte gläserne Brücke lief, doch anstatt dem Weg weiter zu folgen, blieb ich stehen und blickte nach unten. Es ging tief hinab. Bei einem einfachen Sprung würde man im eiskalten Wasser landen, aber daneben gab es einen schmalen Pfad, und im Gegensatz zum Rest des Carnevals lag dieser im Dunkeln. Als würde das Licht vor dieser Welt zurückschrecken.
Mit einem gehetzten Blick über die Schulter setzte ich Averys Käfig ab und wickelte die Laken von meinem Körper, die ich zu einem Seil zusammengebunden hatte. Ich zurrte das improvisierte Seil an dem gläsernen Geländer fest und ließ es durch den Spalt nach unten fallen. Das Ende saugte sich sofort mit dem Wasser des Kanals voll.
»Alles klar …« Zittrig atmete ich durch, packte den Käfig an dem vergoldeten Ring, während mein Cousin unruhig Ausschau nach unseren potenziellen Verfolgern hielt.
Es war beinahe unmöglich, mich an dem Seil festzuhalten und den Käfig nicht loszulassen, doch es blieb mir keine andere Wahl – außer ich wollte Avery ein unfreiwilliges Bad verpassen. Langsam hangelte ich mich nach unten. Meine Muskeln zitterten vor Anspannung, während ich die Knoten anstarrte und betete, dass sie hielten. Avery und ich schwankten hin und her. Das Seil hielt … zumindest vorerst.
»Rain, mir sträuben sich die Nackenfedern, ich sag’s dir, sie wissen, dass wir weg sind«, zischte Avery mir zu.
»Ich mach ja schon«, knurrte ich zurück, während meine Muskeln vor Schmerz brannten. Der dumme Käfig war so schwer. Am liebsten hätte ich ihn fallen lassen, hätte mich fallen lassen, aber stattdessen biss ich die Zähne zusammen und machte weiter.
Der Stoff scheuerte mir die Hände auf, und das Brennen sendete Schmerzwellen durch meine Finger hinauf bis in meine Schultern. Ein Windzug peitschte mir das Kleid um die Beine. Das Wasser dort unten starrte uns finster und hungrig entgegen. Der süßliche Geschmack von Blut vermischte sich mit etwas Säuerlichem auf meiner Zunge, während ich vor Anstrengung keuchte.
Nicht mehr weit. Nur noch wenige Meter trennten mich von dem kleinen Pfad. Sobald ich mir sicher war, dass ich mir nicht mehr alle Knochen brechen würde, fackelte ich nicht lange. Ich schwang das Seil ein wenig, um nicht im Wasser zu landen, und sprang. Wind zerrte an meinen Haaren, und kurz darauf prallte ich mit voller Wucht auf. Mein Knöchel knackte, Averys Vogelkäfig fiel mir aus der Hand und rollte auf das Wasser zu.
»Rain!«, rief mein Cousin, der wie in einem Hamsterrad herumgeschleudert wurde.
»Fuck!« Mit schmerzverzerrtem Gesicht hechtete ich hinterher und stoppte den Käfig, bevor er ins Wasser plumpsen konnte. Mein Cousin klammerte sich mit dem kleinen Flügel an die Gitterstäbe, der Schnabel pikte hindurch, nur wenige Zentimeter vom Wasser entfernt.
»Heilige Scheiße!«, piepte er.
»Sorry!« Ich stellte den Käfig neben mir ab, und für einen kurzen Atemzug blieb ich völlig platt am Boden liegen, während mir der Regen ins Gesicht prasselte. Die Tropfen rannen mir wie Tränen über die Wange. Mein Fuß pochte, doch als ich die Zehen krümmte, war ich mir zumindest sicher, dass er nicht gebrochen war.
Glück gehabt.
»Warum sind heldenhafte Ausbrüche eigentlich so schmerzhaft?«, fragte ich, während mein Cousin völlig zerrupft auf seine Sitzstange flatterte.
»Vielleicht weil wir keine Helden sind, sondern Schüler, die noch dazu zu faul für den Sportunterricht waren?«, gab er zurück.
»Ach ja, das …« Japsend setzte ich mich auf und verzog gequält das Gesicht, ehe ich mich aufrappelte. Wie sehr ich mir gerade wünschte, ich könnte mich einfach auf ein kuscheliges Sofa schmeißen, eine Packung Chips aufreißen und eine Netflix-Serie gucken.
Ein Sofa gab es, aber es stand bei ihm. Und um nichts in der Welt würde ich meine Chips mit ihm teilen. Da konnte er noch so sehr wie Cole aussehen. Bei dem Gedanken an ihn durchfuhr mich ein dumpfer Schmerz, den ich schnell verdrängte.
Mit zusammengebissenen Zähnen humpelte ich weiter. Der schmale Weg bog nach rechts ab, weg vom Fluss. Weg vom Trubel. Diese Gasse war mein Schlupfwinkel. Nicht mehr als ein Mauseloch. Hierher verirrte sich niemand freiwillig. Und falls es geschah, versuchte man, schnellstmöglich wieder zurück ins Licht zu flüchten. Hier gab es nicht viel. Der Glanz, der Glamour, die Magie fehlten, als wäre es ein ausgefranster Ausläufer. Schäbig, weil sich niemand die Mühe gemacht hatte, auch diese Ecke mit Farbe zu füllen. Das hier war die dunkle Seite des Carnevals. Ich hatte beinahe die ganzen zwei Wochen gebraucht, um diese Sackgasse zwischen all dem Trubel zu finden. Mit etwas Glück wussten weder meine Wachen noch er, dass ich diesen Schlupfwinkel kannte. Wenn sie mich dennoch erwischten, war auch dieses schäbige Loch kein Ausweg mehr. Und dann … dann wäre unsere letzte Fluchtoption ausgeschöpft.
Ich drückte mich gegen eine Hauswand und lief vorsichtig weiter. Vorbei an dem schiefen Gebäude, das aussah, als würde es unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrechen. Von vorn wirkte es möglicherweise bunt und einladend, doch seine Rückwand war grau. Der Putz bröckelte und man roch Schimmel und Feuchtigkeit. Eine gedrungene Tür tauchte vor mir auf. Darüber war ein Schild angebracht, auf dem die Abbildung eines gehängten Mannes zu sehen war, der mit gebrochenem Genick an einem Seil baumelte. Darunter stand: »The Hanged Fool«.
Eine Bar.
Ich hatte sie bereits bei meinem letzten Fluchtversuch entdeckt, doch es war nicht der Ort, an dem sich fröhliche Besucher des Carnevals sammelten. Nein, das hier war ein Ort für die Monster. Und es waren inzwischen schon so viele Monster auf den Straßen. Als würden sie aus seinem Schatten kriechen wie Ungeziefer. Sie sammelten sich hier, tauschten Geld, Gift, Waffen, Lügen oder Informationen.
Sobald ich die Bar hinter mir gelassen hatte, tat sich eine weitere Gasse vor mir auf wie ein langer schmaler Schlauch. Die Wände der Häuser standen seltsam schief und krumm wie verfaulte Zähne in einem Maul. Die Dunkelheit wurde durchdringender, und ich lief schneller, bis mein Atem in keuchenden Stößen hervorkam. In der Ferne konnte man immer noch das Lachen und das vibrierende Leben hören, das im Herzen des Carnevals stattfand. Doch hier hinten wirkte es wie ein verzerrtes Echo. Höhnisch und düster, was meine Paranoia um ein Vielfaches steigerte.
Ich lief schneller, so schnell, dass ich fast über meinen eigenen dämlichen Rocksaum gestolpert wäre. Fluchend fing ich mich an einer Hauswand ab und hätte dabei fast Avery fallen lassen, der in seinem Käfig empört mit den Flügeln ausschlug,
»Pass doch auf!«, piepste er.
»Ich gebe mein Bestes«, fauchte ich zurück.
Mein Atem ging hektisch und verlor sich in rauchigen Schwaden in der Luft. Bald würde es Winter werden. Vermutlich. Um ehrlich zu sein, wusste ich nicht, ob die Jahreszeiten überhaupt noch einer natürlichen Ordnung folgten, seit er aufgewacht war. Zumindest wurde es immer kälter. Oder es kam mir im Augenblick nur so vor, weil mir die Angst in den Knochen saß.
Ein erleichtertes Seufzen entwich mir, als wir auf einem Gehsteig herauskamen, der von altmodischen Straßenlaternen beleuchtet wurde. Dahinter befand sich der Fluss, über den ab und zu Gondolieri mit ihren Gondeln fuhren, um tiefer im Carneval zu verschwinden. Und dahinter? Da war der Wald. Es gab hier keine Brücke, die ich nutzen konnte. Die nächste befand sich mitten im Trubel. Auf der hatten sie mich bereits erwischt. Hinter mir dasselbe. Darum blieb mir nur noch eine Möglichkeit.
Ich stellte Avery ab und starrte auf das Wasser, das an meinen Schuhen leckte. Ich sah mich selbst darin. Niemanden sonst. Keine zweite Person, wie es all die Jahre der Fall gewesen war, wenn ich in eine spiegelnde Oberfläche geblickt hatte. Kein junger Mann mit dunklen Haaren, der mich damit aufzog, dass er mich in der Nacht wie eine Motorsäge schnarchen gehört hatte. Wie sehr ich mir inzwischen wünschte, dass alles wieder so war wie damals! Als ich Buh für nicht mehr als einen imaginären Freund, oder allerhöchstens lästigen Hausgeist, gehalten hatte. Als noch keine weißhaarige Version von ihm zum Leben erwacht war und mein Leben völlig verändert hatte. Der Gedanke an ihn schnürte mir die Kehle zu. Er war nicht mehr bei mir, und ich hatte die Scherben, die er in mir hinterlassen hatte, noch immer nicht kitten können. Das Gesicht, in das ich mich verliebt hatte, sah mich jetzt nicht voller Hingebung an, sondern war ein verzerrter Albtraum, der mich verfolgte.
Ich kniff die Augen zusammen und konzentrierte mich wieder auf die Gegenwart. Ich durfte mich nicht ablenken lassen. Entschlossen fasste ich hinter mich und band mit tauben Fingern die Schnüre meines Kleides auf. Der ganze Mist dauerte viel zu lang, und schon bald riss ich nur noch an den Bändern herum, ehe ich es endlich so weit geschafft hatte, dass ich mich aus der Seide herausschälen konnte. Die Unterröcke landeten ebenfalls in einem Haufen aus Stoff zu meinen Füßen. Rein aus Befriedigung gab ich ihnen einen Extratritt.
Die Kälte ließ eine Gänsehaut über meinen Körper rieseln. Augenblicklich begann ich, mit den Zähnen zu klappern. Scheiße, es war tatsächlich zu kalt, um nur noch im weißen Unterkleid dazustehen, aber mit dem schweren Kleid wäre ich mit ziemlicher Sicherheit sofort untergegangen. Das Wasser so schwarz, als hätte jemand Teer darin ausgeschüttet. Allein der Gedanke an Teer und welche Person damit einherging, ließ mich schaudern. Und für einen kurzen paranoiden Augenblick stellte ich mir vor, dass eine Hand aus dem dunklen Wasser auftauchte und mich hinunterzog.
Ich blinzelte heftig und vertrieb die Angst, so gut es möglich war.
Jetzt.
Jetzt oder nie!
Ich holte tief Luft, wappnete mich gegen die Kälte, die noch viel heftiger werden würde, und sprang in den Fluss. Es platschte, und eine Millisekunde spürte ich gar nichts, bis sich meine Muskeln alle gleichzeitig anspannten. Meine Haut brannte förmlich, und es fühlte sich an, als würde ich mich in einen Eiswürfel verwandeln. Die Kälte war so schmerzhaft, dass ich einen Aufschrei unterdrücken musste. Meine Schuhe sogen sich unangenehm mit Wasser voll und ließen mich gefühlt zehn Kilo schwerer werden. Shit, die hatte ich vergessen! Bibbernd streifte ich sie ab, holte aus und warf sie ans andere Ufer. Sie landeten haarscharf auf dem Trockenen, ehe ich mich umdrehte und Averys Käfig nahm. Ein Teil davon tauchte ins Wasser ein, und mein Cousin drückte sich an das Dach, um nicht unfreiwillig ein Vogelbad zu nehmen.
»Wir müssen dringend herausfinden, wie man diesen bescheuerten Käfig öffnet«, knurrte mein Cousin, als ob wir die letzten Tage nicht genau das versucht hätten.
»Machen wir, sobald wir nicht ertrunken sind«, erwiderte ich keuchend und bemühte mich, nicht unterzugehen, während ich durch den Fluss strampelte.
Im Gegensatz zu Avery war ich keine gute Schwimmerin. Mehr Bleiente als Schwan, und meine Muskeln fühlten sich von der Kälte dreimal so schwer an, wie sie es sein sollten.
»Ähm … Rain. Rain … Ich werde nass!«, krächzte mein Cousin mir ins Ohr.
»Dann halt … die Luft an«, brachte ich japsend hervor und versuchte verzweifelt, nicht vom Gewicht des Käfigs nach unten gezogen zu werden.
Gleich. Das Ufer war bereits in meiner Nähe. Ich strampelte kräftiger, als ich es plötzlich hörte. Das Schlagen von Flügeln. Direkt über mir.
Prustend riss ich den Kopf hoch und sah über mir den Umriss eines Vogels. So dunkel, dass er mit der Nacht verschmolz. Ich strampelte heftiger, sodass noch mehr Wasser in den Käfig schwappte.
»Nicht ausflippen!«, zischte mein Cousin.
»Sie haben uns gefunden!«, fauchte ich zurück.
»Es könnten irgendwelche Vögel sein. Es hilft nichts, wenn du uns jetzt beide absaufen lässt.«
»Scheiße noch mal …«, knurrte ich, versuchte, meinen Puls ruhig zu halten und nicht auszuflippen.
Avery hatte recht. Es konnte ein Zufall sein. Es mussten keine Raben sein. Nur leider wurde das Geflatter lauter. Und dann war da noch ein Vogel und noch einer. Drei Stück.
»Sie sind es«, stellte ich trocken fest.
»Mist«, murrte mein Cousin, und ich schluckte Wasser, als einer der Vögel herabstieß.
Sein Körper drehte sich wie eine Pfeilspitze, die zu Boden sauste, begleitet von Flügelrauschen. Der Körper wurde größer, schmaler, muskulöser, ehe die Federn in einem Wirbel abfielen. Auf der Uferseite, an die ich hatte schwimmen wollen, hockte jetzt eine kräftige, männliche Gestalt in dunkler Rüstung, die an steifes Leder erinnerte, und versperrte mir den Weg. Das Gesicht war von rostroten Haaren umrahmt, die er sich nachlässig zu einem Knoten im Nacken gebunden hatte. Hohe Wangenknochen, helle Haut, stechend dunkle Augen.
Melchior.
»Meine Prinzessin, was tut Ihr da?«, fragte er, und ich stieß einen so wüsten Fluch aus, dass seine Augenbrauen nach oben schnellten.
Ich wirbelte herum, doch da landeten nun auch die zwei anderen Vögel in einer Wolke aus Federn, die von den Körpern platzten. Im nächsten Augenblick standen mir ein Mann mit halblangen blonden und einer mit kurz geschorenen schwarzen Haaren gegenüber.
Kaspar und Balzer. Kaspar war so hell wie Balzer dunkel.
Kaspar erinnerte mich immer an einen Wikinger. Seine breiten Schultermuskeln wölbten sich bei jeder Anspannung. Sein Kinn, die Nase, selbst der Mund war kantig, und in die schulterlangen blonden Haare waren Zöpfe und kleine Metallplättchen gewoben, die bei jedem Schritt klimperten. Sein stechend blauer Blick lag kühl auf mir.
Balzer war groß und eher sportlich schlank als ungeschlacht muskelbepackt, doch ich hatte ihn mehr Gewichte stemmen sehen als die beiden anderen zusammen. Er war immer angespannt, sein Blick wachsam. Ihm entging keine meiner Regungen. Seine linke Augenbraue war von zwei Stiften durchstochen, und seine Unterlippe hatte eine helle breite Narbe, als hätte sie jemand zweigeteilt.
Auf den ersten Blick hätte man die drei niemals als Brüder identifiziert, aber in ihren Adern floss das Erbe der Drei Raben. Als sie sich das erste Mal in Federvieh verwandelt hatten, dachte ich, ich hätte endgültig den Verstand verloren. Doch die Magie war inzwischen wie ein Virus, das sich nicht nur durch das Land, sondern auch durch die Menschen fraß.
Ich hatte keine Ahnung, wie sie zu ihm gekommen waren, aber seit ich hier festgehalten wurde, standen mir die Brüder als meine persönliche Leibgarde zur Seite und waren wie Schatten, die mir überallhin folgten.
»Prinzessin«, sagte Kaspar nun ebenfalls, und egal, wie attraktiv dieser Kerl auch sein mochte, in diesem Moment hasste ich ihn wie die Pest.
»Nein!«, blaffte ich nur und strampelte auf der Stelle.
»Prinzessin, kommt heraus, Ihr holt Euch nur eine Erkältung«, sagte Melchior streng. Sein rotes Haar stach in der Dunkelheit hervor.
»Ich gehe nicht zu ihm zurück!«, rief ich wütend.
Kaspar neigte den Kopf und sank auf ein Knie. »Prinzessin, bitte«, sagte er und sah aus, als würde er jeden Augenblick zu mir ins Wasser kommen.
Ich starrte keuchend Melchior an: »Lass mich einfach gehen, Melchior. Bitte.« Ungeweinte Tränen, Angst und Wut ballten sich als Kloß in meinem Hals und machten mir das Atmen schwer.
Doch Melchior schüttelte nur den Kopf. »Ihr müsst zurückkommen. Der Prinz ist krank vor Sorge um Euch. Der ganze Carneval ist in Aufruhr.«
Dieser Bastard!
Ich spuckte Wasser aus und knurrte zurück: »Er kann sich seine Sorgen in den Arsch schieben.«
Melchior zuckte mit keiner Wimper. Er hatte die letzten Wochen auf mich aufgepasst, und ich hatte nicht viel anderes zu tun gehabt, als ausfällig zu werden. Nur seine Stimme wurde eine Nuance dunkler, genauso wie seine Augen, und es wirkte beinahe, als würde sich der Schatten von Federn auf seiner Haut abzeichnen. »Bitte, Prinzessin, wir wollen Euch nicht wehtun, aber wir werden es, wenn Ihr uns dazu zwingt.«
»Fick dich!«, keuchte ich zurück, und Avery planschte nervös in seinem Käfig herum. Er hatte eine Scheißangst vor Melchior.
»Was tun wir?«, fragte Avery.
»Plan Z«, sagte ich.
»Haben wir einen Plan Z?«
Mein Blick landete auf dem Käfig, der mich ohnehin nur nach unten zog. »Jetzt schon. Halt dich fest«, knurrte ich meinem Cousin zu und holte aus, was schwimmend eine ziemliche Meisterleistung war.
»Was hast du vor?«, fragte er panisch.
»Plan Z«, bellte ich, und der kleine Vogel klammerte sich an den Gitterstäben fest.
»Prinzessin …«, setzte Melchior wieder an, und im nächsten Augenblick landete der harte Käfig an seinem Kopf.
Klonk.
Es knallte laut, als Melchior von der Wucht des Treffers aus der Hocke gerissen wurde. Er brüllte vor Schock und Schmerz auf. Ich hoffte, ich hatte ihm die Nase gebrochen.
Kaspar und Balzer kamen hinter mir hektisch in Bewegung, doch da krabbelte ich bereits aus dem Wasser. Ich musste wie eine halb ersoffene Ratte aussehen. Zwischen meinen Zehen spürte ich Kiesel, Gras und Schlick. Melchior lag schlaff am Boden. Blut, dessen Ursprung ich jedoch nicht ausmachen konnte, mischte sich mit Schlamm.
Ohne innezuhalten, schnappte ich kurz nach Luft, packte den Käfig und rannte los. Ich hasste den Gedanken, dass ich meine Schuhe zurücklassen musste. Das Ganze würde ohne sie schwieriger werden, aber dann würden eben meine Füße bluten. Hauptsache, ich kam von hier weg. Wunden heilten, die Welt jedoch nicht, wenn ich hierblieb.
»Prinzessin, bleibt stehen!«, brüllte mir Kaspar hinterher. Seine Stimme war wie ein Donnergrollen und jagte mir einen Schauder über den Rücken.
Avery piepte vor Panik, aber ich hatte keine Zeit zu gucken, ob es ihm gut ging. Ich rannte, als wäre der Tod persönlich hinter mir her. Zweige peitschten mir entgegen, während ich in den schützenden Wald lief. Sofort wurde es stockdunkel. Genau das hatte ich gewollt, doch ich merkte erst jetzt, dass nicht nur meine Verfolger nicht sehen konnten, wo ich war – ich selbst war ebenfalls orientierungslos. Eine Sekunde später knallte ich auch schon hart mit der Schulter gegen einen Baum. Etwas Spitzes rammte sich in meinen Fuß und ließ mich vor Schmerz aufjaulen. Meine Zehen krampften sich zusammen, etwas kratzte an meinen Beinen entlang und riss am Stoff des bescheuerten Unterkleids. Ich humpelte weiter. Äste peitschten mir ins Gesicht, rissen an meinem Kleid wie Finger, die mich festzuhalten versuchten.
Hektisch drehte ich mich um mich selbst, suchte nach einem Schlupfwinkel, einem Ausweg, irgendeinem Weg. Doch es war zu dunkel. Keuchend hielt ich mich an einem Baum fest und tastete mich an der rauen, teils bemoosten Rinde nach vorn. Immer weiter und weiter. Die Bäume standen so dicht, dass sie wie eine Kuppel wirkten, die sich über mir spannte. Ohne jegliches Mondlicht fühlte es sich an, als hätte mich der Wald wie ein Monster verschluckt.
Plötzlich knallte etwas gegen mein linkes Bein.
»Uahhh!« Ein Schrei entkam meinen Lippen, während ich hart zu Boden stürzte. Der Vogelkäfig fiel mir aus der Hand, und ich hörte ein Flattern.
»Rain?«
»Scheiße«, stieß ich hervor und krabbelte keuchend weiter. Tannennadeln, spitze Äste und Erde gruben sich in meine Haut, unter die Fingernägel. Mein Schienbein pochte, und ich presste fluchend die Zähne zusammen. »Avery?«, wisperte ich. Der Schmerz und die Angst trieben mir Tränen in die Augen. »Avery!«, rief ich lauter.
Niemand antwortete mir.
O nein, nein, nein. Hektisch fuhr ich mit den Händen über den Waldboden. Wo war er? Gerade hatte ich ihn doch noch festgehalten. So ein blöder Käfig konnte doch nicht verloren gehen!
Mein Herzschlag wummerte so laut, dass ich Blut auf der Zunge schmeckte. Meine Finger tasteten über den Waldboden, doch da war … nichts. Wo war der Käfig?
»Av…«, setzte ich an und verstummte sofort wieder, als ich es hörte. Das Schlagen von Flügeln. Rabenflügel? Ich erstarrte. Hielt die Luft an und lauschte über das Dröhnen meines Herzschlags hinweg.
Das Flattern klang nah, viel zu nah, gefolgt von einem Krächzen, das mir die Nackenhaare aufstellte.
Kraaah.
Ich traute mich nicht, auch nur einen Finger zu rühren, geschweige denn zu atmen, obwohl ich das Kitzeln von langen dünnen Spinnenbeinen fühlte, die über meine Haut huschten und im Kragen meines Unterkleides verschwanden. Ich spannte mich an und kniff die Augen zusammen. Nicht zucken, nicht bewegen, nicht schreien …
Krraah.
Krrrah.
Das Krächzen wurde lauter. Es erklang direkt über mir. Nicht bewegen, nicht bewegen …
Das hektische Gekrabbel wuselte jetzt meine Wirbelsäule hinab.
Krrrah!
Ein Flattern, gefolgt vom Knacken eines Astes. Der Vogel flog … weg? Ich hielt die Luft an, bis mir schwindelig wurde, doch das Flattern kam nicht zurück. Die Stille lastete wie Blei auf meinen Ohren, und erst als ich kurz davor war, ohnmächtig zu werden, holte ich Luft. Der Laut rasselte durch meine Lunge.
Schluchzend rieb ich mir über den Oberschenkel, als ich unvermittelt dünne, haarige Beine spürte, die über mich krabbelten. Ich würgte, während ich so lang über mich wischte, bis ich nicht mehr das Gefühl hatte, von Spinnen überrannt zu werden.
»Avery?«, flüsterte ich erstickt und tastete mich blind nach vorn. »Avery?«
Doch mein Cousin antwortete nicht. Kein Ton von ihm. Mein Puls hämmerte so heftig, dass ich es am Hals fühlen konnte, während ich versuchte, ruhig zu bleiben. Jetzt nur nicht ausflippen. Wo war er?
»Avery«, rief ich so laut, wie ich mich traute, was nicht mehr als ein Wispern war. »Wo …«, setzte ich erneut an, als ich es fühlte. Ganz sanft. Ein Streifen an meiner Wange. Beinahe wie ein Kuss, ein Wispern, ein Windzug. Reflexartig griff ich nach dem Etwas. Eine Feder. Lang und steif. Zu groß, um zu Averys kleinem braunem Spatzenkörper zu gehören. »Shit!«, stieß ich im selben Augenblick hervor, als es über mir knackte und etwas vor mir landete. Erde spritzte mir ins Gesicht, und der Aufprall mischte sich mit meinem Aufschrei, als ich zurückzuckte.
»Prinzessin.«
Kaspar.
Dieser verdammte blöde Wikinger.
Hektisch rappelte ich mich auf, um weiterzulaufen, doch ein spitzer Schmerz zog sich durch meine Wade, und ich schaffte es nur langsam davonzuhumpeln. Feuchtigkeit sickerte an meinen Beinen hinab, verschmierte mir die Füße. Jeder Schritt war eine Qual und fühlte sich an, als würde ich den Knochen in meinem Unterschenkel ein Stück weiter einreißen. Im nächsten Augenblick stolperte ich gegen eine Wand.
»Uff!«
Die Luft wich mir aus der Lunge, und ich wäre wahrscheinlich unsanft auf dem Hintern gelandet, wenn nicht zwei Arme nach vorn geschnellt wären und mich gepackt hätten. Der Griff war hart wie Stahl und absolut unnachgiebig.
»Ihr könnt nicht weglaufen.« Die Worte waren ein Knurren in meinen Ohren.
Ich trat aus, was in etwa so effektiv war, wie eine Wand zu treten. »Lass. Mich. Los!«, brüllte ich, und mein Schrei zerriss die Dunkelheit.
»Es tut uns leid, Prinzessin«, sagte jemand. Melchior?
»Bitte!« Ich bebte am ganzen Körper, als das Adrenalin meine Muskeln zum Erzittern brachte. In diesem Augenblick wollte ich nichts lieber, als aus meiner eigenen Haut zu kriechen. Mein Blick flackerte. »Ihr dürft mich nicht zu ihm zurückbringen«, flehte ich und hasste mich für meine eigene Schwäche.
»Es tut uns leid«, wiederholte Melchior nur. Im nächsten Augenblick spürte ich einen harten Schlag auf meinem Kopf. Und alles wurde dunkel.
KAPITEL 2
»Es ist draußen so kalt, dass einem der Atem friert: da weht ja der Wind hindurch und die Dornen reißen mirs vom Leib.«
Aus »Die drei Männlein im Walde«Gebrüder Grimm
Happy Ends sind eine Lüge, da war ich mir sicher. Selbst die Götter waren am Schluss elendig zugrunde gegangen. Und Schneewittchen? Rapunzel? Cinderella? Zu guter Letzt war ihnen allen ein miserables Leben beschert gewesen, in denen sie betrogen, misshandelt, eingesperrt und vergiftet worden waren. Mein Leben lang hatte mir meine Großmutter erzählt, unsere Vorfahren seien von den Göttern geliebt und geprüft und danach mit Reichtum, Glück, Wohlstand, Magie und einem Ehemann belohnt worden. Sie waren am Hof der Götter willkommen geheißen und bis ans Ende ihrer Tage mit vollem Bauch, in einem weichen Bett und mit einer Schar Kinder glücklich geworden.
Aber – und das war das Unheimliche an der ganzen Sache – wer wusste schon, ob das wirklich passiert war? Es schien wie ein weiteres Märchen zu sein, das man sich erzählt hatte. So wie unser Pastor in Woodley vom Himmel schwadronierte, um uns die Angst vor dem Tod zu nehmen. Es gab schlichtweg keine Beweise, was nach dem sogenannten Happy End mit unseren Vorfahren passiert war.
Doch absurderweise schien dieses abwegige Happy End das Ziel Dutzender Generationen von Nachfahren geworden zu sein. Wozu? Um in weichen Betten zu liegen, die wir ohnehin hatten? Um Land zu besitzen? Ein Haus? Häuser? Paläste? Geld? Macht? Wenn man so darüber nachdachte, waren all das Ziele, die man auch ohne Märchenprinzen erreichen konnte, solange man etwas dafür tat.
Wie viele der Märchenfamilien hatten sich im Laufe der Zeit selbst in den Ruin getrieben, nur weil sie zu blasiert gewesen waren, um sich einen »normalen« Job zu suchen? Weil sie in ihren alten Häusern saßen und gewartet hatten, umgeben von noch älteren Büchern und Tand. Darauf gewartet, dass Magie und Götter ihnen das gaben, was sie wollten. Vielleicht wäre all das nicht passiert, wenn die alten Märchenfamilien einfach die Vergangenheit hinter sich gelassen hätten. Ihre Sterblichkeit akzeptiert und nicht versucht hätten, verzweifelt so zu tun, als wären sie mehr als gewöhnliche Menschen mit gewöhnlichen Bedürfnissen.
Die Nachfahren hatten sich über so viele Generationen hinweg eingeredet, etwas Besonderes zu sein, dass es uns am Ende in den Ruin getrieben hatte. Im Bestreben, ein Happy End zu finden, hatten wir uns selbst zerstört, und vielleicht war das der Sinn hinter der ganzen Sache. Letztlich war »Und sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Zeiten« nicht mehr als eine süße, tödliche Falle.
Wie es schien, reihte ich mich in die Tradition ganz gut ein. Ich hätte es besser wissen müssen, hätte wissen müssen, dass der schöne blasse Junge mit Haaren so weiß wie Schnee er ist. Doch der feine Ausdruck in seinen Augen, sein sanftes Wesen und das Gefühl, jemandem vertrauen zu wollen, hatten mich naiver gemacht, als ich war. Uns allen war klar, dass die bösen Jungs aufregend, aber tabu waren. Dass man die Finger von den Bad Boys lassen sollte. Dass sie gefährlich waren. Doch er? Er hatte mich mit einem milden Lächeln und sanften Worten in eine vermeintliche Sicherheit gelockt wie eine Spinne in ihr Netz. Und am Ende war ich freiwillig in seine Falle getappt. Er hatte nicht mehr tun müssen, als geduldig zu warten. Auch wenn die Situation mit Cole und Black noch um einiges komplizierter war, so konnte ich dennoch nicht anders, als auf mich selbst wütend zu sein … und auf ihn! Immer wieder auf ihn.
Womöglich sollte ich nun erst recht nicht die Hoffnung verlieren, meinen Kampfgeist wiederfinden und heroisch versuchen, diesen ganzen Scheiß im Alleingang zu retten. Das hatte ich auch ehrlich versucht. Wirklich. Hatte die ganze Scheiße durchgezogen. Aber langsam beschlich mich das Gefühl, dass diese Heldensache auch nur eine Lüge war. Nicht jede Bedrohung konnte mit Licht, Liebe und rechtschaffener Freundschaft besiegt werden. Man konnte den Kerl mit der Knarre in der Hand noch so sehr lieben, wie man wollte, es machte einen am Ende nicht weniger tot, wenn er tatsächlich abdrückte. Zudem war ich mir langsam nicht mehr so sicher, warum ich mich selbst in dieser Sache als das Gute, das Licht, die Liebe und Heldin betrachtete. Wer sagte eigentlich, dass ich die Hauptrolle spielte, die alles am Ende rettete? Vielleicht war ich am Ende nicht mehr als eine unbedeutende Nebenfigur und dachte nur, diese Geschichte würde sich um mich drehen, weil ich nicht bemerkte, dass ich mich in Wirklichkeit um jemand anderen drehte. Wenn dem so war, hoffte ich nur, der wahre Held dieser Geschichte beeilte sich ein wenig. Denn meine Lage wurde brenzlig, und ich brauchte jetzt eventuell doch jemanden, der mich rettete.
Mein Kopf pochte nach dem Schlag so schmerzhaft, dass ich die Augen zusammenkneifen musste. Ich atmete so flach wie möglich und versuchte, Zeit zu schinden, nur um ihn nicht ansehen zu müssen. Ich spürte ihn wie einen kalten Hauch in der Luft. Ich spürte ihn immer, und ich nahm an, er spürte mich ebenfalls. Wie einen zweiten Herzschlag, der zwar nicht in mir war, aber dennoch zu mir gehörte. Ich war mir sicher, nie etwas abgrundtiefer gehasst zu haben als ihn. Allein seine Anwesenheit verursachte mir Übelkeit, und trotzdem … sobald er den Raum verließ, vermisste ich ihn. Ja, ich hatte mich sogar dabei ertappt, wie ich ihn suchte. Er wiederum suchte mich. Wir waren wie zwei Magnete, die einander abstießen und sich direkt wieder anzogen.
Ich hörte ein Feuer prasseln und spürte einen weichen Untergrund. Ein Kissen unter meinem Kopf. Der Saum meines zerfetzten Unterkleids war noch etwas nass. Ich konnte also nicht lange ohnmächtig gewesen sein. Die Schmerzen in meinem Kopf wurden mit jedem Atemzug schlimmer. Wahrscheinlich hatte ich eine Gehirnerschütterung. Hoffentlich würde mir schlecht werden, dann könnte ich ihm zumindest vor die Füße kotzen. Allein die Genugtuung, seinen angeekelten Blick zu sehen, wäre befriedigend. Die letzten zwei Wochen waren ein einziges Katz-und-Maus-Spiel gewesen. Er hatte mir das Gefühl gegeben, ich könnte fliehen, nur um mich danach wieder einzufangen. Doch seine Bestrafung traf nicht mich. Nie. Nur alle um mich herum. Und seine Strafen wurden immer härter und grausamer. Avery war der beste Beweis dafür.
Umso grausamer machte es die Tatsache, dass ich, sobald ich ihm ins Gesicht blickte, Cole darin sah.
Meine Augenlider zuckten. Falls er es bemerkt hatte, sagte er nichts. Das Schweigen im Raum dehnte sich ins Endlose aus. Ich spürte seinen Blick auf mir. Er beobachtete alles an mir. Sah mit Sicherheit meinen beschleunigten Puls, meine etwas zu schnelle Atmung und das unterdrückte Zucken meiner Augenlider. Dennoch hielt ich stoisch die Augen zu und tat so, als würde ich schlafen. Er schwieg. Ließ mich glauben, er würde mir glauben.
All das war wieder ein Spiel. Als amüsierten ihn meine Anstrengungen, ihn übertrumpfen zu wollen. Egal, womit.
Ich wartete darauf, dass er etwas sagte, einknickte, seine Ungeduld zeigte … Doch er tat nichts davon. Und mir schliefen allmählich die Beine ein. Ganz zu schweigen davon, dass meine Nase juckte, meine Beule pochte, mein Fuß schmerzte und ich langsam, aber sicher aufs Klo musste. Meine Blase drückte umso mehr, je länger wir »Wer kann am längsten schweigen« spielten, bis ich vor Ungeduld fast aus der Haut fuhr. Musste der Kerl nicht mal niesen? Nicht einmal seine dämlichen Klamotten raschelten, obwohl er darauf bestand, einen bescheuerten Umhang zu tragen?!
Ich spannte meine Muskeln an, und dann passierte es. Eine Haarsträhne löste sich, fiel mir auf die Stirn, kitzelte meine Nase und … O nein, nein, nein, nicht …
»Hatschi!«
Obwohl ich es zu unterdrücken versuchte, zerfetzte mich das Niesen beinahe innerlich. Der Laut dröhnte ohrenbetäubend in der Stille, und ich biss mir vor Frust auf die Unterlippe. Mist, Mist, Mist!
Ein Lachen folgte. Weich und dunkel, wie Samt und Seide und dennoch bar jeder Emotion. Es stellte mir die Nackenhaare auf.
Das war’s. Ich hatte verloren. Erneut.
Seufzend schlug ich die Augen auf und blickte zu einer Stuckdecke. Mein Blick zuckte durch den inzwischen vertrauten Raum. Alle nannten ihn den kleinen Salon. Es schien sein Lieblingsplatz zu sein, mit dem Kamin, in dem das flackernde blaue Feuer Tag und Nacht brannte, dazu ein dicker Teppichboden, eine Chaiselongue und ein Schreibtisch. Bücherregale säumten die hintere Wand, und ein Schachspiel stand neben mir, die Partie halb fertig. Es war unsere. Er hatte Schwarz gespielt. Ich Weiß. Weiß war dabei zu verlieren.
Ich schluckte und sah auf seinen Rücken. Gegen das flackernde Licht war er im ersten Augenblick nicht mehr als eine Silhouette. Hochgewachsen und schlank. Das Haar etwas zu lang, sodass es seine Schultern streifte. Der dunkle Umhang ergoss sich wie ein Wasserfall über seine Schultern. Er spürte meinen Blick, daran gab es keinen Zweifel, und dennoch wartete er drei weitere angespannte Atemzüge, bis er mir sein Profil zuwandte und das Feuer seine schönen Züge beleuchtete.
Ein Stich durchfuhr mich bei seinem Anblick, der so vertraut war und doch so fremd. Die gerade Nase, die geschwungenen Augen, seine Lippen, von denen die obere etwas voller war als die untere. Er war alterslos, keine Falte war zu sehen, als hätte die Zeit ihn nie berührt, so schön, dass einem schwummrig im Kopf wurde. Doch in seinen Augen fehlte jede Spur von Seele, jeder Funke von Wärme. In diesen Augen war rein gar nichts, nichts als endlose Dunkelheit.
Da stand er.
Meine schöne, dunkle Falle.
Der Prinz.
Black.
Es tat weh, ihn zu sehen und in ihm gleichzeitig Cole wahrzunehmen, sein Spiegelbild, das er zu mir geschickt hatte und in das ich mich verliebt hatte. Ein Spiegelbild, das ich nicht wieder zu Gesicht bekommen hatte und von dem ich nicht wusste, ob es jemals wirklich existiert hatte oder ob Cole nur ein weiteres seiner grausamen Spielchen gewesen war. Ich hatte seit Wochen keine Ahnung mehr, was real war und was nicht.
Wir starrten uns an, und ich fragte mich, was er wahrnahm. Ich musste grauenhaft aussehen. Dennoch zwang ich mich, den Blick nicht abzuwenden, sondern hob das Kinn.
Sein linker Mundwinkel verzog sich nach oben, als wäre er stolz auf meine Reaktion. Oder schlichtweg amüsiert. »Noch fünf Minuten länger, und ich hätte versucht, dich wach zu küssen.« Aus dem Mund einer anderen Person hätte das wie ein Scherz geklungen, doch aus seinem war es eine Drohung.
»Wo ist Avery?«, fragte ich, ohne auf seine Bemerkung einzugehen. Ich wünschte, meine Stimme würde nicht ganz so beschissen dünn klingen.
Der dunkle Prinz legte den Kopf schief und musterte mich eindringlich, als fände er es faszinierend, was da vor ihm lag. »Wir haben deinen Cousin im Wald gefunden. Du solltest Dinge nicht so schnell verlieren, die dir am Herzen liegen«, tadelte er mich sanft.
»Ich will ihn sehen«, sagte ich, schwang meine Beine über die samtrote Chaiselongue und zuckte zusammen, als ein scharfer Schmerz einmal quer durch meinen gesamten Körper fuhr. Ein Fluch entkam mir, während ich eine Hand auf die Stirn presste und gegen den Schmerz anatmete.
Es raschelte. Im nächsten Augenblick stand Black vor mir. Wie ein Schatten, der mich verschluckte. Er berührte mich nicht, doch allein die wenigen Millimeter, die uns trennten, genügten, um mich unvermittelt innehalten zu lassen.
»Dein Cousin erholt sich im Augenblick. Wie es aussieht, hat er sich einen Flügel gebrochen«, sagte er bedächtig.
Scharf sog ich die Luft ein und blickte auf. Es war, als würde man ein Gemälde betrachten. Schön und leblos zugleich.
»Ich will ihn sehen«, wiederholte ich.
Blacks Ausdruck änderte sich nicht, doch er beugte sich zu mir herab. Ich zwang mich stillzuhalten, nicht zurückzuweichen, flach zu atmen, um möglichst wenig jene Luft einatmen zu müssen, die er ausatmete.
»Dein Cousin erholt sich von den Strapazen eures Ausflugs, und das solltest du auch.« Sein Blick wanderte über meine Haut, und ich kam mir viel zu nackt vor. Das ehemals weiße Unterkleid zeigte zu viel, war zu zerrissen. Er ging in die Knie und griff nach meinem Fuß.
»Was machst … Fass mich nicht an!«, fuhr ich ihn an, als er mit dem Finger über mein Schienbein strich.
Instinktiv trat ich aus, doch er schnalzte nur mit der Zunge und packte meinen Fuß so fest, dass ich aus dem Griff nur wieder herauskäme, wenn ich mir selbst etwas brechen würde. Oder ihm. Also hielt ich widerwillig still, während er meinen Fuß einer Musterung unterzog. Das helle Weiß war von Kratzern übersät, die sich blutig in die Haut gruben.
Eine Furche bildete sich zwischen seinen Augenbrauen. »Deine Fußsohlen sind blutig«, stellte er fest und blickte mich über meinen Fuß hinweg an.
Meine Brust hob und senkte sich heftig, während er mit der anderen Hand beinahe liebevoll und zärtlich über die Wunden strich.
»Damals, noch am alten Hof, als der Sonnenkönig regierte, gab es Frauen, die sich die Zehen und die Fersen abhackten, um der gängigen Mode zu entsprechen.« Seine Stimme klang dumpf. Weit weg, beinahe wehmütig und zornig zugleich.
Angespannt hielt ich die Luft an und beobachtete, wie seine Finger über meine Haut tanzten. Irgendwie erwartete ich immer, Nacht und Nebel von seinen Fingern tropfen zu sehen, etwas Magisches, doch wenn er seine Magie wirkte, war es nie mehr als ein unsichtbarer Atemzug.
Er strich über einen tiefen Kratzer und die Wunde schloss sich, als wäre sie nie da gewesen, währenddessen plauderte er mit mir, als wäre diese ganze Situation nicht völlig schräg:
»Die Schwester des Königs, die Göttin der Zeit, die von allen Contessa genannt wurde. Sie hatte schöne Füße, klein, zierlich und perfekt. Beinahe wie die eines Kindes. Ihre Füße galten als so schön, dass sie sich Schuhe aus Glas anfertigen ließ, damit jeder sie sehen konnte. Die Schuhe waren ein Meisterwerk. Einmalig. Sie schimmerten bei jedem Schritt wie Diamanten in der Sonne. Bald schon war es am Hof verpönt, größere Schuhe als die der Contessa zu tragen. Die Frauen am Hof griffen zu den unangenehmsten Methoden, um ihre Füße kleiner erscheinen zu lassen.« Gemächlich strich er mit den Fingern über den Spann meines Fußes.
Ich zuckte zurück, doch er packte fester zu und fuhr fort: »Einmal gab die Contessa zu Ehren einer neuen Hofdame ein Fest, und sie versprach den anwesenden Damen ihre gläsernen Schuhe, sollte auch nur eine hineinpassen.« Er umschloss meinen Fuß, bis es wehtat.
Ich unterdrückte einen Aufschrei.
»Da nahm die neue Hofdame, ohne zu zögern, ein Messer und schlug sich vor allen Anwesenden die Zehen ab«, sagte er, seine Stimme hatte jegliche Wärme verloren. »Ihre Schreie hallten durch den gesamten Palast, genauso wie das Gelächter des Hofs. Sie schluchzte erbärmlich, doch sie hörte nicht auf, sich vor dem Hofstaat ihre Zehen abzuhacken. Einer nach dem anderen fiel zu Boden wie eine überreife Beere.«
Ich verkrampfte mich am ganzen Körper, während er endlich den Griff lockerte. Allerdings nicht so sehr, dass ich mich befreien konnte.
Ein Lächeln stahl sich auf seine vollen Lippen. »Als sie fertig war, rutschte sie auf den Knien vor die Contessa, die sich unter entzücktem Beifall die Schuhe abstreifen ließ. Die Hofdame quetschte ihre verstümmelten Füße in die viel zu kleinen, unnachgiebigen, kalten Schuhe und dann … dann lächelte sie. Trotz der Tränen und der Schmerzen lächelte sie, während die Schuhe sich mit ihrem Blut langsam rot füllten. Der Hofstaat applaudierte höflich, und die Göttin tanzte daraufhin den ganzen Abend mit nackten Füßen durch das Blut, das aus den Schuhen der Hofdame quoll. Sie tanzte bis zum Sonnenaufgang. Als das Fest endlich vorbei war, lag die Hofdame tot da, doch ihre Lippen waren noch immer zu einem Lächeln verzerrt.«
Er hielt inne, und es kam mir vor, als sähe ich in seinen Augen einen Widerhall des Grauens, der mir das Nackenhaar aufstellte.
»Man sollte meinen, diese ganze Sache sei abschreckend gewesen«, fuhr er fort, »doch es wiederholte sich mit jedem Fest, das die Schwester des Königs gab, bis schließlich eine junge Frau auftauchte. Ihr Name war Ella. Sie war das Mündel einer der Hofdamen und sehr hübsch, aber alle machten sich über sie lustig, denn sie hatte missgestaltete Füße. Als Kind waren ihre Zehen von einem durchgehenden Pferd gebrochen worden und danach nur schief und krumm wieder zusammengewachsen. Sie humpelte, wo auch immer sie hinging. Die damalige Hofdame stieß Ella nach vorn, und ich erinnere mich noch gut an die Angst in ihren Augen. Sie hatte allerdings Glück. Ihre Füße waren bereits verbogen, so musste sie sich nur jeweils den kleinen Zeh abschneiden, um in die Schuhe zu passen. Sie tanzte humpelnd durch die Nacht, während sich die gläsernen Schuhe mit ihrem Blut füllten. Als endlich die Sonne aufging, zitterte sie vor Schmerzen, doch sie war am Leben. Die Contessa musste ihr wie versprochen die gläsernen Schuhe schenken. Aber anstatt ihr Beifall zu zollen, verlor die Schwester des Königs augenblicklich das Interesse an den Schuhen, und so tat es auch der Hofstaat. Sie hatten einen Berg an verstorbenen jungen Frauen hinter sich gelassen, und das für nicht mehr als ihr Amüsement. Und das ist die wahre Geschichte von Cinderella.« Er blickte durch seine dunklen Wimpern zu mir auf und ließ endlich meinen Fuß los.
Erleichtert wackelte ich mit den Zehen und bemerkte, dass der Schmerz darin verschwunden war. Jede Wunde war verschwunden. Selbst die kleinen Narben, die ich mir als Kind und später beim Rasieren zugezogen hatte. Auf dem einen Bein genauso wie auf dem anderen. Ruckartig zog ich die Füße an. Mir war klar, dass ich diese Geste nicht als Akt der Fürsorge sehen durfte. Da war kein Mitleid in seinen Augen.
»Warum erzählst du mir das?«, fragte ich und er lächelte mich unschuldig an.
»So etwas nennt man Small Talk«, klärte er mich auf. »Und soweit ich weiß, ist der Nachfahre von Cinderella ein Freund von dir, ich wollte dir die Geschichte vorhin schon erzählen, aber du warst leider … unterwegs.« Seine Worte hingen zwischen uns wie eine Drohung.
Ich starrte ihn wütend an und wartete auf die Konsequenzen. Es würde welche geben. Doch statt ihm die Angst zu zeigen, die er sehen wollte, reckte ich das Kinn.
»Du erzählst diese Geschichte, als wärst du dabei gewesen.«
»Das war ich auch«, sagte er nur.
»Wenn die Legende stimmt, warst du nicht mehr als ein Stallbursche. Was hat ein Stallbursche auf einer königlichen Feier verloren?« Die Worte waren mir kaum aus dem Mund geschlüpft, als ich sie auch schon bereute. Ich biss mir auf die Zunge. Warum hatte ich das gesagt?
Black sah mich amüsiert an. »Stallbursche ist noch zu hoch gegriffen. Letztendlich war ich nicht mehr als ein Haustier. Ich habe immer die niedrigsten Arbeiten erledigt, für die selbst die Dienerschaft zu schade war. Bei den Festen der Könige war es meine Aufgabe, das Blut aufzuwischen und danach die Leichen an die Jagdhunde zu verfüttern. Darum war ich dort.«
Er stand auf, und obwohl er dadurch etwas Abstand schuf, konnte ich mich nicht entspannen. Ich rappelte mich auf und stellte mich schutzsuchend hinter die Chaiselongue.
Der Prinz seufzte, doch in seinen Augen blitzte etwas auf, das mich an den Blick einer Katze erinnerte. »Warum bist du immer so misstrauisch, Rain?«, fragte er sanft und trat wieder einen Schritt auf mich zu.
Ich wich zurück. Meine Knie zitterten. Doch zumindest schaffte ich es, meine Mimik unbewegt zu halten. Mein Puls hämmerte, während ich mich weigerte, den Blick abzuwenden. »Ist die Frage ernst gemeint?«, krächzte ich.
»Aber ja. Ich verstehe dich nicht, Rain. Ich habe dir alles gegeben, was man sich wünschen kann. Ich habe deine Wunden geheilt, du isst von goldenen Tellern die erlesensten Speisen. Du trägst Kleider aus Seide und schläfst in einem weichen Bett. Und dennoch weist du jedes meiner Geschenke zurück, obwohl ich nichts lieber tun würde, als deinen Hals mit Juwelen zu behängen. Ich lasse dir selbst deinen Cousin als Weggefährten, weil mir bewusst ist, wie einsam man sich fühlen kann. Ich habe alles getan, um deinen Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Doch weder wünschst du, Zeit mit mir zu verbringen, noch, dass wir miteinander sprechen. Ich fühle doch, wie sehr du dich nach mir sehnst, wieso siehst du mich dennoch an wie ein Monster? Was muss ich tun, damit du dich an meiner Seite wohlfühlst?«
Seine Stimme war wie dunkle Seide. Allein bei dem Klang zog sich mein Herz zusammen, und Scham überkam mich. Ja, wie konnte ich nur so unhöflich sein? So kalt, so abweisend? Ausgerechnet zu ihm, obwohl er nie etwas anderes getan hatte, als sich um mich zu kümmern und …
Ich schüttelte heftig den Kopf. Der Nebel darin verflog und hinterließ den bitteren Geschmack nach Asche in meinem Mund. Plötzlich fühlte sich der Raum noch kälter an als zuvor. Die Schatten um Black waren so dicht, dass er beinahe mit ihnen verschmolz.
»Du tust es schon wieder«, zischte ich ihn an.
Er hob nur eine Augenbraue. »Was meinst du?«
Ich wich weiter zurück. Er folgte mir, sodass wir uns umkreisten, wie zwei Raubtiere, die einander einzuschätzen versuchten. Nur die Chaiselongue trennte uns.
»Du webst schon wieder deine Geschichten. Du flüsterst mir süße Worte ins Ohr und verdrehst mir den Kopf. Ich habe in den letzten Wochen gesehen, was du tust, mein Prinz«, sagte ich verächtlich.
Seine Schritte hielten den Takt meines Herzschlags. »Was tue ich denn, meine Prinzessin?«, fragte er. »Warum habe ich das Gefühl, dass du mich unter allen Umständen als den Bösen in dieser Geschichte sehen willst? Lass mich dich vom Gegenteil überzeugen.«
Ruckartig spannte ich alle Muskeln an und sah ihn scharf an. »Genau das meine ich. Du spinnst deine Geschichten, du überzeugst, du schmeichelst, du verdrehst Gedanken und die Realitäten. Ich habe aus deinem Mund noch nie eine Lüge gehört, aber gleichzeitig auch noch keine einzige Wahrheit. Deine Stimme ist wie Gift, und sie verpestet uns alle.«
Blacks Mundwinkel verzogen sich erneut, doch diesmal nach unten. Er runzelte die Stirn. »Du verkennst mich, Rain. Hast du mich auch nur einem Menschen echten Schaden zufügen sehen?«
Ich stockte. Eine Antwort lag mir auf der Zunge. Ein Name, doch den konnte ich nicht aussprechen. Ich konnte nicht von Cole sprechen, denn im Prinzip hatte Black nur sein eigenes Spiegelbild in tausend kleine Splitter zerschlagen. Aber nein, er tat tatsächlich niemandem offensichtlich weh. Zumindest nicht körperlich.
»Du hast erst vor ein paar Tagen Avery in einen Vogel verwandelt«, knurrte ich ihn an.
Er grinste. »Eine kleine Strafe, aber ich habe ihm dabei nicht wehgetan.«
Seine Worte fühlten sich in meinem Kopf wie Spinnweben an, die an meinen Gedanken haften blieben. »Du musst niemandem körperlichen Schaden zufügen, um ihn zu verletzen, Black«, stellte ich klar und hasste den unsicheren Ton in meiner Stimme. »Das wissen wir beide. Und du vergisst, dass ich es gesehen habe.«
»Was hast du gesehen, Rain?«, fragte er milde. Auch er war nun stehen geblieben. Wieder auf der anderen Seite der Chaiselongue. Der Schein des Feuers beleuchtete seinen Rücken und verlieh ihm eine blau schimmernde Corona.
»Ich habe gesehen, welchen Schaden deine Vasallen angerichtet haben«, zischte ich, und das Bild von Blut blitzte auf. Blut und Schreie, Körperteile, Schmerz … so viel Schmerz. »Das Gemetzel der Wölfe in Woodley. Ich habe das Grauen erlebt, das der Rattenfänger verursacht hat. Du musst niemanden verletzen, denn du hast Monster, die das für dich erledigen. Du setzt die Welt in Brand, ohne auch nur einen Finger rühren zu müssen. Du stehst da und siehst dabei zu, wie die Welt zu Asche zerfällt, und danach musst du nicht mehr tun, als den Leuten mit einem Lächeln und deinen Worten den Kopf zu verdrehen. Sie sehnen sich doch bereits nach einer heilen Welt, danach zu vergessen, in einem Märchen zu leben. Am Ende fängt man mit Honig mehr Fliegen als mit Essig, und das vergesse ich nicht.« Das Letzte stieß ich zwischen den Zähnen hervor.
Black musterte mich. Seine Pupillen waren geweitet. Selbst jetzt wollte ich die Hand ausstrecken, mit den Fingern in sein dunkles Haar fassen und seine Haut an meiner fühlen. Seinen Herzschlag spüren, der nur wegen mir schlug. Es tat körperlich weh, mich von ihm fernzuhalten, und das war nicht gesund. Das war nicht natürlich. Was auch immer es war, es jagte mir so viel Angst ein, dass ich es schaffte, dem Drang nicht nachzugeben und den Prinzen kühl anzufunkeln, obwohl mein Herz brannte.
»Was willst du von mir?«, fragte Black leise.
»Ich will, dass du mich gehen lässt«, flüsterte ich.
Er neigte den Kopf, sodass eine Haarsträhne über seine Stirn fiel. Ein Ausdruck, den ich beinahe als Schmerz bezeichnen würde, huschte durch seine Züge. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er schlichtweg nicht in der Lage war, etwas zu fühlen.
»Hasst du mich so sehr, Rain?«, fragte er und kam auf mich zu.
Auch wenn ich mutig sein wollte, wich ich abermals zurück. »Du bist ein Monster, Black.«
»Aber du kennst mich, Rain. Du hast mich geliebt. Viele Jahre lang. Ich bin Buh. Dein Buh. Ich bin Cole. Alles, was du an ihm geliebt hast, ist auch in mir. Nichts daran hat sich geändert.«
Lügen. So viele Lügen.
Seine Worte füllten trotzdem meinen Kopf und ließen alles hell und leicht wirken. Tränen stiegen mir in die Augen. Buh. Cole. Black. Waren sie doch ein und dieselbe Person?
»Du bist nicht Cole«, presste ich hervor und schreckte zusammen, als ich gegen den Schreibtisch stieß. Ein Stift rollte darüber hinweg und fiel klackernd auf den Teppichboden.
Black blieb vor mir stehen und schloss mich ein, die Arme links und rechts von mir an der Tischkante abgestützt, während ich mich so weit wie möglich zurücklehnte, um Abstand zwischen uns zu bringen. Seine Wimpern malten zuckende Schatten auf seine hellen Wangenknochen.
»Ich bin Cole. Ich bin Buh«, wiederholte er bestimmt. »Ich habe dich begleitet, seit du ein Kind warst. Ich habe mit dir deine Sorgen und Nöte geteilt. Du warst und bist schon immer mein Leben, Rain. Ich habe geduldig gewartet, bis du endlich so weit warst, zu mir zu kommen. Ich habe dich schon immer geliebt, und ich weiß, du liebst mich auch. Zumindest einen Teil von mir.« Das Letzte sagte er zum ersten Mal mit echter Verbitterung in der Stimme.
Einen Teil von ihm. Cole. Ich glaubte manchmal, ihn zu hören. Seine Stimme, die nach mir rief. Doch im ganzen Carneval gab es keinen einzigen Spiegel. Keine Möglichkeit, ihn wiederzusehen. Black sorgte dafür.
»Du bist nicht mein Freund«, stieß ich hervor und klammerte mich an der Kante fest, während er so nahe kam, dass sich unsere Nasenspitzen beinahe berührten. Die Verbitterung tropfte aus jedem meiner Worte. »Du hast ein verwundbares einsames Kind ausgenutzt, du hast mich beobachtet wie ein Stalker, jeden meiner Schritte kontrolliert, du hast mich studiert wie ein Insekt, um herauszufinden, wie du mich am besten kontrollieren kannst. Du hast mich belogen, hintergangen, meine Gefühle ausgenutzt und sie anschließend gegen mich selbst ausgespielt. Du weißt genau, was du tust, Coalblack.« Ich sprach ihn mit seinem vollen Namen an. Ich senkte meine Stimme zu einem Flüstern. »Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um von hier wegzukommen. Um das aufzuhalten, was du hier tust.«
Er neigte den Kopf und flüsterte mit rauer Stimme zurück: »Ein und dieselbe Geschichte, zwei Seiten. Was, Rain, wenn ich dir deinen Wunsch erfülle und dich laufen lasse? Was willst du tun? Deine Freunde finden? Die Vasallen aufspüren? Sie umbringen und ihre Artefakte sammeln, um anschließend mich zu töten? Ist es das, was du willst? Mich töten?«
Ich schob das Kinn vor. »Wenn. Es. Nötig. Ist«, stieß ich hervor.
Seine Mundwinkel hoben sich, als er den Abstand zwischen uns verringerte und sich an mich presste. Mehr brauchte es nicht. In der nächsten Sekunde lag etwas Kaltes in meiner Hand. Lang und schwer. Ein Brieföffner. Er war geformt wie ein kleines Messer und sehr viel schärfer, als man vermuten mochte.
Ich zielte auf die Kuhle unter seinem Brustbein. Die Schneide glitt durch die Klamotten wie Butter. Er hob die Hand, umschloss damit die meine und verstärkte den Druck aufs Messer. Ich riss den Kopf hoch.
»Warum hast du das nicht gleich gesagt?«, murmelte er, und die Schwärze zog sich um mich herum zusammen. »Wenn es dich glücklich macht, mir ein Messer in die Brust zu rammen, dann tu es. Tu es, so oft du möchtest. Ich will nur, dass du glücklich bist, Rain. Und an meiner Seite.«
»Soll das ein Witz sein?«, stieß ich hervor und versuchte, die Hand zurückzuziehen, doch er verstärkte seinen Griff und drückte den Brieföffner tiefer in seine Brust. Ein schimmernder roter Tropfen rollte über die Klinge. Der Anblick hatte etwas Verstörendes an sich. Vielleicht weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass sein Blut tatsächlich rot war. Es machte ihn menschlich, aber das Letzte, was ich wollte, war, dem Prinzen auch nur einen Funken Menschlichkeit zuzusprechen.
Ich blinzelte heftig und biss die Zähne zusammen. Nahm ihn ins Visier, und anstatt die Klinge weiter wegzuziehen, trieb ich sie ein Stück tiefer. Er zuckte mit keiner Wimper. »Glaubst du, ich traue mich nicht?«
»Ich hoffe, dass du dich traust«, gab er zurück.
»Ich hasse dich«, spie ich aus, und seine Mundwinkel hoben sich abermals.
»Langsam fange ich an zu mögen, wie innig deine Abscheu ist.«
Ich sah ihn in seinen Augen. Den Schalk. Er spielte mit mir. Auch das hier war für ihn nicht mehr als ein Spiel. Die Spinnweben in meinem Kopf waren bereits so dicht, dass ich keinen Ausweg mehr fand. Ich fletschte die Zähne und stieß zu. Mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, trieb ich die Klinge in sein Fleisch und hörte ein Schmatzen, als sie einsank. Ich roch Kupfer, als Blut zu rinnen begann. Erst langsam über den Rand der Klinge, dann direkt auf meine Hand. Ich rammte das Messer so fest hinein, dass ich gegen etwas Hartes stieß. Einen Knochen? Muskeln?
Der Prinz erstarrte. Beinahe verblüfft sah er an sich hinab. Der Schaft steckte jetzt bis zum Anschlag in ihm, und ich konnte es fühlen, das Zittern seines Herzschlags. »Rain …« Überraschung schwang in seiner Stimme mit, und ein Husten entkam ihm. Blut benetzte seine Lippen und spritzte auf mein Unterkleid.
»Danke für das Angebot, ich nehme es gern an«, knurrte ich und stieß ihn von mir.
Der Prinz taumelte, starrte wieder auf seine Brust, als könne er es nicht fassen. Er krümmte sich und hustete noch mehr Blut auf den Boden. Seine Wimpern flatterten, und in der nächsten Sekunde brach er zusammen. Die Augen hatte er weit aufgerissen, die Pupillen waren stecknadelkopfklein. Er rang nach Luft und streckte die Hand nach mir aus. »Rain …«, gurgelte er.
![Kiss me twice [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a0fe1b9f1c7d56660f1a6ac471e68968/w200_u90.jpg)
![Kiss me once [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/58f14f2f022cec4e8263fb50dc264ae2/w200_u90.jpg)
![Night of Crowns. Spiel um dein Schicksal [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f3ef0064b2dcb6a110ec6f7cc33ca401/w200_u90.jpg)
![Kiss Me Now [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2814e535c98fcfda1cfdcb79ccfd3a8/w200_u90.jpg)

![Night of Crowns. Kämpf um dein Herz [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f13c50da50588357fe7b60b5de49bf54/w200_u90.jpg)
![Ever & After. Der schlafende Prinz [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1a15fb283a4db3ffe16e7b163009952b/w200_u90.jpg)
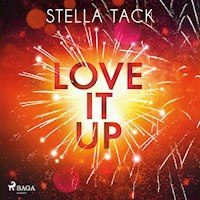


![Ever & After. Die dunkle Hochzeit [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8868ef4c8bf07024c89e72b8d2c844ea/w200_u90.jpg)