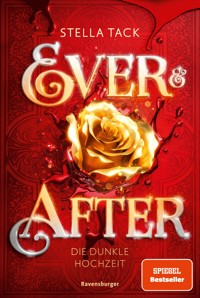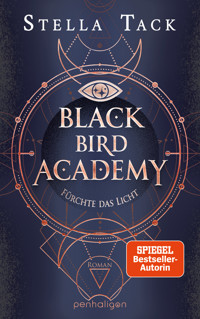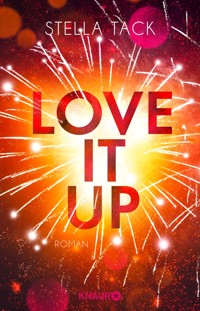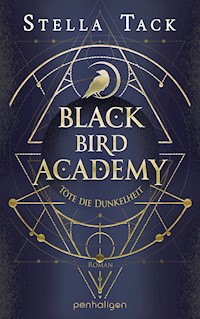
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penhaligon Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Akademie der Exorzisten
- Sprache: Deutsch
Willkommen an der Black Bird Academy! Der TikTok-Trend Dark Academia trifft auf fesselnde Fantasy-Romance!
Die Black Bird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Black Bird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt: Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat! Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle über den eigenen Körper behalten, ohne dabei seinen Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot: Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt: Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich …
Gefährliche Dämonen, heiße Exorzisten und eine schicksalshafte Liebe – die »Black Bird Academy«-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Stella Tack:
Band 1: Black Bird Academy – Töte die Dunkelheit
Band 2: Black Bird Academy – Fürchte das Licht
Band 3: Black Bird Academy – Liebe den Tod
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Buch
Die Black Bird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. An dieser dunklen Schule werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor den Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Black Bird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt: Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat! Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle über den eigenen Körper behalten, ohne dabei seinen Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot: Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt: Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme. Und diese ist nicht menschlich …
Autorin
Stella Tack, 1995 in Münster geboren, wuchs im österreichischen Bad Gastein auf. Nach ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine therapeutische Ausbildung, merkte aber bald, dass ihre wahre Leidenschaft im Schreiben von Geschichten lag. Mit ihren knisternden New-Adult-Romanen und ihren actiongeladenen Romantasy-Stoffen erobert sie mittlerweile die Herzen Tausender Leser:innen und die Spitzenplätze der SPIEGEL-Bestsellerliste. Nach zahlreichen Jugendbüchern wagt Stella Tack mit der »Black Bird Academy«-Reihe den Vorstoß in die fantastische Literatur für Erwachsene. Die Autorin lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Österreich.
Weitere Informationen unter: www.stella-tack.com; www.instagram.com/stellatack/; www.tiktok.com/@stella.tack
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Stella Tack
BLACK BIRD ACADEMY
TÖTE DIE DUNKELHEIT
Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 2023 by Penhaligonin der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © 2023 by Stella Tack
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München (www.erzaehlperspektive.de)
Redaktion: Ulrike Gerstner
Covergestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft, unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com (NadezhdaShu; seno raharjo)
Karte und Wappen: © Thilo Corzilius
Abbildung Buch: Duda Vasilii / Shutterstock.com
DK · Herstellung: mar
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-29878-4V006
www.penhaligon-verlag.de
Für meinen Ehemann Leander, der dieses Buch niemals lesen wird, weil er auf die Verfilmung wartet.
Lieb dich, du Dödel <3
1. Lektion
Magie ist eine große verborgene Weisheit –Verstand ist eine große offene Torheit.
Paracelsus
Prolog
Wenn Henry ein Feigling gewesen wäre, wäre er jetzt umgekehrt, zurück in seine Wohnung am Central Park gegangen, in die Badewanne gestiegen und hätte seinen Rausch ausgeschlafen. Am nächsten Morgen wäre er in frischen Schuhen, einem Nadelstreifenanzug und mit der Krawatte, die ihm seine Mutter zu Weihnachten geschenkt hatte, weil sie zu seinen blauen Augen passte, wieder zur Arbeit erschienen. Er wäre in den achtzehnten Stock gefahren, hätte sich hinter seinen Schreibtisch gesetzt und sich von der blonden Sekretärin seines Vaters, die er einmal im Kopierraum gevögelt hatte, einen Kaffee bringen lassen. Wenn er ein Feigling gewesen wäre, hätte er über die schlechten Witze seiner Kollegen gelacht und so getan, als wäre alles in Ordnung. Bis die Polizei aufgetaucht wäre, um ihn zu verhaften. Denn genau das würde morgen passieren.
Aber Henry war kein Feigling. Zumindest fühlte er sich sehr entschlossen, als er die Flasche Fusel an die Lippen hob und sie hinunterkippte. Es brannte, als ihm die Flüssigkeit durch die Kehle rann. Dabei blickte er nach oben. Stockwerk für Stockwerk. Das Chrysler Building ragte vor ihm auf wie ein Ungetüm aus Stahl und Glas. Ein Monster, das ihm seit einem Jahr jeden Tag den Lebenswillen aus den Knochen saugte. Selbst zu dieser späten Uhrzeit brannte noch Licht hinter den meisten Fenstern.
Der Geruch nach Hotdogs stieg ihm in die Nase, dazu der für New York typische Gestank nach Urin, Schweiß und Abgasen.
Ich sollte springen, bevor die Welt mich stoßen kann.
Die Worte fühlten sich wie ein Flüstern an. Ein Raunen in seinem Hinterkopf. Oder auch nur ein Gedanke. Das Echo eines Gedankens. Freudlos hob er die Flasche erneut an die Lippen und schüttete den nächsten Schluck in sich hinein. Seine Fingerspitzen wurden taub, genauso wie alles andere in ihm.
Er taumelte und trat in eine dreckige Pfütze, die nach Abwasser stank. 1 500 Dollar italienischen Leders waren mit einem Schritt ruiniert. Ein belustigtes Schnauben entwich ihm, während er gleichzeitig gegen die Tränen ankämpfte, die er seit fünfzehn Jahren nicht geweint hatte. Er blinzelte und sah sich selbst im Brackwasser. Blass. Das Haar zerzaust, die Augen stumpf, die Krawatte schief. Man konnte noch erkennen, dass er einmal gut ausgesehen hatte. Aber jetzt? Jetzt sah er aus wie ein Bild, das jemand zerknittert hatte. Henry verzog den Mund und hob die Flasche erneut an, als ihn plötzlich etwas hart im Rücken erwischte. Der Stoß kam so unerwartet, dass er vorwärts stolperte. Brackwasser spritzte nach oben. Die Flasche fiel ihm aus der Hand und zersplitterte mit einem lauten Klirren auf dem Gehsteig.
Was zum …?
Wut stieg in ihm hoch. Heiß und rot pulsierte sie in seinen Adern, gleichzeitig fühlten sich seine Gedanken schwammig an von all dem Alkohol. Scherben knirschten, als er sich schwankend umdrehte und blaffte: »Kannst du nicht aufpassen?«
»Du bist derjenige, der im Weg steht, du Pisser!«
Die scharfe Erwiderung blieb ihm in der Kehle stecken, als er in das kindliche Gesicht blickte, das ihn von der Straße herauf ansah. Die schmalen Züge, umrandet von dunklen Locken, verzogen sich vor Wut, als sich der Junge aufrappelte und dabei gehetzt über die Schulter spähte. Henry folgte seinem Blick, doch die Straße war für Manhattans Verhältnisse fast schon ruhig. Beinahe ausgestorben. Nur eine Straßenlaterne und eine Neonreklametafel mit einem tanzenden Hotdog sorgten für genügend Licht und ließen die Pfützen auf der Straße glänzen. Der Himmel grollte leise, als machte er sich bereit, noch mehr Wasser auf die Straßen hinunterzulassen.
Der Blick des Jungen zuckte über die Straße, während er einen Schritt von Henry weghumpelte. Und noch einen. Und noch einen.
»Hey, nicht so schnell«, knurrte Henry, der den Kleinen an der Schulter packte, damit er nicht einfach türmen konnte. »Was machst du so spät noch hier draußen? Wo sind deine Eltern?«
Der Junge musterte ihn spöttisch, als hätte er die dümmste Frage aller Zeiten gestellt, ehe er auf Henrys Finger auf seiner knochigen Schulter starrte. »Pfoten weg.«
»Solltest du nicht zu Hause sein?«, bohrte Henry nach.
Der Kleine verzog den Mund: »Sollte ich das?«
»Ja, das solltest du. Wie alt bist du? Zwölf?«
Der Junge seufzte und kniff sich in die Nasenwurzel. »Ich bin zu alt für diesen Scheiß.«
»Was?«, fragte Henry zunehmend verwirrt, ehe er einen erschrockenen Schrei ausstieß, als der Junge seinen Arm ausstreckte und seine kleine schmutzige Hand gegen seinen Mund presste.
»Halt die Klappe«, fuhr er ihn an und ließ den Kopf so ruckartig herumschnellen, dass die dunklen Locken um sein schmales Gesicht schnalzten. Seine Nasenflügel blähten sich, als er tief Luft holte. Die Geste hatte beinahe etwas Animalisches an sich. Sein Blick war starr auf die Gasse hinter ihnen gerichtet.
Henry erstarrte und nuschelte unter der Hand:
»Was ist los mit dir? Steckst du in Schwierigkeiten?«
»So kann man es auch nennen. Sie haben uns gefunden«, knurrte der Junge zurück und nahm seine Hand von Henrys Mund.
Henry folgte seinem Blick und sah, wie sich etwas aus dem Schatten löste. Zuerst wirkte es wie ein Spaziergänger, der seinen Hund ausführte. Es war nicht viel mehr als der Umriss eines Hutes und eines Trenchcoats zu sehen, der im Wind nach hinten flatterte. Eigentlich gab es keinen spezifischen Grund dafür, doch Henry schauderte. Die Härchen in seinem Nacken stellten sich auf, und als er die Luft ausstieß, tanzte sein Atem in kleinen Wölkchen vor seinem Gesicht.
Das Licht der Neonreklame zuckte über den Trenchcoatkerl. Henry konnte sehen, dass er in aller Seelenruhe unter einer Straßenlaterne stehen blieb, so als hätte er alle Zeit der Welt. Es klickte, als der Fremde sich eine Zigarette anzündete, und ein kleiner heller Fleck leuchtete auf, ehe er tief einatmete. Dann begann er zu sprechen, während der Rauch aus seinem Mund quoll.
»Hier steckst du also, Lore. Wir haben überall nach dir gesucht«, sagte der Mann mit rauer Stimme. »Hör jetzt auf, uns Scherereien zu machen, und komm einfach mit. Du hast lange genug Katz und Maus mit uns gespielt.«
Der Junge neben ihm wurde blass und wich zurück.
»Kennst du den Mann? Ist das dein Dad?«, erkundigte sich Henry.
»Scheiße«, stieß der Junge hervor, riss sich von Henry los und begann zu rennen.
Henry stolperte überrascht. »Hey! Hey, warte! Wo willst du hin?«, rief er dem Kleinen nach.
Der Junge antwortete nicht, doch der Trenchcoatkerl schnippte mit den Fingern. Das Geräusch hallte ungewöhnlich laut durch die Straßen, und im nächsten Augenblick tönte ein tiefes Knurren durch die Gasse, das Henrys Nackenhaare noch weiter aufstellte. Der Hund ähnelte mit dem schlanken schwarzen Körper, der langen Schnauze und den spitzen Ohren einem Dobermann, doch etwas an ihm schien nicht ganz richtig zu sein. Er sprang in einem einzigen gigantischen Satz nach vorn und schnitt dem Jungen den Weg ab. Ein tiefes Knurren drang aus der Kehle des Tiers, das Henry erschrocken zwei Schritte zurücktaumeln ließ.
»Was zum Teufel …«, konnte er gerade noch hervorstoßen, als der Junge herumwirbelte, seine kleinen Fäuste ballte und den fremden Mann anbrüllte.
»Wie kannst du es wagen? Pfeif dein räudiges Vieh zurück, Alvy, oder du wirst es noch bereuen.«
Die Zigarettenspitze glomm erneut auf, und als der Mann – Alvy? – lachte, waberte wieder Rauch vor seinem Gesicht. »Hör auf, dich zu verstecken, Lore. Langsam wird es peinlich, findest du nicht? Ich jage dich jetzt seit Wochen, und deine Schlupfwinkel werden immer verzweifelter.«
Der Junge spuckte aus. »Verpiss dich, Alvy, oder …«
»… oder was? Du bist nicht länger in der Position, Forderungen zu stellen. Lauf nur weiter weg. Das ganze Syndikat sucht dich. Wir finden dich, egal wohin du dich verkriechst.«
Der Hund knurrte erneut, und Henry kam es so vor, als würde das Vieh wachsen. Er senkte den Kopf und krümmte den Rücken, sodass dieser zu einem großen Buckel anwuchs. Instinktiv stellte er sich vor den Jungen und fixierte Alvy.
»Sind Sie der Vater des Jungen? Wenn nicht, verschwinden Sie zusammen mit Ihrem Köter, sonst rufe ich die Polizei.«
Langsam atmete der Kerl aus. Als er seine Zigarette fortschnippte, flogen Funken von seinen Fingern und verglühten in der Luft. »Verschwinde, Mensch. Das hier geht dich nichts an.«
Henry schwankte und verfluchte den Alkohol, den er in sich hineingekippt hatte. »Ich rufe die Polizei!«, erwiderte er daraufhin lauter, obwohl ihm vor Angst ein Rinnsal aus Schweiß den Rücken hinablief. Sein Atem schwebte in hektischen Wolken vor seinem Gesicht, als wäre die Temperatur in den letzten paar Minuten um mehrere Grad gefallen. »Ich werde …«, setzte er an und zückte sein Handy.
Alvy schnippte, und der Hund grollte. Es knackte. Ein Geräusch, als würden Knochen brechen, während der Hund tatsächlich wuchs und etwas aus dem Buckel hervorbrach. Henry schrie auf, stolperte zurück und drängte sich vor den Jungen.
Der packte ihn am Arm und zischte ihm zu: »Lauf, sonst …«
Doch der Hund war schneller. Noch ehe der Junge seinen Satz beenden konnte, war das Tier mit gefletschten Zähnen nach vorn geprescht. Geifernd schlug es die Fänge mit ungebremster Wucht in Henrys Wade. Für einen kurzen Augenblick war Henry so schockiert, dass er nur auf die Zähne starren konnte, die sich in seinem Fleisch vergraben hatten. Der Hund knurrte, Knochen knirschten, und dann kam der Schmerz. Ein gleißender Lichtblitz, der Henrys gesamten Körper durchzuckte. Es fühlte sich an, als würde man ihm das Bein abreißen. Henrys Knie knickten ein, und er schrie so laut vor Schmerz wie wahrscheinlich noch nie zuvor in seinem Leben. Voller Entsetzen starrte er auf das Monstrum vor sich. Doch seine Augen schienen ihm einen Streich zu spielen, denn das Tier wurde größer und größer. Es schwoll förmlich an, bis es zu einem wahren Ungetüm mutierte. Zwar hatte es noch Fell, aber das Tier wirkte zum Teil menschlich. Ein kräftiger Oberkörper ging in zwei behaarte Arme über, die beinahe denen eines Affen ähnelten. Das Gesicht war grob, als hätte man es aus Stein geschlagen, mit einer eingedrückten Hundeschnauze samt feuchter Nase und schwarzen Augen, die ihn seelenlos anstarrten, während Hörner aus dem verformten Schädel sprossen. Ein intensiver Gestank nach nassem Fell und fauligem Atem schlug Henry entgegen.
Ein Schluchzen entrang sich seiner Brust, als das Ungetüm seinen Kopf ruckartig zurückriss. Wie eine Puppe wurde Henry gegen die nächste Hauswand geschleudert. Das Knirschen in seinem Kopf verhieß nichts Gutes, sein Blick verschwamm, und ein Schrei blieb in seiner Kehle stecken. Henry sackte in sich zusammen. Das Ungetüm knurrte ihn an, während Geifer und rotes Blut von seinen Lefzen auf die Straße tropften. Henry keuchte und versuchte nach hinten zu krabbeln, doch er hatte bereits die Wand im Rücken. Das Tier fixierte ihn mit bösen und erschreckend intelligenten Augen. Es riss sein Maul zu einem gewaltigen Brüllen auf und schoss nach vorn.
Henry hob schützend die Arme vor das Gesicht, während ihm das Wasser einer Pfütze den Anzug durchnässte. Von Grauen erfüllt, kniff er die Augen zu … doch anstatt Zähne zu spüren, die sich in sein weiches Fleisch bohrten, hörte er das Ungeheuer plötzlich ohrenbetäubend laut aufjaulen. Keuchend riss Henry die Augen wieder auf und sah den kleinen Jungen vor dem Monstrum stehen. Eine Glasscherbe ragte aus dem Auge des Hundes hervor. Sein Blut spritzte dabei in das Kindergesicht.
»Scheiße noch mal, nein!«, brüllte Alvy über das Jaulen hinweg.
Mit einem verächtlichen Schnauben zog der Junge die Scherbe aus dem Auge des Hundes, drehte sich um, griff Henrys Hand und zerrte ihn auf die Füße. »Lauf!«, brüllte er ihn an.
Henry war so perplex, dass er sich tatsächlich in Bewegung setzte, obwohl er sich fühlte, als wäre er in Abertausende kleiner Einzelteile zersprungen. Finger zogen Henry weiter, hinter ihnen konnte er das Grollen des Biests und einen scharfen Befehl des Besitzers hören.
Henry rannte. Er rannte um sein Leben, während er zu verstehen versuchte, was da gerade geschehen war. Das konnte alles nicht real sein. Er hatte sich zu sehr betrunken. Er war doch ein Feigling. Darum war er nach Hause gefahren. In Wirklichkeit lag er in seiner Badewanne und schlief seinen Rausch aus. Am Morgen würde er die verquollenen Augen aufschlagen, seinen Anzug wechseln und zur Arbeit fahren. Er würde sich einen Kaffee bringen lassen, über die Scherze seiner Kollegen lachen und danach wegen Steuerhinterziehung verhaftet werden.
Henry war doch ein Feigling. Denn er wollte nicht sterben. Das hier war nicht real, nicht real, nicht real …
»Da lang!« Der Junge zerrte ihn in eine weitere Gasse und schleuderte dabei alles hinter sich in den Weg, was er finden konnte. Kartons knallten auf die Straße, laut scheppernd verteilte sich ihr Inhalt, während der Junge Henry packte und ihn zu einer Mülltonne bugsierte. »Rein da!«, zischte er.
»Wa…«, setzte Henry an, doch da war der Junge bereits mit einem Hechtsprung in den Müll geschnellt.
Henry hörte das Ungetüm hinter sich aufheulen und reagierte einfach. Seine Instinkte übernahmen, und er kletterte in die große Mülltonne. In der nächsten Sekunde knallte der Junge den Deckel zu, und es wurde stockdunkel um sie herum. Henry konnte nur seinen eigenen Atem hören, der viel zu laut in den Ohren dröhnte.
Ein und aus.
Ein und aus.
Ein und aus.
Er schluckte und schmeckte Blut auf der Zunge.
»Das ist nicht real, nicht real …«, flüsterte er sich selbst zu und drücke sich dabei tiefer in den Müll.
»Pssst«, zischte der Junge ihm scharf zu, und Henry hielt die Luft an.
Über das Pochen seines Herzschlags hörte er es. Das Scharren von Krallen. Krallen, die sehr nahe waren. Ein Knurren folgte dem Scharren, und Henry verschluckte sein eigenes Wimmern, indem er sich auf die Zunge biss.
Das hier war nicht real, nicht real …
Das Kratzen der Krallen war jetzt genau über ihnen. Henry erstarrte, als der Deckel zurückgeschoben wurde und eine schnüffelnde Schnauze folgte. Zähne wurden gebleckt. Henry sah, wie sich die Schultern des Jungen anspannten, als ein lauter Pfiff das Knurren unterbrach. Die Schnauze zuckte zurück.
»Hör auf, im Müll zu wühlen, du dummes Vieh! Such weiter!«
Das Untier grollte. Henry sah das Fletschen der Zähne und fühlte, wie etwas Nasses, Schleimiges auf seine Wange tropfte. Ein Wimmern wollte aus seinem Mund schlüpfen, doch der Junge schnellte blitzschnell zu ihm herum und hielt ihm den Mund zu. Seine kleine Hand roch nach vergammelter Banane.
»Los jetzt. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit«, bellte Alvy.
Es klatschte. Das Vieh jaulte auf, als hätte es einen Schlag oder Tritt abbekommen. Dann fauchte es. Die gesamte Tonne wurde durchgerüttelt, als sich das Tier abstieß und weiterhastete.
Henry sog verzweifelt Luft in seine Lunge. Dann war da nur noch Stille. Dennoch blieb die Hand auf seinem Mund. Keiner bewegte sich, außer den Kakerlaken in der Mülltonne.
»Ich bekomme keine Luft mehr«, stöhnte Henry schließlich leise.
»Still«, zischte der Junge ihn an. »Der Bosam ist zwar fast blind, aber er hört alles, und sobald wir aus diesem stinkenden Loch kriechen, kann er uns auch wieder riechen.«
Der Bosam?
Meinte er damit das Vieh? Was für eine abgefuckte Züchtung war das denn? Henry zuckte zusammen, als der Junge ruckartig die Hand von seinem Mund nahm und misstrauisch über den Tonnenrand blickte.
»Sind sie noch da?«, flüsterte Henry.
Der Junge hob die Hand und würgte ihn ab. Wieder lauschten sie nur, ehe der Junge schließlich aufseufzte und über seine schmalen Schultern zu Henry blickte. »Sie sind weg. Komm. Wir müssen uns beeilen.«
Leise packte er den Rand der Tonne und sprang geschickt darüber hinweg. Henry folgte ihm weit weniger elegant. Als er auf der Straße aufkam, knickte sein angebissenes Bein unter ihm ein. Er schrie unterdrückt auf, biss die Zähne zusammen und lehnte sich keuchend gegen die feuchte Hauswand.
»Was … was war das für ein Vieh?«, keuchte er.
Blonde Haarsträhnen hingen ihm ins Gesicht. Der Junge stand vor ihm. Blass und schmal, wie ein Geist. Die Dunkelheit drückte sich um ihn herum, als würde er damit verschmelzen.
»Das war kein Hund.«
»Sondern?«
Henry bekam keine Antwort. Er schwankte und blinzelte auf seinen zitternden Fuß hinab. Blutete er sehr stark? Es fühlte sich so seltsam nass an.
»Wir müssen die Polizei und einen Krankenwagen rufen. Ich muss in ein Krankenhaus«, nuschelte er.
Die Worte fühlten sich seltsam auf seiner Zunge an. Er fummelte sein Handy heraus. Sein Daumen presste sich auf das Display. Tropfen landeten darauf. Es hatte wieder zu regnen begonnen. Das leise Platschen der Tropfen drang erst jetzt zu ihm durch, während er zitternd den Code eingab. Im selben Augenblick griffen schmutzige kleine Finger danach und rissen es ihm aus der Hand.
»Was soll das? Wir müssen die Polizei rufen!«, jammerte Henry.
»Dafür haben wir keine Zeit.«
»Bist du völlig übergeschnappt? Gib mir das scheiß Handy zurück. Wir müssen von hier abhauen!«, keuchte Henry aufgeregt. Seine Stimme überschlug sich dabei.
Der Junge sah ihn ernst an. Er blinzelte, und da war es wieder. Dunkelheit sammelte sich in seinen Iriden, wurde immer dichter und füllte schließlich seinen ganzen Augapfel. Schwarz wie zwei feuchte Murmeln blickten die Augen in den Himmel. Kein Leben spiegelte sich darin. Als würde das Licht selbst darin verschluckt.
Das war nicht der Blick eines Kindes. Das waren nicht einmal die Augen eines normalen Menschen. Es erinnerte Henry an den Blick des Monsterhundes. Böse und gleichzeitig schauderhaft intelligent.
Henry wich zurück, wobei er jedoch nur mit dem Rücken gegen die Wand stieß. »Wer oder was bist du?«, brachte er hervor.
Der Junge trat nach vorn. Regen tropfte aus seinen dunklen Locken. »Ich bin Lore. Es tut mir ehrlich leid, dass du in die ganze Sache reingestolpert bist, aber wir haben keine Zeit. Alvy wird nach mir suchen, und ich muss mir deinen Körper ausleihen.«
»Du musst wa…?«
Henry hatte keine Zeit, seinen Satz zu Ende zu bringen, denn etwas durchschlug seinen Brustkorb. Mit solcher Wucht, dass sein Brustbein brach. Er war so verblüfft, dass er nur an sich hinabblicken konnte – auf die Scherbe in seiner Brust und auf die kleine Hand, die sie umklammert hielt.
Der Junge stand mit unheimlich schwarzen Augen vor ihm und blickte zu ihm hoch. »Sorry, das könnte jetzt etwas piksen.«
Henry öffnete den Mund und rutschte an der Wand hinab. Blut sickerte aus seinem Mundwinkel.
»Bemüh dich nicht. Ich hab’s gleich«, versprach der Junge und richtete sich auf.
Henry holte rasselnd Luft. Für einen kurzen Augenblick sah er nur seinen eigenen Atem vor sich schweben. Im nächsten Moment hörte er ein grauenhaftes Knacken. Henry blinzelte. Der Junge hatte den Kopf so weit nach hinten gerissen, dass es ihm eigentlich das Genick brechen musste. Sein kleiner Mund war wie zu einem stummen Schrei aufgerissen, und daraus quoll dunkler Rauch hervor.
Henry riss die Augen auf und wollte schreien. Doch es kam kein Laut aus seinem Mund. Er konnte nicht mehr tun, als keuchend am Boden zu liegen und zuzusehen, wie schwarze Schlieren aus dem Jungen krochen. Der stieß ein Röcheln aus und begann zu zittern, als würde er von Krämpfen geschüttelt werden. Die Augen rollten in den Höhlen, während immer mehr Rauch aus seinem Mund drang. Dunkle Schwaden, in deren Innerem etwas pulsierte, das vage an den Rhythmus eines Herzschlags erinnerte. Der Dunst waberte zu Boden und kroch wie Schlangen auf Henry zu.
Der ächzte vor Panik, während sich ein Schleier aus Tränen über sein Blickfeld legte. Ein Traum. Das war nicht real, nur ein Traum, ein Traum, ein Traum. Es war nicht möglich. Was auch immer es war, so etwas gab es nicht. Das hier war unnatürlich. Übernatürlich. Er wollte aufwachen, aufwachen, aufwachen!
Aber warum fühlte es sich so real an, als der schwarze Rauch sein Gesicht erreichte? Stöhnend drehte er den Kopf weg, versuchte die Luft anzuhalten, während sich der schwarze Rauch unbeirrt über sein Gesicht tastete und sich zwischen seine zusammengepressten Lippen schlängelte. Der Geschmack nach verbrannter Asche, kaltem Stein und etwas Uraltem flutete seine Sinne. Druck baute sich in seinen Ohren auf. Henry brüllte. Er brüllte mit solcher Inbrunst, dass sich tatsächlich ein Ton seiner Brust entrang. Der Schrei klang verzweifelt, gebrochen und roh. Nichts, was man aus dem Mund eines Menschen vermuten würde. Und während sein Blickfeld von Dunkelheit überflutet wurde, spürte Henry … etwas. Etwas, das nicht er selbst war. Fremd und andersartig. Nicht menschlich. Etwas, das sich in ihm einnistete und seine Adern füllte, bis sie zu platzen drohten. Schwarz und dick wölbten sie sich aus der Haut hervor.
Henry klammerte sich fest, obwohl er nicht einmal wusste, woran. Am letzten Funken seiner Existenz? Leise wie durch das Rauschen von Wellen hörte er schließlich eine fremde Stimme in seinem Kopf. »Tschüss, Henry.«
Er fühlte einen Stoß. Verlor den Halt und fiel. Nur diesmal nicht in einen Abgrund. Es war nicht wie einschlafen, sondern ein Atemzug, und Henry war weg. Der Junge brach zusammen.
Für einen kurzen unheilschwangeren Augenblick war es totenstill. Nichts rührte sich. Nur der Gestank nach Tod hing in der Luft, und das Prasseln des Regens war zu hören. Eine Gasse weiter ging das Leben in New York City seinen gewohnten Gang. Ungehört, ungesehen blieb das, was gerade mitten unter ihnen geschehen war.
Bis ein Finger des Mannes zuckte.
Ein zweiter Finger zuckte.
Wimpern hoben sich.
Der junge Mann schlug die Augen auf. Das bisherige Blau war verschwunden. Schwarz wie zwei feuchte Murmeln blickten die Augen in den Himmel. Kein Leben spiegelte sich darin. Als würde das Licht selbst darin verschluckt.
Ein zufriedenes Lächeln breitete sich auf den Lippen des Mannes aus. Ein tiefer Atemzug hob den Brustkorb, und mit einer geschmeidigen Bewegung richtete er sich auf. Langsam fuhr er sich mit den blutverschmierten Fingern durch das neue Gesicht. Ertastete das blonde Haar, glitt über die perfekt geschwungenen Wangenknochen bis zu der geraden Nase und blieb an den vollen Lippen hängen.
»Besser. Sehr viel besser«, murmelte er und begann sich das Jackett zuzuknöpfen. Langsam und gemächlich, als kostete er die Bewegungen des neuen Körpers aus, während er auf den regungslosen Jungen neben sich hinabblickte.
Das Kind bewegte sich nicht. Der Regen prasselte auf es hinab.
Er zog die blaue Krawatte straff und stieg achtlos über den Jungen hinweg. »Das war verdammt noch mal knapp …«, murmelte er und verschmolz nahtlos mit der Dunkelheit.
1
Leaf
»Einmal den Hamburger mit extra Ketchup für Tisch zehn, den Hackbraten für fünf, die Hotdogs ohne Brot, dafür mit extra Senf für zwei. Einmal Blaubeer-Pancakes mit Speck, das Spiegelei ohne Dotter, und das bitte zum Mitnehmen. Pack es aber ordentlicher ein als beim letzten Mal. Ich will nicht schon wieder eine Beschwerde, weil sich das Spiegelei selbst zum Rührei gemacht hat«, rief ich in die Küche hinein.
Als Antwort schallte mir ein Schwall aus Flüchen entgegen. »Sind wir hier das Ritz, oder was sollen diese Extrawünsche?«, blaffte mich Cox an. Fett spritzte auf, und eine Dampfwolke hüllte den bulligen Körper meines Chefs ein.
»Hast du die Vollkornwaffeln?«, schoss ich zurück.
»Ich bin zu unterbezahlt für diesen Scheiß«, knurrte Cox und stellte mir einen Teller auf die Durchreiche.
»Du bist der Chef, also müsstest du dir einfach nur mehr auszahlen«, entgegnete ich amüsiert und griff mir den Teller.
Mein Chef wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Kette, die ihn als Ex-Marine auszeichnete, baumelte über dem fleckigen weißen Shirt, während er mich anknurrte. »Oder ich ziehe dir all das ab, was dein Bruder da in sich reinschaufelt.« Mit dem Kinn nickte er zu dem letzten Tisch des Diners.
Neben der Jukebox lugte der schwarze Haarschopf meines Bruders MJ hervor. Die Nase tief in einen Comic vergraben. Den Teller vor sich bereits leer.
Ich sah Cox schuldbewusst an. »Er ist fünfzehn und im Wachstum.«
»Er hat drei Teller Pancakes und zwei Milchshakes verdrückt. Das ist kein Wachstum, das ist ein schwarzes Loch.«
»Ich werd’s ihm ausrichten«, versicherte ich Cox und hob den Teller auf meinen Unterarm.
Mein Chef runzelte die Stirn und drehte sich kopfschüttelnd um. »Zu meiner Zeit hat man als junger Bursche noch was anderes getan, als die Nase bloß in Comics zu stecken und seltsame Würfel zu rollen …«
Ich ließ ihn weiterbrummeln und brachte die Waffeln an Tisch drei. »Hier, bitte schön. Möchten Sie noch etwas Kaffee?«
»Danke, nein.«
»Hey Leaf, kannst du mir noch mal nachschenken?«, rief mir eine trockene Stimme vom Tresen aus zu.
»Sicher, Al.« Schnell sammelte ich ein paar auf den Boden gefallene Servietten auf und stellte mich hinter den runden Tresen. »Nur eine Minute«, bat ich und setzte die leere Kanne zurück, während die zweite brodelnd volllief.
»Gib mir auch noch einen von diesen Kuchen, Schätzchen«, murmelte Al, ohne von seiner Zeitung aufzusehen.
»Denk an deinen Cholesterinspiegel.« Ich füllte seine Tasse auf.
Stirnrunzelnd blickte Al auf und rückte seine Hornbrille zurecht. »Wer bist du? Meine Frau?«
Amüsiert sah ich ihn an und hoffte, er würde nicht bemerken, dass ich ihm seit einer Stunde koffeinfreien Kaffee einschenkte. »Nein, deine Kellnerin, die dir seit sechs Jahren drei Mahlzeiten pro Tag serviert. Und glaub mir, du kannst dir nicht noch eine Herz-OP leisten«, erwiderte ich.
Al blickte grimmig drein. »Dafür gibt es kein Trinkgeld.«
»Das macht zwanzig Dollar fünfzig. Mit dem Trinkgeld, von dem wir beide wissen, dass du es mir trotzdem geben wirst, dann dreiundzwanzig.«
Al murrte und warf mir ein paar zerknitterte Scheine hin. »Behalt den Rest. Sag es aber nicht Cox, der Geizhals prellt dich sonst nur wieder um dein Trinkgeld.«
»Bis morgen, Al, und vergiss den Schirm nicht.« Ich deutete mit dem Kinn auf die Fensterfront, gegen die die Regentropfen so schnell und heftig prasselten, dass es kaum möglich war, nach draußen zu blicken.
Al grunzte etwas von einem juckenden Zeh, der nichts Gutes verhieße, während ich im Weitergehen einem anderen Gast Kaffee nachschenkte. Dabei stieß ich mit dem Ellenbogen Missy an, die seit zwanzig Minuten auf den Fernseher starrte und währenddessen rekordverdächtig langsam die Salzstreuer auffüllte. Es ploppte, als sich eine pinke Kaugummiblase zwischen ihren dunkel geschminkten Lippen aufblähte.
»Missy. Ich will dich nicht stören. Aber könntest du die Gäste übernehmen?« Ich nickte zum Eingang in Richtung der Familie, die mit kreischenden Kindern eingetreten war. Unter ihnen sammelte sich bereits eine Regenpfütze. Es schüttete seit Tagen, und wenn man der Wettertante Glauben schenkte, die soeben die Prognose für die nächsten Tage aufstellte, würde das so schnell nicht besser werden.
Die Blase platzte. Missy warf nur einen flüchtigen Blick unter ihren dicht getuschten Wimpern zu der Familie hinüber und verzog den Mund. »Nein, danke«, meinte sie und begann wieder gelangweilt, die Salzsteuer aufzufüllen.
»Und warum nicht?« Ich hielt meine Stimme neutral, auch wenn mir Missys Einstellung ziemlich gegen den Strich ging. Die Neunzehnjährige arbeitete erst seit etwa drei Wochen hier, aber seitdem hatte sie bereits viermal gefehlt, kam meistens zu spät oder völlig übernächtigt zur Schicht und schien alles an dem Job zu hassen. Das Einzige, woran sie wirklich Interesse hatte, war dieser eine Kunde, der seit ein paar Tagen hierherkam.
Ich biss mir in die Wange, um einen sarkastischen Kommentar zurückzuhalten.
Als Antwort bekam ich nur ein Schulterzucken.
»Ich hasse Kinderfinger. Die sind klein und klebrig.«
Atmen, Leaf. Du warst auch mal ein Teenager.
»Ja, das haben Kinderfinger so an sich.«
»Sie schmieren immer die Speisekarten voll.«
»Deswegen sind die laminiert.«
»Das ist eklig.«
Ich kniff die Augen zusammen. »Missy!«, sagte ich scharf.
Das Bimmeln der Klingel unterbrach uns. »Die Bestellungen für Tisch vier und fünf sind fertig und tragen sich nicht von selbst«, bellte uns Cox an.
Ich hob eine Augenbraue und bedachte Missy mit einem vielsagenden Blick. »Tragen oder Kinderfinger?«
Missy seufzte, stieß sich von dem Tresen ab und ging zur Durchreiche.
Na dann.
Lächelnd drehte ich mich zu der tropfnassen Familie um und ließ dabei meinen Kugelschreiber klicken. »Willkommen im Cox’ Diner. Ich bin Leaf, eure Bedienung für heute. Was kann ich für euch tun?«
»Haben Sie Kaffee? Es ist eiskalt dort draußen, und es stürmt wie verrückt. Wir sind keinen Meter weit gekommen«, sagte der Vater seufzend.
»So viel Sie wollen«, versicherte ich ihm, während die Frau stirnrunzelnd die Karte inspizierte.
Ein lautes Donnern ließ mich besorgt nach draußen blicken. Mein eigenes blasses Spiegelbild sah mir in der Fensterscheibe entgegen. Ich steckte in der gelben Uniform, die mir in der Wäsche eingegangen war, sodass ich unfreiwillig mehr Ausschnitt zeigte, und der kurze Rock meinen runden Po betonte. Schon in der Junior High war ich diejenige mit dem Busen und dem Hintern gewesen. Gene, die jedoch eindeutig nicht von meiner Mum kamen. Sie gehörte zu jener Spezies Mensch, die essen konnte, was sie wollte, ohne zuzunehmen. Bei mir war das offenkundig nicht der Fall. Das einzig Schlanke an mir war meine Taille, was mir in Kombination damals den Spitznamen Betty Boob eingebracht hatte. Die wenigen Male, als ich versucht hatte, die überflüssigen Kilos abzutrainieren, und ins Fitnessstudio gegangen war, hatten darin geendet, dass ich einen Smoothie schlürfend meiner Mitbewohnerin zugesehen hatte, wie sie den Fitnesscoach abschleppte. Zumindest hatten wir so herausgefunden, dass man auch im Fitnessstudio zunehmen konnte, wenn man sechs Smoothies in unter einer Stunde wegkippte.
Ich pustete mir eine Haarsträhne aus dem herzförmigen Gesicht, bei dem meiner Meinung nach das einzig wirklich Interessante meine grünen Augen waren. Allerdings brannten sie von der Zwölf-Stunden-Schicht, die ich für drei Dollar die Stunde abrackerte. Zumindest durfte ich das Trinkgeld behalten. Ich sah mein dunkelbraunes Haar, das sich nicht entscheiden konnte, ob es nun lockig oder gerade sein wollte. Es war einfach nur störrisch, weshalb ich es zu einem zweckmäßigen Zopf nach hinten gebunden hatte. Ich freute mich schon auf das Ende der Schicht, wenn ich ihn öffnen und das Spannungsgefühl zusammen mit dem Geruch nach Frittierfett herauswaschen konnte.
Der Regen prasselte mit solcher Heftigkeit gegen die Scheibe des Diners, dass er wie ein Vorhang aus Wasser daran hinabfloss. Ein gewaltiger Blitz zuckte über den Himmel. Das darauffolgende Grollen war so laut, dass die Tassen auf den Tischen vibrierten.
Das neongelbe Licht im Diner flackerte. Es dauerte kaum länger als einen Wimpernschlag, und für einen kurzen Augenblick sah ich eine hochgewachsene Gestalt unter einer Straßenlaterne stehen, die mich durch das Fenster des Diners direkt anstarrte.
Noch ein Donnerschlag. Das Licht der Straßenlaterne blinzelte hektisch. Für eine Sekunde war es draußen stockdunkel. Als das Licht zögerlich wieder über die Straße kroch, war die Gestalt verschwunden. Alles, was blieb, war mein verschreckter Gesichtsausdruck in der Spiegelung des Fensters. Gänsehaut kroch mir die Arme nach oben, während der Puls hochjagte, als ich hektisch über die Straße blickte. Heilige Scheiße, hatte ich das gerade wirklich gesehen? Da stand niemand mehr, oder? Meine Mitbewohnerinnen hatten recht. Ich sollte weniger True-Crime-Serien anschauen.
»Der Laden fällt ja praktisch auseinander. Könnten Sie wenigstens die Heizung höher stellen? Es ist eiskalt hier. Miss? Miss?«
Die nörgelnde Stimme riss meine Aufmerksamkeit zurück in den Diner. »Ich stelle sie höher«, versicherte ich ihr und nahm ihre restliche Bestellung auf. Als ich mich auf den Fersen umdrehte, rieb ich mir schaudernd über die Gänsehaut an meinen Unterarmen. Es war wirklich kalt geworden.
»Hey Cox. Die Bestellung für acht.« Ich klatschte ihm den Zettel auf den Tresen. »Gerade sind alle bedient, ich würde gern meine fünfzehn Minuten Mittagspause machen, wenn das okay ist.«
Ein Brummen antwortete mir, das ich als Zustimmung auffasste. Ich schnappte mir einen großen Becher Kaffee und schlüpfte in die hinterste Nische neben der Jukebox.
»Will ich wissen, warum auf dem Cover Tentakel zusammen mit Brüsten zu sehen sind? Oder sieht Algebra einfach anders aus, seit ich meinen Abschluss gemacht habe?«, fragte ich meinen Bruder und nahm einen großen Schluck von meinem Kaffee, während das Comicheft hektisch zugeklappt wurde.
»Wa… scheiße, was machst du hier?« MJ funkelte mich an, während ich mir den letzten Pancake von seinem Teller stibitzte.
»Arbeiten. Und du solltest Hausaufgaben machen und nicht … das da.« Mit der Gabel wackelte ich vor dem Comic herum, den MJ mit einer viel zu flinken Geste in die Tasche unter sich beförderte.
»Bin schon fertig mit den Hausaufgaben. Ich wollte …«
»… dem Stiefmonster aus dem Weg gehen?«, riet ich, und MJ verzog das Gesicht.
»Sie hat diesen neuen Guru.«
»Den Kerl mit den ausgestopften Frettchen?«
»Nein, den Kerl mit dem Kochbuch.«
»Ach ja?«
»Seit einer Woche essen wir nur makrobiotisch.«
»Klingt … sehr biotisch.«
»Wir essen praktisch nichts, was einen Schatten wirft. Selbst Dad ist seitdem kaum zu Hause, und ich habe ihn dabei erwischt, wie er die Salami unter den Handtüchern versteckt hat.«
»Armer Bob«, murmelte ich.
»Wir riechen jetzt alle nach Salami, was Cherry völlig paranoid macht.«
MJ fuhr sich durch die dichten schwarzen Locken, das meinem dunklen nussbraunen Chaos so gar nicht ähnlich war. Was vielleicht daran lag, dass wir zwar dieselbe Abneigung gegen Gemüse teilten, aber nicht dieselben Gene. Meine Mom und sein Dad waren zwei Jahre verheiratet gewesen. Für Bob Brown war es nach dem Tod seiner ersten Frau mit meiner Mom die zweite Ehe gewesen, in die er MJ mitbrachte. Für meine Mom war Bob Brown Ehe Nummer vier und der Grund, warum wir damals vor sechs Jahren von Michigan nach New York gezogen waren.
Die Ehe hatte jedoch nur zwei Jahre gehalten.
Zwei Jahre mochte nach nicht viel klingen, aber diese zwei Jahre waren die besten meines Lebens gewesen. Noch heute waren MJ und Bob das, was einer stabilen Familie am nächsten kam. Die beiden waren unter anderem der Grund, warum ich in New York geblieben war, als die Ehe zerbrochen und Mom mit Ehemann Nummer fünf nach Hawaii abgedampft war. Anstatt mit ihr umzuziehen, war ich bei Bob und MJ geblieben und hatte meinen Highschool-Abschluss gemacht und mich an der New York University eingeschrieben. Das eine Jahr im College, in dem ich mich letztendlich für Sozialarbeit im Nebenfach Jura entschieden hatte, war so perfekt gewesen, dass es einfach einen Haken hatte geben müssen. So lief es in meinem Leben immer. Dieser Haken war auch aufgetaucht. Und er trug den Namen Cherry.
Bob nannte es Liebe auf den dritten Blick. Ich nannte es Bobs Versuch, über meine Mom hinwegzukommen. Doch ich konnte es ihm nicht einmal verübeln, die Scherben kitten zu wollen, die meine Mom hinterlassen hatte. Wenn River Young in etwas gut war, dann darin, gebrochene Herzen zurückzulassen, während ihres so flatterhaft wie ein Kolibri war. Ihre Art war genauso bestechend und anziehend für Männer wie ihr Hang zur Dramatik. Sie verliebte sich schnell, lebte intensiv, und am Ende, wenn sie jeden Aspekt bis zur Grenze ausgelebt hatte, ließ sie alles leer und in Trümmern zurück.
In meiner Kindheit hatte ich so schon in einem Dutzend Städten gelebt. Manchmal mit einem neuen Stiefvater. Manchmal mit Mom allein, wenn sie länger brauchte, um über eine Beziehung hinwegzukommen, und sich dabei von zu viel Chardonnay und der Kunst reizen ließ, was sie jedoch meist direkt in die Arme eines neuen Mannes trieb.
Ich konnte Bob keinen Vorwurf machen, dass er versucht hatte, wieder sein Leben zu leben, auch wenn wir alle wussten, dass niemand wirklich über River Young hinwegkam. Also lachte sich Bob Cherry an. Die nur leider eine ausgeprägte Abneigung gegen die Tochter aus seiner zweiten Ehe zu haben schien.
Seufzend stützte ich mein Kinn in der Handfläche ab und musterte meinen kleinen Bruder. »Du bist seit Stunden hier. Geh nach Hause, MJ.«
»Ich wollte auf dich warten«, log er. Leider war er ein grauenhafter Lügner.
»Ach, du wartest auf mich?«, fragte ich gespielt entzückt und klimperte mit den Wimpern. »Seit wann heiße ich denn Missy?«
MJ reagierte wie jedes Mal, wenn ihr Name fiel: Er lief hochrot an und versuchte gleichzeitig, ungerührt dreinzublicken. Eine Kombination, die ihn aussehen ließ, als hätte er Verstopfung. Drollig.
»Ich weiß nicht, was du meinst.«
Dumm-drollig.
»Kleiner …«, setzte ich an und wurde sofort mit einem wütenden Blick bestraft. »Großer?«, versuchte ich es noch mal.
Er verdrehte Augen. »Ich hasse dich.«
»Ich dich auch. Aber ganz im Ernst.« Ich griff nach seiner Hand und drückte sie kurz und eindringlich. »Ich weiß, Missy ist hübsch, groß und wütend auf die Welt – was durchaus sexy sein kann. Doch abgesehen davon, dass sie vier Jahre älter ist als du und eine beunruhigende Neigung dazu hat, den Kondomautomaten zu knacken, ist es selten eine gute Idee, in ein Mädchen verknallt zu sein, das gerade schwer damit beschäftigt ist, die Welt zu hassen. Und am allermeisten sich selbst.«
»Leaf …«
»Ich will nur sagen …«
»Hör. Bitte. Auf«, presste er hervor und zog seine Hand weg.
»Sie bricht dir nur das Herz«, schloss ich sanft und wollte seine Hand drücken, die aber leider nicht mehr da war. Also drückte ich die Gabel.
Er biss die Zähne zusammen und stierte auf die Sirupschliere an seinem Teller. Eine Blaubeere klebte traurig am Rand. »Bist du fertig?«, presste er hervor.
»Fürs Erste.« Ich lehnte mich zurück und stupste ihn unter dem Tisch mit der Spitze meiner abgetragenen Converse an. »Ich will nur nicht, dass du dich selbst unglücklich machst.«
»Du meinst, wie Ben dich unglücklich gemacht hat, weil er dich über zwei Jahre lang betrogen hat?«, fragte er, und der Stich, der mir dabei durch die Brust ging, war so heftig, dass ich blinzelnd wegsehen musste.
Nicht weinen.
Nicht schon wieder.
Die Phase, dass ich auch nur bei der Erwähnung von Ben Alderson weinen musste, hatten wir bereits seit drei Wochen, sechs leeren Erdnussbuttergläsern und neunzig Folgen Doctor Who hinter uns.
»Er ist mit ihr verlobt. So gesehen war nicht sie, sondern ich die andere Frau«, presste ich hervor und zwang das Brennen in den Augen zurück.
»Kannst du bitte aufhören, diesen Spießer zu verteidigen? Er hat dich beschissen! Jahrelang!«
»Das tue ich gar nicht«, sagte ich und funkelte meinen Bruder an.
»Doch! Weil du eine viel zu treue Seele bist und du trotzdem Ausreden suchst, um zu rechtfertigen, was er dir angetan hat.«
»Das tue ich nicht!«, knurrte ich meinen Bruder an, während mir das Herz in der Brust eng wurde. Zum Teufel, natürlich tat ich es. Und ich hasste mich selbst für jeden Atemzug, in dem ich den Mistkerl noch immer vermisste.
Er warf die Arme in die Luft. »Leaf, er hat eine Einstecktuch-Sammlung. Mit gestickten Familienmonogrammen. Du hättest ihn schon vor Jahren abschießen sollen. Alleine deswegen!«
»Gut, die Einstecktücher sind ein wenig spießig«, räumte ich ein und musste trotz der absurden Situation lachen, was den Druck hinter meinen Augen endgültig vertrieb. »Aber um solchen Kram geht es nicht in einer Beziehung.«
»Ach, nicht?«
»Nein.«
»Dann um seine nach Farben sortierten Socken, die zu seinen Krawatten passen?«
»Nein, es geht darum, dass du einen Partner hast, bei dem du dich gut fühlst. Zu dem du am Ende eines schweren Tages gehen kannst und deine Sorgen vergisst. Der das Beste aus dir herausholt und dir keinen Tripper verpasst.«
MJ bedachte mich mit einem überraschend erwachsenen Blick, während er sich die letzte Blaubeere in den Mund steckte. »Du solltest vielleicht öfter auf deinen eigenen Rat hören.«
Und da war er wieder.
Mr. Kloß.
»Das sollte ich vielleicht«, stimmte ich zu und seufzte.
»Leaf, seit ihr euch getrennt habt, gehst du nur noch wie ein Roboter zur Uni oder schiebst Doppelschichten im Diner. Ich mache mir Sorgen um dich. Wir alle machen uns Sorgen um dich.«
»Oh, MJ.« Teils liebevoll, teils traurig sah ich ihn an.
»Sitzt du deswegen ständig hier? Weil du dir Sorgen machst? Das musst du nicht. Ich werde schon wieder, ich brauche nur ein wenig Zeit.«
MJ biss die Zähne zusammen und sah störrisch weg. »Werd mal nicht sentimental. Ich bin hier wegen Missy, nicht wegen dir.«
Dummer, kleiner, schlechter Lügner.
Ich streckte ihm die Zunge heraus. Er trat mir gegen das Schienbein.
Ich lächelte, und auch wenn es noch immer beschissen wehtat, an Ben zu denken, könnte es doch schlimmer sein.
»Okay. Dann schmachte Missy weiter an. Ich muss weiterarbeiten und gehe danach noch mit den Mädels aus.«
»Bei dem Sauwetter?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Du bist nicht der Einzige, dem mein Herzschmerz auf die Nerven geht. Tavia und Priscilla haben mir angedroht, mich notfalls auch im Pyjama auf die Tanzfläche zu schleifen. Und ich glaube ihnen. Sag Bescheid, wenn du nach Hause willst. Vielleicht schaffen wir es, ein Taxi zu finden, das im Wasser fahren kann.«
Draußen krachte es im selben Augenblick laut, und das Licht über unseren Köpfen flackerte abermals.
MJ öffnete den Mund, ehe er stirnrunzelnd innehielt. Er starrte einen Punkt hinter meiner Schulter an. Das feine Lächeln in seinem Gesicht war schlagartig verschwunden. »Wer ist der Kerl?«, fragte er mich.
»Welcher Kerl?« Stirnrunzelnd drehte ich mich um und folgte seinem Blick.
Missy stand am Tresen und lächelte jemanden an, der auf dem allerletzten Hocker saß. Genau neben dem Pistazienspender. Das Licht dort hinten war defekt, sodass es die einzige Ecke im Diner war, die ein wenig im Schatten lag. Dennoch erkannte ich ihn, weil er seit etwa einer Woche jeden Tag zur gleichen Zeit hierherkam. In Gedanken nannte ich ihn nur »Missys Kerl«. Er saß immer auf demselben Hocker. Er war schlank, hatte aber breite Schultern und dunkelblondes Haar, das sich feucht in seinem Nacken kräuselte. Was auch immer er sagte, brachte Missy dazu, sich kichernd nach vorn zu lehnen. Er streckte eine Hand aus und rollte eine ihrer langen dunklen Haarsträhnen um seinen Zeigefinger.
Verblüfft musterte ich Missys Kerl. »Wo kommt der denn plötzlich her?«
MJs Blick klebte auf dem lachenden Gesicht von Missy, die aussah, als würde sie gleich auf den Schoß des Kerls kriechen.
»Miss? Können Sie vielleicht den Fernseher etwas lauter drehen? Da kommt gerade eine Eilmeldung rein, die will ich hören«, rief mir einer der Gäste zu.
Es brauchte zwei Sekunden, bis ich begriff, dass die Frage an Missy abprallte und ich wohl ranmusste. »Natürlich.«
Ich seufzte und sprang mit schmerzenden Füßen auf und huschte hinter die Theke. Die Nachrichten hatten das Footballspiel unterbrochen. Eine zu stark geschminkte Reporterin blickte ernst in die Kamera, während Bilder vom Chrysler Building zu sehen waren.
»… aufgefunden. Bei dem Toten handelt es sich um den zehn Jahre alten Murphy Rogers. Der Schüler verschwand vor zwei Wochen spurlos von einem Spielplatz und wurde seitdem von der Polizei und den Angehörigen gesucht. Die Leiche wurde bereits pathologisch untersucht. Dabei wiesen seine Verletzungen Ähnlichkeiten zu zwei anderen Leichenfunden auf …«
Wenn es für den alten Fernseher mal eine Fernbedienung gegeben hatte, so hatte ich sie in den sechs Jahren, die ich jetzt für Cox arbeitete, zumindest noch nie gesehen. Demnach musste ich auf die Zehenspitzen gehen und einen kleinen Hopser machen, um den Lautstärkeknopf zu treffen.
»Brauchst du Hilfe?«, fragte unvermittelt hinter mir eine Stimme. So nah, dass ich den warmen Atem an meinem Ohr fühlte.
Jemand bewegte sich, ein blasser Finger schoss unvermittelt über mich hinweg und drehte den Fernseher lauter. Gänsehaut kroch mir über den Rücken. Erschrocken fuhr ich herum. Dabei wischte ich eine volle Kaffeetasse vom Tresen. Es klirrte laut, als Scherben in alle Richtungen spritzten, zusammen mit heißem Kaffee, der sich in die Fugen des Fliesenbodens fraß.
»Scheiße!«
Murrend bückte ich mich und begann, die Scherben aufzusammeln, als ein Schatten über mich fiel. Verzerrt und irgendwie zu dunkel. Ich hob den Kopf und erstarrte. Ein Kerl lehnte sich über den Tresen. Durchdringende blaue Augen blickten mich unter kurzen dunklen Wimpern an. Dunkelblondes Haar fiel ihm ins Gesicht, das gleichzeitig schmal und kantig war und von einem Grübchen im Kinn gekrönt wurde. Und diese Augen. Mir war klar, was Missy an ihm fand. Der Typ sah aus, als wäre er direkt aus einer Reklametafel herausspaziert. Hätte ich in den letzten Wochen nicht zu viel mit meinem Herzschmerz zu kämpfen gehabt, würde wahrscheinlich ich statt Missy um ihn herumtänzeln. Doch zum ersten Mal, seit er hergekommen war, verschlug es mir bei seinem Anblick wirklich die Sprache. Mein Puls jagte fröhlich los.
Als hätte er es bemerkt, teilte ein spöttisches Lächeln seine Lippen, während er den Kopf neigte, sodass die Sehnen an seinem Hals dabei einen eleganten Bogen beschrieben. Sein Alter war schwer einzuschätzen – etwas zwischen Anfang zwanzig und Mitte dreißig, was vor allem an dem Ausdruck in seinen Augen lag, der älter wirkte als der Rest an ihm. An seiner linken Wange prangte ein dunkles Muttermal. Ein Tupfer, der beinahe malerisch aussah, als hätte ein Künstler, der seine Zeichnung zu makellos fand, versucht, einen Akzent zu setzen.
»Alles in Ordnung?«, fragte er mit einer weichen, vollen Stimme. Die kleinen Härchen in meinem Nacken stellten sich auf.
Um auf etwas anderes als dieses irritierend perfekte Gesicht zu blicken, sammelte ich die Scherben auf. »Klar. War nicht die erste Tasse und wird auch nicht die letzte sein.«
Demonstrativ schmiss ich die Scherben in den kleinen Mülleimer unter dem Tresen und richtete mich auf. »Missy, könntest du …«, setzte ich an, doch die warf sich gerade eine Lederjacke über.
»Ich mach Schluss für heute. Wir sehen uns morgen.«
Argh! Teenager.
Scharf einatmend sah ich auf.
»Unsere Schicht ist erst in drei Stunden um, Missy«, erinnerte ich sie und erntete dafür ein Schulterzucken.
»Ich fühl mich nicht so gut.«
»Ach?« Ich linste zu dem Kerl hinüber, der über den Tresen lehnte, während über uns flackernd weiterhin die Nachrichten liefen.
»Inzwischen zeigt sich die Polizei überzeugt, einem neuen Serienmörder auf der Spur zu sein. Dabei ist weder ein Motiv noch ein gewisses Profil zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Überführung des Mörders führen könnten. Und jetzt zum Sport …«
Mein Blick schnellte zu Missy, die den Tresen umrundet hatte und den blonden Adonis anlächelte. »Wir können gehen.«
»Wie heißt denn eigentlich dein Freund, Missy? Willst du uns nicht vorstellen?«, fragte ich. Missy bedachte mich lediglich mit einem bösen Blick.
»Verpiss dich, Leaf.«
»Was für ein seltsamer Name«, warf ich spöttisch ein.
Missy verdrehte die Augen und riss an dem Arm des Kerls. »Los, lass uns verschw…«
»Henry? Henry Lancester?«, erklang plötzlich eine schrille Stimme. Die nörgelnde Frau von vorhin stand hinter ihm, eine Serviette in der Hand, und starrte den hübschen Kerl an.
Der hob nur eine Augenbraue. »Entschuldigung? Kennen wir uns?«
Die Frau riss schockiert die Augen auf. »Ob wir uns kennen? Wir sind gerade auf dem Weg zu deiner Gedenkfeier! Weißt du, welche Sorgen sich deine Eltern um dich machen?«
Im Diner wurde es unangenehm still. Alle Augen richteten sich auf Missy und ihren Begleiter.
Der Kerl zögerte. Ich sah es an dem Zucken in seinem Wangenknochen, während seine Augen eine Nuance dunkler wurden, dass es beinahe wie Wut aussah, oder vielleicht auch Gereiztheit. Aber nur für einen Augenblick, ehe er ein geziertes Lächeln auf seine Lippen zauberte. »Entschuldigen Sie, Sie müssen mich mit jemandem verwechseln«, gab er zurück.
»Komm. Lass uns gehen«, sagte Missy, ihre Augen zuckten blitzschnell zwischen Henry und der Frau hin und her. Sie zog wieder an seinem Arm, doch die Blonde versperrte ihm weiter den Weg. Missy biss die Zähne zusammen und machte sich im Gegensatz zu ihrem Begleiter nicht die Mühe, ihre Gereiztheit zu verbergen.
»Soll das ein schlechter Scherz sein, Henry? Wir haben zusammen studiert! Du warst Trauzeuge auf meiner Hochzeit!« Sie rückte näher und zischte ihn an. »Weißt du, was die Leute über dich reden? Die Zeitungen waren voll mit den Korruptionsvorwürfen und der Geldwäsche. Du wurdest für vermisst erklärt!«
Was zum Teufel?
Ruckartig hob ich die Augenbrauen, während Missy Henry-nicht-Henry einen verwirrten Blick zuwarf. »Wovon redet sie da?«
Die blonde Frau sah Missy naserümpfend an. »Bitte sag mir nicht, dass du untergetaucht bist, um mit diesem Flittchen zusammen zu sein?«
»Flittchen?«, fuhr Missy sie an, wurde jedoch von Henry zurückgezogen.
»Nicht doch, Süße. Wir wollen keinen Ärger. Das ist nicht mehr als ein Missverständnis. Das passiert öfter. Ich habe nun mal ein Allerweltsgesicht«, sagte er gelassen.
Also, bitte – wenn jemand kein Allerweltsgesicht hatte, dann er. »Ich muss euch bitten, diesen Streit nicht hier im Diner zu führen. Missy, vielleicht sollte ich deine Mom anrufen und …«
»Verpiss dich, Leaf, das geht dich nichts an«, fauchte sie mich erneut an. Könnten ihre Blicke Pfeile abschießen, würde ich jetzt aufgespießt am Boden liegen.
Cox streckte seinen Kopf aus der Küche und schwenkte verärgert seinen fettigen Pfannenwender. »Was ist denn hier los?«
»Gar nichts«, fuhr Henry mit weicher, aber nachdrücklicher Stimme dazwischen und schnippte sich ein nicht existentes Staubkorn von seinem langen dunklen Mantel. »Wir waren gerade dabei zu gehen«, fügte er hinzu. Als er lächelte, konnte ich Grübchen sehen.
»Du kannst doch nicht …«, setzte die Frau an.
»Miss …«, unterbrach sie der junge Mann noch immer galant, aber mit einer Entschiedenheit in der Stimme, die durch Mark und Bein ging. Eine Haarsträhne fiel ihm in die Stirn, als er sich elegant nach vorn beugte und der Frau etwas ins Ohr flüsterte. Die anderen nahmen es wahrscheinlich gar nicht wahr, doch hinter dem Tresen konnte ich genau das Gesicht der Frau sehen und bemerkte den Wechsel in ihrer Mimik. Der wütende, zynische Ausdruck wich einem unruhigen Flackern in ihrem Blick. Sie wurde blass, und ihre Augen weiteten sich kaum merklich, während Henry zurücktrat und sie schief anlächelte. Was zum Teufel? Hatte er ihr gerade gedroht? Unruhig blickte ich mich um, doch die Aufmerksamkeit der meisten war bereits wieder auf ihr Essen gerichtet. Cox schepperte laut in der Küche herum.
»Miss. Brauchen Sie Hilfe? Kann ich etwas tun?«, fragte ich und tastete nach dem Handy am Tresen. Es war nicht das erste Mal, dass es Ärger im Diner gab. Das hier war Manhattan. Es gab immer Ärger, aber das hier war seltsam. Es stellte mir die Nackenhaare auf, ohne dass ich genau wusste, warum.
Henry wandte sich mir zu und lächelte mir zu.
»Kein Grund zur Sorge. Es ist nur ein Missverständnis, oder?«, fragte Henry so laut, dass ich es diesmal auch hören konnte.
Die Frau blinzelte. »N… natürlich. Es war nur eine Verwechslung«, stammelte sie und schenkte mir ein knappes Lächeln. »Wir … wir würden dann gern zahlen.«
»Sind Sie sicher …?«, setzte ich an, doch sie drehte sich bereits um und verschwand zurück zu ihrem Tisch.
Mein Blick huschte zu dem potenziellen Henry und Missy, die ihm wütend etwas zuzischte. »Was war denn das?«, fragte sie, und die Spannung im Raum löste sich so schnell auf, als hätte ich es mir nur eingebildet.
»Das würde ich auch gern wissen«, warf ich ein.
Henry zwinkerte mir zu. Er sah nicht aus, als hätte ihn die Szene in irgendeiner Weise berührt. »Entschuldige die Aufregung. Ich bringe jetzt Missy nach Hause. Vielleicht … sehen wir uns ja wieder.«
Er lächelte. Sein Blick war beinahe zu intensiv, um wirklich angenehm zu sein, aber es war unmöglich, sich davon loszureißen. Die Iriden durchdringend blau und klar. Nicht wie das Meer, dafür war der Blick zu ruhig, jedoch auch nicht wie ein wolkenloser Himmel, dafür war er zu intensiv.
Die Klingel bimmelte, als weitere Gäste den Diner betraten und mich aus der Grübelei rissen. Ertappt blinzelte ich, und Henry warf mir ein spöttisches Lächeln zu. Ich weigerte mich, peinlich berührt zu sein, und hob stattdessen auffordernd eine Augenbraue.
»Wenn ihr nichts mehr bestellen wollt, muss ich euch bitten zu gehen«, sagte ich so kühl wie möglich.
Henry nickte, und als die beiden den Diner verließen, fuhr eine starke Windböe herein und brachte meinen Pferdeschwanz zum Tanzen. Die neuen Gäste flüchteten sich auf eine Eckbank und versperrten mir den Blick auf Missy, die zusammen mit Henry in die Dunkelheit verschwand.
Stirnrunzelnd rieb ich mir über den Unterarm, ehe ich in die Knie ging, um den verschütteten Kaffee aufzuwischen. Cox musste die Heizung reparieren lassen. Es war scheißkalt hier drin.
2
Leaf
»Hey Cox. Abigail hat angerufen. Sie verspätet sich, weil ihr wohl wegen dem Sauwetter alle Babysitter abgesagt haben. Gerade ist alles ruhig. Wenn du nichts mehr brauchst, mach ich die Biege.«
Ich streckte den Kopf in die Küche hinein. Mein Chef lag düster murrend unter der Spüle, die schon tropfte, seit ich hier angefangen hatte.
»Dein Scheck für diese Woche steckt in deinem Fach«, kam es nur dumpf zurück.
»Danke dir. Bis Montag. Ach, und wegen Missy …« Zögernd hielt ich inne. »Kennst du den Kerl, mit dem sie heute verschwunden ist? Ist das ihr neuer Freund? Weißt du was darüber?«
Es rumpelte, als Cox unter der Spüle auftauchte und sich dabei die Hände an einem Lappen abwischte. »Welcher Kerl?«
Irritiert runzelte ich die Stirn. »Der große Blonde. Wegen dem es Stress gab. Missy ist mit ihm verschwunden.«
Cox schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung. Ich weiß von nichts. Sie meinte nur, sie fühle sich nicht gut.« Sein Blick verfinsterte sich prompt.
Ratlos zuckte ich mit den Schultern. »Hat sie morgen Schicht?«
»Ja.«
»Würdest du mich dann anrufen, falls sie … keine Ahnung, sich verspätet oder nicht auftaucht?«
Die Augenbrauen meines Chefs wanderten nach oben. »Mach ich.« Er warf sich den Lappen über die breite Schulter. »Und jetzt schwing deinen Arsch hier raus und nimm deinen Bruder mit, bevor er mir die Haare vom Kopf frisst.«
Ich winkte ihm zu und schlüpfte in meinen blauen Plüschmantel, den ich für schlappe zwölf Dollar in einem Secondhandladen ergattert hatte und der aussah, als hätte jemand dem Krümelmonster das Fell abgezogen.
Ich steckte meinen Scheck ein, ehe ich auf meinen Bruder zuging, der die Nase schon wieder in einem Buch vergraben hatte. »Mathe?«, fragte ich hoffnungsvoll.
»Volo’s Guide to Monsters«, murmelte er.
»Okay, wenn dein Dad fragt, war es Mathe.«
MJ warf mir einen genervten Blick zu. »Bist du endlich fertig?«
»Du wolltest hier warten«, erinnerte ich ihn.
MJ stopfte das Buch in seinen mit Pins übersäten Rucksack, aus dem Zettel ragten, von denen wahrscheinlich kein einziger etwas mit Schule zu tun hatte. »Willst du heute wirklich ausgehen? Komm doch zu uns. Dad und ich wollten einen Twilight-Zone-Marathon machen. Dazu gibt es offiziell zwar nur Karottensticks, aber ich schmuggel ein paar Cheetos mit rein. Frag nicht, woher oder wie, doch sie werden da sein«, meinte er.
»Verlockend, aber Priscilla und Tavia bringen mich um, wenn ich heute nicht mit ihnen ausgehe. Ich habe es hoch und heilig versprochen. Ich schulde ihnen Wiedergutmachung für einen Monat lang Erdnussbutter und heulen, drum schmeiß ich dich auf dem Weg raus, ja?«
Mein kleiner Bruder rümpfte die Nase. »Wo geht ihr hin?«
»Ich habe keine Ahnung, aber hoffentlich bin ich bald betrunken genug, um mich nicht über die Ratten aufzuregen, denn alles, was keine Ratten hat, kann ich mir nicht leisten«, murmelte ich.
MJ schnaubte und warf sich die Tasche über die schmale Schulter. »Ich bin mir bei dir nie sicher, ob du eine hoffnungslose Masochistin oder einfach nur eine krankhaft verzweifelte Optimistin bist.«
»Beides. Mit einer Prise Selbsthass, seit ich mich letzte Woche auf die Waage gestellt habe.«
Fröhlich hakte ich mich bei meinem Bruder ein und zog ihn aus dem Diner hinaus. Sofort schlugen uns Regen und eine kalte Windböe ins Gesicht. Schaudernd zog ich die Schultern hoch, spannte den Schirm auf und sah im selben Augenblick ein schwarzes Auto auf uns zukommen. Das Modell war schnittig und lag so tief, dass es quasi mit der Straße verschmolz. Ohne Rücksicht auf Verluste bretterte der Wagen direkt auf uns zu und raste durch eine Pfütze. Kaltes, dreckiges Wasser spritzte hoch bis zu meinem Oberschenkel und klatschte MJ auf den Rucksack.
»Bäh!«, stieß er hervor, während ich wütend zu dem Auto herumwirbelte, das mit quietschenden Reifen einfach auf dem Gehsteig vor dem Diner hielt. Die Tür wurde aufgerissen, und zwei große Gestalten stiegen aus. Passend zum schwarzen Auto trugen sie dunkle Mäntel, die ihre Körper beinahe nahtlos mit ihrer Umgebung verschmelzen ließen.
»He, habt ihr keine Augen im Kopf? Was soll der Scheiß?«, brüllte ich sie an.
Der Größere der beiden hielt inne und wandte mir den Kopf zu. Es war zu dunkel und stürmisch, um mehr zu sehen als dunkles Haar, das ihm in einem straffen Pferdeschwanz bis zur Mitte des Rückens fiel.
Wütend stapfte ich auf ihn zu, wurde jedoch von MJ zurückgehalten. »Ist das ein Falke?«
»Nein, ein Arschloch.«
»Nein, Leaf, sieh mal, da oben.«
Ich folgte seinem Blick und sah einen Vogel auf dem blinkenden Neonschild des Diners hocken. Schwarze Federn, schlanker Kopf. Ich hatte keine Ahnung von Federvieh, für mich hätte es genauso gut eine Taube sein können. Die Tropfen prasselten auf den Schirm, und für einen kurzen Augenblick kam es mir so vor, als würde mich der Vogel direkt anstarren.
Im selben Moment betraten die beiden Männer den Diner, und der Vogel flog davon. Ich blinzelte, während sich MJ den Hals verrenkte, um dem Tier nachzusehen.
»Das war ein Falke. Wie irre.«
»Oder eine Taube. Und danke für die Ablenkung, jetzt sind die Kerle weg. Notier dir das Nummernschild. Sie stehen im Halteverbot.«
Mit verengten Augen blickte ich den beiden Typen nach. Sie glitten wie zwei Schatten durch den Diner. Ihre Gesichter kaum mehr als ein paar verschwommene Flecken, denn der Regen prasselte so stark gegen die Fensterfront, dass ich nichts weiter erkennen konnte.
MJ murrte und zog die Schultern hoch. »Oder wir suchen uns jetzt ein Taxi und fahren heim, ehe wir schwimmen müssen.«
»Oder das …«, stimmte ich zu und winkte nach dem ersten Taxi, das an uns vorbeibretterte. Wasser spritzte erneut auf, ehe es ruckartig vor uns stehen blieb. Gegen den Wind ankämpfend quetschten wir uns auf die Rückbank.
»Wohin?«, fragte uns der Taxifahrer.
»Halten Sie bitte zuerst am Zuccotti Park an der Liberty Street, danach weiter nach Chinatown.«
Der Fahrer raste bereits los, bevor ich zu Ende gesprochen hatte. Trotz voll aufgedrehter Scheibenwischer schaffte er es dabei kaum, nach draußen zu gucken, was ihn jedoch nicht dazu veranlasste das Tempo zu drosseln.
Erleichtert, endlich nicht mehr auf den Füßen stehen zu müssen, sank ich in den Sitz zurück, während MJ am Handy ein Spiel zu zocken begann. Was mich daran erinnerte, dass ich in den letzten Stunden kaum Zeit gehabt hatte, meine eigenen Nachrichten zu checken. So zückte ich mein altes Samsung und klickte mich durch die eingegangenen WhatsApp-Nachrichten.
Zwei von meiner Mom. Eine, in der sie mich fragte, ob ich eine Ahnung hätte, wo sie ihre Schlüssel hingelegt hatte – Woher sollte ich das wissen? – und die andere, in der sie mir mitteilte, dass sie sie in der Tiefkühltruhe gefunden hatte.
![Kiss me twice [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a0fe1b9f1c7d56660f1a6ac471e68968/w200_u90.jpg)
![Kiss me once [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/58f14f2f022cec4e8263fb50dc264ae2/w200_u90.jpg)
![Night of Crowns. Spiel um dein Schicksal [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f3ef0064b2dcb6a110ec6f7cc33ca401/w200_u90.jpg)
![Kiss Me Now [Kiss the Bodyguard-Reihe, Band 3 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/a2814e535c98fcfda1cfdcb79ccfd3a8/w200_u90.jpg)

![Night of Crowns. Kämpf um dein Herz [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/f13c50da50588357fe7b60b5de49bf54/w200_u90.jpg)
![Ever & After. Der schlafende Prinz [Band 1 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/1a15fb283a4db3ffe16e7b163009952b/w200_u90.jpg)
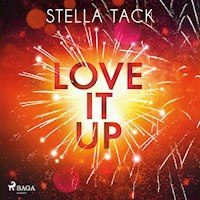


![Ever & After. Die dunkle Hochzeit [Band 2 (Ungekürzt)] - Stella Tack - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/8868ef4c8bf07024c89e72b8d2c844ea/w200_u90.jpg)