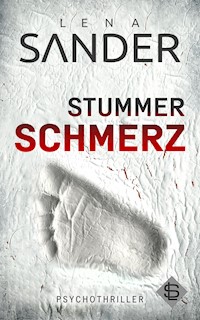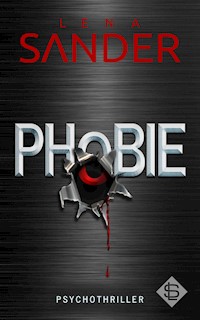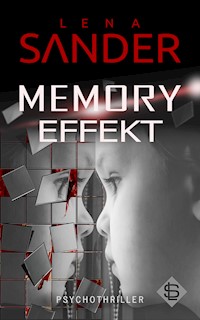SONDERANGEBOT
SONDERANGEBOT
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine Leiche? Keine Anhaltspunkte? Keine Zeugen? Max, ein Afghanistan-Veteran, macht sich auf die Suche nach seinem Freund und entdeckt, dass Björn nicht der einzige Obdachlose ist, der spurlos verschwand. Die Nachforschungen führen Max in ein baufälliges Krankenhaus, am Rande der Stadt. Er ist perfiden Machenschaften auf der Spur, deren Ausmaße sich zu einem realistischen Albtraum entwickeln, aus dem es kein Entkommen gibt. EXITUS: Die Vergessenen, nichts ist so, wie es scheint. Tatsachen, die uns alle betreffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Exitus
Die Vergessenen - Psychothriller
Lena Sander
Für immer in meinem Herzen
Mama
Impressum
© 2014 LENA SANDER
Alle Rechte vorbehalten
Lena Sander
c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
Die Tatsachen, die diesem Buch zugrunde liegen, werden im Nachwort erläutert. Alle weiteren Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.
Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.
Ausgabe Dezember 2014
Lektorat: Susanne Pavlovic www.textehexe.com
Korrektorat: Anke Höhl-Kayser www.hoehl-kayser.de
Coverdesign: BreisgauART
Bildnachweis:
stockadobe – www.stockadobe.com
Newsletter-Anmeldung:
www.lena-sander.de/newsletter.htm
E-Mail: [email protected]
Internet: www.lena-sander.de
Über die Autorin
Lena Sander
Die Thriller-Autorin Lena Sander lebt in Freiburg, am Fuße des Schwarzwalds. Das Schreiben war für sie zunächst ein Ausgleich während des trockenen Marketingstudiums, ließ sie danach aber nicht mehr los.
Die Grundthemen ihrer Psychothriller beruhen immer auf Tatsachen. Das Markenzeichen ihrer Bücher ist, die raffinierte Verknüpfung von Realität und Fiktion zu spannungsgeladenen Storys. Während die plastisch beschriebenen Szenarien ihrer Psychothriller schockieren, wirken die tieferliegenden Botschaften noch lange in der Seele nach.
Über dieses Buch
Eine Leiche? Keine Anhaltspunkte? Keine Zeugen?
Max, ein Afghanistan-Veteran, macht sich auf die Suche nach seinem Freund und entdeckt, dass Björn nicht der einzige Obdachlose ist, der spurlos verschwand. Die Nachforschungen führen Max in ein baufälliges Krankenhaus, am Rande der Stadt. Er ist perfiden Machenschaften auf der Spur, deren Ausmaße sich zu einem realistischen Albtraum entwickeln, aus dem es kein Entkommen gibt.
EXITUS: Die Vergessenen, nichts ist so, wie es scheint. Tatsachen, die uns alle betreffen.
Contents
Title Page
Impressum © 2014 Lena Sander
Über die Autorin
Über dieses Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Kontakt zur Autorin
1. Kapitel
Die kleinen Füße tapsten über den kalten Steinboden. Gerade erwacht, nur mit ihrem kurzen, weißen Nachthemd bekleidet und dem einäugigen Teddybär im Arm, ging Johanna in Richtung Küche. Sie konnte ihre Eltern miteinander sprechen hören, die bestimmt wie jeden Morgen das Frühstück zubereiteten. Kurz vor der wuchtigen Eichentür stoppte das Mädchen, streckte die Hand nach oben und umfasste den Messinggriff. Ein heftiges Klopfen ließ sie zurückschrecken. Der Teddy fiel ihr aus dem Arm. Johanna starrte gebannt zur Tür. Das Klopfen wurde lauter und wandelte sich zu einem Hämmern, das sich auf den Fußboden übertrug – es suchte sich den Weg über ihre nackten Füße bis hinauf in ihren Magen …
»Hallo, können Sie mich hören?« Sie zuckte zusammen, als der Mann auf den Tisch klopfte, als würde er sich von seinen Stammtischbrüdern verabschieden. Johanna öffnete die Augen. Sie war gedanklich noch in ihrem Kindheitstraum. Verwirrt. Ihre Gedanken kreisten, sie wollten nicht anhalten, keine logische Erklärung liefern, nicht einmal einen Anhaltspunkt darüber, wer der Unbekannte ihr gegenüber war oder wo sie sich befand. Ihre Blicke schweiften über den Tisch, auf dessen Kante sie ihre Arme lehnte. Je länger sie auf die Holzmaserung starrte, umso mehr neue Muster formten sich daraus. Die Haut ihrer Hände war papierdünn, runzelig und voller Flecken. Dicke Adern zeichneten sich darunter ab.
»Hallo, hier spielt die Musik.« Sie spürte die Ablehnung und die Ungeduld ihres Gegenübers, der ihr Karten mit unterschiedlichen Motiven vor die Nase hielt. Sie fühlte sich nicht wohl in diesem spartanisch eingerichteten Raum. Die Tintenklecksbilder an den Wänden, die sie an einen Rorschachtest erinnerten, waren abschreckend und trugen nichts dazu bei, die nüchterne Atmosphäre aufzuheitern. Johanna musste die Augen zusammenkneifen, als sie hinauf in das grelle Neonlicht blickte. Der Stuhl, auf dem sie saß, war nicht gepolstert und daher sehr unbequem für ihren geschundenen Körper. Abermals schlug der Mann mit der Faust auf den Tisch, dabei kratzte der Siegelring, den er am kleinen Finger trug, über das Holz. Der barsche Tonfall zwang Johanna dazu, sich abzuwenden und auf den Boden zu sehen.
»Sehen Sie mich an!«, zischte der Fremde. Johanna gehorchte. Das grelle, flackernde Neonlicht spiegelte sich auf seiner Glatze. Johanna musste unweigerlich an Kojak denken, der, mit einem Lolli bewaffnet, die Straßen von Manhattan von den Bösewichten befreite. Der Gedanke an die alte US-amerikanische Krimiserie zauberte ihr ein Lächeln ins Gesicht.
»Was ist denn so lustig? Hören Sie mir überhaupt zu?« Johanna wollte nicht antworten, sie wollte sich nicht auf dieses Niveau begeben. Ein Strang, der um ihren Hals gebunden war, schnürte ihr die Luft ab. Der Druck, der auf ihren Kopf ausgeübt wurde, erhöhte sich und wurde unerträglich. Sie blickte nach rechts und konnte aus ihrem Augenwinkel Kabel erkennen, die von ihrem Kopf ausgehend bis zu einem Gerät führten, das neben dem Siegelringträger stand. Ihr Gegenüber griff nach der nächsten Karte und blieb mit dem Ärmel seines weißen Kittels an dem Stapel hängen. Die Karten rutschten zur Seite, glitten über den Rand der Tischplatte und verteilten sich auf dem Fußboden. Der Mann murmelte etwas Unverständliches vor sich hin und bückte sich unter den Tisch. Jetzt oder nie. Johanna riss die Kopfbedeckung samt Kabel ab. Sie stützte sich auf die Tischplatte, kam in die Höhe, schob den Stuhl nach hinten und schlurfte, so schnell es ihr möglich war, in Richtung Tür. Die Türklinke war in greifbarer Nähe. Johanna streckte ihre Hand aus, umfasste den Griff und drückte diesen beherzt nach unten.
»Halt, wo wollen Sie hin? Stehenbleiben!« Sie drehte sich nicht mehr um. Hinter ihr ertönte ein dumpfer Knall.
»Himmelherrgott noch mal, blöder Tisch«, hörte Johanna. Der Siegelringträger musste sich den Kopf gestoßen haben. Gut so!
Auf dem breiten, langen Flur war niemand zu sehen. Der Linoleumboden war glatt und spiegelte wie frisch gebohnert. Ein renovierter Altbau, abgehängte Decken, neue Böden, Sprossenfenster mit Gittern … Gitter? Sie hatte keine Ahnung, wer der Mann mit dem Siegelring war, aber er passte zu – sie suchte nach der entsprechenden Assoziation – … diesem renovierten, alten Haus. Sie hielt sich an dem umlaufenden Geländer fest. Ihre Gelenke schmerzten. Johanna konnte sich nicht erinnern, wann sie sich zuletzt so schnell bewegt hatte. Wann sie zuletzt vor etwas hatte davonlaufen müssen. Doch vor allen Dingen wusste sie nicht, wo sie sich befand oder welche Richtung sie einschlagen sollte. Wer hatte sie an diesen Ort gebracht und warum?
»Halt. Frau Wiesner, stehen bleiben!« Die Schritte hinter ihr kamen schnell näher.
In Würde zu altern war ihr größter Wunsch gewesen. Johannas Mann, der vor einigen Jahren verstorben war, konnte sie das letzte Stück des Weges nicht mehr begleiten.
»Solange du denken kannst und die Schmerzen in einem erträglichen Maß bleiben, musst du das Leben genießen, jeden Tag, jede Stunde«, hatte Gustav, Johannas Mann, immer gesagt. Sie hatten sich nie gewünscht, wieder jung zu sein, denn auch das Alter mit seinen Erinnerungen und Erfahrungen hatte seine Vorteile. Doch jetzt, genau in diesem Augenblick, hätte Johanna viel dafür gegeben, wieder laufen zu können wie früher. Davonrennen – warum oder vor was auch immer. Sie schleppte sich Stück für Stück weiter, griff wieder und wieder nach dem Geländer, krallte ihre Finger fest und zog. Sie wollte nicht aufgeben, sie wollte keine Untersuchungen mehr. Johanna ging durch eine offen stehende Glasschiebetür und stand vor einem Aufzug, dessen Türen sich gerade schlossen. Noch ein Schritt, nur noch ein Schritt, bis…
Eine kräftige Hand packte sie grob an der Schulter und zog sie unsanft zurück. Johanna geriet ins Wanken, verlor das Gleichgewicht und fiel nach hinten. Kurz bevor sie auf den Boden schlug, wurde sie aufgefangen. Die starken Hände, die Johanna zurückgerissen hatten, packten sie an den Oberarmen. Sie hatte Schmerzen und spürte jeden einzelnen Finger des Siegelringträgers, der sich tief durch ihre dünne Haut bis auf die verschlissenen Knochen presste. Eine junge Frau rollte eine Liege über den Flur und blieb neben Johanna stehen. Ohne zu zögern, ergriff sie Johannas Beine. Sie wehrte sich, zappelte, konnte einen Arm aus der Umklammerung befreien und schlug um sich.
»Jetzt reichtʼs aber, Frau Wiesner.« Die Frau und der Mann in den weißen Kitteln packten Johannas Gliedmaßen und wuchteten sie unsanft auf die Liege. Ihre Hände und Füße wurden mit Schnallen fixiert. Johanna spürte, wie sich das Blut staute.
»Schwester …« Der glatzköpfige Mann sah die Frau an, die ihm sofort etwas in die Hand drückte. Johanna konnte aus ihrem Blickwinkel nicht genau erkennen, um was es sich handelte, doch als die vermeintliche Krankenschwester Johannas Ärmel nach oben krempelte, wusste sie genau, was ihr bevorstand.
Als Johanna wieder zu sich kam, hielt sie ihre Augen fest geschlossen. Sie wusste, dass sie damit ihre Rückkehr in die Realität nicht verhindern konnte, doch es ging ihr in diesem Moment wie einem kleinen Kind, das sich selbst die Hand vor Augen hält, in der Annahme, nicht gesehen zu werden. Früher hatte Johanna Angst im Dunkeln gehabt, doch jetzt fühlte sie sich eher in Sicherheit, wenn sie der unbekannten Lage nicht direkt ins Auge blicken musste. Ihre Situation war grausamer als der Tod. Gefangen in der eigenen Gedankenwelt, die sie nicht sortieren konnte. Kein Mensch, der Erklärungen lieferte. Sie spürte ihren Körper, den eine plötzliche Kältewelle zittern ließ. Solange ich die Augen geschlossen halte, ist alles gut.Ich heiße Johanna, Johanna …, ich bin 87 Jahre alt und wohne in … Heute ist der …
Es half nichts, sie musste es tun, musste stark sein, um Erklärungen zu finden. Tränen rannen unter ihren geschlossenen Augenlidern hervor und hinterließen eine feuchte Spur auf dem Weg vorbei an ihrem Ohr, um dann in den Haaren zu versickern.
Sie öffnete die Augen und sah … – nichts. Nicht der kleinste Lichtstrahl war zu erkennen. Ist es nun soweit? Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen? Sie zwickte sich in den Arm und spürte dem feinen Schmerz nach – sie war also noch am Leben. Sie hatte sich in den letzten Jahren mit dem Tod auseinandergesetzt, sie wusste, dass er unvermeidbar war und für sie immer näher rückte. Er hatte nichts Abschreckendes oder Grausames. Viel schlimmer war die Situation, in der sie sich momentan befand. Plötzlich schoss ihr ein schrecklicher Gedanke durch den Kopf – lebendig begraben? In einer Kiste, tief unter dem Erdboden. Über ihr nur Geröll, Sand, Erde, Würmer und Käfer. Sie würden sich durch das Holz fressen, langsam auf sie zukriechen und ihren kompletten Körper bedecken. Irgendwann, wenn Johanna qualvoll erstickt war, würden sie zum Angriff übergehen – sich durch ihre Kleidung nagen, sich durch die Haut bohren und in ihrem Inneren festsetzen. Johanna wurde übel.
Fragen über Fragen tauchten wie Seifenblasen in ihrem Kopf auf und zerplatzten unbeantwortet. Wo bin ich? Was ist geschehen? Warum bin ich hier? Die größte Sorge bereitete ihr jedoch die letzte Frage, die sich in ihrem Gehirn festsetzte wie eine Zecke. Warum kann ich nichts sehen? Johanna streckte die Arme nach oben – kein Widerstand. Also keine Kiste. Langsam richtete sie sich auf, glitt mit ihren Fingern über die Unterlage bis zur Kante, setzte sich an den Rand und streckte ihre Füße behutsam nach unten. Unter ihr war nichts als Luft – kein Boden? Ein lautes Stöhnen ganz in ihrer Nähe ließ sie zusammenzucken.
»Hallo, ist da jemand?« Keine Antwort. Sie verharrte eine Zeit lang in dieser Stellung und vermied jegliche Bewegung. Dann hielt sie sich mit beiden Händen gut an der Kante fest, rutschte mit ihrem Gesäß weiter nach vorne, streckte die Beine tiefer und versuchte, den Boden zu ertasten – nichts. Auf der Suche nach einem Lichtschalter drehte und streckte sie sich auf ihrer harten Unterlage, doch ihre Finger griffen immer wieder ins Leere. Ich muss mich erinnern, ermahnte sie sich. In einiger Entfernung konnte sie Schritte hören, die sich langsam in ihre Richtung bewegten. Sie hielt den Atem an, als das Klacken der Schuhsohlen ganz in ihrer Nähe verstummte.
2. Kapitel
Den besten Platz konnte Max immer frühmorgens ergattern, bevor die Läden öffneten. Kaum ein anderer Mitstreiter verließ sein Quartier um diese unchristliche Uhrzeit – schon gar nicht im Winter bei klirrender Kälte. Er schlug den Kragen seines zerschlissenen Wollmantels nach oben und zog den grob gestrickten Schal über Mund und Nase. Um sich warm zu halten, trat er auf einer Stelle hin und her. Die große Narbe an seinem Bein schmerzte – wie immer bei kalten oder wechselnden Temperaturen. Wie Messerstiche bohrte sich die Kälte durch das Fleisch bis auf den Knochen.
»Whiskey, hier.« Der zottelige, große Hund ließ vom Mülleimer ab und trottete zu Max. Sein komplettes Hab und Gut hatte Max wie immer dabei. Er stellte den voluminösen Rucksack an der Ecke des Schaufensters ab. Die Wolldecke, die er aus dem Rucksack zog und auf dem kalten, gepflasterten Boden ausbreitete, war für Whiskey der stumme Befehl, sich hinzulegen.
»Oh, der ist aber süß, was ist denn das für eine Rasse?«, fragte eine Passantin, die in Richtung Haltestelle eilte.
»Ein Lastrami.«
»Tolle Rasse«, rief die Dame und hastete zur Straßenbahn.
Max hörte das tiefe Lachen hinter ihm, drehte sich um und wünschte Björn einen
»Guten Morgen.«
»Seit wann ist denn der graue Zottel ein Rassehund und was ist ein Lastrami?«, lachte Björn weiter.
»Ein reinrassiger Landstraßenmischling«, erklärte Max und kraulte Whiskey hinterm Ohr.
Die mit Lichterketten und ausladenden, roten Sternen geschmückte Innenstadt füllte sich langsam. Immer mehr Passanten drängten in die Fußgängerzone, die Läden öffneten ihre Pforten. Max nahm den Stapel Obdachlosenzeitungen so in die Hände, dass die Vorbeigehenden das Titelblatt sehen konnten, und versuchte, freundlich zu lächeln, auch wenn es ihm schwerfiel. Die Fußgänger waren so mit sich und ihren Weihnachtseinkäufen beschäftigt, dass sie Max keine Beachtung schenkten, geschweige denn eine Zeitung kauften. Ob der Gedanke an Weihnachten in den letzten Jahren verloren gegangen war, der Sinn, den Weihnachten ausmachte, ob Kinder und Jugendliche heute überhaupt noch vermittelt bekamen, dass es nicht nur um materielle Dinge ging, konnte Max nicht beantworten. Aber die Mimik der Vorbeihastenden sprach Bände. Sie waren bestimmt damit beschäftigt, welche Krawatte nun besser zu Opas Anzug passen würde, oder ob Oma, die sie zwangsweise zwei Mal im Jahr im Seniorenheim besuchten, auch noch ein paar Hundert Euro zuschießen würde für das neue IPad ihres Sprösslings. Doch die Mitmenschen, die genau vor ihrer Nase standen, wurden nicht beachtet, urteilte Max und schüttelte den Kopf.
Später kam Björn, der sein Glück bereits eine Stunde auf dem Münsterplatz versucht hatte, mit zwei dampfenden Bechern in den Händen zurück.
»Eine ältere Dame hat mir fünf Euro geschenkt. Hab dann gleich mal den Umsatz im Coffeeshop gesteigert. Hier.«
»Danke.« Max nahm den Becher entgegen und wärmte seine Hände daran, bevor er einen vorsichtigen Schluck trank.
»Harry und Sven sind wieder nicht erschienen, denen ist es bestimmt zu kalt, und wir sind die Deppen und machen die ganze Arbeit.« Björn stellte seinen Kaffeebecher auf den Boden, zog einen Kosmetikspiegel aus der Tasche seiner karierten Jacke und zupfte sich die roten Stoppelhaare zurecht.
»Eventuell sind sie über den Winter in Richtung Süden aufgebrochen«, erklärte Max.
»Ich kenne sie seit Jahren, die haben Freiburg noch nie verlassen.« Björn kramte einen blauen Tiegel aus der anderen Tasche und begann, sich Creme in das sommersprossige Gesicht zu tupfen. Max hatte sich Björn vor sechs Monaten angeschlossen und kannte mittlerweile seine Marotten. Björn hatte ihm gezeigt, wie man auf der Straße überlebte, wo sie sich, auch ohne Geld, Nahrungsmittel beschaffen konnten, und vor allen Dingen, wo Max ein warmes Plätzchen für sich und Whiskey zum Übernachten fand. Obdachlose, sie nannten sich selbst Berber, hatte ihm Björn erklärt, waren eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie kannten sich untereinander, und ein Neuer fiel sofort auf. Diesem wurde mit Skepsis begegnet, denn er konnte ja die Stammplätze der Flaschensammler, Nahrungsbeschaffer oder Bettler gefährden. Max hatte Glück, dass Björn ihn als Neuling gleich akzeptiert hatte und seither immer an seiner Seite war.
Ein älterer Herr in einer dicken Steppjacke rutschte auf dem glatten Boden aus und verlor das Gleichgewicht. Max ließ seinen Becher fallen, sprang dem Mann mit zwei großen Schritten entgegen und konnte ihn gerade noch davor bewahren, in eines der Freiburger Bächle zu stolpern, die durch die gesamte Innenstadt flossen.
»Danke«, sagte der ältere Herr, dem die Pudelmütze über die Hornbrille gerutscht war, und schob diese wieder in Position. Die schnelle Bewegung hatte einen bohrenden Schmerz durch Maxʼ Bein gejagt, der nur zögernd abklang. Leise fluchend humpelte er zu seinem Stehplatz vor dem weihnachtlich dekorierten Schaufenster und stützte sich an Björns Schulter ab.
»Danke«, wiederholte der Mann. »Haben Sie sich verletzt?«
»Nein, das ist eine alte Verletzung, die mir immer wieder zu schaffen macht.«
»Mein Name ist Hermann, Doktor Hermann.« Er streckte Max seine Hand zur Begrüßung entgegen. »Soll ich mir Ihr Bein mal ansehen? Ich bin Arzt.«
»Nein danke, geht schon wieder. Ich heiße Max Thum. Hallo.« Max erwiderte den kräftigen Händedruck.
»Die Kälte trägt nicht gerade zur Schmerzlinderung bei. Gehen Sie doch in die Notschlafstelle, dort können Sie sich bei diesen Temperaturen auch tagsüber aufhalten.« Er wies auf Whiskey, der eingerollt auf der Decke lag. »Es gibt sogar Plätze für Menschen mit Hund …« Dr. Hermann zog ein Taschentuch aus seinem Lederkoffer und schnäuzte sich die Nase.
»Wenn Sie morgen in der Notfallstelle sind, dann kann ich Sie untersuchen. Ich biete einmal die Woche eine Sprechstunde für Wohnsitzlose an.«
Max zuckte mit den Schultern.
»Hey Doc, ich hab da auch etwas, was Sie sich unbedingt ansehen sollten, also, ähm … das ist sehr unschön«, mischte sich Björn ein und zeigte auf sein Hinterteil.
»Wir sehen uns dann morgen«, verabschiedete sich Doktor Hermann und legte zehn Euro auf die Hundedecke.
»Was hast du denn Unschönes?«, fragte Max.
»Das ist nicht so einfach zu erklären … egal, Großer, wir hören jetzt auf den Doc und machen uns auf den Weg ins Asyl.«
Bisher hatten sie in einer Hütte in der Kleingartensiedlung übernachtet, doch die Holzverschläge waren nicht isoliert und der Wetterbericht verhieß für die kommende Nacht nichts Gutes. Alles war besser, als zu erfrieren, und so nahmen sie das Angebot von Dr. Hermann an.
»Einer nach dem anderen, das wisst ihr doch.« Olga, die Leiterin, stand in der Tür. Sie strich sich eine graue Haarsträhne aus der Stirn, die aus ihrem langen Zopf herausgerutscht war. Max schulterte seinen Rucksack und stolperte Olga fast in die Arme, als die anderen Herren unsanft an ihm vorbei drängten.
»Langsam, junger Mann, ich weiß auch so, dass du mir dankbar bist. Du musst mir nicht gleich um den Hals fallen«, lachte Olga und ging einen Schritt zur Seite. Sie knöpfte ihre grob gestrickte Jacke mit den braunen Hornknöpfen zu, ging hinter eine ausladende Theke und goss den Ankömmlingen eine Tasse heißen Tee ein. Erst als sie unter der grellen, von der Decke herabhängenden Lampe stand, konnte man die Fältchen um Mund und Augen herum erkennen. Sie hatte ein ständiges Lächeln auf den Lippen und wirkte auf Max freundlich und warmherzig.
»Die Hundezimmer sind belegt, tut mir leid.« Whiskey sah zu Max auf, als hätte er verstanden, dass es um ihn ging.
»Sie können bleiben, aber ohne Hund.«
Max zog sich den zerschlissenen, grauen Mantel wieder an, und als er gerade im Begriff war, seinen Rucksack zu schultern, mischte sich ein Beobachter der Szene ein.
»Mensch, Olga, lass mal stecken. Die zwei können in meinem Zimmer pennen, da ist noch ein Bett frei, und von uns hat keiner was gegen Hunde.«
»Das ist aber nicht gestattet …«, Olga überlegte »… und wenn, dann müssen die anderen Mitbewohner auch damit einverstanden sein.«
3. Kapitel
Der Weg war nicht geräumt, lediglich einige frische Fahrradspuren wiesen darauf hin, dass sie sich nicht alleine an dem zugefrorenen Flüsschen aufhielten. Ihre Schuhe versanken knirschend im Schnee, und Björn machte nicht den Eindruck, als würde er den abendlichen Spaziergang an der Dreisam genießen.
»Warum erzählst du mir eigentlich nie etwas aus deinem früheren Leben?«, fragte Björn, bückte sich und warf einen Stock, dem Whiskey hinterher hechtete.
»Ich rede nicht gern über mich.« Es würde dir nichts bringen, wenn ich über die Einsätze in Afghanistan berichte oder von meiner Frau … Ich kann es ja selbst nicht glauben, geschweige denn verarbeiten. Max wurde heiß, trotz der klirrenden Kälte bildete sich Schweiß auf seiner Stirn. Wie bei einem DVD-Player, dessen Abspieltaste gedrückt wurde, waren die grausamen Bilder in seinem Kopf. Bilder, die er vergessen wollte und die er ausgeblendet hatte.
»Aber mir kannst du doch … Ist dir nicht gut?« Björn sah ihn fragend an.
»Alles okay.« Max zwang sich, an etwas Schönes zu denken. Nur ein einziger glücklicher Gedanke, doch ihm wollte keiner einfallen.
»Lass uns umkehren. Es ist saukalt und ich will ins warme Bett.«
Olga drückte Max eine dicke Decke in die Hand und zeigte ihm sein Nachtlager. Ein übersichtliches Zimmer, in dem drei Stockbetten standen. Max musste unweigerlich an die Bundeswehr denken. Spartanisch, aber im Vergleich zur Straße warm und weich.
»Du musst deine Füße wohl über die Kante strecken, auf deine Körpergröße sind wir nicht eingerichtet.« Olga wies auf das obere Bett, zeigte ihm eine Waschgelegenheit – ein kleines Waschbecken in der Ecke – und verabschiedete sich. Es dauerte nicht lange, und die fünf Zimmergenossen hatten ihr Lager in Beschlag genommen. Björn, dem ein Schlafplatz im Zimmer neben Max zugewiesen worden war, kam herein, kraulte Whiskey und ging dann an das Waschbecken. Er klatschte sich einige Hände voll Wasser ins Gesicht, kämmte die Stoppelhaare und cremte sich ein.
»Was bist du denn für einer? Vom anderen Ufer, was? Komm mir bloß nicht zu nahe«, grunzte der übergewichtige Zimmergenosse, der sich auf dem Bett gegenüber des Waschbeckens breitgemacht hatte.
»Ich achte nur auf mein Äußeres, das könnte dir auch nicht schaden«, pfefferte Björn zurück. Der Bauchträger holte eine Flasche raus, die er ins Asyl geschmuggelt haben musste, und kippte einen Schluck Schnaps in seine Kehle. Dann stand er auf und ging zu Björn. Nebeneinander wirkten die beiden wie Pat und Patachon, nur dass Patachons Frisur eher der von Pumuckl glich, dachte Max.
»Wie hast du das gemeint, Kleiner?«, fauchte der Dicke, griff nach dem Kragen von Björns Pullover und zog ihn zu sich heran. Sofort verwarf Max die Gedanken an die Stummfilmstars und rutschte an die Bettkante.
»So nicht, ähm, Entschuldigung«, stammelte der Rothaarige. Im gleichen Moment, als »Pat« die Faust erhob, um seinem Missfallen auch handfeste Argumente folgen zu lassen, stand Max hinter ihm und hielt seinen Arm fest.
»Lass gut sein und geh wieder ins Bett.« Obwohl der korpulente Mitbewohner nicht klein war, überragte Max auch ihn um einen halben Kopf. Durch das eng anliegende, weiße T-Shirt zeichneten sich seine Muskeln ab und schienen bei dem Krawallbruder den gewollten Eindruck zu hinterlassen.
»Ist ja gut, da haste noch mal Glück gehabt, Kleiner«, knurrte der Mitbewohner, trottete wieder zu seinem Bett und setzte die Flasche mit dem hochprozentigen Inhalt an. Björn stand vor Max und zuckte mit den Schultern.
»Danke«, war das Einzige, was er über die Lippen brachte.
In dieser Nacht war an Schlaf kaum zu denken. Immer wieder wurde Max von Geräuschen auf dem Flur geweckt. Ein tiefes Murmeln, Klappern und etwas, das sich anhörte wie ein großer, schwerer Rucksack, der achtlos in die Ecke geworfen wurde. Ob er aufstehen sollte – nachsehen? Nein, lieber nicht. Es handelte sich bestimmt nur um einige Berber, die auf der Suche nach ihren Betten über den Flur stolperten. Er war es nicht mehr gewohnt, mit mehreren Personen unter einem Dach zu nächtigen. Whiskey war unruhig, lief im Zimmer auf und ab und winselte.
»Psst, schlafen«, flüsterte Max ihm zu. Die Armbanduhr zeigte drei Uhr. Er drehte sich auf der harten Matratze um, zog die Decke bis zu den Ohren und döste ein.
»Der größte Schmerz, den ein Mensch ertragen muss, ist nicht körperlichen Ursprungs. Wunden können heilen und Schmerzmittel das Leiden auf ein erträgliches Maß reduzieren. Wenn die Seele eines Menschen angegriffen und zerquetscht wird wie eine faule Apfelsine, dann gibt es dagegen kein Medikament, kein heilendes Mittel, keine tröstenden Worte oder Berührungen«, hörte Max die imaginäre Stimme. Er sah seine Schwester, die sich tränengeschüttelt über den leblosen Körper beugte. »Der Boden öffnet sich und zieht dich hinab in die Dunkelheit, in eine völlige Leere ohne Halt. Der Verlust eines geliebten Menschen schnürt dir die Seele ab und zerschneidet sie in kleinste Stücke. Die krampfartigen Schmerzen schnüren dir die Kehle zu. Zeit heilt alle Wunden? Nein. Du lernst nur irgendwann, mit dem Schmerz zu leben, er ist da – allgegenwärtig.« Schweißgebadet wachte Max auf.
»Sie haben die Konstitution eines Leistungssportlers, also, wenn ich nicht wüsste, dass Sie auf der Straße leben … doch woher haben Sie die große Narbe an Ihrem Oberschenkel?«
Dr. Hermann, der einen Arztkittel und Einweghandschuhe übergezogen hatte, schob seine schwere Hornbrille auf die Nasenwurzel zurück und betrachtete Maxʼ Narbe etwas genauer.
»Das stammt von einer Granate. Es befindet sich immer noch ein Splitter im Bein. Der kann nicht entfernt werden, da er sich zu nah an der Arterie befindet. Ich war Soldat bei der Bundeswehr und wurde im Einsatz in Afghanistan verwundet.«
»Und warum leben Sie auf der Straße?« Der Arzt wandte sich seinen Notizen zu, und Max begann sich wieder anzuziehen
»Das ist eine lange Geschichte.«
»Haben Sie keine Familie?«
»Nicht mehr.«
»Möchten Sie mir davon erzählen?«
»Jetzt nicht, Doc. Ich suche meinen Kumpel Björn, war er schon bei Ihnen?«
»Nein, Sie sind heute Morgen der Erste. Eventuell lässt er sich noch das Frühstück schmecken.« Der Arzt kramte in seinem Koffer, nahm eine Schachtel Tabletten und eine Tube heraus und reichte sie Max.
»Zweimal täglich eine Tablette, und hiermit reiben Sie die Narbe dreimal täglich ein, das lindert die Schmerzen.«
»Danke, Dr. Hermann.«
Björn war nicht zu finden, weder im Frühstücksraum noch in seinem Zimmer. Wenn er das Obdachlosenasyl verlassen hätte, dann doch nicht ohne ein Wort des Abschieds – oder? Nach dem morgendlichen Spaziergang mit Whiskey, auf dem Max alle ihm bekannten Orte aufsuchte, an denen Björn sich möglicherweise aufhalten konnte, ging er zurück ins Asyl. Er fragte unter den anderen Berbern herum, bekam aber nur spitzfindige Sprüche zu hören. »Seid ihr schon so dicke, dass er sich abmelden muss?« – »Mein Gott, der muss halt auch mal was alleine erledigen, schon Sehnsucht?« Max beschloss abzuwarten. Es konnte auch möglich sein, dass Björn einfach keine Zeit gehabt hatte, sich zu verabschieden, weil er einem Freund hatte helfen müssen. Max kannte den Rothaarigen als freundlichen, hilfsbereiten Mann – gut, Björn hatte seine Macken, aber wer hatte die nicht? Da die Kältewelle anhielt und Max nicht zur völligen Untätigkeit verdammt sein wollte, beschloss er, Olga in der Küche zu helfen.
»Der Hund bleibt draußen!« Max führte Whiskey zurück in den spärlich eingerichteten Aufenthaltsraum und zeigte ihm die flache, ausgestreckte Hand, woraufhin sich der graue Zottel ohne Murren in die Ecke legte.
»Wenn ich schon mal einen starken Mann als Küchenhilfe habe, muss ich das ausnutzen. Kannst du bitte die Getränkekisten in den Keller bringen?« Olga deutete auf das Leergut in der Küchenecke und drückte Max einen Schlüssel in die Hand.
Bepackt mit drei übereinandergestapelten Getränkekisten, stieg Max vorsichtig die schmalen Stufen hinunter in das Kellergewölbe.
---ENDE DER LESEPROBE---