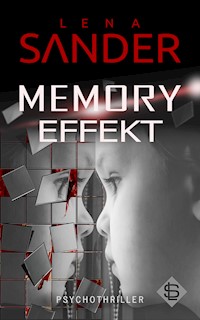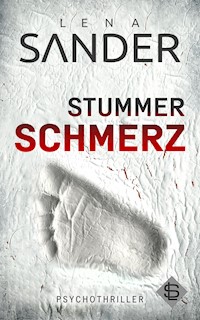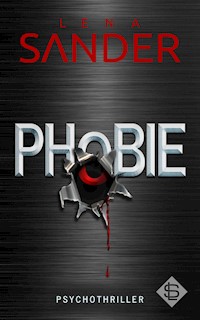Memory Effekt
Psychothriller
Lena Sander
Impressum © 2015 Lena Sander
Alle Rechte vorbehalten
Lena Sander
c/o autorenglück.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
Die Tatsachen, die diesem Buch zugrunde liegen, werden im Nachwort erläutert. Alle weiteren Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.
Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.
Ausgabe Dezember 2015
Lektorat: Susanne Pavlovic www.textehexe.com
Korrektorat: Anke Höhl-Kayser www.hoehl-kayser.de
Coverdesign: BreisgauART
Bildnachweis:
stockadobe – www.stockadobe.com
Newsletter-Anmeldung:
www.lena-sander.de/newsletter.htm
Internet: www.lena-sander.de
Über die Autorin
Lena Sander
Die Thriller-Autorin Lena Sander lebt in Freiburg, am Fuße des Schwarzwalds. Das Schreiben war für sie zunächst ein Ausgleich während des trockenen Marketingstudiums, ließ sie danach aber nicht mehr los.
Die Grundthemen ihrer Psychothriller beruhen immer auf Tatsachen. Das Markenzeichen ihrer Bücher ist, die raffinierte Verknüpfung von Realität und Fiktion zu spannungsgeladenen Storys. Während die plastisch beschriebenen Szenarien ihrer Psychothriller schockieren, wirken die tieferliegenden Botschaften noch lange in der Seele nach.
Über dieses Buch
Zwei Leben - zwei Frauen - ein Komplott?
Kaum ihrer Ehehölle entkommen, entdeckt Mia in der Zeitung ihre eigene Todesanzeige. Ein genialer Schachzug ihres brutalen Ehemannes - oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Je näher sie der Wahrheit kommt, desto grausamer wird sie von der Vergangenheit eingeholt.
Das Leben der Psychiaterin Linda gerät aus den Fugen, als ihr Mann schwer verunglückt. Gleichzeitig sieht sie sich von Unbekannten bedroht. Welches Geheimnis hat Lindas Mann mit ins Koma genommen?
Auf welche fatale Weise sind die Schicksale der beiden Frauen miteinander verbunden?
Memory-Effekt: ein intelligent angelegter Psychothriller, dessen Tatsachen unter die Haut gehen.
Contents
Title Page
Impressum © 2015 Lena Sander
Über die Autorin
Über dieses Buch
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Kontakt zur Autorin
Prolog
Der Regen sammelte sich zu kleinen Pfützen auf dem unebenen Stahlträger. Sie sah einen Käfer, der ins Wasser gefallen war und verzweifelt versuchte, sich auf einen Schraubenkopf zu retten. Er strampelte. Sie hielt sich mit einer Hand an der Querverstrebung der Autobahnbrücke fest und beugte sich nach unten.
»Um Himmels willen, bleiben Sie stehen!« Die Stimmen drangen wie in Watte gepackt an ihr Ohr. Sie ruhte in sich. Hatte mit ihrem Leben abgeschlossen.
Worte konnten geduldig sein. Man konnte mit ihnen spielen. Sie beliebig aneinanderreihen und durcheinanderwürfeln. Sie dienten zur Kommunikation, doch gleichermaßen als Waffe. Jedes einzelne Wort konnte tief in die Seele dringen. Die Zunge war wie eine geschärfte Klinge und stach unerbittlich zu. Man konnte Menschen lenken und manipulieren, sie quälen und zerstören. Worte, sie waren die grausamste Folter.
Wie lange es wohl dauern würde, bis ihr Körper die Wasseroberfläche erreicht hätte? Ob der Aufprall zum sofortigen Tod führen würde? Was, wenn sie sich während des Sprungs anders entschied? Würde ihr die Zeit bleiben, um zu bereuen? »Es gibt immer eine Alternative.« Gab es einen anderen Ausweg, eine Lösung? Nein.
Vorsichtig nahm sie den Käfer auf und betrachtete ihn. Ein Insekt, ein Lebewesen, ein Geschöpf Gottes. Er kämpfte und würde niemals aufgeben. Vor einiger Zeit war sie noch wie dieses kleine Insekt gewesen, das sich gerade auf ihrer Hand trocken putzte. Sie hatte gekämpft und gestrampelt bis zur völligen Erschöpfung. War an unsichtbaren Mauern abgeprallt, immer wieder zu Boden gerissen worden. Ihre Seele war zerquetscht und ausgepresst worden wie eine reife Zitrone. Schon lange hatte sie den Boden unter ihren Füßen verloren. Kein Halt, kein Schraubenkopf, auf den sie sich hätte retten können.
Schwerelos. Einfach fallen lassen – loslassen. Alle Sorgen und Probleme, die an ihr hafteten, würden sich Stück für Stück von ihr trennen und zerplatzen wie Seifenblasen, sie würden zu bedeutungslosen Überbleibseln zerfallen und der Fluss würde sie davontragen. Die Lichter der Kranken- und Polizeiwagen spiegelten sich in dem dunklen, müden Nass. Ein Schritt. Nur ein Schritt trennte sie von der ewigen Ruhe, nach der sie sich sehnte.
Gleich würde sie es wissen. Loslassen, fallen lassen. Der Käfer klappte seine Flügel auf und wieder zu. Sie schimmerten in dem blinkenden Licht. Er schien sie anzustarren, dankbar für seine Rettung. Sie führte die Hand zu ihrem Mund und hauchte ihn an. Wieder klappte er die Flügel auf. Und als wolle er ihr zurufen: »Komm«, hob er ab und flog davon. Sie ließ den Stahlträger los …
1. Kapitel
Juli 2014 – Der stille Schrei
Das Geräusch musste von ihr selbst stammen. Jedes Mal, wenn sie ausatmete, hörte sie dieses Zischen, begleitet von einem Pfeifen. Obwohl ausreichend Sauerstoff zur Verfügung stand – sie hatte schließlich gerade gelüftet – konnte sie kaum die Luft in ihre Lungen ziehen. Die Schmerzen waren so durchdringend, dass sie sich nicht auf Belanglosigkeiten wie ihre Atmung konzentrieren konnte. Er rammte seine Faust mit geballter Kraft in ihren Unterleib. Ein Gefühl, als würden ihre Organe zerquetscht und gewaltsam verschoben. Noch vor einer Stunde war sie so voller Hoffnung gewesen – Hoffnung darauf, dass es besser werden würde. Deshalb war sie auf diese Reaktion nicht gefasst gewesen – diesmal nicht.
»Du bist eine Schlampe, mein Schatz«, flüsterte er und zerrte sie an ihren Haaren über die Papierschnipsel, die er zuvor aus dem Ultraschallbild fabriziert hatte. Er packte sie an ihren Oberarmen. Seine Finger pressten sich wie Schraubzwingen tief in ihr Fleisch.
»Sieh mir in die Augen, wenn ich mit dir spreche, du Hure!« Er hob sie an und stellte sie wieder auf ihre zitternden Beine. Noch bevor sie ihre Arme zur Abwehr erheben konnte, trat er zu. Der Stiefel bohrte sich in ihren Bauch. Sie knallte mit ihrem Rücken und dem Hinterkopf an die Wand. Schmerzen, sie hatte schon so viele ertragen müssen, doch was sie jetzt verspürte, hielt keinem Vergleich stand. Als hätte er mit diesem Tritt ihr Ungeborenes in einen Feuerball verwandelt, der sie von innen zu verbrennen drohte. Oh Gott, hilf, hilf meinem Baby. Ihre Beine gaben nach. Den Rücken an die Wand gelehnt, rutschte sie in die Hocke.
Sie hoffte darauf, dass seine Tritte dem Baby nichts anhaben konnten, hoffte darauf, dass ihr Körper es abschirmen würde und ihre Gebärmutter stark genug war, um es zu beschützen. Doch diese Hoffnung schwand, als sie die warme Flüssigkeit spürte, die an ihren Schenkeln herablief. Eine Blutung im dritten Monat kann schon mal vorkommen, die muss nichts bedeuten, noch nichts bedeuten. Bestimmt. Gott lässt es nicht zu, das kannst du nicht, Gott, du bist barmherzig. Auch wenn ich bis heute nicht so recht an dich geglaubt habe, aber wenn du existierst, dann kannst du es nicht zulassen, hörst du? Das Ultraschallbild setzte sich vor ihren Augen wieder zusammen. Festhalten, diesen einen glücklichen Moment, in dem sie das Bild zum ersten Mal gesehen hatte. Als die Hoffnung in ihr keimte, dass sich alles ändern würde. Diese Hoffnung, die ihre Gebärmutter jetzt abstieß und zerfetzte, so wie er es mit dem Ultraschallbild getan hatte.
Sie sah ihn wie ein Gespenst, unwirklich und doch wahrnehmbar, wie er den Telefonhörer in die Hand nahm, wie er die Tasten drückte und danach in der Küche verschwand.
»Ja, gestürzt, im Treppenhaus … schwanger«, konnte sie hören. Natürlich würde er seinen Kollegen vom ärztlichen Notdienst niemals erzählen, dass die Stufen verblüffende Ähnlichkeit mit seinen Stiefeln gehabt hatten. Sein Wort war Gesetz. Keiner würde ihm widersprechen oder an seinen Schilderungen zweifeln. Keiner wäre so dumm und würde seine Äußerungen hinterfragen. Warum auch, er war der angesehene Arzt, eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Der Inhaber einer aufstrebenden Privatpraxis. Der Mediziner, der an unzähligen Wochenenden freiwillig den Dienst als Notarzt übernahm und sich rührend um seine – wie er es nannte – psychisch kranke Frau kümmerte.
»Natürlich habe ich die Erstversorgung bereits durchgeführt, was denken Sie denn?« Oh ja, das hast du, die Erstversorgung. Sie ließ von ihrem Bauch ab und spreizte ihre angewinkelten Beine. Das Blut hatte ihre Jeans bereits durchnässt und tropfte auf den Boden. Sie fuhr mit dem Zeigefinger hindurch. Warm. Bitte, gütiger Gott, ich habe dich noch nie um etwas gebeten, bitte lass es nicht geschehen. Im gleichen Augenblick veränderte sich der Schmerz. Krämpfe durchzogen ihren Bauch. Sie umklammerte die Knie und krümmte sich. Die Faust, die sie zuerst getroffen hatte, quetschte jetzt ihr Innerstes aus ihr heraus. Sie biss sich auf die Lippen und konnte ein Stöhnen nicht unterdrücken. Sie wusste, dass sie nicht schreien durfte. Schreie würden die Situation verschlimmern.
Du rufst nach mehr? Du willst eine Zugabe? Dann lass mich dich berühren, ganz sanft.
»Quatschen Sie nicht so lange, das können wir vor Ort klären.« Das Gespenst hantierte in der Küche. Die Kühlschranktür knallte zu, und kurz darauf konnte sie das wohlbekannte Geräusch des Kronkorkens hören.
»So eine Sauerei«, fauchte er, trat mit der Bierflasche in der Hand ins Wohnzimmer und kam einige Schritte auf sie zu.
»Wie willst du diese Scheiß-Blutflecken jemals wieder vom Parkett entfernen?« Sie zuckte zusammen. Gleich berührt er mich. Ganz sanft.
Er stellte die Flasche auf den Boden. Beugte sich zu ihr, hob sie hoch und trug sie zum Sofa. Danach sammelte er die Schnipsel des Ultraschallbildes ein und legte sie vor ihr auf den Tisch. Mit seinem Taschentuch wischte er notdürftig das Blut vom Boden, dann schob er den Hocker über den Fleck. Sie griff nach dem größten Schnipsel des Ultraschallbildes und presste ihn fest in ihrer Faust zusammen. Die Papierfetzen waren noch immer mit einem Hoffnungsschimmer behaftet. Auch wenn ihr Verstand das Gegenteil suggerierte. Der Schnipsel war wie ein Anker, an dem sie sich festhalten – nein, festkrallen wollte. So, wie man Papier zusammenkleben konnte, konnte man bestimmt auch ihr Baby reparieren. Reparieren, das war einer seiner Ausdrücke. Kein Problem. Wenn ich etwas bei dir kaputtmache, dann kann ich es ja wieder reparieren. Jetzt würde sie alles dafür geben, wenn er es wieder reparieren könnte.
»Was macht denn das für einen Eindruck, wenn die Kollegen gleich eintreffen und hier sieht es aus wie bei den Hartz IV-Müllers von nebenan?« Er starrte sie wütend an, als sie nach dem nächsten Schnipsel auf dem Tisch griff. Sie erwiderte seinen Blick für eine Sekunde. Den Mut, sich ihm entgegenzustellen, hätte sie nicht aufgebracht – auch nicht die Kraft.
»Sieh mich nicht so an. Du bist selbst schuld, wenn du das Baby verlierst. Das ist jetzt dein Problem«, fauchte er sie an und versuchte, ihre Hand zu öffnen.
Es war immer ihr Problem. Ob sie den falschen Fernsehsender eingestellt hatte, das blöde Buch las, den Knopf an seinem Arztkittel nicht fest genug nähte oder das Essen nicht rechtzeitig auf den Tisch brachte – ihr Problem. Ob sie nun schwanger war oder nicht. Sie hätte auch einfach ein Ei in der Küche fallen lassen können. Es war der Stress. Er hatte es nicht leicht mit seinen Wochenend-Schichten. Komm her, Schatz, ich will dich berühren, ganz sanft. Sie wollte nicht loslassen und presste ihre Finger noch enger zusammen. Du Arschloch, du verdammtes Arschloch. Mit der unbändigen Wut kam auch eine neue Welle der Krämpfe. Sie drehte sich zur Seite und kauerte sich zusammen. Doch diesmal ließen die Schmerzen nicht nach. Eine Armee von Soldaten, bis an die Zähne bewaffnet, marschierte durch ihren Unterleib. Granaten explodierten und Bomben zerfetzten ihre Gebärmutter. Eine Armee, die keinen Waffenstillstand kannte. Sie konnte das Leid und den Schmerz nicht mehr in sich hineinfressen und schrie – laut, zu laut. Nun ist es so weit. Er wird mich berühren, ganz sanft. So sanft, dass ich es diesmal nicht überleben werde. Aber es ist mir egal. Dann gehe ich dahin, wo mein Baby gleich sein wird. Dahin, wo mich niemand mehr ganz sanft berühren wird …
Sie musste das Bewusstsein verloren haben. Vor einiger Zeit hatte sie in einem Buch gelesen, dass Bewusstlosigkeit bei extremen Schmerzen eine körpereigene Schutzfunktion war. In einem dieser nutzlosen Bücher, wie er sich ausdrückte.
»Es tut mir leid, wir konnten den Abort nicht verhindern.« Sie hörte den fremden Arzt, doch eine Antwort blieb sie ihm schuldig.
»Haben Sie mich verstanden, junge Frau?« Sie starrte an die weiß getünchte Decke des Krankenhauszimmers. Schon seit sie denken konnte, hatte sie diese zwei Stimmen in sich vereint. Die Bauchstimme, die ihre Gefühle ausdrückte. Doch die zweite Stimme war die der Vernunft, die der praktischen und logischen Denkerin – der Realistin. Sie nannte diese Stimme Miss Logik.
»Ich injiziere Ihnen ein Beruhigungsmittel und etwas gegen Ihre Schmerzen. Ruhen Sie sich aus. Wir unterhalten uns morgen.« Miss Logik: »Sag es ihm, diesem fremden Arzt. Schrei es aus dir heraus, dann hilft er dir, dieser Hölle zu entkommen, das ist deine Chance. Los jetzt!« Der Arzt drehte sich um, sah ihr in die Augen und schloss die Tür hinter sich.
Seit Jahren war sie eine Gefangene in ihrer eigenen Wohnung. Sie saß unter einer muffigen, gläsernen Käseglocke. Hinter dem Glas tobte das Leben. Junge Menschen, die lachend an ihrem Fenster vorbeischlenderten, und die Nachbarn, die täglich ihren Hund spazieren führten. Sie beobachtete ältere Personen, die sich auf ihren Rollator stützten und nur langsam vorankamen, aber auch Kinder, die sich auf dem Schulweg zu immer größeren Gruppen zusammenschlossen. Kinder … Und sie saß abgeschirmt unter ihrer stinkenden Glaskuppel. Manchmal durfte sie den Deckel heben und ihr Gefängnis verlassen. Die Zeit war begrenzt und die Kontrollanrufe auf ihrem Handy erfolgten punktgenau. Wäre sie nur eine Minute zu spät vom Einkaufen zurückgekommen, hätte sie etwas vergessen oder zu viel ausgegeben, hätte er sie berührt, ganz sanft. Um diese Situation zu vermeiden, gehorchte sie wie befohlen. Acht Jahre lang saß sie abgeschirmt unter der Käseglocke und wartete darauf, bis er es endlich geschafft hatte. Bis er es vollbracht hatte, Stück für Stück ihrer selbst abzutrennen. Sie sah ihn vor sich, wie er mit dem Käsemesser ganz sanft durch den Schmelz glitt, Scheibe für Scheibe abschnitt, hinein biss und sich nach diesem Genuss die Finger einzeln ableckte.
Sie wusste genau, wann dieses Martyrium seinen Anfang genommen hatte, wusste auch den Grund dafür. Sie war schuld. Immer, wenn er sie berühren wollte, ganz sanft, war es ihre Schuld. Wenn sie vergessen hatte, seine Zigaretten einzukaufen, dann wurde sie gebrandmarkt. Musste die Verbrennungen als Konsequenz tragen, als Mahnmal. Nein, musst du nicht! Sie konnte sich niemandem anvertrauen. Diese Schmach hätte sie nicht ertragen. Dann waren die psychischen und physischen Qualen, die er ihr zufügte, bestimmt das kleinere Übel.
2. Kapitel
Februar 2015 – Das Sanatorium
Die Erinnerungen verfolgten sie und wollten sich auch nicht abschütteln lassen. Was sagte die Therapeutin? Es braucht Zeit, viel Zeit ...
Sie öffnete den Mund, in dem sich noch der letzte Bissen ihres Frühstücksbrötchens befand, um ihrer Tischnachbarin die Antwort auf deren Frage: »Und warum sind Sie hier, im Sanatorium?« zu geben. Dazu kam sie nicht mehr. Der Bissen blieb ihr im Hals stecken. Auch die nächste Frage: »Ist Ihnen nicht gut?«, konnte sie nicht einmal mit einer Geste beantworten. Sie hustete und rang nach Luft. Mit zittriger Hand versuchte sie, ihre Kaffeetasse zurück auf den Unterteller zu stellen. Die Tasse entglitt und zersprang auf dem Boden in unzählige Scherben.
»Kein Problem«, sagte James, ein Mitarbeiter des Sanatoriums, beruhigend. »Ich hole etwas zum Aufwischen.« Er, der gute Geist des Hauses, James, wie er sich selbst zu nennen pflegte. Keiner kannte seinen richtigen Namen. Wenn er danach gefragt wurde, winkte er ab, zwinkerte und sagte: »Der beste Butler heißt immer James.« Der groß gewachsene, schlaksige Kerl kümmerte sich um viele Belange der Kurgäste. Tatsächlich wie ein guter Butler, der wusste, was seine Gäste gerade benötigten. Sie hatte sich schon oft gefragt, ob James kein Zuhause hatte. Sie hatte den Eindruck, dass er immer gerade dann anzutreffen war, wenn man ihn brauchte,nicht nur in dem barocken Speisesaal, dessen Spiegelwände jedem vorgaukelten, dass der Raum um ein Vielfaches größer sei.
»Haben Sie sich verbrüht, gnäʼ Frau, kann ich Ihnen behilflich sein?« Sie fuhr auf ihrem Stuhl herum. James schüttelte eine gefaltete Serviette auf und legte sie ihr auf die durchnässte Hose.
»Danke.« Aus dieser Nähe waren seine tiefen Pockennarben gut erkennbar und die frische Schnittwunde, die er sich bei seiner morgendlichen Nassrasur zugezogen haben musste.
»Benötigen Sie die noch?«, war die nächste Frage von James. Er zeigte auf die Tageszeitung ihres Tischnachbarn, die mit Kaffee befleckt war. Ein Schwall seines Rasierwassers zog in ihre Nase – Tabac. Sie hustete erneut, konnte nicht antworten und klatschte ihre Hand mitten auf das nasse Papier.
Es gab viele Gründe, warum sie sich in diesem Sanatorium befand. Hier, in diesem alten Haus, dessen Innenarchitekt ein Verwandter König Ludwigs des Sechzehnten gewesen sein musste. War sie doch heute Morgen von ihrem Tischnachbarn, Herrn Silberkron, der sie gerade schockiert ansah, auf Mitte dreißig geschätzt worden. So rechtfertigte anscheinend allein schon ihr Aussehen diese Kur.
»Ich hätte Ihnen die Zeitung auch so gegeben, junge Frau. Die ist eh schon einige Tage alt. Sie hätten sie nicht extra mit Kaffee tränken müssen.« Herr Silberkron lächelte, schüttelte die letzten Tropfen ab und reichte ihr das nasse Papier.
Ein Trugbild. Das, was sie zuvor nur aus dem Augenwinkel hatte erkennen können, war bestimmt eine Täuschung – ganz sicher. Sie nahm die Zeitung in die Hand, schlug sie auf und starrte wie paralysiert auf die Anzeige:
Plötzlich wurde die Welt um sie herum aus den Angeln gehoben. Es fühlte sich an, als stünde sie auf einer Hängebrücke. Den tiefen Abgrund vor Augen, dünne Seile, die kaum einen Halt boten, und morsche Holzplanken, die beim nächsten Schritt nachgeben und ihr den Weg in die Tiefe eröffnen würden. Die Kaffeeflecken flossen vor ihren Augen ineinander und bildeten abstruse Formen. Der ausgestreckte Zeigefinger, den sie jetzt sah, deutete auf ein Wort. Dieses eine Wort sprang aus der Zeitung direkt auf ihre Stirn, fraß sich durch die Haut, suchte sich den Weg über ihre Gehirnwindungen und brannte sich tief in ihr Gedächtnis.
»Verstorben.« Wie auf einer großen Leuchtreklametafel blinkten die Buchstaben. Sie, Mia Kronen, sie, die gerade mit achtundzwanzig Jahren einen Kuraufenthalt angetreten hatte, war tot.
3. Kapitel
Ihre Welt war zuvor schon verschoben gewesen, doch jetzt vibrierte der Boden unter ihren Füßen beängstigend, wie bei einem Erdbeben.
»Das gibt es doch nicht«, schrie Mia hysterisch und starrte auf die Anzeige. Aber die Buchstaben veränderten sich nicht. Auch das Geburtsdatum blieb bestehen. Sollte es eine Namensvetterin geben, die am gleichen Tag wie sie geboren worden war? Nein, eigentlich unmöglich. Sie wohnte in einer überschaubaren Studentenstadt, und Mia Kronen war kein Allerweltsname.
»Was ist denn passiert, gnäʼ Frau? Was ist der Grund für Ihr Missfallen?« Ein Schwall Tabac zog in Mias Nase.
»Hier.« Mia legte die Zeitung mitten auf den Tisch und deutete auf die Anzeige.
»Mein herzliches Beileid«, sagte Herr Silberkron, und seine Gattin stimmte mit ein.
»Das tut mir leid, gnäʼ Frau.«
»Es tut Ihnen leid, dass ich tot bin? Aha … Kommt es Ihnen nicht merkwürdig vor, dass hier vor mir meine eigene Todesanzeige liegt?« Mia nahm die Zeitung und riss die Seite heraus.
»Ich kannte Ihren Vornamen und Ihr Geburtsdatum nicht, Frau Kronen, daher musste ich davon ausgehen, dass es sich bei der Verstorbenen eventuell um eine Verwandte von Ihnen handelt. Das ist aber sehr makaber«, erklärte James.
Im ersten Moment wusste Mia darauf keine Antwort. Die Gedanken sprangen in ihrem Kopf herum wie Grashüpfer auf einer Sommerwiese. Das ist eine Falle, das war er. Er möchte mich aus meinem Versteck locken. Was konnte eine Bannmeile schon ausrichten? Papier war geduldig und würde sie auch auf der Straße nicht abschirmen. Die Polizei konnte erst tätig werden, wenn er gegen ein Gesetz verstieß. War es denn gesetzeswidrig, eine Todesanzeige für eine lebende Person aufzugeben? Oder hatte er mit der Sache nichts zu tun? Aber wer …?
»Frau Kronen, hallo?«, fragte Herr Silberkron. In Gedanken versunken, hatte Mia nicht bemerkt, wie sie mit offenem Mund auf die anderen Patienten gewirkt haben musste. Im Speisesaal war mittlerweile Ruhe eingekehrt. Einige Gäste hatten sich um Mias Tisch versammelt und starrten sie erwartungsvoll an.
»Ruf doch mal bei der Redaktion an und frag, wer diese Anzeige aufgegeben hat«, durchbrach Nancy Hesse die Stille. Mias Zimmernachbarin. Nancy beugte sich zwischen Herrn Silberkron und dessen Frau über den Tisch. Sie griff nach der Tageszeitung. Die Bluse trug sie sehr offenherzig. Um nicht direkt in ihr ausladendes Dekolleté blicken zu müssen, drehte Herr Silberkron seinen Kopf demonstrativ zur Seite.
»Hier steht die Telefonnummer.« Nancy faltete das Papier und hielt Mia die Zeitung vor die Nase.
»Nun mach schon, kannst auch mein Handy haben.« Seit Mia Nancy das erste Mal gesehen hatte, war das Smartphone deren ständiger Begleiter gewesen. Es grenzte an ein Wunder, dass sie von dem Spektakel am Nachbartisch überhaupt etwas mitbekommen hatte. Sie starrte ständig auf das Display oder tippte darauf herum. Selbst die Therapeutin hatte sie nicht davon überzeugen können, ihr Handy zumindest während der Gruppensitzung auf die Seite zu legen.
Die Gäste, die um ihren Tisch versammelt waren, schienen alle näher zu rücken. Mia fühlte sich wie in einem engen Raum, dessen Wände Stück für Stück auf sie zukamen. Die Luft wurde dünner. Die Gerüche von verschiedenen Parfüms vermischten sich mit dem Duft von Brötchen, Kaffee und Tabac. Jeder für sich genommen wäre bestimmt angenehm gewesen, doch die Mischung schnürte Mia den Hals zu. Sie bekam keine Luft mehr. Abrupt stand sie auf, schob ihren Stuhl dabei unsanft zurück, rempelte Nancy an und rannte aus dem Speisesaal.
Sie schlug ihre Augen auf und starrte in ein Gesicht, das nur eine Handbreit entfernt von ihrem auftauchte. James tätschelte ihre Wange.
»Es reicht jetzt«, flüsterte Mia und schob seine Hand zur Seite.
»Entschuldigung, gnäʼFrau, aber Sie waren ohnmächtig. Darf ich nach Ihrem Befinden fragen?« James musste sie in ihr Zimmer gebracht haben. Mia lag auf dem französischen Bett und sah den röhrenden Hirsch, der sie aus einem goldenen, barocken Rahmen von der gegenüberliegenden Wand aus anstarrte. James deutete auf Mias Hand.
»Das Blatt wollten Sie nicht loslassen.«
Da war sie wieder, die Faust, die ihr den Nackenschlag verpasst hatte. Die Anzeige! Mia hob die zerknüllte Zeitungsseite nach oben.
»Nicht wieder ohnmächtig werden, Sie sind weiß wie die Wand, wenn ich das so sagen darf.« James griff nach einem Gästehandtuch, das auf dem Tisch gegenüber lag, und wedelte ihr damit Luft zu. Mias Finger, in denen sich die Seite der Tageszeitung befand, waren wie festgeschraubt – verkrampft, und ließen sich nicht öffnen.
»Hey!« Mia fuhr herum. Sie hatte nicht bemerkt, dass sich eine weitere Person in ihrem Zimmer aufhielt. Ein fremder Mann, der ihr soeben eine Injektionsnadel tief in den Oberarm stach.
»Ich bin Dr. Mann. Keine Angst, ich spritze Ihnen nur ein Beruhigungsmittel. Bald geht es Ihnen wieder besser. Sie werden nur etwas müde werden.« Der Arzt warf die Verpackung der Spritze in den Müll und ging aus dem Zimmer. Mia spürte, wie sich ihr Herzschlag verlangsamte. Eine wohltuende Ruhe kehrte in ihren Körper ein. Ihre Finger gehorchten und gaben die zerknüllte, mit Kaffeeflecken übersäte Zeitungsseite frei. James nahm sich einen der mit Brokat überzogenen Stühle, stellte ihn neben das Bett und setzte sich.
»Sie können sich ja heute Nachmittag oder morgen mit der Zeitungsredaktion in Verbindung setzen, dann wird sich bestimmt alles aufklären«, sagte er und beugte sich näher zu Mia.
»Ich kann das nicht verstehen. Wer macht so etwas und warum?« Sie deutete auf die Todesanzeige.
»Was fühlen Sie dabei, gnäʼ Frau?«
»Was ich dabei fühle? Also, zuerst war ich schockiert«, antwortete Mia und konnte ein Gähnen nicht unterdrücken.
»Und dann?«
»Wut.«
»Könnte es sich auch um ein Missverständnis handeln? Eine andere Person mit dem gleichen Namen?«, fragte James und rückte ein Stück näher ans Bett.
»Mia Kronen, geboren am 15.05.1986. Missverständnis?«, erwiderte Mia ungläubig.
»Das wäre natürlich ein kurioser Zufall, gnäʼ Frau. Aber Sie sind das blühende Leben, eine hübsche, junge Frau, und der Rest wird sich bestimmt finden.«
»An einen Zufall kann ich nicht glauben.« Müde wedelte Mia mit dem Zeitungsfetzen vor Jamesʼ Nase herum.
»Ich helfe Ihnen gern bei der Aufklärung, doch nun müssen Sie sich zuerst ein wenig ausruhen.« Lag es an der Spritze oder an dem gleichbleibenden Tonfall, mit dem James sprach? Mia wurde immer müder. Ihre Lider fühlten sich an, als würden sie an kräftigen Fäden nach unten gezogen. Als wäre ihr Körper mit Blei beschwert worden, wurde sie tiefer und tiefer in die Matratze gedrückt. Mia sah noch, wie ihr die Anzeige aus den Fingern glitt und zu Boden wehte.
»Ich ziehe mich zurück, gnäʼ Frau. Wenn Sie sich erholt haben, sieht die Welt wieder anders aus.« Sie sah James, der den Stuhl an seinen Platz zurückstellte und zur Tür schritt – kerzengerade, wie ein Soldat beim Salut.
Aus einem traumlosen Schlaf schreckte Mia plötzlich auf und schnappte wie eine Ertrinkende nach Luft. Mit offenem Mund atmete sie tief ein und wieder aus. Sie war allein, nur der Hirsch, ein stattlicher Achtender, starrte sie fragend an. Je länger Mia ihm in die Augen sah, desto mehr meinte sie ein Blinzeln zu erkennen. Auch wenn sie sich in ihrem Zimmer bewegte, wanderten seine Augen mit. Sie setzte sich an die Bettkante und suchte nach der Anzeige, die ihr aus der Hand gerutscht sein musste. Da war nichts. Auf dem dicken, roten Perserteppich, in den man bei jedem Schritt einsank, als würde man auf Sand laufen, war nichts zu finden. Sie bückte sich auf den Boden und kroch unter das Bett. Nichts. War doch alles Einbildung gewesen? Ihr Unterleib krampfte, und sie drückte die Hand gegen ihre Bauchdecke. Mia kniete auf dem Boden und legte ihren Oberkörper auf dem Bett ab. In dieser Stellung hielt sie einen Moment inne und wartete auf das Abklingen der Krämpfe. Seitdem sie Pünktchen – so hatte sie ihr Ungeborenes genannt – verloren hatte, wurde sie immer wieder von diesen Schmerzen heimgesucht. Es war wie ein Phantomschmerz, den auch Menschen bei einer Amputation verspürten.
Die Schmerzen hatten nachgelassen. Mia stand auf, zog sich an, nahm ihre Jacke vom Kleiderhaken und schnappte sich ihre Handtasche. Sie musste James fragen. Es konnte gut möglich sein, dass er die Zeitungsanzeige eingesteckt hatte.
4. Kapitel
Dezember 2014 – Scherben
Sie schlug die Akte zu und schüttelte den Kopf. Der Patient zeigte ihrer Meinung nach keine typischen Anzeichen einer dissoziativen Identitätsstörung, obwohl drei Kollegen unabhängig voneinander diese Diagnose gestellt hatten. Linda zog die Schreibtischschublade auf, nahm sich eine Praline aus der Schachtel und steckte sie genüsslich in den Mund. Glückshormone. Plötzliches Gebrüll auf dem Flur ließ sie aufhorchen. Sie schob den Schreibtischstuhl nach hinten und eilte zur Tür.
»Schräädumpffff«, schrie die junge Frau, bei der es sich um eine neue Patientin handeln musste. Sie stand im Wartebereich, einer Nische, die mit vier Stühlen und einem Tisch ausgestattet war. Oberschwester Irmgard, die eine Patientenakte und einen kleinen Koffer in der Hand hatte, wich einen Schritt zurück.
»Schräääääädumpfff.« Was die Patientin von sich gab, war nur ein unverständliches Kauderwelsch.
»Guten Tag. Ich bin Frau Dr. Schwarz«, stellte sich Linda vor, näherte sich der jungen Frau und streckte ihr die Hand zur Begrüßung entgegen.
»Schräää…« Ihre braunen, kurzen Haare standen wirr vom Kopf. Wasser, Seife und Kamm musste diese Patientin schon lange nicht mehr gesehen haben. Jetzt, Anfang Dezember, war es sehr kalt draußen, doch die junge Frau hatte keine Jacke, oder sie hatte diese bereits abgelegt. Ihre weiße Bluse war zerrissen und übersät mit Flecken. Dort, wo die Haut hindurch schimmerte, waren Blutergüsse erkennbar. Den rechten Fuß stellte sie nur auf den Zehenspitzen ab und verlagerte ihr Gewicht auf den linken. In einer Hand hielt sie ein ramponiertes Smartphone, die andere ballte sie zu einer Faust.
»Duuumpffff.
---ENDE DER LESEPROBE---