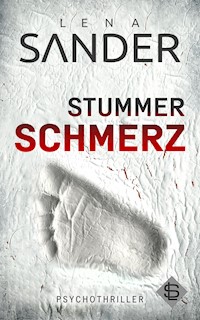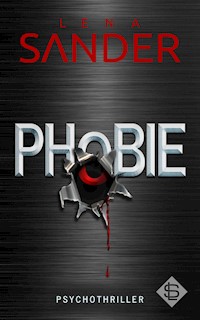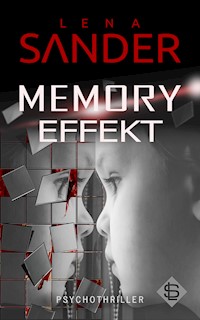Stummer Schmerz
Psychothriller
Lena Sander
Über dieses Buch
Wenn du die Spieluhr hörst, ist es zu spät …
Die Psychotherapeutin Nele erlebt den Albtraum jeder werdenden Mutter, die sich auf ihr Baby freut. Ihr Kind ist tot!Seither hört Nele immer wieder eine imaginäre Melodie und sieht eine Ballerina, deren Gesicht sich mehr und mehr zu einer grausamen Fratze verzieht.
Nur einen Blutfleck findet man von der 17-jährigen traumatisierten Emily auf der Treppe der psychiatrischen Klinik Feldbergblick. Sie selbst ist spurlos verschwunden ...
Wo ist Emily? Lebt Neles Baby oder leidet die Psychotherapeutin selbst an Wahnvorstellungen …?
Folge der Spieluhr und du gelangst zu der grausamen Wahrheit, die tief in der Seele verborgen ist.
Impressum
© 2020 Lena Sander
Alle Rechte vorbehalten
Lena Sander
c/o autorenglueck.de
Franz-Mehring-Str. 15
01237 Dresden
Die Tatsachen, die diesem Buch zugrunde liegen, werden im Nachwort erläutert. Alle weiteren Figuren und Ereignisse sind fiktiv. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder toten realen Personen ist zufällig und nicht vom Autor beabsichtigt.
Kein Teil dieses Buches darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder in einem Abrufsystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise elektronisch, mechanisch, fotokopiert, aufgezeichnet oder auf andere Weise übertragen werden.
Ausgabe Dezember 2020
Lektorat und Korrektorat: Anke Höhl-Kayser
Coverdesign: BreisgauART
Bildnachweis: istock – istockfoto.com
Internet: www.lena-sander.de
Über die Autorin
Lena Sander
Die Thriller-Autorin Lena Sander lebt in Freiburg, am Fuße des Schwarzwalds. Das Schreiben war für sie zunächst ein Ausgleich während des trockenen Marketingstudiums, ließ sie danach aber nicht mehr los.
Die Grundthemen ihrer Psychothriller beruhen immer auf Tatsachen. Das Markenzeichen ihrer Bücher, ist die raffinierte Verknüpfung von Realität und Fiktion zu spannungsgeladenen Storys. Während die plastisch beschriebenen Szenarien ihrer Psychothriller schockieren, wirken die tieferliegenden Botschaften noch lange in der Seele nach.
Inhalt
Titelseite
Über dieses Buch
Impressum
Über die Autorin
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Nachwort
Danksagung
Bücher von diesem Autor
Prolog
Eine Melodie. So hell und klar wie ein Glockenspiel und doch mit so tiefgreifenden Erinnerungen verbunden, dass sie in jeder Faser meines Körpers Schmerzen verursacht. Eine Spieluhr. ›Morgenstimmung‹ von Edward Grieg. Die Noten tanzen vor meinen Augen und das hohe C ist eine Qual für meine Ohren.
Ich kann sie sehen, die Tänzerin. Eine Ballerina in einem blutroten, langen Kleid mit Petticoat. Wie sie sich, den rechten Arm erhoben in der dritten Position, la troisième, auf der Plattform unter ihrer Glaskuppel dreht. Langsam öffne ich meine Augen. Das grelle Licht blendet. Ich blinzle.
Ein vermummtes Gesicht. So nah, dass ich nicht nur die Augenfarbe erkennen kann, sondern auch die winzig hellen Flecke in der Iris. Eine Frau? Ihr Mundschutz zieht sich nach innen, sodass sich die Konturen ihrer Nase abzeichnen. Das grelle Neonlicht blendet und ich schließe die Augen wieder. Zwischen Schlaf und Realität, unwirklich. In die Melodie der Spieluhr fügt sich ein störendes Piepen, ganz nah und doch so fern, monoton und fortwährend. Surreal. Getuschel. Stimmen. Sie flüstern, verstehen kann ich nichts. Einfach fallen lassen, hinübergleiten zum kleinen Bruder des Todes, dem Schlaf. Abschalten. Gedanken kommen und ziehen weiter, wie Wolken im Wind.
Ein Stich. Ich öffne abrupt die Augen und starre auf eine Nadel. Sie steckt, mit Pflaster fixiert, in meiner Armbeuge, an deren Ende ein Schlauch bis zu einem Tropf führt; eine weitere in meinem Handrücken und ein schwarzer Clip an der Fingerspitze meines Mittelfingers. Ich bin müde, benebelt und kann die Situation nicht einordnen. Ein OP-Saal. Bin ich die Patientin? Mein Körper bewegt sich ohne mein Zutun. Legt der Chirurg gerade das Skalpell an und schneidet die Epidermis auf? Stück für Stück – wie bei einer Zwiebel – gleitet die scharfe Klinge durch jede Hautschicht, leicht und geschmeidig, zum Unterhautfettgewebe und weiter, bis zum Ziel. Er wird die OP-Haken ansetzen – einen Doppelhaken – zum Zurückhalten von empfindlichen Strukturen. Schmerzen? Nein. Warum nicht?
Ich zwinge mich, die Augen weiter zu öffnen und starre auf ein grünes Laken, das direkt vor meinem Sichtfeld aufgespannt ist. Köpfe tauchen auf und verschwinden wieder. Ein unangenehmes Ziehen, Drücken und Rütteln in meinem Unterleib. Lasst mich in Ruhe, ich will das nicht, hört auf! Das laute Schluchzen muss von mir stammen, denn es ist kein Mensch in meiner direkten Nähe. Ich kann nicht sprechen, nicht rufen oder gar schreien. Ich will das nicht! Aufhören!
Flüssigkeit. Langsam schlängelt sie sich über meine Hüften. Blut! Die Zimmerdecke ist weiß getüncht, ich starre hinauf. Kein Anhaltspunkt, keine Unebenheit, kein Fixpunkt. Der Piepton aus dem Gerät in meiner Nähe wird schneller und übertönt das Glockenspiel, er hat die Synchronizität mit meinem Puls. Fragen über Fragen beherrschen meine Gedanken und krallen sich unbeantwortet in meinem Gehirn fest. Mein Kopf dröhnt. Es ist ein Druck, der sich hartnäckig über den Halswirbel bis in meinen Schädel bohrt und wie ein Presslufthammer gegen die Stirn schlägt. Hektik! Köpfe tauchen blitzschnell auf und verschwinden wieder hinter dem Laken.
»Systolisch 55«, höre ich deutlich eine weibliche Stimme.
Kapitel 1
Der Aufzug ist eng. Martin quetscht sich neben meinen Rollstuhl und drückt den Knopf zum Untergeschoss. Mein Unterleib schmerzt in dieser sitzenden Stellung, doch ich beiße die Zähne zusammen. Es gibt zwei Arten von Schmerzen. Die körperlichen, offensichtlichen, so wie meine frische OP- Narbe, und die seelischen.
»Wir sind gleich da«, holt Martin mich aus meinen Gedanken. Das war der erste Satz, den ich von ihm höre, seitdem er mich aus meinem Krankenzimmer abgeholt hat. Von Etage zu Etage spüre ich deutlich diese imaginäre Hand, die meinen Magen fest umschließt und ihn zusammenquetscht. Der Aufzug bremst ruckartig ab. Die Türen öffnen sich und mir schlägt sofort eine eisige Kälte ins Gesicht. Eine Ohrfeige, die mich auf schockierende Weise daran erinnert, wo wir sind. Kurz vor unserem Ziel. Im untersten Geschoss des Krankenhauses, dort unten, wo sich das Fachpersonal mit Themen beschäftigt, die mich nichts angehen, weil ich sie nicht wahrhaben will, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Ich ziehe die Decke, die Martin mir über die Beine gelegt hat, bis zu meinem Hals nach oben. Gänsehaut macht sich breit und ich spüre, wie sich mein Körper mit einem innerlichen Zittern gegen diese Situation zu wehren versucht.
»Du kannst es dir noch anders überlegen. Ich kann dich auch wieder in dein Zimmer zurückbringen, Nele.« Martin beugt sich zu mir und sieht mich mit fragendem Blick an. Sein weißer Kittel ist frisch gestärkt und weist keinerlei Flecken auf, nicht einmal ein Schatten von einem entfernten Blutfleck ist zu sehen. Ob er in seiner Position als Chefarzt jeden Tag neue Arbeitskleidung bekommt? Obwohl mein Stiefbruder 40 Jahre alt geworden ist, sieht er älter aus. Die Schläfen sind mit grauen Strähnen durchzogen, die Lachfalten um die Augen wirken wie eingestanzt und die Zornesfalte ist mittlerweile ohne jegliche Mimik gut zu erkennen.
»Nein, es gibt kein Zurück. Ich muss das tun, verstehst du?«
Er nickt stumm und fährt meinen Rollstuhl durch einen langen Gang. Es ist anders als oben auf den Stationen. Hier stehen keine Stühle, Pflanzen oder Betten. Die hellen Fliesen auf dem Boden sind quadratisch und jede einzelne misst bestimmt einen Meter auf einen Meter. Bei jeder Fuge, über die Martin fährt, zucke ich zusammen. Es riecht nach Tod. Wahrscheinlich ist es Einbildung, denn ich habe keine Ahnung vom Geruch des Todes.
Eine Tür öffnet sich.
»Guten Tag, Herr Professor Bender«, grüßt ein junger Arzt im Vorbeigehen meinen Bruder und lächelt mich an. Ist es angebracht, hier und jetzt zu lächeln? Kann er sich nicht denken, wohin mich sein Chef bringt? Ich mache mir hundert Gedanken um unwichtige Dinge. Vermutlich, weil ich mich selbst vom eigentlichen Thema ablenken möchte. Weil ich mir wünsche, dass es ein Albtraum ist und ich gleich aus diesem Horrorszenario aufwachen werde.
Martin hält den Rollstuhl vor einer Tür an, stellt sich vor mich und geht in die Hocke. Er legt meine Hand in seine und sieht mir intensiv in die Augen.
»Nele, bist du dir ganz sicher?« Nein, das bin ich nicht und trotzdem nicke ich ihm zögerlich zu.
»Dein Kreislauf ist noch nicht stabil. Wenn du nicht meine Schwester wärst und nicht so gebettelt hättest, dann …« Ich lege meine andere Hand auf seine, streichle sie und blinzele ihm zu.
»Alles okay, Martin. Lass uns jetzt da reingehen.« Er öffnet die Tür. Im Gegensatz dazu, was ich erwartet habe, sehe ich keine abgedeckten Leichen, an deren großen Zehen ein Namensschild zwecks Identifikation gebunden wurde. Keine Schubladenfächer zur Kühlung der Toten. Nur ein hohes, vergittertes Bett für Neugeborene, das verloren mitten im Raum steht und daneben ein Beistelltisch, auf dem eine dicke, weiße Kerze brennt. Es ist still. Totenstille. Kein Weinen, kein Schreien. Nichts. Steril, kalt und befremdlich. Meine Hände zittern, trotz der Kälte bilden sich Schweißperlen auf meiner Stirn. Mir wird übel.
»Bist du bereit?« Nein. Niemals. Keiner kann für solch eine Situation bereit sein, und doch bin ich dazu gezwungen. Das, was mich dazu antreibt, diesen grausamen Weg zu gehen, ist die Gewissheit. Auch wenn Martin keine Antwort von mir erhalten hat, scheint er zu verstehen und schiebt den Rollstuhl neben das Bett, stellt die Bremsen fest und klappt die Fußstützen nach oben. Ich lege meine Hände in seine und er zieht mich hoch. Ein Dolch durchbohrt meinen Unterleib, ich stöhne und krümme meinen Oberkörper nach vorne.
»Setz dich wieder, Nele. Es ist zu früh, bitte.« Ich schüttel vehement den Kopf, denn ein Wort, geschweige denn einen Satz, könnte ich in diesem Moment nicht äußern. Für einen Augenblick verbleibe ich in dieser Haltung, atme tief ein und wieder aus. Ich beiße die Zähne zusammen und richte mich auf. Martin versteht, tritt einen Schritt zur Seite und stützt meinen Arm.
»Sie ist tot.« Worte, die oberflächlich an meinen Gehörgang dringen. Worte, die an einem imaginären Schutzschild abprallen und als bedeutungslos zurückgeschleudert werden.
Da liegt sie, meine Tochter, die ich gestern per Kaiserschnitt zur Welt gebracht habe. Das kleine Gesicht wirkt blass und so, als wäre sie eine Puppe, aus Wachs gegossen. Sie schläft nur, bestimmt. Ich starre auf die winzige Bettdecke und warte auf einen Atemzug.
Er ist da, ein tief liegender Schmerz, ein stummer Schmerz. Er dringt nicht nach außen. Ist nicht diagnostizierbar, mit keiner auch noch so modernen technischen Errungenschaft der Medizin analysierbar. Mit keiner Therapie oder Medikamenten zu lindern und dennoch allgegenwärtig.
»Es tut mir so leid.« Was tut ihm leid? Ich verstehe nicht. Will es nicht begreifen. Es ist ein Irrtum, bestimmt. Ich greife in das Bett und streichle über ihren Kopf. Kalt. Eiskalt. Leblos. Martin reicht mir ein Taschentuch und erst jetzt bemerke ich die Tränen, die über meine Wangen rinnen und die Bettdecke benetzen. Ich nehme es dankend an, wische mir über die Augen und knülle das durchnässte Tempo in meiner Faust fest zusammen. Auch wenn es sich nur um einen nassen Fetzen Zellstoff handelt, klammere ich mich daran fest. Das Papier ist greifbar real, ich kann es spüren und zur Not zerreißen. Im Gegensatz zu der Situation, die mich einengt, fest umschlingt und aus der ich nicht ausbrechen kann.
Kapitel 2
Zwei Monate später
Niedlich, wie sie daliegt, in diesem modernen, dunkelroten Kinderwagen. Das rosa Mützchen, passend zum Strampelanzug, auf dessen Front ein lachender Bärenkopf aufgenäht ist. Wie sie mich mit ihren großen, blauen Kulleraugen ansieht und grinst. Gewiss können Babys in diesem Alter noch nicht bewusst lächeln, das hatte ich in irgendeinem Ratgeber gelesen, dennoch sieht es für mich so aus. Sie hat meine Augen und mein Lächeln geerbt. Ein ausgeglichenes Kind, meine Kim. Sie lässt sich nicht einmal von dem Krach in der belebten Fußgängerzone aus der Ruhe bringen und konzentriert sich vollkommen auf mich und meine Grimassen, die ein weiteres Lachen ihrerseits erzeugen. Ich spaziere vorbei an den Schaufenstern, den Freiburger Bächle und an den gut besuchten Straßencafés. Heute ist ein wunderschöner Tag, ideal, um mit seinem Kind einen Spaziergang in den Stadtgarten zu unternehmen.
Vor einigen Monaten hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mich tatsächlich irgendwann für Kinder interessieren könnte. Meine eigene Psychotherapiepraxis verlangt mir genug ab, nicht nur zeitlich, sondern auch emotional. Egal. Es ist mein Kind, meine Kim, und ich bin nicht die erste alleinerziehende Mutter, die ihre Arbeit – mit einer gewissen Auszeit – bewältigt und gleichzeitig ein Kind großzieht, basta!
Aus einiger Entfernung kann ich schon die tobenden Kinder hören. In ein paar Monaten kann Kim, meine kleine Maus, auf ihren tapsigen Füßchen mitrennen. Sich am Wasserspiel des Springbrunnens erfreuen und hinterher pitschnass in meine Arme laufen. Ich setze mich auf eine Bank am Rand des Kinderspielplatzes. Die Kleinen buddeln im Sand und auf der angrenzenden Wiese bereiten einige Mütter ein Picknick vor. Kinderlachen ist die Musik der Zukunft.
Ich schaue in den Kinderwagen. Herzerwärmend, wie sie mit ihren kleinen Fingerchen schon versucht, an die Spieluhr zu gelangen. Kim strahlt mich an, als wolle sie mir sagen, dass ich für sie an der Schnur des Plüschmondes ziehen solle, der neben ihr liegt. Natürlich kann ich diesem Blick nicht widerstehen und greife in den Kinderwagen.
»Hey Sie. Nehmen Sie sofort Ihre Hände von meinem Baby«, höre ich eine aufgeregte, weibliche Stimme in der Nähe. Auch wenn diese Fremde nicht mich meinen kann, zucke ich vor dieser grellen Stimme zusammen und gehorche.
»Das ist sie! Das ist mein Baby. Verhaften Sie die Frau!« Wie eine Furie rennt eine Fremde mittleren Alters in einem blumigen Sommerkleid auf mich zu. Ihre schwarzen, kurzen Haare sind verschwitzt und ihre Gesichtsfarbe hat einen rötlichen Touch. Im Schlepptau zwei Polizisten in Uniform. Sie schreit Unverständliches und fuchtelt mit den Händen aufgeregt herum. Einer der Beamten hinter ihr hält sie zurück, versucht, sie zu beruhigen und legt seinen Arm auf ihren. Sie lässt es nicht zu, befreit sich aus seinem Griff, und als sie direkt vor mir steht, holt sie aus und klatscht mir ihre ausgestreckte Hand mitten auf die Wange.
»Haben Sie ´nen Knall?«, schreie ich und stehe wütend von meiner Bank auf. »Und Sie …«, ich sehe zu den beiden Beamten, »Sie helfen dieser Verrückten auch noch dabei. Das ist mein Kind!« Ich kralle mich am Kinderwagen fest und versuche, ihn hinter mich zu schieben. Schließlich würde jede Mutter ihr Kind verteidigen, egal, wie vielen Menschen sie sich dabei in den Weg stellen muss. Wie eine Löwin werde ich kämpfen und wenn diese fremde, hysterische Frau noch einmal handgreiflich wird, dann gnade ihr Gott.
»Ich denke, wir klären das besser auf der Wache.« Der Kleinere des Beamtenduos stellt sich neben mich, und ich drehe mich sofort zum Kinderwagen, sodass er keine Chance hat, Kim zu begutachten.
Einige Mütter stehen von ihren Picknickdecken auf und rufen ihre Kinder zu sich. Eine Frau, die auf der Bank nebenan sitzt, wirft mir einen irritierten Blick zu, erhebt sich, nimmt ihren Kinderwagen und eilt davon. Als wäre ich eine Aussätzige, starren mich einige Schaulustige vorwurfsvoll an und schütteln den Kopf. Mir wird übel und mein Unterleib krampft. Ich sehe in ihren Augen, dass sie nicht mir, sondern der fremden Frau Glauben schenken, schließlich steht das Gesetz in Form von zwei Beamten direkt neben ihr.
»Verhaften Sie jetzt sofort diese Kindesentführerin und geben Sie mir mein Baby zurück.«
Die Aufregung lässt mein Herz schneller schlagen. Wie Buschtrommeln, die ihren Rhythmus beschleunigen, klopft der Puls in meiner Halsschlagader. Warum will diese Fremde den Polizisten weismachen, dass mein Mädchen, meine Kim, ihr Kind ist? Ob es sich tatsächlich um Staatsdiener handelt? Wie krank doch manche Menschen sind, unbegreiflich. Ich blicke mich hilfesuchend um, aber mittlerweile haben sich einige Besucherinnen des Parks gruppiert, zeigen mit den Fingern auf mich, tuscheln und schimpfen.
Mir reicht es. Die Situation ist absurd und ich sehe nicht ein, dass mein Baby sich dieses Geschrei noch länger anhören muss. Mit meinem Ellbogen schubse ich den mutmaßlichen Polizisten, der sich zwischen mich und die Furie gestellt hat, unsanft zur Seite und umfasse mit beiden Händen den Griff des Kinderwagens. Ich renne los. Es ist mir einerlei, dass mir diese Verrückte und beide Beamten auf den Fersen sind. Sie haben keine Chance. Ich bin schnell und der Kinderwagen, durch die Luftbereifung, leichtläufig. Bei jeder Unebenheit wird Kim durchgeschüttelt, aber sie ist tapfer und lacht dabei.
Das ist meine Kim. Genauso tapfer wie ihre Mutter. Keiner kann uns trennen. Niemals! Ich werde immer für dich da sein, dich behüten und beschützen. Immer!
Der Abstand zwischen den Beamten und mir verringert sich. Ich renne über den Zebrastreifen und achte dabei auf den Straßenverkehr. Es ist laut. Autos hupen, an der Ecke stehen Teenies, die über Lautsprecher die neusten Hip-Hop-Songs aus ihrem iPhone abspielen. Dort vorne am Karlsbau tummeln sich die Touristen. Einige steigen gerade aus einem Reisebus. Um mich herum wird das Gedränge dichter, je näher ich der Kaiser-Joseph-Straße und somit der Fußgängerzone komme. Kim ist weiterhin brav und lächelt mich zufrieden an. Hektisch blicke ich mich um. Sie sind immer noch da, die Polizisten. Die Verrückte rennt, weit abgeschlagen, schreiend hinter den Beamten her.
Ich achte auf mein Kind und gleichermaßen auf die Passanten in meiner Nähe. Früher war ich sportlich, drehte jeden Morgen vor der Uni meine Runden im Park, aber seit der Schwangerschaft hat meine Kondition nachgelassen. Ich spüre das Stechen im Rippenbogen. Jeder Atemzug schmerzt. Die letzten Fußgänger springen von der Straße auf das Trottoir und ich lege an Tempo zu. Gleich schaltet die Ampel auf Rot. Wenn ich warte, mich an die Verkehrsregeln halte, Kim und mich nicht der Gefahr aussetze, von dem nächsten PKW erfasst zu werden, haben mich die Polizisten eingeholt. Sprinte ich weiter …?
Ich renne, winke den Autofahrern zu und ernte ein Hupkonzert. Die Karlsbau-Passage ist düster und schmal. Dennoch muss ich genau hier durch, um in ein Kaufhaus zu gelangen. Denn dort bin ich in Sicherheit, dort wird mich in dem Tumult keiner finden. Kim verzieht das Gesicht. Nicht mehr lange und sie wird weinen. Kein Wunder, irgendwann hat auch das geduldigste Kind die Nase voll von diesem Geschüttel. Ich japse nach Luft und versuche, gleichzeitig Grimassen ziehend, die Kleine zu beruhigen.
»Aua«, schreit eine alte Dame. Ihr Rollator fällt um und sie sitzt auf dem Boden. Ich muss mit dem Kinderwagen in sie hineingefahren sein. Ich drehe mich panisch um. Die Polizisten sind nicht zu sehen. Durch meine Ampelaktion habe ich mir bestimmt einen Vorsprung verschafft.
»Aua«, sagt die alte Dame abermals und greift an ihren Rücken. Es ist meine Schuld, hoffentlich hat sie sich nicht ernstlich verletzt. Mit einer Hand am Kinderwagen beuge ich mich zu der Frau. »Entschuldigen Sie bitte«, sage ich und schnappe gleichzeitig nach Luft, »das tut mir sehr leid. Haben Sie sich verletzt?« Im Augenwinkel sehe ich einen der Beamten, der sich suchend umsieht. Ich bete um eine schnelle, positive Antwort, aber die Dame lässt sich Zeit.
»Mein Rücken«, jammert sie. Ich lasse den Kinderwagen los und helfe der Frau auf die Beine. »Kann ich noch etwas für Sie tun?«, frage ich und suche gleichzeitig den Beamten, der aus meinem Blickfeld verschwunden ist.
»So, jetzt bleiben Sie gefälligst stehen.« Einer der Polizisten hält mich fest, als hätte er meinen Oberarm in einen Schraubstock gezwängt. Das Krampfen in meinem Unterleib verstärkt sich. Ich sehe zu der alten Dame, die mir unsicher zunickt und dann zum Kinderwagen, der gerade von mir weggeschoben wird.
Meine Tränen kann ich nicht unterdrücken. Sie kullern meine Wangen hinab, als hätte man vergessen, einen tropfenden Wasserhahn zu reparieren. Reparieren … ist es möglich, alles, was defekt ist, wieder in seinen ursprünglichen Zustand zu versetzen? Auch Gefühle?
Kapitel 3
»Die Bewährungsauflage, deine Therapie hier in der Klinik ›Feldbergblick‹ in Titisee zu machen, war eine gute Entscheidung des Richters. Er hätte dich genauso gut in eine geschlossene Psychiatrie einweisen lassen können. Es lohnt sich eben doch, auf seinen großen Bruder zu hören und Einsicht vor Gericht zu zeigen.« Martin steht vor mir und zerrt das Papier von den Blumen. Der Strauß scheint schon länger im Auto, ohne Wasser mitgefahren zu sein, denn die Gerbera lassen bereits die Köpfe hängen.
»Danke«, sage ich und nehme ihm den Blumenstrauß ab. »Mir blieb ja nichts anderes übrig.« Ich greife die Vase von dem kleinen, quadratischen Tisch und gehe ins Badezimmer.
»Du kannst dich hier von deinem Trauma bestimmt erholen und wieder zu Kräften kommen.« Erholen? Das klingt eher nach Urlaubsreise oder Kuraufenthalt. Martin lässt mich nicht aus den Augen und beobachtet, wie ich die Vase mit Wasser befülle und die Blumen ordne. Erst jetzt bemerke ich seine schwarzen, derben Stiefel.
»Hast du heute frei?«
»Ja, seit Langem das erste Mal. Ich bin mit dem Motorrad da. Die Blumen fanden die Fahrt irgendwie nicht so toll.« Martin lacht und zeigt auf die Vase. Heute, in der verwaschenen Jeans und der Lederjacke, wirkt er nicht mehr so alt wie noch vor einigen Wochen in seiner Klinik. Eigentlich schade, dass wir uns so viele Jahre aus den Augen verloren hatten. Als ihn sein Vater nach einem heftigen Streit aus dem Haus geworfen hatte, brach die Verbindung ab. Um was es sich bei den Streitereien handelte, wollte mir damals niemand erklären. Auch Martin schweigt heute noch, wenn ich dieses Thema zur Sprache bringe. Aber egal. Seit über zwei Jahren haben wir wieder Kontakt und er war für mich da, in meiner schwersten Stunde.
»Was anderes …«, lenke ich vom Thema ab, »konntest du einen Mutterschaftstest beantragen?«
»Nele, ganz im Ernst. Warum sollte ich das tun? Glaubst du tatsächlich, dass es sich um deine Tochter gehandelt hat? Das kann nicht sein. Dein Kind ist tot. Du hast es gesehen.«
Tot, schallt es wie ein Echo nach.
»Nele? Ist alles okay bei dir? Du bist ganz blass. Setz dich mal aufs Bett.« Seine Stimme klingt gedämpft, so, als würde er weit entfernt stehen und hielte sich ein Kissen vor den Mund.
»Bestimmt der Kreislauf«, sagt Martin beiläufig und tastet meinen Puls. Seine Finger sind heiß. Wie spitze, glühende Nadeln durchbohrt die Berührung mein Handgelenk.
»Danke für deinen Besuch und die Blumen. Geh jetzt besser, ich muss mich erholen«, erwidere ich zynisch. Auch wenn mein Stiefbruder es bestimmt nur gut meint, fühle ich mich unverstanden. Natürlich, für ihn zählt nur das, was bewiesen ist. Fakten. Für ihn ist es Fakt, dass meine Kim tot ist. Sicher habe ich sie gesehen, da unten, im Kellergeschoss des Krankenhauses. Sicher habe ich eine Sterbeurkunde erhalten und dennoch …. Er versteht, beugt sich zu mir und gibt mir einen Kuss auf die Wange.
»Mach’s gut, ich bin in den nächsten Tagen auf einem Kongress, aber wenn du etwas brauchst, kannst du dich auch an meinen Partner, Sven Arnold, wenden, er weiß Bescheid«, verabschiedet er sich und geht zur Tür.
Farben sind unausgesprochene Worte, die Emotionen erzeugen. Sie können Gefühle wie Wohlbefinden, Freude, Vitalität, aber auch Trauer und Unruhe auslösen. Ich sitze auf dem Bett, das in der Ecke unter dem Fenster steht, und betrachte heute zum ersten Mal akribisch diesen Raum. Die Raufasertapeten sind lindgrün gestrichen. Mir kommt sofort in den Sinn, welche Kenntnisse ich im ersten Semester Psychologie über die Farblehre erlangt habe. Grün bedeutet Gesundheit, Frische und Natur. Aber auch Wachstum, Erneuerung und Wiedergeburt. Grün ermöglicht, schneller effektive Lösungen für Probleme zu finden, entspannt und wird bei Menschen mit psychischen Problemen eingesetzt, um die Heilung zu erleichtern.
Heilung? Hat man mir aus diesem Grund dieses grüne Zimmer zugewiesen, dessen Einrichtung allein aus einem Bett, dem quadratischen Tisch und einem weißen Plastikstuhl besteht? Bin ich denn krank? Kann man das als Krankheit bezeichnen, wenn sich der Schmerz immer tiefer in die Eingeweide frisst und Stück für Stück meines Körpers in Besitz nimmt?
Da ist es wieder, das Glockenspiel, die Melodie, die mich schon über Jahre hinweg begleitet. Die Tänzerin unter der Glaskuppel, in ihrem blutroten Kleid. Eingesperrt und festgenagelt auf ihrer sich drehenden Plattform. Sie hat ein grausames Grinsen und starrt mich nach jeder Umdrehung an, als wolle sie mir sagen: »Du drehst dich auch im Kreis, genau wie ich, bist festgenagelt auf einem Fleck und eingesperrt unter einer Glaskuppel, genau wie ich.«
Plötzlich steht ein Pfleger mitten im Raum. So in Gedanken vertieft, habe ich nicht realisiert, wie er hereingekommen ist.
»Hallo Nele. Ihr Bruder sagte, dass Sie Kreislaufprobleme haben.« André Schwarz, ein Mann wie ein Bär. Groß, voluminöser Körperbau und dennoch hat er eher die Ausstrahlung eines Teddys, etwas tapsig und unbeholfen.
»Alles wieder okay, danke, André.«
»Sicher?«
»Sicher.« Ich zwinge mich, freundlich und unbekümmert zu wirken. Die Ärzte und Pfleger haben hier in der Klinik bereits all meine emotionalen Reaktionen kennengelernt, auch André Schwarz. Über Wut, Hysterie bis zur vollkommenen Verzweiflung und Aufgabe war alles dabei. Sie dürfen mich nicht mehr mit ihren Beruhigungsmitteln – oder was auch immer mein Denken trübt – vollpumpen, ich muss bei klarem Verstand sein. Es ist an der Zeit, logisch zu reagieren. Ich darf meinen Emotionen keinen freien Lauf lassen, muss klug sein, um die Ärzte und Therapeuten zu überzeugen, dass ich vollkommen gesund bin.
»In dem Fall dürfen wir heute, weil wir so brav waren, zur Feier des Tages an der Gruppentherapie teilnehmen.«
»Sie waren auch brav und machen bei der Gruppentherapie mit?«, scherze ich. Er lacht so, dass sein umfangreicher Bauch wackelt.
»Heute einen Clown gefrühstückt?«
Ich ziehe meine Mundwinkel hoch und hoffe, dass das Lächeln für ihn nicht zu gekünstelt wirkt.
Sieben Stühle, die einen Kreis bilden, zähle ich beim Betreten des Gruppenraums. Mich begrüßt eine helle, gardinenlose Fensterfront, die mir einen freien Blick in die Natur gewährt. Auf die Berge des Schwarzwalds, den blauen, wolkenlosen Himmel und die strahlende Sonne. Aufatmen. Ein kleines Stück Freiheit, auch wenn es sich dabei nur um etwa zwanzig Quadratmeter mehr als in meinem Einzelzimmer und diesen Ausblick handelt.
»Psst, ich bin Beata und du?« Eine kleine, zierliche Frau stupst mich mit ihrem Ellbogen in die Seite. Mit den kurzen, blonden Locken und den Lachgrübchen, die gerade zum Vorschein kommen, wirkt sie freundlich und überaus positiv. Schätzungsweise ist sie ein paar Jahre älter als ich, Mitte dreißig.
Ich erwidere ihr Lächeln. »Mein Name ist Nele, hallo Beata.«
»Bist du die Neue?«
»Ich bin schon über eine Woche hier, aber heute das erste Mal in der Gruppentherapie.«
»Das dachte ich mir. Weißt du, ich bin schon seit sechs Wochen in der Klinik und kenne mich aus. Wenn du etwas brauchst, wende dich vertrauensvoll an mich«, Beata zwinkert mir zu, »zum Beispiel ein gutes Buch. Liest du gerne Thriller?«
»Ich hatte schon lange keine Zeit mehr zum Lesen.«
Langsam füllt sich der Raum. Ich zähle mit mir fünf Frauen unterschiedlichen Alters. Ein junges Mädchen, bestimmt nicht älter als siebzehn, steht an der Tür. Sie wirkt verschüchtert. Die viel zu langen Ärmel der Strickjacke verdecken ihre Hände, die sie an ihren Mund hält, und ihre Augen sind durch das tief heruntergezogene Schild einer Basecap nicht zu erkennen.
Eine Frau in ausgebeulten Jeans, die ihr mindestens zwei Nummern zu groß sind, betritt den Raum. »Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich bin Frau Rachinsky, aber ihr könnt Tatjana zu mir sagen«, trällert ihre Stimme, deren Frequenz in meinem Gehörgang schmerzt.
Um das blaue, labberige T-Shirt, hat sie einen abgewetzten Gürtel gebunden. Die roten High Heels passen allerdings so gar nicht zu dem übrigen Outfit und mein Blick bleibt an ihnen haften. »Setzt euch, macht es euch bequem und dann legen wir auch gleich los.« Sie hat einen übertrieben freundlichen Singsang in der Stimme, der es mir unmöglich macht, sie ernst zu nehmen.
Beata zieht an meinem Arm. »Komm zu mir.« Ich löse mich vom Anblick der Schuhe und setze mich auf den freien Stuhl neben Beata.
»Hey, das ist mein Platz.« Vor mir steht eine schwangere Frau. Sie zerrt an meinem T-Shirt und schaut mich wütend an.
»Larissa, hör bitte auf. Such dir einen anderen Platz. Der Stuhl gehört nicht dir, nur weil du das letzte Mal darauf gesessen hast.« Wieder zwinge ich mich, gute Miene zu dem Ganzen zu machen, unterdrücke einen Kommentar und lächle. Tatjana, die Therapeutin, steht auf und geht zu dem Teenager, der weiterhin am Türrahmen lehnt.
---ENDE DER LESEPROBE---